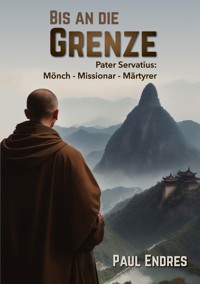
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bis an die Grenze: Die Lebensgeschichte des Pater Servatius Entdecken Sie die packende Lebensgeschichte von Pater Servatius (Otto Ludwig), dessen außergewöhnliches Leben ihn von einem kleinen saarländischen Dorf bis in die Unruhen Chinas führt. Von dieser Zeit, in der sich das 20. Jahrhundert inmitten von Industrialisierung, politischen Umwälzungen und zwei Weltkriegen entfaltet, erzählt dieses Buch aus der Perspektive der Familie Ludwig und ihres Umfelds. Im Mittelpunkt steht ein Mann, der, getrieben von seiner tiefen religiösen Überzeugung und dem Ruf der weiten Welt, sein Leben in den Dienst der Missionsbenediktiner stellt. Während der Geburt von Otto liest sein Vater in der Zeitung von den politischen Unruhen in China und fragt lapidar: "Was hat das mit uns zu tun?" Drei Jahrzehnte später erlebt Servatius im "Land seiner Sehnsucht" die historischen Umbrüche Chinas, nach der Abdankung des letzten Kaisers und der Gründung der Republik. Doch "Bis an die Grenze" ist mehr als nur die Biografie eines Mannes; es ist eine Erkundung der Grenzen zwischen Kulturen, Religionen, sozialen Schichten und den persönlichen Herausforderungen, die diese Grenzen mit sich bringen und ihn letztlich das Leben kosten. Auf der Grundlage von über zehn Jahren akribischer Forschung, untermauert durch private Briefe, Tagebücher, Klosterarchive und Gespräche mit den letzten Zeitzeugen, bietet dieses Buch nicht nur fundierte historische Einblicke, sondern vermag es auch, den Leser auf eine Reise mitzunehmen - bis an die Grenze.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Meiner Frau Maria zum Dank für den langen gemeinsamen Weg
Tue, 24 Jan 2023 07:42:14 +0100
"诺博" <[email protected]>
Lieber Herr Paul,
vielen Dank!
Diese Tage bin ich unterwegs. Die Fotos, die Sie mir gezeigt haben, ist wo Ihr heiliger Onkel missioniert hatte. Ich werde diesen Ort in wenigen Tagen wieder besuchen.
Ich wuensche Ihnen und Ihrer Familie alles Gute und Gottes Segen!
Viele liebe Gruesse aus kaltem Land,
Ihr
P. Norbert
[Fotos Seite → und →]
Pater Norbert Du
Diese Mail setzt einen Schlusspunkt unter eine Geschichte, die gut 100 Jahre zuvor begann. Es geht um die Lebensreise eines jungen Mannes aus Bous, der nach China aufbricht. Dabei überwindet er viele Grenzen geografischer, kultureller und vor allem persönlicher Natur.
Im Jahr 2007 besucht Pater Norbert aus China die Heimatgemeinde von Pater Servatius in Bous. Hier schließt sich der Kreis dieser spannenden und berührenden Lebensgeschichte.
"Der Herr verschafft Deinen Grenzen Frieden"
(Ps 147,14)
INHALT
Prolog
1. Teil
Die Heimat
Familie, Kindheit und Jugend in Bous. Der erste Weltkrieg und die Folgen. Lena im Kloster. Schulzeit bis zum Abitur in Saarlouis.
2. Teil
Im Kloster
Noviziat, Studium in St. Ottilien und in München, die zeitlichen und die ewigen Gelübde, Weihen zum Subdiakon, zum Diakon und zum Priester. Primiz in seiner Heimatpfarrei in Bous, seelsorgliche Aushilfen in Bayern. Die Anfänge von St. Ottilien. Wirtschaftliche Nöte der Abtei. Missionsbenediktiner in Korea? Vorbereitung auf sein künftiges Wirken. Aloys in München. Blick auf die Mandschurei: Ein Märtyrer. Pu Yi, der letzte Kaiser. Abschied von der Heimat.
3. Teil
Abschied und Aufbruch
Reise von der alten Heimat in eine völlig neue Welt, die verschiedenen Etappen an Bord des Frachtschiffs Coblenz: Mittelmeer, Suez-Kanal, Rotes Meer, Colombo, Manila, Hongkong, Shanghai, Ankunft in Dairen
4. Teil
Mandschurei - die neue Heimat
Ankunft in Yenki, Land und Leute, Sitten und Bräuche, Lebensgewohnheiten, Chinesisch und Koreanisch lernen, die praktische Arbeit auf verschiedenen Missionsstationen erfahren, die politische Situation im Marionettenreich.
5. Teil
Sinchan
Die Gründung der nördlichsten und kältesten Missionsstation. Seelsorge in einer zweisprachigen Pfarrei, die wegen der ständigen Wanderbewegungen keine feste Gemeinde ist. Wie gewinnt man neue Christen? Auswirkungen des chinesisch-japanischen Krieges. Problem Schulen. Lokale Bräuche und christliche Feste. Urlaubsreise nach Korea. Herr Wu bringt neue Nachrichten. Schikanen gegen die Mission immer subtiler. Allgemeine Verknappungen.
6. Teil
Der Untergang der Mission
Kapitulation Japans. Besetzung der Mandschurei durch russische, anschließend durch chinesische kommunistische Truppen. Ermordung von Pater Servatius. Ende aller missionarischen Tätigkeiten in der Mandschurei. Missionare im „Umerziehungslager“ in Namping.
Epilog
Der Hund findet die Leiche. Besuche am Grab. Ausländische Presse berichtet. Die Grabstätte jetzt. Die Heimatgemeinde Bous feiert den 100. Geburtstag von Pater Servatius. Besuch aus China.
Anmerkung:
Die kursiven Textpassagen sind wörtliche Zitate aus den über 300 Briefen von Pater Servatius.
PROLOG
"Mutter, er hat sich wirklich nicht ein einziges Mal mehr umgeschaut."
Clothilde steht an diesem Augustmorgen des Jahres 1934 im Nachbarhaus hinter der Gardine des Küchenfensters und sieht wehmütig dem jungen Mönch nach, der mit entschlossenen, kraftvollen Schritten, den großen Koffer in der Hand, neben seinem Vater die Straße hinunter zum Bahnhof geht.
Gestern hat sie ihren Cousin noch gefragt, ob er nicht Angst habe, Heimweh zu bekommen, wenn er doch jetzt so weit von daheim fort ist und wer weiß, wie lange nicht mehr zurückkommen wird.
"Falls überhaupt", hat er in seiner ruhigen, wortkargen Art hinzugefügt. "Jesus hat uns doch gelehrt: Wer die Hand an den Pflug legt und nochmals zurückschaut, ist meiner nicht wert. Wir müssen nach vorne schauen, in die Zukunft." Und für den jungen Pater Servatius beginnt sie jetzt.
An diesem Morgen ist er noch einmal durch sein Elternhaus gegangen, hat alle Räume in sich aufgesogen und das "Alles irdisch, alles vergänglich", war mehr für sich selbst als für die Umstehenden gemurmelt. Denn sonst sagte niemand ein Wort.
Mit dem Kloß, der jedem im Hals würgte, brachte niemand einen Ton hervor. Zudem war ja auch alles gesagt, was zu sagen war.
Die Mutter durchlitt die Schmerzen, dass ihr ein Kind entrissen wird. Wortlos drückte sie ihren Sohn noch einmal an sich und hielt ihn fest, als wolle sie ihn nicht mehr loslassen. Tränen standen auch in den Augen der Anderen, obwohl sie sich nach Kräften bemühten, ihre Trauer nicht zu zeigen. Sie wollten ihrem Bruder den Abschied nicht unnötig schwer machen. "Wie bei meiner Primiz", dachte Servatius, "da waren wir auch alle zusammen."
Barbara, genannt Bäbchen, und Anna, die beiden Lehrerinnen, Magdalena, die selber gern in die Mission gegangen wäre,
Die Familie
Anton, der als Leutnant am Ersten Weltkrieg teilgenommen und von der Ostfront eine unheilbare Lungenerkrankung mitgebracht hatte, Willy mit seiner Frau Anna. Sie hatten geheiratet, als Otto ins Kloster eintrat. Ein Wechselbad, ein Widerstreit der Gefühle, das war es, was ihnen an diesem Morgen gemeinsam war: ein gewisser Stolz, dass der Bruder sein hochgestecktes Ziel erreicht hat. Gleichzeitig war jedem von ihnen das Herz schwer, weil sie ihn nun für immer verlieren.
Einer fehlte jedoch an diesem Morgen im Elternhaus: der jüngste Bruder Aloys, der in München Theologie studiert und nicht verhehlt, was er von der neuen politischen Obrigkeit hält. Von ihm wird er sich morgen im Gestapo-Gefängnis verabschieden dürfen.
Servatius selber hat seine Gefühle streng unter Kontrolle. Nichts verrät, wie es in seinem Inneren aussieht. Auch er ist sich bewusst, dass es ein Abschied für immer ist. Bisher hat er nie an seiner Berufung gezweifelt. Aber muss der Abschied so schmerzhaft für seine Familie werden? Wortlos verlässt er das Haus. Er ahnt wohl, dass die ganze Familie ihm bis vor die Haustür gefolgt war und ihm stumm nachschaut. Aber er dreht sich nicht mehr um.
Peter Ludwig bemüht sich nach Kräften, mit seinem Sohn Schritt zu halten. Er vermeidet es dabei, zur Seite zu schauen. Niemand soll ihm die Abschiedsstimmung anmerken, die ihm doch nur allzu deutlich ins Gesicht geschrieben steht. So muss sich Abraham gefühlt haben, als er seinen Sohn opfern sollte. Er ist sich sicher, er wird seinen zweitjüngsten Sohn nie mehr wieder sehen.
"Warum muss der denn auch so weit weggehen? Bis an die Grenzen der Erde! Und was wird ihn dort in der Mandschurei, im Nordosten Chinas erwarten? Was wird seine Zukunft, seine Existenz sein? Jedenfalls kein angenehmes, leichtes Leben. Im Gegenteil: Mühe, Not, Entbehrungen, Kälte, Einsamkeit, Gefahren. Ein Leben sehr weit weg von daheim, fern von allem Liebgewordenen, Gewohnten, ein Leben in einer völlig fremden Kultur mit einer so völlig anderen Sprache. Dieses Los nimmt er auf sich, um seiner Berufung zu folgen. Hätte man es ihm ausreden sollen? Hätte man es überhaupt gekonnt? Wahrscheinlich nicht. Der Ruf, dem er folgt, ist stärker.
Siebenundzwanzig Jahre ist er erst alt. Genau so alt war ich damals, als ich Ende Mai 1886 nach Bous kam, um mir hier meine Zukunft, meine Existenz aufzubauen." Und die Bilder der Vergangenheit steigen in ihm auf. Er sieht sie, als sei es erst gestern gewesen. Damals .…
1. TEIL
Die Heimat
Familie, Kindheit und Jugend in Bous.
Der erste Weltkrieg und die Folgen.
Lena im Kloster. Schulzeit bis zum Abitur in Saarlouis.
Das metallische Quietschen von Eisenbahnbremsen ist wohl nicht gerade Musik in seinen Ohren, trotzdem ein sehr vertrautes Geräusch. Mit einem Ruck hält der Zug.
"Bous. Hier Bous", ertönt die Stimme des Fahrdienstleiters. Peter Ludwig drückt die Abteiltür auf und springt auf den Bahnsteig. Er schaut sich um. Sein Blick fällt auf die Großbaustelle direkt neben dem Bahnkörper. Hier also entsteht das neue Röhrenwerk von Mannesmann. Davon hat er schon viel gehört.
Versonnen blickt er dem abdampfenden Zug nach. Weit hinten erkennt er das Stellwerk. Das ist also ab morgen sein neuer Wirkungsbereich als Weichensteller.
Vor fünf Jahren ist er schon einmal hier durchgefahren, zum Militärdienst in der Garnison in Metz einberufen, als Muss-Preuße. Lieber wäre er allerdings zu den Bayern gegangen, denn bei denen ging es gemütlicher zu. Eigentlich fühlt er sich keiner der beiden Seiten zugehörig. Seine Heimat ist das Birkenfelder Ländchen, die Enklave an der Nahe, die zum Fürstentum Oldenburg gehört.
Das Gastspiel in der Kaserne war erfreulicherweise nur von kurzer Dauer. Nach gerade mal einem Jahr Dienstzeit verletzte er sich eine Hand und wurde als "Militär-Invalide" entlassen.
"Geh doch zur Bahn", riet ihm ein Nachbar daheim in Eiweiler. "Da werden immer noch gute Leute gesucht. Den elterlichen Betrieb kannst du als Nachgeborener ohnehin nicht übernehmen. Und irgendwo einheiraten? Sieh dich doch mal um!"
Einen Beruf außerhalb der Landwirtschaft suchen? Nun ja, es bleibt schließlich keine andere Wahl. Und wenn die Eisenbahn für die fertigen wie auch für die neuen Strecken Arbeitskräfte braucht, warum also nicht mal dort das Glück versuchen. Die Bezahlung ist nicht gerade üppig, aber es ist ein sicheres Auskommen.
Also schrieb er an einem ruhigen Sonntagmittag vor Weihnachten 1883 ein erstes Gesuch an die Eisenbahn-Direktion in Saarbrücken und erhielt noch vor Jahresende die mit Spannung erwartete Antwort: einen Fragebogen. Obwohl er ihn sofort ausfüllte und zurückschickte, wurde seine Geduld auf eine harte Probe gestellt, denn in Saarbrücken ließ man sich viel Zeit. "Heute ist auch nichts dabei", sagte ihm der Briefträger schon von weitem, wenn er ihm begegnete.
So ging das ein halbes Jahr lang. Dann setzte Peter einen Brief auf und erinnerte an sein Gesuch. Diesmal bekam er sofort eine Antwort, die ihm nur ein verständnisloses Kopfschütteln abnötigen konnte:
"Bevor wir Ihrem Gesuch vom 10. d. Mts. um Anstellung im diesseitigen Verwaltungsbezirke näher treten…" Ob die auch so reden wie sie schreiben? Das Königliche Eisenbahn-Betriebsamt schickte ihn zunächst zum Bahnarzt und forderte ihn auf, "uns demnächst den mit 1 bezeichneten Fragebogen wieder einzusenden, da wir die bei Ihrer ersten Bewerbung in Rücksicht auf die inzwischen verflossene Zeit als gültig nicht mehr anzuerkennen vermögen."
Nun gut, am ersten September 1884 durfte er dann doch seinen Dienst "als Beamter in der Stelle eines Bahnwärter-Diätars für 55 Mark im Monat in St. Wendel" antreten.
Im Frühjahr eröffnete man ihm dann: "Wir sind mit Ihrer Leistung zufrieden und können die Probezeit beenden". In dem amtlichen Schreiben war zu lesen: "Sie werden zum 1. April 1885 zur Station Völklingen versetzt und zum etatsmäßigen Weichensteller ernannt mit einem Jahresgehalt von 810 Mark und ist die Königliche Eisenbahn-Betriebs-Kasse hierselbst (Saarbrücken) zur Zahlung dieser Competenzen in vierteljährlichen Raten im Voraus mit Anweisung versehen."
Die Arbeit in Völklingen gefiel ihm schon, was ihm aber fehlte, war die Natur. Er konnte einfach nicht in der Stadt leben. Deshalb reichte er schon nach zwei Monaten ein Gesuch um Versetzung nach Bous ein.
Trotz seiner ländlichen, landwirtschaftlichen Struktur war Bous ein Eisenbahnknotenpunkt, der an Bedeutung zunahm. So wurde sein Antrag bewilligt und er zum 1. Juni 1886 nach Bous versetzt.
Da ist er nun angekommen. Ein Quartier hat er auch schon gefunden. In "Stuffels Haus" hat er ein Zimmer gemietet.
„Ja, wir sind froh für jeden Mieter, den wir bekommen“, gestand die Vermieterin. „Vor sechs Jahren ist unser Haus abgebrannt und der Wiederaufbau war sehr teuer. Wir haben das Dach jetzt auch mit Ziegeln gedeckt. Die brennen nicht so leicht wie das Stroh. Ja, und essen können Sie gerade gegenüber im Gasthaus Meyer.“
Mit der gleichen Herzlichkeit, mit der ihn vorgestern noch seine Kollegen in Völklingen verabschiedeten, begrüßen ihn nun seine neuen Kameraden auf dem Stellwerk in Bous. Einer nach dem andern schüttelt ihm kräftig die Hand. "Willkommen bei uns." Ein fester Druck schwieliger Hände, die gewöhnt sind, zuzupacken. Er war in den Kreis zuverlässiger Kameraden aufgenommen, dessen ist er sich sicher. "Wir können eine Verstärkung unserer Truppe hier gut gebrauchen." Jakob heißt er und ist vermutlich der Leiter des Stellwerks.
Nicht wenig stolz schildert er dem Neuen die wachsende Bedeutung des Eisenbahn-Knotenpunktes. "Bous war vor dreißig Jahren noch ein völlig unbedeutendes Bauerndorf mit nicht einmal tausend Einwohnern. Jetzt sind es schon über zweitausend. Und wenn das Röhrenwerk von Mannesmann da drüben" – er machte eine Handbewegung zu der Großbaustelle neben dem Bahngleis – "erst einmal in Betrieb ist, wird sich auch der Charakter des Dorfes wandeln. Im Frühjahr bekommt das Werk auch einen eigenen Gleisanschluss. 1859 fuhr hier der erste Zug durch, von Saarbrücken bis Merzig, jetzt geht es schon bis Trier und weiter.
Röhrenwerk (1914)
Damit haben wir Anschluss an das deutsche Schienennetz. Und auf der anderen Saarseite fahren seit 1880 die Züge von hier aus über Wadgassen und Teterchen bis nach Metz.“
"Ja, diese Strecke habe ich schon erlebt", denkt Peter, "damals als Wehrpflichtiger auf dem Weg in die Garnison Metz."
Er schaut sich aufmerksam um. Das Sonnenlicht bahnt sich einen Weg auf die langen Hebel, mit denen von hier drinnen aus die Weichen verstellt werden. Früher mussten draußen die vielen Weichen von Hand bedient werden. Bei jedem Wetter. Diese neue Technik ist ihm von Völklingen her vertraut. Auch die übrigen Arbeitsabläufe im Stellwerk kennt er gründlich. Er braucht nicht umzulernen. Die Fahrpläne kann er sich leicht einprägen, zudem hängen sie ja vor ihm an der Wand.
In einer abgeschlossenen Schublade liegt auch der versiegelte Umschlag, der in keinem Stellwerk fehlt. Er ist zu öffnen, wenn eine allgemeine Mobilmachung ausgerufen wird und enthält ganz klare Anweisungen. Die bestehenden Fahrpläne werden in diesem Augenblick außer Kraft gesetzt und neue treten an ihre Stelle. "Hoffentlich brauche ich den nie zu öffnen", geht es Peter durch den Sinn.
Seine Hemden kauft Peter bei Meyers Lenchen. Sie wohnt in der Gräth gegenüber von "Stuffels" und betreibt mit ihrem Mann, einem Schneider, ein Konfektionsgeschäft. Ihr gefallen das "feine" Benehmen und das Hochdeutsch des neuen Nachbarn.
Von ihr erfährt er auch etwas mehr über die Landwirtschaft zwei Häuser oberhalb. Von den drei Söhnen dort waren zwei im Kindesalter gestorben und der dritte, Anton, ist erst 13 Jahre alt. Also müssen auch die Mädchen beim Füttern oder Anspannen helfen. Genovefa ist 24 Jahre alt, Angela 21 und Barbara 18. Angela, allgemein Engel genannt, kann mit den Pferden umgehen. Die Art, wie sie mit den Tieren spricht, freundlich aber bestimmt, das war ihm aufgefallen und weckte seine Neugier.
Auch Engel scheint den neuen Mieter in der Nachbarschaft bemerkt zu haben. "Er arbeitet bei der Bahn", vertraut Frau Meyer ihr an, bei der sich ja auch schon Peter nach Engel erkundigt hatte.
Es dauert auch nicht lange, bis ihm der Zufall zu Hilfe kommt. Peter kontrolliert gerade eine schwergängige Weiche neben dem Bahnübergang, als Engel mit ihres Vaters Füchsen auf dem Weg in die Saarwiesen hier die Eisenbahngleise überquert. Es ist ihm schon aufgefallen, dass nur immer sie und nie eine ihrer Schwestern diesen Weg nimmt. Ob das auch nur Zufall ist?
Peter fasst sich ein Herz: "Prächtige Pferde. Es muss doch auch Freude machen, mit denen zu arbeiten."
"Was versteht denn ein Eisenbahner schon von Pferden?“, wirft sie ihm über die Schulter zu.
"Eine Menge, wenn er selber aus einer Bauernfamilie kommt und mit Leib und Seele Bauer ist." Sie horcht auf.
"Oh, wir könnten gelegentlich Hilfe gut gebrauchen." Damit ist das Eis gebrochen. Und Engel ist klug genug, seine Zuneigung zu erkennen.
Auch Engels Vater ist der Helfer willkommen. In den wenigen freien Stunden hilft "der Ludwig", wie ihn alle nennen, nun bei "Haases" aus, wo es immer genug Bauernarbeit gibt. Haases, das ist der Hausname, denn eigentlich heißen sie Fery.
"Die Engel muss mal meine Frau werden", sagte er zu seinen Kollegen, als er ihr und ihren Pferden wieder mal die Schranken öffnete.
Es dauert auch nicht mehr lange, bis Peter seinen Mut zusammennimmt und "beim Haases Vater" sein Anliegen vorträgt. „Ich würde gern die Engel heiraten“, bringt er leicht verlegen hervor.
Die Hochzeit der Eltern
„Damit habe ich schon gerechnet“, ist die knappe Antwort. „Peter, ich habe dich als einen ehrbaren, fleißigen Mann kennen gelernt. Ich weiß, dass du mit deiner staatlichen Anstellung als Weichensteller und einem festen Gehalt eine Familie ernähren kannst. Du verstehst, dass mir die Zukunft meiner Tochter wichtig ist. Also, meinen Segen habt ihr.“
Der Haases Vater wusste, dass Peters Gehalt viermal im Jahr in Goldstücken zu 20 oder 10 Mark ausgezahlt wurde. Das war schon eine solide Grundlage. Zudem konnte er eigenen Grund und Boden in seinem neuen Heimatort vorzeigen, nämlich ein Grundstück von 16 Ar, das er vier Wochen zuvor für 309 Mark ersteigert hatte. Das war der erste von weiterem Landerwerb. Er ließ erkennen, dass Peter Ludwig mit seiner Frau, der Bauerntochter, auch eine Landwirtschaft betreiben wollte.
Vor die Hochzeit haben die Behörden noch einige Schranken gesetzt. So muss Peter als Beamter bei seiner vorgesetzten Behörde, dem Königlichen Eisenbahn-Betriebs-Amt in Saarbrücken zuerst einmal die Erlaubnis zum Heiraten einholen. („Ich will doch nicht die Tochter vom Betriebsamt heiraten!“) So wollte es jedenfalls das Reglement. Wie nicht anders zu erwarten, wird die Zustimmung erteilt.
"So, heiraten wollt ihr?", begrüßt sie der Pfarrer an der Tür. „Dann kommt mal rein.“ Er kennt die beiden ja gut, schließlich sieht er sie jeden Sonntag und sehr oft auch an Werktagen in der Messe. An ihrer Gläubigkeit braucht er nicht zu zweifeln.
Die häusliche Feier der Hochzeit wird im alten Haases Haus mit der gesamten Verwandtschaft und den Nachbarn begangen. Dann, am übernächsten Tag, bricht das junge Paar zur Hochzeitsreise auf. Einem Eisenbahner stehen im Jahr mehrere Freifahrtscheine zu. Da darf das Reiseziel ja auch etwas Besonderes sein. Das ist es auch, nämlich Trier. Immerhin siebzig Kilometer weit. Wann kommt man wieder dahin.
Als junge Hausfrau nimmt Engel am Montag in aller Herrgottsfrühe den Korb mit der Wäsche, die sie abends zuvor gekocht hatte, um sie – wie es üblich war – am Brunnen auszuwaschen und zu "plaueln". Diese Arbeit ist ihr seit Jahren vertraut, aber jetzt geht sie zum ersten Mal für den neuen, den eigenen Hausstand, waschen.
Beschwingt, ein Liedchen summend, schreitet sie durch das schmale "Gässelchen" neben ihrer neuen Wohnung, das zwischen Gärten hindurch leicht ansteigt. Bald ist die Stockgartenstraße erreicht. Hier hätte sie den halben Weg zur Kirche und bis zu ihrem Elternhaus ist es nach links auch nicht sehr viel weiter. Aber jetzt biegt sie nach rechts ab. Nur noch ein paar Meter bis zum Waschtrog am Petersbrunnen. Der gesamte Weg reicht nicht für mehr als eine Liedstrophe.
"Na, junge Frau, schon so früh unterwegs?“, begrüßen sie die Frauen, die sie sonst auch montags hier am Brunnen antrifft. "Wie war die Hochzeitsreise? Erzähl schon." Engel lässt sich natürlich nicht lange bitten. Gebannt lauschen die andern, was Engel da alles von Trier zu erzählen weiß. Vorsorglich hatte sie ja schon ein paar Ansichtskarten in die Schürzentasche gesteckt. "Ach ja, durch so eine große Stadt spazieren, die schönen Geschäfte anschauen. Das möchte ich auch einmal erleben", seufzt eine der Nachbarinnen. Aber so weit war noch keine aus dem Dorf hinaus gekommen, man denke 70 Kilometer. "Tja, einen Eisenbahner müsste man haben", wünscht sich eine andere, "dann bekäme man auch etwas von der großen weiten Welt zu sehen."
Auf den abgeernteten Feldern verbrennen sie das Kartoffelkraut und in diesen Feuerchen braten die Kinder einzelne aufgelesene Kartoffeln. So aus der verkohlten Schale gegessen, ist das eine Delikatesse besonderer Art.
Als nun der letzte Sack Kartoffeln abgeladen ist, wischt sich der Haases Vater mit einem blau karierten Handtuch den Schweiß von der Stirn. Das ist für dieses Jahr wieder geschafft. Die Ernte ist unter Dach. Jetzt kann der Winter kommen. Aber etwas anderes beschäftigt seine Gedanken noch.
"Sag mal, Peter", wendet er sich an seinen Schwiegersohn, dem ebenfalls die Schweißperlen von der Arbeit auf der Stirn stehen, "eure Mietwohnung ist doch kein Dauerzustand."
Er hatte lange darüber nachgedacht und nun stand für ihn fest, wie er den jungen Leuten helfen konnte. Er wusste ja, dass sie sich ein eigenes Haus mit Hof und Garten für ihre Familienplanung und mit Stall und Scheune für eine eigene Landwirtschaft wünschten. Dazu hatte er auch einen passenden Vorschlag. Vom eigenen Garten in der Gräth wurde ein Grundstück als Bauland für das neue Haus abgetrennt. Im folgenden Sommer 1890 konnte es schon bezogen werden. Es dürfte das erste zweistöckige Privathaus in Bous gewesen sein.
Das Elternhaus
Jahresmitte. Die Natur hält für einen Augenblick den Atem an. Das Heu ist unter Dach, das Getreide reift noch auf dem Halm und erst später werden dann die Kartoffeln und die Rüben geerntet. Atempause auch für Peter Ludwig an diesem Samstag, dem 15. Juni des Jahres 1907. Er sitzt in der warmen Nachmittagssonne auf der Holzbank vor seinem Haus und legt die schwieligen Hände in den Schoß.
Eine angenehme, wohlige Müdigkeit bemächtigt sich seiner. Die Arbeit für diese Woche ist vollbracht – und drinnen brauchen sie ihn jetzt auch nicht. Vor einer guten Stunde ist die Hebamme ins Haus gegangen.
"Die kennt sich ja mittlerweile hier aus", schmunzelt er in seiner schelmischen Art.
Wieder einmal wandern seine Gedanken in die Vergangenheit. Vor siebzehn Jahren hat er das Haus erbaut und nach und nach hat es sich mit Leben gefüllt. Als sie einzogen, war Barbara eineinhalb Jahre alt und konnte schon fast allein die Treppe zur Haustür hinaufsteigen.
Inzwischen ist Barbara, allgemein nur Bäbchen genannt, schon achtzehn und bereitet sich im Lehrerinnenseminar auf ihren künftigen Beruf vor. Und dort ist sie mit ihrer um vier Jahre jüngeren Schwester Anna zusammen, die ihr mit dem gleichen Berufswunsch gefolgt ist.
Die siebzehnjährige Magdalena, auch Lena oder Lenchen gerufen, geht im Haushalt und auf dem Feld der Mutter tatkräftig zur Hand. Sie kann zupacken, und sie sieht, wo es fehlt.
"Wie ihre Mutter damals", denkt Peter.
Und nach den Mädchen sind dann noch die zwei Buben da. Anton ist zehn und geht in die vierte Klasse. Willy, mit sieben Jahren der bisher jüngste, ist seit einem Jahr in der Schule.
Vier Kinder kamen zur Welt und verließen sie sofort wieder. Erst im vergangenen Jahr trug Peter einen kleinen weißen Sarg zum Friedhof. Er holt tief Luft bei der Erinnerung, als wolle er damit die Wehmut verscheuchen.
Und das Kind, das nun in den nächsten Stunden geboren wird, ist das zehnte. Was aus ihm wohl werden wird? Die Kinder sind dir nur anvertraut, geliehen, nicht geschenkt.
Einundzwanzig Jahre ist Peter jetzt schon in Bous. Die Zeit ist wie im Flug vergangen. Und dennoch hat sich viel ereignet. Mit einem Koffer in der Hand ist er damals angekommen und jetzt sitzt er vor seinem eigenen Haus. Neben seiner Arbeit als Weichensteller betreibt er Landwirtschaft, hält Kühe und Ziegen. Die Bienen nicht zu vergessen.
Das Dorf hat sich gewandelt, wie es damals sein Kamerad Jakob an seinem ersten Arbeitstag vorhergesagt hat. Es ist größer geworden.
Vor allem aber gibt es einige neue Erfindungen. Der Morseschreiber im Stellwerk ist inzwischen vom Telefon abgelöst. Man kann auch schon in die Dörfer der Umgebung anrufen. Über Entfernungen mit Menschen reden, die man nicht sieht. Unvorstellbar. Auch eine Wasserleitung gibt es seit 1898 in Bous, an die seit 1900 auch sein Haus angeschlossen ist. Die Frauen brauchen nicht mehr mit der Wäsche zum Brunnen zu gehen, und immer ist frisches Wasser im Haus.
Noch etwas ganz Wichtiges: Seit 1893 gibt es im gesamten Reich eine einheitliche Uhrzeit. Von hier bis Berlin. Bisher hatte ja jedes Fürstentum, und sei es noch so klein, seine eigene Uhrzeit gehabt. Eine große Erleichterung für die Fahrpläne der Eisenbahn.
Die Gedanken schweifen wieder in die Vergangenheit. Seine erste Begegnung mit Bous, damals. Aber nur auf der Durchreise. Da musste er als junger Wehrpflichtiger in die Garnison in Metz einrücken. Zum Glück blieb ihm der Ernstfall als Soldat erspart. Seit dem großen Krieg, der ja 1871 ganz hier in der Nähe, in Spichern, entschieden wurde, war Friede im Land. Warum kann es so nicht bleiben?
Eine Erregung bemächtigt sich seiner bei dem Gedanken, dass vor ein paar Jahren der Friede in Gefahr geriet. Irgendwo am andern Ende der Welt, im fernen China, gab es einen Aufruhr. Die Zeitungen berichteten von einem Boxeraufstand in der Mandschurei. Er erinnert sich noch an die Berichte, die er gelesen hatte. "Aufständische wollen ihr Land von den Fremden befreien. Die Kolonialmächte USA und alle europäischen Staaten einschließlich Deutschland sind dabei, das Reich der Mitte untereinander aufzuteilen. Ihre Waren verdrängen das einheimische Handwerk, ihre Eisenbahnen die traditionelle Infrastruktur. Der Mandschu-Kaiser in Peking ist machtlos dagegen."
Nun schickt auch noch unser Kaiser Soldaten dorthin! Der deutsche Gesandte von Ketteler wurde ermordet. Ja, das ist schlimm. Aber sollen dafür junge Männer im fernen Osten ihr Leben lassen? Dadurch wird er auch nicht wieder lebendig. Und was heißt das, "die deutsche Fahne ist beleidigt worden?“ In den Zeitungen wurde die Rede des Kaisers gar als "Hunnenrede" bezeichnet.
"Wer euch in die Hände fällt", rief Wilhelm II. den Soldaten seines Expeditionskorps bei der Verabschiedung in Bremerhaven zu, "sei euch verfallen. Pardon wird nicht gegeben, Gefangene nicht gemacht. Wie vor 1.000 Jahren die Hunnen unter König Etzel sich einen Namen gemacht, der sie noch jetzt in Überlieferung und Märchen gewaltig erscheinen lässt, so möge der Name Deutsche in China auf 1.000 Jahre durch euch in einer Weise bestätigt werden, dass niemals wieder ein Chinese es wagt, einen Deutschen auch nur scheel anzusehen!"
Hoffentlich kommt das nicht einmal als Bumerang auf uns zurück.
Wo zum Kuckuck ist diese Mandschurei überhaupt? Am andern Ende der Welt! Da kommt doch von hier niemals jemand hin. Und schließlich, was gehen uns die Menschen dort an? Was haben wir mit ihnen zu schaffen? Wir haben doch genug Arbeit, das eigene Land in Ordnung zu halten. Müssen die Deutschen denn wirklich überall ihre Nase im Spiel haben?
"Peter, komm rein. Es ist ein Junge." Er hatte gar nicht bemerkt, wie die Hebamme aus der Tür getreten war. Rot versinkt die Sonne hinter dem Wadgasser Wald. Er fröstelt leicht, als er von seiner Bank aufsteht und ins Haus geht.
Ein Junge, der dritte. Und drei Mädchen. Aber vier Kinder sind unmittelbar nach der Geburt gestorben.
Am Montag geht Peter dann zur Bürgermeisterei, um das Kind anzumelden. Als er vom Standesamt heimkommt, fragt Engel: "Hast Du ihn auch richtig aufschreiben lassen?" Als sie hört, "Otto", tut sie den denkwürdigen Ausspruch: "Nit genuch, dass ma d' Kinna muss selver krien, ma muss s' aach noch selver aanmellen gehn!" ("Es ist nicht genug, dass man die Kinder selber bekommen muss, man muss sie auch noch selber anmelden gehen!")
Otto hätte nämlich Aloys heißen sollen. Beide haben aber wohl vergessen, darüber zu reden, in der Annahme, der andere sei der gleichen Meinung.
Am Montag kommt auch im Lauf des Nachmittags der Hausarzt Dr. Schwabe, um routinemäßig nach dem Rechten zu sehen. Die Hebamme hatte ihm zwar keine Komplikationen gemeldet, aber er wollte sich doch selber überzeugen, dass Mutter und Kind wohlauf sind.
"Na, Frau Ludwig", grüßt er in seiner jovialen Art, "das ist also das Zehnte. Jetzt kaufen Sie sich nur noch zwei, dann haben Sie das Dutzend voll."
"Ganz recht, Herr Doktor, und Sie kaufen sich nur noch zehn, dann haben auch Sie das Dutzend voll."
Getauft wurde Otto am Sonntag, dem 23. Juni, auf den Namen Otto Aloysius. Rufname blieb aber Otto.
"Wo sind nur die Jahre hingerannt?" Engel schüttelt verständnislos den Kopf. Vor ihr steht der kleine Otto, die Tasche mit dem Pausenbrot fest in der Hand, in gespannter Erwartung, was der erste Schultag wohl bringen mag. Für ihn ist dieser Montag, 31. März 1913, ein denkwürdiges Datum.
Auch für Anna ist es der erste Schultag, allerdings als Lehrerin in Derlen. Bäbchen hat ihre "Wanderjahre" als Junglehrerin schon hinter sich gebracht und unterrichtet jetzt in Werbeln. Damit sind beide ganz in der Nähe der Heimat. Anton besucht das humanistische Gymnasium in Saarlouis.
Willy hat sich entgegen dem Rat seiner Lehrer dafür entschieden, in der Volksschule zu bleiben, um danach einen praktischen Beruf zu ergreifen. Seine Neigung gilt eher der Landwirtschaft, aber zusätzlich will er ein Handwerk lernen, vielleicht Dreher bei Mannesmann.
Lena, ihre Zweitälteste, ist an diesem Morgen schon früh aus dem Haus und aufs Feld gegangen. Auch sie hat auf Studium oder Berufsausbildung verzichtet, um der Mutter im Haushalt und in der Landwirtschaft zu helfen.
"So, Kamerad, auf geht's", fordert Willy seinen kleinen Bruder auf. "Du willst ja nicht am ersten Schultag schon zu spät kommen." Gemeinsam machen sie sich auf den Weg.
Engel hätte zu gerne ihr Schulkind selber zur Schule gebracht. Aber da waren ja noch zwei kleinere Kinder: Aloys (mit dem Namen hat es doch noch geklappt) ist fast drei Jahre alt und die kleine Maria Josefa gerade mal zwei Wochen.
"Tja, Herr Dr. Schwabe", kann Engel sich ein Schmunzeln nicht verkneifen, "ich habe das Dutzend voll. Und Sie?"
Magdalena, Aloys, Papa, Barbara, Otto, Maria, Anton, Mama, Anna, Willi
Die Schüsse von Sarajevo am 28. Juni 1914 schrecken auch die Menschen an der Saar auf, zumal sie ja, falls es zum Krieg mit Frankreich kommen sollte, der Front am nächsten sind.
Auch die Kinder spüren die allgemeine Aufregung und hören die neuen Wörter Mobilmachung, Einberufung, Front oder Spion, ohne sie recht zu begreifen. Mit den anderen laufen Otto und sein vierjähriger Bruder Aloys an die Saarbrücke: Neben dem Brückenhäuschen steht ein Soldat Wache.
Ihr Vater sieht schon mehr vom Krieg, zunächst vom Aufmarsch: "Sämtliche Eisenbahnen sind als in der Nähe des Kriegsschauplatzes befindlich anzusehen", heißt es im Reichsgesetzblatt. Das bedeutet für den Weichensteller: vom 31. Juli an wird jeder Güterverkehr eingestellt, die Waggons, wo sie sind, werden entladen und für den Militärtransport bereitgestellt.
Ein "Eventualfahrplan" für diesen Aufmarsch liegt ja schon jahrelang in einem versiegelten Umschlag in jeder Dienststelle bereit und ist im Augenblick der Mobilmachung zu öffnen. (Peters Befürchtung.)
Nun ist es soweit. Peter liest jeden Tag die Saar-Zeitung und verfolgt die Kriegsberichte mit immer neuen Namen, Brüssel, Namur, Saint Quentin, Maas, Antwerpen, Ypern, Marne-Schlacht. Sein üblicher Kommentar zu den Siegesmeldungen: "Hoffentlich siegen wir uns nicht zu Tode!" obwohl er, wie alle andern auch, das Ausmaß des Geschehens an der Marne, vor allem bei Verdun, nicht erkennt.
Im Westen kommt es zum Stellungskrieg, und die anfängliche Zuversicht der Soldaten: "An Weihnachten sind wir wieder daheim!" geht in den Schützengräben unter.
Die Kriegsbegeisterung von 1914 ist verflogen. Aber der Krieg ist nach einem Jahr noch nicht beendet. Das Lied von den Wildgänsen, das Walter Flex ["Wanderer zwischen zwei Welten"] an der Front im Westen dichtete, wo ja angeblich nichts Neues
war, [Remarque: "Im Westen nichts Neues"] spiegelt die Grundstimmung dieser Zeit.
"Papa, wenn ich nun im März 18 Jahre alt werde, soll ich mich dann freiwillig zum Militär melden?"
Anton (links) in Goldap
Kloster Tutzing
"Zu so etwas meldet man sich nicht freiwillig. Warte die Einberufung ab, dann ist es immer noch früh genug."
Am 8. Dezember 1915 muss Antons Jahrgang 1897 zur Musterung und Anton wird "tauglich" geschrieben. Die Garnison, zu der er einberufen wird, ist Goldap in Ostpreußen, 150 km südöstlich von Königsberg oder 90 Stunden Bahnfahrt von daheim. Am 17. März 1916 meldet er sich auf einer Karte als Musketier des 2. Ers. Btl. 2. Komp. Inf. R. 44.
In dieser Zeit nimmt auch Lena Abschied von daheim. Von ihrem Vater begleitet, fährt sie nach Tutzing, um dort in den Orden der Missions-Benediktinerinnen einzutreten. In der klösterlichen Gemeinschaft glaubt sie sich am Ziel ihrer Sehnsucht. Lange schon hat sie diesen Wunsch gehegt. Lange hat sie mit sich gekämpft. Sie fühlt sich zum Ordensleben berufen. Als sie aber dann vor einem Jahr zaghaft ihre Absicht äußerte, ins Kloster zu gehen, stieß sie auf den erbitterten Widerstand ihrer beiden Schwestern, der Lehrerinnen. Sicher, die Mutter brauchte ihre Hilfe im Haushalt und auf dem Feld. „Aber wo bleibe ich, wenn die Eltern mal nicht mehr da sind?“ Diese Frage stellt sie sich immer wieder und findet keine andere Antwort darauf als: „Ich gehe ins Kloster. Dort könnte ich doch vielleicht als Krankenschwester ausgebildet werden. Dann hätte ich wenigstens einen Beruf und wäre versorgt."
Nun wagt sie einen zweiten Versuch. Ohne dass die Lehrerinnen etwas davon mitbekommen, bittet sie die Priorin in Tutzing um Aufnahme in die Gemeinschaft und erhält eine Zusage. Zum Eintritt ins Kloster gehören auch eine Ausstattung mit Wäsche und die Sicherstellung ihres Erbanteils. Die Wäsche sollte einfach sein, einige Stücke aber haben Spitzen. Kann sie die mitnehmen oder muss sie sie daheim lassen? Nach einigem Zögern packt sie auch diese Stücke mit ein.
Otto und Aloys wissen nicht, was vor sich geht, als Lena sie ganz früh am Morgen weckt. Schlaftrunken bekommen sie nur ein paar Fragmente mit. „Lena verabschiedet sich, weil sie für immer weggeht?“ Mit einem Mal sind sie hellwach und sausen die Treppe runter in die Küche. Hier erfahren sie nun mehr. Lena geht ins Kloster, sie wird Schwester. „So ähnlich wie die Schwester im Kindergarten.“ Das verstehen sie. Aber muss sie dafür weggehen?
Am Starnberger See
Dann schauen sie ihr von der Haustür aus nach, wie sie mit ihrem Vater die Straße hinunter Richtung Bahnhof geht. Mama weint, nicht nur beim Abschied. Sie klagt in der Folgezeit wiederholt um die Zweitälteste, die ihr überall fehlt.
Als Kandidatin fügt sich Lena mit großer Gewissenhaftigkeit in das klösterliche und geistliche Leben ein. Keine Arbeit ist ihr zu viel, auch das frühe Aufstehen fällt ihr nicht schwer. Immer ist sie gut gelaunt, fröhlich und freundlich. Und "Die Spitzen dürfen bleiben," schreibt sie in ihrem ersten Brief.
Vor ein paar Tagen war sie noch mit anderen Kandidatinnen hinunter zum Starnberger See spaziert, einfach die Bahnhofstraße und die Hallbergerallee hinunter, kurz die Hauptstraße entlang und dann noch nach rechts ein kleines Stück durch das Fischergassl zum See. Es hat gut getan, auf einer Bank zu sitzen, die ersten wärmenden Strahlen der Märzsonne zu genießen und auf den See hinaus zu schauen und den Gedanken und Träumen freien Lauf lassen. Ja, hier in der klösterlichen Gemeinschaft ist ihr Platz. Nach der Probezeit wird sie Postulantin sein, dann Novizin und dann in wenigen Jahren die Ordensgelübde ablegen. Gleichzeitig wird sie einen Beruf erlernen, möglichst Krankenschwester, und den dann auf einer afrikanischen Missionsstation ausüben.
Aber schon nach wenigen Wochen fällt der Novizenmeisterin auf, dass die neue Kandidatin gar nicht mehr so heiter ist wie am Anfang. Sie wirkt traurig, niedergeschlagen. Als Lena wieder einmal allein in der Kapelle sitzt, gesellt sich die Novizenmeisterin wie zufällig zu ihr und spricht sie an. „Magdalena, was ist los mit Ihnen? Sind Sie krank?“
Lena schüttelt nur stumm den Kopf.
„Haben Sie Kummer?“ Lena schaut zu ihr auf, versucht erst gar nicht, die Tränen zu verbergen und reicht ihr wortlos einen Brief von daheim. Bäbchen findet sich mit der Entscheidung ihrer Schwester nicht ab und weist sie auf ihre Pflichten gegen Eltern und Geschwister hin. "Du kannst Mama doch nicht mit dem großen Haushalt samt Stall und Feld allein lassen. Du hast schließlich eine Verantwortung gegenüber der Familie!" Dasselbe Argument, das sie schon vor einem Jahr an ihrer Berufung zweifeln ließ.
„Magdalena, Sie sind aus freien Stücken hierher gekommen. Sie sind völlig frei in Ihrer Entscheidung für ein Leben in der klösterlichen Gemeinschaft. Aber ich fürchte, Sie werden im Kloster nicht glücklich, wenn die Sorgen um Ihre Familie Sie bedrücken. Vielleicht ist es wirklich das Beste, wenn Sie wieder heimfahren. Wenn Sie eine Lösung gefunden haben, können Sie jederzeit wiederkommen. Unsere Tür steht Ihnen immer offen.“ Nur mit Mühe unterdrückt sie die Bemerkung, die ihr auf der Zunge liegt, nämlich dass die beiden Lehrerinnen ja auch die Familie verlassen haben und beruflich eigene Wege gehen.
Lena erlebt ganz bewusst die Stille der Karwoche und den Jubel der Osterfeiertage in Tutzing und nimmt dann in der ersten Aprilwoche schweren Herzens Abschied vom Klosterleben. Sie hat sich zu Gunsten der Familie entschieden.
"Ich glaube, dreißig Dienstjahre bei der Bahn in Bous sind genug." Damit beantragt Peter Anfang 1916 seine Versetzung in den wohlverdienten Ruhestand. Genauso herzlich, wie er seinerzeit auf dem Stellwerk begrüßt wurde, wird er jetzt verabschiedet.
"Langweilen wirst du dich ja sicher nicht", meint einer der Kollegen. "Wie ich dich kenne, wird der Eisenbahner jetzt wieder zum Bauern – wie in jungen Jahren. Wenn es deine Zeit als Pensionär erlaubt, dann schau doch mal wieder bei uns rein."
Dreißig Jahre, eine lange Zeit. In der Rückschau ist sie doch sehr schnell vergangen. Ab morgen wird es etwas ruhiger. Jetzt hat er mehr Zeit für seine kleine Landwirtschaft und für seine Bienen. Er fragt sich, wie er das alles neben seiner 12-Stunden-Schicht bewerkstelligt hat.
Aber zu den Exerzitien, für die ihn Pfarrer Anheier gewinnen will, ist er nicht so leicht zu bewegen, obwohl Engel ja auch schon daran teilgenommen hatte. "Erst will ich einmal sehen, welche Früchte die Exerzitien meiner Frau gebracht haben.“ Damit lässt er es bewenden. Aber er will doch wissen, worüber gepredigt wurde. "Dass die Frau die Priesterin des Hauses ist", fasst Engel zusammen, was sie gehört hat. Aber das scheint nun doch nicht seine Zustimmung zu finden. "Dann sollte sie aber auch öfter mal Stillmessen lesen und nicht nur Hochämter."
Otto, 12jährig
Vater (Peter) und Sohn (Willy)
Zu Beginn der Fastenzeit 1917 kommt Otto von einem längeren Urlaub bei seiner älteren Schwester Anna, Lehrerin in Oberkirchen, wieder nach Bous zurück, um am Vorbereitungsunterricht für die Erstkommunion teilzunehmen. Eigentlich ist sein Jahrgang ja erst im nächsten Jahr an der Reihe, aber der Pfarrer möchte ihn schon ein Jahr früher mitnehmen.
Der Weiße Sonntag 1917 fällt auf den 15. April. Die Feierlichkeiten verlaufen wie gewohnt, wenn man von der Kriegsnot absieht. Ein Viertelpfund Kaffee oder sonst eine "Friedensware" sind eine Kostbarkeit. Doch die äußeren Umstände, wie auch der etwas zu große schwarze Anzug, den Anton und Willy schon getragen hatten, stören Ottos Frömmigkeit und sein stilles Glück wenig.
"Otto sollte aufs Gymnasium", sagte seine ältere Schwester. Eigentlich wollte er noch gar nicht. Mehr lernen und weniger freie Zeit. Aber auch Anton redete ihm gut zu. Und dann ist er nach den Herbstferien wieder mit Anna nach Oberkirchen gefahren. Morgens ist er in ihrer Klasse und nachmittags, statt zu spielen, geht das Lernen weiter, vor allem Latein, denn er soll ja gleich die Aufnahmeprüfung für die Quinta machen. „Amo, amas, amat …“
Otto hat nun die Sexta übersprungen und gleich mit der Quinta angefangen. Am Ende seines ersten Schuljahres kommt die Lehrerkonferenz jedoch einhellig zu dem Ergebnis, dass es ihm sicher nicht an Intelligenz mangele, er aber doch einfach noch nicht die notwendige Reife besitze. Es sei ratsam und zu seinem eigenen Vorteil, wenn er die Klasse wiederhole. So kommt er dann zum zweiten Mal in die Quinta und kann von den Heften des Vorjahres profitieren, was ja schließlich auch ein Nutzen ist. In der neuen Klasse ist er ebenfalls einer der Jüngsten.
Durch die Blockade werden Güter aus dem Ausland immer rarer, vom Kaffee bis zur Seife oder Tabak. Stattdessen gibt es Ersatzprodukte aus minderwertigen Stoffen. Im April 1917 wird auch noch die Brotzuteilung herabgesetzt. Namentlich in den Städten steigt die Unzufriedenheit und Kriegsmüdigkeit. Die Schulkinder sammeln Bucheckern, Wildgemüse, Himbeer- und Brombeertee, Brennnesseln und Laub von den Waldbäumen für Pferdefutter. Dem knappen Hafer wird Rübenzucker beigemischt. "Die Polizei war heute schon wieder da und hat im Stall beim Melken aufgepasst, dass ich nur ja keine Milch beiseite schaffe", schimpfte Engel noch vor ein paar Tagen. "Ich weiß nicht, was die erwarten. Wir rackern uns auf dem Feld ab und einen Teil von dem, was wir ernten, dürfen wir sogar großzügig als Eigenbedarf behalten: ein Pfund Kartoffeln pro Tag und Person."
Was darüber hinaus geerntet wird, muss abgeliefert werden. Bei einem Teil der Bevölkerung, der "auf Karte" leben muss, gilt es als sicher, dass die "Selbstversorger" im Überfluss schwelgen. Und so wird Engel von Käufern und Bettlern überlaufen. Dazu kommt, dass der Neid manchen zu Einbruch oder Diebstahl verleitet, um für ausgleichende Gerechtigkeit zu sorgen. Auch Peters Haus ist davor nicht sicher. Wenn nichts zu holen ist, kann man ja immer noch bei der Polizei den Verdacht äußern, da sei irgendetwas versteckt ...
Ernte: links Frau Fetik, Mitte Engel, rechts Lena
Nun ja, Peter versteckte einen Sack Korn im Bienenhaus und wird prompt von Missgünstigen angezeigt.
"Tja, Herr Ludwig, wie kommen Sie dazu, den Sack Korn zu verstecken? Den müssen Sie aufs Amt bringen. Er ist beschlagnahmt." Der Polizist kann auch nicht anders handeln. Dienst ist Dienst.
"Dann zieh wenigstens einen besseren Anzug an", rät Engel. Aber darauf lässt Peter sich nicht ein. "Wenn ich ein Verbrecher bin, kann ich auch in Sträflingskleidern gehen." Er ist sich sicher: mit diesem Korn werden die Hühner einiger Ortsgrößen gefüttert.
Auch die Kartoffeln werden kontrolliert - und versteckt. In dem sehr kalten Winter 1916/17, dem "Kohlrübenwinter", erfrieren die versteckten Kartoffeln und es gibt monatelang jeden Abend nur die berüchtigte „Rappsupp“ aus "gerappten" [geriebenen] Kartoffeln, die trotz einiger Speck-Grieben widerlich süß schmeckt. Zum Glück fällt im Herbst 1917 die Ernte gut aus und Peter kann ein Schwein schlachten. Allerdings bekommt die Familie nur Wurst und Sülze davon. Das ganze eingesalzene Schwein wurde nachts aus der Bütte im Keller gestohlen. Die Polizei stellte amtlich fest, was man ohnehin schon wusste: Die Diebe kamen durch das schmale Kellerfenster und – wie später zu erfahren war – aus der weiteren Nachbarschaft. Aber es gibt keine Beweise.
Und wieder einmal stehen zwei Polizisten vor der Tür. Sie wollen die Leiter in der Scheune sehen. "Herr Ludwig, die Leiter ist nicht sicher genug. Sie müssen sie unten mit Eisenspitzen versehen." Peters Schimpfen hilft nichts. Auch seine Frage bleibt unbeantwortet, ob das Auge des Gesetzes sonst nichts zu tun habe.
Den Kopf auf die linke Hand gestützt starrt Peter auf die Schlagzeilen der Titelseite. Das Frühstücksgeschirr ist abgeräumt, Peter sitzt allein in der Küche, allein mit der Zeitung, wie jeden Morgen. Große schwarze Lettern verkünden den Waffenstillstand mit den Westmächten, gestern, Montag, 11. November 1918. Wortlos legt er die Zeitung aus der Hand und geht hinaus. Der Krieg ist verloren. Nicht dass er unbedingt an einen Sieg geglaubt hätte, aber: "Hoffentlich siegen wir uns nicht mal zu Tode."
Andere Gedanken gehen ihm durch den Kopf. Vor vier Wochen kam Anton von der Ostfront auf Heimaturlaub "zur Wiederherstellung der Gesundheit" wegen einer Grippe, die nicht ausheilen wollte. Nach 70 Stunden Bahnfahrt von Ostpreußen kam er krank in Bous an. Hohes Fieber, Lungen- und Rippenfellentzündung. Der Arzt ließ keinen Zweifel am Ernst der Erkrankung und setzte seine Hoffnung auf ein Medikament, das ebenso zum Tod wie zur Genesung führen konnte. Dazu brauchte er die Zustimmung der Familie.
Am 27. Oktober empfing Anton die Sterbesakramente. Ebenso seine fünf Jahre alte Schwester Maria. Sie lag seit Tagen an einer schweren Grippe lebensgefährlich erkrankt zu Bett.
Ihre Gesundheit wurde nie wieder ganz hergestellt. Im Frühjahr 1921 stellte ein Kinderarzt in Saarbrücken einen Lungenspitzenkatarrh fest. Der Hausarzt erkannte und behandelte die Krankheit als Bauchfellentzündung.
Lena vermerkte in ihrem Tagebuch am Karfreitag: „Oh, was hat heute unser Kind schrecklich leiden müssen. Um 2 Uhr wurde sie so schlecht, dass wir ihr die letzte Ölung geben ließen. Jetzt gegen Abend ist sie wieder etwas besser geworden. Oh, mein Heiland, der du heute so Furchtbares gelitten hast, erbarme dich dieses armen Kindes und auch unser. Oh, lass uns doch mit dir fröhliche Ostern feiern. Mache sie uns wieder gesund, wenn du willst. [25.3.21]
Am Mittwoch in der Osterwoche brachte Kaplan Schmitz Maria ihre Erste hl. Kommunion. „Oh, wie wunderschön war's heute morgen. Mein Schwesterchen empfing ihre erste hl. Kommunion. Wie eine kleine Braut lag sie da. Im weißen Kleidchen, mit Rosen im Haar, zur Seite die geschmückte Kommunionkerze, das Zimmer voll lebender Blumen, die ersten, Frühlingskinder, sie selbst so voller kindlicher Unschuld. Alle Anwesenden waren zu Tränen gerührt." [30.3.1921]
Dienstag nach Weißen Sonntag: "Mein Schwesterchen ist tot. Oh, ich kann es fast nicht fassen, dass dieses gute Kind gestorben ist. Oh mein Gott, tröste uns alle. Heute Nacht gegen 2 Uhr wurde sie auf einmal wie verzückt. Ihr schmerzvoll verzogenes Gesichtchen wurde wie verklärt. Ihr Mund verzog sich zu einem himmlisch schönen Lächeln, die Hände lagen über der Brust gekreuzt, die Augen wurden weit und groß, als ob sie nicht alles fassen könnte, was da zu sehen sei. Sicher kam der Ib. Heiland, den sie immer so gern gehabt hat, und ihre Namenspatrone Maria und Josef sie abholen aus diesem Tränental in ein besseres Jenseits. Als heute Morgen die Betglocke läutete, verschied sie." [5.4.1921]
Für Otto, wie auch für seinen Bruder Aloys, ist es der erste Tod, den er unmittelbar erlebt. Tage lang sucht er, den Gedanken daran zu verdrängen, aber er kommt immer wieder und wird nach und nach zu einer Tatsache, mit der er leben muss. Den langen Leidensweg der kleinen Schwester sehen und nicht helfen können. Wahrscheinlich ist diese seelische Belastung der Grund dafür, dass Otto das Klassenziel nicht erreicht und 1921 die Untertertia wiederholen muss.
Auch in der neuen Klasse ist er der große Schweiger. Er antwortet nur, wenn er direkt gefragt wird. Sich zu Wort melden, ist nicht seine Sache. Ein Deutschlehrer, der „Knips“, schätzt diese ruhige Art. Wenn er eine Frage stellt, die niemand beantworten kann, pflegt er zu sagen: „Dann wollen wir einmal unseren Otto Ludwig fragen!“ Und der weiß die Antwort, hat allerdings, wie üblich, nicht aufgezeigt.
Klassenbild mit Dr. Andreas Mailänder, Otto 1. von links in der 1. Reihe
Ein anderer Lehrer hält diese Zurückhaltung für Nichtwissen und reagiert auf Ottos wortkarge Art, indem er ihn aufruft und dabei seinen Namen in die Länge zieht: "Ohthoh". Zu gern hätte der „Geier“, das war sein Spitzname, seitlich über das Pult gelehnt, die Brille auf die Nasenspitze vorgeschoben und den rechten Arm in Richtung des Schülers vorgestreckt, leicht lispelnd, seinen Lieblingsspruch losgelassen: „Du musst doch zugeben, dass du nichts gelernt hast. Ich kann dir doch keine ausreichende Note schreiben.“ Aber so sehr der Geier sich auch bemüht, Otto bleibt ihm keine Antwort schuldig.
Sein langjähriger Banknachbar bis zum Abitur, Paul Zimmer, erinnert sich: "Otto saß mir immer 'zur Rechten' und war mir oft eine gute Hilfe bei Fragen des Lehrers, bei denen ich keine sofortige Antwort vorrätig hatte, auch bei 'Arbeiten'. Wenn ich einmal im Unterricht an die Reihe kam und nicht weiter wusste, habe ich ihn angestoßen, bis er mir leise, aber treffsicher aus der Not half. Otto war kein Schwätzer. Ich persönlich hatte aber an ihm einen guten Gesprächspartner, auf dessen Urteil ich Wert legte. Ich bleibe dabei: Er war Liebling aller seiner Lehrer! Vor allem, weil er nie den Unterricht störte und weil er immer etwas Vernünftiges wusste.“
Inzwischen ist auch Aloys auf dem Gymnasium in Saarlouis. Als er auf der Untertertia schlechte Noten heimbrachte, wurde Bäbchens pädagogischer Eifer geweckt. Sie erkundigte sich bei seinen Lehrern und brachte die Kunde nachhause, seine Versetzung sei gefährdet. Sie erreichte bei den Eltern, dass Aloys mit Otto in ihrer Wohnung Aufgaben machen und ungestört lernen sollte.
Aloys fiel der Verzicht auf den freien Nachmittag zuhause schwer, doch freute er sich dann über die Versetzung in die Obertertia an Ostern.“
Klassenfoto: Otto, 2. von links in der oberen Reihe
An einem Abend Ende Januar 1926, Otto und Aloys sind noch mit den Schulaufgaben beschäftigt, während der Vater die Zeitung liest, bricht Otto zur allgemeinen Überraschung das Schweigen: "Papa, was würdest Du sagen, wenn ich ins Kloster gehe?"
Der Vater faltet in Ruhe seine Zeitung zusammen. Was er antwortet, war zu erwarten: "Wenn Du glaubst! Du hast es Dir sicher gut überlegt?"
Otto Abiturient
Aloys wird dabei plötzlich klar, dass die gemeinsame Jugendzeit bald nur noch eine Erinnerung sein wird. Sie hatten viele Jahre den gleichen Tagesablauf, waren fast jeden Morgen zur gleichen Zeit aufgestanden, wobei Otto, die Uhr vor der Nase, "bis zur letzten Minute" liegen blieb. Seine Sachen hatte er abends so sorgfältig zurecht gelegt, dass er jedes Stück im Dunkeln greifen konnte, was Aloys nicht immer fertig brachte. Wer zuerst fertig war, nahm als erster die Waschschüssel, den Kamm, kam zuerst zum Frühstück und hatte die Auswahl der eingewickelten Butterbrote. Mit der Uhr in der Hand wartete Otto, bis es höchste Zeit war, um auf den Zug zu laufen, wo jeder seine Kameraden traf. Und das ging nun zu Ende. Er weiß, dass er seinen Bruder vermissen wird, an dem er seit einiger Zeit eine bisher nie gekannte Gesprächigkeit und Aufgeschlossenheit bemerkt hat.
Die Entscheidung fiel vermutlich im Sommer des davor liegenden Jahres bei einer Wanderung mit Ernst Kasper durch den Westerwald. "Ich übernachtete mit Ernst im alten Rundturm mitten in Andernach und von dort brachte uns der Dampfer nach Engers. Dann zogen wir zu Fuß nach Montabaur durch das Kannebäckerland und schließlich über den Arenberg nach Koblenz," erinnerte er sich später. Ludwig Pignon aus ihrem Bouser Freundeskreis war im Jahr zuvor bei den Barmherzigen Brüdern in Montabaur eingetreten und konnte die beiden über Nacht beherbergen.
„Mein Entschluss steht fest“, sagte Ernst sinnend nach einigem Schweigen, als sie nach dem Abendessen noch zusammen saßen. Oft schon hatten sie miteinander über ihre Berufspläne gesprochen, bevor sie andere einweihten.
„Ich gehe zu den Salesianern. Viele junge Menschen haben nicht das, was wir bisher hatten, nämlich eine schöne Kindheit und eine gute Jugendzeit. Sie leben auf der Straße, niemand kümmert sich um sie. Denen möchte ich einiges von dem abgeben, was mir bisher reichlich geschenkt wurde. Und wieweit sind deine Planungen?“
Seit langem schon hatte Otto sich mit der Frage beschäftigt, was wohl seine berufliche Zukunft sein werde. Aber wie er es auch drehte und wendete, immer wieder kam er zu dem Ergebnis, dass er nur als Mönch seine Erfüllung finden wird. Ein Leben außerhalb einer klösterlichen Gemeinschaft konnte er sich nicht vorstellen. Eines stand fest: seine Zukunft war die Mission. „Geht hinaus in alle Welt …“
Steyler, Jesuiten, Weiße Väter oder Benediktiner? Um diese Frage drehten sich seine Gedanken, wobei er immer mehr zu den Benediktinern tendierte. Als Otto an jenem Abend seinen Vater fragte, hatte er sich bereits für die Missionsbenediktiner, den noch relativ jungen Zweig in der benediktinischen Großfamilie, entschieden.
„Ich werde wohl gleich nach dem Abitur bei den Missionsbenediktinern in St. Ottilien eintreten.“ Als er sich dort erkundigt, bekommt er eine grundsätzliche Zusage, man legt ihm aber nahe, erst in Saarlouis seine Reifeprüfung abzulegen und nicht für die Oberprima ins klostereigene Gymnasium überzuwechseln.
Das "Ora et labora", die benediktinische Harmonie von Arbeit und Ruhe entsprach seiner Mentalität. Er wies später darauf hin, dass dieser Orden die Jahrhunderte überdauert habe, weil er nicht hastig, sondern bedächtig vorging.
Drei Wochen vor den Osterferien 1927 kommt Otto wie immer aus der Schule und steckt wie in jedem Jahr sein Zeugnis in den Glasschrank zwischen die Tassen. Seine Mutter fragt verwundert: "Ist eure Schule schon aus? Ihr habt doch noch keine Ferien!" Sie hatte nicht bemerkt, dass Otto in der Woche vorher das schriftliche Abitur gemacht hatte, und wusste auch noch nicht, dass er vom "Mündlichen" befreit wurde, denn Otto hatte - wie üblich - kein Wort darüber verloren.
Inzwischen hat Otto sich in St. Ottilien um Aufnahme beworben und eine Zusage erhalten.
Nun hat seine Schwester Lena einiges zu tun, um seine Kleider und Wäsche noch in Ordnung zu bringen, denn am 1. Mai will er schon eintreten. Ihr wäre lieber gewesen, Otto wäre Weltpriester geworden, aber er blieb fest bei seinen Plan, Missionar zu werden.
Während sich Otto auf seine Abreise vorbereitet, gilt es aber noch ein besonderes Ereignis in der Familie zu feiern: in Sotzweiler bei Tholey läuten am 20. April 1927 die Hochzeitsglocken für seinen nächst älteren Bruder Willy, der mit Anna Eckert getraut wird. Bei diesem großen Familienfest ist Otto noch dabei.
Dann kommt eine Woche später der Abschied von der Heimat. Otto fährt mit seinem Vater am Freitag, dem 28. April 1927, nach St. Ottilien. Direkt schon, noch bevor er das Haus verlässt, beginnt er mit der "klösterlichen Armut": er nimmt seine Taschenuhr und reicht sie seinem Bruder Anton.
Einen Tag danach verlässt auch Ernst Kasper die Heimat und tritt bei den Salesianern ein. Damit trennen sich die Wege einer langen innigen Freundschaft. Gemeinsam haben sie die Jugend-Kongregation geführt, ihre Berufspläne miteinander besprochen. Sie bleiben weiter in Verbindung, in St. Ottilien, München und der Mandschurei, bis die politische Lage ihren Briefwechsel unterbricht.
2. TEIL
Im Kloster
Noviziat, Studium in St. Ottilien und in München, die zeitlichen und die ewigen Gelübde, Weihen zum Subdiakon, zum Diakon und zum Priester.
Primiz in seiner Heimatpfarrei in Bous, seelsorgliche Aushilfen in Bayern. Die Anfänge von St. Ottilien.
Wirtschaftliche Nöte der Abtei. Missionsbenediktiner in Korea?
Vorbereitung auf sein künftiges Wirken. Aloys in München.
Blick auf die Mandschurei: Ein Märtyrer.
Pu Yi, der letzte Kaiser.
Abschied von der Heimat.
Am 12. Mai 1927 wird Otto "eingekleidet" und bekommt mit dem neuen Habit auch einen neuen Namen und heißt nach dem Tagesheiligen des nächsten Tages, einem der drei Eisheiligen, Frater Servatius O.S.B.
St. Ottilien, Gesamtansicht von Südwesten
„Das Leben in klösterlicher Gemeinschaft folgt einem andern Rhythmus als das Leben daheim in der Familie.“ Gebannt lauschen Servatius wie auch die andern Novizen den Ausführungen von Pater Chrodegang, dem Novizenmeister. „Im Mittelpunkt des Tagesablaufs steht die Liturgie, das heißt die Messe und das Stundengebet. Paulus schreibt im ersten Thessalonicherbrief ‚Betet ohne Unterlass‘. Die Eckpunkte des Tages sind die Anhaltspunkte für unsere Gebetszeiten, 'von der Morgenröte bis zur Nachtwache‘. Zu diesen Gebetszeiten, den Horen, versammeln wir uns in der Kirche. Gegen halb fünf ruft die Glocke uns zum Morgengebet, der Prim und den Laudes, das ist der Lobpreis Gottes zum Beginn des Tages.“
Der hagere, etwa sechzigjährige grauhaarige Mönch blickt in die Runde, aber niemand der jungen Leute scheint ernsthaft überrascht zu sein. Eifrig notieren sie, wie ihr künftiger Tagesablauf sein wird, die weiteren Stundengebete, Betrachtungen und Vorträge über die Ordensregel und die Geschichte des Ordens, Lesung über Liturgie, Psalmen, Asketik. Auch die Mahlzeiten sind genau in diesen Ablauf eingeplant, wie auch Freizeit und Handarbeit. Nach dem Abendgebet um 20 Uhr in der Kirche, der Komplet, ist dann der Tag beendet.
Und für diesen durchstrukturierten Tagesablauf, der keine Langeweile aufkommen lässt, braucht Servatius seine Uhr wieder. Anton schickte sie ihm.
Vor ihm liegt nun sein erstes Jahr im Kloster, das Noviziat. Es ist die Zeit, sich zu prüfen, ob dies die richtige Lebensform für das gesamte Leben ist. An seiner Berufung hat Servatius nie wirklich gezweifelt. Ihn quält mehr die Frage: Bin ich auch würdig, dieses hohe Ziel zu erreichen, das ich mir gesetzt habe?
Problemlos lebt er sich in die klösterliche Ordnung ein, bekommt tiefere Einblicke in das ganze Ordensleben.





























