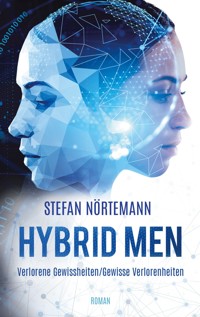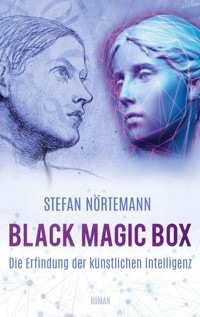
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist kein Fachbuch, sondern ein Roman mit allem, was dazu gehört: Freundschaft, Liebe, Drama, Verrat & Versöhnung, einem folgenreichen Bootsunfall, vielen prächtigen Erfindungen und magisch anmutenden Maschinen. Ganz nebenbei erfährst du alles über künstliche Intelligenz & ihre Geschichte, was du schon immer wissen wolltest. Und wenn du noch mehr wissen möchtest, dann lies die sogenannten Outtakes, die vertiefende Informationen bieten und als Schleifen in die Handlung eingewebt sind. Aber keine Sorge: Für all das benötigst du kein Informatik-Studium oder anderweitige Vorkenntnisse, sondern lediglich ein wenig Lust, in die Welt der vermeintlich großen Verheißungen einzutauchen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 514
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
für Margot, Karen, Meredith, Kate, Timnit, Joy, Katharina und all die anderen Frauen für ihre wertvollen Beiträge zum Umgang mit künstlicher Intelligenz
„Welcome to the machine”
Pink Floyd
Inhaltsverzeichnis
PROLOG
KAPITEL 1
KAPITEL 2
KAPITEL 3
KAPITEL 4
KAPITEL 5
KAPITEL 6
KAPITEL 7
KAPITEL 8
KAPITEL 9
KAPITEL 10
MINIATUR
KAPITEL 11
KAPITEL 12
KAPITEL 13
KAPITEL 14
KAPITEL 15
KAPITEL 16
INTERMEZZO
KAPITEL 17
KAPITEL 18
KAPITEL 19
KAPITEL 20
KAPITEL 21
KAPITEL 22
KAPITEL 23
KAPITEL 24
KAPITEL 25
KAPITEL 26
KAPITEL 27
KAPITEL 28
KAPITEL 29
KAPITEL 30
EPILOG
PROLOG
Schauergeschichten
Cologny, Schweiz – ein Abend im Sommer 1816
„Künstliche Intelligenz? Das ist lächerlich, wie sollte das gehen?“, empört sich George, schüttelt den Kopf und nimmt noch einen tiefen Zug aus dem Schlauch der Wasserpfeife.
Sein neuer Freund Percy pflichtet ihm bei, indem er ebenfalls ein wenig theatralisch den Kopf schüttelt, jedoch nichts weiter zu dem Vorschlag äußert.
Mary und Claire tauschen einen Blick, bevor Mary das Wort ergreift. „Wieso eigentlich nicht? Wilhelm Schickard und Blaise Pascal haben schon im letzten Jahrhundert unabhängig voneinander Rechenmaschinen gebaut. Das hätte zuvor auch niemand für möglich gehalten.“
Claire streicht über ihren Babybauch, der bereits nicht mehr zu übersehen ist, und ergänzt: „Die Pasca-line war ein Wunderwerk der Technik und sie rechnete genauer und schneller, als Menschen es können.“
„Und was ist intelligenter, als rechnen zu können?“, führt Mary den Gedanken ihrer Stiefschwester fort. „Wer weiß heute schon, was die Weiterentwicklung der Rechenmaschine noch hervorbringen wird?“
Nun ist es Percy, der ihr widerspricht. „Und du meinst, irgendwann wird es intelligente Maschinen geben, solche, mit denen man sich zum Beispiel unterhalten kann?“
Mary schenkt ihm ein betörendes Lächeln und zuckt mit den Schultern. „Warum nicht? In den letzten Jahren wurden so viele wundersame Dinge erfunden.“
Mit bereits etwas glasigen Augen schaut George in die Runde und schüttelt erneut den Kopf.
„Klar, man denke nur an die Dampfmaschine, deren Potenzial wir noch gar nicht wirklich begriffen haben. Aber künstliche Intelligenz, das scheint mir doch wirklich zu fantastisch, selbst für unseren kleinen Ge-schichtenwettbewerb.“ Er schaut nochmals in die Runde. „Gibt es weitere abseitige Ideen, über die wir schreiben könnten? Was meinst du, John?“
Sein Leibarzt, der bislang schweigend dabeigesessen und nur hin und wieder einen verstohlenen Blick auf Mary gewagt hat, beugt sich ein Stück vor. „Wie wäre es stattdessen mit künstlichem Leben?“
Percy, der die Blicke des Kollegen längst bemerkt hat, nimmt Marys Hand in die seine und wirft ihm einen ironischen Blick zu. „Das klingt ja noch verrückter als die Sache mit der künstlichen Intelligenz.“
Bevor jemand antworten kann, wird der Raum von einem lauten Knall erfüllt, gefolgt von einem weiteren. Schwerfällig erhebt sich George aus seiner halbliegenden Position in seinem Sessel und bewegt sich mühsam zu dem Fensterladen, der heftig im Wind hin und her pendelt. Als er das Fenster öffnet, um den Laden zu schließen, weht ihm eine Woge Regen entgegen und spritzt in sein Gesicht.
Mit großer Kraft schließt er wütend den Laden und das Fenster, schüttelt sich und begibt sich zurück in seine Sesselposition.1
„Hat jemand schon einmal so einen Sommer erlebt? Dagegen ist der Herbst in London geradezu erfrischend“, führt er aus.
„Aber hier in der Villa lässt es sich gut aushalten“, erwidert Percy und wendet sich sogleich wieder John zu.
Der Arzt fühlt sich aufgefordert, seinen Vorschlag zu erläutern. „Hat niemand von euch je von meinem Kollegen Erasmus Darwin gehört? Auch ein Dichter wie ihr beide. Aber auch ein Arzt und Naturforscher, der vielversprechende Versuche unternommen hat, tote Materie zum Leben zu erwecken.“
„Und, war er erfolgreich damit?“, fragt Percy zurück.
„Falls es so wäre, hätten wir sicher davon gehört“, führt George aus, ohne den Sarkasmus in seinem Ton zu verbergen.
Wieder ist es Mary, die sich auch für diese Idee begeistert. „Warum sollte auch das nicht irgendwann einmal möglich sein? Zwar ist die Frage, was Leben eigentlich ist, wohl eher eine philosophische, aber wer weiß, vielleicht verstehen wir irgendwann, wie Leben entsteht.“
Claire wirft George einen verstohlenen Blick zu. „Genau genommen wissen wir das heute schon.“
George betrachtet ihren Babybauch, verzieht das Gesicht und nimmt noch einen tiefen Zug aus dem Schlauch der Wasserpfeife.
Dann schaut er in die Runde und verkündet: „Okay, wenn es keine weiteren Vorschläge gibt, dann schreiben wir jeder eine Schauergeschichte über künstliches Leben.“
Percy runzelt die Stirn, aber Mary strahlt in die Runde. „Ich glaube, ich habe da schon eine Idee!“
Am 01. Januar 1818 erschien Mary Shellys Roman „Frankenstein“ über den jungen Schweizer Wissenschaftler Viktor Frankenstein, der einen künstlichen Menschen erschafft. Bedauerlicherweise werden wir nie erfahren, welche Geschichte Mary geschrieben hätte, wenn Lord Byron sich für das Thema ‘künstliche Intelligenz’ entschieden hätte.
1. Die Zusammenkunft von Mary Godwin, ihrem späteren Ehemann Percy Shelley, Marys Stiefschwester Claire Clairmont sowie Lord George Gordon Byron und seinem Leibarzt John Polidori an einem Abend im „Jahr ohne Sommer“ 1816 in der Villa Diodati in Cologny am Genfersee hat tatsächlich stattgefunden. Was wirklich gesprochen wurde, ist jedoch nicht überliefert.
KAPITEL 1
Black Magic Box
New York City (NYC) – Gegenwart, Januar
Anne zieht die Kapuze noch ein Stück tiefer ins Gesicht, als sie um die Häuserecke biegt und ihr ein eisiger Wind entgegenweht. Es ist Mitte Januar und immer noch bitterkalt, und sie ist froh, dass sie nun gleich da ist.
Sie liebt diese Stadt, vor allem die Upper-Eastside und den Park, aber die Winter hier sind härter als anderswo, bildet sie sich ein, und die Sommer heißer.
Endlich ist sie da. Sie durchquert das Eingangsportal, winkt dem freundlichen Portier kurz zu, wickelt sich aus ihrem ellenlangen Schal, streift die Kapuze ab und schüttelt ihr langes blondes, feuchtes Haar. Der Lift bringt sie in die sechzehnte Etage wie schon so oft zuvor, und sogleich steht sie in dem kleinen Apartment, wo die anderen sie bereits erwarten.
Die beiden kleinen Räume und die winzige Kochnische sind voll mit jungen Leuten und die Musik ist in dem Stimmengewirr kaum erkennbar.
Da kein Haken an der Garderobe frei ist, wirft Anne ihre dicke Daunenjacke auf einen Haufen, den Schal und die nassen Fäustlinge hinterher.
Dann streift sie ihr Kleid glatt, lächelt kurz ihr Spiegelbild an und stürzt sich ins Getümmel.
In einer Ecke entdeckt sie Jane, ihre beste Freundin seit jeher, die gerade von einem langhaarigen Nerd in ihrem Alter vollgequatscht wird. Als sie Anne entdeckt, winkt sie ihr zu, lässt den Typen kurzerhand stehen und kommt zu ihr. Nachdem sie sich fest gedrückt haben, verdreht Jane die Augen.
„Oh Mann, der Typ ging mir vielleicht auf die Nerven. Danke, dass du mich gerettet hast.“
Anne nickt verstehend. „Gewöhn dich schon mal dran, das sind die Jungs, mit denen wir später zusammenarbeiten müssen.“ Sie schaut sich um. Dann hebt sie kurz die Hand, in der sie eine kleine Schachtel hält. „Wo ist denn unsere Gastgeberin? Ich habe noch ein Geschenk für sie.“
„Vorhin habe ich sie noch mit Catherine in der Küche gesehen“, antwortet Jane, nimmt Annes freie Hand und zieht sie hinter sich her zu der Kochnische in dem anderen Zimmer.
Während Anne hinter ihrer Freundin her läuft, scannt sie kurz den Raum und stellt sogleich fest, dass keiner der Typen in ihr Beuteschema passt.
‚Auch gut‘, denkt sie. ‚Dann bin ich morgen wenigstens ausgeschlafen zu dem großen Ereignis.‘
In der Kochnische treffen sie tatsächlich auf Anna und Catherine, die sie sofort überschwänglich begrüßen. Anne überreicht ihr Geschenk und Anna bedankt sich höflich. Dann verzieht sie das Gesicht und eine Träne läuft ihr über die Wange.
Anne nimmt sie vorsichtig in die Arme und flüstert: „Wir werden dich vermissen, Süße, aber niemals vergessen, versprochen!“
Catherine steht dicht daneben und ergänzt: „Und wir bleiben in Kontakt, jeden Tag.“
Jane hat offenbar das Bedürfnis, auch irgendetwas Tröstliches zu sagen. „Und vielleicht kommen wir dich bald mal besuchen. Paris muss wunderbar sein, vor allem im Sommer.“
Anna wischt sich noch eine Träne aus dem Gesicht, dann versucht sie ein Lächeln.
„Ihr seid lieb und ich bin sehr glücklich, euch zu Freundinnen zu haben. Und im Seminar sehen wir uns ja auch weiterhin, wenn auch nur online.“ Dann deutet sie mit der Hand in den Raum und ergänzt: „So, und jetzt lasst uns feiern!“
Im selben Moment ist sie in der Menge verschwunden.
„Wir hätten nicht zulassen dürfen, dass sie fortgeht“, murmelt Catherine und Jane ergänzt: „Ohne sie wird es nur noch halb so lustig sein an der Uni und auf den Partys.“
Anne nickt. Lange haben sie versucht, Anna von ihrem Plan abzuhalten, an der Sorbonne weiter zu studieren und dort ihren Master zu machen. Aber dann hat sie ein Stipendium von irgendeiner Stiftung und eine Zusage aus Paris erhalten. Anna war überglücklich, zurück nach Europa zu kommen, und gerade Paris ist immer ihr Traum gewesen.
Und sie freut sich, wieder näher bei ihrer Familie zu sein. Ihre Eltern – wie auch ihre beiden Schwestern, an denen sie sehr hängt – leben in Düsseldorf in Deutschland, wo Anna herkommt. ‚Und von Paris bis Düsseldorf sind es nur vier Stunden mit dem Zug‘, hat Anna ihren Freundinnen erklärt, die sich darüber wunderten, dass in Deutschland auch Dörfer einen Bahnhof haben.
In ihre Gedanken hinein bemerkt Anne einen flüchtigen Schatten am anderen Ende des Raums. Ehe sie es realisiert, spürt sie Janes zarte Hand auf ihrer Schulter.
„Ganz tief einatmen, meine Liebe, und keine Panik!“, flüstert ihre Freundin.
Und dann steht er auch schon vor ihnen und wirft ihnen beiden ein hinreißendes Lachen zu. Anne wird es schwindelig und sie sucht einen Halt, an dem sie sich abstützen kann. Jane bemerkt es sofort und hält ihre Hand ganz fest.
„Tag die Damen, schön, euch hier zu treffen!“, flötet er ihnen entgegen.
Anne öffnet den Mund, um etwas zu erwidern, aber es kommt kein Ton aus ihr heraus. Das ist ganz und gar untypisch für sie. Eigentlich ist sie für ihre offene Art und ihre Schlagfertigkeit bekannt. Aber bei Henry versagen alle ihre Reaktionen. Immer wenn sie ihn trifft, erwacht dieses kleine lästige Tier in ihrer Kehle, das all die klugen Worte frisst, bevor sie aus ihrem Mund herauskommen. Tatsächlich hat sie noch nie ein auch nur halbwegs normales Gespräch mit ihm geführt und er hält sie ganz sicher für vollkommen meschugge.
Zum Glück lässt sein Charme Jane völlig kalt, sodass sie die Konversation übernimmt, sich freundlich nach Katharina erkundigt und noch allerlei Weiteres zum Smalltalk beiträgt, was Anne nur von fern mitbekommt, weil sich um sie herum gerade alles in einem diffusen Unfug aufzulösen beginnt.
Als sie Henry das erste Mal traf, damals auf Katharinas Geburtstagsfeier, hat sie sich sofort vollumfänglich in ihn verknallt. Er schien ihr genau der Mann, nach dem sie schon lange gesucht hat, einfach perfekt für sie.
Leider hat er keinerlei Notiz von ihr genommen und hatte nur Augen für seine neue Freundin Katharina. Die hat ihn stolz ihren Freundinnen vorgestellt. Damals hatte Anne noch den Plan, Henry irgendwann für sich zu gewinnen. Aber das scheint ganz und gar aussichtslos, denn er und Katharina sind das Traumpaar schlechthin und inzwischen wohnen sie zusammen in Henrys palastartigem Appartement in Greenwich Village und werden wohl bald heiraten.
Zudem ist Katharina eine gute, wenn auch nicht ihre beste Freundin. Und diese erscheint nun gerade ebenfalls bei den anderen. Strahlend schön mit ihrem dunklen Teint und einem Strahlen im Gesicht begrüßt sie ihre Freundinnen.
So stehen sie kurz beieinander, bevor sich Katharina und Henry ebenfalls ins Getümmel stürzen, wo inzwischen getanzt wird.
„Geht’s wieder?“, fragt Jane besorgt, und Catherine kann ein Grinsen nicht verbergen.
Alle wissen, dass Anne Henry liebt, außer er selbst natürlich und Katharina.
Anne nickt.
„Danke, dass du mich gehalten und für uns gesprochen hast!“
Catherine reicht ihren beiden Freundinnen je ein Glas Wein und dann stoßen sie an.
„Jetzt sind nur noch wir drei übrig. Unser Nesthäkchen in Paris, Katinka bald verheiratet und wir alten Jungfern bleiben einsam zurück“, führt Catherine aus.
Jane wackelt verwundert mit dem Kopf. „Habe ich etwas verpasst? Hat mein Bruder mit dir Schluss gemacht? Wo ist Thomas überhaupt?“
Catherine schüttelt den Kopf und lacht. „Nee, alles gut, der Streber lernt für seine Prüfung nächste Woche, und das mit den Jungfern meine ich im übertragenen Sinne.“
Jane geht nicht darauf ein und wechselt spontan das Thema. „Und wie läuft’s mit euren Hausarbeiten?“
Catherine zuckt mit den Schultern. „Läuft! Klára Dan war eine sehr beeindruckende Frau und sie hat Immenses geleistet. Ist schon irgendwie fies, dass man sie heute nur noch als zweite Ehefrau von John von Neumann in Erinnerung hat.“
„Und wie kommst du mit deinem Referat über Ada Lovelace voran?“, fragt Jane an Anne gerichtet.
Diese rollt mit den Augen. „Frag nicht. Ich hätte den Kurs vielleicht nicht belegen sollen. Meiner unmaßgeblichen Meinung nach wird diese Ada nämlich ganz erheblich überschätzt – von wegen erste Programmiererin und so.“ Auf Annes Stirn erscheint eine Falte, bevor sie in ihrer Klage fortfährt. „Die Gute fühlt sich selbst so toll und plustert sich in einem fort auf, nur weil sie Queen Victoria persönlich getroffen und Prinz Albertsie umschwärmt hat. Hätte ich geahnt, was für eine aufgeblasene Pute sie war, hätte ich ein anderes Thema gewählt.“
„Ups, das tut mir leid. Eigentlich dachte ich, du hättest das beste Thema. Kannst du nicht vielleicht noch wechseln?“
„Nee, hab‘ ich schon versucht, aber Bessie lässt nicht mit sich reden. Sie meint, Professorin Carter hält gar nichts davon, wenn Studentinnen einfach das Thema wechseln, wenn sie mit ihrem nicht zurechtkommen“, antwortet Anne genervt. „Und wie kommst du mit Grace Hopper klar?“
„Ach, ganz gut eigentlich. Grace war echt cool und wirklich genial. Und sie hat mehr als vierzig Ehrendoktortitel.“ Jane räuspert sich, bevor sie weiterspricht. „Aber so richtig sympathisch ist sie mir nicht, sie fuhr völlig auf diesen Militärkram ab und war einige Zeit bei der Marine. Die haben sogar ein Kriegsschiff der United States Navy nach ihr benannt.“
„Quatscht ihr über die Uni?“, fragt Katharina gespielt entsetzt. Gerade eben ist sie in der Kochnische erschienen, um zwei Flaschen Bier aus dem Kühlschrank zu nehmen. Kopfschüttelnd verschwindet sie, ohne eine Antwort zu erwarten.
„Na, die hat gut reden. Aber präzise betrachtet hat sie natürlich recht“, reagiert Catherine als erste. „Also, Ladys, lasst uns feiern. Wer weiß, wann wir wieder dazu kommen.“
In ihre Worte hinein erklingen die ersten Takte von „Seventeen going under” und Anne gibt Catherine recht, denn noch mehr als Henry liebt sie Sam Fender, dessen charismatische Stimme sie sogleich voll und ganz verzaubert. Die beiden anderen nicken und folgen ihr auf die provisorische Tanzfläche in dem anderen Raum.
Unter lautstarkem Protest der Tanzenden beendet der picklige Kommilitone, der gerade den DJ gibt, später die Serie von Britpopsongs mit dem fulminanten „Exits“ von Foals.
Erschöpft lassen sich die drei Frauen auf die Matratzen am Rand fallen, während Katharina mit einem Tablett mit bunten Cocktails vorbeischlendert, von denen sich jede einen nimmt.
Als auch die letzten Nerds die Party verlassen haben, dämmert es bereits und die Freundinnen liegen erschöpft auf den beiden alten Sofas am Rand des kleineren der beiden Räume.
Anna hat glasige Augen und wirkt ordentlich verschoben. Ihren Kopf hat sie an Catherines Schulter gelehnt, die als Einzige halbwegs fit wirkt. Auf dem anderen Sofa hat sich Jane lang ausgestreckt und ihren Kopf in Annes Schoß gelegt. Katharina hat für alle Kaffee gekocht und stellt ein Tablett mit fünf Bechern auf dem Tisch ab, bevor sie sich zu Anna und Catherine auf das Sofa setzt.
„Wann geht dein Flieger morgen?“, fragt sie an Anna gerichtet.
Die reagiert nicht sofort, daher antwortet Catherine für sie. „Erst am frühen Abend, wir haben also noch genügend Zeit, hier aufzuräumen.“
„Dann war das hier also unsere letzte gemeinsame Party“, stellt Katharina fest und schüttelt ein wenig theatralisch den Kopf.
„Nee, die nächste Party machen wir in Paris im Sommer in Annas neuem Appartement“, führt Anne fröhlich aus. „Und ich hoffe, dass du dann ein paar von diesen charmanten Franzosen einlädst und ich am nächsten Morgen nicht wieder unbefriedigt mit euch auf dem Sofa abgammeln muss.“
„Schon vergessen? Die nächste Party ist meine Geburtstagsfeier Anfang Juli bei meinen Eltern in Water Mill“, widerspricht Catherine.
Jane öffnet die Augen und leckt sich kokett, wie es für sie untypisch ist, über die Lippen. „Oh, ich freue mich schon auf deine Hampton-Boys.“
Catherine grinst und nickt. Dann schaut sie Anna
an.
„Zu schade, dass du nicht dabei sein kannst. Nicht nur wegen der Hampton-Boys. Meine Eltern haben neue Nachbarn, die ich dir gern vorgestellt hätte. Sie sind kürzlich erst ins Nachbarhaus eingezogen. Alice ist sehr nett, eine Mathematikerin aus London. Guido ist deutlich älter, aber sehr charmant und ehemals IT-Vorstand einer großen Versicherung in – Trommelwirbel – Düsseldorf.“
Anna hebt den Kopf und macht große Augen. „Ein Deutscher in den Hamptons? Und dann aus meiner Heimatstadt?“
Catherine nickt und reicht ihr einen Becher vom Tablett. Die anderen nehmen sich auch einen und stoßen miteinander an.
„Wer war eigentlich der Typ, mit dem du die halbe Nacht herumgeknutscht hast?“, fragt Jane an Anna gerichtet.
„Keine Ahnung, den kannte ich nicht und hab ihn auch nicht nach seinem Namen gefragt. Muss sich irgendwie hierher verirrt haben“, antwortet Anna, ohne eine Miene zu verziehen.
„War sicher das Abschiedsgeschenk der Stadt an dich“, entgegnet Anne ohne eine Spur von Ironie in ihrer Stimme.
„Wir wär’s nun mit Sonnenaufgang im Park?“, fragt Catherine.
Anne verzieht das Gesicht. „Nee, zu kalt. Außerdem geht die Sonne doch jeden Tag immer wieder auf.“
„Genau genommen geht sie sogar zu jedem beliebigen Zeitpunkt an irgendeinem Ort auf“, präzisiert Jane. „Komm schon, das ist cool und pustet den Kopf frei. Und es wird Annas vorerst letzter Sonnenaufgang auf dieser Seite des Atlantiks sein.“
Viel später finden sich die fünf Freundinnen wieder in Annas Apartment ein und beginnen damit, die Spuren der Nacht zu beseitigen.
Irgendwann schlägt sich Catherine vor die Stirn. „Ladys, habt ihr an unseren Termin heute gedacht?“ Mit einer hektischen Bewegung schaut sie auf ihre Armbanduhr und stößt hervor: „Ups, wir haben nur noch eine Stunde. Und die Fahrt dauert sicher eine halbe, wir sollten also reinhauen.“
Anna macht eine beschwichtigende Handbewegung. „Fahrt ihr ruhig, ich komme sowieso nicht mit und hier gut allein klar.“
Anne widerspricht ihr sogleich. „Es kommt überhaupt nicht in Frage, dass wir dich hier allein zurücklassen. Abgesehen davon musst du mitkommen, denn so etwas wirst du in Europa ganz bestimmt nicht zu Gesicht bekommen.“
Jane nickt zustimmend. „Es ist sowieso ein absoluter Glücksfall, dass ausgerechnet wir heute dabei sein dürfen. Hätte Anne nicht diesen Typen aufgegabelt, kämen wir gar nicht hinein.“
Anne nickt und zeigt ein schelmisches Lächeln, schweigt jedoch dazu.
„Die an der Uni werden Augen machen, wenn wir das morgen erzählen“, ruft Katharina aus und strahlt in die Runde.
Eine Stunde später stehen die fünf Frauen dichtgedrängt in einer Traube von vielleicht hundert Menschen in einem kleinen Saal und starren auf einen großen Kasten, der (noch) von einem schwarzen Samtvorhang verdeckt wird.
Die Gesellschaft ist ebenso exklusiv wie vornehm, besteht vorwiegend aus älteren Männern in teuren Maßanzügen und wenigen Ehefrauen in lässig-eleganten Kleidern.
Einige von ihnen blicken ein wenig verschämt auf das Buffet, das in einem Nachbarraum für nachher aufgebaut ist und das offenbar größeres Interesse hervorruft als die Kiste unter dem schwarzen Stoff.
Die fünf jungen Frauen, die von der Party und der durchgemachten Nacht gezeichnet sind, fallen hier deutlich aus dem Rahmen.
„Wann geht es denn endlich los?“, nörgelt Anna, die gedanklich offensichtlich bereits auf ihrer Reise nach Europa ist.
Catherine legt ihr einen Arm um die Schulter. „Das kennst du doch von den Rockstars, die auch immer viel zu spät auf die Bühne kommen.“
Anne schüttelt den Kopf über diesen seltsamen Vergleich und schaut hinüber zu dem Mann mit dem langen lockigen Haar, der abseits der anderen etwas näher an dem schwarzen Kasten steht und die Hände hinter dem Rücken verschränkt hat. Auf Anne wirkt er wie ein Museumswärter, der aufpasst, dass niemand dem Kasten zu nahe kommt.
Er war es, der sie vorhin am hinteren Lieferanteneingang hereingelassen und sie möglichst unauffällig, wie er meinte, durch zahlreiche Gänge und Flure hierhin gelotst hat, obwohl, genauer, weil sie keine Einladung zu diesem exklusiven Event haben.
Es ist erst wenige Wochen her, dass er Anne in einer Karaoke-Bar in Little Italy angesprochen hat. Sie hat gerade „Toxic“ von Britney Spears performed und dafür beträchtlichen Applaus erhalten, als er sich als Herman vorstellte und sie fragte, ob er ihr etwas ausgeben könne. Sie hat genickt, er hat ihre Tanzeinlage zu „Toxic“ über alle Maßen gelobt und dann haben sie mit Bacardi Cola angestoßen, während Jane „Betsy on the roof“ von Julie Holter auf ihre ganz eigene Weise interpretierte, ohne Playback, nur mit ihrer Stimme und einem Klavier, und dafür ebenfalls fulminanten Applaus bekam.
Nachdem Jane zu den beiden gestoßen ist, gab er ihr einen Gin Tonic aus und sie kamen ins Gespräch über allerlei und das, was sie so machten. Als er erfuhr, dass sie Anne und Jane heißen, kam ihm eine charmante Idee. Er tat geheimnisvoll, ging auf die Bühne und interpretierte „My sweet Lady Jane“, einen sehr frühen Song der Rolling Stones für sie beide. Die zweite Strophe beginnt mit „My dear Lady Anne“, was Anne schon wusste, weil Janes Bruder Thomas sich früher einen Spaß daraus gemacht hat, auf Partys das Lied für Jane, sie und ihre Schwester Mary zu singen und auf seiner Gitarre auf eine beträchtlich schräge Weise zu interpretieren.
Der Applaus des Publikums hielt sich in Grenzen, aber Anne und Jane waren ein klein wenig gerührt und fühlten sich geschmeichelt. Anne war durchaus angetan von Herman, obwohl er deutlich älter ist als sie und die magische Dreißiger-Grenze sicher schon vor längerem überschritten hat. Ein kurzer Blick zu Jane genügte ihr, um zu wissen, dass Jane ihn ihrerseits nicht auf ihre Shortlist setzen würde. Seit sie mit dreizehn angefangen haben, sich für Jungs zu interessieren, haben sie einander versprochen, sich in Sachen Männer niemals in die Quere zu kommen, da ihre Freundschaft ihnen deutlich wichtiger ist.
Seitdem sind Jungs und inzwischen Männer, die sie beide interessant finden, für sie tabu. Zu ihrem Glück kommt dies höchst selten vor, da sie, zumindest in dieser Hinsicht, sehr unterschiedliche Präferenzen haben.
Und so war es ganz okay, dass Herman inzwischen keinen Hehl daraus machte, dass er Anne mehr und sehr zugetan war, was er auch dadurch zum Ausdruck brachte, dass er vorschlug, und sie ein wenig bedrängte, mit ihm ein Duett zu singen. Am liebsten „Where the wild roses grow“ von Nick Cave & Kylie Minogue.
Anne zierte sich, da ihr das doch ein wenig zu intim vorkam.
Auch sein Argument, dass ihre tiefe, etwas rauchige Stimme wie dafür gemacht wäre, Kylies Part zu singen, ließ sie kalt lächelnd ins Leere laufen.
Aber einen Trumpf hatte er noch in der Hand, den er auch sogleich ausspielte. Zu ihrer großen Überraschung lud er sie beide exklusiv zur Enthüllung und feierlichen Inbetriebnahme des neuesten und leistungsstärksten Quantencomputers des Kontinents in der Nord-Amerika-Zentrale von IBM hier in Manhattan ein. Die beiden staunten nicht schlecht, und Anne bemerkte, dass Jane rote Flecken am Hals bekam – wie immer, wenn sie sehr aufgeregt war.
Als er ihnen zuvor erzählte, er würde bei IBM North America in der Entwicklungsabteilung arbeiten, hat Anne ihm nicht geglaubt und gedacht, er würde sie nur beeindrucken wollen, nachdem er von ihnen erfahren hat, dass sie beide gerade ihren Master in Computer Science an der Columbia University machen.
Noch während Anne darüber nachdachte, hat Jane ihr unter dem Tisch zart, aber durchaus spürbar vors Schienbein getreten. Als Anne auch darauf nicht reagierte, verkündete Jane mit fester Stimme: „Okay, sie macht’s! Aber nur, wenn wir noch drei Freundinnen mitbringen dürfen.“
Bevor Anne protestieren konnte, fand sie sich bereits auf der Bühne wieder, zusammen mit Herman, der ihr einen betörenden Blick zuwarf, als die kitschigen Geigen aus dem Playback ertönten und ihr Text auf dem Bildschirm erschien.
Und nun sind sie hier. Wie sich herausstellte, ist Her-man tatsächlich bei IBM und nicht ganz unmaßgeblich an der Entwicklung des neuesten Quantencomputers beteiligt gewesen.
Plötzlich verstummt das Gemurmel im Saal und Anne muss sich auf die Zehenspitzen stellen, um zu erkennen, was vorn vor sich geht. Eine elegant gekleidete Frau mittleren Alters mit einem fröhlichen Gesicht, blondem Haar und großen Ohrringen hat soeben den Saal betreten. Sie nickt Herman freundlich zu und er reicht ihr ein Mikrofon.
„Wer ist das?“, flüstert Anne an Jane gerichtet.
Die Angesprochene schüttelt den Kopf, als wundere sie sich über so viel Unwissenheit. „Das ist Kelly C. Chambliss, Senior Vice President and Chief Operating Officer bei IBM international. Sie ist großartig und eine von nur vier Frauen im IBM Leadership Board.“
Bevor Anne etwas erwidern kann, begrüßt Kelly die Anwesenden und beginnt eine kurze Rede, in der sie hervorhebt, dass die Anwesenden hier und heute wirklich etwas ganz und gar Einzigartiges erleben. Wie zur Bestätigung erscheinen wieder die roten Flecken an Janes Hals, die Anne erneut beweisen, dass ihre Gesangseinlage mit Herman ein geringer Preis für das hier war. Gebannt und mit einem Glitzern in den Augen starrt Jane auf die Black Magic Box, wie sie die Maschine vorhin spontan getauft haben.
Und auch Catherine, Katharina und sogar Anna wirken überaus geflasht. Die anderen Anwesenden scheinen mehrheitlich weit weniger beeindruckt, wie die begehrlichen Blicke zum Buffet deutlich belegen.
Indes führt Kelly aus, dass es vor wenigen Jahren noch gänzlich unvorstellbar war, an einen Quantencomputer mit mehr als einhundert Qubits auch nur zu denken. Und heute ist sie wirklich stolz, das neueste Wunderwerk aus der IBM-Schmiede, den Quantencomputer Eagle mit beeindruckenden 127 Qubits zu präsentieren.
Zeitgleich mit dem Ende ihrer Rede entschwebt wie von Geisterhand der schwarze Samtvorhang und gibt den Blick frei auf eine Glasvitrine mit einer goldglänzenden Maschine, die Anne auf den ersten Blick an das überdimensionierte feinmechanische Räderwerk einer Taschenuhr erinnert. Auf den zweiten Blick erkennt sie, dass sich hier nichts bewegt, sondern eine fast mystische Stille emittiert, die einen Augenblick später von dem losbrechenden Applaus gänzlich verschluckt wird.
In die klappernden Hände mischen sich Rufe der Begeisterung und Bekundungen des Erstaunens. Als sich der Trubel ein wenig gelegt hat, verkündet Kelly mit einem süffisanten Lächeln: „Jenen, die technische Fragen zu diesem Wunderwerk der Technik haben, steht mein Kollege Dr. Hollerith gern zur Verfügung.“
Mit diesen Worten übergibt sie das Mikro an Her-man und verlässt den Saal durch einen Seiteneingang. Während die meisten der Anwesenden zum Buffet schlendern und sich auf dem Weg dahin Champagner von einem Tablett nehmen, gesellen sich Anne und Jane zu der Handvoll Personen, die sich um Herman herum gruppiert haben und ihn mit Fragen löchern, die er allesamt ebenso kompetent wie höflich beantwortet.
So erklärt er den Neugierigen die Idee hinter einem Quantencomputer, der sich die Gesetze der Quantenmechanik geschickt zunutze macht. Zur Illustration beginnt er einen kurzen Ausflug in die Geschichte.
Die ersten mechanischen Rechenmaschinen, wie sie Wilhelm Schickard, Blaise Pascal, Gottfried Wilhelm Leibniz und in fast perfekter Vollendung Charles Babbage gebaut haben, basierten auf der Idee mechanischer Zustände, die durch Walzen und miteinander verbundenen Zahnrädern repräsentiert wurden.
Seit dem ersten elektronischen Computer, der Z3 von Konrad Zuse, nutzen unsere Rechner elektrische Zustände. Die kleinste Informationseinheit, das sogenannte Bit, kann dabei genau zwei Zustände annehmen, meist „0“ und „1“ genannt.
Quantencomputer hingegen basieren auf quantenmechanischen Zuständen, die in sogenannten Quantenbits, kurz Qubits, repräsentiert sind. Das Besondere daran ist, dass ein Qubit die Zustände „0“ und „1“, aber auch beliebig viele Zustände dazwischen annehmen kann! Mit einer speziellen Rechnerarchitektur ist es damit möglich, auch mit verhältnismäßig wenigen Qubits sehr schnell große Mengen von Rechenoperationen zu verarbeiten.
Und auch wenn die Prozessoren in den klassischen Computern in den vergangenen Jahren immer besser und schneller geworden sind, so stehen wir hier an der Schwelle zu einem Quantensprung in der Datenverarbeitung. Herman grinst über sein Bonmot und die Anwesenden sind hinreichend beeindruckt von seinen Ausführungen.
Lediglich Anne scheint noch nicht ganz überzeugt. „Verstehe ich das richtig, der ganze Zauber dient nur dazu, Berechnungen schneller zu machen?“
Jane schüttelt den Kopf und Herman zeigt ein überhebliches Grinsen, bevor er antwortet.
„Nicht nur schneller, sondern gigantisch, galaktisch schneller!“
Anne öffnet den Mund und würde gern spöttisch erwidern, dass sie eigentlich Zeit haben und auch mal ein wenig auf das Ergebnis einer Berechnung warten können, doch Jane kommt ihr zuvor.
„Verstehst du denn nicht? Damit werden die heutigen Programme nicht nur einfach schneller, sondern manche Berechnungen werden dadurch überhaupt erst möglich. Probleme, die heute zwar grundsätzlich lösbar, aber in angemessener Zeit nicht berechenbar sind, werden hiermit überhaupt erst greifbar.“
Herman schenkt ihr ein dankbares Lächeln, sodass Anne schon fürchtet, er würde sich von jetzt an doch ein wenig mehr für Jane als für sie interessieren.
„Genau, ihr kennt sicher Probleme, die so komplex sind, dass man sie heute noch nicht effizient berechnen kann. Etwa die Suche nach einem Eintrag in einer unsortierten Datenbank“, erläutert Herman, wird jedoch von Catherine unterbrochen.
„Das kenne ich, wenn ich in meinem Schuhschrank in den vielen Schuhkartons nach meinen schwarzen High Heels suche.“
Einige der Umstehenden lachen.
„Das effizienteste bekannte Verfahren ist die lineare Suche, das heißt, ich durchsuche den gesamten Schrank Karton für Karton. Im schlimmsten Fall benötigt das so viele Schritte, wie Kartons im Schrank sind“, führt Catherine aus.
Jane lächelt ihr zu. „Und genauso machen es unsere Algorithmen auch in großen unsortierten Datenbanken mit sehr viel mehr Einträgen, als Cathy Schuhe in ihrem Schrank hat.“
„Und für riesige Datenbanken ist das nicht effizient und kann sehr lange dauern“, führt Herman den Gedanken zu Ende. „Aber bereits 1996 hat der indische Informatiker Lov Kumar Grover seinen Grover-Algorithmus vorgestellt. Dieser ist nur mit einem Quantencomputer durchführbar und er ist nicht nur ein bisschen schneller, sondern wirklich effizient.“ 2
Jane bemerkt die fragenden Gesichter der Umstehenden und erläutert. „Wenn Cathy hundert Kartons mit je einem Paar Schuhe in ihrem Schrank hat, so benötigt die lineare Suche im schlimmsten Fall hundert und im Mittelwert fünfzig Schritte, wohingegen der Grover-Algorithmus nur maximal Wurzel aus einhundert, also zehn Schritte benötigt.“
„Ganz genau“, pflichtet Herman ihr bei.
„Und bei hundert Paar Schuhen macht das nicht viel aus, aber bei etwa einer Milliarde von Einträgen sind
es nur zehntausend Schritte, anstatt einer halben 2 Milliarde.“ 3
Und so geht es noch eine ganze Weile weiter. Her-man durchstreift mit Verve und Begeisterung die Quantenwelt und erweist sich als ebenso sachkundig wie leidenschaftlich. Jane hängt an seinen Lippen und Anne gibt sich redlich Mühe, seinen Gedankengängen und Dialogen mit Jane zu folgen.
Irgendwann sind die anderen wie auch ihre drei Freundinnen zum Buffet verschwunden. Nur noch zu dritt stehen sie vor dem Glaskasten, in dem Eagle nach wie vor keine Spur von Bewegung zeigt, obwohl er gerade diverse Berechnungen durchführt, wie Herman glaubhaft versichert.
Jane scheint gleichermaßen hochkonzentriert wie hingerissen von Hermans Ausführungen. Immer wieder stellt sie kluge Fragen und Anne hat den Eindruck, dass sie wirklich versteht, wovon Herman spricht.
Inzwischen geht es um die Probleme und Herausforderungen bei den Quantencomputern, die noch lange nicht hinreichend gelöst sind, um an einen industriellen Einsatz zu denken.
Um mit den Qubits wirklich rechnen zu können, müssen diese gezielt manipuliert werden, ohne ihre spezifischen Eigenschaften zu beschädigen. Die Qubits lange genug stabil zu halten, ist jedoch eine knifflige ingenieurtechnische Aufgabe, denn die Quantenzu-stände sind ziemliche Sensibelchen, die schon durch kleinste Umwelteinflüsse, etwa den Zusammenstoß mit einem Luftmolekül, ihre magischen Eigenschaften spontan verlieren.
Aber das alles bekommt Anne fast gar nicht mehr mit, denn inzwischen ist sie vollumfänglich versunken in ihren eigenen Gedanken, die sich mehr und mehr zu verstanden zu haben, welches Potenzial in dieser atemberaubenden Technologie liegt.
Bereits seit einigen Jahren beschäftigt sie sich intensiv mit dem sogenannten maschinellen Lernen und immer wieder stößt sie dabei auf genau dieses Problem: dass die Verfahren dafür nicht wirklich effizient durchführbar sind. In den vergangenen Jahren hat es dazu viel Forschung und auch beachtliche Fortschritte für einzelne Verfahren gegeben, ohne jedoch einen umfassenden Ansatz für eine Lösung zu finden.
Quantencomputer könnten hier vielleicht Lösungen bieten, geht es ihr durch den Kopf, in dem sie ihre letzten, wenig erfolgreichen Versuche durchgeht und versucht, sich vorzustellen, wie diese mit den magischen Qubits hätten ausgehen können. Wie Jane ist nun auch Anne vollumfänglich begeistert und selbst mächtig überrascht über ihre Träumereien und den fast hypnotischen Zustand, der sie auch in den kommenden Tagen gefangen halten wird.
2. Dazu ein Hinweis, der gefahrlos ignoriert werden kann: Die Laufzeit beträgt O(), wobei n die Anzahl von Catherines Schuhkartons bzw. der Einträge in der Datenbank bezeichnet. Das „O“ hier ist ein sogenanntes Landau-Symbol (auch O-Notation genannt). Dabei handelt es sich um ein Maß für die Komplexität eines Problems bzw. die Effizienz eines Algorithmus oder eines Berechnungsverfahrens.
3. Der Grover-Algorithmus ist neben dem Shor-Algorithmus ein prominenter Beleg für die prinzipielle Überlegenheit eines Quantencomputers gegenüber einem klassischen Computer. Allerdings muss für das Suchen mit dem Grover-Algorithmus die gesamte Datenbank in einem Quantenzustand vorliegen, was heute für große Datenbanken noch nicht praktikabel ist.
KAPITEL 2
Die Differenzmaschine
London – Anfang Juni 1833
Nachdem die Kutsche vor dem Portal angehalten hat, öffnet jemand die Tür, und ein Sonnenstrahl trifft Adas zartes Gesicht, sodass sie kurz die Augen zukneift. Bevor sie die Kutsche verlässt, zieht sie ihren Hut noch ein Stück tiefer ins Gesicht, um sich vor der Sonne zu schützen, jedoch nicht minder, um ihre vor Aufregung geröteten Wangen zu verbergen.
Es ist ihr erster Aufenthalt in London und bereits das dritte Fest, an dem sie teilnehmen darf. Seit ihrem siebzehnten Geburtstag im vergangenen Dezember ist sie endlich alt genug, um an den Vergnügungen der Großstadt teilhaben zu dürfen. Ada liebt London, vor allem im Sommer, wenn die Saison in vollem Gang ist und ein Fest sich an das nächste reiht.
An der Seite ihrer Mutter betritt sie die Halle und winkt den anderen Damen freundlich zu. Ein Diener nimmt den Mantel entgegen und ihren Hut. Dann streift sie ihr Kleid glatt, lächelt kurz ihr Spiegelbild an und folgt ihrer Mutter.
Als sie gemeinsam durch die hohe Doppeltür den Ballsaal betreten, verkündet eine laute Stimme:
„Baroness Anne Isabella Noel-Byron mit ihrer Tochter Miss Ada Augusta Noel-Byron.“
Einige der Umstehenden verbeugen sich ehrfürchtig und widmen sich dann wieder ihren Gesprächspartnern. Ada schaut sich um und ist von der schlichten Größe des Saals genauso beeindruckt wie von der prunkvollen Einrichtung. Sie sind spät dran, daher sind die meisten Geladenen bereits anwesend und es wird auch schon getanzt.
Es dauert nicht lange, bis ein junger Mann in einer schneidigen Uniform sich vor Ada verbeugt und ihr seine Hand reicht. Ada deutet ein Nicken an, zeigt ihm ein Lächeln, nimmt seine Hand und schreitet mit ihm in die Mitte des Raumes zum Tanz.
Ada liebt es zu tanzen, was sie von ihrer Mutter gelernt und worin sie bereits eine gewisse Fertigkeit erworben hat. Nachdem gefühlt mindestens die Hälfte der anwesenden jungen Männer mit ihr getanzt haben, lässt Ada sich erschöpft auf einem der Sofas nieder, die am Rand des Saals aufgestellt sind.
Auf der Suche nach ihrer Mutter schweift ihr Blick durch den Raum. Statt ihrer Mutter entdeckt sie ihre Freundin Sophia Frend in einer Nische vor einem der deckenhohen Fenster in ein Gespräch mit einem vornehmen älteren Herrn vertieft.
Als Sophia sie entdeckt, winkt sie Ada freundlich zu und gibt mit dem Kopf ein Zeichen, dass sie zu ihr kommen solle. Ada erhebt sich von dem Sofa und bewegt sich schwebend elegant durch den Saal.
„Darf ich vorstellen, das ist meine Freundin Ada, die Tochter des berühmten Lord Byron“, flötet Sophia.
Ada knickst vor dem Herrn und kann sich keinen Reim darauf machen, warum Sophia ihn ihr vorstellt.
„Und das ist der ebenso berühmte Mathematiker Charles Babbage“, ergänzt Sophia.
Ada ist sichtlich überrascht und zugleich hocherfreut, einen echten Mathematiker persönlich zu treffen. Neben der Musik ist die Mathematik Adas liebste Leidenschaft.
„Mister Babbage berichtet mir gerade von einer Maschine, die er gebaut hat und die wahrhaft wundersame Dinge zu vollbringen in der Lage sein soll“, führt Sophia aus.
Der Mann neben ihr nickt bestätigend und erläutert, dass die Maschine keineswegs Wunder vollbringt, sondern hochkomplizierte Berechnungen schnell und fehlerfrei durchführt.
Ada hat schon von Versuchen gehört, eine Rechenmaschine zu bauen, und ist sofort fasziniert von der Idee. Und auch der freundliche Herr hat es ihr gleich angetan. Er ist vornehm und elegant und vermittelt eine Gelehrsamkeit, wie Ada sie bislang selten bei Menschen angetroffen hat.
Auf Sophias Nachfrage erläutert er noch einmal die Idee und die Funktionsweise der Maschine und beendet seine Ausführungen mit einer freundlichen Einladung.
„Und diese Maschine gibt es nicht nur in meinem Kopf, sondern ich habe sie wirklich gebaut. Am kommenden Montag führe ich sie einer kleinen Gesellschaft öffentlich vor und es wäre mir eine Ehre, Sie beide dazu einladen zu dürfen.“
Ada stockt der Atem. Waren seine Ausführungen bereits über alle Maßen faszinierend, so ist die Aussicht, die Maschine mit eigenen Augen zu sehen, für sie voll und ganz überwältigend.
Ihre Freundin kennt sie gut genug und hat es bereits bemerkt. Und bevor Ada etwas sagen kann, hat Sophia sich höflich für die Einladung bedankt und auch gleich für sie beide zugesagt.
Ada hofft sehr, dass ihre Mutter es erlauben wird, und schaut sich nach ihr um, kann sie jedoch nirgends entdecken. Stattdessen nähert sich erneut ein junger Mann, der sie zum Tanz auffordert. Charles Babbage nickt ihr freundlich zu und bemerkt, dass er sich nun sowieso verabschieden müsse und sich freue, die Damen in zwei Tagen wieder zu treffen.
Bei ihrer Mutter bedarf es später noch einiger Überredungskunst und Sophias Zuspruch, aber schließlich willigt sie ein.
Am frühen Abend des folgenden Montags stehen Sophia, Ada und ihre Mutter dichtgedrängt in einer Traube von vielleicht hundert Menschen in einem kleinen Saal und starren auf einen großen Kasten, der (noch) von einem schwarzen Samtvorhang verdeckt wird.
Die Gesellschaft ist so exklusiv wie vornehm, besteht vorwiegend aus älteren Männern in maßgeschneiderten Anzügen und wenigen Ehefrauen in sehr eleganten Roben.
Einige von ihnen blicken ein wenig verschämt auf das Buffet, das in einem Nachbarraum für nachher aufgebaut ist und das scheinbar größeres Interesse hervorruft als die Kiste unter dem schwarzen Stoff.
Plötzlich verstummt das Gemurmel im Saal und Ada muss sich auf die Zehenspitzen stellen, um zu erkennen, was vorn vor sich geht. Ein elegant gekleideter Mann mittleren Alters mit gutmütigem Gesicht und prägnanter Nase hat soeben den Saal betreten. Er nickt freundlich in die Runde.
„Ist er das?“, flüstert Adas Mutter.
Die Angesprochene deutet ein Nicken an. „Das ist er höchstpersönlich, der berühmte Charles Babbage.“
Bevor Adas Mutter etwas erwidern kann, begrüßt Babbage die Anwesenden und beginnt eine kurze Rede, in der er hervorhebt, dass seine Gäste hier und heute wirklich etwas ganz und gar Einzigartiges erleben. Wie zur Bestätigung erscheinen rote Flecken an Adas Hals, wie eigentlich immer, wenn sie sehr aufgeregt ist. Gebannt und mit einem Glitzern in den Augen starrt sie auf die Black Magic Box, wie sie die Maschine vorhin spontan ganz für sich getauft hat.
Einige der Anwesenden wirken überaus neugierig und gespannt, anderen ist die Skepsis deutlich anzumerken.
Indes führt Charles aus, dass es vor wenigen Jahren noch gänzlich unvorstellbar war, an eine mechanische Rechenmaschine dieses Ausmaßes auch nur zu denken. Und heute ist er wirklich stolz, einen ausgereiften Prototypen seiner Differenzmaschine zu präsentieren.
Zeitgleich mit dem Ende seiner Rede entschwebt wie von Geisterhand der schwarze Samtvorhang und gibt den Blick frei auf eine silbern glänzende Maschine, die Ada an das feinmechanische Räderwerk eines dieser modernen Webstühle erinnert. Auf den zweiten Blick erkennt sie, dass sich hier nichts bewegt, sondern eine fast mystische Stille emittiert, die einen Augenblick später von dem losbrechenden Applaus gänzlich verschluckt wird.
In die klappernden Hände mischen sich Rufe der Begeisterung und Bekundungen des Erstaunens. Als sich der Trubel ein wenig gelegt hat, verkündet Babbage mit einem zugewandten Lächeln: „Jenen, die technische Fragen zu diesem Wunderwerk der Technik haben, stehe ich nun gern zur Verfügung.“
Während die meisten der Anwesenden zum Buffet schlendern und sich auf dem Weg dahin Sekt von einem Tablett nehmen, gesellen sich Sophia, Ada und ihre Mutter zu der Handvoll Personen, die sich um Babbage herum gruppiert haben und ihn mit Fragen löchern, die er allesamt ebenso kompetent wie höflich beantwortet.
So erklärt er den Neugierigen zunächst, was ihn überhaupt dazu gebracht hat, eine Rechenmaschine bauen zu wollen.
Schon seit Langem ist ihm die mangelnde Zuverlässigkeit numerischer Tabellen mathematischer Funktionen ein Ärgernis. Diese sind etwa für die Schiffsnavigation von zentraler, gar lebenswichtiger Bedeutung. Leider sind sie in der Praxis überaus fehlerhaft. Konkret wimmelt es insbesondere in den Logarithmentafeln nur so von Fehlern. Zwar gibt es mehrere Verlage, die solche veröffentlichen, jedoch finden sich überall dieselben Fehler, was deutlich belegt, dass die Verlage voneinander abschreiben, wie Babbage erbost ausführt.
Einige der Anwesenden schütteln empört die Köpfe, andere blicken verstohlen hinüber zum Buffet und hoffen wohl auf ein baldiges Ende der Ausführungen.
Zuvor berichtet Babbage jedoch von seiner Idee, mathematische Tabellen von einer Maschine berechnen zu lassen. Zum einen erhofft er sich dadurch eine deutliche Effizienzsteigerung gegenüber den händischen Berechnungen durch die wenigen Experten, die überhaupt dazu in der Lage sind. Zum anderen ist er davon überzeugt, dass eine Maschine vollständig fehlerfreie Tabellen erzeugen würde.
„Und den Beweis dafür erbringt nun meine neue Differenzmaschine“, beschließt er seine Ausführungen.
Sogleich begeben sich weitere Personen Richtung Buffet und bekommen nicht mehr mit, wie Sophia Babbage bittet, die Funktionsweise dieses Wunderwerks der Technik, wie sie die Maschine nennt, näher zu erläutern und sie vielleicht sogar vorzuführen.
Dem kommt der Angesprochene gern nach und so erklärt er den Verbliebenen die Idee hinter seiner Differenzmaschine, die sich die Gesetze der Mechanik geschickt zunutze macht.
Zur Illustration beginnt er einen kurzen Ausflug in die Geschichte. Die ersten mechanischen Rechenmaschinen, wie sie Wilhelm Schickard, Blaise Pascal oder Gottfried Wilhelm Leibniz gebaut haben, basierten auf der Idee mechanischer Zustände, die durch Walzen und miteinander verbundene Zahnräder repräsentiert wurden.
Auch seine Differenzmaschine nutzt zum Speichern und Addieren der Zahlen eine Konstruktion, die schon Pascal und Leibniz verwendet haben: Vertikale Stäbe, auf denen mehrere Scheiben mit einem Loch in der Mitte gestapelt sind und die mit einem Zahnrad um ihre Achse gedreht werden können. Konkret besitzt jedes der Zahnräder zehn Zähne und jede der Scheiben zehn Markierungen mit den Ziffern Null bis Neun an ihrem Rand. Dabei steht jede der Scheiben für eine Stelle in der Zahldarstellung, also die erste für die Ein-erstelle einer Zahl, die zweite für die Zehnerstelle, und so weiter.
Das gänzlich Neue an dieser Rechenmaschine ist jedoch, dass sie alle Berechnungen selbstständig durchführt. Wenn die Aufgabe eingestellt ist, muss man nur noch die kleine Kurbel an der Seite drehen. Zur Illustration seiner Aussage stellt er sogleich eine einfache Aufgabe an den dafür vorgesehen Scheiben ein. Dann wendet er sich freundlich ausgerechnet an Ada und bittet sie, die Kurbel zu drehen.
Ada ist erschrocken, zugleich jedoch auch hocherfreut darüber, dass er sich überhaupt an sie erinnert.
Mit einem Knicks wendet sie sich Babbage zu und schreitet dann vornehmen Schrittes zu der Maschine. Mit der gebotenen Vorsicht und in Sorge, die Kurbel könnte abbrechen oder sie der Maschine in anderer Weise Schaden zufügen, dreht sie so langsam und sanft, wie sie nur kann, an der Kurbel und wundert sich darüber, wie leichtgängig diese sich bewegt.
Nachdem die dafür vorgesehenen Walzen das korrekte Ergebnis der Berechnung anzeigen, sind die Anwesenden vollumfänglich beeindruckt, was sie durch Rufe der Begeisterung zum Ausdruck bringen.
Lediglich Ada ist noch nicht ganz überzeugt und hat eine Frage auf den Lippen. Zwar ist sie nicht scheu, dennoch durchaus eingeschüchtert von der Situation, vor allem da sie immer noch an der Maschine steht und die Blicke der verbliebenen Anwesenden auf sie gerichtet sind.
Nach Momenten inneren Ringens fasst sie sich ein Herz und fragt frei heraus: „Verstehe ich das richtig, der ganze Zauber dient nur dazu, Additionen von Zahlen schneller zu machen?“
Noch bevor sie den Satz zu Ende gesprochen hat, spürt sie, wie ihr die Röte ins Gesicht steigt und sie fürchtet, sich im Ton vergriffen zu haben.
Aber Babbage schenkt ihr ein freundliches, vielleicht ein klein wenig überhebliches Lächeln und setzt zu einer weiteren Erklärung an. Obwohl die Differenzmaschine eigentlich nur Additionen und umgekehrt Subtraktionen durchführen kann, ist es mit ihr dennoch möglich, komplizierte Funktionen wie Logarithmen zu berechnen.
„Seit unser verehrter und begnadeter Landsmann, der Mathematiker Brook Taylor, bereits Anfang des letzten Jahrhunderts die nach ihm benannten Taylor-reihen entdeckt hat, wissen wir, dass Exponentialfunktionen, Logarithmen wie auch die trigonometrischen Funktionen als sogenannte Potenzreihen darstellbar sind.“
Für einen Moment wird der Raum von Stille erfüllt und Ada bildet sich ein, die Denkgeräusche der Verbliebenen zu hören.
Auf die fragenden Gesichter der Umstehenden reagiert ausgerechnet Adas Mutter, indem sie erklärt, was Babbage eigentlich sagen will: „Damit lassen sich alle Funktionen, die uns interessieren, beliebig genau als Summen oder Differenzen berechnen.
Und die mögliche Genauigkeit können wir an der Anzahl der Walzen ablesen.“ Ein klein wenig theatralisch und sich ihrer Wirkung offenbar völlig bewusst, reckt sie ihren schlanken Hals ein Stück weit vor und ergänzt: „Und das sind sechs, wenn ich das richtig sehe. Sie rechnet also auf sechs Stellen hinter dem Komma genau.“
Babbage wirkt verblüfft und Ada ist einerseits peinlich berührt über ihre eigene Unwissenheit und andererseits stolz auf ihre Mutter, für die es völlig normal ist, solche Dinge zu wissen.
„Ganz genau“, bestätigt Babbage. „Und damit wird nicht nur die Berechnung von Logarithmentafeln sehr viel schneller. Ganz andere Berechnungen werden dadurch überhaupt erst möglich, denn nach Taylor ist sogar jede nur denkbare glatte4 Funktion lokal durch eine Potenzreihe darstellbar!“
Wieder ist es Adas Mutter, die den Gedanken in etwas Verständliches übersetzt: „Damit sind so ziemlich alle Funktionen, denen man überhaupt seine Aufmerksamkeit widmen sollte, mit dieser Denkmaschine berechenbar.“
Und so geht es noch eine ganze Weile weiter. Babbage durchstreift mit Verve und Begeisterung mathematische Welten und erweist sich als ebenso sachkundig wie leidenschaftlich. Sophia und Adas Mutter hängen an seinen Lippen und Ada gibt sich redlich Mühe, seinen Gedankengängen und Dialogen mit ihrer Mutter zu folgen.
Irgendwann ist dann Sophia, wie auch alle anderen, zum Buffet verschwunden. Nur noch zu dritt stehen sie vor der Differenzmaschine und Ada ist ganz und gar eingenommen von der schlichten Schönheit und Eleganz dieses Wunderwerks der Technik.
Adas Mutter und Babbage sind immer noch in ihre Diskussion vertieft. Inzwischen geht es um die Unzulänglichkeiten, die die Differenzmaschine trotz allem aufweist. Babbage schaut sich um, offenbar um sich zu versichern, dass niemand anderes ihn hört, und erläutert, dass man die notwendigen Additionen jeweils manuell einstellen, das Ergebnis ablesen und es dann in einer Tabelle eintragen muss. Das ist nicht nur mühsam, sondern auch eine Quelle für Übertragungsfehler.
Nach kurzem Zögern verrät Babbage, dass er in Gedanken bereits an einer neuen Maschine arbeitet, die genau diese Probleme löst, da man ihr eine ganze Serie von Berechnungen vorgeben kann, die dann hintereinander durchgeführt und die Ergebnisse direkt von der Maschine in eine Tabelle geschrieben werden.
Eigentlich verfügt Ada über eine lebhafte Fantasie. Die hätte sie von ihrem Vater, der ein Dichter war, wie ihre Mutter ihr häufig bestätigt. Aber wie eine Maschine ihre Berechnungsergebnisse selbstständig in eine Tabelle schreibt, das kann sie sich nicht einmal ansatzweise vorstellen.
Babbage erläutert gern, wie die Maschine, die er die analytische Maschine nennt, funktionieren könnte. Aber das alles bekommt Ada fast gar nicht mehr mit, denn inzwischen ist sie vollumfänglich versunken in ihren eigenen Gedanken, die sich mehr und mehr zu Visionen verdichten.
Inzwischen glaubt sie verstanden zu haben, welches Potenzial in dieser atemberaubenden Technologie liegt.
Spielerisch malt sie sich aus, was mechanische Maschinen noch alles leisten könnten. Wie ihre Mutter ist nun auch Ada vollumfänglich begeistert und selbst mächtig überrascht über ihre Träumereien und den fast hypnotischen Zustand, der sie auch in den kommenden Tagen gefangen halten wird.
4. Falls es jemanden interessiert: Eine glatte Funktion ist eine, die unendlich oft differenzierbar ist und deren Graph deshalb keinerlei Ecken oder Spitzen aufweist, also irgendwie glatt aussieht. Aber das ist für diese Geschichte nicht weiter wichtig.
KAPITEL 3
Pärchenabend
NYC, Dakota Building – Gegenwart, Februar
„Gut, dass du endlich da bist“, ruft Peggy aus der Küche, als sie Steve durch die Haustür kommen hört.
Einen Augenblick später steht er neben ihr, nimmt sie in die Arme und gibt ihr einen Kuss. Peggy löst sich von ihm, greift nach hinten und wirft ihm seine Schürze zu.
„Sue und Reed müssen gleich hier sein. Kümmere du dich bitte um die Töpfe, ich muss mich noch umziehen“, ruft sie im Rausgehen. „Musst nur umrühren, dass nichts anbrennt“, ergänzt sie und ist verschwunden.
Es duftet angenehm. Steve bindet sich die Schürze um, rührt lustlos mit dem Holzlöffel in den Töpfen herum und freut sich auf den Abend.
Sie treffen sich hin und wieder zu viert. Mit Sue, Peggys bester Freundin seit Studienzeiten, und ihrem Mann Reed, einem netten Kerl, den sie vor einigen Jahren kennengelernt hat, haben sie meist viel Spaß.
Peggy ist im Bad und hübscht sich ein wenig auf. Sie freut sich auf ihre Freundin. Es ist schon wieder eine Weile her, dass sie sich getroffen haben, und hier in diesem Appartement war Sue auch noch nicht. Zwar sky-pen sie regelmäßig miteinander, aber so wirklich weiß Peggy nicht, wie es ihrer Freundin geht. Beim letzten Mal hatte sie unverkennbar Ringe unter den Augen und wirkte gestresst oder ein wenig krank, vielleicht war sie aber auch nur überarbeitet.
In ihre Gedanken hinein klingelt es. Steve ist schon an der Tür und bittet die Gäste herein.
Peggy schließt Sue in die Arme und es fühlt sich gut an. Danach begrüßt sie Reed, nimmt beiden ihre Mäntel ab und führt sie ins Esszimmer.
Sue läuft vorbei an dem festlich gedeckten Tisch und tritt an die bodentiefe Panoramascheibe. Reed folgt ihr und umfasst von hinten ihre Taille. Peggy und Steve tun es ihnen nach und für eine Weile stehen sie schweigend beieinander und lassen ihre Blicke schweifen über den Central Park und hinüber zur Upper East Side. Peggy liebt diesen Blick, vor allem früh morgens, wenn die Sonne sich sanft über der Skyline erhebt.
„Das ist unglaublich.“ Sue findet ihre Sprache wieder.
„Wirklich beeindruckend“, ergänzt Reed.
Es ist erst ein halbes Jahr her, dass sie dieses Appartement in einer oberen Etage des Dakota Buildings gekauft haben, und nach wie vor können sie sich nicht sattsehen an dem Ausblick vom Esszimmer wie auch von ihrem Schlafzimmer.
Später sitzen sie zu viert an dem großen Holztisch und genießen den Ausblick sowie das fabelhafte Menü, das Peggy und Steve gemeinsam gezaubert haben. Sue lobt das Essen mit wohlklingenden Worten, worüber Peggy aufrichtig erfreut ist, weil alle wissen, dass Sue eine überragende, fast professionelle Köchin ist.
Während des Essens sprechen sie über allerlei Neuigkeiten und die Dinge, mit denen sie sich gerade beschäftigen.
Reed berichtet von seinem Forschungssemester und freut sich über die freie Zeit, die er nun genießt. Steve ist neidisch, weil es an den privaten Universitäten die schöne Tradition der Forschungssemester gar nicht gibt.
Sue kann darüber nur lachen. „Ihr Lappen, ich würde mich schon über einen freien Tag freuen.“
„Selbst schuld, auch dir hätte die akademische Welt weit offen gestanden, aber du musstest dich ja für den Mammon entscheiden“, zieht Peggy ihre Freundin auf.
Diese nimmt es ihr nicht übel und erwidert lachend: „Witzig, wer wohnt denn im Dakota-Building direkt am Central Park? Bei uns hat es nur für ein kleines Häuschen in New Jersey gereicht.“
So geht es noch eine Weile weiter und Peggy fühlt sich wohl in dieser Runde. Sue, die eigentlich Susan heißt, ist ihre beste Freundin, seit sie sich vor vielen Jahren zu Beginn des ersten Semesters in Cambridge am MIT zum ersten Mal trafen. Sue war ihr sofort aufgefallen, als sie am ersten Tag deutlich zu spät in den Hörsaal gekommen und vornehm die Treppe hinunter geschritten war und sich dann ganz selbstverständlich in die erste Reihe gesetzt hatte.
Peggy war sofort beeindruckt von der eleganten Erscheinung und dem selbstbewussten Auftreten dieser jungen Frau.
Später trafen sie sich in einer Mathe-Übung, sprachen über irgendetwas, gingen zusammen einen Kaffee trinken und wurden Freundinnen. Schnell waren sie unzertrennlich, studierten und feierten gemeinsam, wurden ein verschworenes Team.
Zu allen Veranstaltungen und Festen kamen sie stets gemeinsam. Nicht selten wurde irgendwann auf den Partys „Peggy Sue“ von Buddy Holly gespielt, worauf sie beide miteinander tanzten.
Nach dem Studium trennten sich ihre Wege. Sue ging ins Silicon Valley, wechselte dort von einem Startup zum anderen und landete irgendwann im höheren Management eines der großen Tech Unternehmen.
Peggy hingegen entschied sich dafür, an der Uni zu bleiben, promovierte und bekam danach eine Stelle als Post-Doc. Dann traf sie Steve auf einem Empfang am MIT, an dem er bereits eine Professur für Mathematik hatte.
Noch vor ihrer Heirat gingen sie nach New York. Steve wechselte an die New York University und Peggy wurde Professorin für „Data Science“ an der Columbia University. Und nun sind sie hier in Manhattan und finden es wunderbar.
Vor dem Nachtisch holt Peggy Wein und Maracujasaft aus der Küche. Als sie wieder am Tisch sitzt, fragt Sue: „Und wie läuft es an der Uni?“
„Eigentlich so wie immer“, erklärt Peggy.
„Aber im Sommer plane ich eine Summerschool zur künstlichen Intelligenz. Das wird eine größere Sache, eine Art KI-Festival.“
Sue wirkt begeistert. „Du meinst, so etwas wie damals die Darthmouth Summerschool on Artificial Intelligence?“ 5
„Ja, nur sehr viel größer und diesmal auch mit Frauen“, führt Peggy lachend aus.
„Machst du das alles allein?“, fragt Reed.
„Nein, meine Assistentin Elizabeth unterstützt mich und wir werden noch zwei oder drei Studentinnen nur dafür einstellen, die bei der Organisation helfen und auch eigene Vorträge halten sollen“, antwortet Peggy.
„Und was gibst du für Kurse?“, fragt Sue weiter.
Peggy zuckt mit den Schultern und berichtet von ihrem Seminar über die Geschichte der Informatik und der künstlichen Intelligenz aus Sicht beteiligter Frauen.
„Gab es denn da so viele?“, fragt Reed unbefangen.
„Mehr, als man so meint. Einige von ihnen kennt man noch, wie Ada Lovelace, Grace Hopper oder Klara Dán, um nur die bekanntesten zu nennen. Viele von ihnen sind jedoch heute vergessen. Aber meine Studentinnen recherchieren fleißig und manchmal ist es erstaunlich, was sie herausfinden“, führt Peggy aus.
„Aber gab es nicht viel mehr Männer, die hier geforscht haben?“, wendet Reed ein.
„Natürlich, das bestreitet ja auch niemand. Forschung, gerade in Naturwissenschaft und Technik, war immer schon und ist immer noch in der Hand der Männer. Und ohne Charles Babbage wäre Ada Lovelace heute, wenn überhaupt, nur als die Tochter des Dichters Lord Byron bekannt. Dennoch ist es erstaunlich, was Frauen in der Forschung geleistet haben und heute noch leisten.“
„Apropos, woran forschst du denn gerade?“, wechselt Sue das Thema.
„Zurzeit arbeite ich an verschiedenen Methoden des maschinellen Lernens“, führt Peggy aus. „Und das gemeinsam mit Steve.“
Zur Bestätigung nickt Steve. Bevor er das jedoch vertiefen kann, fragt Reed, was es mit dem maschinellen Lernen auf sich hat. Als Philosoph ist er der Einzige am Tisch ohne technischen Hintergrund.
Gern erklärt Peggy es ihm. „Wie der Name andeutet, geht es darum, Maschinen das Lernen beizubringen. Aber eigentlich ist das zu hochtrabend, denn genau genommen geht es um eine andere Art der Programmierung.“
Sue nimmt den Faden auf. „In der klassischen Programmierung, wie ich sie noch gelernt habe, geht es darum, ein Rechenverfahren in eine Programmiersprache zu übersetzen und daraus Software zu machen. Das bedeutet, man muss vorher genau wissen, was man berechnen möchte, man benötigt eine Formel oder mehrere oder einen Algorithmus, der eine Abfolge von Formeln berechnet.“
„Seit den allerersten Programmen, etwa von Ada Lovelace“, führt Peggy aus und zeigt Reed ein breites Grinsen, „geht man genau so vor. Wenn du in deinem Alltag mit irgendeiner Software zu tun hast, dann ist sie oft so, also klassisch programmiert.“
„Und das funktioniert seit fast achtzig Jahren erstaunlich gut und immer besser“, führt Steve den Gedanken weiter. „Bereits 1997 schlug die Software Deep Blue von IBM den damals amtierenden Schachweltmeister Garri Kasparov. Und Deep Blue war ganz klassisch programmiert.“
„Deep Blue hatte nichts mit künstlicher Intelligenz zu tun. Seine beeindruckende Spielstärke basierte vielmehr auf einer zuvor nicht gekannten Rechenleistung. Die Software war in der Lage, mehr als einhundert Millionen Schachstellungen in einer Sekunde zu berechnen und auf Basis einer Bewertungsfunktion zu beurteilen“, erklärt Sue.
„Seitdem sind Schachcomputer den Menschen deutlich überlegen“, beendet Steve das Beispiel und ergänzt: „Danach hat man sich anderen Spielen zugewandt und ähnliche Erfolge erzielt.“
„Manche Spiele jedoch entziehen sich der Macht der Maschine und konnten nicht geknackt werden“, nimmt Sue den Faden auf. „Zum Beispiel das bekannte Brettspiel Go, das im antiken China seinen Ursprung hat, ist ungleich komplexer als die allermeisten Spiele. Auf einem 19x19-Brett gibt es ungeheuer viel mehr mögliche Züge als beim Schach. Zudem sind keine Methoden bekannt, eine Spielstellung zu bewerten. Es fehlt uns also eine Funktion, die wir berechnen können, um daraus einen erfolgsversprechenden nächsten Zug abzuleiten. Damit entzieht sich Go einem algorithmischen Vorgehen und damit der klassischen Programmierung.“
„Und hier kommt das maschinelle Lernen ins Spiel“, übernimmt Peggy.
„Es gibt viele verschiedene Verfahren des maschinellen Lernens, daher teilt man sie in verschiedene Kategorien ein. Die größten und wichtigsten drei Kategorien nennt man überwachtes Lernen, unüberwachtes Lernen und bestärkendes Lernen.6 Bei den Verfahren der ersten beiden Kategorien, also dem überwachten und unüberwachten Lernen, geht man grundlegend anders vor als in der klassischen Programmierung. Anstatt eine Funktion zu berechnen oder einen vorab bekannten Algorithmus abzuarbeiten, verwendet man ein sogenanntes Lernverfahren und füttert dieses mit meist sehr vielen Datensätzen. Die Idee ist nun, dass das Lernverfahren die Informationen in den Daten extrahiert und aus den Daten lernt.“
„Das klingt vielleicht irgendwie magisch, ist aber reine Mathematik“, führt Steve fröhlich aus.
„Und das klappt in der Praxis?“ Reed gibt sich skeptisch.
„Nicht immer, aber erstaunlich oft“, antwortet Peggy. „Tatsächlich basieren viele Anwendungen in unserem Alltag auf Verfahren des maschinellen Lernens. Etwa in der Spracherkennung, wenn du mit Siri oder Alexa sprichst. Aber auch in der Texterkennung, wie sie in modernen Übersetzungsprogrammen verwendet wird.“ Peggy trinkt einen Schluck Wein, bevor sie weiterspricht. „Aber zurück zu Go. Tatsächlich sind alle Versuche gescheitert, einen professionellen menschlichen Go-Spieler mit einem Go-Programm systematisch zu schlagen – bis zum Jahr 2016. Da hat die britische Firma DeepMind …“
„… eine Software, genannt AlphaGo, gegen Lee Sedol, einen der weltbesten Go-Spieler antreten lassen. AlphaGo basiert im Wesentlichen auf einem bewährten Verfahren des maschinellen Lernens, dem sogenann-ten Deep Learning7, das in die Kategorie des überwachten Lernens fällt. Im Vorfeld hatte man das Programm mit tausenden von Go-Partien gefüttert und es hat daraus gelernt, sehr gut Go zu spielen“, führt Peggy aus und macht eine Kunstpause.
„Und, wie ist es ausgegangen?“, fragt Reed neugierig.
Die anderen schauen Peggy an und überlassen es ihr, zu antworten.
„AlphaGo hat vier zu eins gegen Lee Sedol gewonnen!“
Reed scheint beeindruckt und das sagt er auch.
„Aber es kommt noch besser“, entgegnet Steve. „Bereits im Jahr darauf präsentierte DeepMind den Nachfolger AlphaGo Zero. Zero steht dafür, dass das Lernverfahren nicht mit tausenden bekannten Go-Partien gefüttert wurde, da es auf einem Verfahren beruht, das zur Kategorie des bestärkenden Lernens gehört. Stattdessen hat AlphaGo Zero einfach drei Tage lang gegen sich selbst gespielt.“
„Das ist ein wichtiger Unterschied zwischen beiden Programmen, denn es bedeutet, dass AlphaGo Zero keine Daten über vergangene Partien benötigt, sondern die Daten quasi selbst erzeugt“, ergänzt Sue.
„Und dann hat man AlphaGo einhundert Partien gegen AlphaGo Zero spielen lassen“, erklärt Peggy.
„Und rate mal, wie es ausgegangen ist.“
Reed wiegt den Kopf hin und her, als würde er nachdenken, und schüttelt ihn dann.
„Einhundert zu Null für AlphaGo Zero!“, ruft Peggy aus. „Darauf sollten wir anstoßen.“
Alle erheben sich von den Stühlen und lassen die Gläser klirren. Als sie wieder sitzen, liegt für einen Augenblick eine mystische Stille über der Szenerie. Schließlich ist es Reed, der das Schweigen durchbricht.
„Okay Leute, das ist ja alles wirklich überaus beeindruckend. Aber hat das auch irgendeinen Sinn, außer die armen Go-Profis arbeitslos zu machen?“