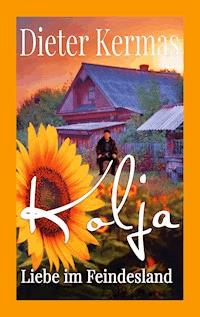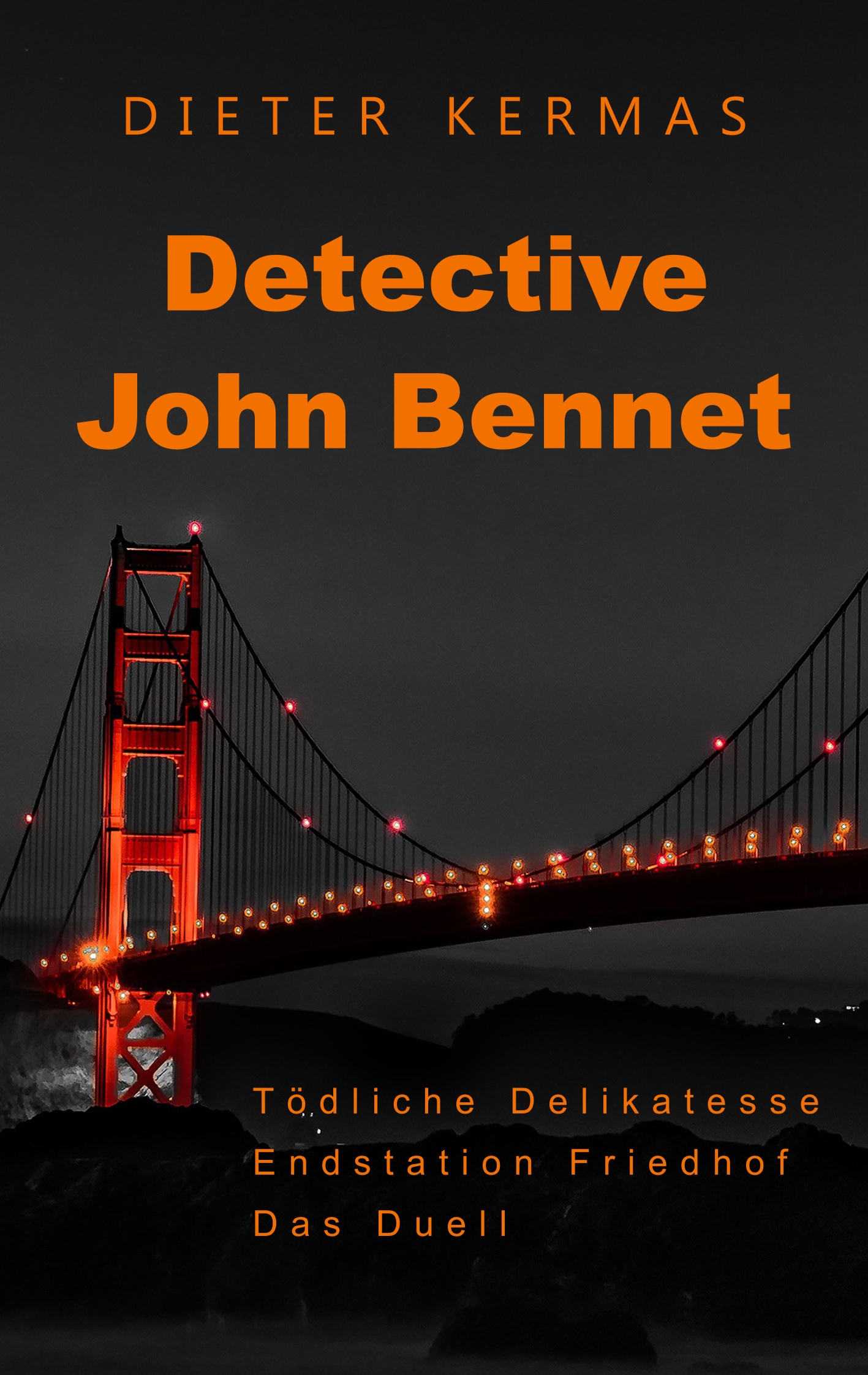Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Poesie und Drama
- Sprache: Deutsch
Ein Aal legt den Verkehr lahm, ein Häuptling fällt vom Baum, ein Troll sinniert über die Zeit, zwei Berliner Steppkes erleben die Nachkriegszeit, ich werde in Moskau interniert, ein Igel sinnt auf Rache, ein UFO landet in Bayern, ein Schneemann verliebt sich, ein Mörder schlägt zu, ein Fernsehkoch ver-wirrt mit Küchenlatein, ein Buchstabe wehrt sich, ein Eisblock rettet Leben, Knochen erzählen, ein Bär tanzt… Literarische Gedankenwelten zum Miterleben, Nachdenken oder Schmunzeln, ob in Versform oder als Erzählung. Erdachtes und Erlebtes wurden Blatt für Blatt über Jahre hinweg gesammelt und in dieser Anthologie festgehalten.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 353
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vorwort
Bald, recht bald werden die Erinnerungen verblassen und vergehen.
Das war der Grund, jetzt, und nicht eine Stunde später, meine Geschichten und Gedichte niederzuschreiben.
Der Sinn und Zweck ist erreicht, wenn sie zum Lächeln oder zum Nachdenken verführen.
Inhaltsverzeichnis
Der Aal von der Kaisereiche
Erdnüsse
Pech
Nur
Schmetterling und Krokodil
Der Knopf
Häuptling fliegender Bär
Gorgonzola
Der Traum
Ostern
AFN-Berlin und der Aufsatz
Schulzeit
Hundstage
Evolution
Seltsame Tomaten
Zwiegespräch
Mondschein
Der Einkauf
Ehrenrettung
Die Mine
Frühlingserwachen
Leseerfahrungen
Die Pilzsuche
Mein guter Freund
Es tippt
Auf der Bergwiese
Der Korkkeller
Heckenrose
Ein Gedicht
Das Nagetier
Die Beilage
Honigbrötchen
Als ich im Gefängnis war
Der Bericht
Der kalte Keller
Et war doch erst jestern
Der Zauberkasten
Omas Rache
Das Frühstück
Jagdbeute
Die Einladung
Nur ‘ne Quiche
Altenmorgen
Musikalisch
Schatten der Mauer
Das Geburtstagsgeschenk
Mein erstes Du
Nebelhörner
Die Flieje
Arrest
Der Fernsehkoch
Gunter
Die Kartenfälscher
Die Reise nach Goa
Der Verlust
Der Hochsitz
Metzgerei Eberhard Säulein
Mordlust
Das Wunder von Depplingen
Das Notizbuch
Das Vau
Der Nebel
Herbstwind
Der erste Tag
Im Jobcenter
Boldi der Netzgeist
Novembersonne
Der Stierkampf
Ein Mordsigel
Lucas
Fliehe
Der blaue Besucher
Ein großer Schritt
Antonios
Der Schneemann
Zu spät
Ein Geschenk des Himmels
Rosie die Leseratte
Tanze alter Bär, tanze
Aal von der Kaisereiche
Der Tag, an dem Vater und ich wieder einmal die Küche mit frischem Fisch zu versorgen gedachten, verlief anders als geplant. Dutzende Regenwürmer waren erst gebadet und dann vom Haken abgefressen worden. Selbst Hände voll gekochter Kartoffeln lockten kein beiß- und hakenwilliges Fischlein herbei. Wir traten den Heimweg an und überlegten bereits, wie wir unsere leeren Hände erklären könnten.
Ausreden wurden uns von Mutter abgenommen, kaum dass wir die Wohnung betreten hatten. »Nichts gefangen, was?«, begrüßte sie uns im Korridor. »Das sieht man euch schon von Weitem an!« Wir nickten leicht betreten. Ein gut ausgedachtes Anglerlatein würde hier auch nichts nützen.
»Gut«, entschied Mutter, »dann gehe ich eben morgen zu Ehorn und hole einen Aal.«
Ehorn, das war das Fischgeschäft an der Kaisereiche, von uns aus gleich hinter der Kirchstraße, der heutigen Schmiljanstraße, das zweite Haus auf der rechten Seite. Schon seit längerer Zeit hatte Vater von ›Aal grün‹ mit Salzkartoffeln und Gurkensalat geträumt. Am nächsten Morgen, einem Freitag, zog Mutter los, um den Aal zu kaufen. Vater rief ihr nach, dass sie ihn bitte lebend bringen sollte. Ehe er in den Kochtopf wanderte, durfte er noch eine oder zwei Stunden in der Badewanne sein Leben fristen. Ich wollte mitgehen und holte aus der Küche das Einkaufsnetz.
Beim Fischladen angekommen, suchte sich Mutter ein Prachtexemplar von Aal aus. Der Fischhändler wickelte das sich wehrende Tier ordentlich in Zeitungspapier ein und legte es in das aufgehaltene Einkaufsnetz. Vor unserem Rückweg wollte Mutter auf die andere Straßenseite, da, wo die Kaisereiche steht. Gerade überschritten wir die Gleise der Straßenbahn, als Mutter einen spitzen Schrei ausstieß. Ich zuckte zusammen.
Der nasse, quicklebendige Aal hatte das Zeitungspapier aufgeweicht und war durch die Maschen des Einkaufsnetzes geflüchtet. Nun schlängelte er sich behände über das Pflaster. Es gelang weder Mutter noch mir, den glitschigen, sich windenden Körper festzuhalten. Die Situation wurde noch kritischer, weil er inzwischen in die U-förmigen Schienen der Straßenbahn gefallen und in dieser Rinne noch schlechter zu fassen war. Eine Straßenbahn näherte sich dem Übergang. Mutter stellte sich mit ausgebreiteten Armen auf das Gleis, um unsere Mahlzeit mit allen Mitteln zu verteidigen.
Nun war auch der Verkehrspolizist, der 1948 nur wenige Autos einzuweisen hatte, auf uns aufmerksam geworden. Die Straßenbahn verlangsamte nur unwesentlich das Tempo, und es war abzusehen, dass es keinen ›Aal grün‹, sondern in wenigen Augenblicken ›Aalmatsch‹ geben würde.
Der Polizist verließ seinen Posten und brachte damit den Verkehr zum Stocken. Er hatte die Sachlage erkannt, stellte sich vor Mutter auf das Gleis und bedeutete dem Fahrer der Straßenbahn, sofort anzuhalten. Nun versperrte auch noch die Tram die Überfahrt, und das Verkehrschaos nahm zu. Der Fahrer stieg aus. »Wat soll denn det, ick muss meinen Fahrplan einhalten, und eenen Unfall seh ick ooch nich.«
Mutter zeigte nur hilflos auf den bereits wieder ein Stück weiter gewanderten Aal.
»Na, wenn det allet is, det ham wa jleich«, beruhigte der Straßenbahnfahrer sie. Er lief ein Stück zurück, wo Ligusterhecken die Straßenbahntrasse säumten, griff mit beiden Händen in den Sand, kam zurück, packte den Aal, der nun keine Chance mehr hatte, ihm aus den Fingern zu rutschen, und wickelte ihn wieder in die Zeitungen ein. Langsam verliefen sich die Schaulustigen, die die ganze Aktion mit hilfreichen Ratschlägen oder schadenfrohen Kommentaren begleitet hatten. Wir bedankten uns herzlich bei unserem Aalfänger und dem Verkehrspolizisten und eilten nach Hause, immer mit einem Blick auf den eingewickelten Aal.
Nachdem wir Vater die Geschichte erzählt hatten, kam das Tier nicht mehr in den Genuss, sich in der Badewanne zu aalen. Um weitere Fluchten zu verhindern, steckte ihn mein Vater umgehend in den Kochtopf. Dieser Aal schmeckte uns ganz besonders gut.
Erdnüsse
Es war im Jahr 1947, als ich zum ersten Mal hörte, dass ein Zirkus in Berlin gastierte. Da wollte ich unbedingt hin. Vater wurde so lange bekniet, bis er einwilligte, mich zu begleiten.
An der Kasse kaufte er dann zu meiner großen Freude Karten für die Loge in der ersten Reihe. So sollte ich alles aus nächster Nähe sehen können. Die Karten berechtigten auch zur Besichtigung der Löwen und der anderen Tiere, die in Käfigwagen untergebracht waren.
In der Nähe des Eingangs konnte man verschiedene Sorten von Futter kaufen, um es dann später bei der Besichtigung an die Tiere zu verfüttern. Vater ließ sich eine Tüte mit Erdnüssen geben. Sie waren noch mit Schalen und ungeröstet. Ich konnte es kaum erwarten, dass die Vorstellung begann.
Nach heutigen Maßstäben war das Programm recht bescheiden. Artisten auf dem Seil, Hundedressur, Pferdedressur, Clowns und Jongleurnummern reihten sich aneinander. Der Geruch der Sägespäne, gemischt mit Pferdeschweiß, die laute Musik, die begeistert klatschenden Zuschauer, die ganze Atmosphäre - alles zusammen zog mich in seinen Bann. Auch als ich durch die vorbeigaloppierenden Pferde mit Sägespänen überschüttet wurde, tat dies meiner Freude keinen Abbruch.
Dann trat der Zirkusdirektor persönlich in das Rund der Manege und kündigte als einen der Höhepunkte die Elefantennummer an. Ein Tusch war das Zeichen, der Vorhang neben der Kapelle wurde zur Seite gezogen, und der erste graue Riese betrat mit gemessenem Schritt die Arena. Mit buntem, glitzerndem Kopfschmuck versehen, trotteten drei der Giganten herein. Nun mussten sie zeigen, was sie gelernt hatten. Sie stiegen auf kleine runde Gestelle, hoben abwechselnd ihre Beine auf Kommando, setzten sich auf die Hinterbeine, machten Männchen und bauten eine Pyramide.
Atemlose Stille herrschte im Zelt, als der Dompteur sich auf den Boden legte und einer der Elefanten den Fuß bis dicht auf den Kopf des Mannes senkte. Tosender Beifall. Nun durften die Elefanten, mit ihren Vorderbeinen auf dem Holzrand der Manege laufend, herumgehen und sich von den Zuschauern in den ersten Reihen Belohnungen abholen. Sie bekamen Brot, Äpfel und ähnliche Leckereien.
Als sich der erste Elefant dicht vor uns aufbaute, wusste ich vor Aufregung nicht, was ich machen sollte. Vater raunte mir zu: »Gib ihm die Erdnüsse!« Ach ja, die Tüte hatte ich fast vergessen. Ich öffnete sie und hielt sie dem Rüssel entgegen. Schwupp, hatte der Elefant die ganze Tüte gepackt und wollte sie mir aus der Hand ziehen. Damit war ich nun gar nicht einverstanden. So zog ich sie ihm wieder aus dem Rüssel, und damit er sie mir nicht erneut wegnehmen konnte, versteckte ich sie hinter meinem Rücken.
Der graue Bursche sah mich mit seinen kleinen schwarzbraunen Augen listig an und war nicht gewillt, seinen Leckerbissen aufzugeben. Sein Rüssel folgte der Tüte bis hinter meinen Rücken. Dummerweise nahm ich die Tüte mit der anderen Hand hinter dem Rücken hervor, wobei der Elefantenrüssel, der Tüte folgend, sich nun wie eine Riesenschlange um meinen Körper legte. Ehe wir die Situation richtig begriffen hatten, hob mich der Elefant hoch und ließ mich wie eine Fliege in der Luft zappeln. Die Zuschauer applaudierten.
Vater zog an meinen Beinen, aber das stellte sich als wirkungslos heraus. Der Dompteur sah meine Angst, hatte nun endlich Mitleid mit mir und rief dem Tier etwas zu. Daraufhin setzte mich der Elefant behutsam wieder zurück auf meinen Platz. Die Erdnüsse lagen verstreut auf dem Boden, und in der Hand hielt ich immer noch krampfhaft den Rest der zerrissenen und angesabberten Tüte. Die Elefanten setzten ihre Bettelrunde fort, während ich sie von dieser Minute an nicht mehr zu meinen Lieblingstieren zählte.
Pech
Ein alter Aal, recht fett und grau, fand bisher leider keine Frau. Doch Amors Pfeil traf ihn dann auch. Nun leibt er einen Gartenschlauch. Sein Glück war kurz, welch Jammer, er hängt jetzt in der Räucherkammer.
Nur
Es sieht so unscheinbar, so nichtssagend aus. Doch es ist ein gefährliches Wort. Als Kind war es harmlos.
Stellte Oma fest, dass die Sahneverzierungen an der Torte angeknabbert waren und ich mit gesenktem Kopf beichtete:
»Ich hab ja nur ein bisschen genascht«, so gab es eine kleine Ermahnung.
Als ich etwas älter war und mit dem Stein eine Scheibe einwarf, wurde meine Verteidigung:
»Ich habe ihn doch nur über die Mauer werfen wollen«, bereits mit Stubenarrest und Taschengeldentzug geahndet.
Wurde ich in der Schule beim Abschreiben ertappt und meinte:
»Ich habe doch nur den einen Satz abgeschrieben«, gab es eine schlechte Zensur und eine ernste Ermahnung.
Doch das »nur« hatte sich in meinem Gehirn festgesetzt und mit ihm versuchte ich, weiterhin unangenehme Situationen zu entschärfen.
Im Beruf dient es oft zur Abschwächung eigener Fehler. Als die neue Brücke bei der Einweihung in den Fluss fiel und ich mich als Statiker entschuldigte:
»Ich habe nur eine falsche Formel erwischt«, blieb mir nichts anderes übrig, als mir einen neuen Job zu suchen.
Mein Finanzamt war äußerst verstimmt, als ich die Nebeneinkünfte nur vergessen hatte anzugeben.
Meine Entschuldigung nach dem Seitensprung
»Es war ja nur ein Mal«, kam überhaupt nicht gut an.
Als ich als Soldat nach verlorenem Krieg vor dem Militärgericht stand und mich versuchte herauszureden, dass ich Geiseln nur auf Befehl erschossen habe, ging das das voll ins Auge.
Stehe ich eines Tages vor Petrus und wenn er spricht:
»Hier dürfen alle rein, nur Du nicht«, dann weiß ich, dass ich das Wort »nur« im Leben zu oft verwendet habe.
Schmetterling und Krokodil
Wie vereinbart stehe ich vor dem Haus Wielandstraße 43. Endlich habe ich Ferien und kann mit meinem Freund Wolfgang zur Fangexpedition aufbrechen. Das Schmetterlingsnetz, von meiner Mutter aus einer alten Gardine genäht, habe ich mit einem Haselnussstock ergänzt. Heute wollen wir zum Grunewaldsee fahren und Schmetterlinge fangen. Bereits im Alter von fünf Jahren ging ich dieser Leidenschaft nach und habe mir etliches Wissen angelesen und praktisch angeeignet.
Ich überlege mir gerade, ob es vielleicht günstiger wäre, nach Lübars zu fahren, weil dort die blütenreichen Wiesen mehr Jagderfolg versprechen, da geht die Haustür auf, und ein älterer Mann kommt auf mich zu.
Vom Sehen kenne ich ihn schon lange. Früher war er sicher recht groß, aber nun hat ihn das Alter gebeugt. Sein scharf geschnittenes Gesicht ziert ein kleiner Kinnbart, und sein Kopf wird von einem grauen, lockigen Haarkranz umrahmt. Er mustert mich forschend mit blauen Augen durch seine Nickelbrille, zeigt auf mein Fanggerät und sagt: »Na, dann wünsche ich dir viel Erfolg bei der Jagd«, und fügt hinzu: »Wenn du dich für Schmetterlinge interessierst, dann kannst du mich besuchen. Ich habe eine umfangreiche Sammlung.«
Da kommt Wolfgang aus der Tür, ich nicke dem Mann kurz zu und verspreche zu kommen. »Hat der wirklich eine Schmetterlingssammlung? «, frage ich meinen Freund, als der Mann die Treppe hinauf verschwunden ist. »Hast du die schon mal gesehen? Wie heißt er, und in welcher Etage wohnt er? «
»Nun halt mal die Luft an«, unterbricht mich Wolfgang. »Sein Name ist Fritsche, und mein Bruder war schon in der Wohnung im Zweiten. Er kam ganz begeistert zurück und erzählte von tausend Käfern und Schmetterlingen, die er gesehen hat.«
Das muss ich mir unbedingt ansehen, denke ich und plane, Herrn Fritsche bereits am nächsten Tag zu besuchen.
Unsere Fangexpedition verläuft, wie bereits geahnt, nicht sehr erfolgreich. Ein Distelfalter, ein großes Ochsenauge und ein kleiner Fuchs hauchen ihre Leben im Äther des Marmeladenglases aus. Nun müssen sie auf dem Spannbrett, fachgerecht ausgebreitet, trocknen und kommen danach in den Schmetterlingskasten.
Auf dem Rückweg, wir schieben unsere Räder mühsam durch den tiefen märkischen Sand, entdecke ich am Stamm einer Linde die ausgewachsene Raupe eines Lindenschwärmers. Das entschädigt mich für die magere Ausbeute. Für lebende Insekten habe ich stets eine kleine Pappschachtel dabei. Mit einigen Lindenblättern als Wegzehrung wird die Raupe eingesteckt. Zu Hause kommt sie in den Anzuchtkasten bis zur Verpuppung. Sobald der Schwärmer dann geschlüpft ist, ereilt ihn leider das Schicksal seiner Artgenossen.
Wolfgang ist nur mitgekommen, weil er unbedingt einige Runden im Grunewaldsee schwimmen will. Wir lehnen unsere Räder an einen Kiefernstamm, und Wolfgang beeilt sich, ins Wasser zu kommen. Mir ist heute nicht nach Baden, und so liege ich in der Sonne und träume vom Besuch bei Herrn Fritsche.
Kaum ist am nächsten Morgen das Frühstück beendet, hält mich nichts mehr. Ich flitze über die Hauptstraße in die Wielandstraße, nehme zwei Stufen auf einmal und stehe nach Luft schnappend vor der Wohnungstür im zweiten Stock. Ich warte etwas, um mich zu beruhigen, und drücke dann entschlossen den Klingelknopf neben dem Namensschild.
Die Tür öffnet sich. Eine Frau mit Kittelschürze und straff zurückgekämmten Haaren, die in einem dicken Knoten enden, sieht mich fragend an.
Ich stottere: »Guten Tag, ich heiße Dieter, und Ihr Mann hat mir gesagt, ich könnte mir die Schmetterlinge ansehen.«
Sie lächelt und lässt mich eintreten. »Warte bitte einen Augenblick, ich sage meinem Mann Bescheid.«
Der Flur ist lang, dämmrig, und ein ungewohnter Geruch hängt in der Luft. Am anderen Ende geht eine Tür auf, und Herr Fritsche kommt mir entgegen. »Ich freue mich, dass du gekommen bist«, begrüßt er mich.
Er geht voraus in den nächsten Raum, ein typisches Berliner Zimmer, das das Vorderhaus mit dem Seitenflügel verbindet. Es ist recht dunkel, ja fast düster. Nur durch die trüben Scheiben des Fensters zur Hofseite fällt etwas Licht. Eine rankende Grünpflanze hat es jedoch zum Teil zugewuchert.
Langsam gewöhnen sich meine Augen an das Dämmerlicht. Als ich mich umsehe, zucke ich erschreckt zusammen. Ein riesiges Krokodil mit aufgerissenem Rachen schaut mich von der Seitenwand an. Dann bemerke ich einen Schrank, der die gesamte Länge der Wand neben dem Fenster einnimmt. Auf der Vorderseite hat er schmale Schübe mit kleinen Schildchen.
»So, was willst du zuerst sehen?«, erkundigt sich Herr Fritsche. »Schmetterlinge aus Europa oder aus Afrika?«
»Oh, dann lieber zuerst die aus Afrika«, bitte ich. Er zieht einen der Schübe auf, und ich sehe Schmetterlinge in fantastischen Farben und Formen. Manche haben lange Schwänze an den Flügeln, während andere schillern und fast so groß sind wie meine beiden Hände zusammen. Schub um Schub wird geöffnet, und mein Staunen nimmt kein Ende. Dann öffnet Herr Fritsche in einem anderen Teil des Schrankes Fächer mit Käfern in den bizarrsten Formen. Manche tragen den Kopf auf stängeldünnem Hals, während andere sich mit Anhängseln tarnen, die wie dürre Blätter aussehen. Absolut begeistert bin ich von den Goliathkäfern, die in unterschiedlichen Arten zu sehen sind. Sie sind, wie der Name schon sagt, riesig, fast wie kleine Buletten mit Beinen.
Danach betrachte ich die europäischen Schmetterlinge. Herr Fritsche fragt nach diesem und jenem Falter, und ich nenne die Namen und die Besonderheiten wie Futter und Vorkommen. Er nickt zufrieden über meine Antworten.
Am Fenster entdecke ich Terrarien mit Eidechsen, Fröschen und in einem der Behälter zwei Schildkröten, die ihren Salat beknabbern. An der Wand, wo das Krokodil auf die Besucher herabstarrt, steht ein Bücherschrank mit Büchern in allen Größen.
Wir setzen uns an den großen Tisch in der Raummitte. Frau Fritsche kommt wie aufs Stichwort herein und fragt, ob ich ein Glas Limonade möchte, was ich dankend annehme. Für ihren Mann bringt sie eine Kanne Tee mit einer Tasse und Zucker.
Endlich habe ich Gelegenheit, meine Neugier zu befriedigen, und frage, woher das alles kommt. Er erzählt, dass er im Auftrag der Regierung mehrere Forschungsreisen nach Afrika unternommen hat. Für einen Elfjährigen hört sich das so spannend an, dass ich wissen will, ob er auch gefährliche Abenteuer erlebt hat. Herr Fritsche schmunzelt, steht auf und zieht auf der linken Körperseite sein Hemd aus der Hose.
Ich blicke etwas erschrocken auf eine breite, weißliche Narbe die, so lang wie drei Hände, schräg über die Rippen verläuft. Er stopft das Hemd zurück, zeigt in Richtung der Zimmertür. Erst jetzt sehe ich das gewaltige Gehörn eines Kaffernbüffels, das über der Tür hängt. »Ja, der war es, dem ich das zu verdanken habe«, erklärt er und schildert mir die Jagd auf das Tier, die ihn fast das Leben gekostet hätte.
Ich frage und frage, und er erzählt, wobei er immer lebhafter wird. Ich habe vergessen, dass ich längst zu Mittag zu Hause sein sollte. Als ich das Treppenhaus hinunterstürme, ruft er mir noch nach: »Und komm bald wieder.«
So kommt es, dass ich Herrn Fritsche immer wieder besuche. Er erklärt mir viele Zusammenhänge in der Natur und begleitet mich beim Schmetterlingsfang. Später erzählt er mir von einer Jagd auf Elefanten, und als ich neugierig frage, was er für ein Gewehr gehabt habe, geht er in den Nebenraum und kommt mit einem Blechkasten zurück. Er öffnet ihn und holt einen sichtlich schweren Gegenstand heraus. Nachdem er das Tuch aufgeschlagen hat, liegt ein kastenförmiges, wie ein großes Schloss aussehendes Metallteil auf dem Tisch.
»Was ist das?«, will ich wissen.
»Das ist das Schloss meines speziellen Gewehrs für Großwild, wie Elefanten, Nashörner und Büffel.«
»Und wo ist der Rest vom Gewehr?«
»Der liegt leider im Wannsee«, seufzt er. »Als die Russen nach Berlin kamen, habe ich das Gewehr lieber weggebracht. Vielleicht hätten sie mich für den Waffenbesitz erschossen, wer weiß. Nur vom Schloss mochte ich mich nicht trennen, ich habe es ausgebaut und versteckt.«
Eines Tages muss ich mich von Herrn Fritsche verabschieden, weil wir nach Spandau umziehen. Ihm fällt der Abschied sichtlich genauso schwer wie mir. Er bittet mich, ihn ab und zu besuchen zu kommen, wenn auch Spandau recht weit weg ist. Ehe ich gehe, bittet er mich noch kurz zu warten, geht zum Bücherschrank und übergibt mir ein dickleibiges Buch mit dem Titel Die Schmetterlinge Mitteleuropas, ein fantastisches Nachschlagewerk mit vielen Abbildungen und ausführlichen Beschreibungen.
Ich könnte ihm vor Freude um den Hals fallen. Doch das verhindert der Respekt vor ihm. So bedanke ich mich, so gut ich kann, und verspreche wiederzukommen.
Das Versprechen endet wie viele dieser Art. Ab und zu denke ich daran, nach Friedenau zu fahren, setze es aber nie in die Tat um. Als dann eines Tages mein Freund Wolfgang anruft, um mir mitzuteilen, dass Herr Fritsche verstorben ist, tut es mir sehr leid, seinem Wunsch nicht nachgekommen zu sein.
Das Schmetterlingsbuch steht auch heute noch in meinem Bücherschrank und erinnert mich an diesen so klugen und liebenswerten Forscher.
Der Knopf
Rutscht das Beinkleid, weil zu lose,
fehlt der Knopf an dieser Hose.
Hieran sieht man klipp und klar,
wie der Knopf doch wichtig war.
Ein Hosenknopf wird kaum betrachtet
und selten wird sein Tun beachtet.
So hält er fest, so gut er kann,
gibt Sicherheit dem Hosenmann.
Vor jedem Fest auf dieser Welt
wird er geprüft, ob er noch hält.
Wie würde man sich wohl genieren
beim Tanz die Hose zu verlieren!
Und folgt darauf an diesem Tage
das lang ersehnte Festgelage,
stopft man sich voll, ganz unbeschränkt,
am Bauch fühlt man sich eingeengt.
Aufgeknöpft wird nun der Bund.
Ein Seufzer tut die Wohltat kund
und belohnt den kühnen Mut
mit dem Satze: »Tut das gut!«
Ein Knopf muss fest sein bis zum Schluss
und Freiheit geben, wenn er muss.
Weil er entspannt ist, kann der Magen
jetzt auch die Torte noch vertragen.
Darum behalte stets im Kopf,
wie wichtig ist so ‘n kleiner Knopf.
Festgenäht wird er dir geben
sichern Halt durchs ganze Leben.
Häuptling Fliegender Bär
Am frühen Morgen hatte Häuptling Flinkes Wiesel die Ältesten vom Stamm der Irokesen zusammengerufen. Eine Weile saßen sie schweigend im Kreis, ehe der Häuptling zu reden begann.
»Meine roten Brüder, es droht Gefahr. Gebrochener Pfeil hat einen Späher der Huronen gesehen, als er unser Lager beobachtete. Als sich dieser entdeckt sah, flüchtete der feige Hund. Gebrochener Pfeil konnte jedoch noch sehen, dass der Hurone in voller Kriegsbemalung war. Sie sind auf dem Kriegspfad. Wir müssen damit rechnen, dass die Huronen in Kürze in unsere Jagdgründe eindringen. Wir werden das Kriegsbeil ausgraben, unsere Wigwams tapfer verteidigen, und ihre Skalps werden unsere Gürtel zieren. Hugh, ich habe gesprochen.«
Da trat Heulender Wolf an den Kreis der Krieger heran und bat um das Wort.
»Rede«, sprach der Häuptling.
»Es ist Eile geboten. Die ersten Krieger der Huronen sind auf der Sponholzstraße Ecke Hauptstraße gesichtet worden.«
Unter den versammelten Irokesen wurde es unruhig. »So nah sind sie bereits?«, rief Müdes Pferd erschrocken.
»Ja, sie haben mindestens zwölf Krieger an der Straßenbahnhaltestelle versammelt«, ergänzte Heulender Wolf.
»Gebrochener Pfeil soll umgehend die Lage erkunden und herausfinden, was die räudigen Hunde von Huronen im Sinn haben«, befahl Flinkes Wiesel.
Eine halbe Stunde später kehrte Gebrochener Pfeil zurück und teilte beruhigend mit, dass die Irokesen-Horde Badesachen dabei habe und sicher mit der Straßenbahn ins Freibad fahre. Die Kriegsbemalung wäre nur Sonnencreme gewesen, entschuldigte sich Gebrochener Pfeil. Ein Aufatmen der Erleichterung ging durch die Reihen der tapferen Krieger. Das Kriegsbeil wurde wieder eingegraben, und das geplante Schlagballspiel auf der Wielandstraße konnte beginnen.
Karl Mays Indianergeschichten fielen bei uns auf fruchtbaren Boden. Wir versuchten, sie voller Hingabe nachzuerleben. Je genauer unsere Kleidung und unsere Ausrüstung den Beschreibungen entsprachen, desto mehr fühlten wir uns als echte Nachfahren der roten Krieger.
Da wir kein Geld hatten, um uns die teuren Bücher zu kaufen, liehen wir sie uns bei einem kleinen Buchladen. Ein netter alter Mann hatte bald nach dem Krieg in der Hauptstraße 76 das Geschäft eröffnet. In dieser Zeit hatte kaum jemand das Verlangen, sich ein Buch zu kaufen. Aus diesem Grund erweiterte er sein Angebot um einen Buchverleih.
Bald bemerkte er, dass wir seine besten Kunden waren. Wir hatten den Eindruck, dass er nur für uns fast alle Karl-May-Bücher vorrätig hielt. Ab und an reichte unser Taschengeld nicht einmal für die Leihgebühr. Wir konnten aber sicher sein, dass er dann sagte: »Na gut, dann kostet es eben heute nur drei Groschen.«
Sicher litten die Hausarbeiten unter unserer Leidenschaft, denn ein dringender Kriegsrat hatte absolut den Vorrang.
Allein in unserem kleinen Friedenau gab es vier Indianerstämme. Jeder beanspruchte mehrere Straßenzüge als sein Revier, besser gesagt: als seine Jagdgründe. So tummelten sich zwischen der Bundesallee und der Rubensstraße blutrünstige Cherokees, Apachen, Sioux und wir, die Irokesen.
So ein Indianerstamm muss aber erst einmal gegründet werden.
In den langen Sommerferien gingen wir baden, spielten Schlagball und dachten uns täglich neue Streiche aus. Verreisen war so kurz nach dem Krieg nur wenigen vergönnt. Unsere feste Clique bestand aus Günter, Klaus, Peter, Manfred und mir.
Auf der Fahrt mit der S-Bahn vom Bahnhof Friedenau zum Strandbad Wannsee erzählte Manfred begeistert von seinem neuen Karl-May-Band Winnetou. Besonders die Stelle, an der Nscho-tschi, Winnetous Schwester, von weißen Banditen ermordet wird, schien ihm nahezugehen.
»Nu heul mal nicht gleich«, ließ sich Klaus vernehmen. Beleidigt hörte Manfred auf zu erzählen, drehte sich um und schaute aus dem Fenster.
»Ist ja schon gut«, beruhigte ihn Peter und versuchte, Manfred zum Weitererzählen zu animieren: »Wer hat denn die Schwester umgebracht?«
Ich hatte mir von Peter ein paar Tagen vorher Der Schatz im Silbersee ausgeliehen und fand es mindestens so spannend wie Winnetou, das ich bereits gelesen hatte.
Günter piepste: »Ich werde mir demnächst eine Indianerausrüstung von meiner Mutter nähen lassen. Ein paar Federn hat mir mein Onkel Paul von seinem Bauernhof bei Erkner mitgebracht. Wenn ich genug Federn zusammenhabe, mache ich mir einen Federschmuck und sehe dann aus wie ein Häuptling, uff!«
»Du mit deiner Größe, einen Kopf größer als ein Dackel, würdest nie Häuptling werden«, stichelte Klaus.
»Mensch, Klaus, du musst doch nicht immer so biestig zu deinen Freunden sein«, rügte ich ihn.
Ehe wir das Gespräch fortsetzen konnten, hielt die S-Bahn mit quietschenden Bremsen in Wannsee. Auf dem Weg zum Kartenhäuschen schlug Günter vor: »Wollen wir uns nicht alle eine Indianerkluft machen? Dann suchen wir uns einen passenden Indianerstamm aus und begeben uns auf den Kriegspfad.«
»Die Idee finde ich dufte«, stimmte Manfred zu. »Wir sind dann Krieger der stolzen Apachen, und alle anderen Stämme werden vor uns zittern.«
»Nee, das geht nicht«, wandte Günter ein, der sich wohl schon länger mit diesem Thema befasst hatte. »Apachen gibt es schon im Birkenwäldchen an der Lauterstraße. Wir müssen uns einen anderen Stamm aussuchen.«
In der Zwischenzeit hatten wir die obere Etage der Wannseeterrassen erreicht und hielten Ausschau nach einem geeigneten Platz am Strand. So weit das Auge reichte, lagen die Besucher dicht an dicht wie die Robben auf einer Sandbank. So beschlossen wir, zu unserem Stammplatz ganz links zu gehen. Dort standen ein paar Weiden. Wenn wir genug getobt hatten und die Sonne unser Fell bereits angesengt hatte, zogen wir uns in deren Schatten zurück.
Wir lagen auf unseren Decken, nuckelten an einer Brause oder leckten ein Eis. »Ja, was denn nun«, begann Günter erneut, »welcher Stamm soll es nun werden?«
»Wie wäre es mit den Mohawks?«, schlug Manfred vor.
»Nee, geht nicht. Von denen weiß man kaum etwas, und wie sollten wir dann wissen, wie die gelebt haben?«, schmetterte Peter den Vorschlag ab. Sioux, Cherokees, Delawares, Iowas, Schoschonen und Huronen wurden genannt und wieder verworfen. Entweder wussten wir zu wenig von ihnen, oder es gab bereits einen Indianerstamm mit diesem Namen in Friedenau. Es war der kleine Günter, der den Stamm der Irokesen ins Spiel brachte.
»Klasse«, ließ sich Manfred vernehmen, »die sind besonders gefürchtet und echt blutrünstig.«
Wir stimmten ab. Der Stamm der Irokesen war geboren.
Nur Peter mäkelte noch etwas: »Die haben aber so doofe Frisuren, nur so’n kleines Büschel Haare auf der Glatze.«
»Musst du dir ja nicht gleich zulegen«, stichelte Klaus.
Die Irokesen hatten neue Jagdgründe in Friedenau gefunden. Seit heute lag unser Stammesgebiet zwischen der Wieland- und der Hähnelstraße.
Bald darauf schaukelte uns die S-Bahn auf ausgefahrenen Schienen heimwärts nach Friedenau. Auf der Rückfahrt überlegten wir, wie unsere Kleidung aussehen sollte. Eifrig suchten wir in den Texten nach Hinweisen. Als wir dann lasen, dass die Kleidung von Winnetou aus weich gegerbtem Hirschleder war, mussten wir uns Alternativen ausdenken.
Günter hatte es gut, weil seine Mutter Schneiderin war. Einige Tage nach unserer Stammesgründung erschien er zum Kriegsrat in voller Indianermontur. Die Beine seiner alten, kurzen Hose waren mit bunten Bändern verziert, von seinem verwaschenen Hemd hatte die Mutter die Ärmel abgetrennt und die Öffnungen mit farbigen Kordeln geschmückt. Ein breiter Ledergürtel, der früher sicher einen Ledermantel zusammengehalten hatte, wand sich um seine magere Hüfte. Darin steckte so etwas wie ein Kriegsbeil aus Holz und eine Zündplättchenpistole. Günters Kopf zierte ein breites blaues Band mit einer einzigen weißen Feder am Hinterkopf.
»Uff«, ließ sich Peter vernehmen, »sieht klasse aus. Da werden wir uns mächtig anstrengen müssen, um mithalten zu können.«
Günter strahlte und fuchtelte wild mit seinem Tomahawk in der Luft umher.
Der heutige Kriegsrat war einberufen worden, weil wir noch keine indianischen Namen hatten. Jeder sollte sich zuerst einen Wunschnamen ausdenken. Sollte er auf allgemeine Zustimmung stoßen, so war er angenommen. Manfred wollte sich Schneller Pfeil nennen.
»Nee, halte ich nicht für gut«, meckerte Klaus. »Könnt ihr euch noch erinnern, als wir mit unseren Flitzebögen Zielschießen gemacht haben? Jeder zweite Pfeil ist bei Manfred bereits vor dem Abschuss zerbrochen. Ich stimme für den Namen Gebrochener Pfeil.«
Nach einigem Zögern nickte Manfred und war einverstanden. Klaus entschied sich für Heulender Wolf, und Peter wollte sich ab sofort Adlerauge nennen. Das stieß auf lautes Gelächter. »Habt ihr schon mal 'nen Adler mit Nickelbrille gesehen? Wie wäre es denn mit Schielender Büffel?«, rief Klaus. Als er jedoch sah, dass Peter mit den Tränen kämpfte, beruhigte er ihn sofort. »Tschuldige bitte, war nicht so gemeint. Adlerauge ist schon in Ordnung«, und wir akzeptierten den Namen. Günter wollte unbedingt Rasendes Pferd heißen. Wieder war es unsere Spottdrossel Klaus, der seinen Senf dazugeben musste. »So langsam, wie du dich beim Spielen bewegst, kannst du niemals so heißen. Was hältst du von Müdes Pferd?«
»Ja, meinetwegen«, murmelte Günter.
Nun war es an mir, einen Namen zu nennen. Ich hatte mir im Voraus einige ausgedacht. »Wie wäre es mit Grollender Donner?«, fragte ich in die Runde.
Da vernahm ich bereits Klaus‘ Stimme: »Weiß nicht, das hört sich an wie Donner von Kanonen. Das passt nicht.«
Mein zweiter Namensvorschlag wurde angenommen, und ab sofort hieß ich Flinkes Wiesel.
»Nun haben wir unsere Namen, aber noch keinen Häuptling und auch keinen Medizinmann«, bemerkte Günter. Heute fällt mir auf, dass keiner von uns auf die Idee kam, unserem Stamm einige Squaws hinzuzufügen. Wir waren eben noch nicht so weit.
»Ehe wir uns schlagen, um zu sehen, wer der Stärkste ist, schlage ich vor zu losen«, sagte Peter. Wir waren einverstanden.
Zu dieser Zeit wurden die Vorderseiten von Zigarettenschachteln gesammelt und getauscht. Peter hatte seine Sammlung dabei. Wir teilten eine Schachtel in fünf Stücke und schrieben drei Mal Krieger, einmal Medizinmann und einmal Häuptling darauf. Die gefalteten Papierschnipsel nahm Klaus in die hohlen Hände, schüttelte sie kräftig, und wir zogen unser Los. Peter zog einen Krieger, Manfred ebenfalls, Günter ließ ein täuschend echtes Indianergeheul vernehmen, als er den Medizinmann zog. Klaus hielt mir seine offenen Hände entgegen und forderte mich grinsend auf: »Nun zieh schon den Häuptling.«
Ich öffnete mein Los, und sein Grinsen war wie weggewischt. Ich war Häuptling, und für ihn blieb nur der dritte Krieger. Schnell hatte er seine Enttäuschung überwunden und suchte nach einem neuen Opfer für seinen Spott. »Eh, Günter, kann dir deine Mutter nicht lange Hosen machen?«
Arglos erwiderte Günter: »Da muss ich mal fragen, vielleicht macht sie das für mich.«
»Wäre sicher gut für uns, wenn die feindlichen Krieger nicht deine dünnen O-Beinchen sehen müssten«, hänselte Klaus unsensibel wie immer und steigerte sich noch: »Aber zum Reiten sollen O-Beine ja vorteilhaft sein.«
Schon schossen Günter wieder die Tränen in die Augen. Peter versetzte Klaus einen Stoß vor die Brust. »Du bist ein Idiot!«
Dann fragte mich Heulender Wolf: »Wie bist du denn auf Flinkes Wiesel gekommen?«
»Da musst du dich noch bis morgen gedulden«, vertröstete ich ihn. Wir verabredeten uns für den nächsten Tag um vier Uhr. Jeder sollte mit möglichst kompletter Indianerkleidung erscheinen.
Zu Hause wartete ich ab, bis Mutter in der Küche das Abendbrot vorbereitete. Ich schlich zum großen Kleiderschrank, der im Schlafzimmer stand. Oben war ein Fach mit Hüten, Schals und einem schwarzen Karton. Nach diesem trachtete ich. Damit ich an das obere Fach herankam, benutzte ich eine Fußbank. Schnell hob ich den Deckel des Kartons ab und zerrte heftig an meiner Beute. Es waren zwei Nerzpelze, komplett mit Köpfen, die am hinteren Ende zusammengenäht waren. Vorne wurden sie durch eine Kette mit Verschluss verbunden. Mutter legte sie sich zu besonderen Festtagen um, das war damals eben die Mode. Dann baumelten hinten die Hinterbeine und die mageren Schwänzchen, während vorne die beiden Nerze den Betrachter aus ihren Glasaugen anklagend anstarrten.
Für den Abtransport hatte ich meinen Brotbeutel mitgebracht, den ich von einem US-Soldaten geschenkt bekommen hatte. Die Fußbank wurde wieder verstaut und der Brotbeutel ganz hinten im Wäscheschrank versteckt. Etwas mulmig war mir doch. Wenn Mutter die Nerze in den nächsten Tagen ausführen wollte, dann gnade mir Gott.
Am folgenden Tag suchte ich mir alles zusammen, was ich mir für die Ausstattung eines roten Kriegers vorstellte. Der Kopfschmuck war sicher eines Häuptlings würdig: ein Stirnband mit vielen Gänsefedern zierte mein Haupt. Ein Tomahawk aus Holz und ein Messer, komplett aus einer Hirschgeweihstange gebastelt, steckten im Gürtel. Nur mit der Bekleidung stand es nicht zum Besten. Zuerst wollte ich meine geerbten ledernen bayerischen Seppelhosen anziehen. Doch als ich mich mit Federschmuck und Tomahawk im Ankleidespiegel betrachtete, war mir klar, das geht nicht.
Also suchte ich mir eine kurze Hose und ein verwaschenes Hemd mit Karomuster aus. Zur Not musste das für die heutige Zusammenkunft reichen.
Doch dann kam die entscheidende Ergänzung meiner Ausstattung. Die Nerze mussten meinen Namen Flinkes Wiesel bestätigen. Flinker Nerz hörte sich nicht so gut an. Ich holte meinen Brotbeutel mit dem Pelzgetier und wollte gerade die Wohnungstür eilig hinter mir zuziehen, als Mutter in den Flur kam und fragte: »Bist du mit den Schularbeiten fertig?« Dabei fiel ihr Blick auf den Brotbeutel und mir das Herz in die Hose. So beeilte ich mich zu sagen, dass ich die Hausaufgaben erledigt habe. Ehe vielleicht die nächste Frage den Beutel beträfe, huschte ich aus der Tür und rannte die Treppen hinunter.
Glücklicherweise sah keiner meiner roten Brüder, wie ich die Flucht vor einer Squaw ergriff.
Erst als ich in der Wielandstraße angekommen war, schlich ich in den Hausflur von Nr. 43, zerrte die Nerze aus dem Beutel und legte sie mir um die Schultern. Kaum war ich wieder auf der Straße, um mich zum Treffpunkt zu begeben, als ein älteres Paar auf mich zukam. Die Frau zeigte sofort auf mich und schüttelte fassungslos den Kopf, während der Mann das Gesicht zu einem belustigten Grinsen verzog. Gut, ich gebe ja zu, dass mein Aussehen nicht als normal zu bezeichnen war: kurze Hosen, Federn auf dem Kopf und Mutters Sonntagsraubtiere um den Hals. Ein Bild für die Götter.
Mit den Worten »Ick werd verrückt, aber det sieht knorke aus« begrüßte mich Klaus. Die anderen Stammesbrüder blickten etwas neidvoll auf meine Jagdbeute und fanden den Namen Flinkes Wiesel absolut passend gewählt. »Und das hat deine Mutter dir gestattet?«, fragte überflüssigerweise Müdes Pferd. Ich blieb ihm die Antwort schuldig.
Wir zogen uns in unseren Wigwam auf dem Ruinengrundstück in der Hauptstraße Nr. 87 zurück. Die Ruinen zwischen der Sponholzstraße und der Hauptstraße waren 1948 noch nicht gesprengt und abgeräumt. Dort hatten wir ein tiefes Loch im Hof mit zwei Blechtüren abgedeckt und aus Ziegelsteinen bankähnliche Sitzgelegenheiten aufgeschichtet. Für den Einstieg schoben wir eine Blechtür zur Seite, stiegen hinunter und zogen die Tür wieder an die alte Stelle. So konnte uns niemand so leicht entdecken. Die Beleuchtung bestand aus Kerzen, die wir von zu Hause gemaust hatten.
Adlerauge berichtete von einem Indianerschmöker, auf dessen Umschlag der Held einen Lederanzug trug. Im Text hatte er gelesen, dass dieser Anzug mit den Borsten eines Stachelschweines verziert war. Er fand die Ausschmückung mit den schwarz-weißen Stacheln so klasse, dass er bereits einen Schlachtplan hatte, wie und wo wir uns diese besorgen könnten.
»Wo denn?«, fragte Heulender Wolf. »Im Grunewald habe ich noch kein Stachelschwein gesehen!«
»Blödmann«, erwiderte Adlerauge und sagte nur drei Worte: »Aus dem Zoo!«
»Uff, det is ne jute Idee«, kommentierte Gebrochener Pfeil die Lösung.
»Wenn wir da alle Mann hingehen, das fällt sicher auf«, gab ich zu bedenken.
»Als Häuptling musst du aber unbedingt dabei sein«, verlangte Adlerauge.
»Zu zweit fällt es am wenigsten auf«, meinte Müdes Pferd und war wohl froh, dass er nicht mitgehen musste.
»Am Wochenende ist da aber viel zu viel Betrieb«, gab ich zu bedenken.
»Wir haben Ferien, und du kannst mit Adlerauge doch gleich morgen am Mittwoch gehen«, schlug Gebrochener Pfeil vor. Der Vorschlag wurde einstimmig für gut befunden, und wir trennten uns. Vorher jedoch verabredete ich mich mit Adlerauge für acht Uhr. Wir wollten sehr früh in den Zoo, damit wir möglichst wenigen Besuchern begegneten.
Bevor ich unsere Höhle verließ, steckte ich die Pelztiere wieder zurück in den Beutel.
Adlerauge war erstaunlich pünktlich, und vom Innsbrucker Platz fuhren wir über Westkreuz bis zum Bahnhof Zoologischer Garten. Wir kannten uns gut aus im Zoo. Nach fünf Minuten standen wir am Gehege der Stachelschweine. Ihr Gelände lag etwa einen Meter tiefer als der Weg, und nur eine niedrige Mauer trennte uns von den Tieren. Die davor verlaufende Absperrung durch eine dreißig Zentimeter über dem Boden verlaufende Eisenstange konnte uns nicht abhalten.
»So, nun los«, forderte ich Adlerauge auf. »Beeil dich, im Moment ist die Luft rein.«
Doch da verließ ihn der Mut. »Ich trau mich nicht, mach du das!«
Also gut, dachte ich, stieg über die Absperrung und beugte mich über die kleine Mauer. Wir wussten von früheren Zoobesuchen, dass Stachelschweine gerne Äpfel fraßen. Daran hatte ich gedacht und holte einen kleinen Apfel aus der Hosentasche. Zwei Stachelschweine waren ganz dicht unter mir an der Mauer und wärmten sich in der Sonne. Ich warf den Apfel vorsichtig genau zwischen die beiden. Sie fuhren erschreckt auseinander, kamen aber sofort neugierig zurück. Das größere Schwein begann am Apfel zu knabbern. Das war die Gelegenheit für mich. »Peter, halt mich am Gürtel fest, damit ich nicht im Gehege lande«, rief ich ihm zu.
So abgesichert, beugte ich mich weit nach unten, bis meine Hand kurz über den Stacheln schwebte. Dann packte ich zu und hielt einen der großen Stacheln fest umklammert. Das Stachelschwein knurrte, schnaufte und versuchte sich loszureißen. Was hatte das kleine Tier für eine Kraft! Ein Glück, das Peter mich festhielt. Mit einem Ruck befreite sich der Stachler und floh wackelnd in seine Höhle. Dort blieb er im Eingang stecken und zeigte uns seine stachelbewehrte Kehrseite. Triumphierend hielt ich einen der wunderschönen schwarz-weißen Stacheln in der Hand.
Nun aber so schnell wie möglich weg vom Tatort, dachte ich und reichte Adlerauge die etwa dreißig Zentimeter lange Beute. Er steckte den Stachel blitzschnell unter sein Hemd und bedankte sich bei mir. »Schon gut«, wehrte ich ab und war heilfroh, nicht erwischt worden zu sein.
Ehe wir den Ort verließen, las ich neugierig das Schild, welches Auskunft über das Leben der Stachelschweine gab. Stachelschweine gehören zu den Nagetieren und kommen in Afrika und Asien vor. Sie ernähren sich von pflanzlicher Nahrung … Also nicht in Nordamerika?, ging es mir durch den Kopf. Dann war die Beschreibung mit der Stachelschweinverzierung des Indianeranzuges reine Fantasie! Wir beeilten uns, den Zoo zu verlassen, und unterhielten uns auf dem Rückweg aufgeregt über den Erfolg.
Erst viele Jahre später las ich, dass es Baumstachler in Nordamerika und Alaska gibt. Diese haben aber nur dünne kurze Stacheln. Vielleicht hatte man damit die Mokassins der Indianer verziert. Sicher hatte der Autor der Indianergeschichte diese Borsten gemeint, und wir hatten ein armes Afrika-Stachelschwein geschändet.
Meine Nerz- beziehungsweise Wieselausstattung hatte Manfred augenscheinlich sehr beeindruckt. Anders kann ich mir die folgende Geschichte nicht erklären.
Einige Tage später trafen wir uns in unserer Höhle. Adlerauge zeigte uns voller Stolz sein Stirnband. Am Hinterkopf steckten drei schwarzweiße Federn, und im Band waren etwa vier Zentimeter lange Stücke der Stachelschweinborste eingesteckt. Wir fanden, dass es sehr echt aussähe, und lobten Adlerauge dafür. Die Zeit verging, nur Gebrochener Pfeil ließ sich nicht blicken. Müdes Pferd erbot sich, nach dem Rechten zu sehen, und schickte sich an, die Höhle zu verlassen. Gerade hatte er den Kopf aus dem Loch gesteckt, als er uns zurief: »Gebrochener Pfeil kommt gerade über den Schuttberg.«
Kaum hatte Gebrochener Pfeil Platz genommen, als Heulender Wolf laut rief: »Tapfere Krieger vom Stamm der Irokesen, Gebrochener Pfeil hat einen Hundesohn von Huronen in die ewigen Jagdgründe geschickt!« Bei den letzten Worten zeigte er auf den Gürtel von Gebrochener Pfeil. Jetzt sahen auch wir, dass am Gürtel ein Skalp baumelte.
»Ist der echt?«, flüsterte Müdes Pferd.
»Wo hast du den erbeutet, rede schon«, bedrängte ich ihn.
Gebrochener Pfeil druckste noch etwas herum und begann dann zu berichten. »Ihr kennt doch meinen Onkel, den Schneider Wessolek. Wie ihr vielleicht schon bemerkt habt, trägt er eine Perücke. Wenn es ihm im Sommer in seiner kleinen Werkstatt zu heiß wird, dann nimmt er kurz die Perücke ab und trocknet sich seine Glatze. Als ich vorgestern bei ihm in der Werkstatt war, um eine Hose zum Ändern zu bringen, entdeckte ich in einem Regal weit hinten eine zweite Perücke. Heute, als ich die Hose abholte, ging er kurz nach hinten, um seinen pfeifenden Wasserkessel vom Herd zu nehmen. Das nutzte ich aus, schnappte mir die Perücke und stopfte sie unter mein Hemd. Er hat es Gott sei Dank nicht mitbekommen.«
Heulender Wolf sagte anerkennend: »Der Mottenfiffi sieht wirklich klasse aus. Wenn wir auf einen anderen Stamm treffen, werden denen die Augen aus dem Kopf fallen, garantiert.«
Heulender Wolf bekam Tage später von einem Verwandten einen schönen buschigen Fuchsschwanz geschenkt. Diesen befestigte er hinten am Gürtel und betonte immer wieder, es sei der Schwanz von einem Wolf, den er erlegt hätte. Das Katschi, das aus seiner Hosentasche lugte, war für einen Irokesen nicht ganz stilecht. Von seinem aus einer Astgabel gebastelten Katapult trennte er sich jedoch nur ungern. Ich hatte mir meine Nerze umgebammelt und vollen Federschmuck angelegt.
Wir waren also alle gut und malerisch ausgestattet und wollten nun die Reaktion auf unser Aussehen bei den anderen Stämmen herausfinden. Am folgenden Dienstag trafen wir uns an der Haupt-/Ecke Sponholzstraße. Dort begann das Gebiet der Huronen. Ihr Häuptling Tapferer Bär war dafür bekannt, dass er gerne Streit suchte. Darauf waren wir nicht aus, zumal der Huronenstamm zwölf Krieger zählte.
Wir waren kaum über ein Ruinengrundstück Richtung Ceciliengärten gelaufen, als uns einige Pfeile um die Ohren flogen. Zum Glück trafen sie nicht. »Was wollt ihr feigen Kojoten in unseren Jagdgründen?«, hörten wir eine Stimme fragen.
»Wir kommen in friedlicher Absicht«, rief ich zurück und fügte hinzu: »Wenn er ein mutiger Krieger ist, dann zeigt er sich und versteckt sich nicht.«
Hinter dem dicken Stamm einer Kastanie trat sogleich der Häuptling Tapferer Bär hervor. Seinen Namen hatte er sich wohl deshalb ausgedacht, weil er einen alten Innenpelz aus braunem Schaffell trug, und zwar mit der Fellseite nach außen. »Wie heißt euer Stamm, und wer ist ihr Anführer?«, fragte er mit bewusst lauter Stimme.
Ich trat einen Schritt vor und erklärte ihm, dass wir Irokesen seien und ich der Häuptling Flinkes Wiesel.
»Ha, wie ich höre, hast du den Namen zu Recht und entziehst dich einem Kampf lieber durch flinke Flucht«, höhnte er.
»Ganz gewiss nicht«, erwiderte ich, »aber wir suchen keinen Streit und möchten nur friedlich euer Gebiet durchqueren.«