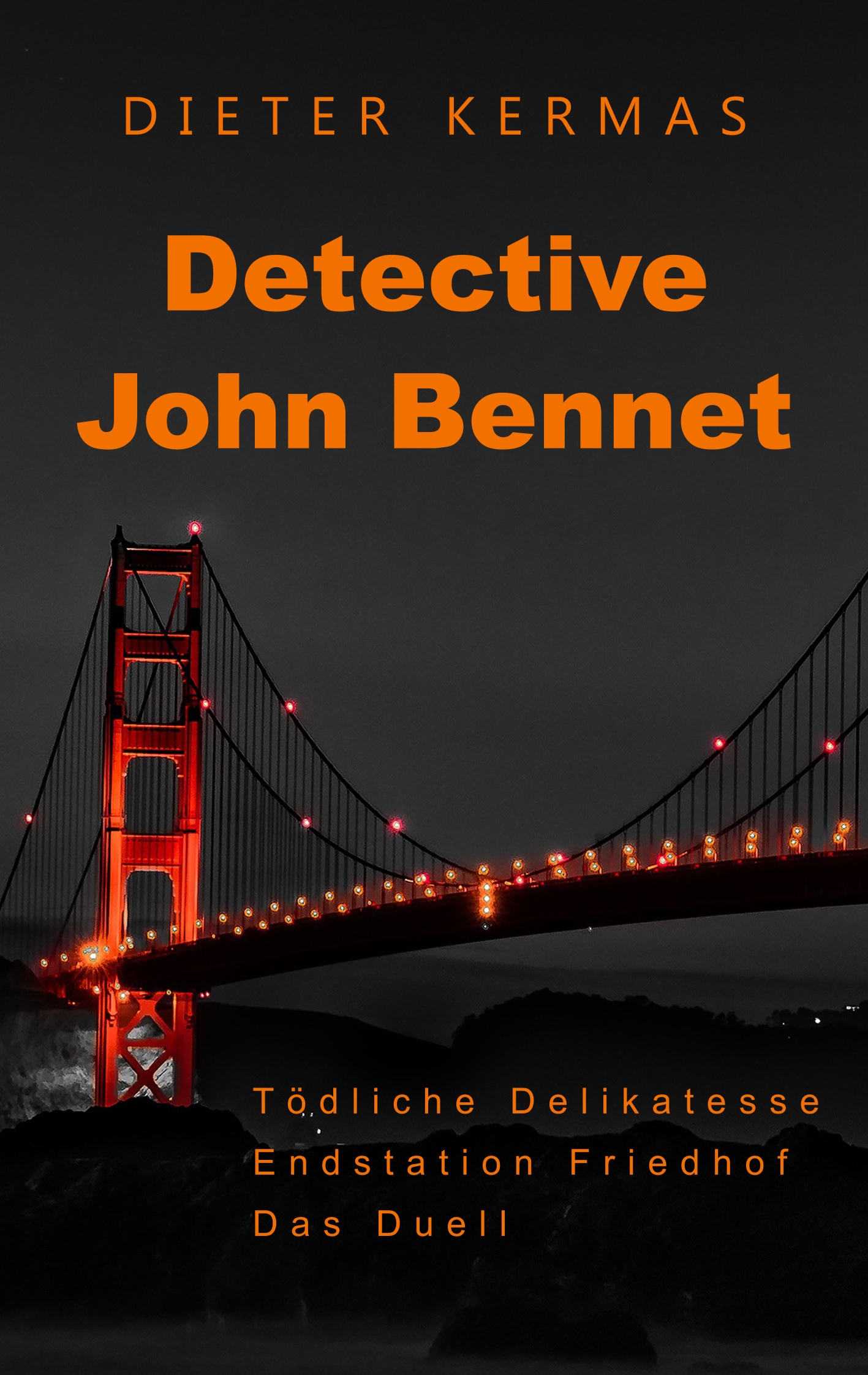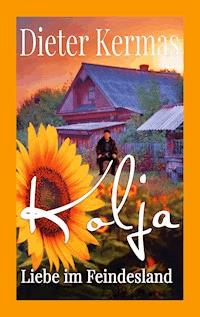
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Kolja, ein junger russischer Soldat, muss 1944 an die Front. Er überlebt die Schlacht um Berlin und findet seine große Liebe Lotte. Doch das Glück währt nur kurz, denn Kolja muss zurück nach Russland. Mögen auch zweitausend Kilometer zwischen ihnen liegen und Jahrzehnte vergehen, Kolja und Lotte vergessen einander nie. Der Untergang der UdSSR ist Koljas Chance: Mit fast zweiundsiebzig Jahren macht er sich auf den Weg nach Berlin zu Lotte und lernt seinen Sohn Peter kennen. Kolja glaubt, sein Leben nun zufrieden beschließen zu können – aber dann wird er eines Mordes beschuldigt.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 237
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Für Diana
Roman
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Larinskaja
Kolja muss an die Front
Lotte
Peter
Wieder zu Hause
Nachkriegstage
Der eiserne Vorhang zerbricht
Flug in die Vergangenheit
Das Wiedersehen
Rückkehr
Alltag in Berlin
Dunkle Wolken über Larinskaja
Koljas Frieden
Vorwort
In diesen Roman sind die Erlebnisse und Erfahrungen aus meinen Reisen nach Russland eingeflossen. Besonders meine Ausflüge in die ländliche Umgebung Moskaus haben dazu beigetragen, das Land und die Menschen näher kennenzulernen und zu verstehen. Diese Eindrücke haben mich veranlasst, Deutschland und Russland erzählerisch durch zwei Schicksale zu verbinden.
Inzwischen sind mehr als fünfzig Jahre vergangen, und auch in Russland ist die Zeit nicht stehen geblieben, doch wenn Sie nach Russland fahren, dann fahren Sie aufs Land. Sie werden sogar heute noch die kleinen landestypischen Holzhäuser vorfinden, und je weiter Sie ins Land hineinfahren, desto mehr nähern Sie sich der Zeit, in der Kolja und seine Familie gelebt haben. Auf Ihrer Reise werden Sie sicher auch eingeladen werden. Dann haben Sie vielleicht das Glück, an einem alten Lehmofen zu sitzen, so wie jenem, an dem sich Koljas Familie gewärmt hat, und vielleicht heißt Ihr Gastgeber sogar Kolja.
Larinskaja
Nikolai zog tief die Luft ein, um den Duft zu genießen. So gut rochen nur die heißen Buchweizenblini aus der Pfanne, die sein Frauchen zubereitete. Eine Weile hatte es noch Zeit, ehe sie ihn ins Haus rief. Sie würden essen und über die Geschehnisse des Tages reden. So lange döste er zufrieden in der Wärme der tief stehenden Spätsommersonne. Der Abendwind wehte durch das angrenzende Sonnenblumenfeld, und dessen herber Geruch mischte sich mit dem der Blini, den er tief in seine Lungen sog.
Wie oft hatten Michael und Maria versucht, die Eltern zum Umzug in einen der nicht weit entfernten Neubaukomplexe zu überreden! Dort wäre es doch so viel angenehmer mit der zentralen Heizung, dem Warmwasser und den gepflasterten Wegen. Nicht zu vergessen die nahen Einkaufsmöglichkeiten. Sie müssten nicht jeden Tag, oft bei Sturm und klirrender Kälte, das Wasser vom Brunnen holen und den alten Lehmofen mit Unmengen Holz und Kohle füttern.
Stets beendete Nikolai das Gespräch mit dem Argument, dass er die Wohnungen von Mischa und von Maschas Familie ja kenne. Er sei jedes Mal froh, wenn er den Neubau verlassen dürfe, um dem durchdringenden Geruch von Essen, dem Gestank der Abfallbehälter, der Neugier anderer Mieter und dem Lärm der Kinder zu entkommen. Nein, aus dem Haus, das sein Vater nach guter alter Art und Weise aus solidem Holz erbaut hatte, bekam man ihn nicht heraus. Besonders unwirsch reagierte er, wenn Mischa Koljas Alter und die damit verbundene Beschwerlichkeit der täglichen Arbeit mit ins Spiel brachte.
»Ihr seid in euren jungen Jahren schon so verweichlicht, dass man Angst haben muss, wie es euch erst im Alter ergehen wird«, brummte Nikolai und beendete die Diskussion mit einer energischen, abwertenden Handbewegung. Danach konnte ihn auch Maschas Einwand »Kolja, wir machen uns doch nur Sorgen um euch« nicht dazu veranlassen, das Thema wieder aufzunehmen.
Niemand brächte ihn hier fort. Nein und nochmals nein. Er würde weiterhin eins sein mit der Natur, die ihn mit all ihren Gaben verwöhnte. Konnte man im Neubaugebiet im Frühling dem Ruf des Kuckucks lauschen oder dem Rauschen des Windes in den Zweigen der Birken? Konnte man Bienen beobachten, wie sie emsig durch die Blütenpracht des Gartens summten und zu den Sonnenblumen flogen, um ihm im Herbst ihren Honig zu schenken? Weder ein zentralgeheiztes Zimmer im Winter noch die Annehmlichkeit einer warmen Dusche konnten dies wettmachen. Nein, hier würde er sitzen bis zum Ende seiner Tage
Das Haus der Markows lag etwas außerhalb von Larinskaja, einem kleinen Dorf östlich von Moskau. Es war ein typisches russisches Holzhaus. Für die Vorderfront hatte Koljas Vater ein helles Himmelblau gewählt. Die in mühseliger Kleinarbeit herausgesägten und geschnitzten Verzierungen, die sich an der Vorderseite des Giebels entlangzogen, hatte er weiß gestrichen. Selbst die Latten des Zaunes waren an den Spitzen blau und weiß bemalt. Auf der windgeschützten Seite des Hauses stand eine geräumige, warm ausgepolsterte Hundehütte. Ihr Dach hatte er mit Blech beschlagen. Wenn es regnete, trommelten die Tropfen ihr eintöniges Lied in die Hundeohren. Kolja verstand seinen Hund recht gut, wenn der bei prasselndem Regen lieber unter dem Vordach des Hauses Schutz suchte, als sich dem Trommelwirbel in seiner Hütte auszusetzen.
Oft bedankte sich Kolja im Stillen bei seinem Vater, dass er das Haus recht weit von den Sümpfen entfernt gebaut hatte, denn im Sommer standen Wolken von Mücken über dem Feuchtgebiet. Die Plagegeister warteten nur darauf, sich auf leichtsinnig zu nahe kommende Menschen zu stürzen. Sechs Kilometer östlich von Larinskaja fließt der kleine Fluss Sudogda. Dort ließ es sich herrlich fischen, und die Kinder aus der Gegend trafen sich hier, um zu schwimmen. In diesem Flüsschen hatte sein Vater auch ihm das Schwimmen beigebracht.
Mit dem Auto waren es so an die zweihundertneunzig Kilometer bis zur Hauptstadt. Luftlinie sogar nur zweihundert, aber die Straße hatte mit großen Umwegen um die Seen und Sumpfgebiete gebaut werden müssen. Ehe jedoch die Bewohner des Dorfes zur gepflasterten Straße gelangten, mussten sie die Lehmwege hinter sich bringen. Besonders im Frühling, wenn der Frost gewichen war, war dies eine knöcheltiefe, aufgeweichte Herausforderung. Mancher Stiefel blieb im schmatzenden Lehmbrei stecken, ehe er von seinem Besitzer fluchend und auf einem Bein balancierend herausgezogen werden konnte.
Bis auf die ausgedehnten Sumpfgebiete war Larinskaja von Wäldern umgeben. Felder anzulegen war sehr mühselig, und man tat es nur für den eigenen Bedarf rund um die Datscha.
Koljas Vater hatte in jungen Jahren eine Beschäftigung in der Holzwirtschaft gefunden. Der Lohn war zwar gering gewesen, aber Holz für den Hausbau und für die Heizung hatten sie jederzeit ausreichend zur Verfügung gehabt. Später, als die Industrialisierung von der Partei mit großem Propagandaaufwand vorangetrieben wurde, hatte er eine besser bezahlte Anstellung in einer Fabrik gefunden.
Fünfundzwanzig Kilometer südlich von Larinskaja gab es ein ausgedehntes Neubaugebiet mit vielen grauen Plattenbauten und eine staatliche Kristallmanufaktur. Die Häuser gehörten zur Fabrik, und fast alle Arbeiter und Arbeiterinnen der Manufaktur wohnten auch dort. Vor der Oktoberrevolution 1917, so hatte Koljas Vater erzählt, lief man sonntags die fünf Kilometer bis nach Dubasowo, wo sich die nächste Kirche befand, um sich den Segen des Popen abzuholen. Nach der Machtübernahme durch die Kommunisten dauerte es nicht lange, und die Kirche verzeichnete einen großen Mitgliederschwund. Selbst an besonders hohen Feiertagen wie zum Osterfest fanden sich nur wenige kopftuchverhüllte alte Frauen ein.
Wollte Kolja nach Moskau fahren, so nahm er den Bus bis Neschajewskaja, und dann waren es noch gut dreißig Stationen und Haltepunkte mit der Elektritschka, dem schnellen Elektrozug, bis zur Metropole.
Die Sonne stand jetzt so tief, dass sie nur noch seinen Oberkörper erreichte. Die Kühle kroch von den Füßen langsam höher. Er reckte sich etwas, damit das Blut wieder leichter fließen konnte. Ein kurzer stechender Schmerz ließ ihn in der Bewegung innehalten. Da war es wieder, das Ziehen im Oberschenkel, wo der kleine Granatsplitter ihn ab und zu immer noch an längst vergangene Ereignisse erinnerte. Er war damals im Lazarett nicht entdeckt worden. Besonders im Winter, wenn die Kälte durch die Kleidung drang, machte sich das Andenken an seine Soldatenzeit unangenehm bemerkbar.
Kolja schloss die Augen, und seine Gedanken begannen in die Vergangenheit zurückzuwandern.
Kolja muss an die Front
Im März 1944 machten sich die Verluste an Menschen und Material auf beiden Seiten immer gravierender bemerkbar. Der Krieg dauerte nun bereits fast drei Jahre. Die faschistischen Eindringlinge hatten ihre erste schwere Niederlage hinnehmen müssen. Im sogenannten Kursker Bogen waren die deutschen Panzertruppen nach tagelangen Gefechten stark geschwächt worden. Diese entscheidende Schlacht im Juli 1943 bei Prochorowka hatte den sowjetischen Truppen wieder Mut und Zuversicht gegeben. Hinzu kam, dass sich die Nachricht von der Kapitulation der 6. Armee unter General Paulus vor Stalingrad blitzschnell verbreitet hatte. Hoffnungsvolle Genugtuung erwachte in allen Menschen. Sollte es doch gelingen, die Okkupanten von Russlands Erde zu vertreiben?
In diesen Stunden des Aufatmens erhielt Kolja ein Schreiben der örtlichen Kommandantur. Er wurde aufgefordert, sich am kommenden Montag bei der angegebenen Sammelstelle einzufinden. Die Heeresführung griff schon seit einiger Zeit auf die Reserven zurück, um die großen Verluste auszugleichen. Eilig und aufgeregt lief er seiner Mutter entgegen, um ihr die Nachricht zu überbringen. Doch auf Lidias Gesicht zeigte sich keine Spur der erwarteten Freude. Sie zog die Stirn in Falten und sagte nur leise: »Ich hatte gehofft, dass du nicht in den Krieg ziehen musst. Denk an Onkel Wanja und an Vaters Bruder, Onkel Leonid, die ihr Leben bereits für das Vaterland geopfert haben!«
»Das wird sicher nicht mehr lange dauern«, meinte Kolja voller Überzeugung, »unsere tapferen Soldaten haben den Feind in die Flucht geschlagen, und bald sind wir in Berlin!«
»Sei nicht so übermütig, verwundete Raubtiere können auch noch beißen«, warf sein Vater Nikita ein. Im Gegensatz zu seiner Frau war er stolz darauf, dass sein Sohn seinen Arbeitsplatz in der Fabrik nun gegen den Dienst in der Armee tauschen musste. »Du musst für mich mitkämpfen«, ermutigte er ihn, »denn seit meinem Arbeitsunfall kann ich leider nicht mehr eingezogen werden.«
»So können nur Männer reden!«, warf Lidia vorwurfsvoll ein. »Ich verstehe, dass ihr alles, auch euer Leben, für eure Heimat geben würdet, aber versteht auch mich. Wie sollte mein Leben ohne Sohn noch einen Sinn haben? Es ist zwar bedauerlich, dass Vater durch den Unfall oft Schmerzen hat, aber ich bin glücklich, dass er nicht in den Krieg ziehen muss und nicht erschossen werden kann.« Sie setzten sich an den Küchentisch. Keiner von ihnen fand die Worte für ein neues Gespräch. Kolja senkte den Kopf und sah auf die Tischplatte. Seine anfängliche Begeisterung war deutlich verflogen. Lidia sah ihren Sohn unauffällig von der Seite an, als wollte sie sich sein Gesicht noch einmal einprägen, ehe er das Haus verließ. Ein Lächeln huschte über ihr Gesicht, als sie seine weißblonden Haare betrachtete, die wie fast immer trotzig, ungebändigt und leicht lockig vom Kopf abstanden. Kolja hatte wohl bemerkt, dass sie ihn musterte. Ihre Blicke trafen sich, und wieder einmal stellte sie fest, dass er wohl die schönsten blauen Augen in der ganzen Umgebung hatte, genauso blau wie die seines Vaters. Seine breiten Schultern, seine kräftigen, schlanken Hände und seine stattliche Größe ließen ihr Mutterherz höher schlagen. Diesen Sohn im Krieg zu verlieren, konnte und wollte sie sich nicht einen Moment lang vorstellen.
»So, jetzt müssen wir uns überlegen, was Kolja mitnehmen muss«, sagte sie.
»Ich bekomme doch sicher alles von der Armee«, mutmaßte Kolja.
»Das Wichtigste schon, aber etwas von zu Hause musst du bei dir haben. Ich denke, ein Paar Socken mehr und ein Stück Speck können nicht schaden.«
»Vergiss nicht deine Musik«, ergänzte lächelnd der Vater und meinte Koljas Mundharmonika. Ein derart hektisches Treiben begann im Haus, dass sich Kater Borja eiligst einen ruhigen Platz auf dem Ofen suchte. Noch bis tief in die Nacht wurden neue Vorschläge gemacht, Adressen notiert, und es wurde Kolja immer wieder das Versprechen abgenommen zu schreiben, sobald die Umstände es zuließen. Dann begab sich die Familie zur Ruhe. Lange noch kreisten in Koljas Kopf die Gedanken um das, was ihn wohl erwarten würde. Als im Morgengrauen der Wecker lärmte, war ihm, als hätte er nur einige Minuten geschlafen.
Die Tage bis zur Abreise vergingen rascher, als Lidia es sich gewünscht hatte. Kolja wurde von seinen Kollegen im Betrieb teils neidisch, teils etwas besorgt verabschiedet. Doch alle verbargen ihre wahren Gedanken hinter lächelnden Gesichtern und halfen Kolja mit aufmunternden Sprüchen über den Abschied hinweg. Wer bereits gefallene Familienmitglieder zu beklagen hatte, vermied es, darüber zu sprechen.
Mit einer Freundin musste er seinen Abschiedsschmerz nicht teilen, da er sich vor einigen Wochen von einem Mädchen getrennt hatte. Sie waren sich im Betrieb nähergekommen und einen Sommer lang miteinander gegangen. Von seinen Schulkameraden waren einige bereits eingezogen worden. Die wenigen Bekannten, die in seiner Nähe wohnten, wünschten ihm alles Gute und eine schnelle, gesunde Heimkehr.
Der Tag der Abreise war gekommen. Die Familie setzte sich noch einmal schweigend zusammen, wie es der alte russische Brauch verlangt, um dem Abreisenden in Gedanken einen glücklichen Weg zu wünschen.
Bei der Sammelstelle fanden sich allmählich die neuen Kameraden ein, begleitet von ihren Familien. Man nickte sich zu, und manch ein Gesicht war Kolja aus dem eigenen Betrieb oder aus der Nachbarschaft bekannt. Die ersten Offiziere zeigten sich, die Unruhe wuchs. Ohne ein Wort steckte Lidia ihrem Sohn noch schnell eine kleine Metallikone zu. Kolja wehrte ab: »Was sollen meine Kameraden von mir denken?«
Doch Lidia sah ihm in die Augen und sagte: »Schaden kann sie sicher nicht, man kann ja nie wissen, was kommt!«
Eine energische Stimme befahl den Reservisten, sich in Reih und Glied aufzustellen. Letzte Umarmungen, Küsse, Tränen, dann standen die Zurückbleibenden wie ein verlorener Haufen beieinander, während sich die Männer formierten und einige etwas verlegen versuchten, kleine Abschiedsgeschenke zu verbergen. Ein weiteres Kommando erschallte, die jungen Burschen zuckten zusammen, und im noch nicht perfekten Gleichschritt begab sich die Kolonne, angeführt von einem Unteroffizier, von der Straße in einen nahen Hof, der durch einen Bretterzaun abgeschirmt war. Ein Posten schloss das Tor, während sich die Menge der zurückbleibenden Angehörigen langsam auflöste und nach Hause strebte.
Kolja und seine neuen Kameraden wurden geschoren, eingekleidet und ausgerüstet. Schließlich fanden sie alle im Schlafsaal zusammen. Bevor sich jedoch nächtliche Ruhe einstellte, führten sie Gespräche, tauschten Vermutungen über den weiteren Weg aus und suchten erste Kontakte. Koljas Gedanken drehten sich um sein Zuhause, um seine Eltern, um sein Heimatdorf und um seine Freunde. Wie sehr hoffte er, alle und alles wiederzusehen! Dauerte der Krieg noch lange, oder könnte er im Herbst bereits wieder zu Hause sein? Dann ebbte das Gemurmel allmählich ab, und der Schlaf gewann die Oberhand.
Früh, sehr früh wurden die Schlummernden unsanft durch eine befehlsgewohnte Stimme zum Aufstehen aufgefordert. Schlaftrunken und augenreibend eilten sie zum Waschhaus, um dann so schnell wie möglich in ihre Sachen zu kommen. Es blieb wenig Zeit bis zum Frühstück, und auch dieses war knapp bemessen. Nach dem Antreten wurde den jungen Soldaten dann mitgeteilt, dass sie nun mit Armeelastwagen bis zum Zug gebracht würden.
Als die Frühlingssonne höher stieg, wurde es recht warm unter den Planen, die bis auf die Rückseite geschlossen waren. Die Kameraden, die hinten saßen, hatten es gut. Sie konnten sich die Gegend ansehen, sich den frischen Wind um die Nase wehen lassen und den glitzernden Schnee sehen, der erst an wenigen Stellen zu schmelzen begonnen hatte. Die Lastwagen brummten monoton und einschläfernd durch die erwachende Natur, so dass die Köpfe einiger Kameraden vor Müdigkeit nach vorne sanken. Um sich munter zu halten, begann erst einer, dann ein anderer Witze zu erzählen. Einige berichteten von zu Hause, meist diejenigen, die ein Mädchen hatten zurücklassen müssen. Drei Kameraden hatten sich erst kurz vor ihrer Einberufung verlobt. Grinsend bemerkte Koljas Nachbar,Leonid Antonow, den Kolja aus dem Nachbarort kannte, das sei keine Garantie für die Treue der Mädchen, doch als er Koljas vorwurfsvolles Gesicht sah, stieg Röte in sein Gesicht. »Ich meine ja nur!«
Die Fahrt war nicht sehr bequem. Die Lastwagen, die der russischen Armee zur Verstärkung ihrer Transportmittel von den Amerikanern geliefert worden waren, ließen jeden Stoß auf der holprigen Straße ungefedert bis in die Sitzbänke durch. So waren alle froh, als sie nach einigen Stunden den Bahnhof erreichten. Anhand der immer breiteren Straßen und des stärkeren Verkehrs hatten sie bereits erkannt, dass sie sich Moskau näherten.
Etwas steifbeinig kamen die Soldaten der Aufforderung abzusteigen nach und stellten sich auf, während weitere Lastwagenkonvois eintrafen und sich ihrer Fracht entledigten.
Kolja ging es durch den Sinn, dass er bereits fast dreihundert Kilometer von seinem Dorf Larinskaja entfernt war. Er fragte Sergej Semjonow, seinen Schulkameraden, der gleich neben ihm stand. »Serioscha, was denkst du, wie weit es noch bis Berlin ist?«
»Hast wohl nicht gut aufgepasst in der Schule«, neckte ihn dieser, »so an die eintausendachthundert Kilometer werden es wohl sein!«
»So weit! Na, hoffentlich müssen wir diesen langen Weg nicht nur marschieren«, argwöhnte Kolja.
Ein Feldwebel forderte sie auf, ihm zu folgen. Es tat gut, sich wieder zu bewegen, weil die Kälte des späten Nachmittags durch die Kleidung drang. In der Bahnhofshalle wurden warme Graupensuppe und Brot ausgegeben. Dazu tranken sie Tee. Die Verpflegungsbeutel wurden aufgefüllt, und die einzelnen Gruppen begaben sich mit ihren Vorgesetzten auf die Bahnsteige, wo die Züge bereits auf sie warteten.
»Das fängt ja gut an«, murrte einer der Kameraden, der mit seiner Brille und der ungewöhnlich langen und spitzen Nase wie eine Maus aussah. Er schien wenig Respekt vor irgendetwas zu haben, da er sich im Laufe des Tages bereits über dies und jenes mokiert hatte. »So also schickt uns Mütterchen Russland in die Schlacht, in Viehwagen, wenn mich meine Augen nicht täuschen!«
»Besser als gelaufen«, entgegnete ein langer Bursche hinter ihm.
»Hast ja Recht. Ich habe im Moment vergessen, wie schwer unser Land zu leiden hat«, lenkte die Maus ein.
Sie kletterten in den Waggon und machten es sich im Stroh bequem. Immer mehr Kameraden drängten hinterher. Endlich war der letzte Mitreisende eingestiegen, und die Tür wurde krachend zugeschoben. Kurz darauf pfiff die Lok, der Zug ruckte an und verließ den Bahnhof.
Damit etwas Licht und Luft ins Innere des Wagens dringen konnte, öffneten sie die Waggonluken. Als einer der Kameraden seine Papirosa anstecken wollte, wurde er sofort ermahnt: »Pass auf, dass du nicht das Stroh in Brand steckst, sonst erreichen wir noch nicht einmal die Front!« Die Maus hatte sich indessen zu Kolja gesetzt und als »Pawel« vorgestellt. »Sag, was hast du für einen Beruf?«, fragte er, um im gleichen Atemzug fortzufahren: »Ich habe ein wenig Ahnung von Elektrotechnik und Motoren, jedenfalls theoretisch.«
»Ach so, du hast also studiert«, stellte Kolja fest.
»War mittendrin, als mich Mütterchen Russland in die Uniform steckte«, erklärte Pawel und fragte erneut: »Was machst du beruflich?«
»Ich arbeite als Mechaniker in einer Fabrik, die Teile für unsere Armeeausrüstung liefert.«
»Was für Teile und wofür?«, erkundigte sich Pawel neugierig. »Das darf ich dir nicht sagen, streng geheim«, witzelte Kolja.
Mit einem »Ist schon gut!« beendete die Maus das Gespräch.
Kolja kramte in seinem Sidor, seinem Armeerucksack, wobei ihm die Mundharmonika in die Finger kam. Er nahm sie zwischen die Hände, um sie etwas anzuwärmen. Das machte er immer so. Er war überzeugt, dass sie dadurch besser klänge. Bei den ersten probeweisen Tönen verstummte das Stimmengewirr, und jemand rief:
»He, du, Kamerad, kennst du das Lied Katjuscha oder den Sewastopolwalzer?«
»Ja, kenne ich«, erwiderte Kolja, und die ersten Töne übertönten das monotone »Rat, ratat, rat, ratat« der Räder an den Schienenstößen. Kaum hatte Kolja das Instrument abgesetzt, als bereits die nächsten Melodien vorgeschlagen wurden. So verging die Zeit recht schnell, bis sich Dunkelheit und Kälte im Wagen breitzumachen begannen.
»Nun, Kameraden, Schluss für heute«, beendete Kolja sein Konzert.
Nachdem der Beifall abgeebbt war, wurde eine Flasche von Hand zu Hand weitergereicht, bis sie bei Kolja angekommen war. »Trink auf deine Gesundheit. Du wirst es bald brauchen. Und bleib uns lange erhalten, damit wir deiner Mundharmonika auch weiterhin lauschen dürfen«, sagte ein Soldat, der etwas älter als die anderen war. »Ich weiß, wovon ich rede, bin gerade aus dem Lazarett raus und muss wieder nach vorne.«
Sofort richtete sich die gesamte Aufmerksamkeit auf ihn. »Erzähl, Kamerad, wo hat es dich erwischt?« »Meinst du, an welchem Körperteil, oder an welchem Ort?«, neckte der Angesprochene, der sich später als Ilja Petrenkow vorstellen sollte. »Es war bei der Schlacht im August vergangenen Jahres, bei Kursk, wo wir den faschistischen Eindringlingen einen Schlag aufs Maul gegeben haben. Da hat es mich an der Schulter erwischt. Glatter Durchschuss, aber leider hat es nicht gereicht, um nach Hause zu fahren.«
»Wohl keine große Lust mehr, das Vaterland zu verteidigen«, kam eine sehr junge und vorwurfsvolle Stimme aus der hinteren Ecke.
»Warte ab, wie lange deine Begeisterung anhalten wird«, entgegnete Ilja. »Wir verloren in den ersten Tagen über zwei Drittel unserer Kameraden. Meinen Schulfreund Bogdan erwischte es beim Sturmangriff. Er lief vor mir, blieb mitten im Lauf stehen, fiel rückwärts um und rührte sich nicht mehr. Mein Bauch, mein Bauch, stöhnte er. Seine Uniform war am Bauch zerfetzt, und aus dem Loch, so groß, dass zwei Fäuste reingepasst hätten, kam Blut. Ich ahnte mehr, als ich es wusste: Hier würde jede Hilfe zu spät kommen. Halte durch, die im Lazarett werden dich schon wieder zurechtflicken, versuchte ich ihn zu trösten. Plötzlich verlagerte sich das feindliche Feuer wieder auf unseren Abschnitt. Die Einschläge der Granaten lagen bedenklich nahe. Als mir die ersten Splitter um die Ohren sausten, versuchte ich meinen Freund – er hatte inzwischen das Bewusstsein verloren – in ein Bodenloch zu ziehen, um mehr Deckung zu haben. Fast hatten wir den Krater erreicht, als mir ein gewaltiger Schlag für einen Moment die Besinnung raubte. Nachdem ich wieder klar denken konnte, schüttelte ich die Erde ab und sah nach meinem Freund. Es war entsetzlich. Die Granate hatte ihn förmlich halbiert. Kopf und Oberkörper lagen vom zur Unkenntlichkeit zerrissenen restlichen Leib abgewinkelt auf der Erde, und nur einige Stoffteile der Uniform stellten noch die Verbindung der Teile her. An diesem Tag habe ich mir von einem Kameraden eine Flasche Wodka besorgt und sie ausgetrunken, um die Bilder in meinem Kopf zu vergessen. Es hat nichts geholfen. Oft genug sehe ich diesen Anblick vor mir und verfluche den ganzen Krieg und die, die ihn angefangen haben.«
Bei seiner Schilderung war es still im Wagen geworden.
Kälte strömte in den Waggon, und jeder versuchte, zum Schlafen eine möglichst bequeme Stellung einzunehmen. Den Kameraden in der Mitte des Wagens ging es gut,denn sie wurden von den neben ihnen Liegenden gewärmt, ebenso jenen, die dicht am kleinen Kanonenofen lagen, aber wer außen an der Wagenwand lag, bekam von einer Seite nur Kälte und Zugluft ab. Damit es gerecht zuginge, vereinbarten sie, dass die nächste Nacht sozusagen umschichtig geschlafen werden sollte.
Es gab nur einen kurzen Halt, bei dem die Aborteimer ausgeleert und neue Verpflegung verteilt wurde. Sobald der Tag dämmerte, versuchten einige, einen Blick aus den Luken auf die vorbeihuschende Umgebung zu werfen. Vielleicht konnte man sogar den Feind erspähen, dachte sie. Doch meist flogen an ihren Augen nur die Stämme der Birken und Kiefern wie ein nicht enden wollender Lattenzaun vorbei. Kam der Zug durch eine baumlose, noch tief verschneite Ebene, meinten manche in der Ferne Rauch zu sehen und rätselten über die Ursache.
Am zweiten Tag ging plötzlich ein starker Ruck durch den Zug, und das Kreischen der Bremsen ließ die Schlafenden hochfahren. Stimmengewirr wurde laut. Noch ein Ruck, und der Zug stand. Ehe sie sich versahen, wurde die Tür aufgerissen, und ein Befehl weckte sie endgültig auf.
»Aufstehen und marschbereit machen. Raus, raus und antreten!«, blaffte die heisere Stimme eines Feldwebels. Langsam kamen die jungen Soldaten zu sich, wozu der kalte Morgenwind seinen Teil beitrug, und stellten fest, dass sie auf einem arg zerstörten Bahnhof standen. Von den Stationsgebäuden standen fast nur noch die Außenwände. Ein kleineres Gebäude wurde gerade notdürftig mit Brettern eingedeckt. Nachdem sich alle Zuginsassen zu einer langen Marschkolonne formiert hatten und mit Verpflegung versorgt waren, verfrachtete man sie auf Lastkraftwagen. Noch war es der kleinen Gruppe um Kolja gelungen zusammenzubleiben. Sie hofften deshalb, auch alles Weitere gemeinsam durchstehen zu können.
Die Gerüchteküche kochte. »Wo werden wir hinkommen?«, überlegten sie sich. Sie wussten nur, dass sie die stark dezimierten Reihen einer Mot.-Schützenabteilung auffüllen sollten. Ob sie zur 1. oder 2. Belorussischen Front oder eventuell zur 1. Ukrainischen Front gehören würden, war ihnen noch nicht mitgeteilt worden. Am dritten Tag sahen sie aus der Öffnung der hochgeschlagenen Wagenplane die zerstörten Dörfer, zerschossene, ausgebrannte Panzer, Lastwagen und Geschütze beider Kriegsparteien.
Am vierten Tag erkannten sie an den Ortsschildern, dass sie sich im Gebiet von Brjansk befanden. Noch hatten sie keine Feindberührung. Die innere Anspannung stieg, und fast alle Gespräche gipfelten in dem ausgesprochenen Wunsch, endlich den Eindringlingen gegenüberzustehen, um sie zu vernichten.
Am Sammelpunkt angekommen, teilte man ihnen mit, welcher Front, welchem Regiment und welcher Division sie zugeteilt werden sollten. Kolja und seine kleine Gruppe kam zu den Mot.-Schützen der 1. Belorussischen Front unter Oberbefehlshaber K. K. Rokossowski. Nach einigen Tagen Ruhe und weiteren Umgruppierungen in der Truppe erhielten sie den Marschbefehl Richtung Westen. Dort hielten Verbände der Wehrmacht noch Frontabschnitte, die nun zurückerobert werden sollten. Nach der verheerenden Niederlage der deutschen Panzerarmee bei Kursk lautete die Devise, den Gegner nicht zur Ruhe kommen zu lassen und weiter westwärts zu treiben. Das war leichter gesagt als getan. Die Deutschen krallten sich verbissen in den russischen Boden und gaben erst nach schwersten Verlusten an Menschen und Material Meter um Meter ihre Stellungen auf.
Die Kompanie, zu der auch Kolja gehörte, zählte bald zur erfolgreichsten Kampfgruppe, die ihre Aufgabe trotz größerer Verluste mutig, oft sogar tollkühn löste.
So vergingen die Wochen, und bisher hatte es keinen Kameraden aus der kleinen Gruppe um Kolja erwischt. Man munkelte, eine große Offensive wäre in Vorbereitung. Genaues jedoch konnten sie nicht erfahren, da alles unter strengster Geheimhaltung vorbereitet wurde. Aus Erfahrung und vertraulichen Gesprächen unter Freunden wussten sie, dass es auch besser war, sich nicht zu offen und zu interessiert über die Angriffspläne zu unterhalten. Hatte man doch schon von Fällen gehört, wo allzu neugierige Kameraden von Politoffizieren, den Politruks, zur Rede gestellt oder sogar als Spione verurteilt wurden. Diese Agitations- und Propagandakader begleiteten die Truppen auf Schritt und Tritt. Viele von Koljas Kameraden empfanden sie so lästig und überflüssig wie die Läuse, denen man auch nicht entgehen konnte.
Sicher, es gab Armeezeitungen, die in fahrbaren Druckereien bis dicht an die Front gedruckt wurden. Sie informierten meist sachgerecht, aber manchmal ein wenig zu euphorisch über die Erfolge der Armee und den Verlauf der Kämpfe. Über zukünftige Strategien und militärische Planungen war darin selbstverständlich nichts zu lesen.
Koljas Mot.-Schützenkompanie wurde in den folgenden Wochen aufgrund ihrer Leistungen an verschiedenen Orten eingesetzt. Sie erfüllte ihre Vorgaben weiterhin so gut, dass sie zunehmend dort eingesetzt wurde, wo es sozusagen »brannte«.
Die Verluste in den eigenen Reihen nahmen zu. Der anfängliche Enthusiasmus dagegen nahm mit der Anzahl der Einsätze rapide ab. Selbst die ab und zu verordneten Wodkarationen konnten den Kampfgeist nur kurzfristig anfachen. Alle warteten angespannt auf den großen Tag, an dem die erwartete Großoffensive beginnen würde. Die Zeichen dafür mehrten sich. Schweres Gerät wie Panzer und Artillerie traf ein und wurde gut getarnt untergebracht.
Um Kolja hatte sich in den gemeinsamen Wochen eine feste, freundschaftliche Gruppe gebildet, die nun auf den Tagesbefehl wartete. Der Einsatz sollte in der Nähe der Stadt Bobruisk stattfinden, wo die Deutschen einen erfolgreichen Vorstoß Richtung Gomel unternommen hatten. Der Frühsommer war da, und neues, kräftiges Grün bedeckte das geschundene Land. Da erklang es wie ferne Trompeten. Kolja schaute überrascht nach oben in den blassblauen Himmel. Ja, da waren sie, die Kraniche auf dem Heimflug aus wärmeren Gegenden! Er schirmte die Augen gegen die Sonne mit der Hand ab, um sie besser beobachten zu können. Ob sie wohl auch über Larinskaja fliegen und die Eltern sie sehen würden? Bei diesem Gedanken wurde es ihm eng um die Brust, und nur mühsam konnte er die Tränen zurückhalten.
»Wo die wohl den Winter verbracht haben?«, murmelte Kolja leise.
Auch Serioscha schaute der keilförmigen Flugformation nach. »Ich habe das in der Schule auch gefragt, und unsere Lehrerin meinte, die Kraniche würden die kalte Jahreszeit in China und Indien verbringen.«
»Das müssen ja viele tausend Kilometer sein«, bewunderte Kolja diese Flugleistung.
»Ja, denk daran, wenn du wieder einmal meinst, es wäre ja noch so weit bis Berlin«, antwortete sein Freund, lachte und spuckte die Schalen einiger Sonnenblumenkerne Richtung Westen.
Warum kann nicht endlich wieder Frieden sein?, dachte Kolja, als sie sich der Frontlinie näherten. Wie mag es jetzt bei uns zu Hause aussehen? Geht es den Eltern gut? Bin ich bald wieder zurück, um meinem gewohnten Leben nachgehen zu können?
Unvermittelt und noch ehe sie ihre vorgesehene Stellung erreicht hatten, wurden sie bereits vom gegnerischen Feuer eingedeckt. Sie zerrten ihre kleine Kanone in den Schutz einer Hauswand und suchten eine Möglichkeit für einen gezielten Schuss. Die feindliche Deckung war ausgezeichnet. »Ich versuche näher an die Stellung heranzukommen. Die Häuserruinen werde ich als Deckung benutzen«, sagte Kolja zu Pawel, schnappte sich ein von den Deutschen erbeutetes Fernglas und sprang wie ein Hase von Hausecke zu Hausecke in Richtung der feindlichen Stellung.