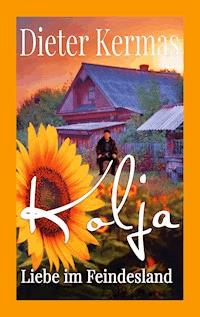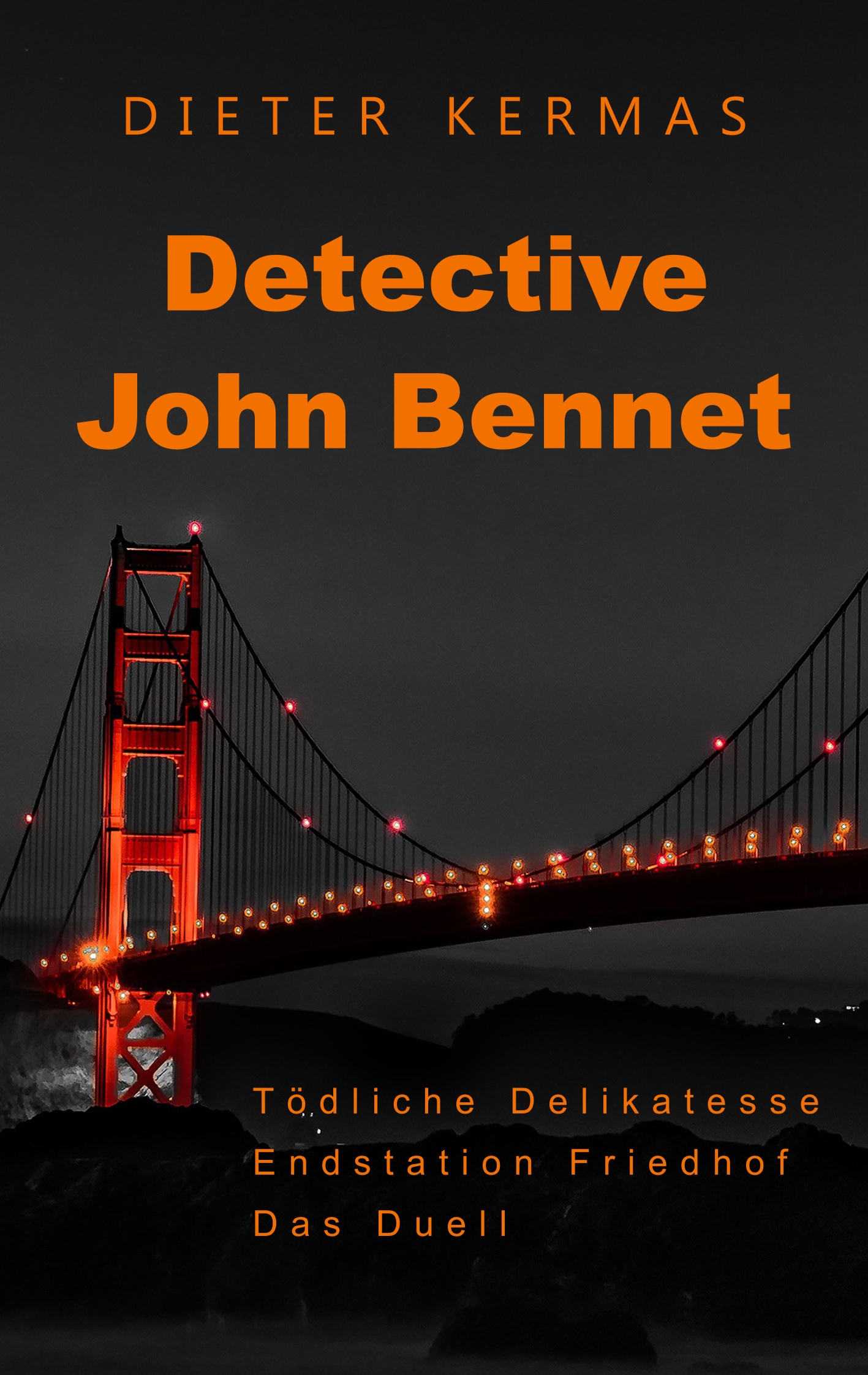Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Biologe Julian muss auf seiner neuen Arbeitsstelle gefährliche Abenteuer bestehen. Auf dem Mars drohen Aufstände, Hungersnöte und Angriffe von Androiden. Auf der Erde versucht sich Drago, ein Kollege, gewaltsam Julians Freundin Johanna zu bemächtigen. Eine Intrige bringt Julian ins Mond-Straflager Luna 22. Er wird rehabilitiert und Drago landet ebenfalls im Lager auf dem Mond. Johanna fliegt zum Straflager, um sich an Drago zu rächen.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 315
Veröffentlichungsjahr: 2023
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Das Vibrieren des Kopfkissens weckte mich. Leise Musik ertönte. Auf der Wand las ich: 7.00 Uhr, Freitag 13. Juli 2333. Kaffeeduft reizte mich, schnell zu duschen. Den Kaffee hatte ich mir von eigenem Geld gekauft, weil er nicht, wie die Lebensmittel, vom Staat kostenlos geliefert wird. Ich schlurfte in die Gesundheitskabine. Aus Düsen wurde der Körper mit Waschlotion besprüht. Ich hielt meinen Kopf in eine vorgeschriebene Position und befahl »Kopfwäsche«. Das Haarwaschmittel war wieder zu reichlich und biss in die Augen. Ich fluchte: »Genug, spülen«! Den folgenden Duschvorgang für den Körper empfand ich zu kalt und ordnete an: »Etwas heißer!« Die Temperatur Automatik schien defekt zu sein, denn der Strahl aus den Düsen war so heiß, dass ich mir keine Zeit mehr nahm, um den Befehl zu korrigieren, sondern sprang pitschnass aus der Kabine. Das Wasser stoppte sofort und ging zum Heißluft - Trockenprogramm über. Ich trat wieder in die Zelle und ließ mich wohltuend trocknen. Rasieren war in diesem Monat nicht nötig. Eine Bartentfernungscreme verhinderte den Haarwuchs für gut vier bis fünf Wochen. Ich betrachtete meinen Körper und stellte zufrieden fest, dass er für seine achtunddreißig Jahre noch respektabel in Form war. Bevor ich in die Einheitsmontur schlüpfte, gab ich den Reparaturbefehl für die Wassertemperatur an die Technikzentrale der Wohnanlage.
Jetzt freute ich mich auf die Tasse Kaffee und auf den Energiedrink, der leicht angewärmt auf dem Tisch wartete. Die dickliche Flüssigkeit im Glas schimmerte grüngelb. Nicht meine Lieblingssorte, stellte ich fest. Ich hatte die Auswahl für das morgendliche Getränk, der Menüautomatik überlassen. Für morgen suchte ich mir eine andere Geschmacksrichtung.
Noch hatte ich in paar Minuten Zeit, lag auf meinem Gesundheitssessel und schaute mir auf der Wand die neuesten Nachrichten an.
Wie immer kamen zuerst die üblichen Warnmeldungen der Wetterwarte. »Tropischer Wirbelsturm im Nord-Pazifik mit dreihundert Stundenkilometern. Evakuierungsmaßnahmen für Hawaii angeordnet. Tsunamis bedrohen die Inseln in diesem Gebiet. Weiterhin …«
Ich löschte die Anzeige mit einer Handbewegung.
Viele werde von der Evakuierung nicht betroffen sein, seit der Meeresspiegel über die Hälfte der Insel überspült hatte, dachte ich. Im Laufe der Jahre suchten die meisten Hawaiianer und Tausende andere Inselbewohner Zuflucht in höhergelegenen Ländern.
Bereits vor sehr langer Zeit gelang es den Menschen nicht, die Temperatur auf der Welt zu senken. Die Polkappen begannen abzuschmelzen. Die Arktis war eisfrei und die Antarktis schmolz schneller ab, als prognostiziert. Orte, die ich nur aus alten Filmen und Reiseberichten kannte, verschwanden.
Der Gesundheitssessel mahnte: »Nur acht Minuten bis zum Verlassen der Wohnung Julian«. Ich hatte die Zentrale gebeten, mich in meinen vier Wänden nur mit dem Vornamen anzusprechen und die Personalnummer wegzulassen. Die früher üblichen Anreden wie Frau und Herr und die Höflichkeitsform »Sie« hielt man für als veraltet und verbot sie.
»Ja, weiß ich«, knurrte ich. Es ist persönlicher, mit einem Namen angesprochen zu werden. Nach zähem Ringen hatte die heutige Weltregierung nachgegeben und uns für die Vereinfachung der Verwaltungstätigkeit vorgesehenen Personalnummern gestattet, wieder zusätzlich Namen zu tragen.
Die alten Familiennamen waren damals abgeschafft worden. Es war seitdem möglich, der Personalnummer einen Vornamen hinzuzufügen. Gerne bediente man sich der Vornamen von berühmten Personen. In meinem Fall den von einem römischen Kaiser.
Mein Arbeitsplatz lag nur einen Kilometer entfernt. Ich arbeitete als Nahrungsmittelbiologe in einem Spaceinstitut. Vornehmliche Aufgabe der Forschung war die Zucht von strahlenresistenten Nutzpflanzen, im Besonderen von Gemüse für Mars-City.
Die Rückkehr zu den seit der Frühzeit zur Nahrung dienender Pflanzen, hatte einen wissenschaftlichen Grund. Nachdem die Menschheit die Erde überbevölkert hatte, wurden die Ressourcen an gesunden Nahrungsmitteln knapp. Darauf stellte die Industrie immer mehr künstliche Lebensmittel her. Damit schien die Lösung für die Versorgung, gefunden zu sein. Es dauerte nicht lange und die Menschen litten an neuen Krankheiten, wie Allergien, Darmkrankheiten, psychischen Schäden und vor allem hatten sie früher und akuter mit Demenz beziehungsweise Alzheimer zu kämpfen. Die Langzeitstudien zeigten, dass Versuchspersonengruppen, die mit natürlichen Lebensmitteln versorgt wurden, weitaus widerstandsfähiger blieben. Darauf beschloss man, zum Glück hatte sich die Anzahl an Menschen durch die Seuche reduziert, weitgehend wieder auf die frühere Landwirtschaft umzusteigen, um gesunde Nahrung anzubieten. Meine Aufgabe ist es, entsprechendes Gemüse für die Marsstation zu erforschen.
Inzwischen hatte sich der Mensch auf dem Mars etabliert und eine kleine Stadt entstehen lassen.
Der rote Planet sollte als Basisstation für weitere Erkundigungen von entfernteren Planeten dienen. Bisher war er nur von Wissenschaftlern und Technikern bewohnt.
Ein Lift transportierte mich sanft auf die Straßenebene, wo die Laufbänder entlangführten. Mit einem Schritt betrat ich das Band und traf auf meinen Kollegen und Freund Julius. Er war klein, mager und von cholerischem Charakter. Die Wahl sich Julius nach dem Imperator Cäsar zu nennen hatte ihn immer wieder Spott eingebracht. Er war auf seinem Spezialgebiet, der Genmanipulation bei Hülsenfrüchten, unbestritten eine Koryphäe.
»Guten Morgen Julius«, begrüßte ich ihn.
»Guten Morgen Julian«, antwortete der Arbeitskollege und mit einem Blick zum Himmel, der in einem gelblich- trüben Licht erschien, setzte er hinzu: »Wetten, bis zum Feierabend wird es einen Sandsturm geben. Ich höre bereits jetzt den Sand zwischen den Zähnen knirschen«, murrte er.
Wir arbeiteten beide im Institut zur Steigerung der Erträge bei Nutzpflanzen. Er im Genlabor, ich in der Anzuchtabteilung.
Am Umsteigekreis des Laufbandes nahmen wir den Abzweig zur Arbeitsstelle. Jemand rempelte mich unsanft an und eilte, ohne Entschuldigung, weiter.
»Hast du den gesehen?«, regte sich Julius auf. »Kein Wort der Entschuldigung«.
Ich hatte im Dämmerlicht den blauen Ring um den Hals des Davoneilenden entdeckt.
»Was erwartest du von einem Perbot? Ich habe ihn erkannt, er ist der Perbot von unserem werten Doktor Henry.«
Nur am blauen Ring sah man den optischen Unterschied zwischen dem Perbot und dem Doktor. Auf das perfekte Ebenbild eines Perbots mit seinem menschlichen Original wurde großer Wert gelegt. Allein an der Ergänzung PR hinter dem Namen auf der Brust, oder zusätzlich, wie beim Perbot des Doktors, am blauen Ring, erkannte man den Androiden, den künstlichen Menschen.
»Besonders dem persönlichen Robot eines Doktors sollte man bessere Manieren beibringen«, lästerte Julius.
»Warten wir ab, bis du einen eigenen Perbot haben wirst. Den kannst du dann meinetwegen im Tanzen unterrichten«, neckte ich meinen Begleiter.
»Daran ist vorläufig nicht zu denken«, winkte Julius ab. »Es sei denn, dass ich in der nächsten Zeit eine sensationelle Entdeckung mache und mir somit einen eigenen Perbot verdient habe.«
Wir waren angekommen und standen in der Schlange der Beschäftigten.
Nach der Einlasskontrolle begaben wir uns in unsere Sektionen. Er eilte ins Genlabor und ich zum Gewächshaus für Nutzpflanzen.
Ich zog mich um und sah nach den Wachstumsfortschritten der bestrahlten Gemüsesorten. Meine Stirn legte sich in Falten. Die erhöhte Strahlung von gestern war dem Kohl nicht bekommen. Welk und verfärbt hingen die Blätter herab oder lagen abgefallen am Boden.
»Du wolltest wieder mal zu schnell zum Erfolg kommen«, riss mich eine angenehme Frauenstimme aus dem Grübeln. Es war Johanna. Seit einigen Monaten waren wir uns privat nähergekommen. Ich hoffte inständig, dass sich unsere Beziehung verfestigte.
»Du schleichst dich an, wie eine Katze an die Maus«, spottete ich.
»Wenn du dich als Maus fühlst, dann bin ich gerne die Katze«, gab sie lachend zurück.
Ich sah in ihre enzianblauen Augen und mein Kreislauf beschleunigte sich rapide.
In diesem Moment erinnerte ich mich daran, welch gütiges Schicksal uns zusammenführte.
Bei einem Kongress vor zwei Monaten saß sie zufällig neben mir. Die trockenen, wissenschaftlichen Vorträge ermüdeten unsere Aufmerksamkeit nach kurzer Weile. Ich fand sie sofort anziehend und wollte die Gelegenheit nicht vergehen lassen, Kontakt mit ihr aufzunehmen. Leise wandte ich mich an meine Nachbarin und stellte mich vor. Ihr prüfender Blick ging mir durch und durch, ehe sie ebenso unterdrückt antwortete:
»Ich heiße Johanna und arbeite in der Abteilung für Fotosynthese«. Den Doktortitel erwähnte sie nicht. Ich wollte mehr von ihr erfahren und, um nicht zu neugierig zu erscheinen, unterließ ich Fragen nach ihrem privaten Umfeld, sondern erkundigte mich nach ihrer Arbeit. So gedämpft wir sprachen, störte es doch die Umsetzenden, die uns ermahnten, mit der Konversation lieber bis nach den Vorträgen zu warten. Ich bat sie, mit mir die Unterhaltung später fortzusetzen. Sie nickte und wandte sich, jetzt wieder aufmerksam, dem laufenden Vortrag über ihr Fachgebiet, der Fotosynthese, zu.
Im Foyer suchten wir uns eine ruhige Ecke und setzten das Gespräch fort. Es stellte sich heraus, dass sie nur einen Block weiter in einer Einraumwabe wie ich wohnte. Das ließ mich aufatmen, denn wer in einer Einraumwabe lebt, der ist nicht verheiratet. Anderenfalls hätte sie Anspruch auf eine Zweiraumwabe. So nebenbei erfuhr ich, dass sie fünfunddreißig Jahre alt war.
Wir unterhielten uns recht angeregt, bis wir feststellten, dass sich das Foyer längst geleert hatte.
Ich bat, sie nach Hause begleiten zu dürfen. Sie überlegte kurz, lächelte und willigte mit den Worten ein: »Den Vorschlag nehme ich gern an, Julian«.
Allein wie sie meinen Namen aussprach, ließ mir einen freudigen Schauer über den Rücken laufen.
Auf dem Laufband trafen wir Julius, der, als er mich, zusammen mit einer Frau sah, nicht grüßte, sondern mit einem Grinsen, dessen nur ich gewahr wurde, weiterging.
Mit den Worten: »Hier wohne ich«, riss mich Johannas Stimme aus meiner Beobachtung. Das Gebäude unterschied sich nicht von dem meinen, denn die Häuser im großen Wohnkomplex, sahen alle gleich aus. Sie bedankte sich für die Begleitung und verabschiedete sich mit einem festen Händedruck, der schon lange nicht mehr üblich war. Das verstärke das Gefühl, ihr näher zu kommen. Im Weggehen schaute ich ihr nach, bewunderte den enganliegenden Overall und merkte mir schnell die Hausnummer.
Vor meiner Haustür erwartete mich Julius.
»Komm schon mit rauf«, lud ich ihn ein. Ich sehe doch, dass du vor Neugier platzt.«
Die Wohnungstür öffnete sich in der Sekunde, wo ich davorstand. Sie reagierte auf mein Gesicht.
»Mach es dir bequem«, forderte ich den Freund auf, der sich daraufhin in den Gesundheitssessel fallen ließ. »Einen Kaffee, oder etwas Anderes?«, fragte ich.
»Gäbe es heutzutage noch Alkohol, so bäte ich darum«, witzelte er. »Ein Kaffee nach so einem langen Arbeitstag tut es fast genauso gut.«
Meine Aufforderung an die Küchentechnik lieferte umgehend zwei Tassen des Getränks, beide mit einem Schuss synthetischer Milch, wie wir ihn gerne tranken. Ich setzte mich auf den Arbeitsstuhl ihm gegenüber und nahm den ersten Schluck Kaffee.
»Schieß endlich los«, drängelte er und stellte die Rückenlehne des Sessels etwas bequemer ein.
In kurzen Sätzen schilderte ich, wie ich sie kennengelernt hatte. »Möchte wissen, was Doktor Johanna an dir so besonderes findet?«, stichelte Julius.
»Sie hat einen Doktortitel?«, fragte ich verblüfft. »Woher weiß du das?«
»Vor einem Jahr gab es ein gemeinsames Forschungsprojekt. Da traf ich sie zum ersten Mal. Hätte ich damals mehr Mut gehabt, sie anzusprechen, hättest du heute vielleicht nicht die Chance bekommen«, gab er zu bedenken. Im Nachsatz bekannte Julius sichtlich bekümmert: »Kann nicht jeder so gut aussehen wie du.«
»Lass mal, die Frau, die zu dir passt, legt gewiss mehr Gewicht auf Geist und innere Werte«, tröstete ich ihn.
Wir unterhielten uns, bis es dunkelte.
»Wird Zeit, nach Hause zu trotten«, gähnte Julius und, mit einem Blick aus dem Fenster:
»Ich ahnte es, und jetzt muss ich den Heimweg bei einem Sandsturm antreten.«
»Du darfst bis morgen im Sessel liegenbleiben«, schlug ich, nicht ganz ernstgemeint, vor.
»Danke für das Angebot, nichts gegen die bequeme Liege, aber ich fühle mich in meinen vier Wänden sicher wohler«, ließ er mich wissen.
Ich brachte ihn zur Tür und im Weggehen rief er zurück: »Ich bin gespannt, wie es mit euch weitergehen wird.«
Ich auch, dachte ich und schloss die Tür.
In der Institutskantine hatte ich nur wenig gegessen. Mit einem Druck auf die Menükarte, wählte ich Geflügelsteak mit gewürztem Reis und einer Beilage aus Seetang. Das Steak bestand aus Kunstfleisch und nur mit dem schmackhaften Reis und dem salzigen Seetang gelang es mir, dem Mahl etwas Geschmack abzugewinnen.
Nach einer wohltuenden Dusche ließ ich das Bett aus der Wand aufklappen, warf mich hinein und wartete darauf, in den Träumen Johanna zu begegnen.
Ich saß mit Johanna am Südseestrand, die Palmen wiegten sich sanft in der Meeresbrise und der Kokosnusscocktail schmeckte köstlich. Ihre blauen Augen strahlten mich an, ihr roter Mund näherte sich… In diesem Moment vibrierte das Kopfkissen heftig und störend. Weg waren Johanna und die Südsee.
Verdammt hätte das Kissen nicht ein paar Minuten mit dem Wecken warten können?
Missmutig klappte ich das Bett in die Wand, absolvierte mein Reinigungsprogramm und orderte keinen schlabbrigen, gesunden Energiedrink an, sondern eine doppelte Portion Kaffee. Aus Vernunftgründen aß ich zwei Getreidepresslinge mit Schokoladenaroma.
Während ich frühstückte, schaute ich auf die gegenüberliegende Wand, wo die Nachrichten erschienen. Die Kapriolen der Natur, wie plötzlich auftretende Tornados, Springfluten oder Vulkaneruptionen, führten dazu, dass man den weltweiten Wetterbericht stets am Anfang der Informationen sendete. So wurden Bewohner vor Katastrophen rechtzeitig informiert.
Beruhigend, es gab zurzeit keine derartigen Hinweise. Es folgten lokale Meldungen, die mit einer dringenden Warnung eröffneten.
»In der vergangenen Nacht geriet der Perbot, eines namhaften Wissenschaftlers aus dem Strahlenforschungsinstitut in der Straße 543, außer Kontrolle.«
Ich war sofort hellwach, denn das Labor befand sich nur zwei Häuserblocks weiter auf der anderen Straßenseite. Der Sprecher fuhr fort:
»Die bisherigen Verlautbarungen der Sicherheitskräfte besagen, dass die Fehlfunktion des Bots vermutlich durch eine versehentliche Dosis hochfrequenter Strahlung ausgelöst wurde. Der Perbot hat, nachdem er große Zerstörung im Labor angerichtet hatte, das Gebäude verlassen und ist untergetaucht. Ein Wachmann, der ihn daran hindern wollte, wurde zur Seite gedrängt, ohne dass er Schaden nahm. Wir gehen davon aus, dass das Programm, das alle Bots hindert, Menschen zu verletzen oder gar zu töten, noch intakt ist. Trotzdem warnt die Polizei davor, sich dem Perbot zu nähern. Achtung: Sie erkennen den gesuchten Perbot an seinem blauen Ring um den Hals, der ihn als Mitarbeiter im besagten Institut ausweist. «
Über die Bezeichnung den Androiden als Mitarbeiter zu titulieren, wunderte ich mich. Unter Mitarbeiter verstand ich immer noch menschliche Wesen. Wie sich die Zeiten doch ändern.
Ich löschte die Nachrichten mit einer Bewegung. Der Bericht würde für ausreichend Gesprächsstoff im Institut sorgen, da war ich mir sicher. Heute vermied ich, mich in den Erholungssessel zu legen, oder auf die Aufforderung zu warten, dass ich in soundso viel Minuten zur Arbeit aufbrechen müsse. Ich fuhr ins Erdgeschoss, um Julius nicht zu verpassen.
Schau an, es hatte ihn früher als sonst aus dem Haus getrieben. Er wartete bereits unten im Flur. Sicher waren die Nachrichten der Grund dafür.
»Was für eine Geschichte«, begann er, ohne gegrüßt zu haben.
»Guten Morgen Julius, war es die Warnung vor dem Perbot, die dich so früh aus dem Haus gejagt hat?«, grüßte ich besonders betont.
»Entschuldige bitte, dir auch einen guten Morgen«, und im Nachsatz: »Ich kann mich nicht erinnern, dass sich in den letzten Jahren ein Bot selbstständig gemacht hat. Soweit ich weiß, wird jeder Robot, der eine Fehlfunktion aufweist, automatisch außer Betrieb gesetzt.«
Kurz darauf näherten wir uns mit dem Laufband dem Institut. Von Weitem sahen wir drei Liftras von den Sicherheitskräften über dem Gebäude schweben. Ein Liftra war direkt vor dem Eingang gelandet.
Vor dem Haus hatte sich eine große Menschenmenge versammelt, die von den schwarzgekleideten Sicherheitskräften immer wieder aufgefordert wurden, weiterzugehen.
Da wir ein paar Minuten Zeit hatten, verließen wir das Laufband und mischten uns unter die Zuschauer.
»Julian, siehst du den alten, grauhaarigen Mann, den die zwei Sicherheitsleute zum Liftra bringen?«
»Ja, ist das etwa der Doktor, dem sein Perbot entwischt ist?«
»Genau, ich kenne ihn, er hat mir für meine Genveränderungen wertvolle Tipps aus seinem Fachgebiet der Strahlung gegeben. Er heißt Maximilian.«
»Weißt du, ob er für das Verschwinden seines Perbots haftbar gemacht werden kann?«
»Das ist zwar möglich, soweit ich weiß, aber alle Eigentümer müssen ihren Perbot gegen viele Arten von Schäden, die er anrichten kann, versichern.«
»Lass uns verschwinden«, drängte ich. Nicht weil ich so scharf darauf war, mich in meine Arbeit zu stürzen, sondern es nicht erwarten konnte, Johanna in ihrem Labor zu besuchen.
Wir begaben uns wieder aufs Laufband und trennten uns dann am Eingang zur Arbeitsstelle. Die Anwesenheit eines jeden Beschäftigten wurde automatisch über einen in der Kleidung vorhandenen Chip erfasst, sobald er das Gebäude betrat. Nicht dokumentiert wurde sein Weg innerhalb des Hauses, sodass ich ohne Gewissensbisse sofort zur Fotosynthesabteilung eilen konnte. Meine Enttäuschung war groß, als ich Dana in ihrem Büro vorfand. Ihre Freundin und Arbeitskollegin teilte mir mit, Johanna hätte sich krankgemeldet. Und ich hatte mich so darauf gefreut, ihr vom Traum der letzten Nacht zu erzählen. Ich nahm mir vor, sie sofort nach der Arbeit aufzusuchen. Dana war das ganze Gegenteil von Johanna. Sie war klein, zierlich und zurückhaltend. Trotz ihrer braunen Augen, dem leicht südländischem Aussehen und dem bezaubernden Lächeln, was sie viel zu selten zeigte, war sie im Grunde genommen, eine graue Labormaus. Sie war unverheiratet und Johanna war für sie so etwas wie eine große Schwester.
In der Mittagspause saß ich mit Julius und Drago, meinem direkten Vorgesetzten zusammen. In Dragos Anwesenheit unterblieben Gespräche privater Natur von alleine. Er, ein Machtmensch durch und durch, dem man nachsagte, er hätte seinen Posten nur durch unsaubere Mittel bekommen, sollte man nicht über den Weg trauen. Selbst in der heutigen Zeit, wo die Durchschnittsgröße bei Männern bei einhundertfünfundneunzig Zentimetern lag und bei Frauen um einhundertachtzig, musste ich mit meinen zwei Metern zu ihm hochschauen. Er überragte mich um zehn Zentimeter. Kaum hatte er sich an unseren Tisch gesetzt, verdrehte Julius die Augen, als wollte er sagen, der hat mir gerade noch gefehlt. Drago grüßte knapp und hob sofort an, unaufgefordert über den verschwundenen Perbot zu reden.
»Wenn mir das mit meinem Perbot passiert wäre«, begann er, um uns daran zu erinnern, dass er einen Perbot besaß, »würde ich ihn zum Abschuss freigeben.«
Wir zuckten zusammen. Zum Abschuss freigeben, was für eine überholte Wortwahl. In den vergangenen Jahrhunderten war mehr als genug geschossen worden.
Heute überwachte die Weltregierung die Menschen so engmaschig, dass Zusammenrottungen sofort erkannt und rigoros unterbunden wurden. Die Ausnahme bildete das Erinnerungsfest. Dem staatlichen Fest, welches am 7. Juli an die Gründung der Weltregierung erinnern sollte, blieb ich seit langen fern. Auf dieser Massenveranstaltung durfte sogar Alkohol, der sonst strikt verboten war, ausgeschenkt werden. Die Wirkung auf die Menschen, die ein Jahr lang abstinent gelebt hatten, war verheerend. Die Sicherheitskräfte hatte alle Mühe, die aufkommenden Streitereien zu unterbinden. Selbst hier konnte sich niemand der Kontrolle des totalitären Regimes entziehen.
Ehe wir zu Wort kamen, verbreitete er ungefragt seine Theorie, was der entflohene Perbot alles anstellen könnte.
»Stellt euch vor, es gelänge ihm, in den nächstgelegenen Ländergroßraum zu kommen. Da könnte er von unseren Sicherheitsleuten nicht mehr geortet werden. Er könnte Schaden anrichten, ohne dass ihn jemand daran hindern würde. Brächte es der flüchtige Perbot fertig, die Grenze zu überschreiten, was ohne Probleme möglich wäre, da es keine Grenzkontrollen mehr gab, so müsste die hiesige Verwaltung der anderen eine Erlaubnis zur Festnahme erteilen. Das konnte dauern, da sich an der trägen Bearbeitung in Verwaltungen bis zum heutigen Tag nicht geändert hatte. Die Genehmigung beinhaltete nach dem Gesetz, den Flüchtigen mit einem Funkbefehl augenblicklich zu neutralisieren. Dieser musste aus einer Distanz von weniger als einhundert Metern abgegeben werden, um zu wirken.«
Julius setze zu einer Antwort an, die Drago mit einer Handbewegung stoppte. Ungerührt fuhr dieser fort:
»Mir könnte das nie passieren, denn ich habe meinen Perbot so programmieren lassen, dass er sich nie weiter als einen Kilometer von mir entfernen kann«, wobei er in meckerndes Gelächter ausbrach. Aus den Augenwinkeln sah ich, wie sich das Gesicht meines Freundes rötete. Ich kannte seinen cholerischen Charakter und ahnte gleich einen Ausbruch. Wahrscheinlich hätte er so ungestüm geantwortet, dass es ihm später reute.
Beruhigend legte ich meine Hand auf die seine und erinnerte daran, dass wir die Mittagspause schon weit überschritten haben. Er reagierte wie erwartet, blickte Drago noch einmal mit zusammengezogenen Brauen an, wandte sich dann mir zu und nickte zustimmend mit dem Kopf, wobei er murmelte:
»Mir kommt gleich mein Mittagessen hoch.«
Drago, der das gehört hatte, starrte ihn mit seinen fast schwarzen Augen feindlich an und entfernte sich grußlos.
Wir verließen die Kantine und Julius fragte mich, ob er heute Abend für einen Plausch zu mir kommen dürfte, worauf ich entgegnete:
»Entschuldige, aber ich beabsichtige, Johanna zu besuchen, um zu sehen, wie es ihr geht.«
Er stellte sofort seinen Wunsch zurück und bat mich, ihr seine Genesungswünsche auszurichten.
Daheim erholte ich mich unter der Dusche, zog einen neuen Overall an und betrat kurze Zeit später das Haus, in dem Johanna wohnte. Sie hatte sich ihren Namen nach der französischen Nationalheldin Johanna von Orleans gewählt. Ich fand, dass er perfekt zu ihr passte.
Sie öffnete die Tür und ich sah erschrocken, wie leidend sie aussah.
»Komm erst einmal herein«, forderte sie mich auf und lief voraus ins Zimmer, wo ich sogleich bemerkte, dass sie im Gesundheitssessel gelegen haben musste, da dort eine Decke lag.
Ehe ich fragen konnte, was sie aus der Bahn geworfen hat, lächelte sie mich bereits tapfer an und verkündete mit schwacher Stimme:
»Das muss gestern Abend der Fischsalat gewesen sein. Ich hatte ihn einen Tag vorher bestellt, hatte aber keinen Appetit und stellte ihn in das Kühlfach. Das hat nicht gereicht und es haben sich sicher Keime entwickelt, die mich außer Gefecht gesetzt haben.« Sie hatte die Haube, die sonst komplett den Kopf umschloss, abgenommen. Die Haare, die die Menschen vor Jahrhunderte noch schmückten, waren inzwischen einem dünnen Haarflaum gewichen. Dieser hatte bei ihr einen rötlichen Schimmer. In historischen Filmen hatte ich gesehen, welche Haarpracht früher bei Frauen normal war und stellte mir in diesem Moment vor, wie sie damit aussehen würde. Noch viel reizvoller, da war ich mir sicher.
Wir setzten uns, sie orderte Tee und wir diskutierten über den verschwundenen Perbot von Doktor Maximilian. Bald merkte ich, wie sehr sie unser Gespräch anstrengte, und verabschiedete mich, nicht ohne ihr weiterhin, gute Besserung zu wünschen. An der Wohnungstür konnte ich mich nicht zurückhalten, zog sie sanft an mich und drückte sie leicht. Sie ließ es zu und ihr Gesicht bekam urplötzlich eine gesunde Farbe.
Am Lift stehend rief ich ihr zu: »Ruf mich bitte an, wenn du etwas brauchst.«
»Mach ich«, kam die Antwort und die Tür schloss sich.
Ich aß eine Kleinigkeit, schlüpfte in meinen weichen, zweiteiligen Hausanzug, legte mich in den Gesundheitssessel und überdachte die Ereignisse des Tages.
Tja, so einen Perbot zu haben, war jedermanns Wunsch. Erstens hob es das Ansehen und zweitens konnte man viele Arbeiten dem Bot übertragen und somit mehr Freizeit gewinnen.
So ein Androide wurde einem gestellt, wenn man sich durch herausragende Verdienste hervorgetan hatte. Das Aussehen des Perbots entsprach dem Ebenbild des Menschen zu genau diesem Zeitpunkt. Wenn der Eigentümer dann älter wurde, so blieb jedoch der Bot unverändert. Manche nahmen diese Tatsache gelassen hin, während andere sich über den jungen Perbot ärgerten, weil er sie an die vergangene Jugend erinnerte. Das Gedächtnis eines Androiden wurde analog, zu dem des Besitzers programmiert. Noch war die Entwicklung nicht soweit, dem Robot Empathie zuzueignen. So war er nicht in der Lage zu erkennen, wann der Mensch Hilfe braucht. War der Mensch zum Beispiel gefallen, stand er daneben und wartete auf Anweisungen. Man musste ihn bitte, zu helfen. Die er dann sofort leistete. Im allgenmeinen Umgang, durfte er den Menschen nicht selbstständig berühren. Im Alltag, wiese der Eigentümer den Maschinenmenschen an, was er tun sollte. Hatte er die Aufgabe beendet, schaltete er automatisch ab und stand in Wartestellung für die nächste Anweisung bereit. Je länger ein Perbot mit verschiedenen Arbeiten betraut wurde, desto eigenständiger agierte er. Normalerweise gab man ihm komplexe Aufgaben aus dem jeweiligen Fachbereich des Eigentümers. Seine überaus leistungsfähige Rechnerleistung erledigte die gestellten Anforderungen in kürzester Zeit und half dem Eigentümer, in der eigenen Arbeit effektiver voranzukommen.
Die Perbots wurden mit größerer Kraft ausgestattet als ihre Eigentümer. Es gab gravierende Unterschiede zwischen Perbots von geistig tätigen Menschen und von Personen, die körperliche Arbeit zu verrichten hatten. Für Letztere bekamen die Perbots zusätzliche Kraftreserven um den Arbeiter zu entlasten, beziehungsweise dessen Pensum komplett zu übernehmen. Die neueste Generation von Perbots hatte man mit Fähigkeiten ausgerüstet, die dem Bot ermöglichte aus Erfahrungen zu lernen und diese später abrufbereit und sogar erweitert einzusetzen. Er »lernte«. Diese Testperbots wurden auf ihre Fähigkeiten hin vom Hersteller laufend überwacht, um daraus weitere Erkenntnisse zu gewinnen.
Allmählich begann die Raumbeleuchtung zu dimmen, um mich darauf aufmerksam zu machen, dass es Zeit sei, schlafen zu gehen. Die Zeit für das langsame Herunterfahren der Helligkeit, hatte ich beim Einzug in die Wabe festgelegt. Ich sah mich im Raum um und stellte fest, dass er, im Gegensatz zu Johannas gemütlichem Heim, sehr nüchtern und, ich möchte fast sagen, geschmacklos ausgestattet war. Ich meine damit, dass ich mich nicht nach den vor Jahrhunderten üblichen dekorativen Dingen wie Gemälden, Vasen, Sofakissen und Reisemitbringsel sehnte, aber ein paar hübsche Accessoires, könnte die Wohnlichkeit aufbessern. Muss mal mit Johanna drüber sprechen, überlegte ich.
Ehe ich mich zur Ruhe begab, sah ich mir die Nachrichten an. Ich war gespannt, zu erfahren, ob sie den Perbot erwischt hatten. Die Sprecherin teilte mit, dass der Perbot nicht gefunden wurde, und man vermutete, er könnte inzwischen über die Grenze in den angrenzenden Großraum, nach Russland, geflohen sein. Das wird Maximilian garantiert beunruhigen, denn sein Android verfügte über das gleiche Wissen vom Stand der Hochfrequenzforschung wie er. So könnte im schlimmsten Fall die neuesten Erkenntnisse auf diesem Gebiet von russischen Wissenschaftlern abgefragt werden. So sehr auch in allen Bereichen eine gegenseitige Pflicht bestand, Forschungs- und Entwicklungsergebnisse auszutauschen, konnte man nicht verhindern, dass manche Wissenschaftler sich weigerten, ihre Erfolge an die Konkurrenz weiterzugeben. Man würde, obgleich Maximilian keine Schuld an dem Verschwinden trug, ihm Fahrlässigkeit mit dem Umgang seines Perbots vorwerfen.
Im Raum herrschte inzwischen nur noch eine schwache Beleuchtung. Es wurde höchste Zeit schlafen zu gehen. Mit dem verständlichen Wunsch, dass sich der Traum vom Vortag fortsetzen möge, schloss ich die Augen.
Dem Weckkissen gelang es nur mit Mühe, um mich aus dem Tiefschlaf zu holen. Es musste bereits länger vibriert haben, wie ich mit einem Blick auf die Zeitanzeige an der Decke sah. Selbst die Musik hatte ich überhört. Ich schwang die Beine aus dem Bett, rieb mir die Müdigkeit aus den Augen und versuchte, mich zu erinnern, was ich geträumt hatte. Die Erinnerung verlief im Nichts. Traumlos hatte ich die Nacht verbracht. In Eiltempo erledigte ich die morgendlichen Tätigkeiten, verschluckte mich hustend an einem Vollkornriegel und trank im Stehen schnell einen Energiedrink. Aus dem Gesundheitssesel drang nervend der Hinweis, ich wäre bereits zehn Minuten über die Zeit im Haus.
»Du kannst mich mal«, fluchte ich unfein.
Beim Anziehen des silbergrauen Overalls, der auf der ganzen Welt als Einheitskleidung eingeführt worden war, entdeckte ich einen Riss quer über dem Knie. Nein, ich hatte keine Zeit mehr, mich umzuziehen. Sollte ein Kälteeinbruch kommen, was selten vorkam, so zöge ich den anthrazitfarbenen Winteroverall an. Er war beheizt und wählte thermostatisch gesteuert die angenehmste Temperatur für den Träger. Dazu gab es warme Stiefeletten und Handschuhe.
Vor der Tür wartete kein Julius auf mich. Mit großen Schritten versuchte ich, etwas Zeit gutzumachen. Die Zeiterfassung würde mir ein Minus an Arbeitszeit bestätigen.
Es kursierte die Nachricht, Maximilian hätte sich krankschreiben lassen. Ihm war der Vorwurf, den Perbot nicht ausreichend im Griff gehabt zu haben, zu Herzen gegangen. Außerdem wurde ihm mitgeteilt, dass er keinen Anspruch auf einen Ersatz - Perbot habe.
In der Pause rief ich Johanna an und erkundigte mich, wie es ihr ginge. Erleichtert bemerkte ich, dass ihre Stimme fester und fröhlicher klang. Sie wollte am nächsten Montag wieder zur Arbeit kommen, verriet sie mir.
Garantiert würde ich am Montag früher im Institut eintreffen, um sie vor Arbeitsbeginn in ihrem Büro zu begrüßen.
Zur Mittagszeit traf ich Julius und wir setzten uns, wie immer zusammen.
Er schien irgendwie bedrückt zu sein.
»Was ist los?«, erkundigte ich mich.
Er stocherte lustlos in seinem Essen und wollte nicht recht raus mit der Sprache.
Endlich rückte er mit der Sache heraus.
»Es kursieren Gerüchte, dass aus unserem Institut Mitarbeiter zum Mars abkommandiert werden sollen, um ihre Forschung unter realen Bedingungen fortzusetzen.
»Denkst du, einer von uns wäre betroffen?«, fragte ich leicht beunruhigt.
»Ich nehme das schon an, denn es soll sich in diesem Fall mehr um Fachleute aus dem Biobereich handeln. Sicher ist bisher, dass Kollegen aus den Disziplinen der Strahlenforschung von Doktor Maximilian dabei sind.«
»Na, dann kann ich nur hoffen, dass es nicht uns beide oder Johanna trifft. Allein, wenn ich an den Flug denke, der im besten Fall zwei Monate beträgt, wird mir übel.«
»Vergiss nicht«, warf Julius ein, »dass diese Flugzeit nur so kurz sein wird, wenn man wartet, bis sich der Mars in seiner Umlaufbahn am dichtesten der Erde genähert hat. Andernfalls könnte die Reise ein paar Monate länger dauern.«
»Weiß du, ob Johanna von dieser Planung informiert wurde?«
»Nein, das glaube ich nicht, denn erst heute kamen die Gerüchte auf.«
»Ich werde sie nicht anrufen, sondern nach Feierabend zu ihr gehen, und ihr darüber berichten.«
»Gute Idee«, meinte Julius und setzte hinzu, »wenn einer von uns etwas Neues erfährt, so benachrichtigt er den anderen.«
Wir verließen die Kantine und die Gedanken schwirrten im Kopf durcheinander, sodass ich mich nicht auf die Arbeit konzentrieren konnte. In meiner Besorgnis stellte ich mir vor, dass es vielleicht Johanna treffen könnte und wir für nicht absehbare Zeit getrennt wären. Eine beunruhigende Vorstellung. Julius und ich arbeiteten, neben einigen anderen Kollegen, am gleichen Problem der Ertragsmaximierung der Erträge bei Gemüsepflanzen. Ich hatte ein neuartiges Testverfahren entwickelt, dass die früheren Zeiten für die Versuchsreihen um über die Hälfte verkürzten. Außerdem hatte ich es als Einziger geschafft, Kohlsorten zu züchten, die im Gegensatz zu den bisherigen Züchtungen, der simulierten Weltraumbestrahlung länger widerstanden und sogar noch größere Erträge brachten. Zweifellos war ich der führende Experte auf diesem Gebiet. Ich hoffte inständig, dass die Reise einen anderen Kollegen treffen möge. Die Gefahr, dass es Johanna auf den Mars verschlagen könnte war hoch, denn als Leiterin der Abteilung Fotosynthese war sie die herausragende Expertin. Voller Ungeduld wartete ich auf den Feierabend, um zu ihr zu laufen. Meinen Besuch kündigte ich per Sprachnachricht an.
Nach dem Feierabendsignal stürmte ich aus dem Haus und eilte zu ihr.
Sie öffnete die Tür und ich stellte wieder, mit nicht geringer Erregung fest, dass der Einheitsoverall ihre weiblichen Konturen voll zur Geltung brachte.
Kaum hatte ich den Raum betreten, fragte sie:
»Was ist los? Ich sehe dir an, dass dich etwas beunruhigt.«
Wie gut sie mich doch schon kannte, ging es mir durch den Sinn.
»Ja, du hast recht. Setz dich bitte, ich habe Neuigkeiten, die uns beide betreffen und nicht beruhigend sind.«
Ihre blauen Augen sahen mich erschrocken an.
»Bist du etwa krank, oder bist du zu einer anderen Arbeitsstelle abgeordnet worden?«
»Nein, das nicht, aber es könnte mit dem Wechsel des Arbeitsplatzes für uns beide eine unerwünschte Entwicklung geben.«
Ich erzählte ihr von dem Gespräch mit Julius und dem Gerücht, dass aus unserem Institut Kollegen zum Mars abgeordnet werden sollen. Ich sah das Erschrecken deutlich ihrem Gesicht an.
»Wir sollten uns nicht verrückt machen, ehe wir mehr wissen«, stellte sie nüchtern fest.
Im Falle, dass mich das Los trifft, werde ich darauf bestehen, dass du mitkommen musst«, wobei sie ihre Worte mit einem Lächeln begleitete.
»Das wäre sicher der einzige Grund, um der Mission einen gewissen Reiz abzugewinnen«, stimmte ich zu.
Wir unterhielten uns, mit Kaffee immer erneut munter haltend, bis spät in die Nacht, ehe ich den Heimweg antrat.
Die Verabschiedung fiel intensiver als beim letzten Mal aus.
Die nächsten Tage vergingen ohne nennenswerte Ereignisse, abgesehen davon, dass die Unruhe im Institut stetig stieg. Die Leitung hüllte sich in Schweigen und förderte damit die Unsicherheit, welche die Mitarbeiter befallen hatte. Wenn ich Johanna traf, bemerkte ich eine gewisse Anspannung bei ihr. Ich meinte, dass sie auf die bevorstehende Umgruppierung und die Auswahl für die Reise zum Mars begründet lag.
Ich irrte mich.
Eines Tages, als Julius und ich nach der Arbeit heimwärts liefen und vor meinem Haus ankamen, stieg er vom Laufband.
»Hast du ein paar Minuten Zeit?«, kam die Frage.
»Ja, sicher, komm mit rauf«, stimmte ich zu.
Er hatte mich seit längerer Zeit nicht besucht. Meine Frage nach einer Tasse Kaffee bejahte er freudig.
Wir tranken und es dauerte, ehe er, zu sprechen begann.
»Julian, ist dir im Verhalten von Johanna in der letzten Zeit nichts aufgefallen?«
Ich stutze und überlegte was er mit dieser Frage bezweckte und dachte kurz darüber nach.
»Ja, ich hatte den Eindruck, dass sie etwas bedrückt schien. Ich meinte, es hätte mit der Situation im Institut zu tun.«
Julius druckste eine Weile herum, ehe er zur Sache kam.
»Ist dir nicht aufgefallen, dass sich der Drago möglichst da aufhält, wo sich Johanna befindet? Offensichtlich sucht er ihre Nähe. Als ich vor zwei Tagen in ihr Büro ging, traf ich ihn dort an. Ich will dich nicht beunruhigen, aber ich habe den Eindruck, er beabsichtigt, sich an sie ranzumachen, wie es so schön heißt.«
Ich setzte die Tasse so heftig auf den Tisch, dass Kaffee überschwappte.
Der Schock saß. Ich wollte wissen, ob er mehr Beweise für seine Beobachtung hätte, worauf er dieses verneinte. Er schlug vor, Johanna baldmöglichst auf das Thema anzusprechen. Die Gedanken kreisten sinn-und nutzlos im Kopf und was er weiterhin sagte, kam nur bruchstückhaft in meinem Gedächtnis an. Er bemerkte, wie tief mich seine Mitteilung verwirrt hatte und drängte, zum Aufbruch, wofür ich dankbar war. Jetzt wollte ich lieber alleine sein, um ungestört nachzudenken.
Kaum hatte er die Wohnung verlassen, war mein erster Gedanke, Johanna sofort anzurufen. Doch dann sah ich ein, dass ein Gespräch, ohne direkten Kontakt mit dem geliebten Menschen, garantiert der falsche Weg sei. Die Ungewissheit brachte mich fast um und als ich morgens geweckt wurde, glaubte ich, nicht eine Minute geschlafen zu haben, so ausgelaugt fühlte ich mich.
Als Frühstück musste eine Tasse Kaffee ausreichen, denn etwas Anderes hätte ich nicht herunterbekommen.
Der Blick aus dem Fenster fiel auf einen dichten Regenvorhang, der wasserfallartig vom grauen Himmel fiel. Das Wetter passte zu meiner seelischen Verfassung. Diese Art von Regenwetter hatte in den Jahren immer stärker zugenommen. Er würde für Stunden weiter vom Himmel strömen, und sogar die Laufbänder auf der Straße überfluten. Nach dem Kalender war heute Mai. Die alten Jahreszeiten wie Frühling, Sommer, Herbst und Winter hatte schon lange keine Bedeutung mehr. Inzwischen sprach man von Großwetterlagen. Es kam vor, dass im Herbst meterhoch Schnee lag und ein Jahr später zur gleichen Zeit wochenlang die Sonne schien wobei die Temperaturen tagsüber auf fünfzig Grad und mehr kletterten. Der einzige positive Aspekt, dem ich dem Regen abgewann, war, dass die Grasfläche auf dem Flachdach ausreichend bewässert wurde. Alle Häuser waren mit dieser Dachausführung und mit Rasenflächen vorgeschrieben.
Mein Overall, der den Körper wie ein Taucheranzug umschloss, hielt mich trocken und die weichen Stiefeletten lagen wasserdicht an den Beinen an, wie die Ärmelabschlüsse an den Handgelenken. Allein das Gesicht würde nass werden. Der Regen war nicht kalt, und so verzichtete ich auf eine zusätzliche Kopfbedeckung.
Im Institut angelangt, blieb ich in der Luftschleuse stehen, und ließ mich trocknen. Wenn es regnete, sorgte sie dafür, dass die Ankommenden trocken den Arbeitsplatz erreichten.
Ich schaute bei Julius vorbei und informierte ihn, dass ich auf dem Weg zu Johanna sei.
Er hielt den Daumen hoch, um mir damit Erfolg zu wünschen.
Im Gang zu ihrem Büro kam mir Drago entgegen. Wir grüßten uns kurz. Ich vermeinte, ein leichtes Grinsen bei ihm zu entdecken.
Beim Annähern an die Bürotür glitt sie automatisch zu Seite. Johanna saß, konzentriert auf einen Bildschirm schauend, am Schreibpult, wo er eingelassen war.
Sie blickte auf, sah, dass ich es war, und zeigte auf die Tür, die ich mit einer Handbewegung schloss. Ich begrüßte sie und ehe sie antworten konnte, stieß ich beunruhigt hervor: »Hattest du Besuch von Drago?«
»Ja, er war hier. Ehrlich gesagt, habe ich nicht verstanden, was er wollte. Ich habe ihn mit dem Hinweis auf eilige Arbeiten, wieder aus dem Büro verwiesen.« Mir war klar, dass er Johanna weiterhin als das Ziel seiner Wünsche ansehen würde. Jede Gelegenheit, sich ihr unter irgendeinen Grund zu nähern, käme ihm recht.
Sie hatte bemerkt, dass ich von dem Besuch nicht erbaut war und begann:
»Setz dich bitte. Ich weiß, warum du gekommen bist. Das Büro ist sicher nicht der richtige Ort, um über das Thema zu sprechen, das uns beide bedrückt. Ich schlage vor, dich bis zum Feierabend zu gedulden. Wenn du möchtest, komme ich dann mit zu dir, oder du begleitest mich zu mir nach Hause.«
Sie hatte sich bemüht, ihre Stimme gefasst und normal anhören zu lassen. Es gelang ihr nur mäßig. Unüberhörbar nahm ich in ihrem Ton eine Erregung wahr.
Ich gab mir Mühe, meine Worte locker und ausgeglichen klingen zu lassen, und antwortete:
»Wenn es dir nichts ausmacht, einen alleinstehenden Mann in seiner Wabe zu besuchen, so komm doch bitte heute zu mir.«
»Einverstanden, also bis dann zum Feierabend«, stimmte sie mit einem kaum wahrnehmbaren Lächeln zu.
Auf dem Rückweg ging ich auf einen Sprung zu Julius rein und berichtete, dass ich mich mit Johann nach dem Arbeitsende treffen werde.
Der Feierabend kam und Johanna holte mich an meinem Büro ab. Die Regenflut hatte nicht nachgelassen. Als wir bei mir ankamen, trieften wir vor Nässe wie zwei Schwimmer, die soeben dem See entstiegen waren. Zuerst ließ sie sich in der Duschkabine vom Warmluftstrom trocknen.
Wir hatten die Kopfbedeckungen abgenommen, um es bequemer zu haben.
»Ich schlage vor«, begann ich, »wir sollten erst einmal etwas essen.«
»Ja, die Idee ist gut, denn heute hatte ich nicht einmal Zeit in die Kantine zu gehen«, stimmte sie zu.
Wir orderten leichte Abendmalzeiten und dazu passende Getränke.
Ich setzte mich auf den Arbeitsstuhl vor dem Schreibpult und bot ihr an, sich auf den Gesundheitssessel zu legen, was sie gerne annahm.
Wir saßen eine Weile da, ohne dass einer von uns, ein Gespräch begann. Doch dann ergriff Johanna die Initiative:
»Ich kann mir denken, warum wir hier zusammensitzen. Sicher hast du erfahren, dass Drago sich für mich interessiert.«
»Ja, das habe ich«, stieß ich heftig hervor, »und hätte gerne gewusst, was an der Sache dran ist.«