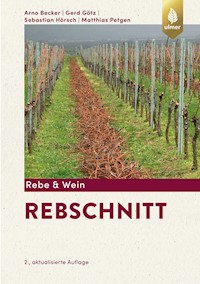Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Sprache: Deutsch
Politisch und gesellschaftlich unruhige Zeiten! Aber eine Kurskorrektur ist vorläufig nicht zu erwarten. Steht ein Kollaps der so genannten Hochkultur bevor? Über die Geschichte des jungen Paares, Justine und Noah, stellt der Autor radikale Entwicklungen vor, die den Fortbestand der Menschheit sichern könnten. Die wechselvolle Erzählung führt - über die Amtseinführung des ersten deutschen AfD-Kanzlers am 30. Januar 2033(!), das zukünftige Leben in Deutschland, Frankreich und China - zu einem überraschenden Ausgang.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 401
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Vor dem Prolog
In diesem Roman kommen Personen und Begebenheiten vor, die frei erfunden sind. Andererseits bezieht sich der Handlungsfaden immer wieder auf Ereignisse, die in der Realität stattgefunden haben.
Naturgemäß gehören die Geschehnisse nach dem Jahr 2025 dem Reich der Fantasie an. Manche werden sagen „Gott sei Dank!“
Dennoch wird die Zukunft alles andere als schwarzgemalt. Den Zweiflern, die die Visionen dieses Romans für unrealistisch halten, biete ich an, dass wir uns im Jahre 2071 zusammensetzen. Wir können dann eine gemeinsame Rückschau halten.
Punkt 18:00 Uhr! Ich werde da sein…
Inhaltsverzeichnis
Prolog
2023
Dienstag, 9. Mai 2023
Samstag, 13. Mai 2023
Dienstag, 16. Mai 2023
Dienstag, 16. Juli 2023
27. Juni 2023
Mittwoch, 5. Juli 2023
Donnerstag, 6. Juli 2023
Freitag, 7. Juli 2023
Freitag, 7. Juli 2023
Samstag, 8. Juli 2023
Montag, 10. Juli 2023
Montag, 10. Juli 2023
Montag,10.7. 2023
Dienstag, 11. Juli 2023
Dienstag, 11. Juli 2023
Dienstag,11.7.2023
Donnerstag, 13. Juli 2023
Donnerstag, 13. Juli 2023
Freitag, 14. Juli 2023
Freitag,14. Juli 2023
Freitag, 14. Juli 2023
Samstag, 15. Juli 2023
Donnerstag, 20. Juli 2023
Montag, 24. Juli 2023
Sonntag, 20. August 2023
Samstag, 26. August 2023
Dienstag, 7. November 2023
Donnerstag, 9. November 2023
Donnerstag, 9. November 2023
Freitag, 10. November 2023
Sonntag, 12. November 2023
Donnerstag, 16. November 2023
Freitag, 8. Dezember 2023
2033
Freitag, 11. Juni 2032
Sonntag, 12.Dezember 2032
Sonntag, 12. Dezember 2032
Sonntag, 12.Dezember 2032
Montag, 13.Dezember 2032
Montag, 13.12.2032
Montag, 13 .Dezember 2032
Donnerstag, 23.12.2032
Woche vom 23.1. – 29.1.2033
Sonntag, 30. Januar 2033
Dienstag, 15 .Februar 2033
Samstag, 19. Februar 2033
Samstag, 26. Februar 2033
Montag, 28. Februar 2033
Montag, 28.2.2033
Dienstag, 1.März 2033
Samstag, 5.März 2033
Freitag, 1. April 2033
Sonntag, 10. April 2033
Freitag, 15. April 2033
Freitag, 13. Mai 2033
Samstag, 14.5.2033
Sonntag, 15. Mai 2033
Montag, 16. Mai 2033
Montag, 16. Mai 2033
Freitag, 26.September 2036
Dienstag, 30. September 2036
Mittwoch, 1. Oktober 2036
Sonntag, 22. Februar 2037
Montag, 23. März 2037
Samstag, 27. Juni 2037
Sonntag, 21.3.2038
Montag, 2.8.2038
Freitag, 6. August 2038
Mittwoch, 27. Juni 2040
Freitag, 7.November 2040
Sonntag, 21. Dezember 2070
Mittwoch, 24. Dezember 2070
Freitag, 26. Dezember 2070
Donnerstag, 1. Januar 2071
Sonntag, 12. April 2071
Dienstag, 14. April 2071
Mittwoch, 15. April 2071
Samstag, 27. Juni 2071
Dienstag, 1. September 2071
Mittwoch, 2. September 2071
Freitag, 4. September 2071
Samstag, 5. September 2071
Mittwoch, 9. September 2071
Donnerstag, 10. September 2071
Dienstag, 20. Oktober 2071
Mittwoch, 21.Oktober 2071
Blick zurück aus der Zukunft
Dienstag, 9. Mai 2023
Prolog
Der achtjährige Roy Peppke wohnte 2012 noch mit seiner Familie in Waßmannsdorf.
Er litt unter dem Lärm landender und startender Flugzeuge auf dem Schönefelder Flugplatz. Aber jetzt, in der heißen Nacht vom 8. auf den 9. Oktober, gab es noch andere fliegende Objekte, die ihm den Schlaf raubten: Stechmücken! Er schaute auf die Uhr: Kurz vor zwei. Roy trat genervt ans offene Fenster.
Der abnehmende Mond beleuchtete die Rudower Straße nur schwach. Er kniff die Augen zusammen. Was war das? Schräg gegenüber spielte sich eine gespenstische Szene ab.
Drei Gestalten, nur schemenhaft zu erkennen, schlichen um das Asylbewerberheim. Eine davon glaubte Roy zu kennen. Die ungelenken Bewegungen und der gedrungene Körper passten zum Freund seines älteren Halbbruders. Roys Halbbruder Maik war neun Jahre älter als er. Ihn vergötterte er wie einen Vater. Er war Roys Vorbild.
Mikes pummeliger Freund hatte eine Spraydose dabei, mit der er in silberner Farbe ein Kreuz malte. Die Enden des Kreuzes versah er jeweils mit einem rechtwinkligen Strich nach links.
Jetzt tuschelten zwei der geheimnisvollen Fassadenmaler. Roy hätte so gerne verstanden, worum es da ging! Ein zweiter nahm dem Dicken das Spray aus der Hand und schrieb etwas auf die Fassade.
„Rostock ist üb…“
Roy glaubte, auch diesen zweiten zu kennen! War das möglich? Er verließ den Platz am Fenster und huschte eilig ins Nebenzimmer. War sein Bruder Maik überhaupt in seinem Bett? Oder war er einer von den drei Geheimnisvollen? Tatsächlich! Maiks Bett war leer! Sofort rannte er wieder zum Fenster. Die drei waren noch da! Von weitem hörte er ein Martinshorn. Der Wachdienst hatte die Täter wohl bemerkt.
Plötzlich hörte Roy ein Klirren. Scherben flogen auf den Bürgersteig. Dann rannten die drei zu einem Auto und brausten davon. Kurz darauf traf die Polizei ein.
Am darauf folgenden Nachmittag berichtete Maik stolz seinem Bruder: „In Berlin haben die Bullen uns erwischt. Jemand hat sich wohl unsere Nummer gemerkt. Aber sie konnten uns nichts nachweisen und mussten uns laufen lassen. Wir waren natürlich so clever und haben die Spraydose unterwegs aus dem Fenster geschmissen. Und Steine hatten wir ja keine mehr. Die sind alle im Zimmer gelandet.“
Der kleine Roy kaufte auf Wunsch seines großen Bruders die „Potsdamer Neuesten Nachrichten“.
„Glückwunsch, Maik! Ihr steht in der Zeitung!“ Seine Bewunderung war grenzenlos.
„Halt bloß die Klappe, Kleiner!“
Roy hätte sich eine andere Reaktion gewünscht.
„Schau mal Roy, sie schreiben, da, wo wir die Fensterscheibe eingeworfen haben, hat eine Afghanen-Hure geschlafen. Die hat angeblich noch nicht mal was gemerkt! Auf den Schreck hin wird die bestimmt heute noch die Rückfahrkarte in den Hindukusch buchen.“
Roy unterbrach Maiks schadenfrohes Lachen: „Darf ich nächstes Mal mit?“
„Erst mal Klappe halten! Und vielleicht kannst du mit Henry mal üben, wie man Hakenkreuze malt – Haken nach rechts!“
2023
Dienstag, 9. Mai 2023
In den Banlieues lebten viele von ihrer Sorte. Junge Franzosen mit nordafrikanischen Vorfahren, nicht selten schon in dritter Generation. Die meisten von ihnen waren hoffnungslos, erfolglos, arbeitslos und – hemmungslos. Trotzdem versuchten sie das Unmögliche – ihrem Leben einen Sinn zu geben.
Am 9. Mai des Jahres 2023 ergab sich eine Gelegenheit dazu – durch einen Aufruf, der auf Instagram und Facebook kursierte.
Karim hatte gelesen, dass Julien Mari aus Marseille, genannt Jul, einer der bekanntesten französischen Rapper, in Nanterre sein Video „Ragnar“1 drehen wollte. Dafür brauchte er Statisten.
Karims Wohngegend, St. Denis, war gerade mal 15 Kilometer von Nanterre entfernt, die gleichen sterilen Hochhäuser voller jugendlicher Arbeitsloser, die gleichen Probleme, der gleiche Frust.
An der Haltestelle „Rue de Tirogne“, der Straße, in der Karim und seine Freunde Mohammad und Ashraf wohnten, bestiegen die drei an jenem kühlen Dienstagnachmittag den Bus nach Nanterre.
Jul war in Nanterre aufgewachsen, zusammen mit Menschen aus den Banlieues. „Ich komme von dort, wo man die Mütter schreien hört“, rappte Jul, und sein Text war nicht übertrieben.
Die drei fanden es toll, dass Jul trotz seiner erfolgreichen Karriere nicht vergessen hatte, wo er herkam, nämlich aus dem gleichen Rattenloch wie sie, den Banlieues.
Das Echo auf Juls Aufruf war überwältigend! Hunderte Halbwüchsiger solidarisierten sich. Dieses Mal war ihr gemeinsamer Nenner nicht die Gewalt, sondern der Rap. Sie würden das Video mitgestalten!
Es gab keine großartige Regie, sondern nur Musik vom Band. Aus einem Lautsprecher hatte jemand ihnen die Anweisung gegeben, immer wieder Daumen, Zeigefinger und Mittelfinger ihrer Hände zu zeigen, wie eine Schwurhand, eine Art durchgehendes, verbindendes Thema des Videos.
Karim war überwältigt von der Atmosphäre, dem Wir-Gefühl, von der Menge Gleichgesinnter und – natürlich vom Groove der Musik. Er drängte sich so nah wie möglich an Jul heran. Der saß auf einem weißen Motorrad mit schwarzem Lenker. Er sang und bewegte sich zum Playback. Neben ihm saß ein Junge, vielleicht sechzehn oder siebzehn Jahre alt, mit brauner Mütze auf dem Kopf, auch auf einem Motorrad. Karim drängte sich hinter die beiden, in der Hoffnung, später auf dem Video zu sehen zu sein.
Alle waren in schwarz gekleidet, die meisten trugen Kapuzen und Handschuhe, so, wie es in dem Aufruf für die Statisten gewünscht war. Mit dieser Art von Uniformierung wurde das Gefühl noch verstärkt, dass alle in einem Boot saßen, alle für die gleiche Sache kämpften.
Endlich war in Karims Leben so etwas wie Perspektive. Bisher gab es nur täglichen Frust – mit den Eltern, mit den ständig wechselnden Arbeitgebern und natürlich mit der Polizei. Erst gestern war sie bei ihm zu Hause gewesen, um zu recherchieren. Die Flics waren zu zweit gekommen, ein Jüngerer und ein Erfahrener. Der Ältere machte hemmungslos Fotos in Karims Zimmer, durchwühlte seine Schubladen, schnüffelte auf Karims Handy – all das, ohne zu verraten, was ihm zur Last gelegt würde. Der Beamte wollte Details aus Karims Sexualleben wissen, ob er schon mal vergewaltigt hätte, welche Fantasien er bevorzuge, ob er auf weiße oder auf arabisch aussehende Frauen stehe. Dabei grinste der Polizist auf eine geheimnisvolle Weise, die Karim schon fast ein schlechtes Gewissen machte.
Das alles konnte er heute beiseiteschieben. Bei der Entstehung des Videos mitwirken zu können, war eine völlig andere Welt. Hier war alles in Ordnung.
Nach anderthalb Stunden anstrengendem, aber erfüllendem Rappen gab es eine Unterbrechung. An einem Stand, den Juls Manager extra für diesen Event organisiert hatte, gab es preiswerte Getränke, aber keinen Alkohol. Karim hatte Durst. Vor ihm drängelten sich ungezählte junge Leute in einer Menschentraube. Weiter vorne erkannte er den Motorradfahrer, der neben dem berühmten Jul gestanden hatte. Für einen Moment drehte sich dieser Junge um. Ihre Blicke trafen sich zufällig.
„Hey Bruder, bring mir eine Cola mit. Ich bezahle sie dir gleich!“ rief Karim ihm zu. Obwohl der Junge ihn nicht kannte, brachte er ihm tatsächlich sein Getränk.
„Echt nett von dir, Bruder! Ich bin Karim.“
Sie stießen die Dosen gegeneinander. „Gerne doch. Prost! Ich bin Nahel. Wir sind doch eine Community. Wir haben doch alle das gleiche Scheiß-Leben.“
„Ja, du siehst aus wie ich. Meine Eltern kamen aus Nordafrika.“
Nahel nickte und nahm noch einen Schluck: „Gleich geht es weiter. Ist das nicht eine krasse Aktion hier? – Ich bin eine Kreuzung, halb algerisch, halb marokkanisch. Aber Quatsch, ich bin natürlich Franzose!“ Bei diesem Satz zwinkerte Nahel mit einem Auge. Aber auch ohne diese Geste hätte Karim verstanden, dass Nahel eine Art Galgenhumor zeigte. In den Augen vieler Franzosen waren sie lästige Fremdkörper, gefährliche Außenseiter.
Karim zeigte auf Jul, der offensichtlich bereit war, den Dreh zum Ende zu bringen. Durch die Boxen wurde aufgerufen, sich bereit zu machen. Musik ertönte, der Groove durchströmte gleichmäßig ihre Körper und spülte sie gleichsam in ein und dieselbe Richtung. Wie ein Bienenschwarm arbeiteten sie alle im gleichen Beat, am gleichen Projekt. „Ragnar“ konnte ein Hit werden.
Zwei oder drei Stunden später waren die Filmaufnahmen im Kasten.
„Nahel, hast du Lust, auf ein Bier mit mir in den Park zu gehen? Ich lade dich ein.
„Wenn da keine Bullen sind – gerne! Ich hasse Bullen. Aber die hassen mich noch mehr!“
„Wieso? Kennen die dich?“ fragte Karim und dudelte den monotonen Rap, der ihn immer noch als Ohrwurm verfolgte.
„Mich kennen sie seit gestern. Sie haben mein Zimmer auf den Kopf gestellt. Keine Ahnung, was sie gesucht haben. Ich hab nichts verbrochen!“
„Ich auch nicht – eigentlich. Ich habe nicht einmal eine Strafakte.“
„Aber?“
„Na ja, der Mensch braucht Geld. Und manch einer braucht Drogen. Wenn man helfen kann…“
„Du meinst, du hast gedealt?“
Nachdem Nahel schweigend weiterging, ließ Karim nicht locker.
„Und hast dich erwischen lassen?“
„Machen sie doch alle.“
„Sich erwischen lassen?“
„Nein, Geld verdienen. Und wenn die Bullen dich mal haben – ich war zweimal in Gewahrsam – dann sind sie alles andere als zimperlich. Das habe ich mir nicht bieten lassen. Die nennen das „Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte“, und schon hat man wieder ein Delikt mehr am Bein. Ich war im Recht. Weiße Franzosen werden von den Bullen mit Samthandschuhen angefasst. Aber unser einer…! – Ach, ein paar Verkehrsdelikte habe ich auch noch.“
„Das ist alles?“
„Entschuldigung! Mehr habe ich nicht auf dem Kerbholz.“ Nahel zwinkerte wieder mit einem Auge.
„Und Arbeit?“
„Ich habe mal ein paar Kurse gemacht, etwas mit Technik, Elektronik und so. Man hat mir was von Ampère, Volt und Ohm beigebracht. Habe ich abgebrochen.“
„Machen sie doch alle, Nahel. – Wie hießen die drei? Mon père, Volt und Ohm?“
„So ähnlich. Jetzt arbeite ich als Pizzabote, das machen nicht alle. Ich verdiene Geld auf Spießer-Art.“
„Super, ich bin stolz auf dich, Bruder“, grinste Karim. „Irgendwann bist du Boss von einer Pizzakette.“
*****
1 Das Video „Ragnar“ des französischen Rappers Julien Mari („Jul“) wurde Anfang 2023 gedreht. Auf diesem Video ist der später bei einer Polizeikontrolle getötete Nahel Merzouk als Komparse in der Nähe von Jul zu sehen.
Samstag, 13. Mai 2023
Roy, Ingo und Patrick waren in der Regel nur zu dritt anzutreffen. Alle drei hatten die Schule abgebrochen. Mit gerade einmal neunzehn waren sie arbeitslos, und keiner in der Nachbarschaft wusste so richtig, womit sie ihr Geld verdienten. Tagsüber fand man sie gewöhnlich in Roys Muckibude, einer mit Gewichten und Hanteln – und Whiskey-Cola – bestückten umgebauten Scheune in der Grätzelstraße in Göttingen, nicht gerade das nobelste Viertel der Stadt.
Roy war eine Art Anführer, eigentlich ein hübscher Kerl, der stolz war auf seine leuchtend blauen Augen. Nur die abstehenden Ohren waren aus seiner Sicht störend und trübten sein ohnehin nicht allzu großes Selbstbewusstsein.
Die Wochenenden waren für sie Highlights. Da gingen sie mit den „Göttingen NullFünf Ultras“ zum Fußball. Selbst gespielt hatten sie nie. Aber darum ging es ja auch nicht. Fußball war für sie wie ein Boxring der Brutalität, bei dem die Spieler und Anhänger nur als Kulisse für das wahre Spektakel dienten. Der Schlusspfiff kam dem erlösenden Gong gleich, der eine neue Runde eröffnete.
Die Fans der jeweils gegnerischen Mannschaft waren nicht Gäste, nicht Gegner, nicht einmal Rivalen. Sie waren Feinde! Also waren sie bei Auswärtsspielen auf feindlichem Territorium, in feindlichen Kneipen neben feindlichen Geschäften. Bei der Auswahl der „Feinde“ waren die drei nicht sonderlich wählerisch. Dort konnten sie zeigen, wie schon ihre berühmten Vorfahren, die Kimbern und Teutonen, was sie drauf hatten.
„Letzte Woche habe ich einem den rot-weißen Schal vom Hals gerissen. Da hat er sich umgedreht und wollte etwas sagen. Was meinst du, wie schnell der die Klappe gehalten hat, als ich tief Luft geholt habe“, johlte Patrick. „Hier habt ihr noch eine Dose.“ Roy und Ingo griffen nach der Whiskey-Cola und belohnten ihn für seine Erzählung mit dem erhofften lauten Gelächter.
Patrick war noch nicht so lange in der Szene. Er musste sich erst noch seine Anerkennung erarbeiten.
Patricks Eltern waren geschieden. Keiner der beiden wollte sich so recht um ihn kümmern. Eine Freundin hatte er leider auch nicht. Aber seit er Roy und Ingo kannte, wusste er wenigstens, wo er hingehörte.
Roy und Ingo waren ein schwules Paar. Allerdings hatte Roy zusätzlich auch eine Freundin. Ihr Name war Nicki, ein außergewöhnlich dünnes, blasses Mädchen aus ähnlichen Verhältnissen wie Patrick. Auch ihr fehlten Zuneigung und Anerkennung. An ihrer rechten Augenbraue hatte sie ein Piercing mit einem roten Stein. Ihr Nasensteg war durchbohrt von einem silbernen Ring, der aber abnehmbar war. Ihr Vater hatte das Septum-Piercing nicht gerne gesehen, weil sie „wie ein Bulle aussah, den man am Nasenring in den Stall führen kann“. So abfällig hatte er sich damals ausgedrückt. Aber trotz ihrer damals sechzehn Jahre hatte sie es sich nicht verbieten lassen. Genauso wie das Labret-Piercing, das seitlich an ihrer Unterlippe wie ein Pickel aussah, der da nicht hingehörte.
Nicki durfte nicht immer bei den drei Freunden sein. Sie hatten manchmal „wichtige Männergeschäfte“, wie Roy es nannte.
„Bello, hast du die Mail abgeschickt?“
Roy fragte Patrick im Ton eines strengen Vaters, der von seinem Sohn Rechenschaft verlangte. Oder wie ein Hundehalter, der seinem unterwürfigen Vierbeiner Anweisungen gibt. Daher auch Patricks Spitzname „Bello“.
„Klaro! Morgen wird’s in der Zeitung stehen: „Politiker mit Ratte, Sau und Arschloch beleidigt!“ Was meinst du, wie dem jetzt die Muffe geht!“2
„Gut, Bello, aber da ist noch Luft nach oben. Deine Ausdrücke hast du wohl in der Klosterschule gelernt? Der muss merken, dass er nicht machen kann, was er für richtig hält. Wir sind die Wähler! Wir haben zu sagen, was Sache ist, oder?“
Keiner der drei war je zu einer Wahl gegangen.
„Klaro!“
Was sonst hätte Patrick auch auf solch eine Frage antworten sollen? Warum er den Auftrag von Roy bekommen hatte, den Landrat zu beschimpfen, wusste er selbst nicht so recht. War ja auch egal. Für Politik interessierte sich Patrick überhaupt nicht.
„Welches Pseudonym hat dir Noah eigentlich gegeben“, wollte Ingo wissen. Patrick zögerte.
„Pseudonym?“
Wörter mit „P“ und „Y“, physio, psycho, pseudo, pyro – die klangen alle so verhängnisvoll ähnlich und mysteriös, dass er sich für eine unverbindliche Antwort entschied:
„Ööh, hab ich vergessen.“
Ingo blinzelte ihn kritisch an.
„Hast du das Wort ‚Arschloch‘ wenigstens mit „r“ geschrieben?“
Bei dieser Frage war es Ingo selbst, der am lautesten grölte. Wieder war Patrick gezwungen zu pokern:
„Klaro!“
Jetzt erst war Ingo zufrieden. Er schien Patricks Wissenslücken nicht bemerkt zu haben.
*****
2 Göttinger Tageblatt vom 18.1.2020: „Ratte, Sau, Arschloch - Auch Lokalpolitiker werden bedroht und beschimpft.“
Dienstag, 16. Mai 2023
Landrat Dielmeister hatte die unruhigsten Nächte seines Lebens. Seit drei Tagen gelang es ihm nicht, die anonymen Beleidigungen einzuordnen, geschweige denn zu verarbeiten.
Tagsüber dachte er an nichts anderes, und nachts bastelte seine Seele Träume daraus, die die Wirklichkeit noch übertrafen. Als wäre die nicht schon schlimm genug!
Im Traum hatte er die letzte Sitzung geschwänzt, hatte sich einfach krank gemeldet und war mit seiner Frau Monika Hals über Kopf nach Mallorca in Urlaub geflogen. Hier vermutete er, würde ihn keiner kennen. An der Theke einer Bar bestellte er einen Cocktail. Der Barmixer musterte ihn und fragte:
„Sind Sie nicht das Arschloch?“
Was war ihm das peinlich! Er rannte, so schnell er konnte, zurück zum Hotel.
„Meinen Schlüssel bitte, Zimmer 112“, rief er außer Atem dem Pförtner zu.
Gott sei Dank gab der ihm den Zimmerschlüssel ohne irgendeinen Kommentar. Er schien ihn also nicht zu kennen. Als er, oben angekommen, zitternd das Schlüsselloch anvisierte, fiel sein Blick auf das Türschild. Tatsächlich stand da „Arschloch“. Jemand musste davon erfahren haben, wo er war. Schnell schloss er die geöffnete Tür hinter sich, um sich unter der Bettdecke zu verstecken. Traum- und Wirklichkeitsebene fingen an, sich zu vereinigen. Vehement schlug er die Decke zurück, und seine Frau schrie:
„Anton, lass das! Mir wird kalt!“
Noch nie im Leben war er so froh darüber, dass seine Frau mit ihm schimpfte – zu Hause in seinem Bett.
„Ich habe blöd geträumt, Monika. Weil ich eine Mail bekommen habe: „Du bist eine Ratte, eine Sau, ein Arschloch!“
Unterzeichnet, falls man dieses Wort hier überhaupt benutzen kann, unterzeichnet war die Mail von einem „Kommando RIP“, der Account hieß „[email protected]“. Also ohne richtigen Namen oder Absender. Feige ist das! Man beleidigt mich, ohne sein Gesicht zu zeigen.“
„Hast du diese Mail wirklich oder nur im Traum bekommen, Anton?“
„Nein, das ist traurige Wirklichkeit“, seufzte ihr Mann.
Monika nahm liebevoll seine Hand.
„Beleidigungen sind die Argumente derer, die über keine Argumente verfügen. Das ist nicht von mir, aber das trifft so was von zu!“ gab sie sich kämpferisch.
„Ja, ich glaube es ist von Rousseau oder Nietzsche. Egal! Schlaf gut!“
Am nächsten Morgen beschlich ihn auf dem fußläufigen Weg zum Büro eine unangenehme Instabilität. War die Nachricht von diesem „Schlachter“ einmalig? Was für ein seltsamer Name! Oder sollte „A.B. Schlachter“ sogar „Abschlachter“ bedeuten? Natürlich gab es Menschen, die wirklich den Namen „Schlachter“ trugen. Aber es konnte auch ein vielsagendes Pseudonym sein, eine Andeutung, vielleicht sogar ein böses Omen? Und RIP? Eine Todesdrohung? Er war noch nicht bereit, in Frieden zu ruhen! Er wollte vielmehr in Ruhe gelassen werden!
Sollte das der Anfang einer langen Reihe von Beleidigungen, Bedrohungen und Einschüchterungen sein? So etwas hörte man ja immer wieder. Und er war sich nicht sicher, ob die Opfer das immer publik machten. Wahrscheinlich gab es eine hohe Dunkelziffer.
Bald stand die Landratswahl an. Das Gehalt von 8500 brutto war verlockend. Aber war das nicht auch schwer verdientes Geld unter diesen Umständen?
Dielmeister kam an einem Blumenladen vorbei. Spontan beschloss er, seiner Frau einen kleinen Strauß mitzubringen, nicht zuletzt als Entschädigung für die unruhige Nacht. Jetzt fühlte er sich schon ein wenig besser, so, als könnte er damit einen Schlussstrich unter die Angelegenheit ziehen.
Als er den Blumenladen mit siebzehn weißen Rosen verließ, standen drei junge Männer und eine Frau am Ausgang, nicht besonders gepflegt, zwei gut durchtrainiert, aber alle offensichtlich nicht bei der Arbeit. Einer hatte einen Aufkleber auf seiner Jacke. Darauf stand: „Das wird man ja wohl noch sagen dürfen!“ Überfreundlich sagten sie im Chor: „Guten Morgen, Herr Landrat!“
Er war überrascht! Völlig überfordert von einem neuen, nie gekannten Gefühl! Er, der Mann mit steiler Karriere, der immer Herr der Lage war, seine gefeilten Reden frei und locker vortrug, ohne jede Nervosität, er wusste nicht, wie er reagieren sollte. War es normal, dass ihn Wildfremde auf diese Art grüßten? Oder war es vielleicht eine Provokation? Natürlich kannten ihn viele Menschen, die er wiederum nicht kannte. „Der auf der Bühne ist der bunte Hund, der im Publikum ist die graue Maus“, versuchte er sich zu beruhigen. „Ich bin vielleicht überempfindlich.“
Er ging weiter, ohne den Gruß zu erwidern. Kurz darauf hörte er die vier schallend lachen. Er fühlte sich, wie nach einer Prüfung, für die er fleißig gepaukt hatte, aber für die er keine Aussicht auf Erfolg sah. Hatten sie über ihn gelacht? Oder waren sie schon bei einem ganz anderen Thema? Sein Leben war zum Angst einflößenden Thriller geworden. Wer konnte ihm einen Ausweg aus diesem grausamen, unwirklichen Film zeigen?
Dielmeister beschloss, zur nächstbesten Polizeidienststelle zu gehen.
Mit seinem Rosenstrauß setzte er sich in den Wartebereich. Offenbar kannte man ihn hier nicht, denn er musste lange warten. Erst nach einer Dreiviertelstunde wurde er von einem jungen Uniformierten in akkuratem Haarschnitt aufgerufen. Er mochte vielleicht fünfundzwanzig gewesen sein. Seitlich am Hals hatte er sich so etwas wie Runen tätowieren lassen. „Wofür die Leute nicht alles ihr Geld ausgeben“, ging es Dielmeister durch den Kopf. Zwei Sterne auf seinen Schulterklappen verrieten ihm, dass der Polizist schon ein paar Stufen auf der Karriereleiter emporgekommen sein musste.
„Polizeikommissar?“ Dielmeister wollte höflich einen Small Talk anfangen. Sehr geschickt war das nicht, denn er hatte eine Stufe zu niedrig getippt und damit möglicherweise den Stolz des Gegenübers gekränkt. Aber wohl auch sonst hätte der Polizist nicht freundlicher reagiert, vermutete er.
„Was kann ich für Sie tun?“ war die förmliche Antwort des Beamten.
„Ich hatte eine anonyme Mail mit Beleidigungen.“
„Sonst noch was?“
„Reicht das nicht?“
„Wie ist Ihr Name?“
„Dielmeister. Anton Friedrich Dielmeister.“
Zum ersten Mal erschien eine Art fröhliches Lächeln auf dem Gesicht des Beamten. Etwas schien ihn zu amüsieren. Der Polizist versuchte, sich das Lachen zu verkneifen.
„Kann man das auch abkürzen?“
Dielmeister war irritiert. Er ging nicht darauf ein.
„Ich möchte zur Anzeige bringen, dass ich beschimpft und beleidigt worden bin. Ich bin der Landrat dieses Landkreises. So etwas ist mir noch nie passiert.“
„Herr Dielmeier, – Landrat? Dann wissen Sie ja, dass es freie Meinungsäußerung in unserer Demokratie gibt. Kritik ist erlaubt. Auch wenn sie unangenehm ist. Der Bürger hat das Recht,…“
„Ich kenne die Rechte des Bürgers“, unterbrach ihn Dielmeister und bemühte sich, seine Erregung zu verbergen. „Außerdem heiße ich Dielmeister, mit „st“. Wenn jemand mit meinen Entscheidungen nicht zufrieden ist, kann er mit mir reden, face to face!“
„Das traut sich nun mal nicht jeder, lieber – Herr Dielmüller. Was waren das denn – für – so genannte – Beleidigungen?“ Der Polizist ließ sich sein „so genannt“ auf der Zunge zergehen, gedehnt und betont, mit dem schon gezeigten Grinsen.
Jetzt reichte es dem Landrat: „Also, wissen Sie was? Bevor Sie mich als nächstes ‚Dielkemper‘ nennen und ich dann wegen Polizisten-Beleidigung angeklagt werde, weil ich die gleichen Ausdrücke benutze, die Sie in meiner Mail für freie Meinungsäußerung halten, verschwinde ich lieber! Danke für Ihre freundliche Hilfe!“
Mit einem Blutdruck von vermutlich hundertachtzig verließ er das Polizeipräsidium. Schnellen Schrittes passierte er einen jungen Mann, der am Ausgang des Präsidiums stand und ihn kurz am Ärmel festhielt:
„Herr Landrat! Zu Fuß? Sie fahren doch sicher auch Auto?“
Der Mann war muskulös und stinkfreundlich. Kam ihm diese Kombination nicht bekannt vor? Oder sah er überall nur noch Verdächtige? Was sollte die Frage nach dem Auto?
Als Dielmeister nach Hause kam, war er erschöpft. Beim Überreichen seiner Rosen versuchte er, einen feierlichen Eindruck zu machen. Es gelang ihm nicht.
Monika Dielmeister sah ihm an, dass er sein seelisches Gleichgewicht suchte: „Kann ich dir was Gutes tun?“
„Nein, einen Rotwein und die Zeitung kann ich mir selbst holen. Das schaffe ich noch, danke, Frau Dielbauer!“ Der Landrat gab sein Bestes, mit Galgenhumor das Erlebte zu verarbeiten.
Monika schaute ihn kurz verwundert an. Dann schmunzelte sie: „Solltest du heute Nacht neben einer Frau Dielbauer wach werden, kannst du ihr ruhig die Decke wegziehen. Aber ich hoffe, du verbringst die Nacht lieber mit Frau Dielmeister, mit Monika Dielmeister. Mit der steckst du nämlich unter einer Decke. Wir beide schaffen das.“
*****
Dienstag, 16. Juli 2023
Polizeioberkommissar Diepholz hatte alle Hände voll zu tun. Gerade hatte sich eine Kita-Leiterin verabschiedet, die die Zerstörung des neuen Trampolins3 zur Anzeige gebracht hatte. Erst vor einer Woche hatten die Kleinen darüber abstimmen dürfen, ob sie vom Kita-Förderverein lieber eine Schaukel, ein Trampolin oder zwei Kletterbäume haben wollten. Sie hatten sich für das Hüpfgerät entschieden, und schon nach einer Woche war es den Vandalen zum Opfer gefallen! Diepholz hatte selbst keine Kinder, aber ihn ärgerte es, dass offensichtlich in diesem Land jeder ungestraft Dinge beschädigen und zerstören kann. So jedenfalls formulierte er es in einer WhatsApp-Nachricht an seine befreundeten Kollegen. Sie hatten vor zwei Jahren eine WhatsApp-Gruppe aufgemacht, um Vorkommnisse zu sammeln, die es zu verbessern galt. Den Gruppenmitgliedern war klar, dass die links-gelb-grüne Regierung zu lasch war. Multikulti und Gendern würde die Probleme des Landes nicht lösen können. Im Gegenteil, man verschwendete wertvolle Zeit und Kraft mit solch unnützen Scheinproblemen.
Bei der zweiten Anzeige drehte es sich um Fahrerflucht. Ein Rechtsabbieger hatte eine Fahrradfahrerin übersehen, sie zu Fall gebracht und war unerkannt davon gefahren. Diepholz langweilten diese ständigen Wiederholungen. Sicher war die Frau auf einem Lastenfahrrad unterwegs gewesen! Täglich gab es solche oder ähnliche Fälle. Was dachten sich die Leute eigentlich? Dass ein Autofahrer, anstatt zu seinem Termin zu fahren, neben der gestürzten Radfahrerin Wache hält, bis die Polizei kommt, um ein Pflaster auf die Wunde zu kleben? Das wäre ja, als ob der Finder einer Geldbörse voller Hunderter nichts Besseres zu tun hätte, als damit zum Fundbüro zu gehen! Diese Zeiten waren doch längst vorbei – falls es sie je gegeben hatte. Diepholz jedenfalls hatte so etwas Märchenhaftes nie erlebt. Ordnung gab es nur, wo für Ordnung gesorgt wurde.
Und der Hammer war ja die Anzeige wegen Beleidigung! Dieses Weichei von Landrat glaubte wohl, etwas Besseres zu sein. Wahrscheinlich auch so ein weltfremder körnerfressender Emanzenfreund, der Öffentlich-Rechtliche konsumierte!
Diepholz war sehr unzufrieden mit seinem Leben. Eigentlich wollte er Stärke und Ordnung. Deshalb hatte er sich nach Abschluss der Schule bei der Polizei beworben. Andererseits fand er die Etablierten jämmerlich, wenn sie wegen Lappalien zu ihm kamen. Das Recht des Stärkeren war ihm sympathisch – vorausgesetzt, es war auf seiner Seite.
*****
3 Rhein-Zeitung vom 30.6.2023: „Neuer Vandalismus-Vorfall in Koblenz-Rübenach – Diesmal trifft es die Kita“
27. Juni 2023
Die Zahlen logen nicht! Emmanuel Macron verzeichnete in seiner zweiten Amtszeit riesige Misserfolge. Die dreijährige Corona-Pandemie Anfang der 2020er Jahre hatte er noch mit leichten Kratzern überstanden. Dann kam die Rentenreform, die er seinem Volk nicht hatte vermitteln können. Dabei galt für Beschäftigte im Öffentlichen Dienst ein regulärer Renteneintritt schon ab 62 Jahren. Auch Polizisten und Feuerwehrleute genossen Privilegien. Dass die deutschen Nachbarn erst mit 67 in Rente gehen durften, interessierte die französische Öffentlichkeit ebenso wenig, wie die rasant gestiegene Lebenserwartung, mit der sich auch die Rentenbezugsdauer der französischen Rentner erhöhte.
Denise Lareine saß am Morgen des 27. Juni 2023 auf ihrer Terrasse und trank einen Kaffee zu ihrem Croissant. Die Umfragewerte ihrer Partei, des Rassemblement National, waren so gut, dass sie zu diesem Zeitpunkt eine Stichwahl gegen den amtierenden Staatspräsidenten gewonnen hätte. Aber, was sie in den Zehn-Uhr-Nachrichten hörte, würde ihrer Partei sicher noch sehr viele weitere Anhänger einbringen. Man berichtete vom Tod eines siebzehnjährigen französischen Jugendlichen marokkanisch-algerischer Abstammung.
Nahel Merzouk war polizeibekannt. Vor drei Tagen erst war er zuletzt in Polizeigewahrsam gewesen, drei Tage vor seinem tragischen Tod. Abgesehen von seinem Ende hatte Nahel Merzouk eine für die Banlieues typische Biografie.
Jetzt war sein junges Leben durch einen französischen Polizisten ausgelöscht. Innenminister Gérald Darmanin hatte Stärke demonstrieren wollen:
„Il faut stopper l’ensauvagement“, zu Deutsch: „Wir müssen die Verwilderung stoppen.“4 Es klang fast zweideutig, denn er hatte wohl nicht die Verwilderung der französischen Polizei gemeint. Der in der Öffentlichkeit nur mit „Florian M.“ bezeichnete Polizist hatte den tödlichen Schuss abgegeben. Zu seinem Schutz nannte man nicht seinen vollen Namen, denn er war früher Teil einer Polizei-Kompanie gewesen, die in Verruf geraten war. Ermittlungen wegen Gewalt, rassistischer Äußerungen, unrechtmäßiger Festnahmen, Erpressung von Dealern und Fälschung waren der Grund. Auf der anderen Seite hatte sich der 38jährige Polizist, der vor seinem Polizeidienst als Soldat in Afghanistan gekämpft hatte, Auszeichnungen für seinen Einsatz gegen die Gelbwestenbewegung verdient.5
Florian M. hatte als Rechtfertigung „Notwehr“ angegeben und eine Version aufgetischt, die so lange seine Argumentation stütze, bis in den sozialen Netzwerken ein Video vom wirklichen Tathergang bewies, dass er die Unwahrheit gesagt hatte.
Für Nahels Familie wurde ein Spendenaufruf gestartet. Aber Jean Messiha, ein Unterstützer der harten Linie der Polizei, startete daraufhin eine Spendenaktion für den inzwischen wegen vorsätzlicher Tötung angeklagten Polizisten und prahlte damit, dass seine Spendensumme die von Nahels Familie übertreffen würde. Tatsächlich hatte er innerhalb von anderthalb Wochen 1,7 Millionen Euro eingesammelt, wohingegen Nahels Mutter nur einige Hunderttausend Euro bekam.6
Solche Ereignisse machten die Spaltung der französischen Gesellschaft deutlich. Anfangs waren es einige wenige radikale Rechte, auf der anderen Seite die Masse der gemäßigten und selbstkritischen Liberalen und Konservativen, die man aber kaum wahrnahm. Nun fühlte es sich so an, als würde sich das Blatt zu wenden.
*****
4 TAZ vom 7.7.2023 — „Krawalle in Frankreich – der Zorn aus den Vorstädten“
5 Wikipedia: Tötung von Nahel Merzouk
6 Wikipedia: Tötung von Nahel Merzouk
Mittwoch, 5. Juli 2023
„So kann ich ungehindert Kritik üben. Das ist bitternötig! Sonst machen die mit uns den Hannes!“ erklärte Noah seiner Mutter.
„Wenn ich schon die Reden unserer Politiker höre, wird mir übel! „Wir müssen über die Steuergruppe noch wichtige weitere Elemente implementieren, dann sind wir so fit unterwegs, dass wir am Ende des Tages nicht nur die Must-Haves, sondern auch die Nice-to-Haves erreichen.“
„Solche inhaltslosen Sätze helfen dem Bürger herzlich wenig, selbst wenn er sie verstehen würde.“
Nicole Pelter war alleinerziehend. Noah, ihr einziges Kind, hatte sie im Alter von Sechsunddreißig bekommen. Mit „Die“ meinte er die Regierenden schlechthin. Wie sonst sollte er Deutschland vor dem Abstieg bewahren?
„Nicht, dass du Ärger mit der Polizei bekommst!“ sorgte sich Nicole. Ihr Sohn wollte in die IT-Branche. Da konnte er viel Geld verdienen. Er würde sie finanziell unterstützen. Schon von klein auf hatte er sich für Computer interessiert. Jetzt mit zwanzig und ein Jahr vor dem Abitur war er einer der Besten auf seinem Gebiet. Nebenher verdiente er sich schon jetzt einige Euro durch Consulting. So nannte er die Beratung seiner Freunde, die wissen wollten, was es mit dem Darknet auf sich hatte. Manchen legte er auch einen Fake Account an, oder er gab in juristischen Dingen Rat.
„Mama, die Zeiten des Sitzenbleibens sind vorbei. Das Abi schaffe ich mit links. Und dann mache ich meine eigene Firma auf und werde ein paar Angestellte haben.“
Nicole hielt das für realistisch und fühlte sich getröstet, denn ihre Arbeit im Altenheim „Abend-Residenz“ fraß sie auf.
Sie hasste den Namen ihres Arbeitgebers:
„Abend-Residenz! Das ist doch eher ein ‚Wartezimmer des Todes‘, immer diese Schönfärberei! Eine Preiserhöhung heißt ‚Anpassung‘, das Ministerium, das für Krieg zuständig ist, heißt ‚Verteidigungsministerium‘. Soldaten werden nicht gekillt, sondern sie „fallen“. Warum sagt man nicht gleich, dass sie stolpern? Und die Dicken sind ‚vollschlank‘! Unsere Sprache verkommt immer mehr. Alles politisch korrekt und gegendert!
Am besten beginne ich meine Briefe nur noch mit: „Liebe diverse Personinnen und Personen unter den Lesend*innen.“
Ihr Sohn Noah konnte sie nur zu gut verstehen, aber nur zu schimpfen würde auch nichts nutzen.
Um ihr kärgliches Gehalt aufzubessern, hatte sich Nicole Pelter auf Nachtdienste spezialisiert. Der Zuschlag war nicht viel, aber er tat gut. Allerdings waren ihre Nächte harte Arbeit.
Früher hatte sie nachts Alexandre Dumas‘ „Graf von Monte Christo“ gelesen oder für ihren kleinen Noah einen Schal gestrickt.
Längst vorbei war die Zeit, da die Heimbewohner starben, bevor sie dement werden konnten. Längst vorbei die Zeit, da Patienten bis morgens um neun selig schliefen. Die Tagesstruktur der „Abend-Residenz“ schrieb vor, dass um 18:00 Uhr das Abendessen serviert wurde. Danach fing das Personal an, die Bewohner zu Bett zu bringen. Jeder wusste, dass das Schwachsinn war. Gestern erst fand Nicole den 84jährigen Herrn Stegner verzweifelt und nur mit einem Hut und einem Unterhemd bekleidet barfuß auf dem Flur. Es war kurz nach 3:00 Uhr nachts. Der Alte schien ausgeschlafen zu haben und rüttelte aufgeregt an jeder Tür, die sich ihm bot. Er war erleichtert, Nicole zu sehen.
„Helfen Sie mir! Ich muss schnell zum Zug, ich habe einen Termin mit meinen Vorstandskollegen, und jetzt finde ich meinen Mantel nicht. Ich habe Angst, den Zug zu verpassen!“
Dabei hielt Herr Stegner die Pflegekraft mit seinen zittrigen, fleckigen Händen am Unterarm. Früher, das wusste Nicole aus der Personalakte, war Herr Stegner tatsächlich im Vorstand einer mittelständischen Textilfirma gewesen. Er hatte sicher viel Verantwortung getragen und war pflichtbewusst gewesen. Wahrscheinlich ein Herr mit Krawatte und weißem Hemd.
Was für ein Kontrast zu heute!
„Den Zug kriegen wir noch, Herr Stegner. Wir gehen zusammen Ihren Mantel holen, der ist in Ihrem Zimmer“, beruhigte ihn Nicole.
Als die beiden sein Zimmer erreichten, war der Senior wieder in einer anderen Welt. Seine geplante Zugfahrt und der Mantel waren vergessen. Nicole würde den Arzt bitten, die Schlafmitteldosis zu erhöhen.
Sie war gut ausgebildet, was Demenz betraf. Sie wusste, wie man angemessen reagierte. Aber ihre Nerven wurden mit den Jahren auch nicht besser.
Wenn Noah richtig Geld verdiente, so hatte er ihr versprochen, würde er ihr erst einmal eine Auszeit und dann Urlaub zahlen – und schließlich seiner Mutter einen gut bezahlten Halbtags-Job in seiner Firma besorgen.
So wie Nicole die dementen Heimbewohner beruhigte, so wollte er seine Mutter besänftigen und ihr Hoffnung geben:
„Arbeiten kann ich dann von zu Hause aus. Vielleicht kaufen wir uns ein Ferienhaus in Frankreich. Da kenne ich…“
„Oh, es ist spät“, unterbrach sich Noah. „Ich hab noch was vor.“
*****
Donnerstag, 6. Juli 2023
Seit Nahels Tod war wieder Bewegung in die Protestszene gekommen. Die Banlieues zeigten wieder, dass die Probleme drängend waren, drängender als je zuvor.
„Wir holen uns, was uns gehört!“ schrie Karim, und damit feuerte er seine Mitstreiter an, von denen er die wenigsten persönlich kannte. Aber ihr Aussehen war eine unübersehbare Gemeinsamkeit: Schwarze Haare, modisch geschnitten, tiefbraune Hautfarbe. Viele waren erst zwischen dreizehn und achtzehn Jahre alt. Nicht nur ihr Äußeres, sondern auch ihr Wunsch, endlich wie Franzosen behandelt zu werden, vereinte sie.
„Wir leben in St. Denis, einem Vorort von Paris! Wenn wir nicht Franzosen sein dürfen, obwohl wir es sind, dann machen wir sie kaputt. Und dazu alles, was ihnen wertvoll ist!“
In seiner Jutetasche suchte er nach einer Flasche Wasser. Trotz der späten Stunde war sie leicht zu finden, denn die brennenden Autos ringsum leuchteten wie hilfreiche Fackeln.
„Ich habe Durst. Lass uns was zu trinken besorgen! Meine Flasche ist leer. Drüben ist der Supermarché. Die öffnen in fünf Minuten für uns!“
Die Jungs um ihn herum grölten. Natürlich waren die Geschäfte geschlossen. Nicht wegen der späten Tageszeit, sondern wegen der Randale. Vom Wachdienst war nichts zu sehen.
Der beißende Rauch der Autowracks zog in ihre Richtung. Die Jungs hatten Tücher vor dem Gesicht. Gegen den Qualm halfen sie wenig, dafür aber bei Fotos und Videos, die die Polizei immer wieder machte. Nutzloses Material, denn so vermummt waren sie kaum zu identifizieren.
Die Polizei würde bei der Auswertung der Bilder bestenfalls Karims Schirmmütze mit dem Schriftzug „Pernod“ als auffällig bewerten. Aber auch die war nicht selten auf anderen Köpfen zu finden.
Karim war sechzehn. Doch in dieser Gruppe hatte er ein Ansehen wie ein alter Hase oder ein erfahrener Vorarbeiter. Seine unerschrockene Entschlossenheit verschaffte ihm Respekt. Er hatte das Gefühl, diesen Kampf sei er Nahel schuldig. Erst vor wenigen Wochen hatte er ihn kennengelernt, und sie hatten Freundschaft geschlossen. Nahel durfte nur 17 Jahre alt werden! Bestimmt mehr als zwanzig Mal hatte sich Karim das Video auf YouTube angeschaut. Es zeigte Jul, daneben Nahel. Und er, Karim, stand dahinter. Bei Minute 5:32 konnte man sie alle drei für ein paar Sekunden sehen: Jul, Nahel und Karim! Hunderttausendfach angeklickt! Karim erinnerte sich, wie sich Nahel augenzwinkernd entschuldigt hatte, weil er nicht mehr angestellt hatte. Warum erschossen die Bullen so jemand? Sein Hass auf die französische Regierung und vor allem auf die französische Polizei war grenzenlos!
Aber unter dieser rauen Schale verbarg sich eine sensible Seele. Aus der Distanz hätte ihm das keiner angemerkt. Er hatte ein feines Gespür dafür, mit welcher Bewunderung die Mitkämpfer auf seine Anweisungen und Ideen reagierten. Genau diese Bewunderung hätte er sich von der französischen Gesellschaft gewünscht! Von seinen Eltern sowieso.
Karim hatte durchaus bestaunenswerte Fähigkeiten. Er sang wie schon sein Vater und Großvater zu den Klängen seiner Gimbri, einer dreisaitigen Laute mit großem, hölzernen Resonanzkörper. Die Maqam-Tonleiter mit ihren Vierteltonschritten ließ bei jedem Nordafrikaner Heimatgefühle aufkommen. Aber kein einziger Franzose nahm seine Musik als wirklich große Kunst wahr.
Heute hatte er keine Gimbri dabei, seine „Instrumente“ waren Messer, Hammer und Steine, nicht zu vergessen ein Feuerzeug. Die Fenster des Supermarché leisteten nur kurz Widerstand. Bevor eine Gruppe von acht jungen Menschen sich unter seiner Führung Zugang verschaffte, winkten sie in die Überwachungskameras und riefen im Chor „Allahu Akbar“, Gott ist groß. Ein Rausch von Erleichterung und Befriedigung durchströmte Karims Körper.
Sie bedienten sich an der reichlichen Getränkeauswahl des Supermarktes und machten es sich in einer Ecke gemütlich. Der Rauch der brennenden Autos zog durch die zerstörte Scheibe zu ihnen herein.
Aber am nächsten Morgen, wenn Karim, wie nach zwei Tagen Schwerstarbeit, müde ins Bett fallen würde, kämen wieder Frust und Ernüchterung über ihn. So war es schon die letzten Tage gewesen. Im Grunde wusste er, dass mit einer Plünderung nicht ein einziges seiner Probleme gelöst war. Eigentlich ist es stumpfe Rache, sagte er sich. Rache, die nicht einmal den Richtigen trifft. Gleichzeitig tröstete er sich: Sie haben es nicht anders verdient! Nur diesen letzten Satz sagte er laut vor den anderen:
„Sie haben es nicht anders verdient!“
Ashraf, sein zwei Jahre älterer Freund, saß neben ihm auf einer Getränkekiste. Er war ruhiger. Fast hätte man glauben können, die Schwere einer Depression oder pure Resignation würden ihn lähmen.
„Karim, ich sehe den Weg nicht“, grübelte er. „Bist du sicher, dass unsere Rache richtig ist? Ist es das, was Allah will?
„Allah will Gerechtigkeit! Und was wir hier erfahren ist das Gegenteil! Sie geben uns keine Chance!“
Nachdenklich und leise entgegnete Ashraf:
„Meine Mutter putzt in diesem Supermarkt. Ihr jedenfalls haben wir nicht geholfen. Die Bankautomaten, die Geschäfte, die Busse, die wir kaputtgemacht haben, all das können wir jetzt selbst auch nicht mehr nutzen!“
Solche Töne passten nicht zu ihren Taten, zu ihrem Rausch der Gewalt und Verzweiflung. Keiner von ihnen kannte Ashrafs Mutter, und doch schwiegen sie plötzlich und machten nachdenkliche Gesichter. Ashraf war noch nicht fertig: „Niemand wird geheilt, indem er einen anderen verwundet!“
Wieder gab es eine Pause. „Ja, wir sind alle verwundet. Deshalb kann ich eure Wut verstehen. Ich habe die gleiche Wut. Wir sind im Recht! Wir müssen protestieren. Der Staat drängt uns in eine Parallelwelt.“
Dieses Wort verstand nicht jeder in der Gruppe. Ashraf kam zwar aus dem gleichen Milieu wie die anderen, aber wo immer er etwas an Bildung erhaschen konnte, sog er es gierig auf.
„Aber einen ersten Erfolg haben unsere Proteste schon gebracht. Leute, ich habe es geschafft, einen Termin bei Monsieur Jouvre, dem Bürgermeister unseres Stadtteils zu bekommen. Das hätten wir ohne Proteste nie geschafft! Morgen um 11.00 Uhr bin ich bei ihm. Er hat gesagt, ich darf noch zwei Freunde mitbringen.“
Mohammad fing an zu lachen: „Warum hast du uns das nicht früher gesagt? Dann hätten wir uns die Arbeit heute sparen können!“
Karim wusste, dass er es nicht ernst meinte, denn alle waren überzeugt, dass nur Zerstörung den Staat zur Vernunft brachte – außer vielleicht Ashraf.
*****
Freitag, 7. Juli 2023
Mit vorsichtigem Optimismus und Herzklopfen, aber auch mit dem Gefühl, nichts verlieren zu können, kam Ashraf in Begleitung von Karim und Mohammad zum Büro von Monsieur Jouvre. Er hatte die beiden tatsächlich überreden können mitzugehen!
„Wen darf ich melden?“ fragte seine Sekretärin.
Sie war eine Frau, die zwar einen nordafrikanischen Touch, offensichtlich aber auch französische Vorfahren hatte. Dennoch machte sie nicht den Eindruck, als fühle sie sich wie eine von ihnen.
„Wir haben um elf einen Termin bei Ihrem Chef. Er weiß Bescheid“, antwortete Karim mit einer Mischung aus Wut und Selbstbewusstsein.
Es dauerte bis 11:10 Uhr, bis die drei eintreten durften. Ob Monsieur Jouvre sie absichtlich hatte warten lassen? Ein taktisches Manöver, um zu zeigen „Hier bestimme ich, wo es lang geht“?
Er bat sie, Platz zu nehmen. An der Wand stand eine bequeme Couch in schwarzem Kunstleder, auf der sie ihm schräg gegenüber saßen. Jouvre saß auf seinem Bürostuhl, rechts neben ihm standen zwei bewaffnete Polizisten in Uniform. Das gefiel Karim zwar nicht, aber andererseits verschaffte es ihm Genugtuung, dass ein Staatsbeamter sich offensichtlich nicht traute, mit drei jungen Menschen alleine zu verhandeln.
Der Bürgermeister wartete aufreizend lange, ohne auch nur ein Wörtchen zu sagen. Er blätterte scheinbar ziellos in seinen Unterlagen. Da ergriff Ashraf die Initiative:
„Gut, Monsieur, nehmen wir an, ab morgen zünden wir keine Autos mehr an. Was passiert dann?“
Jouvre schien mit seinem Schweigen sein Ziel erreicht zu haben.
„Dann gehen Sie wählen. Die Wahlbeteiligung in den Banlieues liegt unter dreißig Prozent!“
Ashraf schüttelte den Kopf: „Wenn wir wählen gehen, haben wir dann Ausbildungsplätze, haben wir dann Anerkennung? Sind wir dann Franzosen? Was ist mit Fraternité? Was ist mit Égalité? Die heutigen Franzosen benehmen sich, wie die Adligen bei der Französischen Revolution. Es fehlt nur noch, dass Sie uns empfehlen, Kuchen zu essen, wenn wir kein Geld für Brot haben, wie Kaiserin Marie-Antoinette damals!“
„Der Bursche scheint nicht ungebildet zu sein“, dachte Jouvre bei sich. Er hatte sich alles, ohne zu unterbrechen, angehört. Ashraf hatte ihn beeindruckt. Jouvre hätte ihn berichtigen können, denn das genannte Zitat war wohl Marie-Antoinette im Rahmen der Propaganda in den Mund gelegt worden. Sie war auch nicht Kaiserin, sondern die Gattin König Ludwigs XVI.
„Aber erst muss die Gewalt aufhören!“ forderte Jouvre.
„Genau!“ rief Mohammad aufgeregt, und er merkte nicht, dass sowohl Jouvre als auch die drei Jugendlichen mit ‚Gewalt‘ jeweils die Gewalt der anderen Seite meinten. „Sie haben einen von uns erschossen! Dafür müssen sie zahlen!“
„Ich meine, die sinnlose Gewalt. Autos anzünden, plündern, Polizisten angreifen.“ Jouvre unterteilte offenbar in sinnlose und sinnvolle Gewalt.
„Und ich meine, Sie behandeln uns wie Sklaven, mit denen die Polizei machen kann, wozu sie Lust hat.“
Mohammad mauserte sich zum Wortführer:
„Bullen sind Rassisten. Sie werden nicht gewinnen!“
Dabei zeigte er wild gestikulierend auf die beiden anwesenden Polizisten, die weiterhin ruhig, aber aufmerksam dastanden.
Ashraf merkte, dass das Gespräch so keine Früchte tragen würde.
„Im Oktober und November 2005, Monsieur Jouvre, gab es Unruhen. Alles wie heute. Wochenlang sah man brennende Autos, Frust, Zerstörung, Gewalt und Gegengewalt. Die Ursachen, nämlich Armut, fehlende soziale Integration und Arbeitslosigkeit haben sich bis heute nicht geändert.“
Mit einer gewissen Berechnung hatte Ashraf den Bürgermeister mit seinem Namen angeredet. Seinen Freunden hatte er schon immer erzählt, dass die Anrede ein wichtiger Schlüssel sei, um Anerkennung und Wertschätzung auszudrücken. Ashraf nannte es „die Seele streicheln“.
Jouvre schien in der Tat weich zu werden, vielleicht sogar einsichtig:
„Das stimmt, es hat sich zu wenig verändert.“
„Sie würden nicht hier sitzen, Monsieur Jouvre, wenn Ihre Eltern aus Saint-Denis kämen. Meine Eltern kommen aus St. Denis!
Sie wären nicht in diesem Büro, wenn Ihre Eltern marokkanische Vorfahren hätten. Meine Eltern hatten marokkanische Vorfahren!
Sie hätten diesen Job nicht, wenn Sie auch so aufgewachsen wären wie wir drei.“
„Auch das stimmt – wahrscheinlich.“
Nach einer Pause fügte Jouvre hinzu: „Beide Seiten haben Fehler gemacht. Sie wollen gerecht von der Polizei behandelt werden. Aber wenn Sie die Polizei mit Steinen bewerfen, sie beleidigen, in Gefahr bringen, erwarten Sie dann nicht, dass die freundlich auf Sie zugehen und Ihnen einen Kaffee anbieten.“
„Sie meinen, der Eine zeigt auf den Anderen und beschuldigt ihn, angefangen zu haben? Wie im Kindergarten?“
„Das könnte man so sagen.“ Jouvre fühlte sich verstanden. Auch Ashraf hatte das Gefühl, wenigstens angehört worden zu sein.
„Monsieur Jouvre, das Wort ‚Banlieue‘ setzt sich zusammen aus ‚ban‘, also ‚außerhalb‘, und ‚Lieue‘, einem alten französischen Maß für Entfernungen. Eine ‚Lieue‘ ist eine Distanz von gut vier Kilometern. In den Banlieues zu wohnen, bedeutet, wir sind raus aus der Gemeinschaft. Aber nicht vier Kilometer vor der Tür, sondern vierhundert! Lassen Sie uns endlich rein! Wir fühlen uns wie Hunde vor der Metzgerei!“
Wieder nahm Bürgermeister Jouvre deutlich wahr, dass sein Gegenüber unerwartet gebildet und wortgewandt war. Er durfte ihn nicht unterschätzen.
„Ich schlage vor, dass wir uns in zwei Wochen wieder treffen. Bis dahin, bitte versprechen Sie mir das, unterlassen Sie jedwede Gewalt als Mittel der Konfliktbewältigung. Außerdem machen Sie mir bitte eine Liste mit Vorschlägen, wie Sie Ihr Können, Ihre Fähigkeiten und Neigungen, nutzbringend für die Gesellschaft einbringen können. Im Gegenzug werde ich versuchen, Haushaltsmittel locker zu machen, um ein solches Förderprojekt zu finanzieren.“
„Ich mache Musik! Meinen Sie so was?“ wollte Karim wissen, der wie immer seine Pernod-Mütze trug.
„Ja, zum Beispiel! Oder, wenn Sie Kontakte zu anderen – wie soll ich sagen – zu anderen jungen Menschen haben – Sie verstehen – Sie könnten als Streetworker Verbindungen knüpfen, Gespräche führen, Verständnis wecken…“
Karim verbuchte die mögliche Förderung seiner Musik als Fortschritt in den Verhandlungen. Vielleicht würde Jouvre ein Konzert arrangieren, dabei eine Rede halten, und er, Karim, durfte vielleicht den Eintritt kassieren. Oder wenigstens einen Teil davon. Aber was wollte der Bürgermeister noch? Wie sollte jemand, der bisher sein Geld als Dealer verdiente, auf einen anderen Weg gebracht werden? Sicherlich nicht mit geknüpften Verbindungen und gewecktem Verständnis!
Dennoch war dieses Treffen ein erstes Zeichen der Hoffnung, und zwar für beide Seiten.
Zwei Tage später stellte Jouvre in einer Ratssitzung seinen ‚Plan für Interaktion, Kommunikation und Inklusion‘ vor. Er hatte kaum ausgeredet, da erhob sich eine wilde, völlig ungeordnete und emotionale Diskussion. Die Opposition sprach lautstark von ‚inakzeptablem Nachgeben gegenüber den Chaoten‘. Sogar seine Parteigenossen bescheinigten ihm ‚Profilneurose und idealistische Fantasterei‘. Der Polizeipräsident warf ihm sogar vor, Gewalt gegen Polizisten unterstützen zu wollen.
Es war der schwärzeste Tag seiner bisherigen Karriere! Zweifel überkamen ihn. Vielleicht hatten seine Gegner Recht.
Nicht ein einziger war seiner Meinung, um ihn zu unterstützen! Konnten so viele Menschen sich gleichzeitig irren? Sollte man den Chaoten doch ausschließlich mit unnachgiebiger Härte begegnen? Jouvre war ratlos und verunsichert.
Auf der anderen Seite hatte er in seinen bisherigen vierunddreißig Dienstjahren so viel Erfahrung gesammelt, dass er das Gefühl hatte, von einer Horde Dummköpfe beraten zu werden, die sich aber für klüger hielten als er es war. Nichts hasste er mehr als dieses Gefühl!
Alle Sitzungsteilnehmer hatten emotional reagiert, aber nicht ein einziges sachliches Argument vorgebracht. Hatten nicht diese Halbwüchsigen mehr für Gleichheit und Brüderlichkeit getan als jene sturen oppositionellen Stadträte? Hatten sie nicht früher schon leise und artig auf Missstände hingewiesen, waren aber nie ernst genommen worden? Und deshalb zwangen sie jetzt den Staat, ihren Anliegen Gehör zu schenken! Mit Gewalt!