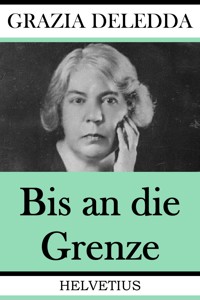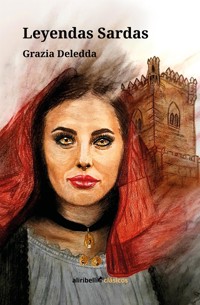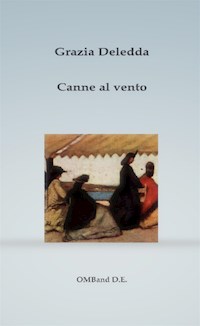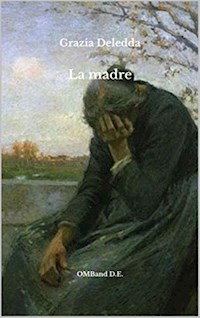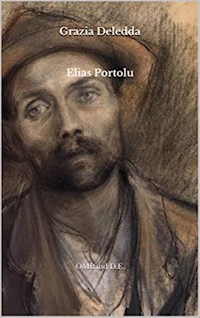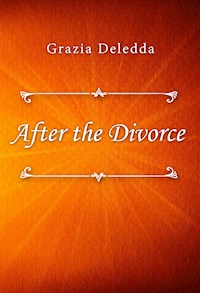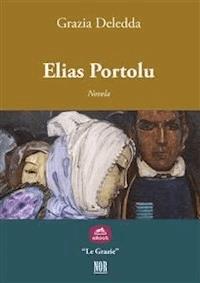Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: marixverlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: PERLEN
- Sprache: Deutsch
Eine junge sardische Frau begibt sich mit ihrem Mann auf Hochzeitsreise an einen stürmischen Ort am Meer. Noch bevor die Braut das alte Städtchen in der wilden Berggegend überhaupt kennenlernen kann, begegnet sie dem »schwarzen Mann«, einem schluchzenden Geigenspieler, und erkennt in ihm Gabriele wieder, den Virtuosen, in den sie sich vor Jahren verliebt hatte, und der damals spurlos verschwunden war. Die Begegnung stürzt die Erzählerin in größte Seelenqualen. Denn obwohl sie willens ist, mit ihrem Ehemann, den sie vergöttert und der in seiner patriarchalen Rolle fest verankert ist, die gemeinsame ewige Glückseligkeit anzustreben, regt sich Trotz und Widerstand in ihr. Sie will ihre alte Liebe nicht begraben, denn diese romantische Fantasie ist so sehr sie selbst, dass sie – die Liebe zu Grabe tragend – sich selbst begraben würde. In dem zeitvergessenen Ort der archaischen Provinz Sardiniens nimmt das innere Drama der Protagonistin Gestalt an. Als es am Abend eines Dorffestes endlich zur Begegnung zwischen ihr und Gabriele kommt, stellt die junge Frau mit Entsetzen fest, dass er gegen sie einen heftigen, alten Groll hegt … Der vielleicht schönste Roman der hierzulande kaum bekannten sardischen Literaturnobelpreisträgerin.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 186
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Grazia Deledda
BLICKE DER LIEBE UND DES NEIDS
Aus dem Italienischenvon Monika Lustig
Grazia Deledda
1871 in Núoro bis 1936 in Rom, begann früh und ehrgeizig, ihr Schreibtalent auszuleben. Sie unterhielt zahlreiche Briefwechsel mit wichtigen Größen. Ihr in 35 Sprachen übersetztes Werk (Novellen, Romane, Gedichte) ist bis heute viel gefragt. 1909 wurde sie im Wahlkreis Núoro vom Partito Radicale Italiano als Kandidatin für die Parlamentswahlen aufgestellt. Der ebenfalls aus Núoro gebürtige Marcello Fois hat ihr ein beeindruckendes Theaterstück gewidmet: Quasi Grazia, vielfach aufgeführt, in der Rolle der Grazia die 2023 verstorbene sardische Autorin Michela Murgia.
Monika Lustig
hat rund drei Jahre in der Provinz Núoro als Landwirtin und Idealistin gelebt, dort einen Sohn zur Welt gebracht. Sie hat Marcello Fois, Simonetta Agnello-Hornby, Leonardo Sciascia, Pier Paolo Pasolini, Andrea Camillieri u.v.m. ihre deutsche Stimme verliehen. 2019 gründete sie Edition Converso – Mediterrane Sprachwelten.
»… als ich mit dreizehn Jahren zu schreiben begann, legte mir vor allem meine Mutter Knüppel in den Weg. Die Weisen mahnen: Wenn dein Sohn Verse schreibt, schick ihn in die Berge; wenn du ihn ein zweites Mal erwischst, bestrafe ihn wieder; beim dritten Mal – lass ihn in Ruhe. Denn er ist ein Dichter. So ist es auch mir ergangen.«
Grazia Deledda in ihrer Dankesredezur Nobelpreisverleihung für Literatur, 1926
Inhalt
Blicke der Liebe und des Neids
PERLEN: SECHS GROSSE ITALIENISCHE SCHRIFTSTELLERINNEN
Trotz sorgfältiger Planung und entsprechender Maßnahmen verlief unsere Hochzeitsreise katastrophal. Geheiratet haben wir im Mai und sind unmittelbar nach der Trauung aufgebrochen. Es war Mittagszeit, ein frisches Lüftchen voller Blumenduft wehte, und Rosen, Rosen säumten unseren Weg. Junge Mädchen warfen sie aus den Fenstern ihrer Häuser, und händevoll Weizen und Blicke der Liebe und des Neids hinterher. Der Bahnhof war über und über mit Rosengirlanden geschmückt, und rötlich schimmerten auch die Hecken im Tal. Rosen und Korn. Liebe und Glück. Alles war uns hold.
Das Ziel unserer Reise stand passend zum Anlass fest: Ein kleines Haus zwischen grünen Auen und dem Meer, wo mein Bräutigam bereits so manche Ferien verbracht hatte. Eine ältere Frau, diskret und tüchtig in häuslichen Angelegenheiten, die er bereits kannte, sollte sich unserer materiellen Bedürfnisse annehmen. Und wir würden am Meeressaum oder inmitten der Wiesen voller Liguster oder weiter entfernt zwischen den moossamtigen Mäandern des rauschenden Pinienhains spazieren.
Zu diesem Zweck hatte ich mir einen Strohhut aus Florenz besorgt: biegsam, mit breiter Krempe wie die Flügel eines großen Schmetterlings und mit flatterndem, karmesinrotem Band, ähnlich denen, wie die Heroinen bei Alexandre Dumas dem Jüngeren sie trugen.
Bis zum ersten Halt des gemächlichen Zugs verlief unsere Reise ganz traditionell: zuerst ein paar Tränen vergießen wegen der zurückgelassenen Menschen und Dinge; dann einander zulächeln, beider Hände verflechten sich ineinander, Augen spiegeln die geliebten Augen des anderen bis ins Unendliche. Herzen voller Gewissheit: Die ganze Welt ist ein irdisches Paradies und gehört nur uns. Rosenblätter und Weizenkörner fanden sich noch immer tief in den Falten meines Gewands verborgen.
Diesem anmaßenden Traum fügte die Wirklichkeit beim ersten Halt des kleinen Zugs einen Riss zu.
Nein, die Welt ist nicht ganz und gar unser! Viele erheben Anspruch auf sie! Der Bahnhof inmitten der Felder wird von einer der Menschenherden geflutet, wie sie sich im Sommer von den Städten auf den Weg zu den Badeorten macht; doch diese Horde, die da über den kleinen Zug herfällt, erweist sich als noch arroganter und abstoßender.
Alles Männer, jung, fast noch Burschen: Menschen vom Dorf, Bauern, Viehhüter, in grotesker Aufmachung, mit Bergstiefeln, geschnürten Bündeln, Wanderstöcken, Geruch nach Herdentier und Menschenleben nah am Erdreich.
Im ersten Moment kamen sie mir vor wie Auswanderer, doch um freiwillige Exilanten zu sein, waren sie allesamt viel zu jung, zu vergnügt, auch wenn ihre Heiterkeit etwas Gezwungenes, Ungeschliffenes an sich hatte.
»Das sind Rekruten«, erklärt mir mein Ehemann, »siehst du nicht den Sergeanten, der sie anführt?«
Tatsächlich steigt dieser ein und betritt unser Abteil, und da die dritte Klasse nicht groß genug ist, um allen Platz zu bieten, hat er einige Untergebene im Gefolge.
Ade, Glückseligkeit!
Unsere Anwesenheit fällt unmittelbar ins Auge, unsere Situation wird auf der Stelle begutachtet und ein entsprechendes Urteil gefällt; denn ein Brautpaar am ersten Tag seiner Hochzeit ist zwangsläufig der Lächerlichkeit preisgegeben, auch seitens braver Bürger, und erst recht vor einer solchen Bande.
Unsere Hände lösten sich, und ebenso schienen sich unsere Seelen voneinander zu trennen.
Mein Ehegatte war und ist ein gesitteter Mensch, das heißt, er ist gesellig, hat ein offenes und verbindliches Wesen; überdies ist er gutgläubig, hat Zutrauen zu seinem Nächsten und sieht in ihm stets einen ehrlichen Menschen, da er selbst ein ehrlicher Mensch ist. Seine Augen sind wie weitgeöffnete Fenster zu seiner Seele, in die alle hineinblicken können, und nicht einen düsteren Winkel gibt es darin, wo ein Geheimnis sich verbergen könnte.
Aber er ist ein Mann, der von seinesgleichen ebenso viel verlangt. Für ihn ist es unablässig, dass aus Achtung vor sich selbst und den anderen auch der Form genüge getan werde. So war er der erste, der unsere Lage gegenüber der ausgelassenen Horde richtig einschätzte, die ganz der Sinnenfreude frönte und in dieser Situation auch recht brutal wirkte. Er rückte von mir ab, nur dem Anschein nach, versteht sich, um uns zu beschützen in dieser perversen Atmosphäre, die schlagartig um uns herum aufgekommen war. Ja, er begann eine Unterredung mit dem Sergeanten, dann auch mit den Rekruten: Auch er habe beim Militär gedient und den Rang eines Reservekapitäns erlangt, worauf er großen Wert legte. Der Kontakt mit den neuen Mitreisenden stimmte ihn augenfällig heiter, ja, er befeuerte ihn geradezu. In aller Ausführlichkeit fing er an, die Geschichte seiner Militärlaufbahn zu erzählen, mitsamt den galanten Abenteuern, und dann, um ihm in nichts nachzustehen, erzählte der Sergeant die seinen.
Jetzt waren die jungen Leute ganz Ohr, sie lachten und schenkten mir keinerlei Beachtung mehr. Schließlich stimmten alle ein Soldatenliedchen an, vielmehr war es mein Begleiter, der zu singen anhob.
Das alles scheint nicht der Rede wert; dennoch kann ich nach so vielen Jahren nicht ohne ein Gefühl der Bestürzung an diese Stunde zurückdenken.
Es schien, als wäre ich allein auf der Welt, und schlimmer noch als allein, einem zwielichtigen Schicksal ausgeliefert und wie eine echte Sklavin nach einer Kriegsrazzia von einer Soldateska verschleppt.
Das entsprechende Wesen besaß ich ja: Geboren an einem Ort, wo die Frau noch immer nach orientalischen Maßstäben gemessen wird – folglich ins Haus verbannt ist, einzig und allein mit der Aufgabe, zu arbeiten und für Nachwuchs zu sorgen –, konnte ich sämtliche Merkmale dieser Rasse auf mich vereinen: kleinwüchsig, dunkler Teint, schwarzes Haar, misstrauisch und verträumt wie eine Beduinin, die selbst von ihrem Zelt aus am Wüstenrand das goldene Blendwerk einer fantastischen Welt erblickt; so versammelte ich in meinen Augen den Widerschein dieser glutvollen Weite, dieses Horizonts, der im herannahenden Abend die flüssigen Farben meiner Iris annimmt.
Alles in meinem Geiste wurde zu einem Werk der Fantasie: Die kleinsten Vorkommnisse spielten sich als grandiose Ereignisse ab, die geringfügigsten Anzeichen der Realität nahmen die Form von Symbolen, Prophezeiungen, Verheißungen an. All das versetzte mich in höchste Begeisterung, um mich dann, kaum war die Fantasie erloschen, wieder zu bedrücken.
Mein Instinkt, auch der ein Merkmal der Rasse, trieb mich so weit, mich auch der schlichtesten Dinge und Bedürfnisse wegen zu verstecken. Niemand durfte mein nacktes Fleisch, mein offenes Haar sehen, selbst meine Hände verbarg ich. Manchmal aß ich wie ein angeschlagenes Wildtier in den abgelegenen Winkeln des Hauses. Warum nur? Wegen des Urinstinkts, meine Nahrung vor fremder Gier in Sicherheit zu bringen, oder weil mich der Akt der Nahrungsaufnahme an sich als etwas Unreines und Vulgäres dünkte?
Mein Körper schließlich durfte nicht existieren, nicht für die anderen und vielleicht nicht einmal für mich selbst: Doch genau wegen dieses willentlich mir auferlegten Zwangs waren alle meine Sinne höchstlebendig, und die Dinge außerhalb von mir, seien sie schön oder hässlich, packten mich mit der Heftigkeit von Lust oder Abscheu.
Vor allem die Augen verbarg ich unter tiefen Lidern und langen Wimpern; um auf diese Weise das heftige Bedürfnis nach Leben und die Glut auf dem Grund meines Wesens zu verhüllen; wohl auch, um dem grellen Licht meiner eigenen Träume zu entgehen, so wie es der Fall ist bei Zugvögeln, die mit ihrem kräftigen Flügelschlag lange Strecken fliegen; ihre Augen sind ausgestattet mit doppelten Lidern, um im Ungestüm des Flugs nicht unter der Wucht des Winds und des Sonnenlichts zu erblinden.
Doch das, was ich verbergen wollte, gehörte ganz allein mir. Insofern betrachtete ich mich in den strengen Gewissensprüfungen, bevor ich zur Beichte ging, nicht als eine Heuchlerin, noch viel weniger als eine vom Ehrgeiz Getriebene. Nein! Ich wusste, dass das, was ich in meinem Innern verwahrte, ein kostbares Erbe war: nämlich der wunderbare Reichtum der jungfräulichen Geschlechter, das Sicherheben des Geistes aus der Glut des Fleischs, so wie das Licht aufsteigt aus der Flamme, und zusammen mit dem angeborenen Streben nach Reinheit und körperlicher Unversehrtheit die Suche nach einem unerreichbaren Punkt ist, was die Suche nach Gott selbst ist.
Aus diesem Grund hatte ich den Mann erwählt, der mich jetzt auf meiner ersten Reise durch die irdische Wirklichkeit begleitete. In seinen Augen, die nichts verheimlichten, fand ich eine Ursache des Mysteriums, nach dem ich suchte.
Die grässliche Fahrt mit den Rekruten, die erst an unserem Zielbahnhof endete, das Zusammentreffen mit einer durch und durch triebgesteuerten Menschheit, zu der auch er, wie mir schien, gehören wollte, zeigten mir allmählich das materielle Gesicht der Wirklichkeit.
In die Ecke des Abteils gezwängt, ohne den Anblick frühlingshafter Landschaften genießen zu können – wie vom Wind davongetragen –, entwarf ich mit luzider Resignation den Plan für mein Leben.
„Ich bin dazu verdammt, alleine zu leben. Nun begreife ich es, aber ich schrecke nicht zurück. Immer schon habe ich allein gelebt, auch an der Seite meiner Mutter und meiner Brüder. Ich glaubte, in meinem Ehemann ebenso auch einen spirituellen Gefährten gefunden zu haben. Doch da habe ich mich getäuscht. Vielleicht ist es das Los aller: alleine zu sein.“
Im Grunde verspürte ich einen kalten und harten Schmerz; als hätte mein Ehemann, der in dem Moment ein solcher noch nicht war, mich bereits betrogen. Und ich war mir nicht bewusst, dass es meine Lebensunerfahrenheit und mein atavistisches Misstrauen gegenüber allem Neuen waren, die dieses Drama hervorbrachten.
Begleitet von Hurrarufen, Gebrüll, Scherzen und den zweideutigen Glückwünschen aus dem Mund der Reisegefährten steigt man also aus dem Zug; selbst der ergebene und höfliche Gruß des Sergeanten klingt in meinen Ohren wie Ironie, und vielleicht ist er es, meiner spröden Ungeselligkeit geschuldet, tatsächlich. In Klüngeln erscheinen die dämonischen Köpfe aller Rekruten an den Abteilfenstern, und da der kleine verwaiste Bahnhof, umtost von einem Wind ähnlich dem auf der Fahrt, keinen anderen Blickfang bietet, sind aller Augen auf das junge Paar gerichtet, das seine Koffer auslädt und sich in Ermangelung von Gepäckträgern anschickt, diese selbst zu tragen.
Mein Ehemann grüßt zum Abschied in die Runde, ja, es hat den Anschein, als daure es ihn, die heitere Kompanie zurückzulassen, um seiner kleinen, ernsthaft verärgerten Braut zu folgen. Endlich setzt sich der unholde Zug in Bewegung und fährt in Richtung des türkisglänzenden Horizonts. Doch wie zu einem letzten derben Scherz stimmen die Rekruten eine Art Hochzeitsgesang an, gespickt mit den üblichen Anspielungen; vielleicht ist es auch ein wohlwollender, gar nostalgischer Chor, schließlich ist alles, was man zurücklässt, gut, auch für einen Menschen, der die Poesie allein in animalischer Form aufnimmt – doch dieser Chor trifft mich hinterrücks wie ein eisiger Windstoß.
In Wirklichkeit bläst tatsächlich ein solcher Wind von Nordwesten, und als wir aus dem Schutz des Bahnhofsgebäudes treten, bedrängt er uns mit boshafter Heftigkeit. Ich habe noch immer den Eindruck, dass es die einsamen Geister vor Ort waren, die uns feindlich empfangen und wie Feinde davongejagt hätten, hätten wir nicht das Gegengewicht der Gepäckstücke gehabt.
Aber wo sind wir?
»Sollte nicht eine Frau kommen, um unsere Sachen fortzuschaffen?«
Beim Pfiff der verärgerten Stimme zuckt mein Mann zusammen, ist mit einem Ruck wieder ganz bei mir.
»Nun, wir werden es sehen, vielleicht verspätet Marisa sich.«
Doch daran glaubt er wohl selbst nicht so recht. Besorgt lässt er mich den Koffer auf einer kleinen Bank am geschlossenen Kiosk auf dem Bahnhofsvorplatz abstellen, äugt hierhin und dorthin, in die Ferne, bis zum Ende der Alleen, die von hier im Dreistrahl abgehen und sich über die jetzt menschenleeren Felder bis hin zum Meer ziehen.
»Ihr muss etwas zugestoßen sein. Oder vielleicht hat sie meinen Eilbrief gar nicht erhalten?«
Aus welchem Grund auch immer, die Frau lässt sich nicht blicken, und im Innern des Kiosks pfeift voller Ironie eine Koboldschar. Ringsum erblicke ich eine Ebene, dicht bewachsen mit hohen Gräsern und weißblühenden Büschen, die wie vom Wind zerzauste Köpfe alter Frauen wirken. In der Ferne zeichnet sich dunkel vor dem schon lohendroten Sonnenuntergang ein Pinienhain ab, und der Glockenturm des Dörfchens erhebt sich über den Baumkuppeln wie der Hirte über seine Herde.
Mein Mann will mir Mut machen.
»Glaub ja nicht, meine Kleine, dass wir bis dort hinten gehen müssen. Unser Häuschen ist hier, nur zwei Schritte entfernt. Lass uns aufbrechen.«
Behänd wie ein gestandener Gepäckträger lädt er sich die Koffer auf die Schultern, überlässt mir nur die Bündel, und ich folge ihm. Jetzt aber ist es mein Herz, das schwer auf mir lastet: Ich habe den ermüdenden Eindruck, auf einen Berg zu steigen und nicht Richtung Meer hinabzugehen.
Aus dem Frühling war mit einem Mal Herbst geworden. Vom Herbst zeugten das kalte Grün der Gräser, das Rötlichgelb der blühenden Büsche, das Laub mancher Bäume, sogar der Himmel. Vielleicht war es das Werk des Winds, ja, ganz sicher war es der Wind, der das Durcheinander und das feindliche Gemurmel erzeugte, mit denen uns die Weiden und Pappeln rings um das Häuschen empfingen, das sich grau und verschlossen zwischen ihnen duckte und mir ungastlich und finster erschien.
Nachdem mein Mann die Koffer vor der Türe abgestellt hatte, ging er, um die Schlüssel zu holen und nachzusehen, was denn mit Marisa geschehen war, die nur wenige Schritte entfernt wohnte, das zumindest wiederholte er in einem fort. Ich konnte ihr Haus jedoch nicht sehen und begann, sie für eine Ausgeburt seiner Fantasie zu halten. Alles, alles erschien mir dem Reich der Fantasie anzugehören: meine Anwesenheit an jenem Ort, ich auf den Koffern hockend wie eine Emigrantin auf der ersten Etappe ihrer tristen Reise ins Ungewisse, ja selbst die Angst und die Aufregung, die mir mehr zusetzten als der Wind den Bäumen ringsum. Und die Bäume, von einem ungewöhnlichen Grün, blass das der Weiden, düster das der Pappeln, das im Zusammenfließen bläuliche Töne vor dem Meeresblau des Himmels annahm, vermittelten den Eindruck von etwas Irrealem, wie Reflexe auf dem Wasser oder den Scheiben eines Fensters.
Minuten verstreichen, noch immer ist mein Ehemann nicht zurück. Du wirst sehen, am Ende taucht er gar nicht mehr auf. Mittlerweile scheint mir alles möglich, in diesem außerordentlichen Abenteuer, das meine Hochzeit gewesen ist: Ein Abenteuer, das mich meinem Land, meinem Haus entwurzelt hat und mich jetzt in der Welt umherziehen lässt.
Überdies verspürte ich Hunger und obwohl ich einen Proviantkorb in Reichweite hatte, glaubte ich, nie mehr wieder etwas zu mir nehmen zu können. Und da sich ein kindlicher Schmerz mit einem Rest romantischer Selbstgefälligkeit vermengte, die meine Situation in mir wachrief, begann ich schließlich, mit dem schwachen Kreischen eines verlorenen Vögeleins zu weinen. Und das ging ein in das große Lamento der Dinge ringsum.
Doch nein, ich bin nicht mehr allein und verlassen auf der Welt. Ein Klagen, durchdringender als das der Bäume, ja selbst des Meeres, antwortet auf meines. Es ist keine menschliche Stimme, und dennoch tut es den Willen eines Menschen kund, spricht von seiner Traurigkeit und Verzweiflung, der meinen so ähnlich. Es ist das Weinen einer Seele, die an einen unbekannten, einsamen Ort gelangt ist, ahnungslos, welches Schicksal die hereinbrechende Nacht für sie bereithält und ob die Morgendämmerung für sie erneut die Knospe der Hoffnung aufblühen lässt. Eine Seele, die nicht um Hilfe bittet, sondern vor sich selbst klagt.
Es war der Klang einer Geige.
Wer da musizierte, machte einfache Tonübungen, einem schöpferischen Motiv auf der Spur, das seinen Empfindungen Form geben könnte; doch allein durch die Vibrationen traten diese hervor, so wie das Wasser aus Gesteinsritzen rinnt, und intonierten sich auf wundersame Weise mit denen, die mein Weinen zum Ausdruck brachte.
Nicht nur das. Mir war, als gehörten die Töne gänzlich dem Reich der Fantasie an oder brächen aus einem dunklen Winkel meines Seins, dem Unterbewusstsein, hervor.
Und ja, dass der ganze Rest, meine Verlobungszeit, meine Hochzeit, der Aufenthalt an diesem Ort und in dieser Situation, all das tatsächlich ein Traum zwischen Tragischem und Lächerlichem wäre. Die Wirklichkeit war eine andere. Ich befand mich noch immer in meines Vaters Haus, an der Grenze zwischen dem Tal und einem Städtchen, das, obwohl Provinzhauptstadt, alle Aspekte, die Farben, das Klima, einer Siedlung aus der Eisenzeit bewahrte.
Unser Haus, eng, quadratisch, schlichtgebaut wie ein Turm, mit einem Treppenabsatz und nur zwei Zimmern auf jedem Stockwerk, war eines der höchsten, und seit meiner Kindheit hatte ich mir im letzten Stock, auf dem Speicher, beschirmt nur vom Dach, das auf schwerem Gebälk ruhte, und von einem dichten Schilfrohrgeflecht, meine ureigene Bleibe eingerichtet.
Von den Balken hingen Weintrauben und andere Früchte, Büschel von Zwiebeln und trocknenden Tomaten; auch Knoblauchzöpfe, die aussahen wie wächserne Votivgaben und marmorierte Salami; angesichts dieser Dinge konnte man den Raum nicht wirklich einen Speicher nennen, die Wände waren weißgekalkt, der Boden war aus Holzdielen; es gab noch zwei schöne Fenster, neben dem einen stand sogar ein gut bestücktes Bücherregal, nahe dem anderen ein antikes Schreibpult, das aussah wie ein maurisches Möbel, ganz aus Ebenholz und mit Elfenbeinintarsien verziert.
Vom Fenster neben dem Regal aus hatte man einen Panoramablick auf das Städtchen, ein Schachbrett aus roten und grünlichen Dächern, höher und tiefer gelegenen, über die drei schmale, weiße, in allem gleiche Glockentürme aufragten, während sich in der Ferne, fast am Horizont, dunkel und massiv die Türme der Kathedrale erhoben.
Dunkel und feucht waren im Winter auch die Farben des Städtchens, im Sommer hingegen rötlich, wie verbrannt, und im Frühling wie auch nach den ersten Herbstregen erinnerten die alten, moosbewachsenen Dächer an etwas Prähistorisches, eben ein Dorf aus Felsgestein, auf dem wieder das Grün einer zarten und unberührten Gebirgsvegetation hervorbrach.
Auch die schmale und steinige Straße, die ich aus dem Fenster gelehnt sah, glich eher einem Gebirgspfad, und Berge, nichts als Berge zeigten sich im Ausschnitt des anderen Fensters, grün, azurblau, weiß, grau und violett, je nach Entfernung. Der ganze Horizont war davon eingefasst und blieb doch weit und luftig, als wären da Wolken und keine Berge. Die nächstgelegenen, die aus dem Tal emporragten, das ich nicht sah, da ein Damm aus Nutz- und Ziergärten mich von ihm trennte, waren zum Teil mit Wald bedeckt und grün mit breiten silbrigen Granitflecken und goldfarbenen Stellen, wo Farnbüschel und Affodillen wuchsen.
Die Felsen im Schatten der höchsten Bergspitzen, die aussahen wie Monolithen, dichtbedeckt von einer samtenen Rinde aus Moos, färbten sich im Frühling rot dank purpurfarbener kleiner Blumen, und bis zum Sommer herrschte dort ein Fest der Farben. Die Berghänge wurden weiß von den erblühten Affodillen, das Königskerzensilber streifte das frische Grün des Farns, der Steineichenwald war durch und durch golden.
Der Herbst verdarb das Fest. Die Farben verblassten, zerflossen, dunkelten, bis dann im Winter alles schwarz wurde, Wolken und Felsen vermengten sich in einem fast bedrohlichen Durcheinander. Das Tag um Tag anschwellende Rauschen des Wildbachs erzählte die Geschichte eines Schmerzes, die sich im Tal verlor.
Das Tal, wie gesagt, sah ich nicht, spürte es jedoch zu allen Jahreszeiten aufgrund des tragischen Klagelieds des Flusses und der Windstöße, die in manchen Winternächten von dort wie aus den Tiefen eines Vulkans aufstiegen und mir fast körperliche Wonne bereiteten, schienen sie doch wie der Schrei der von den Elementen gequälten Erde, ein Echo meiner Jugendzeit gar mit ihrem Wirbel aus Träumen und ungestilltem Verlangen. Träume und Verlangen, die sich im Frühjahr in den Kuckucksrufen wiederholten, immer klarer, je mehr der Gesang des Wildbachs verstummte, und die dann einnickten, sobald der glühende und duftende Atem des Sommers vom Tal heraufdrang.
Unten im Tal besaß meine Familie ein kleines Stück Land, das von einem alten Bauern bestellt und bewacht wurde. Er lebte eremitisch, und sein Äußeres war tatsächlich wie das eines echten Eremiten. Nur von Zeit zu Zeit stieg er hinauf und kam zu uns ins Haus, mit einem Weidenkorb, dessen Inhalt wie ein Schatz unter Akanthusblättern verborgen lag; hob man sie hoch, zeigten sich die ersten Früchte in ihren Edelsteinfarben; im Winter waren es Oliven, und gab es nichts anderes, lagen die schwarzglänzenden Beeren des Myrtenstrauchs und die blutenden Früchte des Walderdbeerenstrauchs darin. Der Alte verkörperte ein mit der Natur verwachsenes Wesen, den Mythos der Erde, die all ihre Gaben, auch die wildwüchsigen, feilbietet – demjenigen, der ihren Wert zu schätzen weiß.
Und ich wertschätzte sie mehr als wegen ihres Geschmacks für das, was sie symbolisierten: die Tage und die Nächte, das Klima, die Gefahren, die gesamte Poesie, alles, was sie hatte reifen lassen. Noch immer verharrt tief unten in meiner Erinnerung die geradwüchsige, granitische Gestalt des Alten, gleich einem jener Steinmonumente mit vagen menschlichen Formen, wie sie prähistorische Völker in ihrer felsigen Einsamkeit als bedeutungstragende Idole errichteten.
Doch ich war kein Leckermaul, naschte auch nicht von den Früchten, die von den Balken des hohen Raums hingen. Ich war keine Nascherin, und nebst dem strengen Gewissen, das keine unerlaubten Handlungen zuließ, hatte ich auch die Manie der Entsagungen.
Trotzdem gab ich mich dem hin, was in den Augen meiner Mama die größte Sünde darstellte, nämlich der fortwährenden und gierigen Lektüre von Büchern, die nicht meinem Alter, vor allem nicht meiner Erziehung entsprachen. Natürlich las ich im Verborgenen, Tag und Nacht. In dem Raum, wo die Mäuse am Papier nagten und die Schwalben ihre ersten Flugübungen machten, öffnete sich allmählich auch meine Seele, Stunde um Stunde, Seite um Seite, wie die hundertblättrige Rose, die, ist sie erblüht, vollständig geöffnet erscheint, jedoch bis zum Schluss in ihrer Mitte ein geschlossenes Blütenblatt bewahrt.
Das prächtige Schreibpult und das alte Nussholzregal hatten meine Familie von einem Verwandten geerbt, einem Bischof, einem gebildeten Mann mit emsig forschendem Geist, der bei seinem Tod im Geruch der Heiligkeit stand.