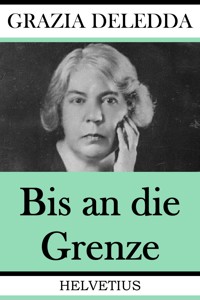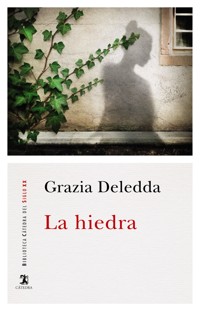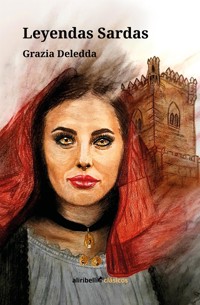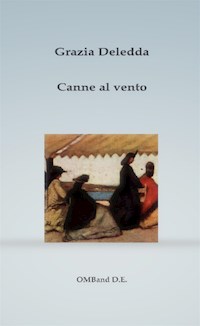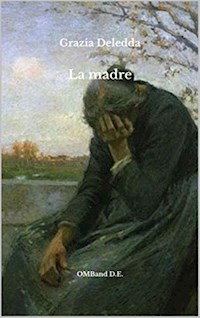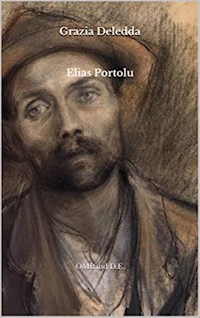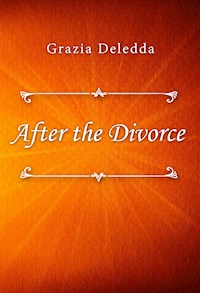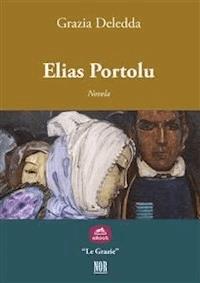14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 18,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Manesse Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Manesse Bibliothek
- Sprache: Deutsch
Ein poetisches Meisterwerk der italienischen Moderne
In der Kunst, mit wenigen Worten Stimmungen zu zaubern, ist Grazia Deledda bis heute unerreicht. Auf der abgeschiedenen Insel der Granatapfelbäume und der wilden Kaktusfeigen siedelt die Erzählerin ihr archaisch anmutendes Drama um Schuld und Sühne an. Wie Schilf im Wind finden sich die Insel-Menschen vom Schicksal erfasst, geknickt, zu Boden gedrückt und zuweilen wieder aufgerichtet. Was an Deleddas Prosa jedoch am meisten bezaubert, sind die poetischen Natur- und Landschaftsbeschreibungen ihrer Heimat Sardinien: an den Ufern der türkisen Flüsse gelbliche Binsen, von Silberfäden umsponnen, Mandel- und Pfirsichhaine vor stahlblauem Himmel, meergrünes Schilf und Palmengestrüpp, inmitten hügeliger Flure da und dort weiße Dörfer mit Glockentürmen, zerfallenes Gartengemäuer, abbröckelnde Hauswände, Überbleibsel von Höfen, dazwischen heilgebliebene Katen, und hoch darüber thronend eine schwarze Schlossruine ...
Für die Jubiläumsausgabe anlässlich des 150. Geburtstags Deleddas am 27.9.2021 wird die Manesse-Übersetzung aus dem Jahre 1954 gründlich überarbeitet und kommentiert.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
In der Kunst, mit wenigen Worten Stimmungen zu zaubern, ist die Nobelpreisträgerin Grazia Deledda unerreicht. Ihre Landschaftsbilder Sardiniens sind von herber Sinnlichkeit und entführen ins Reich der Mandel- und Pfirsichhaine und grünblauen Schilfsäume.
Sardinien im frühen 20. Jahrhundert: das Land karg, das Leben hart, die Seelen verschlossen. Auf dem Landgut der Pintors liegt der Schatten der Vergangenheit. Einst hat das Unglück Einzug in ihr Haus gehalten. Wenn sich doch noch alles zum Guten wenden sollte, so nur dank Efix, dienstbarer Geist von Donna Noemi, Donna Ester und Donna Ruth. «Wir sind das Schilf, und das Schicksal ist der Wind», so sein Credo. In Demut standzuhalten, sich nicht brechen zu lassen, das ist das Edelste, was der Mensch vermag. Auf ihrer Heimatinsel inszeniert Grazia Deledda ihr archaisch anmutendes Drama um Schuld und Sühne. Sie schildert ein scheinbar zeitenthobenes Sardinien, geprägt von tief verwurzelten archaischen Traditionen und einem Synkretismus aus heidnischem Aberglauben und christlicher Volksfrömmigkeit. Doch gleichsam «sottovoce» klingen schon gesellschaftliche und kulturelle Umbrüche an.
Ein Meisterwerk der italienischen Literatur in kommentierter Neuausgabe.
Grazia Deledda
SCHILF IM WIND
Roman
Aus dem Italienischen übersetzt von Bruno Goetz
Neuedition
Anhand der Originalausgabe von 1913 überarbeitet und mit Anmerkungen versehen von Jochen Reichel
Nachwort von Federico Hindermann
MANESSE VERLAG
I.
Den ganzen Tag über hatte Efix1, der Knecht der Damen Pintor, an der Verstärkung des einfachen Damms gearbeitet, den er im Lauf der Jahre nach und nach und mit großer Mühe längs des Flusses in der Talsenke2 des kleinen Landguts eigenhändig errichtet hatte. Und bei Anbruch des Abends saß er vor seiner Hütte unterhalb des grünblauen Schilfsaums, auf halber Höhe des weißen Taubenhügels3, und übersah sein Werk von oben.
Dort zu seinen Füßen liegt still das kleine Anwesen, auf dem nur hie und da das Wasser in der Dämmerung schimmert und das Efix mehr als seinen Besitz als den seiner Herrinnen betrachtet: Dreißig Jahre der Bewirtschaftung und der Arbeit haben es recht eigentlich zu seinem Eigentum gemacht. Und die beiden Hecken aus Feigenkakteen, die es vom Hügel bis zum Fluss wie zwei graue, sich über die Terrassenfelder hinabwindende Steinmauern umfrieden, erscheinen ihm wie die Grenzen der Welt.
Auch weil das Land jenseits der Hecken vor langer Zeit einmal seinen Herrinnen gehört hatte, schaute der Knecht nicht über die Grenzen des Gutes hinaus. Wozu die Vergangenheit heraufbeschwören? Nutzloses Bedauern. Besser war es, an die Zukunft zu denken und auf die Hilfe Gottes zu vertrauen.
Und Gott verhieß ein gutes Jahr. Immerhin hatte er dafür gesorgt, dass alle Mandel- und Pfirsichbäume im Tal von Blüten übersät waren. Und das Tal selbst zwischen den beiden weißen Hügelketten – aus der Ferne schimmerten blau die Berge im Westen und das Meer im Osten herüber – erinnerte mit seinen Frühlingswiesen, seinen Rinnsalen, seinen Blumen und Sträuchern und dem eintönigen Gemurmel des Flusses an die mit grünen, wehenden Schleiern und hellblauen Bändern geschmückte Wiege eines einschlummernden Kindes.
Doch die Tage waren schon zu heiß, und Efix dachte auch an die jähen Wolkenbrüche, die den ungebändigten Fluss anschwellen, gleich einem Ungeheuer über die Ufer steigen und alles zerstören ließen. Man durfte hoffen, doch nicht allzu sehr vertrauen; man musste wachsam sein, wie das Schilfrohr auf dem Hang dort, dessen Spitzen bei jedem Windhauch aneinanderschlugen, als wollten sie einander vor der Gefahr warnen.
Aus diesem Grund hatte er den ganzen Tag gearbeitet und betete jetzt, in Erwartung der Nacht, zu Gott um den Bestand seiner Arbeit, während er, um keine Zeit zu verlieren, damit beschäftigt war, eine Binsenmatte zu flechten. Was bedeutete schon ein kleiner Damm, wenn Gottes Wille ihn nicht gewaltig wie einen Berg werden ließ?
Sieben Binsenstreifen durch eine Weidengerte also und sieben Gebete zum Herrn und zu unserer Lieben Frau, der Madonna del Rimedio4, gesegnet sei sie; dort unten lagen jetzt im letzten blassen Blau der Abenddämmerung die kleine Kirche und das Geviert der Hütten wie ein vorzeitliches, seit Jahrhunderten verlassenes Dorf. Zu dieser Stunde, während der Mond wie eine große Rose zwischen den Sträuchern auf dem Hügel erblühte und die Wolfsmilch am Flussufer ihren Duft verströmte, beteten auch seine Herrinnen. Donna Ester, die älteste, gesegnet sei sie, dachte dabei gewiss auch an ihn, den Sünder. Das war ihm schon genug: Er fühlte sich zufrieden und für seine Mühsal entlohnt.
Ferne Schritte ließen ihn aufschauen. Er glaubte sie wiederzuerkennen; es war der rasche und leichte Gang eines Kinds, der Schritt jenes Engels, der alles Freudige und alles Traurige verkündet. Gottes Wille geschehe! Er ist es, der uns die guten und die schlechten Botschaften sendet. Doch sein Herz begann zu zittern, und auch seine schwarzen, rissigen Finger zitterten und die silbrigen Binsen, die im Mondlicht wie feine Wasserstrahlen glitzerten.
Jetzt waren die Schritte nicht mehr zu hören. Aber Efix verharrte noch immer regungslos und wartete.
Vor ihm stieg der Mond immer höher, und die Stimmen des Abends sagten dem Menschen, dass sein Tag zur Neige ging. Da war der gleichförmige Ruf eines Kuckucks, das Zirpen der ersten vorwitzigen Grillen, das Klagen eines Vogels; da war das Seufzen des Schilfes und die immer reiner tönende Stimme des Flusses; da war, vor allem, ein Hauch, ein geheimnisvoller Atem, der aus dem Herzen der Erde selbst zu kommen schien. Gewiss, der Tag des arbeitenden Menschen ging zur Neige; aber es begann das fantastische Leben der Kobolde, der Feen und der rastlosen Gespenster. Die Geister der einstigen Barone kamen von den Ruinen des alten Bergschlosses über dem Dorf Galte5 herab, dort oben am Horizont, zur Linken von Efix, und durchquerten die Gestade des Flusses auf der Jagd nach Ebern und Wölfen; ihre Waffen blitzten durch die niedrigen Erlenbüsche am Ufer, und das ferne heisere Bellen von Hunden verriet, wo sie vorbeikamen. Efix hörte das Geräusch, das die Panas6 (bei der Niederkunft verstorbene Frauen) machten, wenn sie unten im Fluss ihre Kleider wuschen und mit den Knochen der Toten ausschlugen; er glaubte zu sehen, wie der Ammattadore7, ein Kobold mit sieben Hüten, unter denen er einen Schatz verbarg, zwischen den Mandelbäumen hin und her sprang, gefolgt von Vampiren mit erzenen Schwänzen8.
Wo er sich seinen Weg bahnte, funkelten Zweige und Steine im Mondlicht auf. Zu den bösen Geistern gesellten sich die Geister der ungetauften Kinder, weiße Gespenster, die durch die Luft flogen und sich in silberne Wölkchen hinter dem Mond verwandelten. Die Zwerge und die Janas9, kleine Feen, die tagsüber in ihren Felshäusern an goldenen Webstühlen goldene Stoffe wirkten, tanzten im Schatten der weitläufigen Macchia aus Steinlinden, während die Riesen mit ihren gewaltigen grünen Rossen10, die nur sie allein zu besteigen verstehen, zwischen den Bergzacken im Schein des Monds auftauchten. Die Zügel in den Händen, hielten sie Ausschau, ob sich dort unten in den Niederungen voll verderblicher Wolfsmilch nicht ein Drache versteckte oder die sagenumwobene kanaanäische Schlange11, die seit Christi Zeiten über die sandigen Ränder des Sumpflands schlich.
Besonders in Mondnächten erweckt dieses geheimnisvolle Volk die Hügel und Täler zum Leben; der Mensch hat nicht das Recht, es durch seine Gegenwart aufzustören, wie ja auch die Geister ihn achten, während die Sonne ihren Lauf nimmt. Es ist also an der Zeit, sich zurückzuziehen und die Augen unter der Obhut der Schutzengel zu schließen.
Efix bekreuzigte sich und stand auf, wartete aber noch eine Weile, ob nicht doch noch jemand daherkäme. Dann schob er das Brett vor, das ihm als Türe diente, und lehnte ein großes Kreuz aus Schilfrohr dagegen, damit den Kobolden und den Versuchungen der Zutritt in die Hütte verwehrt bliebe.
Der Mondschein fiel durch die Ritzen in den schmalen, zu den Ecken hin abfallenden Raum. Für ihn indessen, der klein und hager wie ein Jüngling war, bot er ausreichend Platz. Vom kegelförmigen Dach aus Schilfrohr und Binsen, das auf grob gefügten Steinwänden ruhte und in dessen Mitte sich ein Loch für den Abzug des Rauches befand, hingen Zöpfe von Zwiebeln und Sträuße getrockneter Kräutern herab, Kreuze aus Palmzweigen und geweihte Olivenzweige, eine bemalte Wachskerze, eine Sichel gegen die Vampire und ein Säckchen voll Gerste gegen die Panas. Bei jedem Windhauch geriet alles in Bewegung, und die Spinnweben glitzerten im Mondlicht. Unten auf dem Boden ruhte die Kanne, die Henkel in die Seiten gestützt, und ihr zur Seite schlief ein umgedrehter Kochtopf.
Efix breitete seine Schilfmatte aus, legte sich aber noch nicht hin. Er meinte immer noch Kinderschritte zu hören. Irgendjemand würde bestimmt noch kommen, und tatsächlich begannen die Hunde auf den Nachbargehöften plötzlich zu bellen. Und über das ganze Land, das noch wenige Augenblicke zuvor unter dem Gebetsmurmeln der nächtlichen Stimmen eingeschlafen zu sein schien, ging ein Zittern und Klingen, als sei es jäh erwacht.
Efix machte die Tür wieder auf. Eine schwarze Gestalt stieg den Abhang hinauf, dort, wo die Ackerbohnen sich silbern im Mondlicht kräuselten; und er, dem in der Nacht selbst alle menschlichen Wesen unheimlich vorkamen, bekreuzigte sich erneut. Doch eine ihm bekannte Stimme rief ihn an: Es war die lebhafte, aber ein wenig atemlose Stimme eines jungen Burschen, der in unmittelbarer Nachbarschaft der Damen Pintor wohnte.
«Onkel Efisè12! Onkel Efisè!»
«Was ist geschehen, Zuannantò? Geht’s meinen Damen gut?»
«Ja, es geht ihnen gut, glaube ich. Sie haben mich nur hierhergeschickt, um Euch zu sagen, dass Ihr morgen in aller Frühe ins Dorf kommen sollt, weil sie mit Euch sprechen müssen. Vielleicht wegen eines gelben Briefs, den ich in der Hand von Donna Noemi gesehen habe. Sie las ihn vor, und Donna Ruth, die gerade dabei war, den Hof zu fegen, und mit dem weißen Tüchlein auf dem Kopf ausschaute wie eine Nonne, blieb stehen, stützte sich auf den Besenstiel und hörte ihr zu.»
«Ein Brief? Du weißt nicht, von wem?»
«Nein, ich nicht. Ich kann doch nicht lesen. Aber meine Großmutter sagt, er ist vielleicht von Don Giacinto, dem Neffen Eurer Herrinnen.»
Ja, Efix spürte es; so musste es sein; dennoch kratzte er sich nachdenklich an der Wange und senkte den Kopf, während er zugleich hoffte und fürchtete, dass er sich irrte.
Der Junge hatte sich inzwischen müde auf den Stein vor der Hütte gesetzt, schnürte seine schweren Schuhe auf und fragte, ob es nicht etwas zu essen gäbe. «Ich bin gerannt wie ein junger Hirsch. Ich hatte vor den Kobolden Angst …»
Efix hob sein olivfarbenes Gesicht, das hart wie eine Bronzemaske aussah, und richtete seine kleinen bläulichen Augen, die eingefallen und von Falten umringt waren, fest auf den Knaben; und diese lebhaften, leuchtenden Augen zeigten einen Ausdruck kindlicher Angst.
«Haben sie dir gesagt, ob ich morgen oder heute Nacht kommen soll?»
«Morgen, ich hab’s Euch doch gesagt. Während Ihr im Dorf seid, bleibe ich hier und passe auf das Gut auf.»
Der Knecht war es gewohnt, seinen Herrinnen zu gehorchen, und stellte keine Fragen mehr. Er löste eine Zwiebel aus dem Zopf, holte ein Stück Brot aus dem Beutel, und während der Junge lachend aß und wegen der beißenden Schärfe der Beilage zugleich weinen musste, setzten sie ihr Schwätzchen fort. Die wichtigsten Persönlichkeiten des Dorfes kamen in ihrem Gespräch vor. Zunächst war da der Pfarrer, dann die Schwester des Pfarrers, dann der Milese13, der eine ihrer Töchter geheiratet hatte und vom fliegenden Händler für Orangen und Tonwaren zum reichsten Kaufmann des Dorfs geworden war. Dann folgte Don Predu, der Bürgermeister, ein Vetter von Efix’ Herrinnen. Don Predu war ebenfalls reich, doch nicht so reich wie der Milese. Und schließlich kam noch die Wucherin Kallina; auch sie war reich geworden, doch auf eine etwas undurchsichtige Weise.
«Diebe haben versucht, bei ihr einzubrechen. Vergeblich; ihre Mauern sind verzaubert. Und am Morgen hat sie lachend in ihrem Hof gestanden und gesagt: ‹Selbst wenn sie eingedrungen wären, so hätten sie nur Asche und alte Nägel gefunden; ich bin arm, arm wie Christus.› Aber meine Großmutter hat gesagt, dass Tante Kallina ein Säckchen voller Goldstücke in der Wand versteckt hat.»
Doch Efix gab auf diese Geschichten im Grunde genommen nicht viel. Ausgestreckt auf seiner Schilfmatte, die eine Hand unter der Achsel, die andere unter der Wange, fühlte er sein Herz pochen, und das Rascheln des Schilfrohrs oben auf dem Hang erschien ihm wie das Seufzen eines bösen Geistes.
Der gelbe Brief! Gelb war eine schlimme Farbe. Wer weiß, was seinen Herrinnen noch alles zustoßen mochte! Wann immer in den vergangenen zwanzig Jahren bis zu diesem Tag ein Ereignis das eintönige Leben des Hauses Pintor unterbrochen hatte, war es stets ein Unglück gewesen.
Auch der Junge hatte sich hingelegt, hatte aber keine Lust zu schlafen. «Onkel Efix, heute hat meine Großmutter mir noch erzählt, dass Eure Herrinnen einmal reich wie Don Predu gewesen sind. Ist das wahr oder ist das nicht wahr?»
«Es ist wahr», sagte der Knecht mit einem Seufzer. «Aber es ist jetzt nicht die Zeit, an solche Dinge zu denken. Schlaf jetzt!»
Der Knabe gähnte. «Aber meine Großmutter erzählt, dass es nach dem Tod von Donna Maria Christina, Eurer seligen alten Herrin, wie ein böser Bann auf Eurem Hause gelegen habe. Ist das wahr oder ist das nicht wahr?»
«Schlaf jetzt, habe ich dir gesagt! Es ist nicht die Zeit …»
«Ach, lasst mich doch noch sprechen! Warum ist denn Donna Lia, Eure jüngste Herrin, davongelaufen? Meine Großmutter sagt, dass Ihr es wisst, dass Ihr Donna Lia bei der Flucht behilflich wart, dass Ihr sie zur Brücke begleitet habt, unter der sie sich versteckt hielt, bis ein Karren vorüberkam, auf dem sie dann bis ans Meer gelangt ist. Dort hat sie sich eingeschifft. Und Don Zame, ihr Vater, Euer Herr, hat sie gesucht und gesucht, bis er starb. Und gestorben ist er dort, dicht bei der Brücke. Wer hat ihn getötet? Meine Großmutter sagt, dass Ihr es wisst …»
«Deine Großmutter ist eine Hexe! Sie und du, du und sie, lasst doch den Toten ihren Frieden!», schrie Efix; doch seine Stimme klang heiser, und der Junge lachte frech. «Regt Euch nicht auf, das tut Euch nicht gut, Onkel Efix! Meine Großmutter sagt, es sei der Kobold gewesen, der Don Zame getötet hat. Ist das wahr oder ist das nicht wahr?»
Efix antwortete nicht. Er schloss die Augen und legte sich die Hand aufs Ohr, doch die Stimme des Knaben klang weiter durch die Dunkelheit und ihm war, als höre er die Geister der Vergangenheit selbst.
Schon scharen sich alle nach und nach um ihn, dringen wie die Strahlen des Monds durch die Ritzen: da ist Donna Maria Christina, schön und sanft wie eine Heilige, dort Don Zame, rot und ungestüm wie der Teufel; die vier Töchter, in deren blassen Gesichtern sich die heitere Ruhe der Mutter zeigt, in der Tiefe ihrer Augen aber die Flamme des Vaters; und auch die Knechte und Mägde sind da, die Verwandten und Freunde, die ganze Schar, die das reiche Haus bevölkert, das den Nachfahren der Landbarone gehört. Aber dann fegt der Wind des Unheils über alles hinweg, und die Menschen zerstreuen sich wie die Wölkchen um den Mond, sobald die Tramontana14 weht.
Donna Maria Christina ist tot; die blassen Gesichter ihrer Töchter verlieren ein wenig von ihrer Heiterkeit, und jene Flamme auf dem Grund ihrer Augen wird größer; sie wächst in dem Maße, wie Don Zame nach dem Tode seiner Frau immer mehr das anmaßende Gebaren seiner Ahnen, der Barone, an den Tag legt und, wie es bei diesen üblich war, die vier Mädchen, in Erwartung würdiger Ehegatten, im Hause wie Sklavinnen gefangen hält. Und wie Sklavinnen mussten sie arbeiten, Brot backen, weben, nähen, kochen und ihre Sachen in Ordnung halten; vor allem aber durften sie nie den Blick in Gegenwart der Männer heben, noch war es ihnen gestattet, auch nur an einen Mann zu denken, der nicht zu ihrem Bräutigam auserkoren war. Doch die Jahre vergingen, und der Bräutigam kam nicht. Und je älter seine Töchter wurden, umso mehr forderte Don Zame von ihnen unablässige Sittenstrenge. Wehe, wenn er sah, wie sie sich an den Fenstern zeigten, die nach dem Gässchen hinter dem Haus hinausgingen, oder wenn sie ohne seine Erlaubnis das Haus verließen! Er ohrfeigte sie, überschüttete sie mit Schmähungen und drohte den jungen Männern, die zweimal hintereinander durch das Gässchen kamen, mit dem Tode.
Er verbrachte seine Tage derweil damit, in der Gegend umherzuschweifen oder auf der steinernen Bank vor dem Laden zu sitzen, der der Schwester des Pfarrers gehörte. Die Leute gingen ihm aus dem Weg, sobald sie ihn sahen, so sehr fürchteten sie seine böse Zunge. Mit jedem fing er Streit und Händel an und war dermaßen neidisch auf das Hab und Gut der anderen, dass er, wenn er an einem schönen Hof vorüberkam, zu sagen pflegte: «Die Prozesskosten sollen dich verschlingen!» Doch es endete damit, dass die Streitigkeiten seinen eigenen Grund und Boden verschlangen, und schließlich traf ihn ein unerhörtes Unheil mit einem Schlag, wie eine Strafe Gottes für seinen Hochmut und seine Unduldsamkeit.
Donna Lia, seine dritte Tochter, verschwand eines Tages aus dem väterlichen Haus, und lange Zeit hörte man nichts mehr von ihr. Der Schatten des Todes lastete auf dem Haus. Niemals hatte es in der Gegend einen derartigen Skandal gegeben, niemals zuvor war ein adliges und wohlerzogenes Mädchen wie Lia auf eine solche Weise geflohen. Don Zame schien den Verstand zu verlieren. Auf der Suche nach Lia irrte er in der ganzen Gegend umher und durchkämmte die Küste. Doch niemand konnte ihm Auskunft über sie geben. Endlich schrieb sie ihren Schwestern, dass sie sich an einem sicheren Ort befände und glücklich sei, ihre Ketten gesprengt zu haben. Die Schwestern aber verziehen ihr dies nicht und gaben ihr keine Antwort.
Don Zame sprang mit ihnen seither noch tyrannischer um. Er verkaufte, was von seinen Besitzungen übrig geblieben war, schikanierte den Knecht, behelligte alle Welt mit seinen Klagen und reiste immer wieder herum, in der Hoffnung, seine Tochter aufzuspüren und nach Hause zurückzubringen. Der Makel der Schande, der wegen Lias Flucht auf ihm und der ganzen Familie lag, lastete auf ihm wie die Bürde eines Verurteilten. Eines Morgens fand man ihn tot auf der Landstraße, auf der Brücke hinter dem Dorf. Der Schlag musste ihn getroffen haben, denn er wies keinerlei Spuren von Gewalt auf, nur einen kleinen grünen Flecken am Hals unterhalb des Genicks.
Die Leute munkelten, Don Zame habe wahrscheinlich mit irgendjemandem gestritten und sei mit einem Knüppel totgeschlagen worden; doch mit der Zeit verstummte dieses Gerücht, und man nahm als beinahe sicher an, er sei wegen der Flucht seiner Tochter an gebrochenem Herzen gestorben.
Unterdessen schrieb Lia den Schwestern, die durch ihre Flucht entehrt worden waren und daher keine Ehemänner fanden, einen Brief, in dem sie ihre Heirat ankündigte. Der Ehemann war ein Viehhändler, den sie zufällig auf ihrer Flucht getroffen hatte; sie wohnten in Civitavecchia in bescheidenem Wohlstand und würden wohl bald einen Sohn bekommen.
Die Schwestern konnten ihr diesen neuerlichen Fehltritt – die Ehe mit einem Mann aus dem Volk, den sie unter so beschämenden Umständen kennengelernt hatte – nicht verzeihen und gaben ihr keine Antwort.
Kurze Zeit später schrieb Lia erneut und teilte ihnen die Geburt ihres Sohnes Giacinto mit. Sie sandten ein Geschenk an ihren kleinen Neffen, der Mutter aber schrieben sie nicht.
Und die Jahre vergingen. Giacinto wuchs heran und schrieb seinen Tanten jedes Jahr zu Ostern und zu Weihnachten, und die Tanten schickten ihm immer ein Geschenk. Einmal schrieb er, dass er studiere, ein anderes Mal, dass er zur Marine gehen wolle, wieder ein anderes Mal, dass er eine Anstellung gefunden habe; dann benachrichtigte er sie vom Tod seines Vaters, später vom Tod seiner Mutter. Schließlich gab er seinem Wunsch Ausdruck, sie zu besuchen und bei ihnen zu bleiben, falls er auf dem Land eine Arbeit fände: Sein bescheidener Posten beim Zollamt gefiel ihm nicht; es sei eine erbärmliche und mühselige Beschäftigung, die ihn um seine Jugend bringe. Er liebe ein arbeitsames Leben, ja gewiss, aber ein einfaches Leben und an der frischen Luft. Alle redeten ihm zu, sich auf die Insel seiner Mutter zu begeben, um dort sein Glück in ehrlicher Arbeit zu suchen.
Die Tanten begannen sich zu beratschlagen, doch je länger sie diskutierten, desto weniger wurden sie sich einig.
«Arbeiten?», sagte Donna Ruth, die ruhigste von ihnen. Wo doch der Flecken nicht einmal die ernähre, die auf ihm geboren wurden!
Donna Ester dagegen war den Plänen ihres Neffen gewogen, während Donna Noemi, die Jüngste, kalt und spöttisch lächelte. «Vielleicht träumt er davon, hierherzukommen und den großen Herrn zu spielen. Soll er nur kommen! Soll er nur kommen! Er wird zum Angeln an den Fluss gehen …»
«Aber er sagt doch selbst, dass er arbeiten will, liebe Noemi. Also wird er auch arbeiten; er wird Kaufmann werden wie sein Vater.»
«Dann hätte er schon früher damit anfangen sollen. Unsere Vorfahren haben nie mit Vieh gehandelt.»
«Das waren andere Zeiten, Noemi! Im Übrigen sind heutzutage die Kaufleute die wahren Herren. Denk nur mal an den Milese. Der sagt: ‹Heute bin ich der Baron von Galte!›»
Noemi lachte mit einem boshaften Ausdruck in ihren unergründlichen Augen; und dieses Lachen entmutigte Donna Ester mehr als die Argumente der anderen Schwester.
Es war immer die gleiche Geschichte: Der Name «Giacinto» hallte durch das ganze Haus. Und auch wenn die drei Schwestern schwiegen, war er mitten unter ihnen, wie er es seit dem Tag seiner Geburt eigentlich immer gewesen war; und seine unbekannte Gestalt erfüllte das heruntergekommene Haus mit Leben.
Efix erinnerte sich nicht, jemals unmittelbaren Anteil an den Auseinandersetzungen seiner Herrinnen genommen zu haben. Er hatte es vor allem nicht gewagt, weil sie selbst ihn nicht zurate zogen, doch auch, um sein Gewissen nicht zu belasten; aber er wünschte sich, dass der junge Mann kommen sollte.
Er liebte ihn und hatte ihn schon immer geliebt wie ein Familienmitglied.
Nach dem Tod Don Zames war Efix bei den drei Damen geblieben, um ihnen dabei behilflich zu sein, Ordnung in ihre verwickelten Angelegenheiten zu bringen. Die Verwandten kümmerten sich nicht um sie, ja verachteten und mieden sie. Die Schwestern waren lediglich in der Lage, ihre häuslichen Pflichten zu erfüllen, und kannten nicht einmal das kleine Landgut, das letzte Überbleibsel ihres Erbes.
«Ich werde noch ein Jahr in ihren Diensten bleiben», hatte sich Efix gesagt, als ihn das Mitleid angesichts ihrer Verlassenheit überkam. Und er war zwanzig Jahre geblieben.
Die drei Damen lebten von den Einkünften des kleinen Gutes, das von ihm bewirtschaftet wurde. Und in kargen Jahren sagte Donna Ester, wenn der Tag gekommen war, da sie dem Knecht seinen Lohn (dreißig Scudi15 im Jahr und ein Paar Stiefel) auszahlen sollte: «Habe um Christi willen Geduld. Das Deinige sei dir sicher.»
Und er hatte Geduld, und sein Kredit wuchs von Jahr zu Jahr so sehr, dass Donna Ester ihm halb im Ernst, halb im Scherz versprach, ihn zum Erben des Gutes und des Hauses einzusetzen, wenngleich er doch älter als die drei Schwestern war.
Nun war er alt und ausgezehrt. Aber er war immer noch ein Mann, und sein bloßer Schatten gereichte den Schwestern noch zum Schutz.
Nun war er es, der für sie ein glückliches Los erträumte, zumindest, dass Noemi einen Ehemann finden würde! Wenn der gelbe Brief trotz allem nun doch eine gute Nachricht brachte? Wenn er eine Erbschaft in Aussicht stellte? Wenn er am Ende einen Heiratsantrag für Noemi enthielt? Die Damen Pintor hatten immerhin noch reiche Verwandte in Sassari und Nuoro. Warum sollte nicht einer von ihnen Noemi heiraten? Ja sogar Don Predu selbst konnte den gelben Brief geschrieben haben …
Und in den ermüdeten Fantasien des Knechts sehen die Dinge mit einem Schlag ganz anders aus, so als sei die Nacht dem Tag gewichen. Alles ist Licht, alles ist Süße; seine edlen Herrinnen werden wieder jung, sie erheben sich zum Flug wie Adler, denen neue Federn gewachsen sind; das Haus ersteht neu aus den Ruinen, und alles ringsum blüht wieder auf wie das Tal im Frühjahr.
Und ihm, dem armen Knecht, bleibt nur, sich für den Rest seines Lebens auf das kleine Gut zurückzuziehen, seine Schilfmatte auszubreiten und sich mit Gott zur Ruhe zu legen, während das Schilf in der Stille der Nacht das Gebet der einschlummernden Erde vor sich hin flüstert.
II.
Bei Anbruch des Tages machte Efix sich auf den Weg und überließ dem Jungen die Aufsicht über das Anwesen.
Die Straße bis zum Dorf führte bergan, und er schritt nur langsam aus, denn im vergangenen Jahr hatte er die Malaria16 gehabt, und seine Beine waren immer noch sehr schwach. Von Zeit zu Zeit blieb er stehen, drehte sich um und schaute zurück auf das Anwesen, das sich leuchtend grün zwischen den beiden Hecken aus Feigenkakteen hinzog. Und die Hütte dort oben, die schwarz zwischen dem meergrünen Schilf und dem weißen Felsgestein lag, erschien ihm wie ein Nest, wie ein wahrhaftiges Nest. Jedes Mal wenn er von dort wegging, betrachtete er es so: zärtlich und schwermütig, wie ein Vogel, der die Heimat verlässt. Er fühlte, dass er den besseren Teil seines Ichs – jene Kraft, die einem die Einsamkeit, die Abgeschiedenheit von der Welt verleiht – dort zurückließ. Und während er die Straße hinaufstieg, die durch die Heide, das Binsendickicht und das niedrige Erlengebüsch längs des Flussufers führte, war ihm zumute, als sei er ein Pilger, der mit den kleinen wollenen Satteltaschen17 auf dem Rücken und einem Holunderstecken in der Hand einem Ort der Buße zustrebte – der Welt.
Doch Gottes Wille geschehe, und weiter schreiten wir voran. Da öffnet sich mit einem Mal das Tal, und hoch oben auf der Kuppe eines Hügels taucht wie ein gewaltiger Trümmerhaufen die Burgruine18 auf. Aus dem schwarzen Mauerwerk blickt eine leere blaue Fensterhöhle wie das Auge der Vergangenheit selbst auf die melancholische, von der aufgehenden Sonne in rosiges Licht getauchte Landschaft hinaus, auf die geschwungene Ebene mit den grauen Sandtupfern und den blassgelben Binsenflecken, auf die grünliche Ader des Flusslaufs, die weißen Dörfer, aus deren Mitte die Glockentürme emporragen wie die Blütenstempel aus den Blumen, auf die Hügel oberhalb der kleinen Ortschaften und auf die malven- und goldfarbene Wolke der Nuoreser Berge im Hintergrund.
Klein und schwarz geht Efix in all dieser leuchtenden Herrlichkeit seines Weges. Die schräg stehende Sonne lässt die ganze Ebene funkeln. In jeder Binse leuchtet ein silberner Streif, aus jedem Wolfsmilchstrauch steigt der Ruf eines Vogels auf. Und da erhebt sich der grünweiße Kegel des Monte di Galte19, durchfurcht von Schattenfetzen und Sonnenstreifen, und zu seinen Füßen liegt das Dorf, das lediglich aus den Überresten einer antiken römischen Stadt zu bestehen scheint.
Lange, halb verfallene Trockenmauern, armselige Hütten ohne Dächer, zerbröckelnde Hauswände, Überreste von Innenhöfen und Einfriedungen, stehen gebliebene Katen, noch melancholischer als jene in Trümmern, flankieren die abschüssigen Straßen, die zur Mitte hin mit großen Bruchsteinen gepflastert sind. Überall verstreut, bald hier, bald dort liegt Vulkangestein und erweckt den Eindruck, dass eine Naturkatastrophe die antike Stadt vernichtet und ihre Einwohner in alle Richtungen zerstreut hat. Das eine oder andere neue Haus erhebt sich zaghaft aus all dieser Ödnis, und Granatapfel- und Johannisbrotbäume, Feigenkakteen und Palmen verleihen der Trostlosigkeit des Ortes einen Anflug von Poesie.
Doch je weiter Efix hinaufstieg, desto größer wurde die Trostlosigkeit, und gleichsam als Krönung lagen etwas außerhalb im Schatten des Bergs, zwischen Brombeer- und Wolfsmilchhecken, die Reste eines alten Friedhofs und die Ruine der pisanischen Basilika20. Die Straßen waren verlassen, und die Felsen oben auf dem Berg sahen jetzt aus wie marmorne Türme.
Efix machte vor einem Tor halt, das neben dem Eingang zum alten Friedhof lag. Sie sahen fast gleich aus, die beiden Portale, zu deren Füßen jeweils drei geborstene, von Gras überwucherte Stufen lagen. Doch während über die Friedhofspforte gerade mal ein morsches Brett gelegt war, mündete das Portal zum Haus der drei Damen in einem gemauerten Bogen, auf dessen Architrav die Bruchstücke eines alten Wappens zu erkennen waren: ein Ritterkopf mit Helm und ein Arm mit einem erhobenen Schwert; der Wahlspruch lautete: «Quis resistit hujas?»21
Efix durchquerte den weitläufigen quadratischen Hof, der wie die Straßen in der Mitte mit einer Rinne aus Bruchsteinen gepflastert war, damit das Regenwasser ablaufen konnte, nahm die Tasche von den Schultern und schaute, ob sich nicht eine seiner Herrinnen blicken ließ. Das Haus, das neben dem Erdgeschoss noch über ein weiteres Stockwerk verfügte, erhob sich am Ende des Hofs und wurde unvermittelt vom Monte Galte überragt, der wie eine riesige weißgrüne Haube auf ihm zu ruhen schien.
Drei kleine Türen öffneten sich unter einer hölzernen Loggia, die sich über die gesamte Breite des oberen Stockwerks erstreckte und zu der man über eine marode Außentreppe hinaufstieg. Ein schwärzliches Seil, das man an den Enden der Stufen an Pflöcke geknotet hatte, ersetzte das verschwundene Geländer. Die Türen, die Stützbalken und die Balustrade aus Holz waren fein geschnitzt; doch alles verfiel, und das morsche Holz, mittlerweile ganz schwarz geworden, schien bei der kleinsten Berührung zu Staub zu zerfallen, so als habe ein unsichtbarer Bohrer darin gewütet.
An einigen Stellen der Balkonbrüstung, über den noch heilen, schlanken Säulchen, konnte man allerdings die Reste eines Gesimses mit geschnitzten Verzierungen von Blättern, Blumen und Früchten erkennen. Und Efix erinnerte sich daran, dass ihm dieser Balkon schon als Kind einen religiösen Respekt eingeflößt hatte, so wie die Kanzel in der Basilika und die Balustrade, die den Altar umschloss.
Eine kleine, stämmige, Frau, ganz in Schwarz gekleidet und mit einem weißen Tüchlein um das harte, schwärzliche Gesicht, erschien auf dem Balkon. Sie beugte sich herab, sah den Knecht, und ihre dunklen Mandelaugen blitzten vor Freude. «Donna Ruth! Guten Morgen, meine Herrin!»
Donna Ruth kam leichtfüßig die Treppe herab und ließ dabei ihre kräftigen Beine sehen, die in dunkelblauen Strümpfen steckten. Sie lächelte ihn an, und ihre gesunden Zähne kamen unter dem dunklen Flaum ihrer Oberlippe zum Vorschein.
«Und Donna Ester? Und Donna Noemi?»
«Ester ist zur Messe gegangen. Und Noemi steht gerade auf. Schönes Wetter, Efix! Wie geht es bei dir da unten?»
«Gut, gut! Gott sei Dank ist alles gut.»
Auch die Küche war mittelalterlich: geräumig, niedrig, mit einer rußgeschwärzten Kreuzbalkendecke; eine hölzerne Bank lief auf beiden Seiten des großen Kamins an der Wand entlang. Durch das Fenstergitter schimmerte grünlich der Berg im Hintergrund. An den nackten rötlichen Wänden waren noch die Spuren der verschwundenen Kupfertöpfe zu erkennen. Und die glänzenden und polierten Haken, an denen man einst die Sattel, Taschen und Waffen aufgehängt hatte, waren wie zur Erinnerung zurückgeblieben.
«Nun, Donna Ruth? …», fragte Efix, während die Herrin eine kleine kupferne Kaffeekanne auf das Feuer stellte. Doch sie wandte ihm nur ihr großes dunkles, in Weiß gefasstes Gesicht zu und gab ihm mit einem Augenzwinkern zu verstehen, dass er sich gedulden solle.
«Hol mir noch etwas Wasser, bis Noemi herunterkommt …»
Efix zog den Eimer unter der Bank hervor; er war gerade im Begriff hinauszugehen, als er sich in der Tür schüchtern umwandte und auf den schwankenden Eimer schaute. «Ist der Brief von Giacinto?»
«Der Brief? Es ist ein Telegramm …»
«O Jesus! Es ist ihm doch nichts zugestoßen?»
«Nein, nein! Geh nur …»
Es war nutzlos, weitere Frage zu stellen, bevor Donna Noemi nicht heruntergekommen war. Obgleich Donna Ruth die älteste der drei Schwestern war und die Schlüssel des Hauses hütete (es gab allerdings nichts mehr, was man hätte verwahren können), ergriff sie niemals die Initiative und übernahm keine Verantwortung.
Er ging zum Brunnen, der in einer Ecke des Hofes lag und der mit seiner Einfassung aus Bruchsteinen aussah wie eine Nuraghe22. Auf seinem Rand wuchsen in alten, angeschlagenen Tonkrügen Levkojen und Jasmin. Eine Jasminranke war an der Mauer emporgeklettert, als wollte sie sehen, was sich jenseits der Mauer in der Welt zutrug.
Wie viele Erinnerungen rief dieser Winkel des Hofes im Herzen des Knechtes wach, ein Ort, der trist erschien, weil überall Moos wuchs, und zugleich heiter durch den goldenen Glanz der Levkojen und das zarte Grün des Jasmins!
Er glaubte wieder Donna Lia zu sehen, wie sie blass und zart wie eine Binse auf dem Balkon stand und ihre Augen unverwandt in die Ferne richtete, auch sie begierig zu erfahren, was dort draußen in der Welt vor sich ging. So hatte er sie auch am Tag ihrer Flucht gesehen, reglos dort oben verharrend wie der Wachgänger, der mit seinem Blick die Geheimnisse des Meeres ergründet.
Wie schwer wiegen diese Erinnerungen! Sie wiegen so schwer wie der Eimer, der, kaum dass er mit Wasser gefüllt ist, wieder nach unten zieht, hinab auf den Grund des Brunnens!
Doch als Efix die Augen hob, sah er, dass die hochgewachsene Frauengestalt, die sich behände auf der Balkonbalustrade zeigte und sich die Ärmel ihrer schwarzen Schoßjacke zuhakte, nicht Donna Lia war. «Donna Noemi! Guten Morgen, meine Herrin! Kommen Sie nicht herunter?»
Sie verneigte sich leicht, und ihr dichtes schwarzes Haar legte sich goldglänzend um ihr blasses Gesicht wie zwei Bänder aus Seide; sie erwiderte seinen Gruß mit den Augen, die ebenso schwarzgolden unter den langen Wimpern hervorsahen, sprach aber kein Wort und kam auch nicht herunter.
Sie riss Türen und Fenster auf – es bestand keine Gefahr, dass ein Windstoß sie zuschlagen und die Scheiben zerbrechen würde (sie fehlten bereits seit vielen Jahren!) –, und brachte eine gelbe Decke auf den Balkon, um sie sorgfältig in der Sonne auszubreiten.
«Kommen Sie nicht herunter, Donna Noemi?», wiederholte Efix und blieb, den Kopf im Nacken, unter dem Balkon stehen.
«Gleich, gleich!»
Doch sie breitete weiter bedächtig ihre Decke aus und schien sich mit aller Muße der Betrachtung der Landschaft hinzugeben, die sich rechts und links von ihr erstreckte und die von melancholischer Schönheit war: mit der sandigen Ebene, durch die sich der Fluss hinzog, den Reihen von Pappeln und niedrigen Erlen und den Inseln aus Binsen und Wolfsmilch, mit der dunklen, vom Brombeergestrüpp umrankten Basilika, dem alten, von Gras überwucherten Friedhof, wo inmitten des Grüns gleich weißen Margeriten die Gebeine der Toten leuchteten; und im Hintergrund der Hügel mit der Burgruine.
Goldene Wolken bekränzten den Hügel und das bröckelnde Gemäuer; die Süße und Stille des Morgens verliehen der Landschaft die heitere Ruhe eines Friedhofs. Die Vergangenheit herrschte immer noch über diese Gegend; die Gebeine der Toten waren ihre Blüten und die Wolken ihr Diadem.
Noemi ließ sich dadurch nicht beeindrucken: Seit ihrer Kindheit war sie daran gewöhnt, auf diese Knochen zu schauen, die sich im Winter an der Sonne zu wärmen schienen und im Frühling vom Tau glitzerten. Niemand dachte daran, sie von dort wegzuholen; warum also hätte sie darüber nachdenken sollen? Donna Ester aber, wenn sie langsamen und gemessenen Schrittes von der neuen Kirche unten im Dorf zurückkehrt (zu Hause ist sie stets in Eile, aber draußen erledigt sie ihre Angelegenheiten mit Bedacht, weil eine adlige Dame doch gefasst und ruhig sein sollte) und dabei am alten Friedhof vorbeikommt, macht das Kreuzzeichen und betet für die Seelen der Toten.
Donna Ester vergisst nie etwas, und sie behält stets alles im Auge. So bemerkt sie auch, kaum dass sie im Hof angelangt ist, dass jemand Wasser aus dem Brunnen geholt hat, und sie stellt den Eimer an den rechten Platz zurück. Sie entfernt ein Steinchen aus einem der Töpfe mit Levkojen, begrüßt Efix beim Eintreten in die Küche und fragt ihn, ob man ihm schon Kaffee gereicht habe.
«Doch, doch, Donna Ester, meine Herrin!»
Inzwischen war Donna Noemi mit dem Telegramm in der Hand heruntergekommen, dachte aber noch nicht daran, es vorzulesen, als bereite es ihr Vergnügen, die angstvolle Neugier des Knechts auf die Spitze zu treiben.
«Ester», sagte sie und nahm auf der Bank neben dem Kamin Platz, «warum legst du dein Tuch nicht ab?»
«In der Basilika ist heute Morgen Messe; ich gehe noch aus dem Haus. Lies nur.»
Auch sie nahm auf der Bank Platz, und Donna Ruth tat es ihr gleich. Wie die drei Schwestern so nebeneinandersaßen, sahen sie sich außergewöhnlich ähnlich, nur dass sie drei verschiedene Lebensalter verkörperten: Donna Noemi war noch jung, Donna Ester bereits gealtert und Donna Ruth betagt, doch ihr Alter zeugte immer noch von Kraft, Vornehmheit und Heiterkeit. Die nussbraunen Augen von Donna Ester, die mit ihrem goldenen Glanz ein wenig heller waren als die ihrer Schwestern, funkelten allerdings kindlich und arglistig.
Der Knecht stand vor ihnen und wartete. Doch nachdem Donna Noemi das gelbe Papier auseinandergefaltet hatte, starrte sie darauf, als könne sie die Worte nicht entziffern, und wedelte endlich ungehalten damit herum.
«Also gut! Er sagt, dass er in wenigen Tagen hier eintreffen wird. Das ist alles.»
Sie hob ihre Augen und errötete, als sie Efix streng ins Gesicht sah. Auch die beiden anderen Schwestern schauten ihn an.
«Verstehst du? Einfach so, als wenn er zu sich nach Hause käme.»
«Was sagst du dazu?», fragte Donna Ester, wobei sie einen Finger durch die übereinandergeschlagenen Enden ihres Tuchs steckte.
Efix machte ein glückliches Gesicht. Die vielen Fältchen um seine lebhaften Augen sahen wie Strahlen aus, und er gab sich keine Mühe, seine Freude zu verbergen.
«Ich bin nur ein armer Knecht. Aber ich sage, dass die Vorsehung weiß, was sie tut!»
«Herr, ich danke Dir! Da ist wenigstens einer, der Verstand hat.»
Noemi aber war wieder blass geworden. Worte des Widerspruchs lagen ihr auf der Zunge, und obgleich sie sich vor dem Knecht wie immer zu beherrschen wusste, da sie ihm keine besondere Bedeutung zubilligen mochte, konnte sie jetzt nicht umhin zu widersprechen: «Das hier hat mit Vorsehung nichts zu tun, darum geht es nicht. Es geht darum …», fügte sie nach einem Moment des Zögerns hinzu, «es geht darum, ihm kurz und bündig mitzuteilen, dass in unserem Haus kein Platz für ihn ist.»
Da breitete Efix seine Hände aus und beugte den Kopf ein wenig zurück, als wollte er sagen: «Und warum fragt ihr dann mich um Rat?»
Doch Donna Ester fing an zu lachen, erhob sich und warf voller Ungeduld die schwarzen Zipfel ihres Tuchs zurück. «Und wo soll er deiner Meinung nach hingehen? Etwa zum Haus des Pfarrers, wie die Fremden, die keine Unterkunft finden?»
«Ich würde ihm gar nichts antworten», schlug Donna Ruth vor und nahm Noemi das Telegramm, das diese immer wieder nervös zusammen- und auseinanderfaltete, aus der Hand. «Wenn er kommt, dann immer herein! Wir könnten ihn grad so aufnehmen wie einen Fremden … Willkommen, lieber Gast!», fügte sie hinzu, als begrüße sie jemanden, der soeben zur Tür hereingetreten ist. «Gut, und wenn er sich danebenbenimmt, dann ist es immer noch Zeit, dass er wieder geht.»
Doch Donna Ester lächelte, als sie ihre Schwester anschaute, die die ängstlichste und unentschlossenste von allen dreien war. Sie beugte sich zu ihr herab und tätschelte ihr mit einer Hand das Knie. «‹Ihn wieder fortzujagen›, willst du wohl sagen. Das würde ja einen schönen Eindruck machen! Hättest du denn den Mut dazu, Ruth?»
Efix dachte nach. Unversehens hob er den Kopf und legte eine Hand auf die Brust. «Darum kümmere ich mich dann schon!», versprach er mit Nachdruck.
Da begegneten seine Augen denen von Noemi. Und er, der sich immer vor diesen kalten Augen gefürchtet hatte, die wie ein unergründliches Gewässer schimmerten, begriff, wie ernst die junge Herrin sein Versprechen nahm.
Doch bereute er nicht, es gegeben zu haben. Er hatte in seinem Leben schon eine ganz andere Verantwortung auf sich genommen.
Er blieb den ganzen Tag über im Dorf.
Er war etwas beunruhigt wegen des Gutes, wenngleich es zu dieser Zeit nicht viel zu stehlen gab. Aber ihm schien, dass ein schwelender Zwist seine Herrinnen betrübte, und er wollte nicht zurückkehren, ehe er sie nicht wieder versöhnt sah.
Nachdem Donna Ester ein wenig Ordnung gemacht hatte, verließ sie erneut das Haus, um in die Kirche zu gehen. Efix versprach ihr, sie auf dem Weg einzuholen. Doch als Donna Noemi wieder in das obere Stockwerk hinaufging, kehrte er noch einmal in die Küche zurück und bat Donna Ruth, die auf dem Boden vor einem niedrigen Tisch kniete und etwas Teig knetete, mit leiser Stimme, ihm das Telegramm zu geben. Diese hob den Kopf und schob mit der mehlbestäubten Faust das Tuch ein wenig zurück. «Hast du sie gehört?», sagte sie leise und meinte damit Noemi. «Sie ist wie immer! Der Stolz beherrscht sie …»
«Sie hat recht», versicherte Efix nachdenklich. «Adlig bleibt adlig, Donna Ruth. Sie finden eine Münze in der Erde. Sie glauben, sie ist aus Eisen, weil sie schwarz ist. Doch wenn Sie sie putzen, dann sehen Sie, dass es Gold ist … Gold bleibt immer Gold …»
Donna Ruth begriff, dass es zwecklos war, mit Efix über Esters unangebrachten Stolz zu sprechen. Und nur zu bereit, sich der Meinung anderer anzuschließen, zeigte sie sich darüber erfreut. «Erinnerst du dich, wie stolz mein Vater war?», sagte sie und stieß ihre roten, blau geäderten Hände wieder in den Teig. «Auch er sprach so. Er hätte Giacintino ganz sicher nicht erlaubt, hier überhaupt an Land zu gehen. Was denkst du, Efix?»
«Ich? Ich bin nur ein armer Knecht. Aber ich behaupte, dass Don Giacintino trotzdem an Land gegangen wäre.»
«Ganz der Sohn seiner Mutter, willst du damit sagen?», seufzte Donna Ruth. Und auch der Knecht seufzte. Die Schatten der Vergangenheit umgaben sie, waren allgegenwärtig.
Der Knecht aber machte eine Geste, als wollte er diese Schatten vertreiben. Er folgte mit seinen Augen den Bewegungen der roten Hände, die den weißen Teig zogen, falteten und schlugen, und sprach ruhig weiter. «Er ist ein guter Junge, und die Vorsehung wird ihm beistehen. Man muss nur aufpassen, dass er nicht das Malariafieber bekommt. Außerdem sollte man ihm ein Pferd kaufen; denn auf dem Festland pflegt man nicht zu Fuß zu gehen. Ich werde mich darum kümmern. Die Hauptsache ist, dass die Herrinnen sich einig sind.»
Unversehens fuhr sie stolz auf: «Sind wir uns vielleicht nicht einig? Hast du etwa gesehen, wie wir uns gestritten haben? Wolltest du nicht zur Messe, Efix?»
Efix begriff, dass sie nicht mit ihm weiterreden wollte, und trat auf den Hof hinaus, um zu sehen, ob er nicht auch noch mit Donna Noemi sprechen konnte. Sie nahm eben die Decke vom Balkon. Es war zwecklos, sie zu bitten herunterzukommen, er musste zu ihr nach oben gehen. «Donna Noemi, gestatten Sie mir eine Frage? Sind Sie froh?»
Noemi, die Decke auf dem Arm, blickte ihn überrascht an. «Worüber?»
«Dass Don Giacintino kommt? Sie werden sehen, er ist ein guter Junge.»
«Ach, woher kennst du ihn denn?»
«Das sieht man daran, wie er schreibt. Er kann es zu etwas bringen. Man müsste ihm allerdings ein Pferd kaufen …»
«Und womöglich auch noch die Sporen dazu!»
«Alles hängt davon ab, dass die Herrinnen untereinander einig sind. Das ist die Hauptsache.»
Sie zupfte einen Faden von der Decke und warf ihn in den Hof hinunter. Ihr Gesicht hatte sich verfinstert. «Wann sind wir uns denn mal nicht einig gewesen? Bisher waren wir es noch immer.»
«Schon … aber … es scheint, dass Sie nicht glücklich darüber sind, dass Don Giacintino kommt.»
«Soll ich jetzt vielleicht auch noch anfangen zu singen? Er ist nicht der Messias!», erwiderte sie und ging an ihm vorbei durch eine kleine Tür, durch die man das Innere eines hellen Zimmers mit einem alten Bett, einem alten Schrank und einem scheibenlosen Fensterchen erkennen konnte, das auf die grünen Hänge des Monte Galte hinausging.
Efix stieg die Treppe hinab, pflückte im Hof eine kleine rosa Levkoje und schlug den Weg zur Basilika ein, während er die Blume in den hinter dem Rücken verschränkten Händen hielt.
Ringsum herrschte die Stille und Kühle des unweit aufragenden Berges. Nur das Zwitschern der Meisen in den Brombeerbüschen erfüllte die Umgebung mit Leben und begleitete das eintönige Gebet der in der Kirche versammelten Frauen. Efix trat, immer noch die Levkoje in den Händen, auf Fußspitzen ein und kniete vor der Kanzel nieder.
Die Kirche verfiel zusehends, alles war grau, feucht und staubig. Durch die Löcher im Holzdach regneten Strahlen silbrigen Staubs auf die Köpfe der Frauen nieder, die auf dem Boden knieten. Und die gelblichen Gestalten, die sich vom rissigen schwarzen Grund der verbliebenen Gemälde an den Wänden abhoben, ähnelten diesen schwarz und violett gekleideten Frauen, deren Gesichter fahl wie Elfenbein waren. Und selbst die schönsten und feingliedrigsten unter ihnen hatten durch das Malariafieber ausgezehrte Brüste und aufgedunsene Leiber. Das Gebet erscholl träge und monoton, so als würde es aus weiter Ferne jenseits aller Zeiten herüberhallen. Es war eine Messe anlässlich eines dreißigsten Jahrgedächtnisses, und ein schwarzes Tuch mit goldenen Fransen bedeckte die Balustrade des Altars. Der Priester, ganz in Schwarz und Weiß, wandte sich mit ausgebreiteten Händen langsam um. Zwei Lichter tanzten um ihn herum, die von seinem Prophetenhaupt auszustrahlen schienen. Wenn nicht der Klang der Altarglocke gewesen wäre, die der kleine Mesner hin- und herschwang, als wolle er ringsum die bösen Geister vertreiben, hätte Efix, trotz des Lichts und des Vogelgesangs, geglaubt, er wohne einer Messe von Gespenstern bei. Denn sie sind alle da: Don Zame, der im Familiengestühl kniet, und auch Donna Lia, etwas weiter hinten, die in ihrem schwarzen Schal so blass erscheint wie jene Figur dort oben auf dem alten Gemälde, zu der die Frauen von Zeit zu Zeit aufblicken und die auf einem schwarzen, bröckelnden Balkon zu stehen scheint. Es ist die Gestalt der Magdalena, von der es heißt, sie sei nach dem Leben gemalt worden: Liebe, Trauer, Reue und Hoffnung lachen und weinen zugleich in ihren tiefgründigen Augen und in ihrem bitteren Mund …
Efix betrachtet sie und wie immer, wenn er vor dieser Figur steht, die aus dem Dunkel einer allwaltenden Vergangenheit heraustritt, erfasst ihn ein Schwindel, als schwebe er selbst in einer schwarzen, geheimnisvollen Leere … Ihm ist, als entsinne er sich eines unendlich weit zurückliegenden früheren Daseins. Ihm ist, als würde alles um ihn herum zum Leben erwachen, doch zu einem wundersamen Leben wie in den Legenden; die Toten erstehen wieder auf; Christus, der hinter dem gelblichen Altarvorhang verborgen ist und nur zweimal im Jahr dem Volk gezeigt wird, steigt aus seinem Versteck herab und wandelt umher – auch er hager, bleich, stumm; er schreitet voraus, und das Volk folgt ihm nach; und inmitten des Volks geht auch Efix selbst, er geht weiter und weiter, mit der Blume in der Hand, das Herz von einer Woge der Zärtlichkeit bewegt … Die Frauen singen, die Vögel singen; Donna Ester, den Finger zwischen den Enden ihres Tuchs, geht mit kleinen Schritten neben dem Knecht einher. Der Prozessionszug verlässt das Dorf, und das Dorf ist voller blühender Granatapfelbäume und Waldreben; die Häuser sind neu, das Tor der Familie Pintor ist neu, aus hellem Nussbaum, der Balkon ist heil … Alles ist neu, alles ist schön. Donna Maria Christina lebt wieder und tritt auf den Balkon, wo die seidenen Decken ausgebreitet sind; Donna Noemi ist blutjung und mit Don Predu verlobt; und Don Zame, der ebenfalls der Prozession folgt, gibt wie immer vor, missmutig zu sein, ist aber äußerst zufrieden …
Doch der Gesang der Frauen verstummte, und einige erhoben sich, um zu gehen. Efix, der seinen Kopf an die Säule der Kanzel gelehnt hatte, fuhr aus seinem Traum auf und folgte Donna Ester, die hinaustrat, um sich auf den Heimweg zu machen.
Die hochstehende Sonne geißelte jetzt das kleine Dorf, das im blendenden Licht des heißen Vormittags trostloser denn je dalag. Die Frauen, die die Kirche verlassen hatten, strebten schweigend wie Gespenster nach allen Richtungen auseinander, und Einsamkeit und Schweigen umhüllten von Neuem das Haus der Damen Pintor. Donna Ester ging zum Brunnen, um eine junge Nelke mit einem Brettchen abzudecken, lief rasch die Treppe hinauf und schloss Türen und Fenster. Unter ihren Schritten knarrte der Balkon, und von der Mauer und dem morschen Holz rieselte aschgrauer Staub herab.
Efix wartete darauf, dass sie wieder nach unten kam. Er hatte sich in der Sonne auf die Treppe gesetzt, seine Mütze nach vorne gebogen,23 um dem Gesicht ein wenig Schatten zu verschaffen, und spitzte mit seinem Klappmesser einen Pfosten zu, den Donna Ruth unter dem Torbogen einschlagen lassen wollte. Doch das Aufblitzen der Klinge in der Sonne tat seinen Augen weh, und die schon welke Levkoje zitterte auf seinen Knien. Er fühlte, wie seine Gedanken konfus wurden, und dachte an das Fieber, das ihn im vergangenen Jahre gepeinigt hatte. «Etwa schon wieder dieses Teufelsfieber?»
Donna Ester kam die Stufen herab, ein Gefäß aus Kork in der Hand. Er rückte zur Seite, um sie vorbeigehen zu lassen, und hob das von der Mütze beschattete Gesicht. «Gehen Sie nicht mehr weg, Herrin?»
«Wohin soll ich denn deiner Ansicht nach um diese Tageszeit gehen? Niemand hat mich zum Mittagessen eingeladen.»
«Ich möchte gerne über eine Sache mit Ihnen sprechen. Sind Sie zufrieden?»
«Womit denn, mein Guter?» Sie gab sich ihm gegenüber mütterlich, wenn auch ohne alle Vertraulichkeit; sie hatte ihn immer als nur einen einfachen Mann betrachtet.
«Sind … sind alle damit einverstanden, dass Don Giacintino herkommt?»
«Ich bin zufrieden, ja. So hat es kommen müssen.»
«Er ist ein guter Junge, er wird seinen Weg schon machen … Man sollte ihm ein Pferd kaufen. Aber …»
«Aber …?»
«Man sollte ihm anfangs nicht zu viele Freiheiten lassen. Junge Männer bleiben nun mal junge Männer … Ich erinnere mich, dass ich als junger Bursche immer die ganze Hand nahm, wenn man mir den kleinen Finger bot. Und außerdem … Sie wissen es ja, Donna Ester … die Männer aus dem Geschlecht der Pintor … sind hochmütig.»