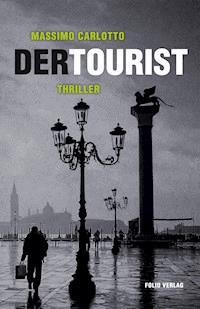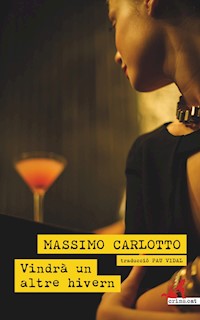Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Folio Verlag
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
Ein Noir der Spitzenklasse zeigt den schmalen Grat zwischen Verbrechen und Gesetz. Marco Buratti, der Alligator, und seine beiden Kumpane Max "das Gehirn" und Rossini, genannt der alte Gauner, jagen ihren ewigen Todfeind Giorgio Pellegrini. Doch dieser kollaboriert längst mit der Polizei als V-Mann. Da ermorden Killer dessen Frau und dessen Geliebte. Die machthungrige Dottoressa Marino vom Innenministerium spinnt ein unentwirrbares Netz von Intrigen und nötigt das skurrile Trio zu verdeckten Ermittlungen in der Mordsache. Erst allmählich erkennen die drei die Falle, auf die sie zusteuern – und gehen aufs Ganze.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 293
Veröffentlichungsjahr: 2019
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Foto © Daniela Zedda
DER AUTOR
Massimo Carlotto, geboren in Padua 1956, ist einer der bekanntesten italienischen Krimiautoren. Neben zahlreichen Büchern mit der beliebten Figur des „Alligators“ hat er eine Vielzahl weiterer geschrieben. Seine Romane sind in viele Sprachen übersetzt und erfolgreich verfilmt worden.
Zuletzt ist auf Deutsch bei Folio Der Tourist (2017) erschienen.
MASSIMO CARLOTTO
BLUESFÜR SANFTEHALUNKENUND ALTEHUREN
EIN FALL FÜR DEN ALLIGATOR
AUS DEM ITALIENISCHEN VON INGRID ICKLER
Für Alvaro
Inhalt
Eins
Zwei
Drei
Vier
Fünf
Sechs
Sieben
Acht
Neun
Zehn
Zur gleichen Zeit irgendwo in einem Vorort von Wien …
Eins
Der Informant wirkte wie ein ehemaliger Polizist. Seine Uniform hatte wahrscheinlich schon seit Jahren eingemottet im Schrank gehangen, aber die Bügelfalte in den Hosenbeinen und der akkurate Scheitel, der seine kurzen blonden Haare teilte, ließen vermuten, dass er es in der Hierarchie nicht weit gebracht hatte.
Meine Beobachtung beruhte allein auf meinem Instinkt und meiner Erfahrung, mehr Anhaltspunkte hatte ich nicht. Doch ich war mir sicher, zumindest sicher genug. Auf der rechten Backe hatte der Mann einen auffälligen dunklen Fleck, der etwa so groß wie ein Fünfcentstück war. Als ich von Geld sprach, hellte sich sein Gesicht auf. Das Strahlen in seinem Blick verriet, dass er auf ein Ende des sparsamen Lebens hoffte.
Er heiße Hermann, sagte er und fuhr sich mit dem linken Zeigefinger über die Lippen, als wollte er sich vergewissern, dass sie sauber waren.
„Sind Sie sich wirklich sicher?“, fragte ich nachdrücklich und zeigte ihm noch einmal die Nahaufnahme des Mannes, den wir suchten.
Er nickte entschieden, und da ich überzeugt war, dass er die Wahrheit sagte, reichte ich ihm den Gegenwert von eintausend Euro in Schweizer Franken. Er fragte nicht, warum wir so misstrauisch nachhakten, die Antwort hätte bei ihm womöglich Zweifel an der Richtigkeit seines Tuns geweckt. Wenn sich das Gewissen zu Wort meldete, musste man vorsichtig sein.
Nicht zuletzt deshalb hatte ich es vermieden, ihm die Wahrheit zu sagen. Er glaubte, dass wir nach einem Mann fahndeten, den ein verstorbener Onkel, der nach Brasilien ausgewandert war, zum Alleinerben eingesetzt und dem er ein Millionenvermögen vermacht hatte.
Zunächst hatten wir in den einschlägigen Lokalen in und rund um Bern diskret die Nachricht gestreut, dass wir nach jemandem suchten, und ein Foto aus einer Hochglanzzeitschrift für Gourmets in Umlauf gebracht. Es zeigte einen gut aussehenden, faszinierenden Typ von Mitte vierzig mit einem intelligenten und selbstsicheren Blick – einen Mann, den wir für immer von dieser Erde tilgen wollten.
Schließlich war die Nachricht an die Ohren des guten Hermann gedrungen, der uns, wie es aussah, die richtige Adresse liefern konnte.
Das Lokal, in dem wir uns trafen, war alt, die Besitzerin ebenfalls. Nach ihrem Tod würde es das Etablissement wohl nicht mehr geben, denn die Gäste waren auch nicht viel jünger. Wir mochten den Schuppen, weil er irgendwie aus der Zeit gefallen war, die Gläser schmeckten leicht nach Spülmittel, und jeden Abend, gute drei Stunden lang, spielten zwei Iren Gitarre und sangen dazu alte, melancholische Lieder. Folk, ein bisschen Jazz, ein paar Bluesnummern.
Mairead hatte eine Stimme, die an Bonnie Raitt erinnerte. Bei Killian, ihrem Mann, hörte man zwischen den Zeilen die mühsam unterdrückte Wut eines nationalistischen Iren. Aber vor allem spürte man, dass sie sich in Liebe verbunden waren. Nach all den Jahren sahen sie sich immer noch tief in die Augen, strahlten einander an und küssten sich. Wir beneideten sie, denn das fehlte in unserem Leben. Dabei waren sie nicht mehr jung, ihre Gesichter zeugten vom jahrelangen Tingeln durch rauchige Kneipen, doch sie waren authentisch. Voller Bewunderung und gerührt prosteten wir ihnen zu: mit Calvados, Grappa, Wodka. Auch wir hatten nach einer solchen Liebe gesucht, sie manchmal gefunden und wieder verloren – doch unsere rebellischen Herzen waren noch nicht bereit, auf sie zu verzichten.
Hermann, der Informant, der mit uns am Tisch saß, schob mir einen Zettel mit der Adresse zu. Offenbar hatte er eine alte Schreibmaschine benutzt, denn das S war schon ziemlich abgenutzt und kaum mehr lesbar. Unser Mann wohnte in der Nähe des Spitalacker-Stadions.
„Was können Sie mir darüber hinaus sagen, Hermann?“
„Es ist ein kleines Haus, er wohnt dort mit einer Frau“, antwortete er in gebrochenem Englisch.
Bei dieser Antwort schwanden unsere letzten Zweifel. „Wann haben Sie die beiden das letzte Mal gesehen?“
„Ihn gestern, bei ihr ist es länger her.“
Ich streckte ihm die Hand hin. Hermann war verlegen und zögerte eine Weile, bis er sie ergriff. Dann ging er mit gesenktem Kopf davon und vermied es, sich noch einmal umzusehen. Kein Mensch hier würde sich an diesen unauffälligen Mann erinnern, nicht in diesem Königreich der Liebe, die das irische Paar zelebrierte.
„Vielleicht ist es tatsächlich Giorgio Pellegrini“, sagte ich, nachdem er weg war, und trank einen Schluck.
Der alte Rossini zuckte die Schultern. „Möglich. Bringen wir es hinter uns.“
Max, den alle „das Gehirn“ nannten und der gerade etwas auf dem Tablet recherchierte, schaute zu uns herüber. „Die Zeit drängt, wir sind inzwischen seit mehr als einem Monat in Bern. Falls der Informant sich irrt, gehen wir zurück nach Italien, sonst haben die Bullen bald hundertprozentig eine Menge unangenehmer Fragen an uns.“
„Einverstanden.“ Ich nickte. „Morgen früh schauen wir dort vorbei.“
Als wir merkten, dass die Wirtin genug von uns hatte, zogen wir in eine ruhigere Kneipe in der Nähe des Bahnhofs um, wo sich elegante Escortladys zwischen zwei Kunden eine Pause gönnten. Sie tranken einen Cappuccino oder einen frisch gepressten Saft und brachten viel Zeit auf der Toilette zu, um den Geruch des letzten Kunden wegzuwaschen. Leider fehlte es uns an den entsprechenden Sprachkenntnissen, um uns mit ihnen näher zu befassen. Dafür schlossen wir Bekanntschaft mit zwei Spanierinnen um die dreißig und einem Transsexuellen aus Slowenien, die alle perfekt Italienisch sprachen. Die falsche Frau nannte sich Katharina und setzte sich sofort an unseren Tisch, hörte unseren Gesprächen zu oder erzählte von ihrer Zeit in Mailand, ihren Liebschaften, ihren Nachbarn. Momentan wartete sie auf den Anruf eines Typs, der im besten Hotel der Stadt abgestiegen war und sie gut bezahlen würde. Deshalb ließ sie es sich nicht nehmen, unsere Getränke zu bezahlen. Normalerweise nahmen wir solche Einladungen nicht an – in diesem Fall machten wir eine Ausnahme, um sie nicht zu beleidigen.
Beniamino mochte sie, das sah man. Und sie mochte ihn, allerdings rein platonisch. So war ihr Leben: Sie ließ sich von Unbekannten vögeln und traf Männer, mit denen sie träumte. Mit einer zärtlichen Geste strich Katharina ihm über den schmalen Oberlippenbart, auf den der alte Gauner sehr stolz war, und ging dann hüftwackelnd davon.
Ich hatte ein anonymes Vorstadthäuschen erwartet, eines, das man übersah, einen guten Ort, um sich zu verstecken. Stattdessen war das Gebäude in einer auffälligen Farbe gestrichen und wirkte recht elegant. Der kleine Garten war gepflegt, die Hecke millimetergenau geschnitten. Ein Weg aus weißen Steinen führte um das Haus herum, er war mit Blättern bedeckt, die der Eisregen von den Bäumen gerissen hatte. Wahrscheinlich kümmerte sich die Frau, die Hermann seit einigen Tagen nicht mehr gesehen hatte, normalerweise um solche Dinge. Giorgio Pellegrini gewiss nicht. Er war nicht der Typ, der einen Besen in die Hand nahm, und er würde zudem nicht das Risiko eingehen, sich in der Nachbarschaft offen zu zeigen.
„Niemand zu Hause“, meinte Beniamino und startete den Motor, „wir kommen noch mal her, wenn es dunkel ist. Vielleicht haben wir dann mehr Glück.“
„Oder er ist für ein paar Tage weggefahren“, warf Max ein.
„Möglicherweise ist er abgehauen und hat uns schon wieder verarscht“, gab ich knapp zurück.
Rossini legte den Gang ein. Wir fuhren einen Geländewagen mit Schweizer Kennzeichen, den uns unser Vermieter besorgt hatte, ein Italiener, der vor zwanzig Jahren Geschäfte mit Beniamino gemacht hatte. Die Wohnung kostete genauso viel wie die Suite in einem Grandhotel, aber sie war gemütlich und sicher. Niemand würde uns dort finden.
Wir fuhren ins nahe gelegene Innenstadtviertel, und jeder ging seiner Wege. Ich trank ein Bier und machte mich dann auf zu einem Plattenladen. Der Besitzer war ein alter Rocker mit wachem Blick, sein Gesicht verriet eine lange Drogenkarriere, die sicher reich an Erfahrungen gewesen war.
„Was suchst du?“, fragte er auf Deutsch.
„Bluessängerinnen. Im Moment höre ich nichts anderes“, erklärte ich ihm auf Englisch.
„Sieh dich dort um.“
Er zeigte auf ein Regal, doch ich schüttelte den Kopf. „Empfiehl mir was. Ich bin auf der Suche nach etwas Neuem und will keine Zeit damit verschwenden, mich durch Massen von CDs zu wühlen.“
Grinsend zog er eine CD heraus und reichte sie mir. „Die kennst du sicher nicht. Finnisch.“
Ich warf einen Blick auf das Cover. Ina Forsman. Rote Haare, tätowierte Arme. „Lass mich reinhören, wenn sie mir gefällt, nehme ich sie.“
„Wie du willst“, meinte er schulterzuckend und drückte mir ein paar abgegriffene Kopfhörer in die Hand.
Der Typ hatte recht. Ina hatte die passende Stimme für Stücke wie Bubbly Kisses. Seit einer ganzen Weile bereits liebten es meine Ohren und mein Herz, ausschließlich Frauenstimmen zu hören. Vielleicht war es auch bloß der Blues, der mein ungestilltes Verlangen nach Liebe erträglich machte. Wenn ich ihn hörte, dachte ich an meine Beziehungen aus der Vergangenheit und erinnerte mich daran, dass ich nicht immer so einsam gewesen war wie im Moment. Als ich nach einer Weile genervt die Kopfhörer abnahm, musterte mich der Rocker erstaunt.
Ich winkte wortlos ab, um ihn zu beruhigen. Schließlich konnte ich ihm nicht erklären, dass man Herzensangelegenheiten beiseitelassen musste, wenn man dabei war, einen Mann zu ermorden. Und es hatte nichts damit zu tun, ob ich persönlich abdrückte oder nicht. Ich würde anwesend und mit Sicherheit erleichtert sein, Pellegrini vor meinen Augen sterben zu sehen.
Das letzte Mal hatte ich dem schönen Giorgio Auge in Auge in einem Kellergewölbe gegenübergestanden, und Rossini hatte eine Pistole auf ihn gerichtet. Und dann schloss der Alte mit ihm einen Deal: sein Leben gegen etwas für uns sehr Wichtiges, obwohl ich ihn beschworen hatte, die Menschheit von diesem Arschloch zu befreien. Er blieb hartnäckig, wollte nicht auf mich hören, und so verschonten wir Pellegrini.
Trotzdem war ich nach wie vor fest davon überzeugt, dass wir in diesem Moment unsere Prinzipien hätten aufgeben sollen. Was mich betraf, ich hätte damit leben können. Beniamino leider nicht.
Ein paar Minuten vor sieben brach Rossini das schmiedeeiserne Tor auf. Wir hatten die Abendessenszeit gewählt, weil die Nachbarn jetzt in ihren gemütlichen warmen Häusern vor dem Fernseher saßen und abgelenkt waren. Geräusche von draußen würden sie kaum wahrnehmen.
Die Tür war doppelt verschlossen, sprang jedoch mithilfe einer reichen Auswahl an Dietrichen widerstandslos auf. Unser Mann fürs Grobe ging zuerst rein, die Pistole im Anschlag. Im Inneren war es still und dunkel. Das Haus wirkte leer. Unser Mann war ausgeflogen. Ein Diplom in einem Bilderrahmen an der Wand im Flur sagte uns, dass hier eine gewisse Lotte Schlegel lebte. Als ich meine kleine Taschenlampe anknipste, fiel ihr Licht auf das Foto einer lächelnden jungen Frau mit kurzen schwarzen Haaren. Ich fragte mich, wie sie wohl in Pellegrinis Fänge geraten war.
Max deutete auf ein anderes Bild, das mit einer Reißzwecke an der Tür des massiven antiken Eichenschranks im Schlafzimmer befestigt war. Giorgio Pellegrini lächelte uns von oben herab an, die Arme vor der Brust verschränkt. Es war das Foto, das wir benutzt hatten, um ihm auf die Spur zu kommen. Irgendwie musste er eines davon in die Finger gekriegt und begriffen haben, dass wir ihn früher oder später finden würden, und war abgehauen.
Die Schranktüren waren mit Paketband zugeklebt, und als Beniamino es mit seinem Taschenmesser durchschnitt, wehte uns ein ekliger, süßlicher Verwesungsgeruch entgegen, der uns verriet, dass eine Leiche im Schrank lag. Die Hausbesitzerin war nackt und mit diversen Schichten Plastikfolie umwickelt. Der Strumpf, mit dem man sie erdrosselt hatte, lag noch eng um ihren Hals, ihre Gesichtszüge waren in panischer Angst erstarrt. Wenngleich wir keine Experten waren, erkannten wir, dass sie seit einigen Tagen tot war.
Max schauderte beim Anblick dieses Haufens Plastik, in dem sich der Körper einer der Frauen befand, die die Bekanntschaft mit dem schönen Giorgio teuer bezahlt hatten. Beniamino legte ihm die Hand auf die Schulter und schob ihn in Richtung Wagen.
„Und jetzt?“, flüsterte ich enttäuscht, als wir alle wieder im Auto saßen.
„Ich rufe die Bullen an, wir haben unsere Optionen ausgeschöpft“, murmelte Rossini.
Seufzend stimmte ich zu.
Es war nie eine gute Idee, Ispettore Giulio Campagna anzurufen. Doch ich durfte mich nicht beschweren, immerhin war ich es, der Hilfe brauchte.
Campagna war ein komischer Kauz, trug seltsame Hawaiihemden und hatte seine ganz eigenen Vorstellungen von der Polizei und der Justiz. Er war oft so unfreundlich und abweisend, dass selbst ein Heiliger die Geduld verloren hätte, aber als wir in Padua einen Schlussstrich unter Pellegrinis kriminelle Machenschaften gezogen hatten, war er bereit gewesen, uns zu decken.
Damals waren wir in der festen Überzeugung in unseren Alltag zurückgekehrt, dass dieser Typ der Vergangenheit angehörte. Ich hatte mich einer Bluesband auf Tournee angeschlossen, war unterwegs, hörte gute Musik, trank und riss Frauen für eine Nacht auf. Das Leben laufen zu lassen war meine Methode, um wieder zu Atem zu kommen. Dann eines Nachmittags bekam ich einen Anruf. Pellegrini. Ich hätte auflegen sollen, aber ich tat es nicht. Zu groß war die Neugier, was er von mir wollte, vielleicht weil ich bereits drei oder vier Bier intus hatte.
Pellegrini war immer für eine Überraschung gut, so auch dieses Mal: Er wollte uns anheuern, damit wir in den Mordfällen an seiner Frau und seiner Geliebten ermittelten. Martina und Gemma. Ich hatte sie beide gut gekannt. Nach der Flucht ihres Herrn und Meisters war das La Nena in ihren Besitz übergegangen – jenes Restaurant, das Giorgio gegründet und berühmt gemacht hatte.
Zwar hatte ich nach einer lebhaften Diskussion den Auftrag abgelehnt, doch er hatte mich nur ausgelacht: „Ich kenne dich, Buratti, ich habe dich arbeiten sehen. Du bist von der Wahrheit besessen, du wirst dir diesen Fall nicht entgehen lassen.“
Sein Ton war zu selbstsicher. Man konnte sich auf diesen Typ nicht verlassen, selbst wenn er die Wahrheit sagte. Jede Aktion war bei ihm genau geplant. Nachdem ich mein Bier ausgetrunken hatte, war ich zu einem Internetpoint gegangen, um zu recherchieren. Laut polizeilichen Erkenntnissen waren die beiden Frauen gefoltert und erdrosselt und im Keller des Restaurants versteckt worden. Die Tageseinnahmen befanden sich noch in Gemmas Tasche, womit klar war, dass es sich nicht um einen Raubüberfall handelte. Vielmehr ging man davon aus, dass eigentlich Pellegrini das Ziel gewesen war und die beiden Frauen ums Leben kamen, weil sie seinen Aufenthaltsort nicht verraten hatten. Trotz grauenhafter Folter.
Nach wie vor hatte ich keine Ahnung, aus welchem Grund Pellegrini mich wirklich angerufen hatte. Ich sollte es einige Stunden später auf unerwartete Weise herausfinden. In dem Augenblick nämlich, als mich der Inspektor und seine Leute nach rauer Polizistenart aus dem Schlaf rissen und ins Präsidium von Padua brachten.
Dort lernte ich Dottoressa Angela Marino kennen. Eine schöne und faszinierende Frau, von der ich niemals erwartet hätte, dass sie so ausgebufft sein konnte. Das begriff ich erst, als sie mein Gespräch mit Pellegrini vom Vortag abspielte. Darin war kein einziger Satz, der gegen mich ausgelegt werden konnte, aber dieses Schwein hatte offenbar eine Vereinbarung mit der Dottoressa getroffen, um dem Knast zu entgehen. Nicht zum ersten Mal, denn er hatte schon früher Komplizen und Informationen an die Polizei verkauft. Inzwischen mischte er bei irgendwelchen geheimen Operationen mit. Wenn wir nicht in der gleichen Liga gespielt hätten, wären wir beide wegen irgendeiner Anklage längst im Knast gelandet und hätten als notorische Kriminelle eine lange Haftstrafe absitzen müssen. Bislang hatten wir uns gegenseitig gedeckt, jetzt schien das vorbei zu sein.
Angela Marino war recht überzeugend gewesen. Sie hatte mir Max’ Krankenakte unter die Nase gehalten.
„Mit seinen gesundheitlichen Schwierigkeiten hält er im Knast nicht mehr als vier, fünf Jahre durch.“
Ich hatte genickt. Oder besser, ich hatte so getan, als ob ich einknickte. In Wirklichkeit begannen meine Freunde und ich, alle möglichen Hypothesen in Betracht zu ziehen. Mit dem Resultat, dass es uns als beste Lösung erschien, das Problem an der Wurzel zu packen und Giorgio Pellegrini, der uns lediglich aus Rache in diese Sache mit hineingezogen hatte, das Lebenslicht auszublasen. Also waren wir aus der Szene verschwunden und machten Jagd auf ihn, doch er war uns dreimal entwischt. Inzwischen waren uns die Ideen ausgegangen, was wir noch versuchen könnten.
Wir mussten unbedingt Zeit gewinnen. Selbst wenn wir bislang nicht alle Details kannten, lag auf der Hand, dass es sich um eine äußerst schmutzige Geschichte handelte, bei der von vornherein außer Frage stehen dürfte, mögliche Zeugen ungeschoren zu lassen. Und da die Dottoressa offenbar nicht vorhatte, irgendwelche Absprachen einzuhalten, dachten wir darüber nach, uns an der Dalmatinischen Küste oder im Libanon zu verstecken, wo Rossini sichere Kontakte hatte.
Aber dann beschlossen wir dummerweise, es noch ein allerletztes Mal zu versuchen. Weil diese ganze Sache eine solch ekelhafte Dimension angenommen hatte und wir das alles unerträglich und ungerecht fanden. Außerdem wollten wir der Marino, einer hochrangigen Ermittlungsbeamtin aus dem Innenministerium in Rom, eins auswischen. Sie behandelte uns wie Marionetten, die man nach Belieben hin und her bewegte. Dorthin, wo man sie gerade brauchte.
Wenn sie glaubte, wir würden uns verkaufen, dann hatte sie sich böse getäuscht. Um keinen Preis der Welt.
„Wir setzen alles auf eine Karte“, hatte Rossini gesagt, der so manche Kämpfe in seinem Leben ausgefochten hatte. Und meinte damit selbst die Freiheit und das Leben. Wie früher in der hohen Zeit der Banden.
„Ruf ihn an.“ Rossini blieb hartnäckig, und ich holte das Handy aus meiner alten Fliegerjacke.
Zwei Tage später saß ich am frühen Morgen in einer Bar, die in einem Vorstadtviertel von Padua im Erdgeschoss eines grauen Mehrfamilienhauses mit einem antennengespickten Dach lag. Um diese Zeit gab es hier nur Cornetti, die noch halb gefroren waren, und einen grauenvoll schmeckenden Kaffee mit einem ekligen Milchpulver aus Österreich. Dafür konnte man sich hier ungestört mit Leuten treffen, mit denen man auf keinen Fall gesehen werden wollte. Hier achtete niemand auf die anderen.
Die Besitzerin stammte aus Albanien und kümmerte sich ausschließlich um ihre eigenen Angelegenheiten. Sie war 1991 mit der ersten Welle von Flüchtlingsbooten in Brindisi gelandet, hatte Jobs angenommen, die kein Italiener machen wollte, und dabei genug Geld zur Seite gelegt, um diese Bar zu eröffnen. Ihre Kundschaft bestand hauptsächlich aus Rentnern und Hausfrauen, ein überwiegend ruhiges und friedliches Publikum.
Ich bestellte einen Birnensaft und überflog die Schlagzeilen der Zeitung. Einige Priester waren in einen Sexskandal verwickelt, um den sich die landesweiten Talkshows kümmerten. Pfarrkinder, Pornovideos, Sexspielzeuge und für den „Capo“ eine Anklage wegen Ausbeutung und Prostitution. Die Presse versuchte eine moralisch korrekte Berichterstattung zu liefern, aber die ganze Stadt lachte, Witze und freche Sprüche kursierten. Die Empörung hielt sich in Grenzen. Nicht zuletzt, weil die Geistlichen trotz allem für ihr Engagement in der Gemeinde bekannt waren und ein Fick schließlich keinem wehtat. Also nichts Neues unter der Sonne des Veneto.
Mir kam ein alter Priester in den Sinn, der vom Zölibat wie von einer Folter zu sprechen pflegte, für die er sich bewusst entschieden hatte. Er war aus anderem Holz geschnitzt, redete Klartext und war fest von seiner Mission überzeugt: Ex-Häftlinge davor zu bewahren, wieder ins Gefängnis zu wandern. Leider starb er zu früh.
Ispettore Giulio Campagna kam zehn Minuten zu spät. Er trug einen Parka mit einem Pelzbesatz an der Kapuze, der zwar echt, jedoch ziemlich dreckig aussah. Er bemerkte meinen prüfenden Blick und deutete mit seinem behandschuhten Finger auf das Fell. „Präriekojote.“
„Also Hund“, gab ich trocken zurück.
„Genau.“ Er zog seine haselnussbraue Cordjacke zurecht, unter der sich sein Halfter verbarg. „Früher nahm man das Fell der Kanalratten und nannte es rat musqué.“
Mit Grauen erinnerte ich mich an die leuchtenden Kragen und Manschetten, die die Frauenmäntel zierten. Später kam Nutria in Mode. Nach der Schließung der Zuchtbetriebe wuchs ihre Zahl explosionsartig an, und die Provinz Venetien schuf erst mit zehnjähriger Verspätung Abhilfe, indem sie spezialisierte Jäger ausbildete.
„Du hast deinen Bart rasiert“, bemerkte der Inspektor, „hast du eine Wette verloren?“
„Nein“, antwortete ich lakonisch.
Eine Frau hatte mir gesagt, dass er mir nicht stünde, und zwar in dem Moment, als es zur Sache ging. Dabei hatte sich der Sex ziemlich gut angelassen. Jedenfalls beschloss ich daraufhin, solch wenig erhebende Momente künftig zu vermeiden, und nahm den Bart ab.
Campagna beäugte argwöhnisch die Auslage. „Diese widerlichen Croissants kosten im Einkauf zwanzig Cent, und hier verkaufen sie sie dir für einen Euro.“
„Eins dreißig“, korrigierte ihn die Besitzerin.
„Und was ist mit dem Palmöl? Wollen wir uns darüber ebenfalls unterhalten?“, fuhr er fort, wobei seine Stimme lauter wurde.
„Nein“, gab ich knapp zurück, wohlwissend, dass der Inspektor Vorgeplänkel liebte und andere Leute gerne in fruchtlose Diskussionen verwickelte, bevor er zum eigentlichen Thema kam.
Er sah mich kurz an und bestellte einen Kaffee. „Mit dem falschen Fuß aufgestanden?“
So langsam verlor ich die Geduld.
„In was für eine geheime Operation sind wir reingeraten? Erklär mir bitte, was dieses Arschloch von Pellegrini da treibt! Er hat gerade eine Frau in Bern umgebracht und ist mal wieder verschwunden.“
Gemächlich ließ mein Gegenüber eine ganze Tüte braunen Zucker in seine Tasse rieseln.
„Ich weiß genauso wenig wie du, Buratti. Die sagen mir nichts. Und sie geben mir ständig Anweisungen, die für mich keinen Sinn ergeben.“
„Dann organisier ein Treffen mit der bösen Hexe“, erwiderte ich entnervt, „und dieses Mal nicht im Präsidium.“
„Bist du sicher, dass das eine gute Idee ist?“, hakte er nach und prüfte, ob der Löffel wirklich sauber war. „Die Marino will dir ans Leder. Sie zwingt dich dazu, für sie die Drecksarbeit zu machen, und anschließend lässt sie dich fallen.“
„Und das ist alles deine Schuld. Du hast erst zugelassen, dass sie mich in die Hand bekommt.“
„Ich sage es noch mal, ich bin der Letzte in der Kette und muss jedem gehorchen, der etwas zu sagen hat.“
„Und wieso habe ich den Eindruck, dass es dir am Ende wie mir ergehen wird. Du bist nicht gerade das Idealbild des braven Polizisten.“
„Solange ich eine gewisse Grenze nicht überschreite, bin ich sicher, und mir passiert nichts.“
„Diesen Schwachsinn glaubst du ja selber nicht.“
Er trank seinen Kaffee, kratzte den Zucker vom Tassenboden und saugte ihn vom Löffel.
„Dich kennengelernt zu haben, das war scheiße.“
„Komm, du hattest dir mit deinen Aktionen die Karriere bereits vorher versaut.“
„Es ist eben kein leichter Beruf.“
„Fällt mir schwer, das nachzuvollziehen.“
„Weil du ein Scheißkrimineller bist. Ich hätte dich gleich beim ersten Zusammentreffen ins Gefängnis stecken sollen.“
Ich seufzte, wenngleich das Schmierentheater für dieses Mal vorbei war, denn der Inspektor stand auf und verließ die Bar, um zu telefonieren.
„Die Marino trifft sich morgen zur gleichen Zeit hier mit dir“, sagte er, als er wieder hereinkam, und wandte sich an die Frau hinter der Theke. „Er zahlt.“
Mit diesen Worten verließ er grußlos die bescheidene Bar.
Campagna schien alles andere als glücklich, dass er mit Angela Marino zu tun hatte. Mir ging es nicht anders, aber die Chance, klammheimlich aus der Geschichte zu verschwinden, gab es seit Bern nicht mehr, und jetzt mussten wir nach den Vorgaben dieser gefährlichen Beamtin tanzen.
Kaum hatte ich die Bar verlassen, schlug mir eisige Kälte entgegen. Auf meinem Weg zum Auto beneidete ich den Inspektor um seinen Parka. Meine alte lederne Fliegerjacke war nicht die passende Bekleidung für so ein Wetter, und ich war froh, dass die Heizung in meinem Škoda Felicia, die auf osteuropäische Temperaturen ausgelegt war, sofort Abhilfe schuf. Ich schaltete die teure Hi-Fi-Anlage an, die den Wert des Autos bei Weitem überstieg, und lauschte der Stimme von Beth Hart, die Baddest Blues sang, während ich mich durch die Stadt quälte. Wie üblich dauerte es eine Weile, bis ich auf dem Corso Milano einen Parkplatz gefunden hatte, wo ich mir mit Max eine Wohnung teilte, in der immer häufiger auch Beniamino übernachtete.
Zur Zeit des Ausverkaufs stürmten die Paduaner nämlich die Geschäfte wie eine Horde Barbaren und verstopften regelmäßig die Parkplätze der Innenstadt. Und sobald die Stadt ins Shoppingdelirium fiel, füllten sich die Bars ebenfalls mit Kunden, die ihre erworbenen Schätze wie Trophäen in die Luft reckten.
Eine Studie, die kürzlich auf der Basis von Emoticons über den Gefühlszustand der Internetnutzer erstellt worden war, hatte ergeben, dass Padua eine der traurigsten Städte Italiens sei. Das glaubte ich gerne. Padua war schön, das schon, bequem wie ein alter Pantoffel, doch in den letzten Jahren hatte die Stadt leider jene Lebhaftigkeit verloren, die sie in der Vergangenheit so spannend gemacht hatte.
Padua sterbe, ertrinke in Verboten und einem sinnlosen Ordnungs- und Sauberkeitswahn, hieß es in einem Rap von Massima Tackenza. Das hatte dem Bürgermeister gar nicht gefallen, und ein Sondereinsatzkommando der Polizei war bei den jungen Rappern aufgetaucht, um mit ihnen über die Rechtmäßigkeit ihrer Kritik zu sprechen. Das Stadtoberhaupt hatte sich sogar eine Pistole gekauft und seine Bereitschaft erklärt, auf den erstbesten Dieb zu schießen, der in sein Haus einzubrechen versuchte. Obwohl er sich mit solchen Parolen zur Selbstverteidigung zusätzliche Wählerstimmen versprochen hatte, verlor er die Mehrheit, und seit ein paar Monaten wurde Padua bis zu den notwendigen Neuwahlen von einem Übergangsbürgermeister regiert.
Der alte Rossini saß perfekt gekleidet auf einem Sessel im Wohnzimmer und las die Zeitung.
„Campagna war keine große Hilfe, morgen treffe ich die Marino.“
„Da bist du nicht zu beneiden“, bemerkte er trocken und tippte sich ans Ohr. „Hörst du dieses nervige Summen?“
Ich konzentrierte mich. „Ja, was ist das?“
„Das Schwergewicht hat sich entschlossen, ein paar Pfund loszuwerden.“
Als ich an seinem Zimmer vorbeiging, sah ich Max in einem niegelnagelneuen Trainingsanzug. Er saß auf einem Hometrainer, und seine Füße, die in neuen Turnschuhen steckten, traten schwerfällig in die Pedale. Ich tat so, als würde ich sein feuerrotes, schweißglänzendes Gesicht gar nicht bemerken.
„Spar dir jeden Kommentar“, keuchte er.
„Okay.“
„Falls ich in den Knast muss, will ich wenigstens einigermaßen fit sein.“
„Musst du nicht.“
Er senkte den Blick auf die Lenkstange und verstärkte seine Anstrengungen, während ich ins Wohnzimmer zurückkehrte.
„Es macht mich traurig, ihn so zu sehen.“
„Die Schweiz war ein schwerer Schlag für ihn. Er hat sich immer noch nicht davon erholt.“
Ich genauso wenig, dachte ich und riss eine neue Packung Zigaretten auf.
Eine halbe Stunde später kam Max ins Zimmer. Er trug jetzt einen Frotteebademantel und hielt einen frisch gepressten Obst- und Gemüsesaft in der Hand. Als er einen Schluck nahm, wirkte er wie ein kleiner Junge, der seinen täglichen Löffel Lebertran schlucken muss. Unwillkürlich brachen Rossini und ich in Gelächter aus.
„Aperitif auf der Piazza und dann ins Fischrestaurant in Punta Sabbioni“, schlug Beniamino vor.
Auf Max’ Gesicht machte sich Erleichterung breit. „Fein, ich ziehe mich an.“
Am nächsten Morgen stand ich früh auf. Nach einer Zigarette und einem Kaffee begann ich mich ruhig und bedächtig zu rasieren. Allein das Aufschäumen der Seife war ein Ritual. Ich musste ein letztes Mal meine Gedanken sortieren, bevor ich Dottoressa Marino gegenübertrat.
Im Radio hörte ich, dass es in Mittel- und Süditalien schneite und dass unter dem Schnee die Erde bebte. Wie üblich in solchen Katastrophenfällen zeigte Italien, was es gut konnte und was gar nicht. In Padua strahlte trotz Eiseskälte zum Glück die Sonne. Auf dem Weg zur Bar hielt ich an einem Geschäft an, das unglaubliche Rabatte versprach, um mir etwas Wärmeres als meine alte Jacke zu kaufen.
„Parkas sind wieder im Kommen“, sagte eine junge Verkäuferin und warf mir einen komplizenhaften Blick zu.
Offenbar hatten sie mein Look und mein geschätztes Alter davon überzeugt, dass ich seinerzeit bei der Protestbewegung dabei gewesen sein musste.
Ich schüttelte den Kopf, so nostalgisch war ich nun wieder nicht. Stattdessen griff ich nach einer blauen Winterjacke in einer gedeckten Farbe und besonders dick gefüttert.
„Die nehme ich“, erklärte ich und ging zur Kasse.
Einige Meter von der Bar entfernt fand ich einen Parkplatz, und auf dem Weg dorthin kam ich an einer frisch gewaschenen Limousine mit Fahrer vorbei, die zweifellos zu Dottoressa Marino gehörte.
Als ich den Laden betrat, nickte mir die Besitzerin zu und deutete verstohlen auf einen verdeckten Tisch, an dem die Karrieristin aus Rom, der Inspektor und ein etwas jüngerer Polizist saßen. Letzterer erhob sich und kam mir entgegen. Er hatte das Gesicht eines netten Jungen, aber einen tückischen Blick. Mit anderen Worten: Er war ein Schwein.
„Lass dich durchsuchen, mein Guter“, flüsterte er mit kalabrischem Akzent.
Demonstrativ hob ich die Arme und machte die Beine breit.
„Lass den Quatsch, kein Grund, hier aufzufallen“, zischte er und tastete mir diskret die Körperseiten ab.
„Dass ihr Bullen seid, weiß längst das ganze Viertel.“
Angela Marino seufzte: „Lassen Sie es gut sein, Sovraintendente Marmorato, unser Freund Buratti ist nie bewaffnet, dazu hat er nicht den Mumm.“
Sie musterte mich, während ich mich setzte.
„Ganz im Gegensatz zu Beniamino Rossini, der sich mit jedem brüstet, den er umgebracht hat, und dafür einen Armreif trägt“, spottete sie. „Es ist noch nicht zu spät, ihn für die alten Sachen hinter Gitter zu bringen.“
Ihre Stimme hatte einen angenehmen Klang, was es noch schwerer machte, ihre hinterhältigen Sprüche zu ertragen. Ich sah zu Campagna hinüber, der unmerklich den Kopf schüttelte, um mir zu signalisieren, dass ich lieber die Klappe halten sollte. Es war das zweite Mal, dass ich diese Hyäne traf, und mir war sehr wohl bewusst, dass sie mich mit allen Mitteln zu provozieren versuchte, um mir klarzumachen, wer hier der Chef im Ring war.
Wie beim ersten Mal hatte sie die Haare zu einem Pferdeschwanz gebunden, vielleicht war das ja ihre Arbeitsfrisur, oder sie wollte auf jugendlich machen. An ihren Ohrläppchen baumelten zwei goldene Kreolen mit Aquamarinen.
„Du bist gerade noch rechtzeitig aufgetaucht, bevor ich die Geduld verloren hätte“, eröffnete sie das Gespräch und trank einen Schluck Wasser. „Ich habe für dich und deine Freunde drei Kilo Kokain ad acta gelegt, die ich jederzeit als Beweismittel wieder hervorzaubern kann, wann und wo ich will. Weißt du, wie lange man dafür in den Knast geht? Mindestens fünfzehn Jahre, wenn ich die zuständige Staatsanwaltschaft entsprechend instruiere.“
„Wir haben Pellegrini gesucht“, unterbrach ich sie.
„Ich weiß. Er hat es mir erzählt. Übrigens ist er überzeugt, dass ihr ihn umbringen wollt.“
Sieh mal einer an, der schöne Giorgio und die schöne Angela hatten einen direkten Draht zueinander, dachte ich, ohne mir etwas anmerken zu lassen.
„Pellegrini täuscht sich“, protestierte ich mit gespielter Empörung. „Wir wollten lediglich mit ihm reden, um herauszufinden, wer noch eine Rechnung mit ihm offen hat, die hoch genug ist, um Martina und Gemma auf so grauenvolle Weise umzubringen. Leider ist die Liste der Leute, die infrage kommen, ziemlich lang.“
„Quatsch. Ihr wolltet ihn töten und dann verschwinden.“
Ich versuchte das Thema zu wechseln: „Hat Pellegrini Ihnen eigentlich gesagt, dass er Lotte Schlegel umgebracht hat, die Frau, bei der er in Bern wohnte?“
„Giorgio hat damit nichts zu tun, wahrscheinlich waren das die gleichen Typen, die seine Frau und die Freundin auf dem Gewissen haben.“
„Nein, das war er.“
„Vielleicht seid ihr es ja gewesen?“
Abwehrend hob ich die Hände. „Reicht es Ihnen nicht, dass Sie uns jederzeit wegen Drogenhandels drankriegen können?“
„Es geht anders besser“, konterte sie mit zynischem Lächeln.
Ich tat so, als ob ich kapitulieren würde. „Okay, was sollen wir machen?“
„Im Fall der Morde an Martina und Gemma ermitteln.“
„Und warum? Ist da nicht die Mordkommission dran?“
„Nun, ich bin mir sicher, dass ihr mit euren Kontakten im Milieu mehr Chancen habt, die Schuldigen zu finden.“
„Stimmt, aber Sie haben nicht auf meine erste Frage geantwortet.“
Angela Marino stand auf, Marmorato ebenfalls. „Von jetzt an toleriere ich keine Spielchen mehr“, beschied sie mich mit eiskalter Stimme. „Ispettore Campagna wird euch die entsprechenden Informationen geben.“ Sie ging ein paar Schritte, bevor sie sich noch einmal umwandte. „Ich habe meine Kontakte bei Interpol spielen lassen, um mir eine Vorstellung davon zu verschaffen, mit wem ihr in Slowenien und Kroatien Kontakte unterhaltet. Die Behörden vor Ort haben kollaboriert, und in Zukunft wird es für euch nicht leicht sein, dort unterzutauchen. Flucht ist keine Option mehr, Buratti. Vielleicht solltest du dich mit der Vorstellung vertraut machen, mir nach der Lösung des Falls Rossini auszuliefern, sozusagen im Tausch gegen deine eigene Freiheit. Deine und die von diesem Wrack Max, dem sogenannten Gehirn.“
„Die drei Kilo Kokain sind mehr als genug, um Ihr Ziel zu erreichen. Dafür brauchen Sie mich nicht.“
„Du könntest Rossini für jeden seiner Armreife ans Messer liefern.“
„Sie irren sich, zudem würde ich mich darauf niemals einlassen.“
„O doch. Am Anfang tut ihr noch so, als wärt ihr harte Männer, aber wenn es darum geht, einem armseligen Leben im Knast zu entkommen, dann würdet ihr jeden verraten.“
„Dann ist es also Ihr erklärtes Ziel, Rossini reinzureiten?“
„Nicht das wichtigste natürlich. Wenn wir allerdings schon dabei sind, warum die Gelegenheit nicht nutzen? Giorgio wird wegen ein paar Morden aussagen, bei denen er dabei war, und du bei den anderen.“
Plötzlich verstand ich. „Es war Pellegrinis Idee, Rossini in den Knast zu bringen, oder?“
„Er hat es in die Verhandlungen eingebracht. Euch mit ins Boot zu holen gibt uns die Möglichkeit, die kriminellen Machenschaften eurer Bande für immer zu beenden.“
„Wir sind keine Bande.“
„Eine Meinung, die sicher das Interesse des Schwurgerichts wecken wird“, kanzelte sie mich ab und wechselte einen belustigten Blick mit ihrem Assistenten Marmorato.
„Es gibt noch eine Sache, die ich nicht verstehe, Dottoressa.“
„Beeil dich, ich habe zu tun.“
„Sie verlangen, dass wir uns einer Erpressung beugen, die es eigentlich gar nicht geben darf. Und am Ende wollen Sie uns ungeachtet unserer Kooperation reinreiten. Erklären Sie mir bitte, was wir von der ganzen Sache haben.“
„Wach auf, Buratti. Das ist ein Wettkampf darum, wer seinen Arsch am teuersten verkauft“, gab sie gereizt zurück, als ob sie mit einem Schwachsinnigen sprechen würde. „Beweis mir, dass du zu allem bereit bist, um die Justiz zu unterstützen, dann wirst du eine Chance bekommen, deinen Kopf aus der Schlinge zu ziehen.“
Damit drehte sie sich um, gefolgt von Marmorato. Die Dottoressa hatte es nicht an Deutlichkeit fehlen lassen.
Ich packte Campagnas Handgelenk. „Wie kommt es, dass du uns nicht mit deinen üblichen flotten Sprüchen erfreut hast, während diese Kuh bereits unsere Särge ausgemessen hat?“
Der Inspektor löste sein Handgelenk aus meiner Umklammerung, er war blass geworden. „Übertreib’s nicht, Buratti.“
„Du hast verdammt noch mal nicht das Geringste kapiert“, fauchte ich ihn an. „Es wird dir rein gar nichts nützen, bei ihr zu schleimen und dich anzubiedern. Du wirst genauso wie ich in der Kategorie der Opfer und Abgehalfterten enden.“
„Du vergisst, dass ich wie sie Staatsbeamter bin.“
„Meinst du, das sieht sie so? Sie spielt in der Oberliga, und du bist für sie ein Nichts. Sie verachtet dich und wird dich das Klo runterspülen, wenn du für sie nicht mehr nützlich bist.“
„Du hast eine merkwürdige Fantasie“, sagte er gekränkt und stand auf. Aus der Jackentasche zog er eine CD. „Das ist die Kopie der Ermittlungsakten des Doppelmords. Gestern aktualisiert.“
„Und du glaubst wirklich, sie würde dich vor Gericht aussagen lassen, dass du mir die Akten in ihrem Auftrag übergeben hast?“
„Vielleicht spiele ich ihr Spiel mit, vielleicht weiß ich einfach nicht, was ich sonst tun soll, weil keiner meiner Kollegen einen Finger krümmen würde, um mich gegen diese Giftschlange zu verteidigen.“