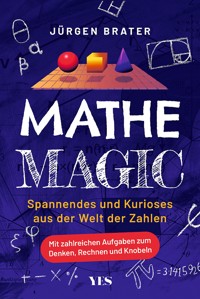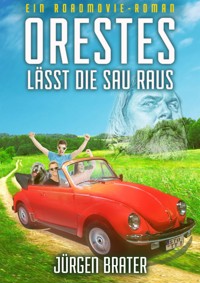14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Herbig, F A
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
Eine faszinierende Entdeckungsreise! Für unser Leben so unverzichtbar wie keine andere Flüssigkeit: unser Blut. Dr. Brater nimmt uns mit auf eine Expedition in unseren Körper. Was ist Blut eigentlich? Warum fließt es und wohin? Wie kommen Bluthochdruck, Anämie, Leukämie und Gerinnungsstörungen, Herzinfarkt und Schlaganfall zustande? Was ist eine Blutvergiftung? Er zeigt, wie Blut jede einzelne unserer rund 100 Billionen Zellen mit allem Notwendigen versorgt, wie es dafür sorgt, dass uns immer wohlig warm ist, wie es uns vor dem Angriff skrupelloser Mikroben schützt und mittels eines raffinierten Systems Informationen zwischen den entferntesten Organen hin- und herschickt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 387
Veröffentlichungsjahr: 2016
Ähnliche
Die Ratschläge in diesem Buch wurden vom Autor und dem Verlag sorgfältig geprüft, dennoch kann keine Garantie übernommen werden. Jegliche Haftung des Autors bzw. des Verlags und seiner Beauftragten für Gesundheitsschäden sowie Personen-, Sach- und Vermögensschäden ist ausgeschlossen.
Besuchen Sie uns im Internet unter
www.herbig-verlag.de
© für die Originalausgabe und das eBook: 2016 F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten
Umschlaggestaltung und Illustrationen: Jera Kokovnik
eBook-Produktion: VerlagsService Dietmar Schmitz GmbH, Heimstetten
ISBN 978-3-7766-8253-3
INHALT
Einleitung
TEIL 1WAS BLUT IST:Zusammensetzung unseres Superorgans
Das Flüssige: Blutplasma und -serum
Das Feste: Die berühmten Körperchen
Die roten Drops: Erythrozyten und Blutfarbstoff
Power spritzen: Blutdoping mit Epo
Die weißen Kämpfer: Leukozyten
Die Scheibchen mit den Ärmchen: Thrombozyten
Blut ist nicht gleich Blut: Blutgruppen und Rhesusfaktor
Die roten Blutkörperchen machen den Unterschied: Das AB0-System
Manchmal ist weniger mehr: Bluttransfusion
Alimente ja oder nein?: Vaterschaftstest
Wenn die Mutter ihr Kind bedroht: Rhesusunverträglichkeit
TEIL 2WAS BLUT KANN:Aufgaben unseres Superorgans
Blut fließt: Blutkreislauf und Blutdruck
Überall »Adern«: Arterien, Venen, Kapillaren
Bleich und zart: Lymphgefäße
Hohler Muskel: Das Herz
Eine Runde nach der anderen: Blutkreislauf
Giftiges unschädlich gemacht: Pfortaderkreislauf
Regelmäßig messen!: Blutdruck
Immer schön im Rahmen bleiben!: Blutdruckregelung
Blut befördert: Transportfunktion
Brennstoff für die Zellen: Nähr- und Sauerstofftransport
Weg mit dem Müll: Abfallentsorgung
Chemische Stoffe unter Zwang: Harnpflicht
Bloß nicht zu süß!: Blutzucker
Blut wird fest: Blutgerinnung
Weil’s schnell gehen muss: Primäre Blutstillung
Weil’s dicht bleiben soll: Sekundäre Blutgerinnung
Gerinnung allein genügt nicht: Wundheilung
Blut heizt und kühlt: Thermoregulation
Wenn wir frieren: Wärmeerzeugung
Wenn’s uns zu warm wird: Kühlmechanismen
Blut kämpft: Immunsystem
Extrem fremdenfeindlich: Unspezifische Abwehr
In aller Munde: Entzündung
Gezielter Kampf gegen bekannte Feinde: Spezifische Abwehr
Eine Krankheit vergessen können: Impfung
Blut gleicht aus: Säure-Basen-Haushalt
Nicht zu sauer, nicht zu basisch: pH-Wert
Blut informiert: Nachrichtenübermittlung
Langsam, aber zuverlässig: Hormone
Fight or Flight: Stress
Blut gibt Auskunft: Blutuntersuchung und -diagnose
Künstlerisch wertvoll: Blutbild
Was Blut sonst noch verrät: Aktuelle Forschungsergebnisse
Dem Mörder auf der Spur: Blut im Fokus der Kriminalistik
TEIL 3WENN’S SCHIEFLÄUFT:Blut- und Kreislaufkrankheiten
Anämie: Wenn Sauerstofftransporter fehlen
Wenn’s am Eisen hapert: Eisenmangelanämie
Wenn zu wenige Erythrozyten unterwegs sind: Hämolytische Anämie
Wenn andere Leiden schuld sind: Anämie bei chronischer Erkrankung
Wenn das Knochenmark schwächelt: Aplastische Anämie
Leukämie: Wenn weiße Blutzellen wuchern
Bei Kindern am häufigsten: Akute lymphatische Leukämie (ALL)
Bevorzugt Ältere: Akute myeloische Leukämie (AML)
In Europa am häufigsten: Chronische lymphatische Leukämie (CLL)
Ursache bekannt: Chronische myeloische Leukämie (CML)
Gerinnungsstörungen: Wenn’s zu stark blutet
Wenn’s an Blutplättchen mangelt: Thrombozytopenie
Wenn’s an Gerinnungsfaktoren hapert: Bluterkrankheit
Wenn ein Rädchen im Getriebe fehlt: Willebrand-Jürgens-Syndrom
Sepsis: Wenn sich im Blut Erreger tummeln
Bluthochdruck: Das Volksleiden Nummer eins
Dampf ablassen: Blutdrucksenker
Arteriosklerose: Wenn sich das Blut staut
Herzinfarkt: Wenn ein Teil der Pumpe stirbt
Schlaganfall: Wenn das Gehirn Mangel leidet
Schock: Wenn Blut fehlt
TEIL 4WAS WIR TUN UND LASSEN SOLLTEN:Leben, wie es Herz und Kreislauf gefällt
Optimismus: Zuversichtliche Menschen sind gesünder
Gesundes Vergnügen: Lachen
Kann man lernen: gute Laune
Entspannung: Damit der tägliche Stress nicht schadet
Chillen auf Kommando: Entspannungsübungen
Power durch Nichtstun: gesunder Schlaf
Blutdruck senken mit den Ohren: Musik
Ernährung: Nicht alles, was uns schmeckt, tut uns gut
Am besten lange Ketten: Kohlenhydrate
Ein Plädoyer für Fleisch: Proteine
Die richtigen sollten es sein: Fette
Verteufelt, aber unentbehrlich: Cholesterin
Wenig hilft viel: Vitamine und Mineralstoffe
Wieviel wovon?: Ernährungspyramide
Rauchen: Genuss zu einem hohen Preis
Alkohol: Allzu viel ist ungesund
Bewegung und Sex: Kann nie schaden
Am besten mäßig, aber regelmäßig: Ausdauersport
Feuerwerk der Hormone: Sex
Noch kurz zum Schluss
Quellen
Register
EINLEITUNG
»Blut ist ein ganz besonderer Saft« – der das gesagt hat, war kein Geringerer als der gute alte Mephisto und damit sein Schöpfer Goethe, und zwar schon Anfang des 19. Jahrhunderts. Zu einer Zeit also, da der Dichterfürst noch nicht annähernd so viel Ahnung von Biologie, Physiologie und Medizin haben konnte wie wir heute. Und dennoch war ihm klar, dass die rote Flüssigkeit, die unseren Körper pausenlos vom kleinen Zeh bis zu den Hinterkopf-Haarbalgzellen durchströmt, etwas ganz Besonderes ist. Eine Flüssigkeit, die für unser Leben so unverzichtbar ist wie keine andere, Erdöl – wobei Goethe daran wohl kaum gedacht hat –, Alkohol und Wasser eingeschlossen.
Wasser, werden Sie jetzt fragen? Wieso Wasser? Schließlich weiß jedes Kind, dass wir ohne Wasser nur kurze Zeit existieren können, dass wir darauf im Gegensatz zu fester Kost absolut angewiesen sind. Das stimmt natürlich. Aber ohne Blut würde das Wasser, das wir oben in uns hineinschütten, unten ruckzuck wieder herauslaufen. Es würde Speiseröhre, Magen, Dünn- und Dickdarm wie in einem gewundenen Bach durchfließen und aus dem Allerwertesten wieder so heraussprudeln, wie wir es in den Mund hineingekippt haben. Erst das Blut macht das Wasser für uns nutzbar und wertvoll.
Und obwohl das jeder weiß, gibt es doch nicht wenige Zeitgenossen, die die klebrige rote Flüssigkeit »nicht sehen können«, ja, denen es regelrecht schlecht wird, wenn Blut aus einer Wunde, aus der Nase oder beim Zähneputzen aus dem Mund tropft. Sogar gestandene Männer kippen um, wenn sie die wichtigste Flüssigkeit der Welt zu Gesicht bekommen. Schon der bloße Anblick einer Spritze kann solchen Menschen – Männern ebenso wie Frauen – extrem zusetzen. Ich hatte einen Studienfreund, der später Chirurg wurde, dem machte es gar nichts aus, das Blut anderer Menschen zu sehen, aber wenn es um sein eigenes ging, verdrehte er die Augen und musste ganz schnell an die frische Luft.
Nun kann man natürlich einwenden, das sei doch durchaus verständlich, schließlich sei ja immer etwas faul, wenn man irgendwo Blut sehe. Normalerweise fließe das ja innerhalb des Körpers im Kreis herum und habe außerhalb nichts verloren. Das stimmt sicher, aber dennoch ist Blut keinesfalls unappetitlich. Von seiner Farbe und Klebrigkeit her gleicht es rotem Lack, und den kann doch schließlich auch jeder anschauen, ohne dass ihm davon übel wird.
Wie kann man sich eine solche »Blutphobie« – so nennen Mediziner das merkwürdige Phänomen – erklären? Dazu gibt es verschiedene Theorien. So gehen einige Biologen davon aus, dass betroffene Eltern die heftige Reaktion auf den Anblick von Blut ihren Kindern, bewusst oder unbewusst, regelrecht anerziehen. Dafür spricht, dass die übersteigerte Angst in manchen Familien auffällig häufig vorkommt, während sie in anderen vollkommen unbekannt ist. Für wahrscheinlicher halte ich allerdings die Auffassung, dass die familiären Häufungen Zufall sind und die krankhafte Abneigung gegen den »ganz besonderen Saft« auf unsere steinzeitliche Vergangenheit zurückgeht und bis heute fest in unseren Genen verankert ist. Seinerzeit war der Mensch ganz anderen Gefahren als heute, etwa durch wilde Tiere, ausgesetzt, von denen nicht wenige gerade durch den Geruch von Blut angezogen wurden. Verständlich, dass unsere Körperflüssigkeit den damaligen Menschen Angst und Schrecken einjagte. Und für den Homo erectus hatte es sogar einen ganz konkreten Vorteil, wenn er beim Anblick seines Blutes in Ohnmacht fiel: Dadurch sank automatisch sein Blutdruck, was wiederum weniger Blut fließen ließ und so die Gerinnung erleichterte.
Wie dem auch sei, fest steht, dass auch Blutphobiker auf das, was ihnen so große Angst macht, angewiesen sind wie auf nichts sonst. Blut ist eine ungemein faszinierende Flüssigkeit mit einer Vielzahl unterschiedlichster Fähigkeiten. Es ernährt, hält warm, befördert alles Mögliche, übermittelt Nachrichten und bekämpft gefährliche Krankheitserreger, um nur die wichtigsten Eigenschaften zu nennen.
Das sollte doch Grund genug sein, sich einmal intensiver mit unserem Superorgan zu beschäftigen. Folgen Sie mir deshalb auf eine faszinierende Entdeckungsreise, die uns im wahrsten Sinne bis in die entlegensten Winkel unseres Körpers führt. Ich möchte Ihnen erzählen, was Blut eigentlich ist, warum und wohin es fließt und wieso es das erstaunlich schnell nicht mehr tut, wenn wir uns verletzen. Ich möchte Ihnen zeigen, wie der rote Saft jede einzelne unserer rund 100 Billionen Zellen mit allem Notwendigen beliefert, wie er dafür sorgt, dass uns immer wohlig warm ist, wie er uns vor dem Angriff skrupelloser Mikroben schützt und mittels eines raffinierten Systems Informationen zwischen den entferntesten Organen hin- und herschickt. Ich möchte Ihnen erläutern, was es mit Bluthochdruck, Anämie, Leukämie und Gerinnungsstörungen auf sich hat, wie Herzinfarkt und Schlaganfall zustande kommen und warum eine Blutvergiftung, eine sogenannte »Sepsis«, so oft zum Tod führt. Und nicht zuletzt möchte ich Ihnen Tipps geben, wie Sie durch Ihr eigenes Zutun Blut, Herz und Kreislauf möglichst bis ins hohe Alter fit und leistungsfähig halten können.
Ich verspreche Ihnen, dass Sie nach der Lektüre dieses Buches etliches wissen, was Ihnen bisher unbekannt war, dass Sie vieles anders sehen und – das würde mich freuen – einiges vielleicht auch anders machen werden. Und wenn Sie danach die komplizierten Begriffe, mit denen Ihr Arzt um sich wirft, auch noch ein bisschen besser verstehen würden, wäre das ja auch nicht schlecht.
Also, legen wir los!
TEIL 1WAS BLUT IST:Zusammensetzung unseres Superorgans
Unser Blut macht etwa 8 Prozent unseres Körpergewichts aus. In einem 80 Kilo schweren Mann fließen also rund 6,5 Liter, während es bei einer 60 Kilo schweren Frau nicht einmal ganz 5 Liter sind. Allerdings ist dieser Wert nicht konstant, vielmehr steigt die Blutmenge, wenn wir viel trinken oder etwa Salzheringe essen, da Salz im Blut Wasser an sich bindet. Umgekehrt verlieren wir bei ausdauernder körperlicher Anstrengung reichlich Schweiß, wodurch das Blut eindickt wie eine länger gekochte Soße und dadurch deutlich weniger wird. 1,5 Liter Abweichung vom Normalwert kann so etwas locker ausmachen. Daneben gibt es aber noch eine Reihe krankhafter Ursachen für zu viel oder zu wenig Blut, die uns noch beschäftigen werden.
Chemisch gesehen ist Blut eine Suspension, das heißt, eine Flüssigkeit mit darin herumschwimmenden festen Bestandteilen, etwa so wie frisch gepresster Orangensaft mit seinen Fruchtfleischfetzen. Allerdings verhält es sich, wenn es fließt, ganz anders als Fruchtsaft. Denn auf den kann man Druck ausüben, man kann ihn umrühren oder schütteln, er bleibt doch immer derselbe. Blut dagegen benimmt sich, sobald es unter Druck gerät, wie Ketchup. Wenn das, zäh wie es ist, nicht aus der Flasche will, muss man die nur ein Weilchen schütteln, und schon ergießt sich die rote Soße willig auf den Teller. Physiker nennen so etwas eine »nicht-Newton’sche Flüssigkeit«, und eine solche ist auch Blut. Je stärker es unter Druck gerät, desto dünnflüssiger wird es und kann so auch feinste Äderchen passieren. Das liegt vor allem daran, dass die roten Blutkörperchen elastisch sind wie Gummibärchen. Haben sie reichlich Platz, bleiben sie kreisrund, wird es um sie herum jedoch so eng, dass sie an die Gefäßwand anstoßen, machen sie sich ganz dünn und flutschen wie Öltropfen auch durch die schmalsten Lücken.
Oft wird Blut als »flüssiges Organ« bezeichnet, und ich finde, das trifft die Sache ganz gut. Denn während man ein Team identischer Zellen mit gleichartiger Funktion Gewebe nennt, versteht man unter einem Organ ganz allgemein einen Körperteil, der aus verschiedenen Geweben besteht, die bei der Erledigung bestimmter Aufgaben sinnvoll zusammenarbeiten. Und genau das ist beim Blut der Fall. Zwar ist das kein zusammenhängendes Gebilde, aber davon ist in der Definition ja auch nicht die Rede.
In der medizinischen Fachsprache trägt fast alles, was mit Blut zu tun hat, den Wortbestandteil »hämat-« »häm-« oder kurz »äm-«. Der leitet sich vom griechischen Wort »haima« für Blut ab. Deshalb heißt die Lehre vom Blut, von der dieses Buch handelt, fachlich korrekt »Hämatologie«. »Anämie« bedeutet, wörtlich übersetzt, »kein Blut«, während »Hyperämie« – »hyper-« heißt »vermehrt« – ein Zuviel davon, also eine Blutfülle, bezeichnet. Die Bluterkrankheit etwa nennt der Mediziner »Hämophilie«, wobei der Wortbestandteil »phil« – im Gegensatz zu »phob« – eine Neigung bezeichnet, und »Leukämie«, dessen erste Silbe »leuk-« »weiß« bedeutet, kann man mit »Weißblütigkeit« übersetzen. Schließlich ist das entscheidende Kennzeichen dieser üblen Krankheit, auf die wir noch ausführlich zu sprechen kommen, ein Viel-zu-viel an weißen Blutkörperchen, den Leukozyten.
Und was versteht man dann unter »Hämaturie«? Richtig: Blut im Urin, wobei es, genau genommen, nur um darin vorkommende rote Blutkörperchen geht.
Medizinische Fachbegriffe rund ums Blut
Anämie
Mangel an roten Blutkörperchen
Arterie
Blutgefäß, das Blut vom Herzen wegleitet
Arteriole
kleinste Arterie
Dialyse
Blutwäsche außerhalb des Körpers
Embolus
verschlepptes Blutgerinnsel
Epistaxis
Nasenbluten
Erythrozyt
rotes Blutkörperchen
Granulozyt
Unterform der weißen Blutkörperchen
Hämangiom
Blutgeschwulst
Hämarthros
Bluterguss in ein Gelenk
Hämatemesis
Bluterbrechen
Hämatokrit
Anteil der Zellen am Blutvolumen
Hämatologie
Lehre vom Blut
Hämatom
Bluterguss
Hämatopoese
Blutbildung
Hämatorrhoe
starke Blutung
Hämaturie
Blut im Urin
Hämodilution
Blutverdünnung
Hämodynamik
Lehre von der Physik des Blutkreislaufs
Hämoglobin
Blutfarbstoff
Hämogramm
Blutbild
Hämolyse
Auflösung von Erythrozyten
Hämophilie
Bluterkrankheit
Hämoptyse
Bluthusten
Hämorrhagie
Blutung
Hämorrhoiden
Blutgefäßknoten am After
Hämospermie
Blut im Sperma
Hämostase
Blutgerinnung
Hämostyptika
blutstillende Mittel
Hämozyt
Blutzelle
Hämozytoblast
Blutkörperchen-Stammzelle
Hyperämie
verstärkte Durchblutung
Hypertonie
zu hoher Blutdruck
Hypotonie
zu niedriger Blutdruck
Kapillare
Haargefäß, allerfeinstes Blutgefäß
Koagulum
Blutgerinnsel
Leukämie
Blutkrebs
Leukopenie
Mangel an weißen Blutkörperchen
Leukozyt
weißes Blutkörperchen
Leukozytose
Überschuss an weißen Blutkörperchen
Lymphozyt
Unterform der weißen Blutkörperchen
Monozyt
Unterform der weißen Blutkörperchen
Plasma
Blutflüssigkeit
Retikulozyt
unreifes rotes Blutkörperchen
Sepsis
Blutvergiftung
Serum
Blutflüssigkeit ohne Gerinnungsfaktoren
Thrombopenie
Mangel an Blutplättchen
Thrombozyt
Blutplättchen
Thrombus
Blutgerinnsel innerhalb eines Gefäßes
Varize
Krampfader
Vene
Blutgefäß, das Blut zum Herzen hinleitet
Venole
kleinste Vene
Das Flüssige: Blutplasma und -serum
Die festen Bestandteile, die in der Suspension Blut herumschwimmen, sind die Blutzellen, die man drolligerweise auch »Körperchen« nennt. Sie machen circa 45 Prozent des Gesamtvolumens aus – den Wert nennt der Mediziner »Hämatokrit« –, die restlichen rund 55 Prozent – bei Frauen liegt der Wert eher bei 60 – sind flüssig und heißen Plasma. Das ist eine klare, gelbliche Flüssigkeit, die ein wenig an Hühnersuppe erinnert. Man gewinnt sie, indem man die zellulären Bestandteile mittels einer Zentrifuge entfernt, indem man also das Blut in sehr schnelle Umdrehungen versetzt, wodurch sich die schwereren Bestandteile außen absetzen. Plasma ist demnach frei von Blutkörperchen, enthält aber noch alle Substanzen, die dafür sorgen, dass es, etwa wenn wir uns geschnitten haben, aufhört zu bluten. Diesen Vorgang nennt man bekanntermaßen Gerinnung; auch er wird uns noch ausführlich beschäftigen.
Plasma – das ist zu rund 90 Prozent Wasser, den Rest bildet eine Fülle gelöster Substanzen, unter anderem rund 120 verschiedene Eiweißstoffe oder Proteine, Zucker, Harnstoff, Harnsäure sowie diverse Fette. Dazu Mineralien wie Calcium, Kalium und Natrium, und nicht zuletzt allerlei Botenstoffe, die berühmten Hormone. Auch mit denen werden wir uns noch näher befassen. Speziell aus den Proteinen gewinnt man eine Vielzahl hochwirksamer Arzneimittel, so etwa die Gerinnungsfaktoren zur Behandlung der Bluterkrankheit oder allerlei Antikörper gegen lebensbedrohende Infektionskrankheiten wie Hepatitis oder Tetanus.
Entfernt man die Gerinnungsfaktoren aus dem Plasma, erhält man Serum, das ebenfalls gelblich aussieht, da es Abbauprodukte der roten Blutkörperchen enthält. Für die medizinische Diagnostik sind darin vor allem eine Reihe gelöster Substanzen wichtig, deren Zuviel oder Zuwenig – das sind die berühmten »Laborwerte« – dem Arzt wertvolle Hinweise auf bestimmte Krankheiten liefern. Auch dazu später mehr.
Das Feste: Die berühmten Körperchen
Nicht ganz die Hälfte des Blutvolumens besteht also aus Zellen oder Blutkörperchen, wobei man grob rote, weiße und Plättchen unterscheidet. Gebildet werden sie samt und sonders im Knochenmark, und zwar im roten. Das findet sich bei Säuglingen noch im Inneren sämtlicher Knochen, verfettet aber – wie leider oft der ganze älter werdende Körper – im Lauf der Entwicklung vor allem in den langen Röhrenknochen immer mehr und wird dabei zum sogenannten »gelben Mark«. Weil das eine ziemlich schmierige, in jedem Fall aber träge und faule Masse ist, spielt sich die Blutbildung bei Erwachsenen fast nur noch in den flachen Knochen des Kopfes, des Beckens, der Rippen und der Wirbelkörper ab. Und selbst dort besteht fast die Hälfte des Knochenmarks aus nutzlosem Fett.
Dort aber, wo noch intaktes, gesundes Mark vorhanden ist, geht es voll zur Sache. In jeder einzelnen Sekunde entstehen dort sagenhafte zwei Millionen neue Blutkörperchen, wobei die roten mit fast 99 Prozent den weitaus größten Anteil ausmachen. Deshalb gibt der Hämatokrit, also der prozentuale Anteil der Zellen am Gesamtblutvolumen, im Grunde nur den Anteil roter Blutkörperchen an. Die anderen spielen praktisch keine Rolle. »Körperchen« statt »Zellen« heißen die festen Blutbestandteile übrigens, weil sowohl die roten als auch die Blutplättchen keinen Zellkern besitzen, und ohne Kern ist so ein winziges Gebilde eben keine richtige, teilungsfähige Zelle.
Ohne im Einzelnen auf die komplexen Vorgänge bei der Blutbildung einzugehen, sei nur so viel gesagt: Ganz am Anfang steht eine sogenannte »pluripotente Stammzelle«, wobei man »pluripotent« wohl am besten mit »zu Vielem fähig« übersetzt. Diese Urmutter aller Blutzellen teilt sich in zwei Töchter, die sich wiederum teilen und so weiter und so weiter. Das erinnert an die berühmte Geschichte von den Weizenkörnern auf dem Schachbrett, deren Anzahl sich von Feld zu Feld verdoppelt, bis auf dem Brett am Ende theoretisch tausend Mal mehr Körner liegen, als in einem Jahr auf der ganzen Welt geerntet werden. Nach 20 Teilungen haben wir es schon mit einer Million Blutzellen zu tun, wobei diese sich in verschiedene Richtungen entwickeln, aus denen letztlich die unterschiedlichen Blutkörperchen hervorgehen und ins strömende Blut abgegeben werden.
Bevor ich näher erläutere, wie die alle heißen und was sie den lieben langen Tag – und natürlich auch die liebe lange Nacht – so alles treiben, möchte ich einen Merkspruch aus Studententagen loswerden. Der klingt ein bisschen makaber, prägt sich aber vielleicht gerade deshalb so gut ein: »Theo lyncht Erich ganz mondän.« Daraus lassen sich – von der kleinsten bis zur größten – die Blutzellen ableiten, mit denen wir uns im Folgenden – wenn auch in anderer Reihenfolge – näher beschäftigen wollen: Thrombozyten, Lymphozyten, Erythrozyten, Granulozyten, Monozyten.
Die roten Drops: Erythrozyten und Blutfarbstoff
Ich weiß nicht, ob Ihnen der Begriff »Drops« etwas sagt, er scheint aus der Mode gekommen zu sein. Ich kenne ihn noch aus meiner Kindheit, und zwar in der Wortverbindung »Fruchtdrops«. Das waren kreisrunde Bonbons mit dickerem Rand beziehungsweise flacherem Inneren. Was das mit den roten Blutkörperchen zu tun hat? Nun, die sehen unter dem Mikroskop fast genauso aus. Dass sie im Zentrum von beiden Seiten eingedellt sind, hat den Vorteil, dass es die in ihnen enthaltenen Gase – Sauerstoff O2 beziehungsweise Kohlendioxid CO2 – bis zur begrenzenden Zellwand nicht weit haben und so viel schneller herausströmen können als aus einer kugelrunden Zelle. Mit bloßem Auge oder einer Lupe kann man rote Blutkörperchen nicht sehen, dazu sind sie viel zu klein. Gerade mal 0,75 µm, also nicht einmal einen Millionstel Meter oder Tausendstel Millimeter, messen sie im Durchmesser. Um einen einzigen Millimeter zu überbrücken, müssten sich nicht weniger als 140 von ihnen nebeneinanderlegen.
Mit dem Fachausdruck heißen die Drops »Erythrozyten«, was nichts anderes bedeutet als »rote Zellen«. Wer zeigen will, dass er Bescheid weiß, sagt nur lässig »Erys«, und da Sie, liebe Leser, ja mit jeder Seite, die Sie in diesem Buch lesen, immer mehr zu Durchblickern werden, lassen Sie uns fortan getrost auch dieses Kürzel benützen. Erys gibt es im wahrsten Sinne des Wortes wie Sand am Meer. Obwohl jeder einzelne, wie wir gesehen haben, unglaublich winzig ist, würden diejenigen eines Durchschnittsmannes – bei Frauen sind die Zahlen ein kleines bisschen weniger eindrucksvoll – nebeneinander gelegt eine Fläche von rund 3000 Quadratmetern bedecken. Man könnte mit ihnen also die Hälfte eines Fußballfeldes von der Toraus- bis zur Mittellinie belegen. Hintereinander aufgereiht wäre die Erythrozytenschlange eines einzigen Mannes sage und schreibe 190 000 Kilometer lang, würde also fast fünfmal um den Äquator reichen.
Wenn man sich das auch nur in etwa vorzustellen versucht, wundert man sich nicht, dass die enorme Neubildung von zwei Millionen pro Sekunde – die anderen Blutzellen können wir hier getrost außen vor lassen – gerade mal ausreicht, um den täglichen Abbau von einem Prozent, also jedem hundertsten Ery, wieder auszugleichen. Auch dazu ein hübscher Vergleich: Wäre jedes rote Blutkörperchen ein Grashalm, könnte man allein mit den an einem einzigen Tag neu gebildeten rund 1000 Fußballfelder begrünen.
Wozu wir derartige Wahnsinnsmengen brauchen? Nun, ihr einziger, aber ungemein wichtiger Job ist, Sauerstoff aus der Lunge zu den Zellen und Kohlenstoffdioxid von dort wieder zurück zu den Lungen zu transportieren. Die Aufgabe klingt nicht besonders anspruchsvoll, aber wenn man bedenkt, dass jeder von uns aus circa 100 Billionen Zellen besteht, die alle nach Sauerstoff schreien, sieht die Sache schon ganz anders aus. Die roten Kerlchen sind also pausenlos kreuz und quer in unserem Körper unterwegs, wobei ihr Tempo beachtlich ist: Gerade mal eine Minute brauchen sie, um mit dem Blutstrom eine volle Runde Lunge-Zelle-Lunge zu drehen. Also jede Minute Sauerstoff tanken, durch den Körper rasen, Sauerstoff abladen, Kohlenstoffdioxid aufnehmen, zurück zur Lunge sausen, das Kohlenstoffdioxid wieder gegen Sauerstoff tauschen und so weiter und so weiter.
Dass das ganz schön anstrengend ist, kann man sich vorstellen. Und so verwundert es nicht, dass die kleinen Flitzer nach fast 200 000 Umläufen fix und fertig sind und nur vier Monate nach ihrer Geburt schon wieder sterben und von frischen Kollegen ersetzt werden. Wobei sterben die Sache nicht ganz trifft. Vielmehr ist es so, dass sämtliche Erys auf ihren Runden durch den Körper immer wieder mal die Milz durchfließen, in der sich eine Art Kontrollinstanz befindet: Jede rote Blutzelle, die hier vorbeikommt, wird auf ihre Fitness abgecheckt und nur durchgelassen, wenn sie für gesund befunden wird. Ist sie dagegen altersbedingt starr geworden oder hat irgendwo eine Macke, wird sie gnadenlos ausgemustert. Warum man den Vorgang analog zum regelmäßigen Federwechsel der Vögel »Erythrozytenmauserung« nennt, habe ich allerdings nie begriffen.
Unsere Milz ist also gleichsam unser Eryschlacht- und -friedhof zugleich und scheint daher unverzichtbar zu sein. Doch das ist sie allenfalls bei Kindern. Wird sie etwa bei einem Unfall schwer verletzt oder im Gefolge einer inneren Erkrankung in Mitleidenschaft gezogen, kann man sie bei einem Erwachsenen getrost operativ entfernen. Dann erweisen sich andere Organe, in erster Linie die Leber, als freundliche Nachbarn, die sich zuverlässig um die Blutkörperchen-Entsorgung kümmern. Ganz risikolos ist der Eingriff allerdings nicht: Menschen ohne Milz werden deutlich häufiger Opfer brutaler Angriffe durch Bakterien oder Pilze. Auch spontane Blutgerinnungen mit der Gefahr gefährlicher Thrombosen, der Bildung von Blutpfropfen innerhalb der Gefäße, kommen bei ihnen signifikant öfter vor.
Doch zurück zum Gastransport. Zu diesem Zweck befinden sich in jedem einzelnen Ery rund 250 000 Moleküle des roten Blutfarbstoffs Hämoglobin. Damit diese gewaltige Menge in die winzigen Gesellen hineinpasst, stoßen sie kurz vor ihrer endgültigen Reifung im Knochenmark ihren Zellkern aus. Bis dahin hießen sie »Retikulozyten«, erst jetzt, also ohne Kern, sind sie ausgewachsene Erythrozyten. Auf den Zellkern können sie getrost verzichten, schließlich müssen sie sich nicht zwecks Vermehrung teilen. Nachschub wird ja reichlich im Knochenmark produziert, und zwar aus Ursprungszellen, sogenannten »Erythroblasten«.
Jedes einzelne Hämoglobinmolekül besteht seinerseits aus einem Proteinanteil, dem »Globin«, und einem komplexen Gebilde, dem »Häm«, in dem vier Eisenatome jeweils ein Sauerstoffmolekül an sich binden können. Dieses Eisen ist, nebenbei gesagt, schuld daran, dass Blut, wenn man es in den Mund bekommt, deutlich nach Metall schmeckt. Ein Hämoglobinmolekül ist also in etwa so etwas wie ein klitzekleines viersitziges Taxi, das seine Insassen bis in die entlegensten Winkel des Körpers befördert, sie dort absetzt und auf dem Rückweg Kohlendioxidmoleküle mitnimmt. Allerdings gelingt es nur einem Teil des Sauerstoffs, am Taxistand in der Lunge einen Wagen zu ergattern, der Rest wird wieder ausgepustet und hat vielleicht beim nächsten Atemzug die Chance, mitgenommen zu werden. So erklärt sich, dass die Luft, die wir einatmen, 21 Prozent, und diejenige, die wir wieder von uns geben, immer noch 16 Prozent Sauerstoff enthält. Genug, um damit bei einer Mund-zu-Mund- oder Mund-zu-Nase-Beatmung Leben zu retten.
Was haben Erythrozyten mit Gelbsucht zu tun?
Gelbsucht ist keine eigenständige Krankheit, sondern nur ein Symptom, das folgendermaßen zustande kommt: Beim Abbau des Hämoglobins entsteht ein braunroter Farbstoff namens Bilirubin. Der wandert mit dem Blutstrom zur Leber, die ihn als Hauptfarbstoff der Galle in der gleichnamigen Blase speichert, bis er mit dieser zur Unterstützung der Fettverdauung in den Dünndarm fließt. Ist nun der Abfluss der Galle – in der Regel infolge einer krankhaften Veränderung des Lebergewebes – behindert, staut sich die gelbbraune Flüssigkeit in die Leber zurück, und der so entstehende Druck presst das Hämoglobin ins Blut. Mit dem wird es unter anderem in die äußere Haut befördert, die es dann gelblich bis bronzefarben braun färbt. Außerdem erscheint es in der Lederhaut des Auges, wo es wegen des weißen Untergrundes besonders auffällt.
Da das Bilirubin nun nicht mehr mit der Galle in den Dünndarm abfließt, wo es normalerweise in eine Substanz umgewandelt wird, der unser Kot die typische braune Farbe verdankt, ist der auffallend hell. Dagegen sieht der Urin bräunlich aus, weil ein Großteil des im Blut schwimmenden Bilirubins jetzt nicht mehr über den Darm, sondern über die Nieren ausgeschieden wird.
Power spritzen: Blutdoping mit Epo
Bei der Blutbildung spielt ein Hormon eine wichtige Rolle, dessen Namen Sie mit Sicherheit schon mal gehört haben, und zwar in eher zweifelhaftem Zusammenhang: »Erythropoetin« oder kurz »Epo«. Das schütten die Nieren immer dann in größeren Mengen aus, wenn Sensoren irgendwo in unserem Körper ein Zuwenig an Sauerstoff registrieren. Dann kurbelt es unverzüglich die Bildung neuer Erythrozyten an, mit der Folge, dass das Blut mehr Sauerstoff befördern kann. Da der ja der Verstoffwechslung – landläufig, aber falsch als »Verbrennung« bezeichnet – von Nährstoffen und damit der Energieproduktion in den Zellen dient, bedeutet mehr davon automatisch auch mehr Power. Sportler wissen das schon lange und nutzen den Effekt aus, indem sie längere Zeit in größeren Höhen mit weniger Luftsauerstoff trainieren. Das Defizit bekommen die Nieren nämlich rasch mit, die dann auch prompt den Erythrozyten-Ausstoß steigern.
Man muss sich das so vorstellen: Sensoren in Blutbahn und diversen Geweben registrieren, dass es überall an Sauerstoff hapert und die Zellen deshalb nicht mehr genügend Energie produzieren. Das heißt, Nährstoffe häufen sich unverarbeitet an, und weil das nicht ungefährlich ist, alarmieren sie unverzüglich das Gehirn. Das fühlt sich natürlich verpflichtet, dem Übel irgendwie abzuhelfen, und da es nun mal nicht für mehr Sauerstoff in der Atemluft sorgen kann, probiert es einen anderen Trick: Es befiehlt den Nieren, reichlich Epo freizusetzen, um die Zahl der Sauerstofftaxis zu erhöhen. Kein einziges Sauerstoffmolekül soll in der Lunge vergeblich einen Platz in einem Hämoglobintransporter suchen. Das ist zwar gut gemeint, aber natürlich nicht logisch, denn wenn weniger Sauerstoff zu befördern ist als sonst, helfen mehr Mitfahrgelegenheiten auch nicht wirklich. Also meckern die Gewebe weiter, woraufhin das Gehirn in seiner Not mittels mehr Nieren-Epo die Zahl der Erys immer weiter in die Höhe schraubt, bis das Blut schließlich von roten Blutkörperchen nur so wimmelt. Wenn der Sportler nun wieder in tieferen Gegenden atmet, verfügt er über so viel Hämoglobin, dass kein einziges Sauerstoffmolekül vergeblich auf ein Transportvehikel warten muss. Die Zellen erhalten Sauerstoff in Hülle und Fülle und produzieren mit seiner Hilfe Energie im Überschuss. Folge: Der Höhentrainierte rennt, fährt oder schwimmt seinen Flachlandkollegen auf und davon.
Doch wer bei der Tour de France, nachdem er an einem einzigen Tag mit Affentempo drei Pyrenäenpässe hochgestürmt ist, als Erster ins Ziel kommen will, kann auf das anstrengende Höhentraining auch getrost verzichten und es sich viel einfacher machen, indem er sich das Erythrozyten produzierende Wundermittel – es lässt sich in beliebigen Mengen synthetisch herstellen – einfach spritzt. Das ist zwar streng verboten, bringt aber einen derartigen Leistungsschub, dass die Versuchung, sich dieser ebenso beliebten wie bequemen Dopingmethode zu bedienen, für viele Leistungssportler – und keinesfalls nur für Radrennfahrer – übermächtig ist. Ja, wer ganz vorne mit dabei sein möchte, kann heutzutage eigentlich gar nicht anders, als seinen Körper auf diese Weise aufzuputschen. Weil das ja alle Konkurrenten auch tun, hat er sonst nicht den Hauch einer Chance. Dabei nimmt er sogar in Kauf, dass das für ihn selbst alles andere als ungefährlich ist. Denn zu viele Erys machen das Blut dickflüssig, und zähes Blut erhöht das Risiko lebensgefährlicher Gefäßverschlüsse und damit von Herzinfarkt und Schlaganfall ganz massiv.
Seit die Epo-Tests allerdings dermaßen verfeinert wurden, dass sich damit auch geringste Mengen des Hormons nachweisen lassen, ist Dopen mit dem Nierenmedikament vielen Sportlern zu riskant geworden. Seither erlebt eine Energie-Aufputsch-Methode eine Renaissance, die aus den Siebzigerjahren des letzten Jahrhunderts stammt und eigentlich schon als bedeutungslos galt: das Eigenblut-Doping. Dabei erhöht der Sportler die Zahl seiner Erys mit einer Kombination von Höhentraining und Epo-Spritzen binnen kurzer Zeit ganz massiv, und zwar an einem geheimen Ort, wo er mit keinen Kontrollen rechnen muss. Anschließend lässt er sich einen Liter Blut abzapfen. Die darin enthaltenen roten Blutkörperchen werden in einer Zentrifuge isoliert, der Rest kommt zurück in die Blutbahn. Das so gewonnene Erythrozytenkonzentrat versetzt man mit einem Gerinnungshemmer und lagert es kühl, um es dem Athleten unmittelbar vor dem Wettkampf wieder ins Blut zu spritzen. Das Epo ist dann längst nicht mehr nachweisbar.
Ein kleines Risiko bleibt allerdings auch bei dieser Methode: der Hämatokritwert, also der Anteil fester Bestandteile am Gesamtblutvolumen. Ist der massiv erhöht, bedeutet das ja, dass das Blut viel zu viele Erys enthält. Allerdings schwankt der Wert auch bei Nicht-Dopern zum Teil erheblich. Da es zudem möglich ist, ihn durch reichliches Trinken oder die Einnahme blutverdünnender Mittel unter einen kritischen Wert zu drücken und getestete Sportler ja zudem behaupten können, ihr Mehr an Erythrozyten wochenlangem Höhentraining zu verdanken, ist ein auffälliger Hämatokrit zwar grundsätzlich verdächtig, aber keinesfalls ein unumstößlicher Beweis für illegale Praktiken. Es sei denn, man verhält sich so dumm wie der frühere Radrennfahrer Marco Pantani. Dessen Hämatokrit war bei einem Test während des Giro d’Italia vollkommen unverdächtig, doch als man den Wert – womit der Italiener offenbar nicht gerechnet hatte – überraschend am nächsten Morgen vor dem Frühstück nochmals bestimmte, war er plötzlich massiv in die Höhe geschossen. Folge: Pantani wurde umgehend gesperrt.
Die blaue Frau
Die Ärzte eines Krankenhauses in Kanada standen vor einem Rätsel: Die junge Frau, die gerade eingeliefert worden war, war von Kopf bis Fuß blau angelaufen, ein untrügliches Zeichen für akuten Sauerstoffmangel – Mediziner nennen so etwas »Zyanose«. Blau wird die Haut nämlich dadurch, dass das Hämoglobin, wenn es nicht mit Sauerstoff beladen ist, seine hellrote Farbe verliert. Hatte die Patientin vielleicht Probleme mit Herz oder Lunge, oder stand sie womöglich unmittelbar vor einem lebensbedrohlichen Schock? Eine gründliche Untersuchung bestätigte weder die eine noch die andere Verdachtsdiagnose. Doch was höchst merkwürdig war: Die Zunge war ganz normal rosa gefärbt, also bestens durchblutet. Wie war das möglich?
Des Rätsels Lösung fand ein junger Assistenzarzt, der an der Haut der Frau mit einem alkoholgetränkten Tupfer herumwischte und dabei verblüfft feststellte, dass sich die rätselhafte Verfärbung problemlos beseitigen ließ. Und plötzlich war der Patientin auch klar, seit wann sie ihre normale Hautfarbe verloren hatte: seit sie in neuer Bettwäsche schlief. Die war nämlich knallblau und hatte schlicht abgefärbt.
Die weißen Kämpfer: Leukozyten
Während die Erythrozyten so aussehen wie Chinesen für Mitteleuropäer, nämlich alle gleich, haben wir es bei den weißen Blutkörperchen oder Leukozyten mit einem Sammelsurium unterschiedlicher Zellen zu tun, die allerdings dreierlei gemeinsam haben: Erstens erscheinen sie unter dem Mikroskop, wie ja schon ihr Name sagt, allesamt ziemlich bleich, zweitens stehen sie samt und sonders im Dienst der körperlichen Abwehr, sprich des Immunsystems, und drittens können sie sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben jederzeit ganz klein machen und so problemlos die Blutbahn verlassen, um sich auf der Suche nach ungebetenen Eindringlingen überall im Körper herumzutreiben. Außerdem besitzen sie im Gegensatz zu ihren roten Kollegen und den Blutplättchen einen Kern, sind also richtige Zellen und nicht nur kernlose »Körperchen«. Doch obwohl sie so vielgestaltig sind, machen sie insgesamt weniger als ein Prozent aller Blutzellen aus. Nicht einmal jede hundertste Blutzelle ist also weiß.
Geboren werden die Leukozyten samt und sonders im Knochenmark, allerdings aus unterschiedlichen Vorläuferzell-Müttern. Im Einzelnen unterscheidet man Granulozyten, Monozyten und Lymphozyten, die bei der Bekämpfung von Bakterien, Viren und Giftstoffen ganz unterschiedliche Aufgaben und Befugnisse haben, dabei aber reibungslos zusammenarbeiten. So wie idealerweise die Abteilungen einer funktionierenden Firma, in der alle dasselbe Ziel haben. Jede einzelne weiß genau, was zu tun ist, bleibt dabei aber immer auf die anderen angewiesen und steht deshalb in ständigem Kontakt mit ihnen. Die Blutbahn nutzen die weißen Zellen im Grunde nur als Fluss, in dem sie sich von einem Ort zum anderen treiben lassen. Dort steigen sie dann wieder an Land und unternehmen ausgedehnte Streifzüge in die Umgebung, ständig auf der Suche nach ungebetenen Eindringlingen. Doch auch während sie innerhalb eines Gefäßes unterwegs sind, sind sie nicht faul. Vielmehr tasten sie dessen Wand permanent nach auffälligen Veränderungen ab, die vielleicht von Krebszellen verursacht worden sind. Damit ihnen dabei auch nicht der geringste Schaden entgeht, sind sie viel langsamer unterwegs als das umgebende Blut, schwimmen also keinesfalls mit dem Strom, sondern bewegen sich eher wie Hobbysportler unter hochtrainierten Marathonläufern. Werden sie bei ihrer routinemäßigen Inspektion fündig, setzen sie unverzüglich einen vielschichtigen Abwehrapparat in Betrieb, um die Übeltäter so schnell wie möglich aufzuspüren und rücksichtslos niederzumachen.
Die größten Leukos – so nennt man die weißen Blutzellen in Fachkreisen – sind die Monozyten. Sie machen allerdings nur 3 bis 6 Prozent der weißen Blutkörperchen aus. Nachdem sie im Knochenmark herangereift sind, zirkulieren sie höchstens drei Tage im Blut, dann verlassen sie die Gefäße und wandern ins umgebende Gewebe, wobei sie nicht wählerisch sind. In der Lunge werden sie ebenso gerne sesshaft wie in der Leber, im Bindegewebe oder einer der vielen Schleimhäute, ja, sogar im Glaskörper des Auges. Dort verändern sie ihre Gestalt und wachsen zu sogenannten »Makrophagen« heran. Wenn man weiß, dass das nichts anderes bedeutet als »große Fresser«, ist klar, was diese relativ voluminösen Zellen den lieben langen Tag tun: Fressbares suchen und verschlingen. Dabei sind sie nicht wählerisch. Bakterien, denen sie auf ihrem Weg zufällig begegnen, lassen sie sich genauso schmecken wie infizierte, gealterte oder entartete Körperzellen, Pilze, Würmer oder Einzeller. Haben sie sich ein Bakterium einverleibt, verdauen sie es jedoch nicht vollständig, sondern geben mächtig mit ihrem Erfolg an, indem sie Teile davon an ihrer Oberfläche zur Schau stellen, nach dem Motto: »Schaut her, was ich gerade zur Strecke gebracht habe!« Und diese sogenannten »Antigenbruchstücke« lassen dann andere Immunzellen nicht ruhen, ihrerseits aktiv zu werden. Kurz: Die Makrophagen kurbeln mit ihrer Angeberei das komplette Immunsystem an. Was dann im Einzelnen passiert, ist Thema eines gesonderten Kapitels.
Die nächste und mit 60 bis 70 Prozent zahlenmäßig größte Gruppe der weißen Blutzellen bilden die sogenannten »Granulozyten«. Die heißen so, weil man in ihrem Inneren unter dem Mikroskop eine Fülle kleiner Körnchen – lateinisch: »granula« – sieht, die mit Enzymen gefüllt sind, mit denen sie Bakterien den Garaus machen können. 90 Prozent aller Granulozyten bleiben im Knochenmark, ganze 2 bis 3 Prozent schwimmen im Blut herum, der Rest patrouilliert durchs Gewebe
Und jetzt wird es kompliziert. Denn man teilt die Granulozyten nach der Art, wie sie sich anfärben lassen, in drei Untergruppen ein: die neutrophilen, die basophilen und die eosinophilen. Diese Unterscheidung ist keinesfalls nur von akademischem Interesse, sondern hat durchaus konkrete Auswirkungen: Die drei Sorten gehen nämlich im Rahmen der körpereigenen Abwehr ganz unterschiedlichen Aufgaben nach, arbeiten dabei aber prima zusammen. Man kann das mit der Polizei vergleichen: Gemeinsames Ziel aller Beteiligten ist, Straftaten aufzuklären und Verbrecher dingfest zu machen, dazu braucht man aber nicht nur Kriminalpolizisten, sondern auch Spurensicherer, Gerichtsmediziner, Psychologen und Wissenschaftler, die im Labor mikroskopisch kleine Stofffetzen oder unter Fingernägeln herausgekratzten Dreck analysieren. Nach dem Motto: »Einigkeit macht stark!«
Die neutrophilen Granulozyten tun so ziemlich dasselbe wie die Makrophagen: Sie fahnden pausenlos nach Bakterien, Viren und Pilzen und folgen dabei wie Bluthunde beharrlich sämtlichen Spuren, die diese bei ihrer Wanderung durch den Körper hinterlassen. Haben sie den Eindringling schließlich gestellt, fressen sie ihn kurzerhand auf.
Die Eosinophilen – die heißen so, weil sie mit Vorliebe Eosinfarbstoffe aufnehmen und sich so unter dem Mikroskop leicht von ihren Kollegen unterscheiden lassen – sind auf das Aufspüren von Parasiten wie Würmern und Einzellern spezialisiert. Die können sie jedoch aufgrund ihrer Größe nicht einfach verschlingen, sondern greifen sie mit giftigen Stoffen an, die sie in ihren Körnchen immer bei sich haben. Haben sie etwa irgendwo im Körper einen Wurm gestellt, bespritzen sie ihn von allen Seiten so lange mit Gift, bis der ungebetene Eindringling erledigt ist. Außerdem locken sie mit den freigesetzten Abwehrstoffen andere Immunzellen an, denn wo ein Wurm ist, gibt es meist noch mehr, da kann Verstärkung nie schaden. Außerdem beteiligen sich die eosinophilen Granulozyten fatalerweise an allergischen Überempfindlichkeitsreaktionen.
Insofern haben sie viel mit der dritten Leukogruppe gemeinsam, den Basophilen. Die sind regelrecht Allergiespezialisten und für die unangenehmen Begleiterscheinungen verantwortlich, die Betroffenen dabei zu schaffen machen. So enthalten ihre Körnchen etwa Histamin, das den für Überempfindlichkeiten typischen fiesen Juckreiz auslöst. Allerdings muss man ihnen fairerweise zugutehalten, dass sie daran nur zum Teil schuld sind, das meiste Histamin stammt nämlich aus sogenannten »Mastzellen«, die nicht, wie die Basophilen, im Blut kreisen, sondern vor allem in diversen Bindegeweben und Schleimhäuten sowie der äußeren Haut zu Hause sind. Aber auch die versprühen ihr Histamin mitnichten, um Allergiker mit Hautrötung, Schwellung und ekligem Jucken zu piesacken, sondern um damit unter anderem auch die Blutgefäße um Wunden herum zu erweitern und so dafür zu sorgen, dass möglichst viele Leukozyten angerauscht kommen, um sich auf etwaige Angreifer zu stürzen.
Womit ich zu den kleinsten Immunzellen komme, den Lymphozyten, die etwa 20 bis 30 Prozent der im Blut kreisenden Leukos ausmachen, bei Kindern sogar mehr als die Hälfte. Sie sind gerade mal so groß oder besser gesagt winzig wie ihre roten Kollegen, haben aber vollkommen andere Aufgaben. Zwar werden sie wie diese im roten Knochenmark gebildet, doch anschließend reifen sie in sogenannten »lymphatischen Organen« heran, von denen sie auch ihren Namen haben. Die sind Teil des Immunsystems, wobei man die primären von den sekundären unterscheidet. Hier sollen uns nur die primären, nämlich bestimmte Abschnitte des Knochenmarks sowie der hinter dem Brustbein gelegene Thymus, interessieren. Das sind gleichsam Ausbildungszentren, in denen die heranwachsenden Lymphozyten vor allem eines lernen: körpereigen von körperfremd zu unterscheiden. Denn wenn sie fertig ausgebildet sind, sollen sie ja skrupellos gegen alles vorgehen, was nicht zu uns gehört, uns selbst dabei aber unbedingt ungeschoren lassen.
Diejenigen Lymphozyten, die ihre Ausbildung im Knochenmark absolvieren, heißen B-, diejenigen, die im Thymus zur Schule gehen, T-Lymphozyten. Dabei ist speziell der Thymus eine absolute Eliteanstalt. Hier werden den Schülern permanent Proteine und Gewebeproben vorgesetzt, und sie müssen in Sekundenbruchteilen entscheiden, ob die zum Körper gehören und mithin zu schonen sind oder ob es sich um möglicherweise gefährliches Fremdmaterial handelt. Vertut sich ein potenzieller T-Lymphozyt bei diesen Prüfungen auch nur ein einziges Mal, bekommt er nicht etwa statt einer Zwei eine Drei, nein, er wird gnadenlos vom weiteren Unterricht ausgeschlossen und umgehend hingerichtet. Kein Wunder, dass nur kümmerliche 5 Prozent das strenge Ausbildungsziel – fachlich korrekt spricht man von »Immunkompetenz« – erreichen und die Schule mit Diplom verlassen, will heißen, ins Blut abgegeben werden. Dort arbeiten sie dann bei der Bekämpfung von Krankheitserregern höchst eindrucksvoll mit ihren B-Kollegen zusammen. Auch darauf komme ich noch ausführlich zu sprechen.
Daneben gibt es noch eine dritte Art von Lymphozyten, die sogenannten »natürlichen Killerzellen«. Das sind, wie schon ihr martialischer Name sagt, ganz und gar rücksichtslose Burschen, die anders als ihre B- und T-Verwandten von Geburt an vorhanden sind. Daher das Attribut »natürlich«. Damit unterscheiden sie sich von anderen Killerzellen – auch »zytotoxische T-Lymphozyten« genannt –, die im erworbenen Abwehrsystem erst bei Bedarf entstehen und darauf spezialisiert sind, anhand spezieller Merkmale virusinfizierte und Tumorzellen zu erkennen. Haben sie eine solche aufgespürt, machen sie ihrem Namen alle Ehre und bringen die komplette Zelle samt ihrem verdächtigen Inhalt mindestens so gnadenlos um die Ecke wie mexikanische Drogendealer ihre Konkurrenten.
Die »speziellen Merkmale«, mit denen sich Eindringlinge als nicht zum Körper gehörig verraten, sind typische Molekülmuster in ihrer Zellmembran, die erst Mitte der 1990er-Jahre entdeckt wurden. Maßgeblichen Anteil hatte daran die deutsche Nobelpreisträgerin Christiane Nüsslein-Vollhardt, die davon angeblich so begeistert war, dass sie laut »Toll!« ausrief. Seither heißen derartige Erkennungsmuster, von denen es unterschiedliche Typen gibt, allgemein »Toll-like-«, also »Toll-ähnliche« Rezeptoren. Man muss sich die in etwa so vorstellen wie die charakteristischen Merkmale von Computerviren, anhand derer sie von speziellen Scanner-Programmen erkannt und unschädlich gemacht werden können.
Und damit zum letzten Typus der Leukozyten, den sogenannten »dendritischen Zellen«, die erst in den letzten Jahren und Jahrzehnten in den Fokus der Wissenschaft gerückt sind. Sie bilden sich aus Vorläuferzellen von Makrophagen und Lymphozyten und haben ihren Namen vom griechischen Wort »dendron« für »Baum«, denn sie besitzen lange tentakelartige Fortsätze, die unter dem Mikroskop an Äste und Zweige eines Baumes erinnern. Mit diesen Ausläufern tasten sie ihre Umgebung unentwegt Millimeter für Millimeter nach Körperfremdem ab, das sie sich, sobald sie fündig geworden sind, unverzüglich einverleiben. Dendritische Zellen finden sich in großer Zahl in der Nähe von Körperöffnungen, durch die Bakterien theoretisch in den Körper eindringen könnten, etwa im Rachen, der Speiseröhre, der weiblichen Scheide und am Darmausgang. Dazu noch gehäuft in den Schleimhäuten der Verdauungs- und Atmungsorgane. Wie die Makrophagen sind sie in der Lage, Mikroben, die sie verschlungen haben, in Einzelteile zu zerlegen. Die heften sie sich dann wie kleine Fähnchen an ihren Zellkörper und wedeln damit anderen Immunzellen aufgeregt vor der Nase herum. So erfahren die, dass sich in unserem Körper ungebetene Eindringlinge herumtreiben, und beteiligen sich unverzüglich an deren Aufspürung und Bekämpfung.
Die Scheibchen mit den Ärmchen: Thrombozyten
Die kleinsten festen Bestandteile des Blutes sind die Blutplättchen oder Thrombozyten. Die entstehen ebenfalls im Knochenmark, und zwar aus vielkernigen Ursprungszellen, in deren Inneren sich so lange immer mehr feine Körnchen bilden, bis die Zellen voll davon sind und sie in Form dünner Scheibchen ins Blut abdrücken. Auf diese Weise entstehen aus einer einzigen Vorläuferzelle zwischen 4000 und 8000 kernlose Blutplättchen. Unterstützt wird die Produktion von einem dem Epo ähnlichen Hormon namens Thrombopoetin, das von Leber, Niere und Knochenmark abgesondert wird. So wie das Erythropoetin immer dann die Bildung roter Blutkörperchen ankurbelt, wenn es an Sauerstofftransportern mangelt, wird auch das Thrombopoetin besonders reichlich ausgeschüttet, wenn sich die Anzahl der zirkulierenden Blutplättchen einer bedrohlichen Untergrenze nähert. Mit der Abschnürung von der Mutterzelle sind die Blutplättchen aber noch nicht arbeitsfähig, vielmehr dauert es danach noch etwa zehn Tage, bis sie voll ausgereift sind. Dann schwimmen sie mit dem Blutstrom im Körper herum, bevor sie nach weiteren sieben bis zehn Tagen schon wieder in der Milz abgebaut werden. Die allermeisten werden also geboren, leben gerade mal knapp drei Wochen und gehen dann wieder sang- und klanglos ein, ohne in ihrem kurzen Leben mehr getan zu haben, als sich träge treiben zu lassen. Unter den Blutkörperchen sind sie eindeutig die Faulpelze.
Dabei haben sie durchaus Fähigkeiten, die den Erys und Leukos komplett abgehen. Sie spielen nämlich eine entscheidende Rolle bei der Blutgerinnung, die wir aber ja zum Glück nur selten bemühen müssen. Dazu verfügen sie über eine bemerkenswerte Eigenschaft: Sobald sie feststellen, dass irgendwo eine Ader verletzt ist, rauschen sie in Massen zu der Unfallstelle und stülpen zahlreiche feine Ärmchen aus. Mit denen krallen sie sich an den Verletzungsrändern und vor allem auch aneinander fest. So entsteht rasch ein kompakter Pulk fest miteinander verzahnter Blutplättchen, der die Wunde erst einmal provisorisch verklebt und verhindert, dass zu viel Blut ausströmt. Wir finden das im Allgemeinen vollkommen selbstverständlich, so wie wir die liebevolle Fürsorge unserer Eltern als gleichsam naturgegeben hinnehmen. Dabei sollten wir uns durchaus einmal bewusst machen, dass wir ohne die aufopferungsvolle Tätigkeit unserer Thrombozyten – wenn sie denn mal richtig gefordert werden – allein schon am Stich einer Rose jämmerlich verbluten würden. Wir hätten wirklich allen Grund, ihnen, aber auch ihren Blutkörperchen-Kollegen von den anderen Fakultäten, zutiefst dankbar zu sein.
Auf die komplexen Vorgänge des endgültigen Wundverschlusses, sprich: der eigentlichen Blutgerinnung, komme ich, wie gesagt, in einem späteren Kapitel noch näher zu sprechen.
Blut ist nicht gleich Blut: Blutgruppen und Rhesusfaktor
Sagt Ihnen der Name Karl Landsteiner etwas? Nein? Sollte er aber. Denn immerhin hat der Mann, dessen markantes Gesicht vor der Einführung des Euro den österreichischen 1000-Schilling-Schein zierte, mit seiner bahnbrechenden Entdeckung der Blutgruppen Millionen Menschen das Leben gerettet. Schon mehr als 200 Jahre, bevor ihm das 1901 gelungen ist, gab es immer wieder Versuche, etwa Unfallopfern, die eine Menge Blut verloren hatten, dasjenige eines anderen Menschen zu übertragen. Und merkwürdigerweise funktionierte das in etlichen Fällen auch einwandfrei, während es in anderen für den Patienten überaus prekär, nämlich tödlich endete. Mit diesem russischen Blut-Roulette wollte sich der österreichisch-amerikanische Serologe Karl Landsteiner nicht länger abfinden und begann daher, systematische Untersuchungen durchzuführen. Dazu mischte er die durch Zentrifugieren gewonnenen Erythrozyten eines Menschen mit dem Serum eines anderen. Und das viele Male mit dem Blut unterschiedlicher Probanden. Und siehe da: Manchmal führte das dazu, dass die Erys schlagartig verklumpten – heute nennen Mediziner das »agglutinieren« – manchmal aber auch nicht. Blut war also offenbar nicht gleich Blut.
Landsteiner forschte weiter, unternahm Versuch auf Versuch und kam schließlich 1901 zu dem Schluss, dass es drei Blutgruppen geben müsse, die er A, B und C nannte. C wurde später in 0 (Null) umbenannt. Ein Jahr später fanden seine Mitarbeiter dann noch eine vierte Gruppe: AB. Aber erst nach sechs weiteren Jahren wagten sich Mediziner an die erste Bluttransfusion, die auf Landsteiners Erkenntnissen beruhte. Und hatten damit Erfolg. Das war vor allem für die verwundeten Soldaten im Ersten Weltkrieg ein wahrer Segen, da man sie jetzt gefahrlos mit geeignetem Spenderblut versorgen und damit in vielen Fällen ihr Leben retten konnte.
Den Nobelpreis, den Landsteiner 1930 für seine grandiose Entdeckung erhielt, hatte er sich wahrlich verdient. Selten vorher, aber auch nachher hatte medizinische Forschung einen derart durchschlagenden praktischen Nutzen.
Die roten Blutkörperchen machen den Unterschied: Das AB0-System
Heute wissen wir: Es sind die Erythrozyten oder genauer gesagt Merkmale ihrer Zellmembran, die den Unterschied ausmachen. Diese Merkmale nennt man Antigen A und Antigen B. Ganz allgemein versteht man unter einem Antigen ein – in der Regel fremdes – Protein, das im Körper eine Abwehrreaktion auslöst. Die besteht normalerweise in der Produktion und Bereitstellung sogenannter Antikörper, die sich kriegslüstern auf die Angreifer stürzen, sich fest an sie krallen und sie damit außer Gefecht setzen. So etwas nennt man einen »Antigen-Antikörper-Komplex«. Ich komme bei der Beschäftigung mit dem Immunsystem noch näher darauf zu sprechen.
Die Erythrozyten-Antigene unterscheiden sich von ihren Namensvettern dadurch, dass sie eben nicht von anderen Organismen stammen, sondern sich bei einem Säugling schon in den ersten Lebensmonaten bilden und von da an zeitlebens an den Erys kleben. Was indes nichts daran ändert, dass sie, sobald sie in Kontakt mit den passenden Antikörpern kommen, das Blut wie einen Schneeball fest zusammenklumpen. Und diese Antikörper finden sich wie die Antigene ebenfalls von Anfang an im Blut, müssen also nicht, wie sonst bei einer Immunreaktion, erst mühsam und zeitaufwendig hergestellt werden.
Menschen, deren Erys das Antigen A aufweisen, haben in ihrem Serum Antikörper gegen die Blutgruppe B, die man sinnig Anti-B nennt. Umgekehrt weist das Blutserum von Menschen mit Blutgruppe B Antikörper des Typs Anti-A auf. Demnach besitzen die Erythrozyten einer Person mit Blutgruppe 0 null, also gar keine Antigene, dafür schwimmen im Serum sowohl Anti-A als auch Anti-B herum. Und wer die seltene Blutgruppe AB sein Eigen nennt, dessen Erys sind gleich mit beiden Antigenen behaftet, während ihr Serum komplett antikörperfrei ist. Das muss ja auch so sein, denn sonst würden die Antikörper die eigenen Erys killen.