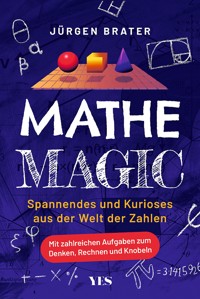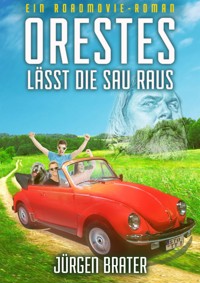12,99 €
Mehr erfahren.
»Gehirnjogging stoppt Alzheimer«, »Sport macht schlau«, »Mammografie verhindert Brustkrebs«, »Zucker ist das neue Rauchen« – die Medien sind voll von derartigen Parolen, die uns angeblich ein gesünderes und längeres Leben garantieren sollen. Doch was steckt wirklich dahinter? Und vor allem: Was sagt die seriöse Forschung dazu? Dieser Frage widmet sich dieses Buch, indem es die vielen Ratschläge und Warnungen auf den Prüfstand aktueller wissenschaftlicher Studien stellt. Und dabei zeigt sich, dass so manches, was man liest und hört, zumindest fragwürdig, zum Teil durch neuere Untersuchungen längst überholt und oft sogar schlicht falsch ist.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 453
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Dr. med. Jürgen Brater
DAS GESUNDHEITS NAVI
Dr. med. Jürgen Brater
DAS GESUNDHEITS NAVI
Orientierung im Labyrinth der Gesundheitsempfehlungen
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek
Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen National-bibliografie.
Detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://d-nb.de abrufbar.
Für Fragen und Anregungen
Wichtige Hinweise
Dieses Buch ist für Lernzwecke gedacht. Es stellt keinen Ersatz für eine individuelle medizinische Beratung dar und sollte auch nicht als solcher benutzt werden. Wenn Sie medizinischen Rat einholen wollen, konsultieren Sie bitte einen qualifizierten Arzt. Der Verlag und der Autor haften für keine nachteiligen Auswirkungen, die in einem direkten oder indirekten Zusammenhang mit den Informationen stehen, die in diesem Buch enthalten sind.
Ausschließlich zum Zweck der besseren Lesbarkeit wurde auf eine genderspezifische Schreibweise sowie eine Mehrfachbezeichnung verzichtet. Alle personenbezogenen Bezeichnungen sind somit geschlechtsneutral zu verstehen.
Originalausgabe
1. Auflage 2021
© 2021 by riva Verlag, ein Imprint der Münchner Verlagsgruppe GmbH
Türkenstraße 89
80799 München
Tel.: 089 651285-0
Fax: 089 652096
Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und Verbreitung sowie der Übersetzung, vorbehalten. Kein Teil des Werkes darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung des Verlages reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme gespeichert, verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden.
Redaktion: Stephanie Kaiser-Dauer
Umschlaggestaltung: Karina Braun, München
Umschlagabbildung: shutterstock/svetlichniy_igor
Illustrationen: Hans Winkler
Satz: abavo GmbH, Buchloe
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-7423-1626-4
ISBN E-Book (PDF) 978-3-7453-1325-3
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-7453-1326-0
Weitere Informationen zum Verlag finden Sie unter
www.rivaverlag.de
Beachten Sie auch unsere weiteren Verlage unter www.m-vg.de
Inhaltsverzeichnis
Einführung:
»Sitz gerade!« – ein empfehlenswerter Ratschlag?
Wie soll man sitzen?
Wissenschaftliche Studien: Mit Vorsicht zu genießen
Halten den Geist fit: Bewegungspausen
Ein Bein über das andere – bekommt man davon Krampfadern?
Duschen, saunieren, Zähne putzen – wann, wie und wie oft?
Jeden Tag duschen – ist das gesund?
Kaltes Wasser – bringt’s das?
Leben Finnen gesünder?
Zähne putzen – vor oder nach dem Frühstück?
Wie sinnvoll sind Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen?
Lohnen sich Vorsorgeuntersuchungen?
Schützt regelmäßige Mammografie vor Brustkrebs?
Dunkle Flecken auf der Haut: Soll man sie regelmäßig kontrollieren lassen?
Und wie sieht es mit Darmspiegelungen aus?
Impfungen: Sind skeptische Einwände berechtigt?
Was bringt die professionelle Zahnreinigung?
Gesund durch Bewegung?
Jeder Schritt zählt
Hilft Sport beim Abnehmen?
Macht Sport schlau?
Welcher Sport soll es denn sein?
Bei Freizeitsportlern beliebt: Jogging
Doch nicht so gelenkschonend: Nordic Walking
Wenn es weiter gehen soll: Wandern
Wohl der gesündeste Sport überhaupt: Radfahren
Auf Platz 3 der Favoritenliste: Schwimmen
Weit mehr als komplizierte Verrenkungen: Yoga
Entspannung und Erholung
Dolcefarniente – ist süßes Nichtstun erstrebenswert?
Kann man Entspannung trainieren?
Schlaf: Nichts ist erholsamer
Positiv denken – eine gute Empfehlung?
Ist Lachen tatsächlich gesund?
Macht Gehirnjogging intelligent?
Lesen – viel mehr als nur Entspannung
Was tut uns gut, was nicht? Ein Sammelsurium populärer Gesundheitstipps
A wie Auswaschen: Darf man Wunden mit Wasser auswaschen?
B wie BH: Straffere Brüste mit BH?
C wie Cola: Helfen Cola und Salzstangen bei Durchfall?
D wie Durst: Ist Über-den-Durst-Trinken gesund?
E wie Erkältung: Erkältet man sich bei niedrigen Temperaturen leichter?
F wie Fernsehen: Ist zu viel Fernsehen schädlich?
G wie Gelenke: Macht lautes Knacken die Gelenke kaputt?
H wie Hornissen: Sind Hornissenstiche gefährlicher als Wespenstiche?
I wie IGeL: Sind IGeL-Leistungen sinnvoll?
J wie Jucken: Soll man sich kratzen, wenn es juckt?
K wie Kurzsichtigkeit: Macht lesen kurzsichtig?
L wie Leichengift: Ist es gefährlich, Leichen anzufassen?
M wie Mindesthaltbarkeitsdatum: Darf man Lebensmittel mit abgelaufenem MHD verzehren?
N wie Nase: Ist es ungesund, die Nase hochzuziehen?
O wie Obst: Darf man nach dem Obst-Essen Wasser trinken?
P wie Potenz: Beeinträchtigt Fahrradfahren die Potenz?
R wie Reiseübelkeit: Kann man sich Reiseübelkeit abtrainieren?
S wie Sex: Macht Sex vor Sport schlapp?
T wie Trinken: Macht reichliches Trinken eine glatte Haut?
U wie Urin: Ist es gesund, den eigenen Urin zu trinken?
V wie Verdauungsschnaps: Fördert Hochprozentiges die Verdauung?
W wie Wunden: Brauchen Wunden Luft oder ein Pflaster?
Z wie Zecken: Hilft Knoblauch gegen Zecken?
Unendliches Thema: Gesunde Ernährung
Warum man nicht jeder Gesundheitsstudie glauben darf
Nutrigenomik: Wie Ernährung und Gene interagieren
Abnehmen: Warum es so verdammt schwer ist
Ist Bio gesünder?
Macht Fett fett? Und wie steht es mit dem Zucker?
Ist Süßstoff die Lösung?
Salz: Wie viel oder wenig ist gesund?
Ballaststoffe: Das Allheilmittel schlechthin?
Nüsse: Gesunde Kraftpakete?
Eier: Zum Frühstück besser nicht?
Milch: Nur für Babys gesund?
Kaffee: Teufelszeug oder gesunder Fitmacher?
Alkohol: Verwirrung komplett
Rauchen: Viele Studien, eine Meinung
Wie ich es persönlich mit Ernährung und Genussmitteln halte
Zum guten Schluss: Fünf verblüffende Studien zum Schmunzeln
Putzen bringt Männer um
Stirnfalten verraten Herzprobleme
Ängstliche Menschen haben öfter Heuschnupfen
Nägel lackieren macht dick
Biertrinkende Studenten sind erfolgreicher
Das Wichtigste in Kürze: 25 Ratschläge für ein gesünderes Leben
Literatur
Einführung:
»Sitz gerade!« – ein empfehlenswerter Ratschlag?
Wie soll man sitzen?
Dieses Buch verdankt seine Entstehung einem massiven Bandscheibenvorfall. Das überaus schmerzhafte Ereignis streckte mich völlig unvorbereitet im Januar 2019 nieder; knapp zwei Wochen später wurde ich an der Wirbelsäule operiert. Darauf folgte die obligatorische Reha-Behandlung, in deren Verlauf ich nicht nur massiert und mit Reizstrom traktiert wurde, mich an fiesen Kraftmaschinen abquälen und schweißtreibende Gymnastikübungen absolvieren musste, sondern auch verpflichtet war, mir eine Reihe mehr oder minder aufschlussreicher Vorträge anzuhören. Vorträge über Aufbau und Erkrankungen der Wirbelsäule, über neuartige Behandlungsmethoden und postoperative Vorsichtsmaßregeln, aber auch über rückenschonendes Verhalten im Alltag und muskelaufbauende Ernährung. Im Grunde samt und sonders Dinge, von denen ich glaubte, alles Wesentliche schon zu wissen. Aber man lernt ja bekanntlich nie aus, und so erfuhr ich im Hinblick auf die aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnisse – das gebe ich ehrlich zu – doch das eine oder andere, was mir zumindest in Teilen neu war.
Eine der Referentinnen war eine Therapeutin um die 50 mit ausgeprägtem hessischem Dialekt, deren munterem, mit konkreten Beispielen gespicktem Vortrag ich eigentlich ganz gerne zuhörte – eigentlich deshalb, weil sie die Angewohnheit hatte, uns Patienten vor Beginn ihrer Ausführungen erst einmal einen nach dem anderen streng zu mustern und zu kontrollieren, ob wir auch absolut aufrecht mit durchgedrücktem Kreuz, den Kopf erhoben und keinesfalls die Rückenlehne berührend auf dem Stuhl saßen. Wobei die allergrößte Sünde darin bestand, die Beine übereinanderzuschlagen. Das würde unweigerlich zu Krampfadern führen, wurde sie nicht müde zu behaupten. Erst wenn auch der letzte Zuhörer – nach allerlei wortreichen Ermahnungen – ihren kritischen Blicken sitztechnisch standhielt, begann sie mit ihrem Referat, das sie jedoch auf der Stelle unterbrach, wenn sich jemand erdreistete, die unbequeme Haltung auch nur ansatzweise zu lockern, um es sich ein klein wenig bequemer zu machen.
So saßen wir denn, steif wie die Zinnsoldaten, nebeneinander auf unseren Stühlen und hatten größte Mühe, der Dozentin zu folgen, nahm doch der zunehmende Rückenschmerz unsere Aufmerksamkeit mehr und mehr in Beschlag. Als ich die Referentin einmal am Ende der Unterrichtsstunde darauf ansprach, winkte sie ab und meinte, das sei alles nur eine Frage der Gewohnheit. Wenn ich nur tapfer durchhielte, würde auch ich bald die segensreichen Wirkungen aufrechten Sitzens am eigenen Leib verspüren.
Darauf wartete ich in der Folgezeit zwar vergebens, doch meine Neugier war geweckt. Und so begann ich zu recherchieren. Im Internet, in Fachzeitschriften und Büchern sowie mithilfe eines längeren Telefonats mit einem Experten. Welche Meinung vertraten namhafte Wissenschaftler als Resultat einschlägiger Forschung zu der wohl den meisten Kindern vertrauten Ermahnung »Sitz gerade, sonst bekommst du einen krummen Rücken!«? Mit wachsendem Interesse las ich Studie um Studie und versank geradezu in den daraus gewonnenen Erkenntnissen. Deren einhellige Meinung lautete kurz gefasst: Der Mensch ist aufgrund seiner Anatomie und speziell wegen des Aufbaus seines Skelettes für stundenlanges Sitzen grundsätzlich nicht geschaffen. Schließlich hat sich dieses Skelett ja im Lauf der Evolution aus dem unserer vierbeinigen Vorfahren entwickelt, wurde also immer wieder nur angepasst und vielleicht in dem einen oder anderen Detail verbessert, aber niemals komplett neu konstruiert. Die Folge sind chronische Rückenschmerzen, unter denen speziell in den modernen Industriestaaten Millionen von Menschen leiden und die heutzutage einer der Hauptgründe längerer Berufsunfähigkeit sind.
Doch damit nicht genug. Aktuelle Forschungsergebnisse deuten sogar darauf hin, dass übermäßiges Sitzen das Leben verkürzt. Das ist zumindest das Resultat einer Metastudie – darunter versteht man die zusammenfassende Auswertung zahlreicher Einzeluntersuchungen zu einem bestimmten Thema – US-amerikanischer Wissenschaftler vom Pennington Biomedical Research Center in Louisiana, veröffentlicht im renommierten Fachblatt British Medical Journal. Demnach verlängert die Beschränkung der Sitz- und speziell Fernsehstunden auf weniger als zwei pro Tag die Lebenserwartung um etwa eineinhalb Jahre. Peter Katzmarzyk, der Leiter der Studie, in der er und sein Team sich intensiv mit dem Zusammenhang zwischen den durchschnittlichen Sitzzeiten – nicht selten mehr als neun Stunden täglich – von 167 000 Erwachsenen und ihren Todesursachen beschäftigen, weist allerdings darauf hin, dass es sich bei dem Ergebnis um eine rein theoretische Abschätzung handelt, die weitgehend auf freiwilligen Angaben der Teilnehmer beruht.
Wissenschaftliche Studien: Mit Vorsicht zu genießen
Das veranlasst mich zu einer grundsätzlichen Warnung, die ich diesem Buch voranstellen möchte: Es ist es sicher kein Fehler, die Resultate wissenschaftlicher Studien mit einer gewissen Skepsis zu betrachten. Um über jeden Zweifel erhabene Ergebnisse zu liefern, gibt es schlicht zu viele Fehlerquellen. So ist es etwa möglich, dass die Probanden einer bestimmten Gruppe unbekannte Eigenschaften aufweisen, die den Angehörigen einer Kontrollgruppe fehlen. Wissenschaftlicher ausgedrückt: Korrelation ist keinesfalls gleichbedeutend mit Kausalität. Ein – zugegeben etwas konstruierter – Vergleich mag das verdeutlichen:
Nehmen wir an, ein Forscherteam würde eine Studie über den Zusammenhang zwischen Augenlasern und Lebenserwartung stellen. Dann kann man mit einiger Sicherheit davon ausgehen, dass die Wissenschaftler zu folgendem Resultat gelangen: Die Behandlung von Sehfehlern mittels Laser verlängert das Leben. Doch ist die hochmoderne Behandlungsmethode tatsächlich der Grund für den erfreulichen Effekt? Besteht da wirklich ein kausaler Zusammenhang? Sicher nicht. Vielmehr ist es doch so: Augenlasern ist teuer. Leisten können sich das nur Menschen mit höherem Einkommen, unter denen der Anteil an Gebildeten zweifellos größer ist als unter den Angehörigen ärmerer Schichten. Und Menschen mit höherem intellektuellem Niveau achten bekanntermaßen deutlich mehr auf ihre Gesundheit und können sich zudem teurere Kliniken, Ärzte und Behandlungen leisten. Zwar lässt sich körperliches Wohlbefinden nicht kaufen, aber mit Geld lässt es sich deutlich steigern. Fazit: Zwischen Augenlasern und Lebenserwartung besteht eine klare Korrelation, aber keine Kausalität.
Auf einen vergleichbaren Effekt dürfte die lange Zeit propagierte Warnung vor zu viel Kaffee zurückzuführen sein, die heute als widerlegt gilt. Wir kommen später noch darauf zu sprechen. Denn es ist bekannt, dass nicht wenige Menschen zu ihrem Kaffee gerne eine Zigarette rauchen. Ich selbst habe als Student gern und viel Kaffee getrunken und dabei regelmäßig mindestens eine – selbst gedrehte, filterlose! – Zigarette gepafft (seit über 30 Jahren rauche ich nicht mehr). Vielleicht ist ja die angeblich gesundheitsschädigende Wirkung des Kaffees gar nicht auf das Getränk an sich, sondern auf den begleitenden Teer- und Nikotinkonsum zurückzuführen. Auch hier wieder eine Diskrepanz zwischen Korrelation und Kausalität. Die meisten gesundheitlichen Effekte haben eben mehr als einen Grund, sie sind multikausal. Was übrigens das ärztliche Handeln massiv erschwert. Denn zwei auf den ersten Blick scheinbar identische Krankheitsfälle können vollkommen unterschiedliche Ursachen haben und daher auch ganz anders auf identische Therapien ansprechen.
Eine wichtige Rolle spielt daneben aber auch reiner Zufall. Wenn ein Forscher zum Beispiel ein neues Medikament an Akne-Patienten testet und die Zahl der Pickel dadurch signifikant zurückgeht, ist das sicher ein ermutigendes Zeichen. Doch damit ist keinesfalls schlüssig bewiesen, dass der Effekt tatsächlich auf den enthaltenen Wirkstoff zurückzuführen ist. Würde der Forscher schlicht abwarten oder den Probanden ein bekanntermaßen unwirksames Präparat verabreichen, könnte es ja durchaus sein, dass diese nach einer gewissen Zeit im Vergleich zu einer Kontrollgruppe ebenfalls »signifikant weniger« Pickel aufwiesen – allein aufgrund des Zufalls.
Ein weiterer zu berücksichtigender Effekt ist daneben auch die persönliche Interessenslage der Wissenschaftler. Denn von Kollegen und anderen interessierten Personen beachtet wird ihre Studie doch umso mehr, je spektakulärer das Ergebnis ist. Was möglicherweise ja die höchst erwünschte Folge hat, dass Forschungsgelder künftig üppiger fließen. Ganz besonders gilt das, wenn der Auftraggeber der Studie von vornherein ein starkes Interesse an einem bestimmten Resultat hat – etwa weil er es zu Werbezwecken einsetzen will. Wenn beispielsweise die Milchindustrie eine Untersuchung zu den gesundheitlichen Auswirkungen des Buttermilchkonsums auf den Glanz der Haare pubertierender Mädchen in Auftrag gibt, erwartet sie natürlich, dass ein solcher – positiver – Effekt nachgewiesen wird. Und wenn es um die Wirksamkeit von Medikamenten bei irgendwelchen Krankheiten geht, ist es eben oft die Pharmaindustrie, die ein derartiges Forschungsprojekt finanziert. Auch dass auffällig viele Studien zur angeblich segensreichen Wirkung von Rotwein aus Südafrika, Kalifornien, Italien und Frankreich stammen, ist sicher kein Zufall. Doch zum Thema Alkohol später mehr. Die New Yorker Ernährungsexpertin Marion Nestle hat den Zusammenhang zwischen Studienergebnis und Auftraggeber in einer Stichprobe von 168 industrienahen Untersuchungen demonstriert: Von denen gelangten nicht weniger als 156 – das sind sage und schreibe 93 Prozent – zu einem Fazit, das ganz im Sinne des Sponsors war.
Schließlich noch ein entscheidendes Faktum, das die Aussagekraft wissenschaftlicher Forschungsergebnisse erheblich schmälern kann: die mangelnde Ehrlichkeit der Teilnehmer. Das gilt umso mehr, je persönlicher und intimer die Fragen sind, die sie beantworten sollen. Hand aufs Herz: Wären Sie rückhaltlos ehrlich, wenn Sie im Rahmen einer Befragung präzise Angaben zu Ihrem Alkoholkonsum oder gar Ihren sexuellen Vorlieben, Abneigungen und Praktiken machen sollten? Auch wenn solche Umfragen selbstverständlich anonym sind, wird wohl kaum einer der Probanden offen zugeben, etwa von Sex mit kleinen Kindern oder Tieren zu träumen, und das auch dann, wenn es beim Träumen bleibt. Dazu der Evolutionsbiologe Bernhard Fink von der Universität Göttingen: »Der Mensch ist ein geborener Lügner. Und am meisten lügt er, wenn es um Lust und Liebe geht.«
Sind also die Resultate der meisten wissenschaftlichen Studien Nonsens? Nein, das ganz gewiss nicht. Aber oft sind sie eben nur ein Glied in einer Erkenntniskette, die erst, wenn alle Glieder miteinander verknüpft sind, möglicherweise bahnbrechende Resultate liefert. So war es etwa bei Aids, bei dem zahlreiche, für sich genommen bescheidene Forschungsergebnisse nach und nach wie die Steine eines Mosaiks ein Gesamtbild lieferten, aus dem sich schließlich konkrete Handlungsoptionen – in diesem Fall die Entwicklung hochwirksamer Medikamente – ergaben.
So viel zu Aussagekraft und Zuverlässigkeit wissenschaftlicher Studien. Weil deren Ergebnisse im Einzelfall durchaus zweifelhaft sein können, scheinen mir Metaanalysen, die auf der Auswertung zahlreicher Einzeluntersuchungen beruhen, noch die verlässlichsten Schlussfolgerungen zuzulassen. Aber auch viele andere Studien liefern zweifellos wichtige Erkenntnisse. Wenn ich also im weiteren Verlauf dieses Buches eine große Anzahl derartiger Untersuchungen zitiere – deren Erscheinungsjahr, Titel und Autoren Sie im nach Themen gegliederten Literaturverzeichnis finden –, sind das durchaus ernst zu nehmende Belege für die jeweiligen Thesen. Ich habe mich nach Kräften bemüht, nur solche zu berücksichtigen, die ich für seriös und glaubwürdig halte, aber garantieren kann ich natürlich für nichts.
Doch zurück zum aufrechten Sitzen, zu dem ich im Internet weit mehr wissenschaftliche Untersuchungen gefunden habe, als ich erwartet hatte. Bei deren aufmerksamem Studieren konnte ich – ich gebe zu, nicht ohne ein gewisses Triumphgefühl besagter Referentin gegenüber – feststellen, dass die negativen Auswirkungen die positiven bei Weitem übertrafen. Vorteilhaftes hatte nur eine einzige Studie aus den USA zu vermelden: Demnach führt eine aufrechte Sitzhaltung zu deutlich besseren Ergebnissen bei Prüfungen aller Art. Zu diesem Ergebnis kam jedenfalls im Jahr 2018 das Forscherteam um Erik Peper von der San Francisco University. Dabei mussten 125 Studenten eine komplizierte Rechenaufgabe lösen, wobei die Hälfte der Probanden stramm aufrecht sitzen sollte, während die anderen sich nach Belieben auf ihrem Stuhl herumlümmeln durften. Als man die Teilnehmer anschließend befragte, stellte sich heraus, dass diejenigen der ersten Gruppe die Aufgaben als deutlich einfacher empfunden hatten. Dementsprechend waren auch ihre Ergebnisse klar besser. Ganz besonders profitierten von der geraden Sitzposition Studenten, die schon vorher über ihre schwachen Rechenfähigkeiten geklagt und zugegeben hatten, vor Prüfungen regelmäßig Angst zu haben.
Warum aufrechtes Sitzen diesen Effekt hat, darüber können die Forscher nur Vermutungen anstellen. Es scheint so zu sein, dass eine gebeugte Körperhaltung unbewusst an unserem Selbstbewusstsein nagt, was sich wiederum negativ auf unsere Aufmerksamkeit auswirkt. Für diese Theorie, wonach die Sitzposition einen unmittelbaren Einfluss auf die Konzentrationsfähigkeit hat, sprechen unter anderem buddhistische Mönche. Haben Sie schon einmal einen gesehen, der bei seinen Meditationsübungen lässig herumlümmelt? Ich nicht. Nein, es hat schon seinen Grund, dass die Männer in ihren orangefarbenen Kutten entschieden Wert darauf legen, diese Übungen im Lotussitz mit durchgedrückter Wirbelsäule zu absolvieren.
Außerdem signalisiert eine gekrümmte Sitzposition nach Ansicht der Forscher von vornherein eine körperliche und geistige Defensivhaltung. Demnach machen sich Betroffene gleichsam kleiner, als sie tatsächlich sind, und trauen sich entsprechend weniger zu – was die denkbar schlechteste Voraussetzung für ein erfolgreiches Abschneiden ist. Nicht ohne Grund lernt jeder, der ein Seminar über erfolgreiche Verhandlungsführung besucht, zuallererst, wie wichtig es ist, dem Gegenüber aufrecht und »auf Augenhöhe« zu begegnen. Nur so strahlt man Kompetenz und Überzeugung aus. Möglicherweise spielen neben diesen psychologischen Faktoren aber auch körperliche eine Rolle. Es ist durchaus denkbar, dass die »Buckelhaltung« Atem und Kreislauf beeinträchtigt und auf diese Weise die Sauerstoffversorgung des Gehirns beeinträchtigt.
Fazit meiner Studien: Falls Sie zu den Menschen gehören, die sich vor einem Examen, einem Referat oder einer wichtigen Besprechung jedes Mal Sorgen machen, setzen Sie sich dabei betont aufrecht hin. So strahlen Sie nicht nur Selbstsicherheit und Zuversicht aus, sondern verschaffen Ihrem Gehirn auch eine höchst willkommene Extradusche energiespendenden Sauerstoffs.
Halten den Geist fit: Bewegungspausen
Das ist allerdings auch der einzige positive Effekt geraden Sitzens, auf den ich bei meinen Recherchen gestoßen bin. Ansonsten hat die starre Position offenbar nur Nachteile. Und das umso mehr, je länger sie eingehalten wird. Grundsätzlich ist es demnach für die Wirbelsäule mit den zwischen den knöchernen Anteilen gelegenen dämpfenden Bandscheiben am günstigsten, wenn langes Sitzen, etwa vor einem Bildschirm, regelmäßig durch Geh- oder – noch wesentlich besser – kurze Gymnastikpausen unterbrochen wird. Ja selbst wenn man zwischendurch nur immer wieder einmal aufsteht, hat das schon verblüffende Effekte, und zwar nicht nur für den Körper, sondern auch für den Geist. Dazu eine bemerkenswerte Untersuchung, die der Experimentalpsychologe David Rosenbaum und Kollegen von der Universität Tel Aviv im Jahr 2017 durchführten. Sie maßen, in welcher Geschwindigkeit und wie korrekt Probanden den sogenannten Stroop-Test absolvierten. Dabei geht es darum, die Farben gedruckter Farbbezeichnungen so schnell wie möglich zu benennen. Das klingt einfach, ist es aber keinesfalls, wenn beides nicht übereinstimmt, wenn also beispielsweise das Wort »ROT« grün oder das Wort »GELB« blau geschrieben ist. Falls Sie das nicht glauben, probieren Sie es doch einmal aus. Im Internet finden Sie Übungstafeln zuhauf. Dabei stellte sich heraus, dass von mehreren Probandengruppen diejenigen, die kurz vor der Aufgabe aufgestanden waren, deutlich besser abschnitten als ihre sitzen gebliebenen Kollegen. Es ist offensichtlich so, dass der bloße Akt des Aufstehens kognitive und neuronale »Ressourcen« mobilisiert, die sonst ungenutzt bleiben. Noch mehr gilt das, wenn man sich nicht nur erhebt, sondern ein wenig umhergeht. Dass dadurch der sonst bei längerem Sitzen unvermeidliche Abfall der Gehirndurchblutung wirkungsvoll gestoppt wird, belegen mehrere Studien – unter anderem eine der Professorin Sophie Carter und ihres Teams von der Universität Liverpool aus dem Jahr 2018 – überaus eindrucksvoll. Im Kapitel über die positiven Auswirkungen reichlicher Bewegung (»Gesund durch Bewegung?«) werde ich näher auf diese Effekte eingehen.
Doch wo Aufstehen oder Herumgehen – aus welchen Gründen auch immer – angeblich nicht möglich ist, sollten sich die Betroffenen unbedingt das sogenannte dynamische Sitzen angewöhnen. Damit ist schlicht gemeint, die Position immer wieder mal zu wechseln. Denn – darin sind sich die diversen Studien weitgehend einig – weder krummes noch aufrechtes Sitzen ist auf Dauer empfehlenswert. Bei allen für längere Zeit beibehaltenen Positionen produzieren die malträtierten Zellen speziell der Wirbelgelenke und Bandscheiben nämlich Entzündungsbotenstoffe, die das Schmerzzentrum im Gehirn aktivieren. Angehörige der Naturvölker machen uns vor, wie es richtig ist: Sie hocken auf allen möglichen Unterlagen und Schemeln, kauern, ziehen die Beine unter den Körper und strecken sie gleich darauf wieder weit von sich. Sie stützen sich mit beiden Händen nach hinten ab oder verschränken die Arme vor der Brust. Das Ergebnis: Rückenschmerzen sind bei ihnen praktisch kein Thema.
Am besten gelingt das, wenn der Stuhl, auf dem Sie sitzen, über ergonomische Merkmale verfügt, die derartige Positionswechsel unterstützen. Dazu müssen sich die Neigung der Rückenlehne und der Sitzfläche so aufeinander abstimmen lassen, dass sie sich Ihren Bewegungen flexibel und dynamisch anpassen. Als besonders schonend erwies sich in einer Untersuchung US-amerikanischer Wissenschaftler aus dem Jahr 2006, bei der sie den Druck auf die Bandscheiben in verschiedenen Sitzpositionen maßen, das Sich-nach-hinten-Legen. Da dabei die Lehne einen Großteil des Körpergewichts trägt, ist das eigentlich auch kein Wunder.
Fazit meiner Studien: Falls Sie immer wieder längere Zeit im Sitzen – meist vor einem Computer, aber vielleicht ja auch vor dem Fernseher – verbringen, gewöhnen Sie sich an, von Zeit zu Zeit aufzustehen und ein paar Schritte zu gehen. Lassen Sie dabei Kopf und Schultern in beide Richtungen kreisen und schütteln Sie ein paarmal Ihre Arme und Beine aus. Beim Sitzen selbst verändern Sie spätestens alle 15 Minuten die Körperhaltung, um die Rückenmuskulatur zu aktivieren und Verkürzungen zu vermeiden. Dabei ist es durchaus empfehlenswert, dass Sie nicht nur Ihr Gewicht regelmäßig von einer Pobacke auf die andere verlagern, sondern sich auch immer mal wieder ausgiebig rekeln und strecken. Ihr Rücken wird es Ihnen danken.
Ein Bein über das andere – bekommt man davon Krampfadern?
Und was ist mit dem Beine-Übereinanderschlagen? Ist das tatsächlich so schädlich? Nun, dazu gibt es eine ganze Reihe von Untersuchungen, die letztendlich alle zu dem Schluss kommen, dass diese Sitzhaltung schon allein deswegen unbedenklich ist, weil sie auf Dauer alles andere als bequem ist und deshalb nicht allzu lange beibehalten wird. Zwar wäre es theoretisch möglich, dass sehr langes Beine-Übereinanderschlagen Nerven abklemmt und dadurch Lähmungserscheinungen auslöst. Schlimmstenfalls könnte das sogar zur Lähmung eines Nervs namens Nervus peroneus führen, infolge derer es nicht mehr möglich wäre, Fuß und Zehen anzuheben. Doch bevor es so weit ist, breitet sich über das Bein ein zunehmendes Kribbeln aus, das ziemlich rasch so unangenehm wird, dass der Betreffende automatisch eine andere Sitzhaltung einnimmt.
Auch in puncto Krampfadern kann Entwarnung gegeben werden. Keine einzige Studie bringt deren Entstehung ursächlich mit dem Beine-Übereinanderschlagen in Verbindung. Vielmehr sind daran die Gene schuld. Krampfadern entstehen, wenn die ventilähnlichen Klappen in den Venen, die dafür sorgen, dass das sauerstoffarme Blut stets Richtung Herz fließt, defekt sind. Dann lässt das gestaute Blut die Gefäße anschwellen, bis sie als Geflecht dicker blauer Stränge auf der Beinhaut sichtbar werden. Doch die meisten Venen liegen viel zu tief, um vom Druck des oben liegenden Beins abgequetscht zu werden.
Es gibt sogar eine Studie der Erasmus-Universität in Rotterdam, die dem Beine-Übereinanderschlagen eine positive Wirkung attestiert, und zwar deshalb, weil dabei ein bestimmter Hüftmuskel (Musculus piriformis) gedehnt wird. Und das erhöht nach Auffassung der Autoren messbar die Stabilität der Beckengelenke.
Fazit meiner Studien: Ob das Übereinanderschlagen der Beine tatsächlich einen positiven Effekt hat, mag dahingestellt sein. Fest steht jedenfalls, dass es nicht schadet. Wenn Ihnen also danach ist, tun Sie’s getrost. Lähmungen müssen Sie dadurch ebenso wenig befürchten wie Krampfadern.
So weit zu meinen Recherchen in puncto »dynamisches Sitzen« und »Beine übereinanderschlagen«. Für mich hatten sie gleich zwei entscheidende Auswirkungen: Zum einen halte ich mich seither an die – im Grunde einfach zu befolgenden – Empfehlungen, und das mit bemerkenswert positiven Effekten auf meine früher oft so quälenden Kreuzschmerzen. Zum anderen war mein Forscherinstinkt geweckt. Wenn es zu etwas scheinbar so Banalem wie dem Verhalten auf einem Stuhl schon so viel Interessantes und zum Teil auch Überraschendes zu entdecken gab, wie musste das dann erst bei all den anderen gesundheitlich relevanten Themen sein? Wenn ich gängigen Empfehlungen wie »Sport hilft beim Abnehmen«, »Häufiges Saunieren ist gesund«, »Gehirnjogging erhält die geistige Fitness« oder »Täglich ein Glas Rotwein schützt vor Herzinfarkt« auf den Grund gehen und die einschlägigen Untersuchungen und Analysen studieren würde – was würde ich dann erst an Bemerkenswertem und Erstaunlichem zutage fördern?
Und so machte ich mich mit gespannter Vorfreude ans Werk. Ich las Hunderte und Aberhunderte von wissenschaftlichen Untersuchungen, führte ungezählte Telefonate mit Experten, stand mit zahlreichen Wissenschaftlern in E-Mail-Kontakt und schrieb gewissenhaft auf, was ich dabei so alles in Erfahrung brachte. Das Ergebnis dieser umfangreichen Recherche – allen, die mir dabei geholfen haben, sei von Herzen Dank – halten Sie gerade in Händen.
Ich wünsche Ihnen beim Lesen möglichst viele erhellende Aha-Momente. Und natürlich eine Menge neuer Erkenntnisse, deren Beachtung Ihnen persönlich Nutzen bringt. Erkenntnisse, die Ihnen helfen, in Zukunft gesundheitliche Risiken zu vermeiden, und Sie veranlassen, sich künftig öfter so zu verhalten, wie es Ihrem Wohlbefinden zuträglich ist. Die 25 wichtigsten Empfehlungen habe ich am Ende des Buches noch einmal kurz zusammengefasst.
Und noch etwas: Wenn in diesem Buch etwa von Ärzten, Patienten oder Kollegen – aber auch von Ihnen, liebe Leser – die Rede ist, sind natürlich immer auch die weiblichen Pendants, also Ärztinnen, Patientinnen, Kolleginnen und nicht zuletzt Leserinnen, gemeint. Ich finde es nur umständlich und zudem ziemlich albern, jedes Mal beide Geschlechter erwähnen zu müssen. Wenn man sagt, Deutschland habe rund 83 Millionen Einwohner, weiß doch jeder, dass damit auch der weibliche Teil der Bevölkerung gemeint ist. Sonst müsste man ja sagen, es seien 41 ½ Millionen Einwohner und 41 ½ Millionen Einwohnerinnen.
Ich hoffe, Sie sind mit mir einer Meinung.
Duschen, saunieren, Zähne putzen – wann, wie und wie oft?
Jeden Tag duschen – ist das gesund?
Eine Geburtstagsfeier vor etwa einem Jahr. Vergnügte Gäste, die sich in froher Runde miteinander unterhalten. Irgendwann dreht sich das Gespräch um morgendliche Routinen. Ein guter Bekannter, Berufsschullehrer seines Zeichens, erzählt, bei ihm laufe die erste Stunde des Tages sommers wie winters, an Arbeits- ebenso wie an Feiertagen, immer gleich ab. Mit dem einzigen Unterschied, dass diese erste Stunde an Werktagen um 5.50 Uhr, an arbeitsfreien dagegen erst gegen 7.30 Uhr beginne: aufstehen, eine Tasse Kaffee trinken, zur Toilette gehen, ausgiebig duschen, anziehen, frühstücken, dabei eine zweite Tasse Kaffee trinken und Zeitung lesen, anschließend Zähne putzen und dann, je nach Tag, Abmarsch zur Schule oder irgendeine Freizeitbeschäftigung.
»Was? Du duschst jeden Tag?«, fragt eine alleinerziehende Mutter. »Dazu hätte ich beim besten Willen keine Zeit. Und auch, ehrlich gesagt, keine Lust. Ist das denn überhaupt gesund? Nötig doch sicher nicht. Schließlich arbeiten wir ja nicht im Bergwerk.«
»Nach meiner Meinung ist so häufiges Duschen nicht nur unnötig«, schaltet sich ein weiterer Gast ein. »Ich bin sogar fest davon überzeugt, dass das der Haut und den Haaren alles andere als guttut.«
Er hat noch nicht ausgesprochen, da prallen schon die konträren Meinungen aufeinander. Und bald ist eine lebhafte Diskussion im Gange – die noch an Schwung zulegt, als es nicht mehr nur um das Duschen an sich, sondern um die Vor- und Nachteile des Sicheiskalt-Abbrausens geht. Von da ist es nur ein kleiner Schritt zum regelmäßigen Saunieren. Gänsehaut-Kälte oder schweißtreibende Hitze: Was davon ist der Gesundheit förderlich? Oder kann man sich damit vielleicht sogar schaden? Hört man nicht immer wieder, dass jemand unter der eisigen Dusche oder in der heißen Sauna zusammengebrochen ist? Und während unterschiedliche reichlich skurrile Argumente aufeinander prallen, während leidenschaftlich diskutiert und dabei mit Verve versucht wird, andere von der eigenen Auffassung zu überzeugen, nehme ich mir vor, der Sache einmal aus wissenschaftlicher Sicht auf den Grund zu gehen.
Tatsächlich gibt es zu beiden Themen – kaltem Duschen sowie Saunieren – zahlreiche Veröffentlichungen und wissenschaftliche Studien, die ich im Folgenden näher beleuchten möchte. Beginnen wir mit dem Duschen als solchem. Fragt man Hautärzte, so rät die Mehrheit davon ab, sich das täglich anzutun. Vor allem, wenn man dabei auch noch Seife oder Duschgel verwende, argumentieren sie, schwemme man wertvolles Fett aus der Haut und zerstöre deren natürlichen Säureschutzmantel. Die Folge sähen die Mediziner jeden Tag in ihrer Praxis: trockene, gerötete, nicht selten sogar juckende Hautpartien ohne jeden natürlichen Glanz.
Unterstützt wird diese Auffassung von zwei wissenschaftlichen Untersuchungen. Sowohl die Dermatologin Elaine Larson von der New Yorker Columbia School of Nursing als auch ihr Kollege C. Brandon Mitchell von der George Washington University in Washington D. C. warnen vor zu häufigem Duschen und halten zweimal pro Woche für vollkommen ausreichend. Laut Mitchell macht übermäßige Wasseranwendung die Haut auf Dauer spröde und erzeugt Minirisse, durch die krank machende Keime eindringen können. Dieses Risiko steigt mit dem Lebensalter, da die Haut im Lauf der Jahre – ein ganz natürlicher Prozess – zunehmend dünner wird. Besonders, wenn der oder die Duschende die Haut im Bestreben, sie möglichst gründlich zu reinigen, auch noch kräftig abrubbelt, tut er oder sie sich alles andere als einen Gefallen.
Der Vollständigkeit halber sei allerdings erwähnt, dass es auch einige wenige Dermatologen gibt, die im häufigen Duschen kein besonderes Risiko sehen. Sofern dabei nicht jedes Mal Seife, sondern nichts als sauberes Wasser verwendet werde. Aber auch sie stimmen ausnahmslos der These zu, dass es im Sinne einer guten Körperhygiene durchaus genügt, sich zwei- bis dreimal pro Woche abzubrausen.
Fazit meiner Studien: Für die Haut ist es vollkommen ausreichend und wahrscheinlich sogar gesünder, wenn man nur zwei- bis dreimal pro Woche duscht. Dabei sollte man eine pH-neutrale Seife verwenden, die den Säureschutzmantel der Haut nicht angreift. Das Wasser sollte nicht zu heiß sein: 35 Grad Celsius reichen vollkommen aus. Und weder beim eigentlichen Duschen noch beim anschließenden Abtrocknen mit einem Handtuch sollte man sich allzu kräftig rubbeln. Sehr empfehlenswert ist dagegen, der Haut nach dem Duschen mit einer geeigneten Creme die verloren gegangene Feuchtigkeit zurückzugeben.
Und noch etwas: Denken Sie an die Umwelt und duschen Sie nicht länger als nötig. Schon nach vier Minuten haben Sie etwa 40 Liter Wasser verbraucht. Dazu 1,5 Kilowatt Strom – das ist so viel, wie ein Kühlschrank in fünf Tagen benötigt.
Kaltes Wasser – bringt’s das?
Was mich persönlich betrifft, so halte ich mich seither weitgehend an diese Empfehlungen und dusche durchschnittlich nur jeden dritten Morgen. Lediglich wenn ich einmal bei besonders intensiver körperlicher, vor allem sportlicher Betätigung heftig geschwitzt habe, gönne ich mir eine zusätzliche Ladung Wasser. Wobei ich mir seit meiner Jugendzeit angewöhnt habe, den Hebel an der Armatur zum Schluss bis zum Anschlag nach rechts zu drehen und mich etwa eine halbe Minute lang eiskalt abzubrausen.
Als ich das in der Geburtstagsrunde erzähle, stoße ich damit sofort eine neue Diskussion an, bei der bald ebenso heftig debattiert wird wie bei der Frage der Duschhäufigkeit. Ich berichte, dass ich in den letzten Jahrzehnten im Gegensatz zu vielen Freunden und Bekannten nur höchst selten erkältet gewesen sei. Und wenn das doch einmal – in der Regel mit nur leichten Symptomen – vorgekommen sei, hätte ich mich rasch wieder erholt. Wofür ich nicht zuletzt das regelmäßige Kalt-Duschen verantwortlich mache. Mit diesem Statement löse ich bei einigen Gästen wohlwollende Zustimmung, bei anderen jedoch strikte Ablehnung aus. Ich könne doch überhaupt nicht sagen, ob ich ohne meine Kalt-Duscherei nicht ebenso selten einen grippalen Infekt erlebt hätte. Ein Einwand, gegen den ich schwerlich etwas vorbringen kann. So muss ich kleinlaut eingestehen, dass ich mir bisher nie die Mühe gemacht habe zu überprüfen, ob meine Überzeugung, kaltes Duschen härte ab und sei daher gesund, einer wissenschaftlichen Überprüfung standhält.
Das tue ich dann sehr ausführlich gleich am folgenden Tag und fühle mich bestätigt, als ich bei meinen Recherchen auf die Studie eines Forscherteams des Academic Medical Centers in Amsterdam aus dem Jahr 2016 unter der Leitung von Geert A. Buijze stoße. Die Wissenschaftler haben 3000 Freiwillige in vier Gruppen eingeteilt, die allesamt 30 Tage lang jeden Morgen duschen mussten. Doch während die Teilnehmer der ersten Gruppe den Wasserhahn einfach abdrehen durften, wenn sie genug hatten, mussten diejenigen der anderen drei Gruppen ihn zum Schluss bis zum Anschlag auf kalt drehen, und zwar je nach Gruppe 30, 60 oder gar 90 Sekunden lang. Am Ende des Monats bekam jeder Proband einen Online-Fragebogen zugesandt, in dem er Angaben über die individuell empfundene Lebensqualität während der letzten 30 Tage sowie über etwaige krankheitsbedingte Fehlzeiten bei der Arbeit machen musste.
Dabei stellte sich heraus, dass die Versuchspersonen der Kaltwasser-Anwender – in allen drei Gruppen! – knapp 30 Prozent weniger Fehlzeiten hatten als ihre warm duschenden Kollegen, wobei der Ausdruck »Warmduscher« hier natürlich in seiner ursprünglichen Bedeutung gemeint ist. Auf nähere Befragung gaben einige Kaltduscher zwar zu, im Beobachtungszeitraum ebenfalls krank gewesen zu sein, jedoch mit so milden Symptomen, dass sie ihren Beruf problemlos weiter ausüben konnten.
Wie lässt sich dieser Effekt erklären? Professor Buijze führt ihn darauf zurück, dass kaltes Duschen die Muskeln im Bestreben, die Körpertemperatur aufrechtzuerhalten, unwillkürlich zittern lässt. Das löst eine Stressreaktion aus, in deren Verlauf diverse Hormone ausgeschüttet werden – was wiederum das Immunsystem aktiviert, das seinerseits spezielle Abwehrstoffe produziert, um damit eingedrungene Krankheitserreger zu bekämpfen. Und das führt letztlich dazu, dass etwaige Infekte weniger schwer verlaufen und schneller wieder abklingen. Außerdem aktiviert die Kälte sogenannte braune Fettzellen, die in der Lage sind, mittels Oxidation von Fettsäuren Wärme zu produzieren. Möglich ist aber auch, dass daneben der berühmte Placeboeffekt eine nicht unwesentliche Rolle spielt. Das heißt: Wenn ich fest davon überzeugt bin, dass mich kaltes Duschen widerstandsfähiger gegen Erkältungen macht, dann wird es das auch tun. Das hat nur sehr bedingt mit Einbildung zu tun. Vielmehr ist in der medizinischen Forschung längst anerkannt, dass der Placeboeffekt auf komplexen neuropsychologischen Mechanismen beruht, die im Einzelnen allerdings noch nicht restlos verstanden sind.
Ich möchte hier jedoch nicht verschweigen, dass die niederländische Untersuchung von anderen Forschern als mit zahlreichen Mängeln behaftet kritisiert worden ist. So wurde etwa beanstandet, dass 30 Tage viel zu kurz seien, um eine verlässliche Aussage über die Wirkung kalten Duschens zuzulassen. Außerdem sage die Anzahl der Arbeitsunfähigkeitstage nur sehr bedingt etwas über Art und Schwere der zugrunde liegenden Krankheit aus. Doch die meisten Kritiker räumen ein, dass kaltes Duschen in Maßen gesunden Menschen sicher nicht schaden kann.
Wie dem auch sei, ich selbst kann nur bestätigen, dass ich mich nach dem morgendlichen Kalt-Abbrausen – das mir im Winter durchaus nicht immer leichtfällt und bei dem ich manchmal sogar den berühmten inneren Schweinehund überwinden muss – jedes Mal überaus wohl- und fit fühle. Aufgrund meiner jahrzehntelangen Erfahrung bin ich fest davon überzeugt, dass die Kaltwasser-Anwendung einen abhärtenden Effekt hat, der maßgeblich dazu beiträgt, grippale Infekte erst gar nicht zum Ausbruch kommen zu lassen oder sie zumindest in engen Grenzen zu halten.
Fazit meiner Studien: Wenn Sie die kalte Jahreszeit gesund überstehen wollen, drehen Sie am Ende des morgendlichen Duschvorgangs den Hebel bis zum Anschlag auf kalt. Führen Sie dabei den Duschkopf erst ein paarmal um Ihre Unterschenkel herum und dann langsam nach oben. Lassen Sie auch Ihre Brust und – zugegeben am unangenehmsten – den Rücken nicht aus und halten Sie mindestens eine halbe Minute lang durch. Ich verspreche Ihnen: Sie werden sich danach ausgesprochen wohlfühlen. Ihre Haut wird prickeln, Ihnen wird angenehm warm werden, und wenn andere husten, niesen und sich schnäuzen, werden Sie mit hoher Wahrscheinlichkeit gesund bleiben.
Leben Finnen gesünder?
Womit ich noch einmal auf die lebhafte und zum Teil sogar hitzige Unterhaltung während besagter Geburtstagsfeier zurückkommen möchte. Denn wie bereits erwähnt, drehte sich das Gespräch nach dem Warm- und Kalt-Duschen eine ganze Weile um die gesundheitlichen Effekte der Sauna. Auch dazu habe ich anschließend zahlreiche aufschlussreiche Studien gelesen. Mit Abstand die meisten davon stammten aus Finnland, wo Saunieren mehr als irgendwo sonst auf der Welt zum täglichen Leben gehört. Immerhin gibt es in dem Land mit seinen 5 Millionen Einwohnern geschätzte 3 Millionen Saunas. In praktisch jedem Haus findet sich eine, dazu in jedem Hotel und sogar in einigen Flughäfen. Allein in Helsinki kann man unter 100 öffentlichen Einrichtungen wählen. Die traditionelle finnische Sauna ist heiß und trocken. In Kopfhöhe herrschen 80 bis 100 Grad Celsius, am Boden etwa 40 Grad Celsius – wobei die relative Luftfeuchtigkeit nicht mehr als 10 bis 20 Prozent beträgt.
Das wichtigste Ergebnis gleich vorweg: Regelmäßiges Saunieren ist gesund. Das belegen zahlreiche Studien. Übereinstimmend heben sie den positiven Effekt auf Blutdruck, Lungenfunktion und chronische Schmerzen hervor. Daneben wird häufigem Saunieren eine wohltuend-entspannende Wirkung attestiert, die durchaus mit den Effekten spezieller Trainingsprogramme vergleichbar ist. Doch damit nicht genug. Eine groß angelegte finnische Untersuchung aus dem Jahr 2015 belegt sogar, dass regelmäßiges Schwitzen das Leben verlängert, indem es vorbeugend gegen Herz-Kreislauf-Erkrankungen – noch vor Krebs die Todesursache Nummer eins – wirkt. Dabei werteten die Wissenschaftler unter Leitung von Tanjanina Laukkanen von der University of Eastern Finland Fragebögen von 1688 durchschnittlich 63-jährigen Personen aus, in denen diese Auskünfte zu ihrem Lebensstil und speziell auch zu ihren Saunagewohnheiten gegeben hatten. Innerhalb des 15-jährigen Beobachtungszeitraums starben 181 Studienteilnehmer an Herz-Kreislauf-Erkrankungen (von Medizinern kurz »CVD« für »Cardio-Vascular Diseases« genannt). Dabei stellte sich ein linearer Zusammenhang heraus: Je häufiger die Versuchspersonen pro Woche die Sauna benutzten, desto niedriger war ihre CVD-bedingte Todesrate. Bei denjenigen, die zwei- bis dreimal in der Woche in die Sauna gingen, sank das Risiko, an einem Herz-Kreislauf-Leiden zu sterben, um 32 Prozent. Saunabesucher, die vier- bis siebenmal pro Woche schwitzten, reduzierten ihr Risiko sogar um volle 74 Prozent.
Einen entscheidenden Einfluss auf Gesundheit und Lebensdauer hatte aber nicht nur die Häufigkeit des Saunierens, sondern auch dessen jeweilige Dauer. Von 1000 in der Studie erfassten Menschen, die jede Woche 45 Minuten oder mehr in der Sauna verbrachten, starben pro Jahr nur 5,1, während es bei denjenigen, die es nur auf maximal 15 Schwitz-Minuten brachten, mit 9,6 Todesfällen fast doppelt so viele waren, und zwar bei Männern und Frauen gleichermaßen. Allerdings sollte man bei derlei statistischen Erhebungen natürlich immer ein bisschen skeptisch sein. Denn es ist ja durchaus möglich, dass fleißige Saunagänger auch sonst besonders gesundheitsbewusst leben, sich etwa mehr bewegen oder gesünder ernähren als andere.
Doch der Nutzen regelmäßigen Saunierens wird, wie gesagt, auch von zahlreichen anderen Studien bestätigt, sodass man ihn wohl als bewiesen betrachten kann. Doch worauf ist er zurückzuführen? Nun, vor allem wohl darauf, dass häufige Saunabesuche ähnlich wie regelmäßige sportliche Aktivitäten die körperliche Ausdauer erhöhen. Das beweist nicht zuletzt die Untersuchung einer Forschergruppe unter Leitung des australischen Sportwissenschaftlers Will Hopkins von der Universität Melbourne, der männliche Leichtathleten in zwei Gruppen einteilte. Die mussten alle mehrere Wochen lang jeweils zwei Tage hintereinander eine Viertelstunde mit maximaler Anstrengung auf einem Laufband trainieren, was einer Strecke von etwa 5 Kilometern entsprach. Nach dieser Anstrengung besuchten die Teilnehmer der ersten Gruppe jeden Tag eine Sauna, während ihre Kollegen aus der Kontrollgruppe das nicht taten. Schon nach drei Wochen zeigte sich, dass die Saunierer ihre sportliche Leistungsfähigkeit und vor allem ihre Ausdauer deutlich gesteigert hatten: Bis sie vollkommen erschöpft waren, konnten sie eine um knapp 30 Prozent längere Laufstrecke zurücklegen als die Schwitz-Abstinenzler. Bei der ärztlichen Untersuchung zeigte sich, dass die eindrucksvolle Leistungssteigerung vor allem auf ein größeres Blutvolumen zurückzuführen war. Mehr Blut bedeutet eine bessere Sauerstoffversorgung der Gewebe und erleichtert zudem die Regulierung der Körpertemperatur. Regelmäßiges Saunieren ist also, was den gesundheitlichen Nutzen betrifft, durchaus mit intensivem sportlichem Training vergleichbar.
Und wie steht es mit der häufig postulierten Abhärtung, genauer gesagt, der Vorbeugung gegen Erkältungskrankheiten? Aktuelle Studien aus dem Jahr 2017 scheinen diesen Effekt zu bestätigen. Demnach stärkt regelmäßiges und ausdauerndes Saunieren das Immunsystem und beugt insbesondere Atemwegserkrankungen vor. Der von Kritikern vorgebrachte Einwand, an der Erhebung hätten ausschließlich gesunde finnische Männer mittleren Alters teilgenommen, wird von einer anderen Untersuchung entkräftet, die bereits 1990 in der Fachzeitschrift Annals of Medicine veröffentlicht wurde. Dabei hatte eine Gruppe von Wissenschaftlern der Universität Wien unter Leitung des Alternativmediziners Edzard Ernst sechs Monate lang die Häufigkeit grippaler Infekte bei Versuchspersonen aufgezeichnet, von denen die Hälfte häufig saunierte, und dabei festgestellt, dass die Vielschwitzer nur annähernd halb so oft erkrankten wie die Probanden der Kontrollgruppe – was übrigens wohl nicht an den Aufgüssen liegt. Sie bringen zwar die Luft in der Sauna gefühlt zum Kochen, doch dafür, dass sie die gesundheitsfördernden Effekte der Sauna steigern würden, gibt es keinerlei wissenschaftlichen Beleg.
Worüber sich sämtliche Studien – unter anderem eine des schwedischen Wissenschaftlers Bertil Olsson von der Universität Lund aus dem Jahr 2018 – jedoch einig sind, ist die Warnung davor, zu saunieren, wenn man bereits erkältet ist, in der Hoffnung, so schneller wieder gesund zu werden. Denn wer unter einem grippalen Infekt leidet, dessen Immunsystem läuft bereits auf Hochtouren und sollte – ebenso wie Herz und Kreislauf – nicht noch durch zusätzliche Heißkalt-Wechselbäder gestresst werden. Da es bereits mit Volldampf an der Bekämpfung der Erkältungsviren arbeitet, bedeutet Saunieren nur eine massive und vor allem unnötige Zusatzbelastung, die den Genesungsprozess eher behindert, anstatt ihn zu fördern. Und da man als an einer Erkältung Erkrankter selbst kaum beurteilen kann, ab wann dieses Risiko besteht, ist es auch keine gute Idee, gleich bei den ersten Symptomen wie Husten, Schnupfen, Kopf-, Hals- oder Gliederschmerzen auf die heilende Wirkung der Sauna zu hoffen. Oder, um es kurz zu sagen: Wer krank ist, egal in welchem Stadium, hat in der Sauna nichts verloren!
Zum Schluss noch ein bemerkenswerter Aspekt regelmäßigen Schwitzens, dessen Entdeckung in der Fachwelt erst vor wenigen Jahren für beträchtliches Aufsehen sorgte: Saunieren beugt Demenzerkrankungen und speziell Alzheimer vor. Herausgefunden haben das Wissenschaftler unter Leitung der bereits erwähnten finnischen Professorin Tanjanina Laukkanen. Auch wenn die Forscher Risikofaktoren wie Alter, Zigaretten- und Alkoholkonsum, sportliche Aktivitäten, den sozioökonomischen Status sowie andere gesundheitlich relevante Lebensstilfaktoren berücksichtigten, ergab sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen Saunieren und Demenzvorbeugung. Das allerdings nur bei wirklich häufiger Saunabenutzung: Diejenigen Studienteilnehmer, die mindestens fünfmal pro Woche schwitzten – für viele Finnen nichts Besonderes –, hatten ein um etwa 60 Prozent geringeres Erkrankungsrisiko. Als Ursache vermuten die Forscher eine durch das Saunieren verbesserte Funktion der Blutgefäße mit einer daraus resultierenden verminderten Entzündungsneigung sowie eine dauerhafte Stabilisierung des Blutdrucks, also allesamt Faktoren, die auch für die Herz-Kreislauf-Gesundheit eine entscheidende Rolle spielen.
Fazit meiner Studien: Für gesunde Menschen ist regelmäßiges Saunieren absolut zu empfehlen, und zwar je häufiger und länger, desto besser. Mit intensiver sportlicher Betätigung vergleichbar verbessert es vor allem die körperliche Ausdauer. Daneben stärkt es das Immunsystem und wirkt so vor allem Erkältungskrankheiten entgegen. Allerdings ist unbedingt davon abzuraten, bei einer bereits bestehenden Erkrankung auf die heilende Wirkung der Sauna zu hoffen. Damit erreicht man eher das Gegenteil. Schließlich hat häufiges (!) Saunabaden auch einen positiven Einfluss auf die geistige Gesundheit, indem es nachweislich Demenzerkrankungen, speziell Alzheimer, vorbeugt. Also: rein in die Sauna, und das möglichst mehrmals pro Woche!
Zähne putzen – vor oder nach dem Frühstück?
Doch damit war für mich die Recherche zu den bei der Geburtstagsfeier geäußerten Fakten und Behauptungen noch immer nicht zu Ende. Denn eine Frage zu den allmorgendlichen Gewohnheiten des Berufsschullehrers ging mir nicht aus dem Kopf. Der hatte doch erklärt, seine Zähne grundsätzlich erst nach dem Frühstück zu putzen. Ich selbst halte es zwar genauso, weil es mir unlogisch erscheint, die Zähne gleich nach dem Aufstehen zu reinigen und die dazwischen festhängenden Frühstücksreste einfach an Ort und Stelle zu belassen. Schließlich duscht man ja auch nach dem Sport und nicht davor. Doch in letzter Zeit hatte ich immer wieder gehört und gelesen, die Morgenmahlzeit – speziell, wenn dabei Orangen- oder andere Fruchtsäfte konsumiert würden – senke den pH-Wert im Mund. Und das saure Milieu erweiche dann die Oberfläche der Zähne, sodass sie beim anschließenden Bürsten geschädigt werden könnten. Deshalb solle man sie frühestens eine halbe Stunde nach der Morgenmahlzeit putzen. Wenn dafür keine Zeit sei, dann sei das Vor-dem-Frühstück-Putzen die bessere Wahl. Zu empfehlen sei allerdings, folgenden Ratschlag aus einer Broschüre der Bundeszahnärztekammer zu befolgen: »Spülen Sie nach dem Obstverzehr erst mit Wasser, um die Fruchtsäuren im Mund zu verdünnen, warten Sie dann 30 Minuten, damit sich der Zahnschmelz wieder erholen kann. In dieser Zeit sorgt der Speichel durch die in ihm enthaltenen Enzyme und Mineralstoffe für die Remineralisation des Zahnschmelzes.«
Remineralisation – das ist offenbar der entscheidende Vorgang. Man versteht darunter die Wiedereinlagerung der aus dem Zahnschmelz gelösten Mineralstoffe durch den Speichel und damit gewissermaßen dessen »Heilung« von den Säureschäden. Also stürzte ich mich wieder in die Recherche, sprach mit mehreren Zahnärzten und führte ein aufschlussreiches Telefonat mit einem Fachmann der Landeszahnärztekammer. Thema: Soll man die Zähne vor oder nach dem Frühstück putzen?
Eine Umfrage der Splendid-Research-Marktforschung unter 1058 Deutschen zwischen 18 und 70 Jahren aus dem Jahr 2016 belegt, dass beide Varianten etwa gleich viele Anhänger haben: 42 Prozent putzen vor, 45 Prozent nach der Morgenmahlzeit. Der Rest putzt morgens gar nicht, wobei etwa 9 Prozent der Befragten angeben, das nicht zu tun, weil sie grundsätzlich nicht frühstücken.
Erstaunlich viele Studien befassen sich mit dem Thema des optimalen Putzzeitpunkts. Eine derjenigen, die die halbstündige Wartezeit empfehlen, wurde im Jahr 2004 von einer Forschergruppe um den Zahnmedizinprofessor Thomas Attin von der Universität Zürich erstellt. Die Wissenschaftler hatten den Einfluss von Zitronenlimonade auf extrahierte Zähne untersucht, die nach dem 90 Sekunden währenden Säureangriff unterschiedlich lang im Mund einer Versuchsperson verblieben, bevor sie mit einer elektrischen Zahnbürste bearbeitet wurden. Dabei zeigte sich, dass der Verlust an Zahnhartsubstanz nach einer Wartezeit von einer halben Stunde nur noch halb so groß war wie beim Putzen unmittelbar nach dem Kontakt mit der Limonade. Danach hatte weiteres Warten kaum noch einen messbaren Effekt.
Zwar gibt es eine Studie des Kariesforschers Adrian Lussi von der Universität Bern, wonach die Remineralisation der Zähne Stunden bis Tage dauert, sodass es grundsätzlich egal ist, ob man nach dem Essen mit dem Putzen wartet oder nicht. Aber diese Schlussfolgerung scheint mir im Hinblick auf die anderen Studien doch recht fragwürdig. Einig sind sich die Wissenschaftler immerhin darin, dass die Zahnreinigung nach der Mahlzeit unbedingt derjenigen im Rahmen der Morgentoilette gleich nach dem Aufstehen vorzuziehen ist.
Fazit meiner Studien: Putzen Sie Ihre Zähne morgens nach (!) dem Frühstück. Verzichten Sie bei der ersten Mahlzeit am Tag auf stark säurehaltige Getränke wie Softdrinks und Fruchtsäfte, und warten Sie vor der Zahnreinigung vorsichtshalber etwa eine halbe Stunde ab. Sollten Sie dafür keine Zeit haben, ist es trotzdem besser, nach der Morgenmahlzeit zu putzen als vorher. Spülen Sie in diesem Fall Ihren Mund vor der Zahnreinigung gründlich mit Wasser aus. Benutzen Sie keine harte Zahnbürste und üben Sie beim Putzen keinen starken Druck aus. Und vielleicht am wichtigsten: Achten Sie darauf, mit Ihren Putzwerkzeugen sämtliche Zahnflächen – außen, innen, Kauflächen und idealerweise auch die Zahnzwischenräume – zu erreichen. Das heißt: Putzen Sie nicht wild drauflos, sondern systematisch nach einem bestimmten Schema. Und schließlich: Erneuern Sie Ihre Zahnbürste etwa alle drei Monate!
Wie sinnvoll sind Vorsorgeuntersuchungen und Impfungen?
Lohnen sich Vorsorgeuntersuchungen?
Weil wir gerade beim Zähneputzen sind: Warum tut man das eigentlich? Ist doch klar, werden Sie sagen, weil man schädliche Zahnbeläge entfernen und so seine Beißwerkzeuge gesund halten will. Das heißt, man möchte verhindern, dass sie infolge von Karies und Parodontitis frühzeitig verloren gehen. Demnach ist das Zähneputzen wie vieles andere, was wir hoffentlich tagtäglich tun – uns reichlich bewegen, gesund essen, nicht rauchen, zu viel Alkohol meiden etc. –, keine heilende (kurative), sondern vielmehr eine vorbeugende (prophylaktische oder präventive) Maßnahme. Das gilt auch und in besonderem Maße für zwei spezielle Angebote unseres Gesundheitssystems, die wir annehmen, aber natürlich auch ablehnen können: Früherkennungsuntersuchungen und Impfungen. Mit beiden wollen wir uns in diesem Kapitel näher beschäftigen und uns ansehen, was die Wissenschaft dazu sagt.
Zu Sinn und Unsinn von Vorsorgeuntersuchungen gibt es eine große Anzahl wissenschaftlicher Studien, von denen ich im Literaturverzeichnis nur diejenigen aufgeführt habe, mit denen ich mich intensiv beschäftigt oder deren Autoren ich kontaktiert habe. So gut wie einmütig kommen sie zu dem Resultat, dass Kosten und Aufwand in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen und nur einer einzigen Gruppe von Beteiligten einen sicheren, nämlich monetären Vorteil bringen: den Ärzten. Ganz besonders gilt dies für die groß angelegten Reihenuntersuchungen, die man als »Screening« bezeichnet und an denen zum größten Teil Menschen teilnehmen, die keinerlei Symptome aufweisen, welche den Verdacht nahelegen würden, sie könnten in absehbarer Zeit erkranken.
Der bekannte Satz »Vorbeugen ist besser als heilen«, mit dem derartige Untersuchungen oft beworben werden, suggeriert, die regelmäßige Inanspruchnahme könne die Teilnehmer vor einer Erkrankung schützen. Das aber ist nicht der Fall. Früherkennung kann den Ausbruch von Krankheiten nicht verhindern. Der finanzielle und organisatorische Aufwand steht in keinem Verhältnis zum Nutzen. Das gilt umso mehr, als dabei doch eine ganze Menge nicht unerheblicher Schäden angerichtet wird. Eine Ausnahme macht allenfalls die Darmspiegelung zur Entdeckung von Darmkrebs. Denn dabei lassen sich mit minimalem Mehraufwand Schleimhautwucherungen, sogenannte Polypen, entfernen, die sich zu bösartigen Tumoren weiterentwickeln könnten – nicht müssen. An drei bekannten Arten von Früherkennungsuntersuchungen möchte ich die grundsätzlichen Einwände näher erläutern: am Brustkrebs-Screening für Frauen, am Hautkrebs-Screening zur frühzeitigen Entdeckung maligner Melanome (schwarzer Hautkrebs) und an besagter Darmspiegelung.
Schützt regelmäßige Mammografie vor Brustkrebs?
Beginnen wir mit der Brustkrebs-Vorsorgeuntersuchung mittels Mammografie. Diese wird Frauen zwischen 50 und 69 Jahren – für diese Altersgruppe übernimmt die gesetzliche Krankenversicherung die Kosten – auf zahlreichen Internetportalen mit großspurigen Versprechungen ans Herz gelegt, die jedoch einer näheren Überprüfung nicht standhalten. So behaupten auch durchaus seriöse Informationsangebote, das Sterblichkeitsrisiko würde durch das Screening um 20 Prozent reduziert. Das ist, mathematisch gesehen, sogar richtig, und doch grob irreführend. Warum?
Zieht man zur Beurteilung die Zahlen heran, die in wirklich groß angelegten Studien angegeben werden, ergibt sich folgendes Bild: Von jeweils 1000 Frauen, die entweder regelmäßig alle zwei Jahre zum Screening gehen (Gruppe eins) oder nicht (Gruppe zwei), sterben innerhalb von zehn Jahren in Gruppe eins durchschnittlich vier und in Gruppe zwei fünf Frauen an Brustkrebs. Vier gegen fünf: Das sind tatsächlich 20 Prozent. Doch in Wirklichkeit ist es nur eine einzige Frau von 1000, die in den zehn Jahren als Folge des Screenings gerettet wird. Das ist gerade mal 1 Promille! Nach der größten und aktuellsten Studienübersicht, die sich auf die Daten von immerhin 600 000 teilnehmenden Frauen stützt, ist die Risikoreduktion sogar noch geringer. Demnach liegt sie gerade mal bei einem halben Promille. Das bedeutet, dass von 2000 Frauen, die zehn Jahre lang regelmäßig zur Mammografie gehen, nur eine einzige vor dem Tod gerettet wird. Schuld daran ist die Tatsache, dass aggressive Tumoren in der Regel auch dann tödlich enden, wenn sie frühzeitig entdeckt werden, während bei harmloseren Varianten vielleicht überhaupt keine oder zumindest keine dringende Behandlung erforderlich ist.
Aber selbst das könnte man ja noch als – wenn auch äußerst begrenzten und unter Aufwand-Nutzen-Aspekten höchst zweifelhaften – Erfolg werten, wären da nicht die vielen schädlichen Effekte des Screenings. Da ist neben der nicht zu vernachlässigenden Strahlenbelastung zum einen die nicht gerade kleine Zahl von übersehenen Tumoren – die Schätzungen schwanken zwischen 10 und 30 Prozent. In derartigen Fällen wiegt das Screening die Teilnehmerinnen in trügerischer Sicherheit, sodass sie in der Folgezeit möglicherweise verdächtige Symptome missachten und nicht abklären lassen. Zum anderen werden bei etlichen Frauen in der Brust Gewebeveränderungen entdeckt, die gar kein Krebs sind. Nicht nur, dass ein solcher falscher Alarm die armen Betroffenen unnötigerweise in höchste seelische Nöte bis hin zu regelrechter Panik stürzt, immer wieder erfolgen auch Behandlungen, schlimmstenfalls die komplette Entfernung der Brust, die überhaupt nicht notwendig gewesen wären.
Ganz besonders gilt dies für sehr langsam wachsende Tumore, die der Mediziner »Carcinoma in situ« nennt. Es ist unter Fachleuten unbestritten, dass sich ein Großteil solcher bei der Mammografie entdeckter »Pseudo-Krebse« auch ohne jegliche Behandlung spontan zurückbildet. Stattdessen werden die betroffenen Frauen, wenn man ihnen nicht gleich die komplette Brust abnimmt, unnötigerweise bestrahlt oder einer höchst belastenden Chemotherapie unterzogen.
Zusammenfassend kann man sagen, dass das Mammografie-Screening bei den teilnehmenden Frauen das Risiko, an Brustkrebs zu sterben, nicht senkt. Sie leben keinesfalls länger als ihre Geschlechtsgenossinnen, die auf die regelmäßige Röntgenuntersuchung verzichten. Das beweist unter anderem auch eine Übersichtsarbeit, die Studien aus sieben Ländern zusammenfasst und dabei zu dem Ergebnis kommt, dass die regelmäßige Brustkrebs-Früherkennungsuntersuchung die Rate an fortgeschrittenen Brustkrebsen nicht beeinflusst. Oder wie es der Autor der wohl umfangreichsten Studie zu diesem Thema, der dänische Wissenschaftler Peter Gøtzsche, formuliert: »Der wirksamste Weg für eine Frau, nicht zur Brustkrebs-Patientin zu werden, besteht darin, nicht zum Screening zu gehen.«
Zum selben Ergebnis kommt eine Studie von Wissenschaftlern der Universität Toronto unter Leitung des vielfach ausgezeichneten Onkologen Anthony B. Miller, an der knapp 90 000 Frauen im Alter von 40 bis 59 Jahren beteiligt waren. Ich möchte hier nicht näher auf die Einzelheiten eingehen und beschränke mich daher auf die zusammenfassende Wertung der Autoren: Ein über Jahre durchgeführtes jährliches Mammografie-Screening senkte die Brustkrebssterblichkeit bei 40- bis 59-jährigen Frauen im Vergleich zu herkömmlichen Tastuntersuchungen nicht. Dagegen gab es 22 Prozent Überdiagnosen, und einer von 424 Tumoren wurde vollkommen unnötig behandelt.
Fazit meiner Studien: Sparen Sie sich als Frau in der genannten Altersgruppe das Brustkrebs-Screening durch Mammografie. Ganz abgesehen davon, dass es schmerzhaft und mit einer nicht unbeträchtlichen Strahlenbelastung verbunden ist, sind die Chancen, dadurch einen Tumor zu entdecken und behandeln zu können, bevor Sie daran sterben, extrem gering. Dafür gehen Sie das erhebliche Risiko eines falschen Alarms ein, der Ihnen mit Sicherheit zumindest einen gewaltigen Schrecken einjagen wird. Außerdem vermeiden Sie, wenn Sie nicht teilnehmen, dass bei Ihnen möglicherweise Therapiemaßnahmen durchgeführt werden, unter denen Sie massiv leiden, ohne davon den geringsten Nutzen zu haben. Gewöhnen Sie sich stattdessen, falls Sie das nicht ohnehin schon tun, daran, Ihre Brüste regelmäßig auf Gewebsverdickungen im Sinne von Knoten abzutasten, und suchen Sie, wenn Sie fündig werden, einen Frauenarzt zur genaueren Abklärung auf.
Dunkle Flecken auf der Haut: Soll man sie regelmäßig kontrollieren lassen?
Womit wir zu einer weiteren Art von Früherkennungsuntersuchung kommen: dem Screening der Haut zur frühzeitigen Entdeckung eines malignen Melanoms (schwarzer Hautkrebs). Das wurde am 1. Juli 2008 für gesetzlich versicherte Deutsche über 35 Jahre eingeführt. Seither bezahlen die Krankenkassen für den genannten Personenkreis alle zwei Jahre die Kontrolle verdächtiger, sprich dunklerer Hautflecken durch einen speziell geschulten Haut- oder Allgemeinarzt. Rund 15 Millionen Anspruchsberechtigte nehmen das Angebot regelmäßig an. Haben sie davon einen erkennbaren Nutzen?
Eher nicht. Denn erstaunlicherweise ist Deutschland das einzige Land, das sich eine solche Früherkennungsuntersuchung – sie verschlingt mehrere Hundert Millionen Euro im Jahr – leistet. Selbst in Australien, wo der schwarze Hautkrebs infolge massiver Sonnenbestrahlung drei- bis viermal häufiger ist als bei uns, gibt es nichts Vergleichbares. Und das offensichtlich aus gutem Grund, denn wenn das Screening Erfolg hätte, müsste die Melanomsterblichkeit seit 2008 signifikant abgenommen haben. Das aber ist mitnichten der Fall. Obwohl seit Beginn des Massen-Screenings die Zahl der Melanomdiagnosen sprunghaft – immerhin um 25 Prozent – gestiegen ist, sterben an der Krankheit noch immer genauso viele Menschen wie früher.
Das Problem ist, dass es mit weitem Abstand die dicken, über 2 Millimeter messenden Melanome sind, die frühzeitig Tochtergeschwülste (Metastasen) in anderen Organen entstehen lassen und damit zum Tod führen. Nun ja, könnte man einwenden, gerade das sei ja schließlich der Zweck des Screenings: bösartige Hauttumoren im Anfangsstadium, das heißt bevor sie die kritische Ausdehnung erreicht haben, zu entdecken und zu entfernen. Doch dann müsste die Melanomdicke bei den untersuchten Personen Jahr für Jahr abnehmen. Aber das tut sie leider nicht.