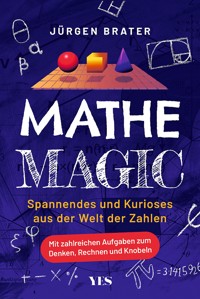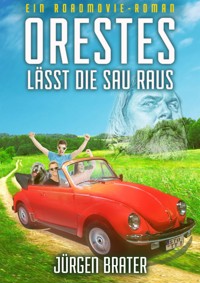11,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Yes Publishing
- Kategorie: Lebensstil
- Sprache: Deutsch
Früher war das Leben viel einfacher. Man wusste, wo man mit dem Hund spazieren geht, ganz ohne GPS. Heute kann die Jugend ohne Google Maps nicht mal den nächsten Supermarkt finden. Oder Onlinebanking – damals steckte man das Geld noch unter die Matratze. Sicher ist sicher. Jetzt soll man seine Ersparnisse einem Computer anvertrauen! Nicht zu schweigen vom sonntäglichen Mittagessen mit der Familie. Hat man einst noch angeregte Gespräche mit den Kindern und Enkeln geführt, kleben mittlerweile alle nur noch an ihren Handys. Hermann, 79-jähriger Ex-Gymnasiallehrer und diesem ganzen neumodischen Zeug gegenüber sehr skeptisch eingestellt, findet sich plötzlich mitten in einem digitalen Dschungel wieder. Doch die neue Zeit bringt noch weitere Ärgernisse mit sich. Plötzlich sagt man "to go" statt "zum Mitnehmen" oder "Sale" statt "Ausverkauf". Und dieses ganze Gendern – früher waren die Dinge noch einfach und klar. Mann war Mann, und Frau war Frau. Punkt. "Für diesen Mist bin ich zu alt!", denkt Hermann – bis die Begegnung mit einer jungen Schülerin ihn zum Umdenken bringt… Ein vergnügliches Buch, in dem Bestsellerautor Jürgen Brater humorvoll erzählt, was Senioren das Leben schwermacht, aber auch dazu inspiriert, selbst in höherem Alter immer wieder Neues zu wagen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 264
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Jürgen Brater
Für denMistbin ich zu alt
Als Senior unter Handystarrern und Sprachverhunzern
Originalausgabe
5. Auflage 2026
© 2024 by Yes Publishing – Pascale Breitenstein & Oliver Kuhn GbR
Türkenstraße 89, 80799 München
Alle Rechte vorbehalten.
Redaktion: Stephanie Kaiser-Dauer
Umschlaggestaltung: Ivan Kurylenko (hortasar covers)
Layout und Satz: Satzwerk Huber, Germering
eBook: ePUBoo.com
ISBN Print 978-3-96905-353-9
ISBN E-Book (EPUB, Mobi) 978-3-96905-354-6
Das Ärgerliche am Ärger ist, dass man sich schadet, ohne anderen zu nützen.
Kurt Tucholsky
Inhalt
Einige erklärende Worte vorab
Ein gemütlicher Nachmittagskaffee
Wer ich früher war und heute bin
Immer mehr Alte in einer immer komplizierteren Welt
Was uns nervt und warum
Sind Manieren heute unmodern?
Armer Goethe
Was soll das?!
Alt sein – eine Schande?
Online, online über alles
Junge Lehrerin, alter Schüler
Handys, wohin man blickt
Sind Computer die klügeren Menschen?
Kein Platz für Senioren
Auch alte Menschen müssen einkaufen
Moderne Autos – nichts für Senioren?
Moderner, aber auch besser?
Telefonieren einst und jetzt
Als Senior vor der Glotze
Lesen hat mal Spaß gemacht
Die Boomer – Ursprung allen Übels?
Einige erklärende Worte vorab
Dies ist die Geschichte von Hermann, einem fast 80-jährigen Ex-Gymnasiallehrer, der betrübt feststellen muss, dass er die Welt um sich herum immer weniger versteht. Wo er hinblickt, sieht er Jüngere, die auf ihr Handy starren, stößt auf fremdsprachliche Begriffe, die er nicht kennt, schüttelt den Kopf über Wörter wie »Mitarbeitende« und »Ärzt_innen« und stößt sich an Umgangsformen, die seine Eltern bei ihm heftig getadelt hätten. Er fragt sich, ob seine Großeltern ihn in vielen Bereichen des Miteinanders wohl ebenso wenig verstanden hätten, wie er das bei seinen Enkeln erlebt, und erkennt zähneknirschend, dass sich das Leben – vor allem in technischer Hinsicht – immer schneller verändert.
Vor allem wenn es um die allgegenwärtige Digitalisierung und den zunehmenden Zwang geht, sich »online« zurechtzufinden, fühlt er sich total hilflos, und vor der immer weiter um sich greifenden »künstlichen Intelligenz« hat er regelrecht Angst. Also beschließt er schweren Herzens, sich den Herausforderungen der modernen Zeit zu stellen, und macht sich nach und nach mit der Handhabung von Computern und Smartphones sowie dem Internet vertraut. Was ihm erstaunlicherweise mit der Zeit sogar Spaß bereitet.
Dieses Buch ist kein klassisches Sachbuch, aber auch kein Roman. Alle vorkommenden Personen sind zwar frei erfunden, haben aber durchaus Bezüge zu realen Menschen aus dem Umfeld des Autors. Der wünscht Ihnen beim Lesen viel Spaß und vielleicht, sofern Sie auch zu den Senioren gehören, den Mut, es Hermann nachzutun und sich zumindest mit den grundsätzlichen Anforderungen unserer modernen technischen Welt auseinanderzusetzen.
Damit Sie immer seltener konstatieren müssen: »Für den Mist bin ich zu alt!«
Ein gemütlicher Nachmittagskaffee
Sonntagnachmittag, halb vier. Sohn Sven und Schwiegertochter Julia mit Enkel Jonathan und Enkelin Kara sind bei uns zu Kaffee und Kuchen eingeladen. Es gibt Zwetschgendatschi mit Sahne, alle futtern vergnügt und beteiligen sich munter an der Unterhaltung. Doch kaum sind Geschirr, Servietten und Besteck weggeräumt, ändert sich die Szenerie dramatisch. Wie auf Kommando hat jeder von den vieren plötzlich ein Mobiltelefon in der Hand. Und schlagartig herrscht eine Stille, als hätte jemand den Ton abgestellt. Alle sind vollkommen in ihre Handys vertieft, tippen schweigend auf den Tasten herum, freuen sich über irgendwelche Nachrichten, Bilder oder Videos. Enkelin und Enkel nehmen grinsend ein Selfie auf – den Ausdruck »Selfie« kannte ich vor wenigen Jahren noch gar nicht –, Sven antwortet wie immer auf angeblich wichtige geschäftliche E-Mails, und Julia tauscht sich vermutlich mal wieder mit den Mitgliedern einer Elterngruppe aus. So versunken sind alle in ihre Handys, dass eine Ratte samt Jungen quer über den Tisch trippeln könnte, und niemand würde sie bemerken. Ja, schlimmer noch: Gäbe die Ratte ein wütendes Piepen oder Quieken von sich, würden mit Sicherheit alle vier denken, sie hätten soeben eine wichtige WhatsApp, E-Mail, Erinnerung oder sonst etwas überaus Bedeutsames erhalten, und würden hektisch tippend, wischend und scrollend – schon wieder so ein neumodisches Wort – danach suchen. Und wenn meine Frau Ella und ich jetzt den Raum verließen, vielleicht um einen Spaziergang zu machen, würde es von unserem Besuch bestimmt niemand mitbekommen.
Mit leiser Stimme, um die vier nicht unnötig zu stören, frage ich, ob wir vielleicht ein gemeinsames Spiel machen wollen. Das war früher, als unsere Enkelkinder noch kleiner waren, eigentlich immer angesagt, und alle hatten ihren Spaß daran. Doch damit ist es vorbei. Zwar machen kurz darauf sechs Würfel die Runde, aber würde man Julia fragen, welche Augenzahl ihre Tochter soeben erreicht hat, müsste sie bedauernd mit den Schultern zucken. Denn sie hat schon wieder ihr Handy vor der Nase. Was Sven und Jonathan allerdings nicht auffällt, da auch sie angestrengt auf ihre Bildschirme starren und dem Spiel keinerlei Beachtung schenken. Schade, geht es mir durch den Kopf, dass man den Smartphones nicht mit einem Handgriff den Strom abstellen kann. Die verblüfften, ja geradezu entsetzten Gesichter möchte ich sehen! Ich blicke Ella an, sie blickt mit hochgezogenen Augenbrauen zurück, dann beschließen wir, das Spiel, obwohl noch längst nicht fertig, kurzerhand zu beenden. Was, wie erwartet, keinen unserer Gäste zu stören scheint. Im Gegenteil! Sven widmet sich wieder schweigend seinen Mails – würde ich jetzt seinen Kaffee gegen Zitronensaft tauschen, er würde es mit Sicherheit nicht bemerken –, Jonathan und Kara vertiefen sich wie ihre Mutter ebenfalls wieder in ihre Handys, und ich nehme ein Buch zur Hand, um zu lesen. Schließlich erhebt sich auch Ella und verschwindet ins Nachbarzimmer, wo unser Fernseher steht. Bevor sie die Tür hinter sich zuzieht und ich mich in meine Lektüre vertiefe, mache ich angesichts des prächtigen Wetters noch den zaghaften Vorschlag eines gemeinsamen Spazierganges. Die einzige Reaktion besteht darin, dass Kara gequält aufstöhnt, die anderen drei haben meine Worte offenbar überhaupt nicht mitbekommen
So vergehen etwa zwei Stunden, dann erklärt Jonathan, er habe für morgen noch Hausaufgaben zu erledigen, Kara will sich mit ihrem neuen Freund treffen, und Sven verkündet, er müsse noch an einer wichtigen Telefonkonferenz teilnehmen. Die drei erheben sich kurz nacheinander und verabschieden sich, nur Julia würde offensichtlich gerne bleiben, offenbar gibt es mit den anderen Eltern noch dieses und jenes zu bereden. Dann sind Ella und ich wieder allein. Und weil die Würfel noch immer auf dem Tisch liegen, spielen wir eben alleine eine Runde und beschließen, beim nächsten Familienkaffee unsere Gäste Gäste sein zu lassen und zusammen ins Kino zu gehen.
Wer ich früher war und heute bin
Doch entschuldigen Sie bitte, ich habe mich ja noch gar nicht vorgestellt. Also hallo, ich bin der Hermann. Ich bin 79 Jahre alt, habe demnächst die ersten acht Jahrzehnte meines Lebens mehr oder minder glücklich und erfolgreich vollendet und damit die aktuelle Lebenserwartung für Männer bereits um ein knappes Jahr überschritten. Allerdings fühle ich mich keineswegs wie Ende 70, sondern mindestens 20 Jahre jünger. Aber das geht ja wohl jedem so: Welches Alter man auch erreicht, immer hätte man erwartet, sich dabei deutlich älter zu fühlen. Mit 20 ist man überzeugt, ein 70-Jähriger sei jenseits von Gut und Böse und müsse vor allem anderen daran denken, sein Testament zu machen und sich um sein Begräbnis zu kümmern. Und wenn man dann tatsächlich 70 geworden ist, hat man keineswegs das Gefühl, ab jetzt zu den Alten zu gehören. An dem Spruch, 70 sei das neue 50, ist also tatsächlich eine Menge dran.
Seit 14 Jahren lebe ich im – wie man so sagt – wohlverdienten Ruhestand, vorher habe ich an einem hiesigen Gymnasium Deutsch und Französisch unterrichtet. 40 Jahre lang und eigentlich immer ganz gerne. Sicher, auch in meiner beruflichen Laufbahn gab es hin und wieder Momente, in denen ich die Schule und alles, was dazugehörte, am liebsten an den berühmten Nagel gehängt oder gar in die Ecke gepfeffert hätte. Aber solche Phasen haben in der Regel nicht lange gedauert, danach bin ich jeden Morgen wieder gerne zur Arbeit gegangen. Zurzeit fühle ich mich, von gelegentlichem Reißen und Zwicken hier und da einmal abgesehen, eigentlich ganz wohl und hoffe, das möge zumindest noch ein paar Jährchen so bleiben. Natürlich ist mir klar, dass die Zahl der Bäume, die ich noch ausreißen werde, begrenzt ist, aber ich habe erst kürzlich von einer Studie der Universität von Südkalifornien gelesen, derzufolge Senioren jenseits der 65 glücklicher sind als alle anderen Altersgruppen. Ich muss sagen, der Erkenntnis kann ich guten Gewissens zustimmen. Deshalb antworte ich auch auf die mir immer mal wieder gestellte Frage, ob ich gerne noch mal 20 oder 30 wäre, mit einem überzeugten Nein. Mein Leben war ein stetiger Wechsel von Aufs und Abs, wobei ich zum Glück sagen kann, dass mir und meiner Frau Ella, mit der ich übrigens 55 Jahre glücklich verheiratet bin, die wirklich schlimmen Abs, damit meine ich Schicksalsschläge wie den Verlust eines Kindes oder eine massive gesundheitliche Beeinträchtigung, bislang erspart geblieben sind. Natürlich haben auch uns Krankheiten heimgesucht, und einige Male mussten wir Chirurgen an uns herumschnippeln lassen. Aber danach ging es uns erfreulicherweise immer wieder gut. Möge es bis zum wohl nicht mehr allzu fernen Ende unseres Lebens so bleiben!
Ella und ich bewohnen in einer mittelgroßen schwäbischen Stadt eine komfortable Eigentumswohnung im Hochparterre – sagt man eigentlich noch so? – eines Mehrfamilienhauses mit Aufzug, Terrasse und überschaubarem Garten. Und, nicht zu vergessen, mit einem Hausmeister, der sich um alles Notwendige kümmert, das Treppenhaus jede Woche von oben bis unten durchwischt sowie – für uns besonders erfreulich – im Winter frisch gefallenen Schnee wegräumt. Wir haben eine Tochter und einen Sohn namens Kerstin und Sven, beide in den frühen 50ern und verheiratet, dazu fünf Enkel: vier Jungen, Elias, Noah, Niklas, Jonathan, und ein Mädchen namens Kara – die beiden Letztgenannten kennen Sie ja schon. Elias, der Älteste, ist 23, Kara, die Jüngste, gerade 17 geworden. Auch sie sind alle gesund, im Allgemeinen guter Dinge und mir, das muss ich bedauerlicherweise konstatieren, in immer mehr Dingen des täglichen Lebens deutlich überlegen. Besonders wenn es um Computer und Digitales geht, kann ich bei Weitem nicht mit ihnen mithalten. Bei derlei Themen könnte man meinen, sie hätten ihr Wissen und Können mit der Muttermilch eingesogen, was aber auch nicht stimmen kann, da ihre beiden Mütter in puncto Datenverarbeitung zu Zeiten ihrer Geburten auch nur bescheidene Kenntnisse hatten. Aber heutzutage lernen die Kinder ja den Umgang mit Informationstechnologie und den dazugehörigen Gerätschaften und Verfahren genauso mühelos, das heißt praktisch nebenbei, wie ihre Muttersprache. Ohne sich bewusst darum zu bemühen, können sie schon in frühen Jahren mit Computern und Handys umgehen, als sei das die einfachste Sache der Welt. Ich werde noch ausführlich darauf zu sprechen kommen.
Meine reichliche Freizeit verbringe ich – wenn ich nicht gerade für ein paar Tage mit Ella irgendwo unterwegs bin, wo es schön ist – vorzugsweise mit Lesen und im Sommer mit Gartenarbeit, die ich sehr liebe. Außerdem gehe ich seit mehr als 30 Jahren begeistert zur Jagd, aber meine Leidenschaft für das Waidwerk hat in letzter Zeit wegen immer weniger Wild und überbordender Bürokratie, besonders bei der Jagd auf Schwarzwild, deutlich nachgelassen, und ich setze mich nur noch auf einen Hochsitz oder nehme an einer Drückjagd teil, wenn ich dazu von einem Jagdfreund persönlich eingeladen worden bin. Morgens um vier Uhr aufzustehen oder die ganze Nacht in der Hoffnung auf Wildschweine im Wald zu verbringen, macht mir schlicht keine Freude mehr. Was mich dagegen notgedrungen immer mehr Zeit kostet, ist der Versuch, mit der heutigen Welt klarzukommen. Was hat sich da seit meiner Jugend nicht alles – und bei Weitem nicht immer zum Vorteil – verändert! Wie Ella und ich mit all diesen Umstellungen und Neuerungen oft mehr schlecht als recht zurechtkommen, darüber möchte ich im Folgenden berichten.
Ist Ihnen übrigens aufgefallen, wie ich Sie, liebe Leserinnen und Leser, zu Beginn dieses Kapitels begrüßt habe? Nicht etwa mit eben diesen Worten und schon gar nicht mit einer offiziellen Anrede wie »Sehr geehrte Damen und Herren«, sondern mit einem überaus schlichten »Hallo«. Denn so grüßt man sich heute allenthalben. Und zwar unabhängig von Anlass und Adressat des Grußes. So wie man sich auch immer mehr duzt. Ich glaube nicht, dass mein Sohn auch nur einen einzigen seiner Kollegen oder Geschäftspartner – die meisten etwa in seinem Alter – jemals mit »Sie« angeredet hat. Wenn ich denke, dass ich sogar meine Studienkollegen und -kolleginnen – die ganz besonders! – im ersten Semester gesiezt habe, hat sich in dieser Beziehung doch enorm viel getan. Und das wird – da bin ich mir sicher – auch so weitergehen. Für mich ist es nur eine Frage der Zeit, bis man – wie schon heute in den skandinavischen Ländern – auch Vorgesetzte und andere hochgestellte Personen hemmungslos mit »Du« anspricht. Zwar werde ich selbst es wohl nicht mehr erleben, aber meine Enkel werden zweifellos irgendwann nichts Besonderes mehr daran finden, wenn sie im Fernsehen sehen und hören, wie sogar der Chef der katholischen Kirche statt mit »Heiliger Vater« mit einem lapidaren »Hallo Franziskus« – oder wie der aktuelle Würdenträger dann gerade heißt – angeredet wird. Alles nur eine Frage von Zeit und Gewohnheit.
Immer mehr Alte in einer immer komplizierteren Welt
Früher sprach man von Menschen jenseits der 70 ganz unverblümt von den »Alten«. Und alt sind sie natürlich nach wie vor. Aber das drückt man heute tunlichst nicht mehr so schonungslos aus. Schon weil es ja nur eine Frage der Zeit ist, bis man selbst zu dieser Kategorie gehört. Heute spricht man lieber euphemistisch von »Senioren«. Klingt doch gleich viel freundlicher. Und vor allem – darauf wird ja allenthalben größter Wert gelegt – bei Weitem nicht so diskriminierend. Denn Senioren gibt es ja immer mehr. Weil die Lebenserwartung seit vielen Jahren steigt und steigt. Allein im letzten Jahrhundert hat sie sich fast verdoppelt, und ein Ende dieser Entwicklung ist nicht abzusehen. 24 Prozent und damit fast ein Viertel der deutschen Bevölkerung zählen heute zu den Senioren, also den über 70-Jährigen, und diese Zahl nimmt stetig zu. 2030 werden es voraussichtlich bereits 35 Prozent sein. Schon heute sind mehr als die Hälfte der Deutschen älter als 60. Auf einen über 75-Jährigen kommen nur noch 12 Personen, die jünger als 75 sind – um 1900 waren das noch 74 –, und 2040 werden es nur noch ganze 6 sein.
Das wäre alles kein Problem, hätte die Welt sich in den letzten rund 150 Jahren nicht immer schneller verändert und wären die technischen Neuerungen nicht so rasant in praktisch alle gesellschaftlichen Bereiche vorgedrungen. Vor Beginn der Industrialisierung, also vor 1850, hätte ein neugeborenes Baby, wenn es zu derlei Gedanken in der Lage gewesen wäre, noch davon ausgehen können, dass die Lebensumstände bei seinem Tod 40 oder 50 Jahre später bis auf minimale Änderungen noch immer dieselben sein würden. Davon kann längst keine Rede mehr sein. Im Gegenteil: Man hat das Gefühl, dass speziell der technische Fortschritt immer schneller und schneller vonstattengeht. Wenn ich nur an meine eigene Kindheit denke: Lesen und Rechnen lernte ich in einer Volksschulklasse mit mehr als 40 Schülern und Schülerinnen mithilfe einer Schiefertafel, auf die man mit einem Griffel schrieb. Was im Übrigen alles andere als einfach war: Entweder man drückte zu wenig auf und konnte dann nichts erkennen, oder man erhöhte den Druck und der Griffel brach ab. Außerdem bekam die Tafel dadurch tiefe Rillen, was nachfolgendes Schönschreiben von vornherein vereitelte.
Wenn wir nicht spurten oder auch nur während des Unterrichts redeten, legte uns der Lehrer kurzerhand übers Pult und zog uns einen Rohrstock über den Hintern. Vielleicht hatte er ja im Knigge von 1955 gelesen, was dort über erfolgreiche Kindererziehung stand: »Jeder ist nur das wert, was er im Interesse seiner Gemeinschaft leistet. Der Junge auf der Schwelle zum Mannestum und das Mädchen auf der Entwicklungsstufe zur Jungfrau haben sich zu läutern, um ein wertvolles Glied in der großen Kette zu werden, die aus grauer Vergangenheit in die fernste Zukunft reicht.« Zu dieser Läuterung hat er jedenfalls nach Kräften beigetragen.
Auf den Straßen sah man praktisch nur buckelige VW-Käfer mit 30-PS-Heckmotoren, in denen die Leute unangeschnallt, ohne ABS, Airbags, Scheibenwaschanlage, Einparkhilfe oder Rückfahrkamera unterwegs waren. Autos, bei denen man zum Herunterschalten noch Zwischengas geben und zum Wechsel von Fahr- auf Fernlicht einen Knopf im Fußraum treten musste. Was zur Folge hatte, dass man nachts bei unvermutet auftauchendem Gegenverkehr mit dem linken Fuß erst mehrmals hektisch ins Leere tappte, bevor man die grelle Beleuchtung abgestellt und den Entgegenkommenden vom Geblendetwerden erlöst hatte. Dafür waren uns aber Probleme mit überfrachteten, aus der Lenksäule ragenden Multifunktionsschaltern zum Auf-und-ab-Kippen, Drehen und Vor-und-zurück-Bewegen gänzlich fremd. Mit denen habe ich, obwohl mir mein Auto eigentlich durchaus vertraut ist, bis heute meine Probleme, und wenn ich etwa den Heckscheibenwischer auf Intervall stellen will, passiert es mir immer wieder, dass plötzlich sein Pendant an der Frontscheibe mit einem Affentempo loslegt. Die Seitenscheiben kurbelte man von Hand herunter, und das Stoffdach, so vorhanden, schob man nach beherztem Entriegeln mit einer einzigen ruckfreien Bewegung zurück, einem lässigen Schwung aus dem Handgelenk, dessen Beherrschung den Fahrer in den Augen fachkundiger Passanten auf den ersten Blick als Experten auswies.
Mein erstes eigenes Auto war natürlich ebenfalls ein Käfer – was sonst? Zwar war der Opel Kadett seinerzeit schwer im Kommen, aber mit den bescheidenen Mitteln, die mir für einen Gebrauchtwagen zur Verfügung standen, und in Anbetracht der Tatsache, dass mir ein Kleinstwagen wie ein Goggo- oder Fuldamobil dann doch zu popelig erschien, kam einzig und allein ein betagter Käfer infrage. Der, den ich schließlich erwarb, war schwarz, besaß als einzigen Luxus eine unten spitz zulaufende Vase am Armaturenbrett sowie – für einen Käfer eher ungewöhnlich – Weißwandreifen in recht ordentlichem Zustand. Den Kaufpreis – gerade mal 1100 Mark – hatte ich mir durch Nachhilfeunterricht verdient, den ich jüngeren Gymnasiasten in Mathe, Physik und vor allem Englisch erteilte – anfangs für drei, später für fünf Mark die Stunde. Zusammen mit meinem Freund Herbert, der nach dem Tod seines Vaters über den elterlichen Käfer verfügen durfte, war ich der Einzige in der Klasse, der mit einem eigenen Auto zur Schule kam.
Irgendwann klemmte bei dem VW die Fahrertür, das heißt, sie ließ sich nicht mehr von innen, sondern nur noch von außen öffnen. Doch wegen einer solchen Lappalie suchte ich natürlich nicht gleich eine Werkstatt auf, sondern kurbelte eben vor dem Aussteigen jedes Mal das Seitenfenster herunter, sodass ich bequem den äußeren Türöffner erreichen konnte. Daran gewöhnte ich mich mit der Zeit derart, dass ich, wenn ich ausnahmsweise einmal ein anderes Auto – etwa das meines Vaters – fahren durfte, vor dem Parken ganz automatisch die Fensterkurbel bediente. Und als ich mit meinem Käfer beim TÜV vorfahren musste und der Prüfer eine Runde auf dem Hof drehen wollte, lief ich einfach nebenher und riss, als der Mann anhielt, scheinbar beflissen die Tür von außen auf. Das funktionierte prima.
Ein echtes Problem war das Nichtvorhandensein einer Scheibenwaschanlage, speziell bei Schmuddelwetter, bei dem das vorausfahrende Auto eine Wasser-Matsch-Spray-Fontäne hinter sich herzog, die binnen kurzer Zeit meine Frontscheibe zukleisterte. Um in einer solchen Situation noch eine halbwegs gute Sicht nach vorne zu haben, konnte ich zwischen zwei Möglichkeiten wählen, von denen eine so schlecht war wie die andere. Zum einen konnte ich den Abstand zum Vorausfahrenden so groß halten, dass mich der von ihm hochgewirbelte Schmutz nicht mehr traf, zum anderen konnte ich umgekehrt so nahe an ihn heranfahren, dass möglichst viel Wasser gegen meine Frontscheibe klatschte. Das konnte ich dann als Scheibenwaschflüssigkeit verwenden. Variante eins führte zu wütenden Hupkonzerten der hinter mir Fahrenden, speziell, wenn sie an einer auf Grün schaltenden Ampel nicht losfahren konnten, weil ich erst startete, wenn sich mein Vordermann schon mindestens 50 Meter entfernt hatte. Und bei Variante zwei, dem dichten Auffahren, bestand natürlich für den Fall, dass der Vorausfahrende plötzlich bremsen musste, ein sehr hohes Risiko, von hinten in sein Auto zu knallen. Ich entschied mich trotzdem so gut wie immer für diese zweite Alternative und kann stolz resümieren, dass ich einen Auffahrunfall immer, wenn auch manchmal wirklich erst im allerletzten Moment, vermeiden konnte.
Bei alledem muss man natürlich berücksichtigen, dass die Verkehrsdichte mit der heutigen nicht einmal ansatzweise vergleichbar war. Denn ein Auto war seinerzeit ebenso ein Luxusartikel wie ein Telefon und später ein Fernseher. Und Computer gab es natürlich noch lange nicht. Wie wenig meine Enkel sich das vorstellen können, bewies Jonathan, als er mich neulich mit gerunzelter Stirn fragte: »Und wie kamt ihr dann ins Internet?«
Nach den Hausaufgaben ging es bei nahezu jedem Wetter raus ins Freie, wo wir ebenso begeistert wie verbotenerweise in einer der vielen Nachkriegsruinen Verstecken oder Räuber und Gendarm spielten. Mangels technischer Kommunikationsmöglichkeiten hatten unsere Eltern stundenlang nicht die geringste Ahnung, wo wir uns herumtrieben – für heutige Väter und Mütter ein undenkbarer, Panikattacken und Schnappatmung auslösender Zustand. Solange wir zum Abendessen wieder zu Hause waren, war alles in bester Ordnung. Unsere Mütter wuschen unsere verdreckten Klamotten einmal pro Woche am sogenannten Waschtag in der Gemeinschaftswaschküche unseres Mehrfamilienhauses. Wobei die Wäsche bei Weitem nicht so umfangreich war wie heutzutage, weil wir viel länger ein und dasselbe Hemd, dieselbe Hose und dieselben Strümpfe trugen und selbst unsere Unterwäsche nur wöchentlich wechselten. Ich komme noch darauf zu sprechen.
So wie auch Baden nur einmal pro Woche, bei uns stets am Samstagnachmittag, stattfand. Nach langwierigem Aufheizen des Warmwasserboilers mit Holz und gerne auch Fichtenzapfen waren genau zwei Wannenfüllungen möglich, von denen die eine unseren Eltern, die andere meinem Bruder und mir zustand. Jedes zweite Mal war ich derjenige, der in das trübe Nass steigen musste, in dem Schmutz, Schweiß und Haare meines Bruders schwammen, aber wenn ich meinen eigenen, im Lauf der Woche kumulierten Schmutz und Mief loswerden wollte, blieb mir keine andere Wahl. Allerdings empfand ich das wöchentliche Ritual damals als gar nicht so eklig, wie es mir heute vorkommt, auch wenn ich lieber der erste als der zweite Wannennutzer war. Und wenn wir Jungen nach dem Fußballspielen auf dem Platz neben der Kirche – eine unserer absoluten Lieblingsbeschäftigungen – auch noch so verdreckt waren und schwitzten, dass man unsere Kleidung hätte auswringen können: Wir konnten uns im Badezimmer, so hieß das seinerzeit, nur so gut es ging mit dem Waschlappen abwischen. An eine Dusche, wie sie heute für uns selbstverständlich ist, war unter der Woche überhaupt nicht zu denken.
Wie hat sich das Leben seit damals verändert! Kickende Jungen sieht man heute ebenso wenig wie Ball-an-die-Wand spielende oder Kästchen hüpfende Mädchen. Die Freizeit verbringen die Kinder und Jugendlichen heute größtenteils vor dem Computer. Was man damit alles machen kann, lernen sie von klein auf und sind uns Alten in dieser Hinsicht daher schon im Grundschulalter meilenweit voraus. Wollen wir auch nur einigermaßen mithalten – und ganz ohne digitale Gerätschaften ist das Leben ja kaum mehr möglich –, sind wir, ob es uns passt oder nicht, gezwungen, bei unseren Kindern und Enkeln in die Lehre zu gehen. Früher lernten die Jungen von den Alten, heute ist es in vielen Bereichen des modernen Lebens umgekehrt. Wobei das mit dem Lernen mit fortschreitendem Alter immer schwieriger wird. Unsere Großeltern waren, wenn sie sich nur ein bisschen anstrengten, noch einigermaßen in der Lage, bei den technischen Neuerungen einer sich kontinuierlich verändernden Welt auf dem Laufenden zu bleiben. Heute ist uns das ganz und gar unmöglich. Da muss man schon froh sein, wenn man von den wichtigsten Trends zumindest gehört hat. Zumal deren Bedeutung einem enormen zeitlichen Wandel unterliegt.
Beispiel Fax. Als ich irgendwann in den 1990er-Jahren in der Wohnung eines jüngeren Lehrers mit offenem Mund zusah, wie aus einem mir völlig unbekannten Gerät plötzlich etwas Gedrucktes herauskam, war ich schlichtweg baff. So funktioniere das, erklärte mir mein Kollege überlegen lächelnd, so kommuniziere man heutzutage miteinander, der umständliche und zeitraubende Versand von Schriftstücken per Post sei vorbei – vermutlich sagte er »out« –, dem Fax gehöre die Zukunft. Und heute? Gerade mal 30 Jahre später? Wer benutzt da noch ein Faxgerät? Heute ist E-Mail angesagt. Mit allen möglichen Anhängen, wobei selbst das Verschicken von Fotos und umfangreichen Videos problemlos möglich ist. Und das Ganze in Sekundenschnelle, weltweit und an beliebig viele Empfänger gleichzeitig. Für mich ein Wunder! Aber auch auf Computer und Co. komme ich noch ausführlich zu sprechen.
Fakt ist, dass Altsein noch nie so kompliziert war wie heute. Waren in früheren Zeiten die Senioren diejenigen, zu denen die Jungen bewundernd aufschauten und auf deren Rat sie große Stücke hielten, ist es heutzutage umgekehrt. Den Jungen gehört die Welt, wir Betagten werden allenfalls mitleidig belächelt. Das geht mittlerweile so weit, dass man sich manchmal regelrecht schämt, sein Alter zu nennen, so als wäre es ein selbst verschuldetes Manko. Milliarden werden für alle möglichen Methoden und Mittelchen ausgegeben, die versprechen, den Anwender optisch ein paar Jahre frischer aussehen zu lassen, und der Satz »Ich hätte sie jünger geschätzt« gilt als das ultimative Kompliment schlechthin. Und zwar schon lange nicht mehr nur für Frauen.
Als ob man mit derlei Tricksereien den altersbedingten körperlichen und geistigen Abbau, ja, sagen wir getrost Verfall, verhindern könnte. Der ja auch völlig normal, das heißt physiologisch ist. Stehen in den ersten 20 Lebensjahren Aufbau und Reifung der körperlichen Systeme im Vordergrund, so übernimmt in den letzten 20 eben das Gegenteil, der allmähliche Abbau, die Hauptrolle. Und wenn dieser Abbau so weit fortgeschritten ist, dass nichts mehr richtig funktioniert, dass das Herz nicht mehr kräftig pumpt, die Lungen nur noch mit Mühe Luft in den Körper bringen, Leber und Nieren das Blut nicht mehr ausreichend von giftigen Substanzen befreien und das Immunsystem immer häufiger schlappmacht, endet das Ganze unweigerlich mit dem Tod. So einfach ist das. Je früher wir das einsehen, desto besser. Die Kindheit bereitet uns auf das Leben vor, das Alter auf den Tod. Und weil das ebenso simpel wie unabänderlich ist, bringt es überhaupt nichts, sich darüber aufzuregen oder ständig zu lamentieren. Viel sinnvoller ist es doch, am Lebensabend die noch verbliebenen Kräfte dazu zu verwenden, sich mit den permanenten Veränderungen unserer Lebensumstände so gut wie möglich zu arrangieren. Das ist weiß Gott – denken Sie nur an die pausenlos fortschreitende Digitalisierung – schwer genug. Denn auch wenn wir uns noch so anstrengen, es wird immer mehr Dinge geben, die uns Probleme bereiten. Immer mehr, was uns ängstigt oder gar ärgert, worüber wir uns wundern oder was wir schlicht nicht mehr verstehen. Oder unverblümt gesagt: wofür wir uns zu alt fühlen.
Was uns nervt und warum
Genau genommen sind Sich-Ärgern und Genervt-Sein keineswegs ein und dasselbe. Wir ärgern uns über ein einzelnes Ereignis, einen unglücklichen Vorfall oder ein konkretes, in unseren Augen dämliches oder unhöfliches Verhalten eines anderen Menschen. Auf die Nerven geht uns dagegen erst ein wiederkehrendes Ärgernis, ein Problem, das wir gerne abstellen würden, aber aus irgendwelchen Gründen nicht können, und in Bezug auf unsere Mitmenschen die eine oder andere Person, mit der wir, warum auch immer, einfach nicht klarkommen. Ein Mensch, der uns in der Straßenbahn auf den Fuß tritt, ohne sich zu entschuldigen, ärgert uns, einer, der uns jeden Morgen albern lächelnd mit den Worten begrüßt »Na, süße Träumchen gehabt?«, der nervt.
Ein gutes Beispiel für extreme Nervensägen ist Gregor, ein Junggeselle, der in unserem Haus im zweiten Stock wohnt und mit dem zusammenzutreffen ich, wenn irgend möglich, tunlichst vermeide. Er ist Realschullehrer, schätzungsweise Mitte 30, und wenn ich ihm trotz aller Vorsicht doch einmal über den Weg laufe, fängt er unweigerlich sofort an, heftig zu jammern. Über die Scheißschule mit dem Scheißschulleiter und vor allem den Scheißschülern, die sich für nichts, aber auch gar nichts interessieren. Dabei sei Biologie doch ein hochspannendes Fach – man denke nur an Genetik, Immunsystem und Evolution –, und von Chemie keine Ahnung zu haben, könne man sich in unserer wissenschaftlich geprägten Welt einfach nicht mehr leisten. Findet jedenfalls Gregor. Natürlich solle man von Goethe, Shakespeare, Mozart und Rembrandt schon mal gehört haben, aber wer keine Ahnung von Fotosynthese, Zellaufbau und Gentechnik habe, passe einfach nicht in die moderne Zeit.
Dass ich einmal von einem Bekannten, zufällig Vater einer seiner Schülerinnen, erfahren habe, Gregor strahle nach Aussage seiner Tochter permanent eine geradezu penetrante Lustlosigkeit aus und mache einen derart stinklangweiligen Unterricht, dass ihm – wie bei einer Predigt in der Kirche – beim besten Willen niemand zuhören könne, binde ich ihm besser nicht auf die Nase. Sonst ist für mich der Tag endgültig verdorben. Zumal dann unweigerlich die mit säuerlichem Lächeln vorgetragene Anmerkung kommt, wie gut ich es als Ruheständler doch hätte, so ganz ohne Vorgesetzte, Stress und ebenso undankbare wie unbelehrbare, dazu noch katastrophal schlecht erzogene Halbwüchsige. Dann dauert es nicht mehr lang, bis er für die brutal überlasteten Lehrer den Ruhestand mit 50 fordert. Dass der Lehrerberuf jedes Jahr so viele Urlaubstage mit sich bringt wie sonst kein anderer – eine Tatsache, die mich maßgeblich bei der Berufswahl beeinflusst hat –, will er schlicht nicht gelten lassen, denn mit noch mehr Arbeitstagen wäre der Stress beim besten Willen nicht auszuhalten. Dann bin ich jedes Mal kurz davor, ihn zu fragen, warum in Gottes Namen er ausgerechnet Lehrer geworden ist. Ob ihn etwa jemand dazu gezwungen hat. Aber was soll’s. Es gibt nun mal solche Null-Bock-Typen, denen es niemand recht machen kann, die an allem und jedem etwas auszusetzen haben. Und das keinesfalls nur unter uns Älteren.
Doch wenden wir uns im Folgenden Dingen zu, die uns vor allem deshalb nerven, weil wir uns von ihnen aufgrund des rasanten technischen Fortschritts schlicht überfordert fühlen. Wobei wir unser mangelndes Verständnis zweifellos noch dadurch verstärken, dass wir unsere modernen Lebensbedingungen viel zu oft mit denen unserer Kindheit und Jugend vergleichen und dabei, ob bewusst oder unbewusst, denken: »Muss das unbedingt sein? Früher ging es doch auch ohne!« Und dabei genau wissen, dass uns diese Frage überhaupt nichts nützt, sondern im Gegenteil dazu führt, dass wir uns mit jedem Jahr, das wir älter werden, den Jüngeren gegenüber unterlegen, ja oft sogar regelrecht rückständig fühlen.
Dabei gibt es doch eigentlich keinen Grund, uns unseres Altseins zu schämen, denn was wäre die moderne Welt ohne uns? Viele von uns engagieren sich in einem Ehrenamt, arbeiten bei kirchlichen Veranstaltungen mit, betätigen sich in Sportvereinen, als Wahlhelfer, im Tierschutz oder – besonders aktuell – im Rahmen der Flüchtlingshilfe. In der Zeitung liest man im Zusammenhang mit alten Menschen immer nur von Alters-, Renten- und Pflegelast, also von den Kosten und nicht auch vom unbestreitbaren Nutzen der Senioren. Warum sieht man in älteren Menschen fast ausschließlich Empfänger irgendwelcher von den Jungen zu finanzierender Leistungen und nicht auch Werte-Schaffende? Warum vernachlässigt man ihre unbestreitbare Bedeutung als Wirtschaftsfaktor? Zahlreiche produzierende Firmen sind von den Betagten abhängig, und zwar keineswegs nur im Hinblick auf Sehhilfen, Hörgeräte, Treppenlifte, Rollatoren, Inkontinenzprodukte und derlei Dinge. So manches Reiseunternehmen könnte schließen, gäbe es die unternehmungslustigen Senioren nicht. Ja, Umfragen unter Älteren haben sogar ergeben, dass nicht wenige von ihnen durchaus bereit wären, für Reisen noch deutlich mehr Geld auszugeben, wenn es mehr auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnittene Angebote gäbe.
Gemäß einer Verlautbarung der Gesellschaft für Konsumforschung – das habe ich erst vor Kurzem mit großem Interesse gelesen – gehören Senioren zu den konsumfreudigsten Kundengruppen überhaupt. Der Wert der von ihnen Jahr für Jahr in Deutschland gekauften Produkte liegt bei schätzungsweise 640 Milliarden Euro. Da erstaunt es doch sehr, dass immer mehr Unternehmen ihre Erzeugnisse vor allem online anbieten und keine Zugangsalternativen für all jene bereitstellen, die weder über einen Computer noch über ein Handy verfügen oder sich mit dem Internet schlichtweg nicht auskennen. Das Familienministerium hat dieses Missverhältnis erkannt und versucht, die Senioren zu unterstützen. In seinem aktuellen Altenbericht kommt es zu dem Ergebnis, dass »die Lebensphase Alter nicht mit Krankheit und Unproduktivität gleichgesetzt werden kann, sondern Ältere – beschönigend als Silver oder Best Ager bezeichnet – bereits heute einen großen Beitrag zum gesellschaftlichen Wohlstand erbringen«.
Und man muss wahrlich kein Mathematiker, Weissager oder Wirtschaftswissenschaftler sein, um zu erkennen, dass sich die Diskrepanz zwischen Angebot und Zielgruppenbedürfnissen immer mehr verstärken wird, je mehr Senioren es im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung gibt.