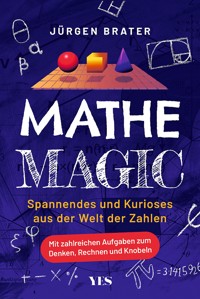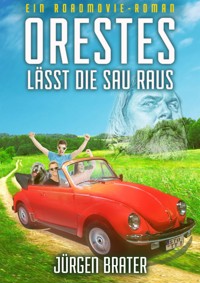7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: FISCHER Digital
- Kategorie: Wissenschaft und neue Technologien
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2016
Warum sind rote Rosen rot? Warum sind Schimpansen mit uns Menschen näher verwandt als mit Gorillas? Und was hat es eigentlich mit Gentechnik und Stammzellen auf sich? Beim täglichen Spaziergang mit seinem Hund Sina setzt sich Dr. Jürgen Brater mit diesen und vielen weiteren Fragen der Biologie auseinander. Ein Jahr lang hat er die Vorgänge und Veränderungen in der Natur beobachtet und erläutert nun anhand dessen, was er Monat für Monat am Wegesrand gesehen hat, die vielfältigen Geheimnisse der Biologie. ›Wie mein Hund die Biologie entdeckte‹ informiert, erklärt und ist zudem äußerst unterhaltsam! (Dieser Text bezieht sich auf eine frühere Ausgabe.)
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 405
Ähnliche
Jürgen Brater
Wie mein Hund die Biologie entdeckte
Von Photosynthese bis Immunsystem: Ein Spaziergang durch das Leben
FISCHER Digital
Inhalt
Für Gaby Diener mit Dank
Unser täglicher Weg
Wer einen Hund sein Eigen nennt, weiß, dass ein solches Tier neben dem ständigen Verlangen nach Essbarem vor allem ein Bedürfnis hat: im Freien herumzutollen. Und das bei jedem Wetter. Bei strahlendem Sonnenschein ebenso wie bei prasselndem Regen, dichtem Nebel, wildem Schneetreiben oder strengem Frost; ja, selbst dann, wenn man einer ebenso verbreiteten wie missverständlichen Redensart zufolge nicht einmal einen Hund vor die Tür jagt. Das hat durchaus sein Gutes, denn so wird auch das Herrchen gezwungen, sich mehrfach täglich aus dem bequemen Sessel zu erheben und einen mehr oder minder langen Ausflug durch die Natur zu unternehmen. So geht es auch mir: Jeden Tag gehe ich morgens, mittags und abends mit meiner Münsterländer Hündin hinaus, und mindestens einen dieser drei Spaziergänge dehnen wir beide ziemlich lang aus, indem wir »unseren Weg« nehmen.
Der beginnt etwa 400 Meter von unserer gemeinsamen Wohnung entfernt hinter den letzten Häusern der Siedlung. Insgesamt etwas mehr als 3 Kilometer lang zieht er sich zuerst ein Stück durch einen vorwiegend aus Buchen und Fichten bestehenden Mischwald, biegt danach auf einen grasbewachsenen Feldweg ein, überquert eine schmale, hölzerne Brücke und schlängelt sich in umgekehrter Richtung, spärlich geschottert, am Ufer des Sauerbachs entlang. Dann schwenkt er nach rechts ab, steigt, von Pappeln gesäumt, einen langgezogenen Hang hinauf, verläuft quer durch einen uralten Bauernhof, fällt auf der anderen Seite, von nun an asphaltiert, in zwei sanften S-Kurven wieder ab, um nach einer weiteren, diesmal steinernen Brücke wieder den Ausgangspunkt zu erreichen.
Wenn man langsam geht, braucht man eine knappe Stunde; und weil Sina und ich uns grundsätzlich viel Zeit lassen, kommt es nicht selten vor, dass wir sogar noch eine ganze Weile länger unterwegs sind. Diesen Weg kenne ich, um eine arg strapazierte Floskel zu benutzen, wie meine Westentasche, wobei der Vergleich insofern hinkt, als es in meiner Westentasche immer mehr oder minder gleich aussieht, während die Natur links und rechts des Weges unablässig ihr Gesicht verändert und immer wieder mit neuen Überraschungen aufwartet.
Ich weiß nicht, wie oft ich den Pfad im Lauf der Jahre schon entlangmarschiert bin, aber ich bin sicher, dass keine zwei Spaziergänge völlig identisch waren. Mir scheint vielmehr, dass eine Landschaft, die man voller Neugier, mit offenen Ohren und wachen Augen durchstreift, die man mit allen Sinnen zu sehen, hören, schmecken und riechen trachtet, sich dem Bewusstsein immer weiter öffnet. Wer ein Tal, einen Bergkamm, einen Wald oder eine Flussaue nur ein einziges Mal durchwandert, kann allenfalls einen oberflächlichen Eindruck gewinnen, kann vielleicht sogar ein grobes Urteil über die charakteristische Eigenart eines Fleckchens Erde mit all seinen tierischen und pflanzlichen Bewohnern fällen, aber es verstehen, das kann er nicht. Dazu gehört unbedingt, dass man dieselbe Strecke zu unterschiedlichen Tages- und Jahreszeiten zurücklegt, dass man erlebt, wie verschieden ein und dieselbe Umgebung morgens, mittags, abends und durchaus auch nachts erscheint und wie sie im Lauf der Wochen und Monate eines Jahres ihr Gesicht immer wieder vollkommen wandelt, sodass man bisweilen Mühe hat, sie wiederzuerkennen.
Ein Höhepunkt am Rande unseres Weges ist eine von einem großzügigen Spender gestiftete Bank, die die Gemeinde an einem idyllischen Plätzchen nicht weit vom Bachufer entfernt aufstellen ließ, eine Ruheinsel aus farblos lackiertem Kiefernholz, die erstaunlicherweise so gut wie nie besetzt ist. Wann immer es die Witterung erlaubt, lasse ich mich dort für ein Viertelstündchen, bisweilen auch erheblich länger, nieder und mache mir über all das Gedanken, was Sina und ich am Wegesrand gesehen und erlebt haben. Während ich das Fell meines Hundes kraule, denke ich über die vielfältigen Eindrücke nach, die uns die Natur in geradezu verschwenderischer Fülle bietet, über das, was aus wissenschaftlicher Sicht dahintersteckt, und warum wir es so und nicht anders erleben. Denn eines steht für mich fest: Die Natur in all ihrer Vielfalt und Pracht, aber auch in ihren oft unverständlichen Aspekten, die uns beim ersten Erleben manchmal sogar mit Abscheu erfüllen, verdient unsere Achtung, ja, sagen wir ruhig, unsere Demut. Wir brauchen die Natur, sie braucht uns nicht!
Von diesen Spaziergängen mit meiner Hündin, die mich immer wieder mit ihren feinen Sinnen, vor allem ihrer überragenden Nase verblüfft und mich auf Dinge aufmerksam macht, an denen ich ohne sie achtlos vorüberginge, möchte ich berichten. Von Streifzügen durch die Natur, auf immer demselben Weg, aber zu unterschiedlichen Zeiten. Mal begleitet vom morgendlichen Konzert der Vögel im Frühjahr, mal in der sommerlichen Mittagshitze, wenn Sina mit heraushängender Zunge hechelnd neben mir hertrottet. Mal auf buntem, unter den Füßen raschelndem Herbstlaub und nicht zuletzt bei beißender Kälte durch frischgefallenen Schnee, wenn der Atem wie eine kleine Eiswolke in der Luft hängt.
Ich möchte dabei von der Vielfalt des Lebens erzählen, die es bei einer solchen Runde am Rand des Weges zu sehen, hören und riechen gibt. Von den manchmal geradezu unglaublichen Erscheinungen der Natur, die uns immer wieder aufs Neue staunen lassen, wenn wir nur offenen Auges, wachen Sinnes und voller Neugierde unterwegs sind. Von den Eigenschaften der verschiedenen Organismen, den Stoffen, aus denen sie bestehen und ihren charakteristischen Unterschieden, von der Fähigkeit der Pflanzen, organische Substanz zu produzieren, ohne die wir alle verhungern müssten, und Sauerstoff, ohne den wir nicht atmen könnten. Von den allenfalls unter dem Mikroskop sichtbaren, so ungemein faszinierenden Vorgängen in den Zellen tierischer und pflanzlicher Lebewesen, von ihrer Ernährung und Energiegewinnung, ihren oft geradezu unglaublich erscheinenden Sinnesleistungen und ihrem Abwehrkampf gegen feindliche Moleküle. Aber auch von nur mittelbar damit zusammenhängenden Phänomenen wie den erstaunlichen Fähigkeiten embryonaler Stammzellen, der Erzeugung von Klonen oder der Manipulation von Erbanlagen durch uns Menschen. Und nicht zuletzt ist es mir ein Anliegen, die Wissenschaftler vorzustellen, die es zu ihrem Lebensziel erkoren haben, unter teils enormem zeitlichem und ideellem Aufwand immer neue Erkenntnisse über all diese unglaublichen Vorgänge, Fakten und daraus resultierenden Folgerungen ans Tageslicht zu bringen.
Unternehmen wir also gemeinsam einen Streifzug durch die wunderbare Welt der Biologie, erkunden wir die Geheimnisse des Lebens.
Januar Was lebt
Die Konturen des nahen Waldes sind in der Morgendämmerung nur zu erahnen, als ich mich an diesem Januarsonntag mit Sina auf den Weg mache. In der Nacht ist reichlich Neuschnee gefallen, und ich möchte unbedingt draußen sein, solange die Spuren der Tiere noch nicht verweht sind. Ich nehme den Hund, der seine Nase bereits tief in die erste Rehfährte steckt und begierig den Duft aufsaugt, vorsichtshalber an die Leine und hefte im Weitergehen den Blick fest auf den Boden.
Für denjenigen, der die Spuren im Schnee in all ihrer Vielfalt zu deuten weiß, sind die Bewegungen der Tiere in Wald und Feld zu keinem anderen Zeitpunkt so leicht nachzuvollziehen wie nach einer Nacht, in der es geschneit hat. Nicht nur die Art der Verursacher – Wildschwein, Reh, Hase, Fuchs, Marder, Iltis oder Eichhörnchen – ist unschwer zu erkennen, sondern vielfach auch deren Größe, die Art der Fortbewegung – langsam bummelnd, rasch ziehend oder auf der Flucht (dann weisen die Spitzen von Rehhufen V-förmig auseinander) – und natürlich vor allem das Woher und Wohin.
Weitaus schwieriger ist es da schon abzuschätzen, wie viele Wildtiere in einem bestimmten Gebiet leben. Hier vermitteln die sich vielfach überschneidenden Spuren oft ein völlig falsches Bild. So kreuzen an diesem Morgen gleich viermal Pfotenabdrücke eines schnürenden Fuchses unseren Weg, und es ist sehr wahrscheinlich, dass sie von ein und demselben Tier oder allenfalls von zweien herrühren. Genau beurteilen könnte ich das nur, wenn ich die Spur exakt ausmäße oder, noch besser, ihr nachginge. Auf diese Weise würde ich erfahren, wo der Fuchs haltgemacht hat, um zu schnuppern, wo er das Bein gehoben hat (falls es ein Rüde war), wo er seine Nase auf der Suche nach einer Maus in den Schnee gesteckt und wo er ausgiebig eine Hasenspur beschnüffelt hat.
Auch die zahlreichen Rehfährten, die überall zwischen den Bäumen zu erkennen sind, täuschen dem Unkundigen einen viel zu großen Wildbestand vor. Wer morgens durch frischgefallenen Schnee geht und überall die vielen Abdrücke sieht, wundert sich, wenn er tagsüber nicht ein einziges Reh und ebenso wenig einen Hasen oder Fuchs zu Gesicht bekommt. Dabei sind Füchse im Januar den ganzen Tag unterwegs. Sie erleben gerade ihre Paarungszeit – oder Ranzzeit, wie der Jäger sagt. Zwar stellen die männlichen Füchse ihren potenziellen Partnerinnen vorzugsweise erst nach Sonnenuntergang nach (in hellen Mondnächten kann man weithin ihr heiseres Bellen hören), doch treibt es die nach Sex gierenden Rüden auch tagsüber mächtig um.
Sich fortzupflanzen ist nun einmal ebenso wie die Nahrungsaufnahme ein fundamentales Bedürfnis jedes Lebewesens, ein mächtiger Trieb, der all seine Sinne derart beherrscht, dass es während der Paarungszeit oft die sonst so ausgeprägte Vorsicht vergisst und unglaubliche Risiken eingeht. So mächtig steht den Fuchsmännern der Sinn nach einem Weibchen, dass sie jede Füchsin decken, die ihnen über den Weg läuft, sofern sie nur ihre in dieser Jahreszeit offenbar unwiderstehliche Witterung ausströmt. Dabei ist es den Fuchsherren ganz und gar gleichgültig, ob bei der Auserwählten vielleicht schon ein anderer Freier zum Zug gekommen ist. So passiert es gar nicht selten, dass die Welpen ein und desselben Wurfes von mehreren unterschiedlichen Vätern stammen. Und damit die Fuchsbabys – normalerweise drei bis fünf an der Zahl – Ende März, Anfang April zur Welt kommen, also bei angenehmen Temperaturen und zu einer Zeit, in der es Nahrung in Fülle gibt, ist es bei einer Tragezeit von rund fünfzig Tagen eben zwingend erforderlich, dass sich Fuchs und Füchsin ausgerechnet im unwirtlichen Januar oder allenfalls noch im Februar paaren.
Leben unter dem Eis
Als ich auf der Holzbrücke, die über den Sauerbach führt, angelangt bin, lehne ich mich eine Zeit lang an das Geländer und blicke ins quirlige Wasser. Überraschend viele Fische schwimmen darin scheinbar planlos umher und suchen nach Fressbarem, das es offenbar auch jetzt im Winter, wo der Bach an einigen Stellen unter einer geschlossenen Eisdecke verschwindet, zur Genüge gibt. Während ich Sina von der Leine lasse und vergnügt beobachte, wie sie, ihre plötzliche Freiheit auskostend, begeistert das Ufer hinauf- und hinunterflitzt, rufe ich mir ins Gedächtnis, warum ein Gewässer von oben nach unten und nicht in umgekehrter Richtung zufriert. Das ist nämlich keinesfalls selbstverständlich, da sich Stoffe normalerweise mit zunehmender Kälte zusammenziehen und dadurch immer starrer und schwerer werden. Wäre das bei gefrorenem Wasser ebenso, würde das Eis auf den Boden des Gewässers sinken und alles Leben unter sich begraben.
Doch für Wasser gilt die Gesetzmäßigkeit der kältebedingten Gewichtszunahme glücklicherweise nur bei Temperaturen über 4 Grad Celsius. Kühlt man es bis dahin ab, wird es tatsächlich zunehmend dichter und schwerer. Doch unter 4 Grad kehren sich die Verhältnisse plötzlich um: Das Wasser dehnt sich wieder aus (man spricht von der Anomalie des Wassers). Bei 0 Grad schließlich können sich die Moleküle nicht mehr heftig genug bewegen, um die zwischen ihnen herrschenden elektrostatischen Kräfte, die so genannten Wasserstoffbrücken, zu lösen (tatsächlich ist Wärme, physikalisch gesehen, nichts anderes als eine ungeordnete Bewegung von Molekülen), und das Wasser gefriert zu Eis. In diesem Zustand bildet es ein starres Kristallgitter, in dem die erwähnten Wasserstoffbrücken die Moleküle gleichsam auf Armeslänge voneinander entfernt halten, mit dem Ergebnis, dass Eis um etwa 10 Prozent weniger dicht und damit deutlich leichter ist als Wasser von 4 Grad. Oder anders ausgedrückt: Die zwischen den Wasserteilchen herrschenden Kräfte bewirken, dass ein bestimmtes Volumen Eis 10 Prozent weniger Moleküle enthält als die gleiche Menge 4 Grad kalten Wassers.
Daher schwimmt Eis auf Wasser, und es muss schon extrem kalt werden, bis es sich so weit in die Tiefe ausdehnt, dass es den Gewässerboden erreicht, was naturgemäß vor allem in sehr flachen Teichen vorkommt. In fließenden Gewässern gefriert das Wasser sogar erst bei noch viel tieferen Temperaturen, weil die unablässige Bewegung seiner kleinsten Teilchen das Erstarren verhindert. Insofern kann man kaltes, aber fließendes Wasser im Hinblick auf die Ruhelosigkeit seiner Moleküle durchaus mit wärmerem vergleichen: In beiden Fällen schwirren diese unablässig hin und her. Erst wenn es derart eisig wird, dass die Kälte den Wasserteilchen auch noch den größten Teil ihrer Bewegungsenergie entzieht, erstarrt selbst fließendes Wasser nach und nach zu Eis – natürlich auch wieder schön langsam von oben nach unten.
Schnee ist kein Leichentuch
Beidseits des Sauerbachs tollt Sina noch immer voller Begeisterung herum, und an einigen Stellen hat sie mit ihren wirbelnden Pfoten den Schnee so heftig beiseitegeschleudert, dass der dunkle Boden hervorschaut. Das ist für die freigelegten Pflanzen alles andere als angenehm. Denn nicht nur in der Tiefe der Gewässer, auch unter dem kühlen Weiß herrscht im Winter eifriges Leben. Insofern hinkt der Vergleich einer geschlossenen Schneedecke mit einem Leichentuch ganz erheblich. Da trockener Schnee die Wärme etwa zehnmal schlechter leitet als nasser Boden, stellt die glitzernde Schicht eine hervorragende Isolierung dar, unter der selbst bei klirrendem Frost von minus 20 bis 30 Grad noch vergleichsweise angenehme, nur wenig unter den Gefrierpunkt sinkende Temperaturen herrschen. Deshalb ziehen kleinwüchsige Pflanzen im Winter ihre Lebenskraft in vor der Eiseskälte geschützte, bodennahe Dauerorgane wie Wurzelstöcke, Erdsprossen oder Knollen zurück und überstehen die unwirtliche Jahreszeit im Extremfall sogar in Form eines einzigen keimfähigen Samenkorns. Zugute kommt ihnen dabei, dass der Schnee zwar trocken, die Luft darunter jedoch recht feucht ist, sodass sie nicht Gefahr laufen, durch Verdunstung zu viel Wasser zu verlieren, denn das kostbare Nass könnten sie wegen des gefrorenen Bodens nicht ersetzen.
Dafür, dass auch die empfindlichen oberirdischen Triebe ausreichend feucht bleiben, sorgen bei unseren Gehölzen die Knospen, die jetzt im kahlen Winterkleid, wo keine Blätter sie verdecken, besonders auffallen. Damit aus ihnen im Frühjahr neue Blätter sprießen, dürfen sie in ihrem Inneren auf keinen Fall zu trocken werden. In der Tat sind die Knospen nur sehr bedingt geeignet, die dicht verpackten Blattorgane zu wärmen; ihre Aufgabe besteht vielmehr darin, unbedingt zu verhindern, dass sie mit der Umgebung Wasser austauschen. Denn auf die minimalen Feuchtigkeitsmengen, die die jungen, entwicklungsfähigen Gewebe im Knospeninneren enthalten, sind die frischen Triebe im Frühjahr angewiesen. Eine totale Austrocknung wäre für sie ebenso tödlich wie die plötzliche Aufnahme von Wasser, das in der Eiseskälte gefrieren und ihre Zellen zum Platzen bringen könnte. Daher schotten die Knospenschuppen, die an ihren Rändern dicht verklebt und dazu vielfach noch mit Wasser abweisenden Haaren besetzt sind, jedwede Aufnahme oder Abgabe von Feuchtigkeit höchst wirksam ab.
Leben – was ist das eigentlich?
Während ich langsam am Sauerbach entlanggehe und Sina zusehe, die sich unermüdlich in einer Schneewehe nach der anderen wälzt, wird mir bewusst, dass der Wind immer mehr auffrischt. Ich stelle den Kragen meiner Winterjacke hoch, ziehe mir die Wollmütze tiefer in die Stirn und lasse meinen Blick über die kahlen Felder schweifen, die den Eindruck machen, als sei auf ihnen alles Leben erloschen.
Doch Leben – was ist das eigentlich? Wodurch unterscheidet sich Lebendiges von Totem? Bewegung allein kann es nicht sein, denn auch die Wassertropfen des Sauerbachs stehen nicht still. Nur am Wachstum kann es ebenfalls nicht liegen, da ja auch leblose Kristalle an Umfang zunehmen und eine beträchtliche Größe erreichen. Die Sache scheint komplizierter zu sein, und es müssen offensichtlich mehrere Eigenschaften zusammenkommen, um etwas als lebend bezeichnen zu können. Auf der anderen Seite gibt es offenbar auch sehr einfach zu deutende Kriterien für das Lebendige, denn schon ein kleines Kind erkennt intuitiv, dass ein Hund, eine Katze, ein Schmetterling und auch ein Baum leben, ein Felsen oder ein Auto aber nicht.
In der Tat haben sich schon die Philosophen der Antike intensiv mit dieser Frage auseinandergesetzt. Doch erst wesentlich später – ermöglicht durch die Entwicklung immer besserer Gerätschaften und Untersuchungsverfahren – entdeckte man die entscheidenden Strukturelemente, deren Vorhandensein Lebewesen von jedweder Materie unbelebter Art unterscheidet: die Zellen. Der Aufbau aus diesen winzigen Strukturen ist sämtlichen Lebewesen, egal ob Bakterium, Pflanze oder Tier, gemeinsam, doch daneben gibt es noch eine Reihe weiterer Eigenschaften, die allgemein als Kennzeichen des Lebens gelten.
Lebewesen sind formvollendet
Da ist zum einen die charakteristische Gestalt, die sich durch einen hohen Ordnungsgrad auszeichnet und dafür verantwortlich ist, dass wir mühelos einen Vogel von einem Fisch und einen Farn von einem Pilz unterscheiden können. Die Gestalt ist demnach nicht nur für das einzelne Individuum, sondern auch für die Art, ja, in der Regel sogar für eine ganze Gruppe verwandter Lebewesen typisch.
Bemerkenswert ist dabei, wie gut im Allgemeinen die Gestalt eines Organismus, aber auch die Form seiner einzelnen Bestandteile zu seiner Lebensweise passen. So gleichen sich etliche Tiere, die sich vorwiegend im Wasser aufhalten, unabhängig von ihrer stammesgeschichtlichen Herkunft, höchst auffällig in ihrem Äußeren: Sowohl der Vogel Pinguin als auch der Fisch Forelle und das Säugetier Delfin kommen deshalb so ideal in ihrem Lebensraum voran, weil sie perfekt stromlinienförmig gebaut sind und so dem Wasser den geringstmöglichen Widerstand bieten. Diese Anpassung an die umweltbedingten Erfordernisse, ein allgemeingültiges, die gesamte Welt des Lebenden durchziehendes Struktur-Funktions-Prinzip, ist auf das fundamentale Leitmotiv der Biologie zurückzuführen: die Evolution oder, genauer gesagt, die von den Umweltbedingungen abhängige natürliche Auslese.
Lebewesen verändern sich
Doch Lebewesen haben in der Regel keine konstante Gestalt, die während ihres Daseins immer gleich bleibt, vielmehr verändert sich ihr Aussehen zwischen Geburt und Tod zum Teil ganz erheblich. Die äußere Form unterliegt einem fortgesetzten Wandel, der im Allgemeinen zumindest zeitweilig mit Wachstum verbunden ist – ebenfalls ein Kennzeichen alles Lebenden. So wie ein Tier sich vom Embryo über das Neugeborenen-, Kindheits- und Jugendstadium zum erwachsenen Wesen entwickelt, das schließlich stirbt, so wird aus einem in einer Frucht verpackten Samen ein Sprössling, aus dem eine komplette Pflanze hervorgeht, die vielfach ein Leben lang wächst und schon allein dadurch kontinuierlich ihre Gestalt verändert.
Besonders deutlich wird die Entwicklung, die bei verwandten Arten ähnlichen genetisch vorgegebenen Mustern folgt, bei vielen Insekten wie zum Beispiel den Schmetterlingen. Sie machen bekanntermaßen eine so genannte Metamorphose durch und werden dabei vom Ei zur Raupe, von der Raupe zur Puppe und erst ganz zum Schluss zum fertigen Tier mit all seinen charakteristischen Merkmalen.
Lebewesen bauen um
Damit ein Lebewesen wachsen oder sich zumindest verändern kann, muss es Stoffe aus der Umwelt aufnehmen, sie verwerten und die Abfallprodukte ausscheiden. Oder es muss – im Fall der grünen Pflanzen – äußere Energiequellen wie das Sonnenlicht nutzen, um daraus in Eigenarbeit die benötigten Substanzen herzustellen; kurz, es benötigt einen Stoffwechsel. Dieser – also die Aufnahme sowie der Ab- und Umbau von Stoffen – sorgt nicht nur für das Baumaterial, aus dem körpereigene Materie nach einem festgelegten Programm zusammengesetzt ist, sondern liefert auch die Energie, ohne die Leben nicht möglich wäre.
Auch ein ausgewachsener Organismus ist mit ständigen Renovierungsarbeiten beschäftigt. So stoßen wir Menschen jede Minute rund fünfzigtausend verbrauchte Hautzellen ab, die von darunterliegenden Schichten ersetzt werden. Und unser Knochenmark produziert jede Sekunde die unvorstellbare Menge von rund drei Millionen roten Blutkörperchen, mit denen es ebenso viele ausgemusterte ersetzt. Durch einen lebenden Organismus fließt also ein niemals endender Strom von Materie und Energie.
Dass das Prinzip des fortwährenden Umbaus und Erneuerns für sämtliche Lebewesen gilt, zeigt sich jetzt in der kalten Jahreszeit allenthalben: Die Bäume sind ohne Laub und müssen dieses Blatt für Blatt im nächsten Frühjahr neu bilden; die Rehe haben ihr Sommer- durch ihr Winterfell ersetzt, und auch Sina trägt jetzt einen viel dichteren Pelz als noch vor wenigen Monaten. Die Hundehaare in unserer Wohnung sind dafür ein eindeutiger Beweis.
Lebewesen lassen sich reizen
Ein weiteres Kriterium, das lebende Organismen von toter Substanz unterscheidet, ist Bewegung in irgendeiner Form. Bei Tieren ist das ganz offensichtlich, doch auch Pflanzen wenden ihre Blüten und Blätter dem Licht zu, winden sich umeinander, lassen ihre Samenkapseln platzen oder – ein besonders eindrucksvolles Beispiel – fangen mit speziell dafür konstruierten Vorrichtungen Fliegen und andere Insekten, um sich an ihnen gütlich zu tun.
Womit bereits das nächste Kennzeichen des Lebens angesprochen wäre: die Reaktion auf äußere Reize. Die Fliege entkommt durch eine blitzartige Bewegung der zuschlagenden Hand, den Hund zieht es unwiderstehlich zu seinem gefüllten Fressnapf, der Auto fahrende Mensch tritt heftig auf die Bremse, wenn unvermittelt ein Fußgänger auf der Straße auftaucht, und selbst ein unscheinbares Bakterium spricht auf chemische Substanzen seiner Umgebung an, indem es sich entweder begierig darauf zu bewegt oder schleunigst Reißaus nimmt. Bei den Pflanzen ist es vielleicht die Mimose, die am eindrucksvollsten auf äußere Reize reagiert: Berührt man eines ihrer Blätter, so knickt dessen Stiel ein, und das Blatt hängt daraufhin scheinbar leblos herab. Bei Tieren und Menschen bestimmen die Reaktionen auf Einflüsse der Umwelt und die dadurch bedingten Handlungen in ihrer Gesamtheit das, was man gemeinhin als Verhalten bezeichnet.
Lebewesen pflanzen sich fort
Wie schon am Beispiel des liebestollen Fuchses erläutert, ist für jedes Lebewesen weiterhin charakteristisch, dass es sich fortpflanzt, dass es teils immense und in unseren Augen nicht selten groteske Anstrengungen unternimmt, um die Art zu erhalten, wobei dies im Erfolgsfall oft, aber keinesfalls immer, mit Vermehrung einhergeht. Viele Pflanzen können Nachkommen erzeugen, indem sie ohne Mitwirkung eines Geschlechtspartners einfach Ableger bilden. Selbst winzig kleine Bakterien vermehren sich voller Eifer, indem sie sich schlicht teilen, sodass aus einem Individuum zwei, aus diesen vier, dann acht und so weiter werden.
Auf diese Weise können die in unserem Darm lebenden Kolibakterien ihre Anzahl, sofern es ihnen an nichts mangelt, alle 20 Minuten glatt verdoppeln. Das bedeutet, dass ein einziges Bakterium – und in unserem Darm hausen ungeheure Mengen davon – über Nacht bis zu hundert Millionen Nachkommen hervorbringen kann. Würde dieses immense Vermehrungstempo anhalten (was es zum Glück wegen des dramatisch zunehmenden Nahrungs- und Platzmangels nicht tut), so gäbe es nach 36 Stunden genügend Bakterien, um die gesamte Erdoberfläche mit einer etwa 30 Zentimeter hohen Schicht zu bedecken.
Im Gegensatz zu Bakterien vermehren Viren sich nicht, zudem besitzen sie keinen Stoffwechsel. Aus diesem Grund sind sie keine Lebewesen. Sie nehmen nichts zu sich, scheiden nichts aus und können sich aus eigener Kraft nicht einmal fortpflanzen. Genau genommen ist ein Virus nichts weiter als ein Stück in Eiweiß (Protein) verpackter Erbsubstanz. Dieses genetische Material schleust es in lebende Zellen ein, die dadurch kurzerhand umprogrammiert werden und fortan haufenweise neue Viren produzieren. Ohne Wirtszellen sind Viren also ganz und gar aufgeschmissen.
Für denjenigen, der an einer Viruserkrankung leidet, hat die Leblosigkeit seiner Peiniger einen erheblichen Nachteil, denn im Gegensatz zu Bakterien kann man Viren nicht abtöten; Antibiotika wie das bekannte Penizillin können ihnen nicht das Geringste anhaben. Will man ihrer Herr werden, muss man entweder von vornherein verhindern, dass sie in Zellen eindringen und diese in Virenfabriken umfunktionieren, oder – so macht es unser Immunsystem – man vernichtet kurzerhand die gesamte Zelle mitsamt den darin enthaltenen Viren.
Eine im Vergleich zur Kolibakterien-Methode erheblich langsamere, dafür aber umso erfreulichere Art, sich fortzupflanzen, besteht bekanntermaßen im Sex. Dabei entstehen die Nachkommen aus der Verschmelzung einer männlichen mit einer weiblichen Keimzelle und vereinigen deshalb Eigenschaften von Vater und Mutter in sich. Eine solche Weitergabe von Merkmalen an die nächste Generation bezeichnet man als Vererbung, und diese stellt ebenfalls ein fundamentales Kennzeichen alles Lebendigen dar. Während Bakterien, die mit sämtlichen Geschwistern von einer einzigen Mutterzelle abstammen, allesamt genetisch identisch und damit das sind, was man Klone nennt, unterscheiden sich Nachkommen, die aus Eltern beiderlei Geschlechts hervorgehen, zum Teil ganz erheblich voneinander. Wer hat sich nicht schon gewundert, wie verschieden Brüder oder Schwestern sein können.
Unabhängig von der Art der Fortpflanzung sorgt die Vererbung jedenfalls zuverlässig dafür, dass aus Hunden immer wieder ein Hund, aus Mäusen eine Maus und aus einer Eiche eine weitere Eiche und nicht etwa eine Buche oder Birke hervorgeht. Und wenn der fallschirmbewehrte Samen des Löwenzahns auf eine Unterlage fällt, auf der er auskeimen kann – wobei er in dieser Hinsicht alles andere als anspruchsvoll ist –, kann man sich mit hundertprozentiger Gewissheit darauf verlassen, dass dort in Kürze ein neuer Löwenzahn und nicht etwa, was vielleicht erfreulicher wäre, ein Vergissmeinnicht erscheint.
Lebewesen lieben geordnete Verhältnisse
Schließlich sei noch ein letztes Kriterium erwähnt, durch das sich lebende Organismen von unbelebten unterscheiden: die Konstanthaltung des inneren Milieus. Physikalisch gesehen, stellen Lebewesen samt und sonders offene Systeme dar, die Energie und Materie aus der Umgebung aufnehmen und wieder an diese abgeben. Dazu verfügen sie über Mechanismen, mit deren Hilfe sie in ihrem Inneren möglichst gleichbleibende Verhältnisse aufrechterhalten. Zwar bedienen sich die einzelnen Kreaturen dabei höchst unterschiedlicher Methoden und Einrichtungen, gemeinsam ist ihnen jedoch, dass sie allesamt in der Lage sind, den eigenen Zustand wahrzunehmen, ihn mit einem Idealwert zu vergleichen und, falls nötig, zu korrigieren.
So können gleich warme Tiere, zu denen im biologischen Sinn auch wir Menschen zählen, ihre Körpertemperatur – egal, wie kalt oder warm die Umgebung ist und unabhängig davon, ob sie gerade etwas Eisiges getrunken oder etwas Heißes gegessen haben – in einem sehr engen Schwankungsbereich halten, in unserem Fall um 37 Grad Celsius. Nehmen Messfühler in unserem Inneren einen Temperaturanstieg wahr, so sorgen Regulationsmechanismen umgehend dafür, dass sich die Blutgefäße der Haut erweitern und dadurch mehr Wärme abstrahlen (deshalb werden wir rot, wenn wir schwitzen). Gleichzeitig werden die Ausführungsgänge der Schweißdrüsen geöffnet, sodass die austretende Flüssigkeit auf unserer Haut verdampft und dieser dadurch Wärme entzieht (man nennt das Verdunstungskälte).
Und wenn wir frieren, kümmert sich ein ähnlicher Mechanismus automatisch darum, dass sich im Inneren unserer Haut die Adern verengen (wir werden blass). Außerdem stellen sich die feinen Härchen auf und sorgen für ein wärmendes Polster; bei der heutzutage im Allgemeinen nur noch spärlichen Behaarung funktioniert das freilich nur unzureichend und hat allenfalls eine Gänsehaut zur Folge. Zudem vollführen unsere Muskeln, ohne dass wir etwas dagegen tun können, rasche Bewegungen und erzeugen dadurch Wärme (deshalb zittern wir bei Kälte). Im Extremfall beginnen sogar die Kaumuskeln sich in schneller Folge zusammenzuziehen und wieder zu entspannen (dann klappern wir mit den Zähnen). Insofern verfügen wir in unserem Inneren über einen eingebauten Thermostaten, der im Hinblick auf seine Genauigkeit und sein ebenso rasches wie präzises Ansprechen den meisten handelsüblichen Geräten ebenbürtig, wenn nicht gar überlegen ist.
Sina wird allmählich müde und gesellt sich wieder zu mir. Mit weit heraushängender Zunge hechelt sie laut und zeigt damit, dass auch sie unbewusst bemüht ist, ihre Körpertemperatur im Normbereich zu halten. Ein Hund hat ja im Gegensatz zu uns Menschen nicht die Möglichkeit, der Witterung dadurch zu trotzen, dass er sich entsprechend kleidet. Zwar hüllt er sich jetzt in der kalten Jahreszeit in das erwähnte wärmende Winterfell, doch dieses kann er, wenn wir später wieder in die geheizte Wohnung kommen, nicht einfach abstreifen und an den Haken hängen wie ich meine dicke Jacke. Vielmehr ist Sina noch viel mehr als wir Menschen auf Regelmechanismen angewiesen, die ihre Körpertemperatur konstant halten, und zwar unabhängig davon, ob sie, wie jetzt, mit bloßen Pfoten durch den eiskalten Schnee tappt oder später am Abend vor dem flackernden Kaminfeuer döst.
Entscheidend für eine rasche und zielgerichtete Reaktion auf äußere und innere Veränderungen ist, dass sämtliche beteiligte Körperteile darüber möglichst umgehend und korrekt informiert werden. Dies geschieht einerseits über Nerven, die man mit elektrischen Leitungen vergleichen kann, andererseits über Botenstoffe, so genannte Hormone.
Immer wieder etwas Neues
Als ich mit Sina im Gefolge den Hang zum Bauernhof hochsteige, höre ich plötzlich ein rhythmisches, von regelmäßigen Pausen unterbrochenes Klopfen. Kurz darauf erblicke ich den Verursacher, der jetzt, wo ihn kein Laub der Bäume verdeckt, weithin sichtbar ist: ein Buntspecht, eifrig damit beschäftigt, die Rinde eines Kirschbaums zu bearbeiten, um darunter vielleicht das eine oder andere nahrhafte Insekt aufzustöbern. Ich bleibe stehen und grabe in den Taschen meiner Winterjacke nach dem kleinen, zusammenlegbaren Fernglas, ohne das ich mich nie auf den Weg mache. Und schon habe ich den Vogel im Blickfeld. Sein Gefieder erscheint jetzt in der kahlen Jahreszeit besonders prächtig: die hell leuchtende Brust, der schwarz-weiße Kopf mit der roten Kappe, der anmutig gezeichnete Rücken und natürlich der rote Bauch und die daraus hervorgehenden Schwanzfedern, mit denen er sich gekonnt an der Rinde abstützt. Biologisch betrachtet, ist das hübsche Äußere des Vogels Ausdruck eines hohen Ordnungsgrades, und dieser beruht auf einer hohen Komplexität untergeordneter Strukturen, die sich, weil sie so winzig sind, unserer Betrachtung entziehen.
Auf der untersten Ebene sind es die Atome, deren Eigenschaften Form und Wesen aller höheren Strukturelemente bestimmen. Sie lagern sich zu all den unterschiedlichen Molekülen zusammen, aus denen ein Lebewesen besteht und die es entweder unmittelbar aus der Umgebung aufnimmt oder in komplexen Stoffwechselwegen selbst herstellt. Derartige Moleküle, die die Grundlage alles Lebendigen darstellen und deren charakteristisches Kennzeichen ein Grundgerüst aus Kohlenstoffatomen ist, bezeichnet man üblicherweise als organisch. Von sehr einfachen Verbindungen wie Kohlendioxid oder Kohlensäure (diese rechnet man der anorganischen Chemie zu) abgesehen, sind daher zu Ketten oder Ringen zusammengefügte Kohlenstoffatome die Grundlage allen Lebens.
Darüber hinaus sind es nur einige wenige chemische Elemente, die in lebenden Organismen in größeren Mengen vorkommen, nämlich Sauerstoff, Wasserstoff, Stickstoff und dazu noch Schwefel und Phosphor. Viele andere – beispielsweise Eisen, Magnesium, Kupfer, Zink und Fluor – spielen quantitativ nur eine höchst bescheidene Rolle, was jedoch keinesfalls bedeutet, dass sie verzichtbar wären. Man bezeichnet sie daher als Spurenelemente.
Hier wird ein wesentliches Grundprinzip der strukturellen Hierarchie alles Lebendigen deutlich: Immer weist die nächsthöhere Ebene neue Eigenschaften auf, die der darunter befindlichen fehlen. So wie Moleküle Merkmale zeigen, die man bei den Atomen, aus denen sie bestehen, vergeblich sucht, so verfügen die aus diesen Molekülen zusammengesetzten Zellbestandteile – weil sie wie winzige Organe funktionieren, nennt man sie Organellen – ihrerseits über neu auftauchende kennzeichnende Qualitäten. Diese befähigen sie, spezielle Aufgaben, etwa die Bereitstellung von Energie oder die Synthese bestimmter Stoffe, aber auch deren Abbau, in perfekter Weise zu bewerkstelligen. Ihr geordnetes Zusammenwirken führt zu der Struktur, der man erstmals mit vollem Recht das Attribut lebendig zuschreiben kann: Es ist die bereits erwähnte Zelle, von der es zahlreiche, höchst unterschiedliche, auf ihre jeweilige Aufgabe spezialisierte Formen gibt. Und gleichartige Zellen sind zu Funktionseinheiten zusammengefasst, die man Gewebe nennt: bei Tieren etwa zu Muskel-, Nerven- und Knochengewebe und bei Pflanzen zu Bildungs-, Leit- oder Festigungsgewebe, um nur einige zu nennen.
In komplexeren Organismen, zu denen eigentlich alle Lebewesen mit Ausnahme von Einzellern und den aus ihnen bestehenden Verbänden gehören, bilden unterschiedliche Gewebe aufwändige Strukturen, die umfangreiche und höchst komplizierte Aufgaben erfüllen: die Organe. Bei Tieren sind das beispielsweise Lunge, Leber und Herz, bei Pflanzen Blätter, Spross und Wurzeln. Und diese Organe sind häufig zu ausgedehnten Organsystemen zusammengefasst, die im Dienst einer höheren Aufgabe stehen: etwa dem Nerven- oder dem Verdauungssystem, aber auch dem Atmungs-, Fortpflanzungs- und Kreislaufsystem. Als typisch pflanzliches Organsystem sei das der unterschiedlichen Leitgewebe genannt, das den Transport von Wasser bis in das letzte Blatt an der Spitze und von Zucker und anderen organischen Substanzen in umgekehrter Richtung gewährleistet.
Womit wir schließlich beim Organismus als höchster und komplexester Ordnungseinheit angelangt wären. Unabhängig von seiner Größe – das kleinste Säugetier, die Etruskerspitzmaus, wiegt gerade mal 2 Gramm, während es das größte, der Blauwal, auf weit mehr als 100 Tonnen bringt – lassen sich daran vorzüglich die beschriebenen Kennzeichen des Lebendigen in ihrer ganzen Vielfalt erkennen. Dass ein Organismus so gut funktioniert, dass alle Bestandteile dank perfekter Kommunikation zwischen den einzelnen Geweben und Organen optimal zusammenarbeiten, verdankt jedoch auch das komplexeste Lebewesen letztlich den Bestandteilen der niedrigen Strukturebenen: den Organen, Geweben, Zellen, Organellen, Molekülen und Atomen.
Von Eichenrinde und Mönchszellen
Dort, wo unser Weg nach Durchquerung des Bauernhofs als schmale Asphaltstraße einen langgezogenen Bogen beschreibt, stehen zwei uralte und entsprechend gewaltige Eichen. Genau genommen sind es Traubeneichen, aber das kann ich jetzt im Winter allenfalls an den auf dem Boden liegenden, von Reif überzogenen braunen Blättern erkennen, die im Gegensatz zu denjenigen der Stieleiche am baumseitigen Ende keine ohrläppchenartigen Fortsätze aufweisen. Sogleich muss ich daran denken, dass es eine Eiche war, in deren Rinde zum ersten Mal die Struktur entdeckt wurde, die wir seither als Zelle bezeichnen.
Eine solche Zelle ist, wie bereits erläutert, die kleinste Organisationseinheit, die alle Merkmale des Lebendigen aufweist: Sie besitzt eine spezielle, ihrer Funktion angemessene Gestalt, sie wächst nach ihrer Entstehung und verändert sich im Lauf des Lebens mehr oder weniger stark. Sie vermehrt sich, wobei sie ihre Erbinformation an ihre Nachkommen weitergibt (die vielen Billionen Zellen, aus denen wir bestehen, gehen allesamt aus einer einzigen befruchteten Eizelle hervor und verfügen samt und sonders über dasselbe genetische Material), und sie reagiert auf äußere Reize.
Doch das erkannte man erst im 19. Jahrhundert. Der Erste, der Zellen sah und beschrieb, war der englische Physiker, Naturforscher und Architekt Robert Hooke. Im Jahr 1665 betrachtete er mit Hilfe eines selbst konstruierten und für damalige Zeiten höchst bemerkenswerten Mikroskops – mit nur zwei Linsen erlaubte es eine geradezu sensationelle Vergrößerung um das Dreißigfache – ein Stück Baumrinde, und zwar von einer Korkeiche. Zu seiner eigenen Verblüffung erblickte er darin große Mengen kästchenförmiger Bausteine, die er little boxes oder – da sie ihn in ihrer strengen Anordnung an Mönchszellen erinnerten – cells nannte.
Hooke, auf der Isle of Wight geboren, war in Westminster zur Schule gegangen und hatte in Oxford studiert, wo er zusammen mit dem berühmten Naturforscher Robert Boyle unter anderem eine neue, sehr effektive Luftpumpe entwickelte. Später wurde er Professor für Geometrie am Gresham College in London und konstruierte dort besagtes Mikroskop, mit dessen Hilfe er die ersten Zellen erblickte, die er später in ähnlicher Form auch in anderen Pflanzenteilen fand. Zusammen mit zahlreichen anderen mikroskopischen Zeichnungen beschrieb er sie in seinem berühmt gewordenen Buch »Micrographia«, in dem er seine Leserschaft mit einer Fülle winziger und höchst komplexer Strukturen verblüffte, wie man sie in dieser Vielfalt nie zuvor gesehen hatte.
Ein Holländer braucht kein Latein
Doch es dauerte nicht einmal zehn Jahre, bis ein anderer, bis dato unbekannter Forscher Hookes Leistung übertraf und ein Mikroskop entwickelte, das eine mehr als neunmal höhere Vergrößerung zuließ. Der Mann hieß Antoni van Leeuwenhoek und war der Sohn eines Korbmachers aus Delft, der früh verstorben war. In seiner Jugend besuchte er ein Gymnasium und wurde von seinem Onkel zudem mit den Grundlagen der Mathematik und Physik – seinerzeit keine gymnasialen Lehrfächer – vertraut gemacht. Doch anstatt zu studieren und Latein, die Sprache der Gebildeten, zu erlernen, ging er danach bei einem Tuchmacher in die Lehre und eröffnete schließlich in seiner niederländischen Heimatstadt einen eigenen Laden.
Van Leeuwenhoek betrieb sein Geschäft, doch mit wesentlich größerem Eifer widmete er sich seinem Hobby, der Mikroskopie, und setzte seinen ganzen Ehrgeiz darein, möglichst exakte Linsen zu schleifen. Das war auch nötig, denn die damals gebräuchlichen Gläser waren von minderer Qualität; sie hatten keine symmetrische Form und wiesen zudem Einschlüsse auf, die ihrer Verwendung in Mikroskopen enge Grenzen setzten. Leeuwenhoek umging dieses Problem, indem er nur sehr kleine, dafür aber perfekt geschliffene Linsen verwendete, die er zwischen Messingplatten einbaute und sehr nahe an das Auge hielt. Mit diesen Geräten – im Grunde erinnerten sie eher an eine Lupe als an ein Mikroskop – erreichte er eine mehr als zweihundertsiebzigfache Vergrößerung, für damalige Zeiten ein geradezu sensationeller Wert.
Bis heute ist nicht geklärt, wie er diese enorme Leistung zustande brachte, fest steht jedoch, dass er mit Hilfe seiner Apparaturen nicht nur rote Blutkörperchen beim Passieren der winzigen Kapillaren in den Ohren eines Kaninchens, sondern auch zahlreiche Einzeller aus dem Wasser eines Tümpels beobachtete, zeichnete und beschrieb. 1677 veröffentlichte er Abbildungen tierischer Spermien und widersprach damit der bis dato anerkannten Urzeugungs-Theorie, derzufolge Käfer, Flöhe und andere kleine Lebewesen spontan aus unbelebter Erde entstehen. Und als er die Beläge auf einem menschlichen Zahn beschrieb – von Mundhygiene konnte man seinerzeit nur sehr bedingt sprechen –, entdeckte er darin seinen eigenen Angaben zufolge mehr Kleinstlebewesen, »als es Untertanen in einem Königreich gibt«.
Leeuwenhoeks mangelhafte Kenntnis der lateinischen Sprache, in der damals sämtliche wissenschaftlichen Veröffentlichungen verfasst waren, erwies sich jedoch als entscheidender Nachteil und hatte zur Folge, dass man sein Wirken lange Zeit mit Missachtung strafte. Nur zögernd und mit beträchtlicher Skepsis nahmen andere Forscher seine Entdeckungen zur Kenntnis, konnten aber am Ende nicht umhin, die hervorragende Qualität seiner Mikroskope anzuerkennen. So erlaubte man ihm schließlich, seine Arbeiten – samt und sonders in niederländischer Sprache verfasst – der Royal Society of London vorzulegen, der führenden naturwissenschaftlichen Gesellschaft der damaligen Zeit. Zu deren frühen Mitgliedern gehörten außer dem bereits erwähnten Robert Hooke so bedeutende Persönlichkeiten wie der Astronom und Architekt Christopher Wren sowie der geniale Entdecker der Gravitationsgesetze, Sir Isaac Newton. Fortan genoss Leeuwenhoek hohes Ansehen und plauderte unter anderem mit der englischen Königin, dem Zaren von Russland sowie dem großen deutschen Philosophen und Naturwissenschaftler Gottfried Wilhelm Leibniz über seine Entdeckungen. Insgesamt baute er in seinem Leben die unglaubliche Anzahl von rund fünfhundert Mikroskopen, von denen er der Royal Society aus Dankbarkeit sechsundzwanzig vermachte.
Im Jahr 1683 – knapp zwanzig Jahre nach Hookes Entdeckung der Korkeichenzellen – beschrieb Leeuwenhoek als erster Wissenschaftler die winzigen Lebewesen, die wir heute Bakterien nennen. Von derartigen Fortschritten bei der Erkundung kleinster Strukturen inspiriert, verbrachten in der Folgezeit zunehmend mehr Menschen ihre freie Zeit damit, in Mikroskope zu blicken, und fanden dabei vor allem immer wieder eines: Zellen. Zellen in allen möglichen Formen: langgestreckt, quadratisch, rundlich und bei einigen Pflanzen sogar sternförmig, Zellen mit langen Fortsätzen und andere mit einem Saum winziger Ausstülpungen, große Zellen mit einem becherförmigen Hohlraum und kleine mit einem Besatz von nach allen Seiten abstehenden Härchen.
Tier ist Tier und Pflanze ist Pflanze
Dabei blieben natürlich auch nicht die charakteristischen Unterschiede zwischen Zellen tierischer und pflanzlicher Herkunft verborgen (Abbildung 1). Zwar sind sie allesamt von einer dünnen Membran umgeben, doch Pflanzenzellen weisen zudem eine stabile Wand auf, die größtenteils aus Zellulose besteht. Deren Sinn ist leicht zu erklären: Pflanzen verfügen über kein stützendes Skelett, jede einzelne Zelle muss daher für ihre eigene Stabilität sorgen. Dazu trägt vor allem ein Hohlraum in ihrem Inneren bei, der sie nicht selten fast ganz ausfüllt und die anderen Bestandteile an den Rand drückt. Dieser Hohlraum – man nennt ihn Vakuole – ist mit Flüssigkeit gefüllt, die unter anderem die Aufgabe hat, von innen her einen Druck auf die Wand der Zelle auszuüben und diese dadurch, einem aufgeblasenen Ball vergleichbar, schön prall zu halten.
Erst letzte Woche ist mir dieser Mechanismus wieder einmal bewusst geworden. In meinem heimischen Arbeitsraum steht nämlich ein Alpenveilchen, dessen rosafarbene Blüten in dieser dunklen Jahreszeit ein wenig Farbe in den Raum bringen. Dieses Alpenveilchen hatte ich vergessen zu gießen. Prompt sackte die Pflanze, des stützenden Innendrucks ihrer Zellen beraubt, jämmerlich in sich zusammen und begann zu welken. Zum Glück fiel mir mein Versäumnis gerade noch rechtzeitig auf, und eilig gab ich der Pflanze Wasser. Sie saugte es begierig in sich hinein, um damit die geschrumpften Vakuolen ihrer Zellen zu füllen, und kurz darauf konnte man buchstäblich zusehen, wie diese wieder prall und fest wurden. Schon wenige Stunden später erfreute mich das Alpenveilchen wieder mit gewohnter Pracht.
Abbildung 1: Tier- und Pflanzenzelle
Übrigens können wir Menschen die Zellulose pflanzlicher Zellwände nicht verwerten und scheiden sie daher nach einer vegetarischen Mahlzeit weitgehend unverdaut wieder aus. Dennoch sind wir darauf angewiesen und tun daher gut daran, uns reichlich von Obst, Gemüse und Salat zu ernähren. Die Zellulose wirkt nämlich als so genannter Ballaststoff, der unseren Darm zu vermehrter Bewegung anregt, und das ist für eine geregelte Verdauung ausgesprochen hilfreich.
Doch noch ein weiteres charakteristisches Merkmal pflanzlicher Zellen fällt unter dem Mikroskop sofort auf: eine Vielzahl kleiner grüner Körperchen, die man Chloroplasten nennt. Im Inneren dieser winzigen Gebilde findet der bedeutendste aller biologischen Prozesse statt, ohne den das Leben auf unserer Erde unmöglich wäre: die Photosynthese.
Kein Leben ohne Zelle
Außer diesen Entdeckungen, die mit immer leistungsfähigeren Mikroskopen nach und nach möglich wurden, ist über die Geschichte der Zellbiologie fast eineinhalb Jahrhunderte – genauer gesagt: bis 1830 – nichts entscheidend Neues zu berichten. In diesem Jahr veröffentlichte der trotz seiner unbestrittenen Verdienste bis heute nahezu unbekannt gebliebene Mediziner und Botaniker Franz Julius Meyen ein Buch mit dem Titel Phytotomie (was man mit Pflanzenzerlegung übersetzen kann). Darin unterschied er nicht nur die einzelnen pflanzlichen Gewebe allein anhand ihrer charakteristischen Zellform, sondern behauptete auch kategorisch, Pflanzen wüchsen ausschließlich aufgrund sich teilender Zellen.
Neun Jahre später war es dann der deutsche Botaniker Matthias Schleiden, der zusammen mit dem Mediziner Theodor Schwann die Erkenntnis aus der Untersuchung und Beschreibung aller möglichen tierischen und pflanzlichen Zellen in einer allgemeingültigen Theorie zusammenfasste, nach der sich sämtliche Lebewesen, sosehr sie sich auch äußerlich unterscheiden mögen, aus Zellen als kleinster funktioneller Einheit zusammensetzen. Die beiden Forscher entdeckten, dass es neben mehrzelligen Organismen auch solche gibt, die nur aus einer einzigen Zelle bestehen, und erklärten, sämtliche Zellen besäßen gemeinsame Merkmale wie die äußere Begrenzung durch eine Membran und einen Kern in ihrem Inneren, dessen Bedeutung für die Zellteilung sie immerhin schon erahnten. Nicht die zuerst entdeckte Hülle der Zelle sei der eigentliche Träger des Lebens, verkündeten sie, sondern vielmehr ihr Inneres. In diesem spielten sich sämtliche Vorgänge ab, die ein Lebewesen von toter Materie unterschieden.
Omnis cellula e cellula
Endgültig bestätigt wurde die fundamentale Bedeutung der Zelle für alles Lebende schließlich durch den Berliner Arzt und Begründer der modernen Pathologie Rudolf Virchow. Er kam 1821 in Pommern zur Welt und studierte nach der Schulzeit in Berlin Medizin. Nach wenigen Jahren an der Berliner Charité lehrte er von 1849 bis 1856 in Würzburg. Danach ging er zurück nach Berlin und leitete bis zu seinem Tod im Jahr 1902 die pathologische Abteilung der Charité. Er war es, der im Jahr 1855 einen der berühmtesten Kernsätze der Biologie formulierte: Omnis cellula e cellula (Jede Zelle entsteht aus einer anderen Zelle). Demnach geht alles Leben auf dieser Erde, seit es vor mehr als dreieinhalb Milliarden Jahren begonnen hat, aus einem fortwährenden Strom sich teilender Zellen hervor, die in der Regel zu höchst komplizierten Organismen zusammengesetzt sind. Drei Jahre nach dieser Feststellung veröffentlichte Virchow seine Theorie der Zellularpathologie, nach der alle Krankheiten letztlich auf Störungen der Körperzellen und ihrer Funktionen beruhen. Auch diese Erkenntnis hat bis heute nichts von ihrer allgemeinen Gültigkeit verloren.
Zellen haben ein reiches Innenleben
Wieder passierte längere Zeit nichts Wesentliches, nur hin und wieder fanden die Forscher in den Zellen, die sie untersuchten, das eine oder andere neue Detail. Einen richtigen Sprung nach vorn machte die Zellbiologie erst, nachdem es dem deutschen Elektrotechniker Ernst Ruska im Jahr 1931 gelungen war, ein Mikroskop zu entwickeln, das statt gläserner Linsen Elektromagnete zur Bündelung und Ablenkung von Strahlen verwendete, die nicht aus sichtbarem Licht, sondern aus Elektronen bestanden. Kurz, er hatte das Elektronenmikroskop erfunden. Erst fünfundfünfzig Jahre später, nämlich 1986, erhielt er dafür zusammen mit zwei anderen Wissenschaftlern den Physik-Nobelpreis.
Während man mit dem besten Lichtmikroskop unter optimalen Bedingungen gerade noch Strukturen mit einem Durchmesser von 0,2 Mikrometern, also zwei Zehntausendstel Millimetern, erkennen kann, ermöglicht ein Elektronenmikroskop Einblicke in Größenordnungen, die noch zweitausendmal kleiner sind. Allerdings ist dazu ein immenser Aufwand nötig, der unter anderem aus der Tatsache ersichtlich wird, dass ein Präparat, dessen feinste Strukturen man mit einem Elektronenmikroskop untersuchen möchte, derart dünn sein muss, dass man ein Blatt dieses Buches in zweitausend Scheiben schneiden müsste, um überhaupt etwas erkennen zu können.
Mit Elektronenmikroskopen konnte man nun bis tief in das Innere einer Zelle blicken, und man fand dort Strukturen, die man nicht für möglich gehalten hätte: die bereits erwähnten Organellen. Man entdeckte, dass diese zelleigenen Miniorgane von Membranen umgeben sind, die derjenigen, welche die Zelle nach außen begrenzt, in ihrem Aufbau stark ähneln. Den Zellkern umhüllt sogar eine doppelte Membran, die in regelmäßigen Abständen von Löchern, so genannten Kernporen, durchbrochen ist.
Auffällig sind zudem die etwa acht Tausendstel Millimeter großen, ebenfalls von einer Doppelmembran umhüllten Mitochondrien