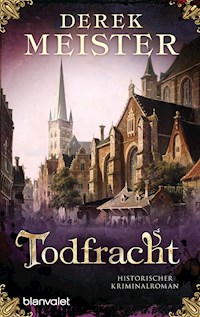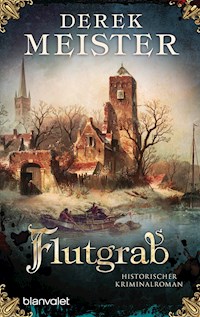8,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Henning & Jansen
- Sprache: Deutsch
Auf einem Geisterschiff im Watt werden die Leichen zweier Frauen gefunden. Sie sind grausam zugerichtet, wie Fische aufgehängt und ausgenommen worden. Ihre Lungen fehlen, und der Mörder hat eine seltsame Rune hinterlassen. Ein Ritualmord? Die Ermittlungen führen Knut und Helen zu einem weiteren Todesfall, der bereits Jahrzehnte zurückliegt. Treibt ihr Täter seitdem unbemerkt an der Küste sein Unwesen? Bevor Knut und Helen die schaurige Wahrheit herausfinden können, werden sie selbst zu Gejagten ...
Der dritte Teil der Thrillerserie um das Ermittlerteam Henning und Jansen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 431
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Buch
Auf einem Geisterschiff im Watt werden die Leichen zweier Frauen gefunden. Sie sind grausam zugerichtet, wie Fische aufgehängt und ausgenommen worden. Ihre Lungen fehlen, und der Mörder hat eine seltsame Rune hinterlassen. Ein Ritualmord? Die Ermittlungen führen Knut und Helen zu einem weiteren Todesfall, der bereits Jahrzehnte zurückliegt. Treibt ihr Täter seitdem unbemerkt an der Küste sein Unwesen? Bevor Knut und Helen die schaurige Wahrheit herausfinden können, werden sie selbst zu Gejagten …
Der dritte Teil der Thrillerserie um das Ermittlerteam Henning und Jansen.
Autor
Derek Meister wurde 1973 in Hannover geboren. Er studierte Film- und Fernsehdramaturgie an der Filmhochschule Potsdam-Babelsberg und schreibt erfolgreich Serien, Spielfilme fürs Fernsehen – und rasant-spannende Romane, mit denen er sich eine große Fangemeinde erobert hat. Er lebt mit seiner Familie in der Nähe des Steinhuder Meers.
Weitere Informationen unter: www.derekmeister.com
Von Derek Meister bereits erschienen
Rungholts Ehre · Rungholts Sünde · Knochenwald · Todfracht · Flutgrab · Der Jungfrauenmacher · Die Sandwitwe · Blutebbe
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvalet und
www.twitter.com/BlanvaletVerlag
DEREKMEISTER
BLUTEBBE
THRILLER
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © 2017 by Derek Meister
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30827 Garben.
© 2017 by Blanvalet in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Angela Kuepper
Umschlaggestaltung: www.buerosued.de
Umschlagabbildungen:
Mauritius Images/Alaska Stock/William W. Bacon; Plainpicture/BY
Illustrationen Innenteil: © Marion Meister
BL · Herstellung: sam
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN 978-3-641-20919-3V002
www.blanvalet.de
Für Dorothe und Ina
Ing wurde zuerst unter den Ost-Dänen
gesehen, bis er nach Osten zog
über das Meer. Sein Wagen zog ihm nach.
So nannten die Herdinger ihren Helden.
Altenglisches Runengedicht
Mut ist, wenn man Todesangst hat,
aber sich trotzdem in den Sattel schwingt.
John Wayne
1
Im letzten Licht der Dämmerung lag die Nordsee bleiern da. Der Mond war bereits aufgegangen, aber es ging auf Neumond zu, und die hauchdünne Sichel zeichnete sich kaum vom nachtblauen Himmel ab.
Hier draußen war die See eiskalt. Rutger keuchte vor Anstrengung und drehte sich auf den Rücken. In seinem schwarzen Neoprenanzug lag er wie ein Schatten auf dem dunklen Wasser. Einen Moment ließ er sich reglos treiben, sammelte Kraft und sah zu den ersten Sternen auf, die sich am Himmel abzuzeichnen begannen.
Du schaffst das. Langsam Luft holen. Beruhig dich … Es sind nur noch ein paar Meter …
Rutger konnte kaum schlucken, so sehr raste sein Herz vor Anstrengung. Das Blut rauschte ihm in den Ohren. Er hatte erst zwei Drittel des Wegs geschafft.
Komm runter. Du kannst das.
Der Anblick des Firmaments hatte ihn bisher oft getröstet, aber heute war das anders. Die Kälte drang durch seinen Taucheranzug, und es war nicht die Nordsee allein, die ihn frösteln ließ.
Vor allem der Gedanke an die nächsten Minuten schickte eine Gänsehaut über seinen Körper. Langsam zählte er bis dreißig und bekam immerhin seine Atmung wieder unter Kontrolle. Er hatte sich nicht getraut, mit dem Schlauchboot näher an die Segeljacht heranzufahren. Lieber war er gut siebzig Meter längsseits gegangen.
Vom Segelschiff drang Frauenlachen durch das Meeresrauschen zu ihm. Die Leiter war heruntergeklappt – das machte es fast zu einfach, an Bord zu gelangen.
Er rückte seinen Tauchrucksack zurecht, drehte sich wieder auf den Bauch und schwamm hinüber. Kurz darauf schwang er sich über die Reling, kauerte sich sofort nieder und lauschte angestrengt. Seine Hände fühlten sich taub an. Vor lauter Aufregung hatte er vergessen, die Handschuhe anzuziehen und sie im Rucksack bei seinen Utensilien gelassen.
Zahlreiche Schnitte und winzige Narben zeichneten sich auf seinen Fingern und der Handfläche ab. Einige der Wunden waren frisch und brannten vom Meerwasser.
Wenn du nicht tust, was ich sage, kommt das Vöglein geflogen.
Mit zitternden Fingern wischte er sich das Salzwasser aus dem Gesicht und spürte erneut, wie die Nervosität seine Kehle zuschnürte.
Er sah sich zur Kajüte um. Die beiden Frauen hatten das Licht gelöscht und stattdessen Kerzen angezündet, deren Schein flackernd aufs Deck fiel.
Das Lachen war nun lauter. Klassische Musik drang kaum hörbar zu ihm.
Für einen Moment kam es ihm vor, als habe er übermenschliche Kräfte, als könne er jede Planke, jede Schraube, jedes noch so stille Knarzen und Ächzen des Schiffs wahrnehmen. Ja, als sehe er schärfer als jemals zuvor in seinem Leben.
Beruhig dich, ermahnte er sich. Luft. Hol Luft. Zähl bis zehn. Du schaffst das. Konzentriere dich auf deine Aufgabe.
Du wirst es jetzt tun. Du ziehst das durch.
Gehorche.
Sie waren bloß zu zweit auf der Jacht. Er hatte das abgecheckt. Gründlich. Er kannte ihre Vorlieben, ihre Namen.
Vergiss ihre Namen! Sofort! Sie dürfen keine Namen haben.
Drei Tage lang war er auf der Pirsch gewesen, hatte sich fortgeschlichen und die beiden beobachtet, hatte sie studiert. Er hatte gehört, wo sie ankern wollten, und einen Plan geschmiedet.
Rutger schnallte den Tauchrucksack ab. So leise wie möglich zog er den Reißverschluss auf, nahm die Tauchhandschuhe heraus und streifte sie sich über.
Denk an die Vögelchen, mein Sohn. Tu, was ich sage. Sonst flattern die Vögel herbei. Pick-Pick-Pick.
Er nahm die Druckluftharpune von seinem Gürtel, spannte sie, pirschte sich an. Geduckt schlich er an der Reling bis zur Kabinentür. Dort meinte er, den Duft von Wein wahrzunehmen, das Parfüm dieser Weibsstücke und den Geruch von Sex.
Er wagte einen Blick, spähte durch die offene Tür.
Im goldenen Licht der Kerzen sah er einen nackten Rücken. Die Blonde hockte barfuß vor dem Bett. Sie hatte bloß ihren Slip an. Nur ihren Slip. Er glaubte, den Rand ihrer Brüste zu sehen, die sich in den Schoß der Schwarzhaarigen drückten, die breitbeinig dalag. Genussvoll dalag. Ein Bein aus der Koje baumelnd, das andere gegen die niedrige Decke gestemmt.
Diese Huren.
Die Blonde ließ ihre schmalen Finger über die Taille der Schwarzen streichen, küsste ihren Bauch und rutschte mit ihrem Kopf tiefer und tiefer.
Es erregte ihn. Er schloss die Augen, atmete leise.
Tu es. Gehorche.
Die Angst ist eine Welle. Aber du bist das Schiff. Du bezwingst die Welle. Du siehst meinen Wagen. Das Feuer wird in dir sein.
Denk an die Vögelchen.
Gehorche.
Tu es.
Sie haben keine Namen. Diese Nutten.
Die Druckluftharpune lag gut in seiner Hand. Er spürte sein steifes Glied unangenehm in seinem Anzug drücken.
Gehorche. Sonst… Pick-Pick-Pick.
Ohne eine Warnung trat er vor, zielte und schoss.
Beinahe lautlos zischte der Pfeil davon, traf die Schwarze im Bein und heftete dieses Miststück an die Wand. Ganz wie er es gewollt hatte. Ihre Schmerzensschreie peitschten sein Blut auf.
Die Blonde fuhr herum. Zu spät.
Er war schon bei ihr.
So fest er konnte, hieb er ihr mit dem Kolben der Harpune ins Gesicht. Blut rann aus ihrer Nase, dann kippte sie zur Seite, stürzte vor die Koje. Er hieb noch einmal zu. Noch einmal. Noch einmal.
Zwei, drei, vier, fünf Mal. Noch mal! Noch mal! Und noch mal!
Was tust du! … Stopp! Stopp! Bring sie nicht um.
Bebend rang er nach Luft. Die Frau hatte längst das Bewusstsein verloren. Er starrte auf sie herab, fühlte und genoss. Fühlte und genoss. Fühlte und genoss und spürte seine Kraft, seine eigene Urgewalt.
Seine Erektion wurde noch härter. Sie schmerzte.
Die Schwarze schrie wie am Spieß, wollte weg, aber der Pfeil mit seinen Widerhaken hatte ihr Bein durchschlagen und steckte fest in der Verkleidung.
Rutger konnte ihre Scham sehen.
Mit der Verzweiflung einer Sterbenden bückte sie sich, riss an dem stählernen Pfeil, versuchte, ihr Bein herunterzuziehen. Es wollte ihr nicht gelingen. Sie wimmerte und keuchte. Tränen liefen über ihr Gesicht.
Er baute sich vor ihr auf, griff ihre Haare und zerrte ihren Kopf hoch, sodass sie ihm in die Augen sehen musste. Triumphierend lächelte er und bedeutete ihr, still zu sein.
Anstatt sich weiter um sie zu kümmern, ließ er von ihr ab und packte stattdessen die bewusstlose Blonde an den Armen, schleifte sie aus der Kajüte, über das Deck.
Als er zurückkam, sah er, wie die Schwarze erneut panisch am Pfeil zerrte und mit ungeheurer Willenskraft versuchte freizukommen. Er beendete das lächerliche Schauspiel, indem er ein paar Mal auf sie einschlug, bis sie sich nicht mehr wehrte, sondern sich nur noch flehend die Hände vors Gesicht hielt.
Er las die Harpune auf, die er abgelegt hatte, und klippte sie an seinen Gürtel. Dann löste er den Harpunenpfeil vom Seil und zog ihn mit einem Ruck aus der Bordwand, wobei er darauf achtete, dass er in ihrem Bein stecken blieb. Mit beiden Händen packte er ihn und zerrte sie daran vom Bett, schleifte die Frau am Pfeil hinter sich her.
Ihre Angst und der Schmerz formten Schreie, wie er sie noch nie gehört hatte. Schrill wie ein Trennschleifer in Metall, erstickt wie winselnde Hunde, gurgelnd wie Schritte im Schlick. Sie schickten wohlige Schauer über seine Brust und verhallten dann über der mondbeschienenen Nordsee. Ungehört.
Mit einem letzten Ruck ließ er die Schwarzhaarige neben ihre Freundin fallen. In ihren Augen las er reine Panik. Es war schön anzusehen, wie sie bettelte und nicht wusste, was er als Nächstes vorhatte. Niemals hätte er gedacht, dass es so erregend war.
Es tat so gut zu bestimmen.
Gehorche. Sonst kommen die Vögelchen. Pick-Pick-Pick.
Die beiden lagen vor dem Mast. Er lud die Harpune ein zweites Mal, trat zur bewusstlosen Blonden und setzte ihr den Lauf auf den Unterschenkel.
Der Muskel war stark genug für das, was er vorhatte.
Er jagte auch der Blonden einen Pfeil durchs Bein. Sie riss die Augen auf, nicht wissend, wo sie war und was der Schmerz zu bedeuten hatte. Blind um sich schlagend, bäumte sie sich auf, griff panisch nach dem Pfeil, zerrte. Rutger kümmerte das nicht. Seelenruhig holte er seinen Rucksack herbei, kniete sich damit neben die beiden Frauen und zog den Reißverschluss auf.
Kurz darauf legte er einige akkurat aufgewickelte Leinen aufs Deck. Dann griff er noch einmal hinein und nahm, vor Erregung zitternd, ein Einweckglas heraus.
Behutsam stellte er es auf die Planken.
Es schimmerte magisch im Mondlicht.
»Es wird kaum wehtun«, raunte Rutger und zog lächelnd ein zweites Glas aus seinem Rucksack.
2
»Komm schon, Veith. Hör auf zu kichern.« Knut Jansen zog seine E-Gitarre von der Rückbank. Die 59er Telecaster hatte er diesen April zu seinem Dreißigsten geschenkt bekommen. Ein wunderbares Instrument mit schmeichelnd geschwungenen Linien. »Das Outfit passt doch perfekt. Ich weiß gar nicht, was du hast.«
Der junge Polizeirevierleiter von Valandsiel hatte sich in Schale geworfen: blaue Westernstiefel mit Goldnaht, Wildlederweste und stonewashed Levi’s.
Knuts Freund verkniff sich ein weiteres Grinsen. »Na, wenn du meinst.«
»Bisschen Show muss sein.« Gut gelaunt tätschelte Knut seinen Labrador Butch, bevor er auch ihn aus dem Landrover hob. Der gute Kerl war in die Jahre gekommen.
»Da hast du wohl recht.« Veith fädelte aus dem Heck seines Volvos einen Kontrabass und streifte sich ein schnittiges Sakko über sein edles schwarzes Hemd.
Eine Brise wehte über den kargen Parkplatz des Dock-5. Die Bar lag abseits der Touristenströme an einem Seitenbecken des Hafens, der zur größten Werft Valandsiels gehörte. Keine sehr ansehnliche Ecke, auch wenn die Barbesitzerin mit Strandsand und Palmen tapfer gegen den Industrielook ankämpfte.
»Oh nein!« Veith tat, als falle er gleich in Ohnmacht. »Haben die etwa auch Fransen?«
»Was?« Knut, der ein weiteres Mal in den Rover gegriffen hatte, sah auf das Bündel in seiner Hand. »Sicher. Das sind Chaps. Chaps müssen Fransen haben. Keine Fransen, keine Chaps.« Er hielt sich die ledernen Beinkleider für Cowboys an.
»Na, immerhin sind sie braun und nicht elvisblau.« Amüsiert schüttelte Veith den Kopf und schloss den Wagen ab.
»Sieht doch cool aus. Ich mein, Pia will mehr Show, also kriegt sie mehr Show. Entweder richtig oder gar nich’.«
»Dann bin ich eindeutig für ›gar nich’‹.«
»Nur weil wir Ring of Fire im Repertoire haben, muss ich ja nicht wie Johnny Cash rumlaufen, oder?« Knut deutete mit einem Nicken auf Veiths Hemd und Sakko.
»Nur weil wir Tumbling Tumbleweeds im Repertoire haben, musst du ja nicht wie John Wayne rumlaufen, oder?«
»Touché.«
»Avec plaisir.«
»Avec was?« Knut winkte ab, zögerte dann aber doch. »Okay. Ist wahrscheinlich zu dicke.« Schweren Herzens packte er die Chaps zurück.
»Wyatt Earp sei Dank.«
»Aber der! Der gehört echt dazu!« Unvermittelt zog er aus dem Wagen einen weißen Prunkwesternhut und setzte ihn auf.
Veith lachte lauthals.
»Ich muss schon bitten, Herr Kollege. Der muss sein. Original Rodeoking mit 4-Zoll-Brim.«
Hilflos vor Lachen, winkte Veith ab. »Okay, okay … Sheriff.«
Mit einem schelmischen Grinsen warf sich Knut prompt in Elvis-Pose. »Rock ’n’ Roll, Baby!«
Pia goutierte seine Aufmachung mit einem Pfiff. Die Barbesitzerin stand am Hintereingang, ein Spültuch über der Schulter und eine Getränkekiste vor dem Bauch. »Du siehst echt … echt … äh … schillernd aus.«
»Hörst du’s, Veith? Im Gegensatz zu dir hat die Lady Geschmack.« Lässig schulterte Knut seine Gitarre und schlappte mit ausladenden Schritten, Butch an seiner Seite, zur Bar. Seine Cowboystiefel klackten auf den Pflastersteinen, während der leichte Seewind Sand über den Parkplatz wehte.
»Ich glaub, du hast deine Sporen vergessen«, rief Veith ihm feixend hinterher, bevor er seinen Bass nahm und Knut folgte.
Normalerweise spielte Knut im Dock-5 allein und gab ein paar Klassiker zum Besten: Stairway to Heaven, Babe I’m Gonna Leave You, My Secret Live, Suzanne, Leyla … Und das vor einer sehr überschaubaren Anzahl Zuhörer.
Heute füllten sich jedoch die Überseecontainer, in denen Pia ihre Bar eingerichtet hatte, zusehends. Die Stimmung war ausgelassen, die Theke umlagert und kein Platz mehr vor der winzigen Bühne frei.
Knut, der die Gästeflut beim Aufbau und dem Soundcheck registrierte, wurde ein wenig flau im Magen. Er sah an sich herunter, und mit einem Mal kam ihm sein Sheriff-Outfit unglaublich kindisch vor, und er wünschte sich inständig, sie hätten die letzten Tage mehr geprobt.
Pia und ihre Werbeaktionen, dachte er.
Vor einem Monat hatte er noch über das Motiv geschmunzelt: »Sheriff Knut Jansen & Begleitung«, prangte auf ihren Flyern – direkt über einem Cowboy, der in den Sonnenuntergang ritt. Sehr komisch.
Warum war er auch so doof und pflasterte in Pias Auftrag halb Valandsiel mit Plakaten? Als hätte er auf Streife nichts Besseres zu tun.
Die Wahrheit war, er hatte nichts Besseres zu tun.
Meistens jedenfalls. Wenn nicht gerade ein Bewohner des Altenheims vermisst wurde, die üblichen Teenager mit frisierten Mopeds irgendwelche Touristen verschreckten oder der Hund des Metzgers wieder einmal an einen Strandkorb pinkelte.
Knut sah Helen, die sich einen Weg nach vorne bahnte, und gab Veith die Kabel für das Mischpult. »Mach du das mal eben. Bin gleich wieder da.«
Mit einem lässigen Sprung setzte er über die Monitorboxen und landete direkt vor ihr.
»Miss«, begrüßte er sie und tippte charmant an seine Hutkrempe.
»Wow«, stieß sie angesichts seiner Klamotten aus und umarmte ihn freudig. Ihr Geruch ließ sein Herz schneller schlagen, und das Kitzeln ihrer Haare bei der Umarmung war wie ein wohliger elektrischer Schlag. Er traute sich, ihr die Wange zu küssen.
Sie hatten zwar beinahe miteinander geschlafen, aber die Betonung lag auf »beinahe«, und nach jenem Zwischenfall war nichts mehr in dieser Art geschehen. Keine Liebkosungen, keine eindeutigen Rendezvous. Es war zum Verrücktwerden. Nur ein paar Verabredungen zum Essen, einige Ausflüge und gemeinsame Abende hier im Dock-5. Lediglich das Du war von dem Abend auf dem Schrottplatz, als er sie voller Begierde auf die Motorhaube gehoben hatte, übrig geblieben. Immerhin das. Ein Anfang.
Nachdem sie sich begrüßt hatten, lächelte sie und meinte unvermittelt: »Sobald du auf der Bühne stehst, wird es besser.«
Knut musste schmunzeln. Ab und an machte sie sich einen Witz draus, seine Fragen im Voraus zu beantworten.
»Ist das ein Punkt?«, fragte sie.
»Eindeutig. Dafür gibt es auf jeden Fall ’n Punkt.«
»Die Frage?«
»Glaubst du, dass mein Lampenfieber weggeht? … Du hast voll ins Schwarze getroffen.«
»War ja auch nicht schwer. Du hast zu den ganzen Leuten gesehen, kurz bevor du mit mir Augenkontakt gesucht hast. Als würden dich die Gäste stören, als fändest du es unangenehm, dass sie hier sind, dass sie dich beobachten.«
»Und weil du ganz egoistisch davon ausgehen kannst, dass es nicht an dir liegt …«
»Genau. Weil du es nicht peinlich findest, mit mir gesehen zu werden, ist es höchstwahrscheinlich das Konzert. Außerdem bist du ziemlich nervös.«
»Niemals.«
Helen lachte. »Du grübelst, versuchst deine Unsicherheit zu überspielen, indem du deine Hände knetest. Ach – und das Zucken deines Mundwinkels verrät dich auch. Das Zucken des kissing muscle.«
»Kissing muscle?« Er musste schmunzeln, denn ihm war ihr flirtender Ton nicht entgangen.
»Musculus orbicularis oris.« Verschmitzt spitzte sie die Lippen, um es zu demonstrieren. »Kissing muscle … Oder liegt es etwa doch an mir?«
Küss sie doch einfach. Trau dich, sagte er sich. Entweder, sie knallt dir eine, oder … Das ist doch ’ne Steilvorlage. Mach schon …
Er tat es nicht.
Feiger Sheriff.
Na toll, schoss es ihm durch den Kopf. Bei Helen bist du zu feige, mal durchzustarten, das Outfit ist dir zu kindisch, aber das willst du nicht zugeben, und das Lampenfieber schickt dich gleich aufs Klo. Knut Jansen, du hast deine Gefühle voll im Griff.
»Schade«, stellte sie leicht enttäuscht fest. »Anscheinend wirklich nur Lampenfieber.«
»Was? Nein, nein. Du … Also … Äh, was hältst du davon, wenn wir im Anschluss noch was trinken?«
Helen nickte, während sie sich beide stumm in die Augen sahen.
Veiths und Pias Rufe störten ihre Zweisamkeit. Die beiden winkten von der Bühne. Es sollte losgehen.
»Morgen kommt der Makler mit zwei Käufern fürs Haus. Wehe, du lenkst mich heute Abend nicht ab.« Aufmunternd drückte sie ihm den Hut fester auf den Kopf. »Los, Cowboy. Lass es ordentlich krachen da oben.«
Er zwinkerte ihr cool zu, holte dann aber so seufzend Luft, als trüge er fünfzehn schwere Lautsprecher auf der Schulter.
Drei Minuten später führten sie den letzten Soundcheck durch, und Knut spürte, dass sein Lampenfieber tatsächlich nachließ. Wahrscheinlich weil er sich auf die Stücke und sein Spiel konzentrierte, anstatt über die ganzen Gäste zu grübeln. Das bunte Licht der Bühnenstrahler schien ihn aufzuheizen und ihm Kraft zu geben.
»Darf ich um Ihre Aufmerksamkeit bitten?« Pia hatte sich das Mikro geschnappt. Mit knappen Worten stellte sie die beiden vor, verkniff sich aber Gott sei Dank jeden Sheriff-Gag.
Showtime, dachte Knut, als er von Pia das Mikro bekam und in den Ständer steckte.
Er lüpfte cool seinen Cowboyhut und fing Helens Blick ein, die ihm lachend ein »Daumen hoch!« schenkte.
»Howdy! Ihr Greenhorns«, begrüßte er das Publikum. »Wir starten sofort. Erste Nummer heißt Communication Breakdown. Das Ding ist zweieinhalb Minuten lang, wir schaffen es in einer! … Uuuuund los geht’s.« Er nickte Veith zu, hob das Plektron und wollte in die Saiten …
Da klingelte Veiths Handy.
»Oh. ’tschuldigung. ’tschuldigung.« Peinlich berührt fingerte Knuts Freund es aus seiner Jackentasche und drückte es aus.
»Ha! Guter Hinweis. Wenn ihr telefonieren wollt, jetzt ist es zu spät. Denn es wird … laaaauuuuut!« Knut wollte gerade erneut anfangen, da bemerkte er, wie sein eigenes Handy im stummen Alarm auf der Lautsprecherbox vibrierte und runterzufallen drohte.
»Shit. Sekunde!« Er sprang hin, wollte es eigentlich sofort ausdrücken, sah aber Diehls Konterfei auf dem Display. Ihr Kollege schob heute mit Birthe die Nachtschicht in der Wache.
Wollte Diehl sie verarschen? Er wusste genau, dass ihr Gig in dieser Minute losging. Wenn der jetzt mit irgendeiner Katze auf einem Baum ankam, dann …
Knut rang mit sich. Abnehmen? Ignorieren? Das durfte er nicht als Revierchef. Aber wenn Diehl sich echt einen Scherz erlaubte, würde er ihn ungespitzt in den Boden rammen.
»Ähm, sorry«, rief er ins Publikum. »Die ollen Stones mal wieder. Keith hat Rücken. Ich soll einspringen. Sekunde.«
Immerhin hatte er die Lacher auf seiner Seite.
Fluchend nahm er ab. »Ja?«
»Entschuldige, dass ich störe, Knut … Aber ich hab hier ’n Schiff.«
»Schiff? Willst du mich … Diehl, wir sind hier …«
»Nein. Hör zu. ’ne Fähre aus Norwegen hat vor einer Dreiviertelstunde gemeldet, dass ’ne Jacht in die Rinne treibt. Da meldet sich niemand. Kein Funk, keine Lichter, kein Garnichts.«
»Was?«
»Da ist irgendwas passiert. Da draußen ist ein … ein Geisterschiff.«
»Geisterschiff?« Sofort stellten sich Knuts Nackenhaare auf. Er spürte, wie ihm ein Schauer über den Rücken kroch. In diesem Moment hatte er glatt vergessen, dass er noch immer auf der Bühne stand.
3
»Ein paar Segler, die nach ihrem Angeltörn vergessen, die Rundumleuchte einzuschalten«, moserte Veith. »Sechs Bier zu viel, ab in die Koje, und dann werden sie abgetrieben. Irgendwann sieht eine Fähre sie, und jetzt sind sie irgendwo da draußen im Matsch. Das war’s.«
»Weiß nicht.« So recht konnte Knut an die Erklärung seines Kollegen nicht glauben. »Wisst ihr schon, welches Schiff es überhaupt ist?«, fragte er Diehl.
Der dickliche Beamte setzte sein Fernglas ab. »Nein. Wir versuchen seit Stunden, wen zu erreichen. Keine Antwort bisher über Funk.«
Sie fuhren gemeinsam in einem wendigen Aluschiff über einen der Priele nach draußen. Er war gute sechs Meter breit und würde sich mit der bald einsetzenden Flut in einen Fluss voller gefährlicher Strömungen verwandeln.
Der Fahrtwind strich Knut über die Wangen. Im Gegensatz zum Land war die Luft hier im Watt extrem feucht. Nebel war aufgezogen und hatte sich über die flache, unwirtliche Landschaft des Wattenmeers gelegt. Er sah auf den scheinbar endlosen Schlick, der im Scheinwerferlicht in dieser weißen Mauer verschwand, während die Nacht ebenso endlos an ihnen vorbeizog.
Vor zwanzig Minuten hatte Knut mit Veith auf der Slipanlage nahe der Promenade gehalten, wo Diehl schon mit zwei Mitarbeitern der DLRG auslaufbereit auf ihn wartete. Nach den Wind- und Seekarten zu urteilen, war das Geisterschiff wahrscheinlich in die Drift gegangen und mit dem auflandigen Wind Richtung Küste getrieben. Dann war die Ebbe gekommen, und das Wasser hatte sich zurückgezogen. Wenn es noch dort draußen war, lag es irgendwo im Watt.
Die Deutsche Gesellschaft zur Rettung Schiffbrüchiger auf Sylt zu bitten, einmal nachzusehen, war sinnlos. Mit ihrem Schiff, der Pidder Lüng, kämen sie nicht dicht genug heran. Und weil der Amphi Ranger, der zum Amphibienfahrzeug umgerüstete Unimog der Valandsieler DLRG, wegen Getriebeschaden auf unbestimmte Zeit außer Gefecht gesetzt war, hatte Knut angeregt, über einen der Priele so weit wie möglich heranzufahren. Den letzten Rest würden sie zu Fuß zurücklegen.
Auf dem Slip hatte er es noch für eine gute Idee gehalten, aber in Anbetracht des zuziehenden Nebels war er sich nicht mehr sicher. Nebel, Watt und Flut waren eine Kombination, die ihm eine Heidenangst einjagte.
Je weiter sie rausfuhren, desto unbehaglicher fühlte sich Knut. Die klamme Kälte und der Geruch von Salz, Fisch und Schlick ließen ihn an alte Gemäuer denken, an die verhängnisvolle Reise in eine Gruft.
Fröstelnd blickte er zurück zum Land, konnte die Lichter Valandsiels aber wegen des Nebels nicht mehr erkennen.
»Blinder Alarm. Ich sag’s euch. Ich bleib dabei.« Veith putzte seine Brille. Er war noch immer verärgert über den Abbruch ihres Gigs.
Knuts Gefühl sagte ihm etwas anderes. »Was ist mit einem Notruf?«, hakte er noch einmal bei Diehl nach.
»Es wurde keiner abgesetzt. Weder auf UKW sechzehn noch null.«
»Wird wer vermisst?«
»Im Revier ist nichts eingegangen«, antwortete Diehl. »Birthe hat in Husum und Sylt bei den Dienststellen nachgefragt. Fehlanzeige.«
»Die Häfen?«
»Sind wir durchgegangen. Wir haben hier vor Ort nachgefragt, alle gängigen Anlegestellen und Vercharterer. Und auf Sylt, Amrum und Föhr. Nichts.«
Knut nickte. Diehl hatte gute Arbeit geleistet. »Das heißt, das Schiff ist noch nicht überfällig.«
»Scheint so, ja.«
»Oder es kommt von weiter weg«, stellte Veith fest.
»Gut möglich«, gab Knut ihm recht.
Einer der DLRGler wandte sich zu ihnen um. Der Mann war noch ein halbes Kind, gerade mal über zwanzig. Er hatte seinem älteren Kollegen das Steuer überlassen und die ganze Zeit per Funk versucht, eine Verbindung herzustellen. »In fünf Minuten sind wir da«, stellte er fest. »Wir nehmen an, dass es da vorne irgendwo liegt. Nordwestlich.«
Wie Gaze breitete sich der Nebel vor ihnen aus und stieg geradewegs aus dem Meeresboden. Angestrengt versuchten sie, etwas im Kegel des Suchscheinwerfers zu erkennen – aber dort vor ihnen lag bloß die nebelgeschwängerte Nacht.
Der junge Mann hatte dennoch nicht zu viel versprochen. Ein paar Minuten später ließ sein Kollege, ein älterer Herr mit Öljacke und wachen Augen, das Boot sanft auflaufen. Knut kannte ihn als aktiven Vogelschützer und ambitionierten Mitarbeiter der Lebensrettung. Auf den Mann war Verlass, und er kannte das Watt wie seine Westentasche, aber dennoch konnte seine Anwesenheit Knuts mulmiges Gefühl nicht vertreiben.
Sie gingen alle von Bord. Fünf Lichtkegel schnitten über den dunklen Schlick und den dichter werdenden Nebel. Die Szenerie war mehr als unwirtlich.
Wie auf einem anderen Planeten, dachte Knut und sah sich um. Über ihnen meinte er durch den Dunst noch ein paar Sterne sehen zu können, aber wahrscheinlich bildete er sich das nur ein. Lediglich die hauchdünne Sichel des Neumonds stand unscharf und vom Nebel zerfranst am Himmel. Sein spärliches Licht vermochte kaum zu ihnen zu dringen.
»Wo sind denn die Sterne hin?«, wollte Knut wissen.
»Was?«, fragte Diehl.
Knut winkte ab. Er hatte gar nicht laut fragen wollen, aber als er noch mal hinaufsah, war dort nichts als unendliche Schwärze. Alles wurde vom Nebel geschluckt.
Die Sterne waren fort.
Bereits wenige Meter außerhalb der Lichtkegel verlor sich die Welt in Finsternis. Den Horizont hatten Nacht und Dunst gefressen. Ebenso jegliches Geräusch, wie Knut schaudernd feststellte.
Nur die schmatzenden Laute ihrer Schritte begleiteten sie. Knut hatte seine Western- gegen Gummistiefel eingetauscht. Im Kofferraum seines Landrovers hatte er immer welche dabei. Die kunstvollen Lederstiefel hätte er nach fünf Metern wegwerfen können. Schritt um Schritt verdichtete sich sein Gefühl, dass die Stiefel immer tiefer in den Schlick sanken.
Die Flut war eindeutig auf dem Vormarsch.
Gut, dass wir detaillierte Karten haben, versuchte Knut sich Mut zu machen. Er hatte schon mehrmals Ertrunkene geborgen, die von der Flut überrascht worden waren. Wir haben Lampen, Kompass und GPS. Hier draußen ist nichts, was uns Angst macht. Trotzdem wollte er auf seinem Smartphone nachsehen, wann die Flut kam. Sicher ist sicher. Aber er hatte keinen Empfang.
»Wann kriegen wir hier nasse Füße?«, wandte er sich an den älteren DLRGler. »Wie viel Zeit ist noch?«
Als normaler Wattwanderer ohne Boot hätten sie es von hier aus sicher nicht an Land geschafft, sondern sich zwischen den Prielen heillos verlaufen.
Der Mann hatte die Zeit im Kopf, musste nur überschlagen, wie weit sie draußen waren. »Das Wasser müsste in rund vierzig Minuten hier sein. Wenn wir dann nicht zurück am Boot sind, wird’s langsam eng.«
»Dann beeilen wir uns lieber.« Knut zog seine Basecap tiefer ins Gesicht und legte einen Schritt zu. Mittlerweile war ihm nicht nur klamm, sondern wirklich kalt. Er hatte sich bloß eine dünne Regenjacke übergestreift.
»Sekunde«, pfiff der junge DLRGler ihn zurück und checkte noch einmal sein GPS, dann zeigte er ein paar Grad weiter westlich mit seiner Lampe in den Nebel. »Nord-Nord-West. Eher da lang. Ist noch ein ganzes Stück, wenn unsere Vermutung stimmt.«
»Wattwanderung. In der Nacht. Sensationell«, meinte Veith genervt.
»Bei der letzten wär ich fast mit drei Kumpels ertrunken.«
»Mutprobe?«, fragte Veith.
»Mit zwölf. Ziemlich fahrlässiger Unfug.«
Veith knurrte bejahend. Er schloss zu Knut auf und stimmte die ersten Zeilen von Tumbling Tumbleweeds an. Angesichts des Songs stöhnte Diehl auf.
Die Männer marschierten zügig durch die feuchte Wüste. Die Kegel ihrer Taschenlampen tanzten bei jedem schmatzenden Schritt.
»Da drüben. Ich glaub, da ist was!«, sagte Veith.
Nach einer gefühlten Ewigkeit meinte auch Knut, einen Schatten auf dem Watt wahrzunehmen. Ein Stück des Nebels schien ihm dunkler. Der Strahl seiner Stablampe verlor sich zwar im Dunst, aber da war etwas. Ein Schemen, der sich vor dem dunklen Hintergrund abzeichnete.
Abermals korrigierten sie ihre Marschroute.
Nach weiteren hundert Metern konnten sie eindeutig die Silhouette eines Schiffs auf dem Watt erkennen.
Surreal schob sich ein Rumpf aus dem Nebel und ragte als dunkler Schatten über dem dunklen Schlick.
Es war ein gut fünfzehn Meter langes Segelboot. Die Jacht war auf dem Watt trockengefallen und stand auf ihrem Twinkiel sicher da. Sie war nicht umgekippt, wie Knut die ganze Zeit befürchtet hatte, sondern ruhte – als habe ein Riese sie ordentlich abgestellt – in der Nacht.
Weil das Schiff auf dem Kiel stand, ragte die Reling zu hoch vor ihm auf, als dass Knut etwas auf Deck hätte erkennen können.
Die fünf traten näher. Ihre Lichtkegel strichen über den Rumpf.
»Haaallooo? Polizei Valandsiel. Haaallo? Ist da wer?«, Knuts Ruf wurde vom Nebel geschluckt.
Alle lauschten.
War da ein fernes Meeresrauschen zu hören? Auf jeden Fall drang ein leises Klirren zu ihnen, rhythmisch, als schlage ein Stückchen Metall gegen etwas.
»Hier ist die Polizei! Bitte antworten Sie!« Auch sein zweiter Ruf blieb unerwidert.
»Vielleicht sind alle ausgeflogen«, überlegte Veith laut.
»Ja«, wandte Diehl ein. »Möglicherweise sind die von Deck und machen auch ’ne Nachtwanderung.«
»Glaub ich nicht«, meinte Knut. »Hätten sie dann nicht ein weißes Licht gesetzt?« Das weiße Rundumlicht war nicht eingeschaltet worden.
»Überhaupt keine Beleuchtung. Vielleicht sind die Akkus leer«, mutmaßte Diehl.
Die Erklärung kam Knut zu simpel vor. Mittlerweile war sein ungutes Gefühl geradezu greifbar. Er ließ den Strahl seiner Taschenlampe über das Watt gleiten, um Veiths These zu prüfen. Nichts. Auf dieser Seite des Schiffs waren lediglich ihre Spuren im Schlick zu erkennen. Sie gingen um das Boot herum. Gleiches Spiel. Keine Fußspuren.
»Die Leiter ist hochgeklappt, keine Hängeleiter. Kein Anker. Nichts«, stellte Knut fest. »Da ist niemand vom Deck runter.«
Das mulmige Gefühl wanderte von seinem Magen in seine Brust. Das Segelschiff stand so ungeheuer ruhig da. So friedlich und dennoch unwirklich.
Bis auf das Klirren herrschte noch immer Grabesstille.
Knut ließ den Schein seiner Stablampe über den Namen gleiten. »Marietta«, las er vor und stutzte … »Shit. Was ist das denn?«
Alle richteten ihre Lampen auf Knuts Spot. Über die weißen Holzplanken des Rumpfs war etwas geflossen. Knut trat näher und berührte es mit dem Finger. Es war Blut. Kein Rost. Es war eindeutig Blut.
Reichlich Blut.
»Das kommt durch die Überlauflöcher von der Reling«, stellte Veith fest.
»Halloooo«, Knut brüllte aus Leibeskräften. Totenstille. »Scheiße. Scheiße. Scheiße«, fluchte er. Es war absolut richtig gewesen, hier rauszufahren, nicht bis zur Flut zu warten und sich auf die Pidder Lüng oder die Sylt zu verlassen.
»Das ist ziemlich viel Blut«, stellte Diehl fest. »Schaut mal, das geht hier zwei Meter in die Breite und ist bis unten …«
»Alarmier ’n Notarzt, ’n Krankenwagen«, befahl Knut Diehl. »Der soll zur Slipanlage kommen – oder besser, die sollen einen Heli schicken. Sofort.«
Diehl funkte das Krankenhaus an, während Knut die besudelte Seite entlangleuchtete. Er ging sie ab und blieb ein paar Schritte neben dem blutroten Rinnsal entfernt stehen. »Veith? Räuberleiter. Ich versuch’s hier und werf euch eine Strickleiter oder so runter.«
»Du willst da alleine …?«
»Willst du hier warten?«
»Nein, nein, Mann.« Veith gefiel das alles ganz und gar nicht, aber er half Knut hinauf. Auch die beiden DLRGler packten an und schoben ihn den letzten Rest in die Höhe, sodass er sich über die Reling ziehen konnte.
Kaum an Bord, kaum die Lampe aufs Deck gerichtet, fuhr Knut zu seinen Kollegen herum. Keuchend, kreidebleich erschien sein Kopf in Veiths Lichtkegel.
»Was ist?«, wollte er wissen.
Knut antwortete nicht, rang nach Luft.
»Knut? Was ist los?«, fragte auch Diehl.
Das, was der Lichtkegel seiner Lampe Knut offenbart hatte, war derart grauenvoll, dass ihm das Essen hochkam. Immerhin kämpfte er tapfer und behielt alles drin. Er schnappte nach Luft. »Scheiße«, keuchte er. »Bleibt bloß unten.«
Die beiden warfen sich einen überraschten Blick zu, waren nicht sicher, was sie davon halten sollten. Selbstverständlich würden sie ihm beistehen, und selbstverständlich würden sie alles inspizieren.
Angewidert bemerkte Knut, wie sich der Gestank des Watts mit einem anderen Duft hier oben vermischte: dem eisernen Geruch von Blut.
Seitdem er in Valandsiel das Revier übernommen hatte, spielte die Welt verrückt. Er hatte so viel Blut gesehen und Leichen gefunden wie in seinem ganzen restlichen Leben nicht. In Kühlschränken nach Sturmfluten und halb verwest unter Wasser. Letzten Sommer mehrere Tote, die mit Sand gefüllt worden waren, und davor junge Mädchen ohne Füße. Abgesägt, verstümmelt.
Er atmete schwer durch, hielt sich an der Reling fest, starrte in den Nebel und rang um Fassung. Die Kollegen von der freiwilligen Feuerwehr und die Sanitäter hatten ihn schon öfter aufgezogen, weil er den Anblick von Blut nicht ertragen konnte. Aber ehrlich gesagt, war es ihm lieber, sich einmal mehr zu übergeben, als abzustumpfen und irgendwelche beschissenen Bilder jahrelang mit sich herumzuschleppen. Bilder, die aus dem brackigen Tümpel der Erinnerung hochstrudelten – noch nach Jahren – und wie mit Gift gefüllte Blasen aufplatzten. Genau damit hatten die meisten seiner Kollegen zu kämpfen – vor allem die Freiwilligen, die kaum Schulungen für die Bewältigung traumatischer Situationen bekamen. Nach Jahren ploppten die Erinnerungen an irgendwelche Touristen hoch, die sie von der Bundesstraße gekratzt oder aus Autos geschnitten hatten, und machten sie fertig.
Das hier aber war eindeutig schlimmer als jeder Einsatz auf der Bundesstraße.
Schluckend rückte er seine Basecap zurecht und zögerte noch immer, sich erneut dem Deck zuzuwenden.
»Was ist denn? … Knut?«, wollte Diehl wissen. Der korpulente Beamte hatte den Kopf in den Nacken gelegt und wartete mit Veith auf Anweisung. Alle starrten zu Knut hinauf.
»Gleich. Sekunde.« Endlich fasste er sich ein Herz.
Diesmal leuchtete er nicht voll rein, sondern ließ den Strahl tastend über die Blutlache am Boden streichen, dann immer weiter Richtung Mast. Weiter und weiter …
Im Lichtkegel tauchten zwei Paar Füße auf. Nackt. Beide waren rot vor Blut, das die Beine hinabgelaufen und aufs Deck geflossen war.
Sein Lichtstrahl glitt höher, leckte über die Beine, über etwas Rotes, das er erst für eine Decke hielt, aber eher Eingeweide waren …
Ihre Bäuche und die Brust waren geöffnet. Knut schloss die Augen, zählte bis zehn. Doch es half nichts. Irgendwann würde er die Augen öffnen müssen. Hadernd blickte er in ihre Gesichter. Sie waren zerschlagen. Fast wäre er wieder zur Reling gestürzt, aber er riss sich zusammen, konnte lange Haare an den blutigen Klumpen erkennen. Die Füße waren ebenfalls zu grazil für Männer.
Frauen. Es waren zwei nackte Frauen.
»Fuck«, würgend trat Knut näher heran, hielt sich den Arm vor den Mund, als könne er so verhindern, dass er die bösen Bilder einatmete.
Jemand hatte den Frauen die Hände gebunden, hatte Leinen über die unterste Saling geworfen und die beiden nackten Opfer an den Händen einen halben Meter hinaufgezogen.
Zögernd ließ er den Strahl noch einmal von den gebundenen Händen hinab zu ihren Oberkörpern gleiten, über das, was einst Bauch und Brust gewesen waren …
Jetzt klaffte dort ein einziges Loch. Ihre Brustkörbe waren geöffnet, Hautlappen weggeklappt. Durchtrennte Rippen ragten Knut entgegen.
»Gott«, war das Einzige, was er herausbrachte.
Die Leiber der beiden waren regelrecht ausgeweidet worden.
»Verdammte Scheiße«, hörte er Veiths bebende Stimme, noch bevor der drahtige Kerl ganz über die Reling geklettert war. Auch er kämpfte mit dem Anblick.
Von unten zerschnitten Diehls Rufe die Nacht. »Was ist denn los? Könnt ihr mal mit uns reden? Hallo?« Er war zu ungelenk und zu korpulent, als dass die beiden DLRGler ihn hätten hinaufheben können. »Klappt mal die Leiter runter! … Hallo?«
Weder Knut noch Veith war zum Sprechen zumute. Fassungslos starrten sie auf die beiden Frauenkörper.
Es war alles so brutal. Und gleichzeitig so … irreal.
Ein Schiff auf dem trockenen Meeresgrund und zwei Frauen, aufgeknüpft und ausgenommen wie Haie oder Thunfische nach der Hochseejagd.
Abrupt riss Knut sich vom Anblick los. »Wir … wir … wir brauchen Maas hier. Und …«
Er zögerte. Wollte er Helen das zumuten? Er wusste, dass sie sicher Schlimmeres in ihrer Laufbahn gesehen hatte. »… und Helen Henning. Sofort … Diehl?«
»Ja?«
Knut sah zu ihm runter. »Funk die an. Funk Birthe an. Die sollen jetzt kommen.«
Diehl nickte und zückte abermals sein Funkgerät.
»Und Thorsten«, wandte sich Knut an den älteren DLRGler. »Geht bitte vorsichtig vom Schiff zurück. Ihr alle. Ich will, dass ihr eure Handys nehmt und sofort alles fotografiert. Komplett. Macht von mir aus fünftausend Bilder. Schiffsrumpf und Watt, unsere Spuren. Alles im Umkreis von hundert Metern um die Jacht. In zwanzig Minuten stehen wir im Wasser. Wenn da irgendwas ist, irgendeine Spur, ist sie für immer weg.«
4
»Noch einen, Helen?« Pia deutet auf Helens leeres Weinglas, das sie auf die Bar gestellt hatte.
»Ja. Warum nicht? Sag mal, den von letztem Monat …?«
»Der Grauburgunder?«
»Den fand ich ja … wie sagt man? … superb.« Sie schob Pia ihr Glas hin. Nach Knuts überraschtem Aufbruch waren zwar einige Gäste gegangen, die meisten jedoch hatten keine Lust, sich den Samstagabend vermiesen zu lassen. Auch Helen brannte nicht gerade drauf, den angefangenen Abend mit ihrem Personal im Dünenkieker oder allein in ihrem kleinen Zimmer zu verbringen.
»Ja. Der ist gut, aber nichts für die Klitsche hier.« Pia zog einen Wein aus dem Kühlschrank. »Da bleibt nichts in der Kasse hängen. Aber wenn du Lust hast, nehm ich dich mal mit zu Hifikepunye.«
»Hifike-wer?«
Lässig wischte sich Pia die Stirn mit einem Spültuch ab und schenkte Helen ein. »Hifikepunye macht so Weinabende. Der ist ein Somalier-Sommelier.«
Helens Blick hätte nicht fragender sein können.
Pia lachte. »Kein Witz. Ein Weinkenner aus Somalia. Wenn du was brauchst für dein Lokal, dann ist Hifikepunye dein Mann. Sieht auch ganz knackig aus, der Gute.« Pia schob Helen ihr Glas hin. »Kannst natürlich auch deinen Koch hinschicken, aber dann entgeht dir was.«
»Klingt nach einem netten Abend.« Helen stieß mit Pia an, die von irgendwoher ein volles Whiskyglas gezaubert hatte. »Auf den Frauenabend.«
Kaum hatte Helen einen Schluck genippt, piepte ihr Handy.
»Entschuldige.« Sie zog es aus ihrer Hosentasche. Eine Mail.
Der Absender ließ sie ins Stocken geraten. Die Nachricht kam aus den Staaten. Ihr ehemaliger Executive Director beim FBI hatte sie von seinem privaten Konto abgeschickt.
Möge der Kerl in einer Papierflut mitsamt seinem Mahagonischreibtisch ertrinken, dachte sie verbittert und drückte sie weg.
Seitdem sie vor anderthalb Jahren beim FBI aufgehört hatte, hatte sich ihr Chef kein einziges Mal gemeldet. Es herrschte Funkstille – keine Nachfrage, wie es ihr ging, keine aufmunternden Worte, nichts.
Entschlossen wandte sie sich wieder ihrem Wein zu. Nach zwei weiteren Schlückchen spürte sie jedoch ein flaues Gefühl im Magen – und das kam nicht vom Alkohol. Mit sich hadernd, ob sie die Mail nicht doch sofort lesen sollte, spielte sie mit dem Handy herum.
Warum soll er sich auch privat bei mir melden?, dachte Helen bitter. Er hat Besseres zu tun, als ausgerechnet mich nach meinem Wohlbefinden zu fragen.
Einen Moment lang ließ sie ihren Finger über der Mail-App kreisen, dann gab sie sich einen Ruck. Scheiß drauf, dachte sie, trank ihren Wein in einem Zug aus und öffnete die Nachricht.
Pls call back, Nicols.
Vier Wörter. Mehr nicht. Sie starrte die Zeile an und begann unbewusst, ihre Drosselgrube mit den Fingern nachzufahren.
Nicols? Sie checkte die Uhrzeit. Zwischen Seattle und Valandsiel waren es wegen der noch herrschenden Sommerzeit sieben Stunden Zeitunterschied.
Dort drüben, im Außenbüro des FBI, musste jetzt beste Kaffeezeit sein. Kein Grund also für sie, nicht zurückzurufen. Wahrscheinlich ging Nicols noch Akten durch, bevor er ins Wochenende startete.
Eigentlich gab es nur drei Gründe, weswegen er um einen Rückruf bat. Entweder, es ging um ihre Pension oder um irgendwelche Formulare ihres Ausscheidens. Oder …
Jetzt hast du die Mail geöffnet, dann kannst du ihn auch anrufen, Schätzchen.
Seufzend schob sie das leere Glas zu Pia und ging zu den Damentoiletten. Im Gang vor den Türen war es etwas ruhiger. Sie holte tief Luft und überwand sich, rief ihn an.
»FBI Seattle, Nicols.«
»Helen Henning … Wenn Sie das nicht schon an der Vorwahl erkannt haben.«
»Henning!« In seiner strengen Stimme klang ein Anflug von Freude mit. Nur ein Hauch, aber dennoch.
»Was wollen Sie?«, fragte sie barsch, denn sie hatte keine Lust, mit ihrem Exchef Süßholz zu raspeln. Immerhin war Nicols nicht ganz unschuldig daran, dass ihr ein Bein weggeschossen worden war. »Es ist verdammt spät hier in Deutschland. Sie wollen sich ja wohl kaum entschuldigen.«
»Seien Sie nicht so …« Er brach ab. »Okay. Wenn Sie so wollen … Ja, eine … eine Entschuldigung.«
Helen lachte auf. »Was? Nicht Ihr Ernst.«
Er holte ein paar Mal tief Luft und schien seine Worte abzuwägen, bevor er fortfuhr: »So was in der Art zumindest, Henning. Ich dachte jedenfalls, Sie sollten es erfahren.«
»Was erfahren?«
»Sehen Sie, mir ist klar, dass wir uns damals … nun ja, Ihnen gegenüber nicht ganz offen verhalten haben.«
»Nicht ganz offen …« Es fiel ihr schwer, den aufbrandenden Zorn zu zügeln.
»Ich hatte meine Weisungen, verstehen Sie? Und außerdem … Immerhin haben Sie es geschafft, einen der führenden Köpfe der organisierten Kriminalität von Seattle hinter Schloss und Riegel zu bringen.«
Sie musterte, ohne dass es ihr wirklich bewusst war, ihre Prothese. Ihr rechtes Bein war unterhalb des Knies amputiert. Nur ein kleines Stück des Fußpassteils ragte aus den Sneakers. Es war so gut wie nicht zu sehen, dass sie überhaupt einen künstlichen Fuß trug. »Sie reden von Chris?«
»Sawyer. Richtig«, brummte Nicols. »Durch Ihren Einsatz haben wir in den letzten anderthalb Jahren rund vierzig Personen in seinem Dunstkreis dem Haftrichter …«
»Kommen Sie zum Punkt«, unterbrach sie ihn. »Was ist mit Sawyer? Ist er draußen?« Sie biss sich auf die Lippen. Verdammt. Jetzt hatte sie es gesagt. Allein der Gedanke, er könne die Gefängnismauern hinter sich lassen … Sie schüttelte den Kopf. Unsinn.
»Nein …«, begann Nicols, zögerte jedoch. Sie spürte, wie er nach den richtigen Worten suchte. »Henning, Sie wissen, ich habe persönliche Beziehungen zur Staatsanwaltschaft und auch zum County Jail. Gestern war ich auf einem Charitydinner mit Senator Grover, und da kam Staatsanwalt Jenkins zu uns. Kennen Sie ihn?«
»Flüchtig.« Peter Jenkins war ein aufrichtiger Mann, ein gewissenhafter Anwalt, der statt Auszeichnungen und Urkunden sein Büro an der Fifth Ecke Columbia mit Medaillen seiner Sportangler-Wettbewerbe zugepflastert hatte.
»Es besteht eventuell die berechtigte Möglichkeit, dass Sawyers Anwälte Verfahrensfehler geltend machen könnten.«
»Wovon … wovon reden Sie? Verflucht noch mal. Verfahrensfehler?« Sie lehnte sich an die Wand.
»Anscheinend Unregelmäßigkeiten nach seiner Verhaftung. Der leitende Ermittler hat wohl leicht Druck bei einem Verhör ausgeübt …«
Helen hatte die Verhaftung und das Verfahren nur in den Medien verfolgt, aus ihrem Krankenzimmer heraus, das damals für viereinhalb Monate ihre Heimat geworden war.
Schweigend wartete sie, dass Nicols präziser wurde.
»Sehen Sie, seine Anwälte könnten das Urteil womöglich anfechten. Es sind nur unbestätigte Gerüchte, die aber bereits bis zum Staatsanwalt vorgedrungen sind.«
Unbestätigte Gerüchte? War nicht jedes Gerücht unbestätigt? Sonst wäre es ja keines. Was redet dieser Mann für einen Mist?
»Jenkins bringt sich langsam in Stellung, und ziemlich viele Leute im Police Department bekommen kalte Füße. Um es noch einmal zu betonen: Das hat nichts mit uns zu tun, weder mit dem FBI noch Ihrer Arbeit, Henning.«
Sie schwieg weiterhin.
»Sind Sie noch dran?«
»Ja«, brachte sie hervor und zwang sich, ruhig zu atmen. »Wann?«
»Wie gesagt, es sind nur unbestätigte …«
»… Gerüchte. Ja, ja … Kommen Sie! Wenn alles nur heiße Luft wäre, würden Sie kaum an einem Samstag eine Mail schicken. Und weil Sie sie schicken, muss was dran sein – nicht nur an der Einreichung dieser Anwälte, sondern auch an den … Wie haben Sie es genannt? ›Unregelmäßigkeiten‹. So wie ich Sie kenne, Nicols, haben Sie doch schon intern Nachforschungen angestellt und den leitenden Ermittler mehrfach auf links gedreht …«
Ein Seufzen auf der anderen Seite der Welt gab ihr recht.
»›Leicht Druck ausgeübt?‹«, fuhr Helen fort. »Haben die Sawyer im Verhör geschlagen? Sagen Sie, dass das nicht wahr ist.«
»Da ist bislang nichts bewiesen. Sawyers Anwälte müssen sich an jeden Strohhalm klammern. Und es ist fraglich, ob jemand im Police Department …«
»Aber es stimmt, oder?« Helen wurde flau im Magen. »Es stimmt. Halten … halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, okay?«
Bevor er antworten konnte, hatte sie bereits aufgelegt. Einen Moment stand sie da und konzentrierte sich auf ihren Atem, strengte sich an, möglichst nicht an Sawyer zu denken. Dann ging sie schnurstracks zum Damenklo, riss die Tür auf und stellte sich ans Waschbecken. Ließ sich eiskaltes Wasser über die Handgelenke laufen.
Der Gedanke, Sawyers Anwälte würden diesen Mann in ein paar Monaten freibekommen und den ganzen Fall wegen eines Verfahrensfehlers zunichtemachen, ließ ihr den Mageninhalt in die Kehle steigen.
Sie spülte sich den Mund aus und starrte in den Spiegel. Ihr Gesicht kam ihr vor wie das Antlitz einer Toten. Fahl und bleich. Immerhin versuchte sie ein Lächeln. Es gelang nach einem zweiten Anlauf, wenn auch sehr bemüht. Noch einmal atmete sie ganz bewusst hörbar ein und aus. Dann strich sie ihre Haare zurecht, räusperte sich und kehrte schließlich zur Bar zurück.
Zehn Minuten später bestellte sie einen vierten Friesengeist. Der Schnaps vertrieb das Bauchziehen und schenkte Wärme. Zumindest kam etwas Farbe in ihre Wangen.
Weihnachten hatte sie sich geschworen, endlich hier in Valandsiel ein Leben ohne Chris Sawyer zu führen. Bisher hatte es gut funktioniert, ihn auszusperren. Selbst in ihren Träumen war er das letzte halbe Jahr so gut wie nicht mehr vorgekommen.
Chris würde niemals so einfach aus dem Gefängnis marschieren, damit das klar war.
5
Die Nacht, die er so sehr liebte, wurde brutal zerstört. Knut versuchte, den Lärm der beiden Helikopter auszublenden und sich für einen Moment auf die schwarze See vor ihm zu konzentrieren, aber es gelang ihm nicht. Dem Meeresduft nachspürend, atmete er tief ein. Immerhin ging es ihm allmählich wieder besser.
Die Helikopter flogen Suchrunden, nur um wieder und wieder um das Schiff zu kreisen.
Bei dem Nebel würden sie niemals etwas finden.
Die Flut hatte der Jacht mittlerweile genug Wasser unter den Kiel gebracht, sodass die Pidder Lüng an ihr festgemacht hatte. Sobald Friedrichs, der Gerichtsmediziner, mit seinen Untersuchungen fertig war, würden sie die Marietta durch die schwarzen Wellen zum Jachthafen Valandsiels schleppen. Inzwischen war auch die Wasserschutzpolizei vor Ort. Sie hatten alle Hände voll zu tun, neugierige Reporter abzuhalten. Immer wieder versuchte ein Zodiac mit Kamerateam trotz der fortgeschrittenen Stunde durch den Nebel zu brechen und Aufnahmen zu machen.
Es gab eine Menge zu fotografieren, denn auf der Marietta herrschte Hochbetrieb. Das LKA war hinzugezogen worden. Für die Staatsanwaltschaft stand es außer Frage, wegen der Schwere der Tat das Landeskriminalamt zu alarmieren. Knut hatte vollkommen richtig gehandelt. Johann Maas war so schnell wie möglich mit einem Team erschienen.
Diehl hatte gemeinsam mit den DLRGlern alles fotografiert und war dann mit Veith im Schlepptau zum Schlauchboot am Priel zurückmarschiert. Knut hatte an Bord der Marietta die Stellung gehalten. Die letzte Stunde, bevor der Trubel wie eine Springflut über die Jacht hereingebrochen war, hatte er schweigend an Bord verbracht, zur Untätigkeit verdammt. Eine Zeit lang hatte Knut sogar gezögert, die Kurbel des Ankers anzufassen. Es war nicht auszuschließen, dass der oder die Täter ihn hochgezogen hatten, damit das Schiff und die Leichen aufs Meer hinaustrieben.
Am liebsten hätte Knut das Deck abgesucht, hätte sich in der Kajüte umgesehen und einen Blick ins Logbuch geworfen, aber in Anbetracht ihrer vollkommen verdreckten Stiefel hatten sie es lieber bleiben lassen. Sie hätten einfach zu viele potenzielle Spuren verwischt.
Nun steckten Knuts Gummistiefel, wie die des ganzen Teams, in Plastiküberziehern. Bloß einen Overall trug er nicht, weil er keinen angeboten bekommen hatte. Knut folgte dem Summen einer Spheron-Kamera, die ihre Arbeit vollendete und die Kajüte in 3-D aufnahm.
Neugierig trat er vor und spähte hinein. Das Funkgerät sah intakt aus. Dafür waren sämtliche Schränke und der Klapptisch mit Blut besudelt. Hände hatten ihre Spuren hinterlassen, als jemand die Schiffsunterlagen durchgesehen und jede Klappe geöffnet hatte. Jede dieser Spuren war mit nummerierten Klebepfeilen markiert. Knut gab das Zählen bei vierhundertsiebenundzwanzig auf. Er war, grob geschätzt, nicht mal bis zur Hälfte gekommen.
Im hinteren Teil der Kajüte, wo die Betten zerwühlt waren, hockte ein Mann der Spurensicherung. Zwischen einer zerschlagenen Weinflasche und den Resten eines zersplitterten Weinglases schoss er Fotos. Seine Blitze ließen die Blutschlieren und Klebezettel gespenstisch aufleuchten. Ein weiterer Mitarbeiter besprühte die Oberflächen mit Luminol, durch dessen Glimmen unter UV-Licht selbst geringste Mengen von Blut und Sperma nachgewiesen werden konnten.
Knut ging um die Kajüte herum. Den Fotografen interessierte offenbar besonders eine abgeplatzte Stelle am Bett.
»Ist das ein Einschuss?«, wollte Knut wissen.
»Schwer zu sagen. Auf jeden Fall ist etwas mit hoher Geschwindigkeit hier eingeschlagen. Eine Hülse oder ein Projektil haben wir bisher nicht gefunden.«
Kaum hatte der andere das Bett und die Umgebung eingesprüht, zückte er ein Schwarzlicht. Mit einem Mal zeichneten sich bläulich schimmernde Blutfleckchen durch das Luminol ab, die vorher nicht zu sehen gewesen waren. Im Loch schimmerte es ebenfalls.
»Ist da Blut drin?«
»Ja. Oder Urin oder Sperma. Die Luminol-Wasserstoffperoxid-Lösung ist reaktiv genug, um winzigste Mengen anzuzeigen.«
»Das heißt, was da eingeschlagen is’, das is’ vorher mit Blut in Berührung gekommen?«
»Höchstwahrscheinlich. Sehen Sie die Spritzer hier und hier?« Er zeigte aufs Bettlaken. »Bei der Fülle an Spuren wird es Wochen dauern, auch nur einen Bruchteil auszuwerten. Wir warten noch auf unseren Blutspurenanalysten.«
Polizeihauptkommissar Johann Maas trat zu Knut und zog sich die Gummihandschuhe ab. Das Strahlerlicht von einem der Helikopter knallte ihm in den Rücken. Knut kam es vor, als entzündeten sich Maas’ Haare schlagartig. Sein roter Schopf züngelte im Gegenlicht. Eine Sekunde später war der Spuk vorbei.
»Wissen Sie schon, wer die Frauen sind?«
»Ja«, bestätigte Maas, beließ es aber dabei.
Knut spürte, wie abfällig der ältere Kommissar ihn mit seinen stahlblauen Augen musterte, wie er den Blick über seine stonewashed Jeans mit dem breiten Schmuckgürtel und der Prunkschnalle, weiter über seine Wildlederweste und das Westernhemd gleiten ließ.
Du hättest mich mal vor drei Stunden sehen sollen, dachte er. Ich weiß, du kannst mich nicht ausstehen.
»Kommen Sie vom Rodeo?«, fragte Maas.
»So was Ähnlichem. Ja.«
Maas nickte, als sei damit die Frage nach dem eigentümlichen Outfit beantwortet.
»Und?«, hakte Knut nach, der es hasste, Maas alles aus der Nase ziehen zu müssen.
»Wir wissen es.«
Nachdem Maas keine Anstalten machte, ihm etwas über die Identität der Frauen zu verraten, drehte sich Knut zu den sechs emsig arbeitenden Beamten der Spurensicherung um, die Doktor Friedrichs koordinierte. Die Männer und Frauen schleppten Koffer mit Geräten und Tüten voller Beweismaterial. Sie arbeiteten Hand in Hand und sahen in ihren weißen Overalls vor den schwarzen Wellen wie Astronauten aus. Noch immer baumelten die beiden Frauen am Mast, weil es einfach noch zu viele Spuren zu sichern gab.
Sie hatten entschieden, die Marietta in den Jachthafen nach Valandsiel zu schleppen, aber noch auf See mit der Arbeit zu beginnen. Der Staatsanwalt und Maas hatten Angst, das gischtende Meerwasser könne sonst Spuren vernichten, wenn sie nicht schnell genug waren.
»Sie wissen es. Na, dann bin ich aber wirklich beruhigt … Sie haben nicht zufällig Lust, mich dran teilhaben zu lassen, Maas? Oder sind die Namen der Opfer wieder mal so ’n Zuständigkeitengedöns.«
Maas überlegte.
Knut winkte ab. »Vergessen Sie’s, okay. Dann telefoniere ich eben selbst ein bisschen rum und find’s raus, wenn Ihnen das lieber ist. Sie recherchieren da lang …«, er zeigte zur Kajüte, dann rüber aufs Meer, »… und ich hier lang, und wir beide sind glücklich. Zufrieden?«
Knuts Gemaule ließ Maas lächeln. »Immer wieder schön zu sehen, wie leicht man Sie auf die Palme bringt.« Kopfschüttelnd zückte er seinen Tablet-PC und checkte seine Notizen. »Maria Herbst und Judith Kehrheim, stammen aus Heidelberg. Die beiden haben das Boot vor vier Tagen gechartert.«
»Heidelberg?«
»Die beiden sind passionierte Seglerinnen. Laut Vercharterer haben sie einen Sportküstenschifferschein und wollten nach Skagen.«
»Wo sind die denn los?«
»Gestartet? Ihren Trip haben sie in Cuxhaven begonnen.«
»Hm. ’n Viertel vom Weg haben sie geschafft. Oder war’s ihr Rückweg von Skagen?«