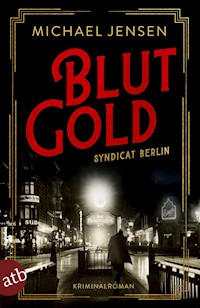
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Brüder Sass
- Sprache: Deutsch
Legendär und kriminell.
Berlin nach dem Ersten Weltkrieg. Glücksspiel, illegale Wetten, kleinere Diebstähle – so sehen die Geschäfte der Brüder Sass aus. Doch dann gerät ihre ganze Familie ins Visier der Polizei, als Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht ermordet werden. Die Ermittlungen drohen für sie in einer Katastrophe zu enden. Bis ihre verschollen geglaubte Tante Antonia auftaucht und das Heft in die Hand nimmt. Mir ihrer Hilfe gelingt es den Brüdern Sass nicht nur, vorerst den Kopf aus der Schlinge zu ziehen – ihnen steht auch ein einzigartiger krimineller Aufstieg bevor, der nicht nur die Polizei, sondern auch mächtige Neider auf den Plan ruft ...
Packend und nach wahren Begebenheiten erzählt – wie die Verbrecherbande Sass ganz Berlin in Aufruhr versetzt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Es beginnt wie ein harmloser Einbruch, doch auf einer ihrer nächtlichen Touren werden die Brüder Max und Franz Sass unfreiwillig Zeugen eines Mordes im angesehenen Hotel Adlon. Mit knapper Not können sie sich im Nebenzimmer der jungen Gräfin Romanowa verstecken. Der Täter ist offenbar ein Kommunist. Der Tote ein Offizier einer rechten Freikorps-Brigade. Somit scheint für Polizeikommissar Paul Konter vom Präsidium Alexanderplatz der Fall klar. Alles deutet auf einen weiteren Feme-Mord hin. Und die Sass-Brüder sind in einen gefährlichen Strudel aus Politik, Verrat und Mord geraten.
Über Michael Jensen
Michael Jensen wurde im Norden Schleswig-Holsteins geboren. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg und Flensburg. Im Hauptberuf ist er als Arzt und Therapeut tätig. Für sein literarisches Schreiben hat er ein Pseudonym gewählt. Der Roman »Blutgold« ist der Auftakt einer Serie über die Brüder Sass.Im Aufbau Taschenbuch sind seine Kriminalromane »Totenland«, »Totenwelt« und »Totenreich« lieferbar.
Mehr zum Autor unter https://www.autor-jensen.de
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Michael Jensen
Blutgold
Syndicat Berlin
Kriminalroman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Motto
PROLOG — Berlin-Zeitungsviertel, Oktober 1918
I BERLIN 1918
Kapitel 1 — Berlin-Moabit, 9. November 1918
Kapitel 2 — Berlin-Luisenstadt, 16. November 1918
Kapitel 3 — Berlin-Moabit, 7. Dezember 1918
Kapitel 4
Kapitel 5 — Berlin-Dorotheenstadt, 31. Dezember 1918
II BERLIN 1919
Kapitel 1 — Berlin – Neuer Westen, 15. Januar 1919
Kapitel 2 — Berlin-Dorotheenstadt
Kapitel 3 — Berlin-Moabit
Kapitel 4 — Berlin-Alexanderplatz, 17. Januar 1919
Kapitel 5 — Berlin-Alexanderplatz, Anfang Februar 1919
Kapitel 6 — Berlin-Scheunenviertel, 15. Februar 1919
Kapitel 7 — Berlin-Luisenstadt
Kapitel 8 — Berlin-Alt-Treptow, März 1919
Kapitel 9 — Berlin-Alexanderplatz, April 1919
Kapitel 10 — Polizeipräsidium, Mai 1919
Kapitel 11 — Berlin-Moabit
Kapitel 12 — Hoppegarten, Juli 1919
Kapitel 13 — Berlin-Rosenthaler Vorstadt, Ende August 1919
Kapitel 14 — Spandau, Oktober 1919
III BERLIN 1920
Kapitel 1 — Berlin-Neuer Westen, Januar 1920
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4 — Charité, Frauenklinik
Kapitel 5 — Berlin-Lichterfelde
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9 — Berlin-Wannsee
Kapitel 10
Kapitel 11 — Berlin-Steglitz, Juni 1920
Kapitel 12
Kapitel 13 — Berlin-Charlottenburg
Kapitel 14 — Rennbahn Mariendorf, Oktober 1920
Kapitel 15
Kapitel 16
IV BERLIN 1921
Kapitel 1 — Berlin-Spandauer Vorstadt
Kapitel 2 — Berlin-Schöneberg
Kapitel 3 — Reichspräsidentenpalais
Kapitel 4
EPILOG
NACHWORT
Impressum
Wer von diesem spannenden Roman begeistert ist, liest auch ...
Nach wahren historischen Begebenheiten. Einige Namen, Ereignisse und Schauplätze sind aus dramaturgischen Gründen fiktiv.
Freundschaft, das ist wie Heimat
(Kurt Tucholsky, Schloss Gripsholm, 1931)
PROLOG
Berlin-Zeitungsviertel, Oktober 1918
Auf dem Schreibtisch lagen Zahnstocher. Wenn er unruhig war, liebte Ludwig Uhlfeldt es, damit Mikado zu spielen. Oder er legte Figuren und Muster auf die dunkelgrüne Ledereinlage des ramponierten Biedermeierstücks. Die Abendsonne hatte sich bereits zwischen den Häuserschluchten verabschiedet. Und natürlich warfen die elektrischen Lampen längst ihr totes Licht in den Raum; er hasste den dunklen Winter. Ludwig Uhlfeldt war Verleger mit Leib und Seele. Der Beruf hatte ihm zwar ein Magenleiden eingebracht. Und eine Fülle schlechter Manuskripte. Aber trotz aller Unbill schien für ihn klar: Das Zeitalter des Buchs war endlich angebrochen. Nicht mehr nur edle Folianten in den Klosterbibliotheken; nicht die ledernen Schmuckausgaben des Bildungsbürgers. Nein, das Buch wurde nun den Massen zugänglich; einfach und schnörkellos wie die Menschen in ihren stickigen Arbeiterwohnungen. Der Werther für neunzig Pfennige. Und Glaßbrenners Berlin wie es ist für vier Groschen. Uhlfeldt war überzeugt, Büchern stand bevor, was die Zeitungen bereits geschafft hatten. Sie wurden Massenware. Und sie würden Speerspitze sein gegen die Dummheit, gegen die Jahrhunderte der Unterdrückung und inneren Verkrustung.
»Ludwig, die Ditzen-Fahne ist noch nicht zurück«, rief eine Stimme über den Flur.
Uhlfeldt schrak aus seinen Tagträumen und stach sich eine dieser winzigen Holzlanzen in den Finger. Es war das Schicksal der kleineren Unternehmer, dass sie sich um alles selbst kümmern mussten. Vom Ersatz der Glühfäden in den Gaslampen bis zum Vertrieb der Bücher in den Buchhandlungen, überall hatte Ludwig Uhlfeldt mitzuwirken. Er zog den Splitter aus der Daumenkuppe und fluchte leise. Ein winziger Tropfen Blut bildete sich dort.
»Schick diesem Nichtsnutz von Autor einen Botenjungen«, erwiderte er. »Wenn das Buch nicht morgen um acht auf meinem Schreibtisch liegt, kann er seine Texte auf dem Jahrmarkt verkaufen.«
Ditzen war einer seiner Hoffnungsträger. Jung und ohne Konventionen, ein Robespierre des Wortes. Uhlfeldt liebte Visionen. Er hatte sein Unternehmen vor einigen Jahren in der Besselstraße aufgebaut, unweit der Imperien von Mosse und Ullstein, mit Blick auf die Friedenssäule am Belle-Alliance-Platz. Für ihn war es ein Omen. Sein Geschäft waren zwar nicht die Zeitungen, nicht das schnell hingeworfene Gegröle des Alltags. Nein, er setzte eher auf das gereifte Wort. Er hatte Kontakte zu jungen Schriftstellern, die darauf brannten, veröffentlicht zu werden. Er stand in Verbindung mit Karl Kraus, und vielleicht würde dieser obskure Gottfried Benn einen Titel mit ihm machen. Und Rudolf Ditzen wollte er zum Hausautoren aufbauen. Vielleicht war der Mann ja eine große Entdeckung. Denn gerade jetzt brauchten alle ein Fanal, ein Zeichen, das den Neubeginn ankündigte. Die Geister der alten Zeit mussten ausgetrieben, das Denken musste befreit werden. Und nun gab es auch noch beunruhigende Nachrichten von der Front. Die Einheiten waren müde, der Nachschub stockte. Der Krieg war verloren, hieß es. Uhlfeldt war kein flammender Patriot, aber der Gedanke an eine Niederlage des Vaterlands schmerzte ihn doch. Es lag Ärger in der Luft. Vieles würde sich ändern. Ein Journalist hatte mit ihm über eine mögliche Rebellion der Truppe gesprochen, vielleicht sogar eine Revolution im Volke.
Wir müssen dem Kaiser ja nicht gleich den Kopf abschlagen, dachte Uhlfeldt. Es reicht, wenn er seine Macht an den Reichstag abgibt. Blutige Verhältnisse wie nach der Oktoberrevolution in Russland im letzten Jahr wollte hier niemand. Es waren schon so genügend Bolschewisten in der Stadt. Nein, die Deutschen würden wieder »ordentlich und gemäßigt revolutionieren«, wie es 1848 geheißen hatte.
Uhlfeldt waren vor drei Wochen heikle Unterlagen zugespielt worden. Darin gab es Beweise für eine Verschwörung rechtsnationaler Kreise gegen alle Formen demokratischer Mitbestimmung. Heimlich hatten diese Kräfte Truppenverbände in die Großstädte des Kaiserreichs beordert und verlässliche Reserveeinheiten mobilisiert. Das Ganze war hochbrisant und gefährlich. Ludwig Uhlfeldt plante deshalb, morgen mit dem Mittagszug nach Leipzig zu fahren. Bei seiner Schwester war er aus der Schusslinie und konnte in Ruhe die Dokumente sichten. Vielleicht konnte er auch schon mit seinem eigenen Buch beginnen. Mit solchen Enthüllungen machte man sich schnell einen Namen. Und sein Verlag konnte ein wenig mehr Aufmerksamkeit gebrauchen. Aber man erwarb sich eben auch Feinde.
»Ich gehe noch in die Druckerei und mache dann Feierabend. Kannst später abschließen, Heinrich«, rief er seinem Mitarbeiter im Nebenzimmer zu. »Und denk dran, morgen bin ich nur bis zwölf im Haus.«
Seinen Reisekoffer hatte er bereits am Anhalter Bahnhof in Verwahrung gegeben. Auf diese Weise war er morgen Vormittag nicht durch Gepäck behindert. Zumindest redete er sich ein, dass dies der Grund dafür war, dass er schon vor drei Tagen ein Schließfach gemietet hatte. In Wahrheit jedoch hatte er einen gehörigen Respekt vor diesen geheimen Dokumenten. Sie beunruhigten ihn auf unerklärliche Weise. Und er hatte sie deshalb gleich mit ins Schließfach gelegt. In Leipzig konnte er sich wieder darum kümmern.
Sein Weg führte ihn tatsächlich zunächst in das Erdgeschoss. Die Druckmaschinen und das Papier waren derart schwer, dass sie bei den Verlagen fast immer in den unteren Räumen untergebracht waren. Eigentlich war der Verlag zu klein, um sich eine eigene Druckerei zu leisten. Aber Uhlfeldt stand der Sinn nach Höherem. Er wusste, binnen Jahresfrist musste ein großer Erfolg her, sonst würde ihn die Bank pfänden.
Der Geruch von Druckerfarbe lag in der Luft. Das Klackern der Bleilettern wirkte in den ersten Minuten beruhigend, dann aber nervtötend. Er fragte sich, wie die Setzer ihre Arbeit den ganzen Tag verrichten konnten, ohne den Verstand zu verlieren. In einem abgetrennten Bereich weiter hinten versah die Schneidemaschine ihr Werk. Jeden Tag wurden dort mehrere Eimer Papierstaub zusammengefegt. Schließlich wurde alles noch geleimt und gebunden. Und irgendwann nach all diesen Tätigkeiten lag das erste Exemplar auf Uhlfeldts Schreibtisch.
Mit dem angekündigten Feierabend wurde es für den Verleger allerdings noch nichts. Nach einer kurzen Besprechung mit dem Druckleiter – sie hielten sich mit ein paar Werbedrucken über Wasser – machte er sich auf den Weg zum Lehrter Bahnhof. Kurz überlegte er, ob er eine Droschke oder ein Automobil nehmen sollte. Aber er hatte noch Zeit, und der Weg Unter den Linden entlang zum Tiergarten und am Reichstag vorbei war an einem milden Oktoberabend belebend. Es hatte in den letzten Wochen einige Demonstrationen in der Stadt gegeben, jetzt hingegen war es ruhig. Er lief zügig in Richtung Reichstag. Die kaiserliche Polizei und das Stadtregiment waren dort vor einigen Tagen nicht zimperlich gewesen und hatten eine Arbeiterversammlung auseinandergetrieben. Die Siegessäule auf dem Kaiserplatz wurde von Gaslampen in gelbliches Licht getaucht. Ihre Spitze verschwand schon im Dunkel der Nacht. Auf der Moltke-Brücke blieb Uhlfeldt stehen. Er blickte kurz zum Gebäudekomplex des Klinikums Charité hinüber und erinnerte sich an das Rezept in seiner Tasche. Er musste unbedingt morgen zum Apotheker. Der Magen und die Gelenke machten ihm Sorgen. Die verdammte Aufregung! Das verdammte Alter! Er riss sich von den Gedanken an seine Beschwerden los und kam wenig später beim Bahnhof an.
»Steig vier, Nachtexpress nach Köln, am dritten Wagen vorn«, hatte sein Kontakt den Treffpunkt am Telefon benannt. Die Sache war ziemlich undurchsichtig. Er hatte vor wenigen Tagen erneut einen Brief erhalten. Schrift und Ausdruck waren anders als bei den ersten Briefen. Der anonyme Absender behauptete, er habe Beweise für Pläne des deutschen Generalstabs, alle linken und liberalen Kräfte im Reich durch Handstreich auszuschalten. Und alles geschähe mit Wissen und Duldung des Kaisers. Entweder kamen diese Andeutungen von einem verwirrten Freidenker. Es geisterten mancherlei abstruse Theorien durch den Blätterwald. Oder es war eine Chance, die für einen Publizisten und Verleger nur einmal im Leben kam. Zusammen mit den anderen Dokumenten konnte Uhlfeldt dann all jene Machenschaften beweisen, die in den Reden einiger SPD-Politiker oder den Artikeln liberaler Zeitungen immer wieder angedeutet wurden.
Auf dem Bahnsteig wurde es ruhiger. Die Reisenden waren mittlerweile in ihre Wagen gestiegen und in den Abteilen verschwunden. Fenster wurden nach unten geschoben. Eine Kakophonie des Abschiednehmens erhob sich. Aber nur wenige Angehörige standen auf den Bahnsteig. Uhlfeldt hatte bereits die vierte Zigarette geraucht, als ein Mann auf ihn zukam.
»Sie fahren heute nicht?«
»Ich habe mich im Bahnhof geirrt«, gab Uhlfeldt die vereinbarte Antwort.
»Dann sollten Sie es am Hamburger Bahnhof versuchen«, gab der Mann passend zurück. Er war äußerst leger, fast dandyhaft gekleidet. Ein Umstand, der im krassen Gegensatz zu seiner Haltung, seiner strengen Frisur und seinem Gesicht mit Mensurnarbe stand. Alles an ihm wirkte, als sei er ein reiferer Offizier der Jahrhundertwende. Anzug und Hut ließen ihn jedoch fast amerikanisch frivol wirken.
Beide Männer gaben sich kurz die Hand und verließen die Halle. Sie gingen Richtung Invalidenstraße und bogen in die Heidestraße ein. Dort lag der aufgelassene Hamburger Bahnhof im Dunkeln, seine Gebäude verfielen allmählich. Dahinter begann das Gelände des Güterumschlags. Uhlfeldt fühlte sich zunehmend unwohl, da kaum eine Menschenseele sich um diese Zeit hierher verirrte.
»Woher weiß ich, dass ich Ihnen vertrauen kann?«, fragte er.
»Weil ich mich bereits durch meine Andeutungen Ihnen gegenüber des Hochverrats schuldig gemacht habe«, entgegnete der Unbekannte. »Aber woher weiß ich, dass ich Ihnen vertrauen kann, Herr Uhlfeldt?« Er schwieg einen Moment und lächelte. »Wir müssen uns wohl beide aus der Deckung wagen, wenn wir etwas erreichen wollen.« Mit diesen Worten nahm er ein Dokument aus seiner Jackentasche und reichte es seinem Gegenüber.
Uhlfeldt trat an die letzte Gaslaterne heran, die hier in der Seitenstraße noch brannte. Im trüben Schein konnte er nicht alles auf dem Papier entziffern:
Geheimes Civil-Cabinett … zu Berlin
Vierte …ember 1918
Vorsitz: Regierungsdirektor … von Berg
sowie die Regierungsräte …
anwesend als Vertreter der Obersten Heeresleitung: General Erich Ludendorff
Die Mitglieder des Cabinetts beschließen … zu ermächtigen, neben den regulären … Sondereinheiten zu bilden. Deren … revolutionäres Handeln an der … niederzuschlagen. Mit aller gebotenen Härte … in dieser Frage einig mit Seiner Majestät …
Alle Bestrebungen … zu einer unmittelbaren Gefährdung des Reichs. Sie sind deshalb als Hochverrat zu betrachten … Es liegt in der Entscheidung des militärischen Führers … ein Standgericht …
Es ist anzustreben, die führenden Köpfe … mit Zuchthaus oder mit dem Tod …
Das Civil-Cabinett beschließt weiterhin, die kaiserliche Armee mit Rechten auszustatten, die die Stabilität des Reichs in dieser schweren Zeit gewährleisten sollen. Es sind dies im Einzelnen: … fünfzig Millionen Goldmark, Ausweitung der Militärgerichtsbarkeit auf Zivilpersonen …
Um Veranlassung werden ersucht …
(Im Schriftverkehr streng vertraulich, nur als Original zu archivieren.)
»Das ist ungeheuerlich!«, rief Uhlfeldt so laut, dass er sich in der Stille des verlassenen Bahnhofsgeländes selbst erschrak. »Ludendorff ruft sich damit zum Diktator aus!« fügte er mit gedämpfter Stimme hinzu.
»Darf ich das Dokument zurückerbitten?« Der unbekannte Mann streckte die Hand aus. »Immerhin sind wir uns ja noch nicht einig.«
Uhlfeldt atmete schwer. Der Preis für die Papiere war eine Sache, aber gerade fragte er sich, ob er die Unterlagen überhaupt haben wollte. Ob er wissen wollte, was darin stand.
»Ist Ihnen klar, dass dieses Protokoll eine Bombe ist?«, fragte er. »Wenn sie hochgeht, reißt sie unser Land in den Abgrund. Dieses Dokument stürzt das Reich in Anarchie.«
Das erste Mal in seinem Leben wusste er nicht, was er tun sollte. Einfach schweigen? Der Kaiser und die Armee planten offenbar, alle Reformkräfte mundtot zu machen. Konnte er da wegsehen? Andererseits gäbe es beim Bekanntwerden dieser Dokumente einen Volksaufstand, einen Bürgerkrieg. Die linke Opposition im Reich war bereits derart groß, dass sie dem Kaiser solche Pläne niemals durchgehen lassen würde. Die Spartakisten planten gar einen Umsturz wie in Russland vor einem Jahr.
»Kommen Sie, gehen wir ein Stück, Herr Uhlfeldt.« sagte sein Begleiter. Er schlug dem Verleger fast freundschaftlich auf die Schulter. »Ich kann verstehen, dass Sie ein wenig nachdenken müssen. Aber Sie können Geschichte schreiben, mein Lieber. Im wahrsten Wortsinne. Sie werden als das schreibende Gewissen des Reichs unsterblich sein, ein moderner Cicero. Der deutsche Rousseau! Und ich gebe Ihnen die dafür notwendigen Informationen. Sie schreiben dann das Buch und verlegen sich selbst. Niemand pfuscht Ihnen rein.«
Linker Hand tauchte eine kleine Gasse auf. Von den Gleisen her kam etwas Licht. Ein Zug verließ gerade den Lehrter Bahnhof, vielleicht war es der Nachtexpress nach Köln. Die Stahlräder schlugen dumpf über die Schienenstöße, in einer kleinen Kurve erklang ihr typisches Kreischen. Der Verleger fühlte sich benommen. Zu unglaublich schien das politische Treiben, welches er nun aufdecken konnte. Immer noch sah er dem Zug nach, der in Richtung Nordwesten verschwand. Er bemerkte nicht, dass sein Begleiter ein kurzes Seil aus der Manteltasche gezogen hatte. Aus der Ferne war das Zischen einer Dampflok zu hören. Es war das letzte Geräusch, das Ludwig Uhlfeldt in seinem Leben hörte.
IBERLIN 1918
1
Berlin-Moabit, 9. November 1918
Max Klante war sicher kein Held. Er war nur ein einfacher Bürstenmacher gewesen, bevor der Krieg kam. Wie sein Onkel und dessen Vater vor ihm. Es war kein angesehener Beruf, eher ein sterbendes Handwerk. Nun schien ihm dieser Umstand im Moment höchst egal, denn er selbst starb ebenfalls. Wie sein Handwerk. So glaubte er wenigstens. Der spindeldürre Mann saß da, die Hände auf beide Ohren gepresst und schrie. Wer ihn hörte, musste vermuten, dass er dabei schon gar nicht mehr atmete. Denn man konnte meinen, er brüllte sich gänzlich ohne Unterlass die Seele aus dem Leib; ohne jene typische Unterbrechung, die ein kurzes, lebensnotwendiges Einatmen auszulösen pflegte. Dabei musste die Wucht der Explosion doch jede Luft aus seinen Lungen gepresst haben. Niemand konnte ihm jedoch diese angstvolle Reaktion verdenken, angesichts der Steine, Hölzer und Metalle, die ihm um die Ohren flogen. Er saß einfach wieder in seinem Schützengraben. Gefangen in seiner Erinnerung. Er hatte vergessen, ob es der Kampf um Höhe 60, die Kaiserschlacht oder die Hunderttageoffensive war, in deren tödlichem Treiben er sich befand. Vier Jahre Elend, und nun war es auch für ihn zu Ende.
Max Klante war kein Held. Ein Ende musste schließlich alles finden. Aber ganz besonders hatte ihn stets die Vorstellung gequält, dass er so entbehrlich war. Wen scherte, ob er, der Bürstenmacher, lebte oder starb? Für ihn selbst schien das eigene Leben ja durchaus von Wichtigkeit. Gott und das Schicksal jedoch kümmerten sich einen abgegriffenen Sechser darum. Die Welt drehte sich, und alles ging doch immer so aus, wie es ausging. Mit Klante. Oder eben ohne ihn.
»Mit den Füsilieren war ich in Versailles«, hatte sein Onkel noch zu Kriegsbeginn vor vier Jahren geschwärmt, als Max den kaiserlichen Gestellungsbefehl erhalten hatte. Der alte Mann meinte natürlich den Sieg vor über vierzig Jahren, der den französischen Erzfeind in eine tiefe Depression gestürzt und den Deutschen einen Kaiser beschert hatte.
»Ich habe die Krönung Wilhelms im Spiegelsaal gesehen«, schwadronierte der Alte weiter. »Und den Schneckenfressern ins Schloss geschissen.« Max erinnerte sich an das zahnlose Grinsen seines Vaterbruders und hatte ihm kein Wort geglaubt, denn er wusste, der greise Aufschneider war nur Stallbursche bei der hessischen Reiterei gewesen.
Eben wunderte er sich, welche Gedanken einem in den letzten Sekunden des Lebens durch den Kopf gingen. Im Angesicht des Todes wurde dies egal. Knochen gaben einen seltsamen Laut von sich, wenn sie brachen. Klante hatte es in den Schützengräben oft gehört, wenn die Bunkerbohlen nach einem Granattreffer die Rückgrate der Männer zermalmten. Auch das helle, metallische Klicken, dem ein dumpfes Schmatzen folgte, wenn ein Geschoss erst den Helm durchstieß und dann im Hirn des Getroffenen herumrührte, als wäre es der Morgenbrei. All dies war ihm nur zu gut in Erinnerung. Ja, er wusste, es ging zu Ende. Backsteine, Ziegel und Mörtel. Sein Anzug war bereits durchlöchert, an einigen Stellen zeigte er gar Brandlöcher. Anzug? Dreißig Mark hatte er dafür bei Wertheim bezahlt und zwei Wochen gehungert. Aber man musste unbedingt gut gekleidet sein, wenn man Geschäfte machen wollte. Wenn die Leute einen ernst nehmen sollten. Und auch wenn man in den Tod ging. Aber schade war es doch um das teure Stück.
*
Sass wurde langsam zu alt für die Clique. Die Jungs waren in Ordnung, dafür hatte er als Anführer gesorgt. Aber es waren eben noch Jungs. Er hatte es schon vor einiger Zeit bemerkt. Die Gespräche der anderen interessierten ihn nicht mehr. Die ewige Angeberei mit den Mädchen. Dabei wurde jeder von ihnen schon knallrot, wenn ein verliebtes Augenpaar sich ihm zuwandte.
»Der is hinüber, gloob ick.«
Und das ewige Saufen. Als wäre es eine Heldentat, fünf Gebrannte und Molle zu vernichten. Oder das Geschrei ums Geld. Die ewige Penunze. Die Kleinen fühlten sich wie die Könige, wenn sie zwanzig Märker in der Tasche hatten.
»Den ham se plattjemacht wegen seine jute Kinderstube. Guck da die Strümpfe an. Wer hat feene Strümpfe, der hat Piepen, sacht meen Alter.«
Hinüber? Plattgemacht? Was redeten die Schwachköpfe da? Max Sass wurde plötzlich aus seinen Gedanken gerissen. Er war mit seiner Bande zum Hamburger Bahnhof gekommen. Das Teil war aufgegeben worden und bot viel Raum. Leider wussten das auch andere. Die nördlich gelegenen seitlichen Gleise zum Kanal wurden im Moment wenig genutzt. Und viele Schuppen standen leer. In der Stadt herrschte ein fürchterliches Tohuwabohu, der Kaiser hatte abgedankt, der Krieg war aus, und grölende Arbeiter marschierten durch die Straßen. Auf dem Güterbahnhof war es relativ ruhig. Den zwei Vorarbeitern hatten sie versprochen, dass sie hier keine krummen Touren abziehen würden. Dazu vier Packungen Josetti, und die Sache war geritzt. Die Bruderschaft hatte für den Winter ein Quartier. Nur auf die Bahnpolizei mussten sie achtgeben. Die Kerle kamen mit bissigen Hunden. Und sie schossen scharf.
Was interessiert mich der Kaiser?, dachte Max Sass. Nach ihm kommt ein anderer, der uns wieder das Fell gerbt. Malochen bis zum Umfallen. Wie bei Vadder. Mit oder ohne Herrschaften.
Hinüber. »Wer ist hinüber?«, fragte Max plötzlich hellwach.
»Na, der hier«, rief Kuli. Otto Stehn ließ sich gern auf den Gepäckwagen über die Bahnsteige schieben. So hatte er seinen Spitznamen bekommen. Im Sommer war er dabei einem feinen Herrn in die Hacken gefahren. Der Kerl hatte ihm mit dem Gehstock derart heftig ins Gesicht geschlagen, dass Kuli jetzt auf dem linken Auge beinahe blind war.
Max war zu den anderen Jungs gegangen. Sie drängten sich neben einem leicht abgesackten Gleis, das mit dichtem Gras überwuchert war. Hinter einem Busch am Kanalufer lag eine männliche Leiche. Fidel stand etwas abseits und wollte sich wohl nichts anmerken lassen. Er würgte. Alle hatten schon Blut, ausgeschlagene Zähne und gebrochene Knochen gesehen. Das störte sie wenig. Aber Tote waren nicht so häufig, obwohl Max und einige ältere Jungs auch damit schon Erfahrung hatten. Und dieser hier war Stoff aus einem Schauerroman. Gerade kroch ihm ein Älchen aus dem Ohr. Die Haut war teigig und schimmerte blass-bläulich. Der Mann lag seitlich auf dem Bauch. Bis auf Unterwäsche und Socken war er entkleidet. Der Haarschnitt wies ihn als Stutzer aus, ein gepflegter Herr aus der Mittelschicht. Die Haut war an einigen Stellen abgeschürft, ohne dass Blut zu sehen war.
»Der wurde schon ein paar Mal bewegt«, sagte Kuli. »Glaube, jemand hat ihn aus dem Wasser gefischt. Die Klamotten haben se ihm geklaut. Und die Brieftasche gleech zu Anfang, denk ick.«
»Ick hab se«, frohlockte Klaus und hielt eine lederne Geldbörse in die Höhe. Schon fummelte er darin herum, um einen Moment später enttäuscht aufzublicken. »Leer.«
»Bist du bekloppt?«, rief Max. »Jetzt hat die Polente deine Fingerabdrücke. Die können so was heute.« Er hatte gelesen, dass man anstatt der Abdrücke auch gleich seinen Namen dalassen konnte. Zwar glaubte er, dass nur die schlauen Herren von der Kripo solche Tricks draufhatten. Aber es konnte nicht schaden, den Jungs ein bisschen Angst zu machen.
»Oh.« Eingeschüchtert hielt Klaus ein Dokument in die Höhe, das er aus einem Seitenfach gezogen hatte. »Alles ins Wasser?«
»Gib den Wisch her, und wirf dann die Brieftasche rein«, erwiderte Max. Kurz darauf flog das Ding in hohem Bogen in den Kanal. Max betrachtete das Papier. Es war eine polizeiliche Meldebescheinigung.
»Kam aus Neukölln«, sagte er.
»Pfui Tasmania«, riefen mehrere seiner Jungs und spuckten kollektiv aus. In Moabit war man nicht gut zu sprechen auf den Neuköllner Fußballklub.
Zwischen dem Dokument hatten sich noch zwei weitere Zettel befunden, die auf den Boden segelten. Max Sass bückte sich danach. Ein Gepäckschein vom Anhalter Bahnhof. Und ein ärztliches Rezept mit dem Stempel eines Stabsarztes der Reserve von der Charité. Er spähte über den Humboldt-Kanal. Nebel lag über dem Wasser. Die Lichter des Krankenhauses waren am anderen Ufer zu erkennen.
Vielleicht ist der Kerl dort drüben ins Wasser gefallen, dachte er. Und dann ertrunken.
»Eukodal«, las er laut vor.
»Heißt der Mann so?«, fragte Fidel.
»Dat is een Medikament, du Fritze.« Max Sass verpasste ihm eine Kopfnuss und steckte die Verordnung in die Innentasche seiner Joppe.
»Wat is mit dem Schein?«, fragte Kuli. »Vielleicht wollte er uff Reise jehn. Und det janze Jold und Jeschmeide is inne Schließfach.«
Max vergab die zweite Kopfnuss. »Klar. Wohnt auf Neukölln und versteckt seene Sachen am Anhalter.« Trotzdem war er neugierig. Gepäckscheine konnten eine Menge einbringen. In den geklauten Börsen fanden die Jungs manchmal einen. Meistens waren sie jedoch zu feige, ihn einzulösen. Wenn der Besitzer Anzeige erstattet hatte, bekamen die Beamten am Schalter eine Liste mit den verdächtigen Nummern. Kam der Dieb vorbei, nahmen sie ihn gleich hoch.
»Machen wir morgen. Ist ja keen Diebstahl, sondern ne Fundsache.« Max grinste. Er trat noch einmal an den Toten heran. Ludwig Uhlfeldt stand auf dem Meldeschein. Und auf dem Rezept. Nirgendwo an der Leiche war Blut zu sehen.
Weder abgestochen noch erschossen, überlegte er. Vielleicht doch nur ertrunken.
Er nahm einen dickeren Ast und schob das Kinn des Toten nach oben. Ein fingerdicker, blassblauer Streifen war um den Hals zu erkennen. Die teigig aufgetriebene Haut der Wasserleiche war an diesen Stellen eingedrückt. Und der Kopf des Mannes lag auf ungewöhnliche Weise abgeknickt. Unbewusst ahmte Max die Stellung nach. Unmöglich. Er ging näher heran. Ein modriger Sumpfgeruch stieg ihm in die Nase. Fäulnis. Daher der aufgetriebene Leib und die Schwellungen. Am Nacken bemerkte er etwas, das er kannte. Die Knochen der Wirbelsäule standen unnatürlich gegeneinander verschoben. Dem Stürmer von Union war einer ins Bein gegrätscht. Das Knie hatte danach ausgesehen, als wäre am Unterschenkel eine Weiche verstellt worden.
»Erst gewürgt, dann Hals umgedreht«, sagte Max mehr zu sich selbst. Er wusste, dass dazu bei einem Mann, der sich wehrte, sehr viel Kraft und Geschick nötig waren. Besser, das Opfer war bereits bewusstlos. Wer immer dies hier getan hatte, war kein einfacher Taschendieb und Gelegenheitsräuber gewesen. Ihn schauderte.
»Jungs, krempelt die Ärmel hoch. Wenn sie den hier finden, gibt es Ärger. Und unser Quartier sind wir dann auch los. Also, ab in den Kanal. Solln se ihn woanders rausfischen.«
Maulend machten sich die Jugendlichen daran, den Leichnam näher an die Böschung zu rollen. Mehrmals entwichen Faulgase mit lautem Gurgeln aus After und Mund.
»Det Schwein furzt ja noch«, rief Fidel entsetzt und übergab sich ins Gebüsch. Kurz darauf verschwanden Ludwig Uhlfeldts Überreste mit einem leisen Klatschen im braungrauen Wasser des Schifffahrtskanals.
*
Franz Sass war erst fünfzehn. Er war in den letzten Monaten enorm geschossen, wie seine Mutter oft sagte; die Hosen und Hemdsärmel zu kurz, der Bartflaum noch lächerlich. Dennoch wirkte er älter. Und sehr zum Bedauern der Eltern hatte er eine Menge Unsinn und Träume im Kopf. In seinem Alter musste er eigentlich mitten in der Lehrzeit stecken, aber es fand sich für ihn nichts Rechtes. Die Arbeit am Tiefbau war ihm doch eine elende Plackerei gewesen, und so erschien er nur dann und wann bei seinem Meister, der für Siemens & Halske an den U-Bahn-Tunneln buddelte. Schon eher interessierten den jungen Mann Automobile und Motoren, aber sein Vater meinte, dass Kutschen ohne Pferde nach dem Krieg bald keine Zukunft mehr hätten.
»Die Dinger sind doch unnatürlich«, pflegte er zu sagen. »Nur Lärm und Gestank. Nee, nee, lass mal.«
Lohnschneider wie sein alter Herr wollte Franz jedoch ebenfalls nicht werden.
»Krummer Rücken und schlechte Augen für zwanzig Mark die Woche. Nee, danke«, sagte er leise, damit es der Vater nicht hörte, denn sonst setzte es Dresche. Kurzum, Franz Sass hatte die ungerichtete Entschlossenheit und Zielstrebigkeit aller jungen Männer, die eben noch Kinder gewesen waren. Nur eines schien ihm sicher. »Ick will wat werdn. Dat steht mal feste.«
Franz war gerade mit sich selbst beschäftigt, als er vom Knall einer großen Explosion aufgeschreckt wurde. Es folgten ein dumpfes Grollen und ein Zittern der Wände in seinem Zimmer. Er lag, nur mit seiner Unterhose bekleidet, in der seine Hand steckte, auf dem Bett, das er mit seinem Bruder Erich teilte. Die Wohnung in der Birkenstraße war für die achtköpfige Familie viel zu klein. Immer war jemand da, nie hatte man seine Ruhe. Heute jedoch hatte Franz endlich einmal Glück gehabt. Andreas Sass, sein Vater, war im Stadion an der Wattstraße, um sich ein Spiel von Union anzusehen. Immerhin hatte er den Verein vor über zwanzig Jahren mitgegründet und besaß eine Freikarte auf Lebenszeit. Seit ihm ein Fuhrwerk unglücklich über den Fuß gefahren war, hatte er sich allerdings vom Kicken verabschieden müssen. Nach dem Spiel würde er sich betrinken – entweder vor Freude oder aus Kummer – und erst spät heimkommen. Die Mutter, Marie Sass, musste für Herrschaften am Alexanderplatz Wäsche ausliefern. Meist kaufte sie noch Kuchen und trank Mokka danach. Een uff feene Dame machen nannte sie das. Der Likör stieg ihr schnell zu Kopf. Und die fünf Geschwister waren ebenfalls ausgeflogen. Gerade hatte Franz wohlig daran gedacht, dass er eigentlich schon viele Erfahrungen mit Frauen hatte. Er besaß ein paar dieser Bildchen, auf denen die Damen keine Kleider trugen. Er hatte bei der dicken Ursula von gegenüber ins Fenster gespäht, als sie sich gewaschen hatte. Und überhaupt wusste er Bescheid. Denn zumindest mit einer Frau war es richtig zur Sache gegangen. Die Rote Susi hatte ihn geküsst. Nicht diese Küsse, die man von Müttern und Tanten bekam. Es war ein Kuss auf den Mund gewesen. Leidenschaftlich und heiß. Ihre Lippen hatten sich dabei leicht geöffnet. Franz war verwirrt gewesen von den Eindrücken. Ihr Atem roch ein wenig nach Minze, ihr Duftwasser nach Rosen. Er hatte sich an sie gedrückt und alle Wölbungen ihres Körpers gespürt, die ihm Erlösung von seiner Qual verhießen.
»Da musst du noch ein wenig sparen«, hatte Susi gesagt und ihm die Hand keck in den Schritt gelegt. »Bei uns ist der Eintritt vierzig Mark. Dann trinken wir Sekt und gehen ins Schambre.«
Franz hatte zwar nicht ganz verstanden, was es mit dem Schambre auf sich hatte, wagte aber auch nicht zu fragen, sondern nickte nur wissend. Er ahnte, dass dort die Wonnen wohnen mussten. Ein Olymp der Sinnlichkeit. So hatte es in einem zerlesenen Heft gestanden, dass seine Mutter gut hinter der Kartoffelkiste versteckt hatte. Offenbar gab es das Schambre also auch für Frauen.
Susanne Bentmann, von allen nur die Rote Susi genannt, gehörte nicht zu den Flittchen, die man an jeder Straßenecke für drei Mark haben konnte. Franz Sass war schon oft am Nollendorfplatz gewesen, um die Häuser gezogen und hatte sich die unterste Kategorie käuflicher Liebe angesehen. Nein, für ihn sollte es Susanne sein. Proper und gepflegt. Mit guten Manieren. Sie hatte fast weiße Haut, saubere Fingernägel und duftete herrlich. Er kannte sie noch aus der Schulzeit. Sie war fast drei Jahre älter als er. Bei der Geschäftsleitung im Temple de Salomé an der Friedrichstraße hatte sie angegeben, sie wäre einundzwanzig. Sonst hätte man sie nicht genommen. Denn Minderjährige durften im Schwof mit Herrenbedienung nicht arbeiten. Jetzt war sie dort Tänzerin. Franz selbst fand ebenfalls, dass er viel reifer als fünfzehn wirkte, zumindest redete er sich das ein. Sie würden ihn schon reinlassen in den Temple. Und ins Schambre. Wenn er nur das nötige Geld hätte. Ja, Susanne, die Rote Susi, sollte es sein, die ihn in die Liebe einwies, keine andere. Zwischen dem Vorhaben und dessen Ausführung lagen jedoch vierzig Hürden. Elf Mark und drei Groschen hatte er bereits zusammen. Aber dafür hatte er beinahe drei Wochen gebraucht. Wenn das so weiterging, wurde es vor März nichts mit der Erlösung. Und die Schufterei bei Siemens war wirklich nichts für ihn.
Immerhin hatte er nun tröstende Minuten in Gedanken an die Angebetete gehabt. Er würde seine Susanne da herausholen und heiraten. Aber erst einmal waren noch dreißig Mark zu organisieren. Aus diesen seligen Gedanken wurde er jetzt gerissen, als die Scheiben klirrten und ein leichtes Beben durchs Haus ging. Etwas beunruhigt erhob er sich und blickte aus dem Fenster in Richtung der Paulus-Kirche. Eine große Staubwolke kam von der Bremer oder Oldenburger Straße herübergeweht. Er konnte die Richtung nur erahnen, denn die Fenster der Wohnung in der vierten Etage gingen auf den Hof hinaus. Dort qualmte eine Aschetonne. Wahrscheinlich hatte ein besoffener Boofke seinen Abfall auf die Glut gekippt. Was Franz jedoch sah, war die große, schwarze Rauchwolke, die über der Dachkante des Hauses aufstieg.
Die Franzosen!, dachte Franz entsetzt. Oder die Räte. Jetzt kommen die Bolschewiki, hatte sein Vater gesagt. Jeden, der mehr als zehn Mark hat, schießen die tot! Vorsorglich hatte er dann den Überschuss beim Alten Fritz in der Lehrter Straße versoffen. Schließlich ging es ums nackte Überleben. Auf dem Tisch lag die heutige Ausgabe des Vorwärts, die sich Franz jetzt griff. Auf der Titelseite eine Erklärung des Reichskanzlers, dass der Kaiser abgedankt hatte. Es wird nicht geschossen!, stand dort weiter geschrieben. Von wegen, in der letzten Zeit hatte es, vor allem nachts, immer wieder Schüsse gegeben. Und heute waren eine Menge Soldaten am Bahnhof vorbeimarschiert und zum Reichstag gezogen. In vielen Fabriken ruhte die Arbeit. Es gab Streiks und Aufstände überall. Franz hatte mit Freunden sogar eine fast neue Pistole am Güterbahnhof gefunden. Ohne Munition. Er hatte sie in ein Öltuch gewickelt und auf dem Friedhof bei St. Johannis vergraben. Man konnte nie wissen. Eine der wenigen brauchbaren Weisheiten seines Vaters.
*
»Sie hatten keinerlei Befugnis, Herr Oberleutnant«, polterte ein grauhaariger Major der Schützendivision. »Sie gefährden durch Ihre Tat die Rückführung der Truppe nach Berlin und die Ziele der Heeresleitung.«
»Der Befehl lautete, die Aufdeckung der Absprachen von Militärführung und Seiner Majestät in Bezug auf die bolschewistische Unterwanderung zu verhindern. Mit allen Mitteln«, entgegnete der jüngere Offizier blasiert. Dabei zuckte die Narbe unter seinem linken Auge nervös.
»Von Dehlbergh! Mord war dabei nicht vorgesehen!«
»Ich protestiere gegen diese Unterstellung, Herr Major! In aller Form! Ich habe einen Vaterlandsverräter gerichtet. Es war Gefahr in Verzug für Seine Majestät und das Reich. Somit handelte es sich quasi um ein standrechtliches Urteil und dessen sofortige Vollstreckung. Et iudex et carnifex. Ich war also Richter und Henker in einer Person. Laut preußischer Militärstrafrechtsordnung hat ein Offizier die Pflicht, in solch einem Fall zu handeln. Das Gesetz sieht hierfür ausdrücklich vor …«
»Verschonen Sie mich mit Ihren Belehrungen«, wies ihn der Major scharf zurecht. »Die Abteilung III b am Alex, die Geheimkammer Seiner Majestät und die Politische Polizei Berlin hatten Hinweise auf mindestens einen weiteren Verräter. Durch Ihre übereilte …« In der Stimme des Offiziers lag Verachtung. »… Vollstreckung haben Sie leider verhindert, dass wir die Hintermänner enttarnen.« Er verabscheute das liberale Pack in den Parlamenten ebenso wie die meisten seiner Kameraden. Diese Leute untergruben die Moral seiner Männer, forderten Rechte für alle. Und Frieden. Er hasste die jüdischen Bankiers, denen ihre Spekulationen wichtiger waren als das Vaterland. Zumindest war er überzeugt, dass es so war. Aber noch mehr verabscheute er Männer wie diesen Oberleutnant Dehlbergh. Männer, die kein Feingefühl mehr für diplomatisches Handeln besaßen. Keinen Anstand. Sich jedoch ungeniert nach vorn drängten und immer mehr an Einfluss gewannen. Der Sieg des Mittelmaßes. Inkompetenz als Maßstab. Solche Kerle verkörperten den Verfall der Werte im kaiserlichen Offizierskorps.
»Der jüdische Schmierfink und Aufrührer ist immerhin tot«, sagte Oberleutnant von Dehlbergh ungerührt. »Es mag sein, dass er irgendwo noch etwas versteckt hat. Oder dass er jemanden kennt. Na und? Wir übernehmen in wenigen Tagen die Hauptstadt und hängen alle Linken an die Laternen. Und die Zeitungen kontrolliert dann sowieso …«
»Halten Sie den Mund!«, unterbrach ihn der Ältere. »Keine Namen. Die Sache wird ein Nachspiel haben, wenn sich herausstellt, dass uns die nicht aufgefundenen Dokumente Ärger machen.«
Der Oberleutnant grüßte nur halbherzig und verließ den Besprechungsraum. Auf den Gängen herrschte reges Treiben. Die Kaserne des 1. Dragoner-Regiments an der Belle-Alliance-Straße bereitete sich auf das Eintreffen von Teilen der Garde-Division vor.
Diese alten Säcke im Korps müssen weg, dachte von Dehlbergh. Sie haben nicht verstanden, wie gefährlich diese jüdisch-bolschewistische Bewegung ist. Es geht nicht mehr nur um den Kaiser oder die Abschaffung der Parlamente. Die deutschen Länder in Europa mussten endlich eine Nation werden. Und das Reich musste endlich beanspruchen, was ihm gehörte. Dafür waren sämtliche störenden Fremdkörper zu entfernen. Mit allen Mitteln. Von Dehlbergh grinste. Bolschewisten, Juden, Sozis, Freimaurer. Das Pack hatte Deutschland geschwächt und die schmachvolle Niederlage zu verantworten. Dafür würde es bezahlen.
*
Elisabeth Kerner war tot. Und es wäre ihr sehr unangenehm gewesen, hätte sie noch erfahren müssen, dass sie doch mit allerlei Krach und Staub aus der Welt geschieden war. Sie war weder eine Frau, die gern auffiel. Noch war sie eine Frau, die in den Freitod ging, nur weil der Kaiser am heutigen Tag im Exil verschwunden war. Elisabeth war auch nicht ernstlich erkrankt, abgesehen von einem chronischen Husten, den sie sich in der Berliner Luft eingefangen hatte. Nein, sie war schlicht ihres Lebens überdrüssig. Sie war stolz, eine geborene Bohnhügl zu sein. Ihr Urgroßvater war immerhin Dorfschulze gewesen. Ein Amt! Sie stammte aus dem Süden, und dorthin – zu ihren Bergen – zog es sie zurück, seit sie vor bald zwanzig Jahren ihrem Mann nach Berlin gefolgt war. In den feschen Siegfried Kerner hatte sie sich verliebt, als der Handwerksgeselle auf der Walz für einige Wochen auf ihrem Hof gearbeitet hatte. Und ihr Vater war damals froh gewesen, die zweite Tochter für eine kleine Mitgift los zu sein. Ein schlechtes Gewissen musste er sich obendrein nicht machen, denn Zimmerleute waren begehrte Männer. Jedoch erwies sich Siegfried schon kurz darauf nicht als die beste Wahl. Er hatte mehr Flausen als Grips im Kopf und wollte nach Berlin, einen »Reibach machen«.
»Ich komme groß heraus dort. Schnell den Meister, dann einen Betrieb, und ich baue dem Kaiser ein zweites Schloss«, hatte er damals geprahlt. Da er von seinem alten Lehrherrn keinen Goldklumpen – den er sich verdient zu haben glaubte – bekam und sich um guten Lohn betrogen sah, langte er zum Abschied ordentlich in die Kasse. Dafür brummte er ein Jahr im Zuchthaus Köpenick. Die Innung warf ihn mit Schimpf hinaus, auch den Gesellenbrief musste er abgeben.
Elisabeth träumte von ihren Bergwiesen. Dort hatte sie mit den Freundinnen gesessen und die Wolken gezählt. In Berlin war selbst das Grün grau, der Himmel schien aus Blei gegossen. Überall Häuser, Straßen, Fabriken. Schlote und Kot. Lärm und rastloses Treiben. Zwei Kinder waren ihr hier gestorben. Bei der Wohlfahrt musste sie betteln und hatte sich dafür so furchtbar geschämt. Siegfried war nur ein Hilfsarbeiter am Landwehrkanal. Mal stakte er eine Schute aus der Unterschleuse, mal half er unter den Brücken oder beim Entladen aus. Kaum zehn Mark brachte er nach Hause, von denen er fünf mit Korn und Molle wieder fortspülte. Jetzt aber schien alles gut zu werden. Sie kannte den Pastor vom Paulus-Kirchsprengel. Er hatte ihr eine neue Wohnung vermittelt. Mit Gasanschluss. Kein Kohleschleppen mehr. Keine feuchte Schuster-Bude wie das Loch davor. Und Siegfried? Hatte er sich gefreut? Keineswegs.
»Bist dem Pfaffen wohl ins Bett gestiegen?«, lallte er eines Abends und verschwand gleich wieder. »Obwohl det mir wundern tut, du schlaffe Katschi«, rief er noch im Treppenhaus.
Nun aber träumte Liesl für immer. Sie hatte das Bett gerichtet, das in der Küchenecke stand. Es war für Gäste. Sie trug ihr bestes Kleid, das blaue, und dazu die alten Hochzeitsschuhe, die ihr schon viel zu eng waren. Der Backherd war modern. Sie öffnete die Klappe, dann drehte sie an allen Hähnen. Das Zischen beruhigte sie. Ein guter Tag, um auf die Wiesn zu gehen. Immerhin war jetzt Frieden. Und auch ihr Krieg war vorüber.
*
Max Klante wohnte seit drei Wochen im selben Haus wie die Kerners. Zwei Stockwerke tiefer. Und nur zur Untermiete. Von der Front zurück. Jedoch schien sein Geist auf wundersame Art dort geblieben zu sein. Als wäre er ihm abhandengekommen im ewigen Vor und Zurück der Grabenkämpfe. Klante schlich als dürres Gespenst durch sein Leben, das er doch eigentlich hier neu beginnen wollte.
Die Feuerwehr fand den Mann, immer noch schreiend, eine Stunde später. Über ihm der kalte Novemberhimmel und auf ihm eine Menge Dreck. Die Decke war nur halb zusammengebrochen und hatte eine schützende Hand über den zerbrechlichen Körper gehalten. Schluchzend hatte Klante von Gräben, Gewehren und Haubitzen gefaselt, im Wahn an Schwester und Arzt gezerrt. Später streichelte er einen toten Sperling, der in seinem Krankenzimmer ans Fenster geflogen war.
Franz Sass hatte sich in aller Eile angekleidet und dabei Hemd und Strümpfe vergessen. Er stand ein paar Minuten nach der Explosion auf der Bremer Straße. Schutzpolizisten drängten die Neugierigen zurück. Die ersten Leute begannen, die verstreuten Sachen aufzusammeln. Die Druckwelle hatte die Glasscheiben auf fünfzig Meter zertrümmert. Die Mitarbeiter von Schrauben-Müller standen ebenfalls auf der Straße und gafften. So kam Franz auf billige Weise an seinen ersten Werkzeugkoffer, als er unbemerkt und flink in die Schaufensterfront des Eisenwarenladens stieg. Ein schlechtes Gewissen plagte ihn jedoch bereits, kaum dass er mit dem Ding um die Ecke war.
Das Chaos, das sie angerichtet hatte, wäre Liesl sicherlich unangenehm gewesen. Hätte sie gekonnt, sie hätte sich in ihrer leisen Art vielmals entschuldigt. Und dabei hätte sie die Hände gefaltet und den Kopf gesenkt. Frau Kerner hatte sanft und ohne Schmerz entschlafen wollen. Das Vorhaben gelang zwar, jedoch hatte sie nicht damit gerechnet, dass ihr Mann drei Stunden später rauchend nach Hause kommen würde. Der Knall, der folgte, war typisch für ihn. Siegfried überlebte wie durch ein Wunder. Er hing im Geäst einer nahen Ulme und sang ein Lied. Von Elisabeth fand man das blutig verschmierte Kleid. Und den linken Hochzeitsschuh. Ein Unwissender konnte fast meinen, sie wäre nie da gewesen.
2
Berlin-Luisenstadt, 16. November 1918
Der Sonnabend war ein beliebter Reisetag bei den Berlinern. Entsprechend überfüllt und laut war die Vorhalle am Anhalter Bahnhof. Es roch nach Bohnerwachs, Schweiß und Kölnisch Wasser. Potsdamer oder Anhalter Bahnhof, von hier fuhr fast alles ab, was in Richtung Süden ging. Wenn man die Leute so sah, konnte man durchaus meinen, einen Krieg hätte es nie gegeben. Oder zumindest wäre er gewonnen worden. Zwar waren nun an allen Reisetagen mehr Bahnpolizisten unterwegs als früher, jedoch waren diese auch gut beschäftigt. Mancher Koffer wechselte nämlich ungewollt den Besitzer, manche Geldbörse wurde ohne Wissen ihres Besitzers des Inhalts beraubt.
Max Sass hoffte, dass man seinem Anliegen am Schalter wenig Beachtung schenken würde. Und sollte doch die Pfeife schrillen, dann wäre er sicherlich in der Menschenmenge wieselflink untergetaucht. Obwohl es erst zehn Uhr war, hatte er sich einen Humpen Bier gegönnt. Um die Nerven zu beruhigen. Lügen und Täuschen hatten ihm nie gelegen. Manche Leute konnten – ohne rot zu werden – behaupten, sie wären mit dem Großen Fritz verwandt. Oder sie marschierten seelenruhig auf den Alex, um einem Schupo die Stiefel zu klauen. Nicht so Max. Ihm fehlte das dicke Fell, die Abgebrühtheit. In einer Gruppe fühlte er sich wohl, da konnte er seine Stärken ausspielen. Und die Kumpels machten eben die Dinge, die ihm nicht so leicht von der Hand gingen. Auf sich allein gestellt, war er jedoch oft hilflos. Seit Tagen schon grübelte er, wie es für ihn aussah, wenn er die Bruderschaft verließ. Dann war er ein Wolf, wie die Straßenbanden es in ihrer Sprache nannten. Ein Einzelgänger auf der Platte. Max war derart in Gedanken versunken, dass er gar nicht mitbekam, dass er der Nächste in der Schlange an der Ausgabe der Gepäckaufbewahrung war.
»Ich hab nicht ewig Zeit«, grunzte der Mitarbeiter hinter der Scheibe. »Schein her oder Mücke machen.«
»Mach hinne, Mann. Mia kommen schon Wurzeln aus de Latschn«, krähte ein kleiner Dicker von hinten, der mit seiner Frau in der Reihe stand. Die Leute lachten.
»Ja?« Max wandte sich um. Er mochte es nicht, wenn man sich auf seine Kosten amüsierte. »Wat willst du denn, du Kurzpalme? Bei deene Alte is ja det Laub schon welk. Und zwischen ihre Beene wächst dat Moos.« Das Gewieher der Leute wurde lauter. Bisschen Schnauze und Zoff. Ein Berliner Zeitvertreib. Die alte Schabracke an der Seite des Dicken kochte vor Wut.
»Tu wat, Paule. Meene Ehre …«
»Also der Näch…«, rief der Mann am Schalter, aber Max schob schnell den Gepäckschein durch die Öffnung unter der Glasscheibe. Eigentlich hatte er unauffällig sein wollen. Das Krakeele hinter ihm musste alle Schupos anziehen. Und die Bahner noch dazu.
Wenn sie mich jetzt einsacken, habe ich das meiner großen Klappe zu verdanken, dachte er.
»De beeden Koffa wolln Se nich?«, fragte der Angestellte.
Max blickte ihn verdutzt an. Um sich nicht verdächtig zu machen, schüttelte er einfach den Kopf und orientierte sich bereits für seinen Fluchtweg.
»Na jut.« Der Mann kam zurück. »Also nur die Aktentasche. Denken Se dran. In eener Woche loofen die andren Scheine ab. Det kost Strafe. Nach dree Monate gehts uff Auktion.« Durch eine Klappe schob er eine braune, abgegriffene Ledertasche. Die Schabracke schimpfte immer noch, als Max zügig durch den Ausgang Schöneberger Straße verschwand.
Zwei Koffer! Wer wusste schon, was da alles zu holen gewesen wäre. Und jetzt nur eine dämliche Aktenmappe. Aber es war ja auch nur ein Gepäckschein gewesen. Max hatte den Jungs der Bruderschaft nichts von seiner Aktion erzählt. Die Sache wollte er ohne seine Kumpel durchziehen. Er fiel als junger Erwachsener im Bahnhof nicht auf. Wenn hingegen ein Vierzehnjähriger mit einem Gepäckschein kam, dann roch der Beamte gleich Lunte. Es waren schon jüngere Steppkes von der Polizei aus der Warteschlange gezogen worden, weil man sie für Diebe hielt. Was ja oft auch stimmte …
Füllfederhalter, Tinte im Reisefässchen, Löschpapier und ein Notizblock. Dazu Briefbögen und Umschläge. Ein kleines Taschenmesser und Notgroschen in einem Seitenfach, kaum fünf Mark. Wütend kippte Max den Inhalt der Ledertasche auf den Fußboden seiner kleinen Bude. Er war überrascht, als eine flache Schachtel, die er wohl übersehen hatte, herausfiel. Er legte sie zur Seite und betrachtete die Tasche eingehend. Tatsächlich war ihm ein Nebenfach entgangen, das mit Druckknöpfen verschlossen gewesen war. Durch die rüde Behandlung war es aufgesprungen. Max verdrehte die Augen, als er wieder Papier entdeckte. Er zog die Blätter unwillig heraus und überflog deren Inhalt.
Verehrter Herr Uhlfeldt!
Sicherlich werden Sie sich fragen, aus welchem Grund ich mich an Sie wende. Es geht um Wissen, das eines bedachten Umgangs bedarf. Viele Ihrer Kollegen sind darauf aus, durch schnelle Sensation die Auflage zu steigern. Dabei geht allzu oft die Wahrheit verloren. Zudem gibt es Verlage, die noch vollkommen im alten Jahrhundert verblieben sind. Sowohl im Denken als auch in den Vertriebsmethoden.
Sie, Herr Uhlfeldt, scheinen mir modern genug, um meine Kenntnisse zügig, aber nicht übereilt unter die Leute zu bringen. Und besonnen genug, um damit nicht das gesamte Kaiserreich ins Wanken zu bringen.
Ja, Sie lesen richtig. Die Informationen, die ich Ihnen anbiete, sind in höchstem Maße gefährlich. Ich habe Beweise dafür, dass Teile der Feldtruppen und der kasernierten Einheiten des kaiserlichen Heeres jede Opposition im Land unterdrücken sollen. Hinzutreten sollen die Polizei und eine Art Bürgerwehr, um alsdann die Rädelsführer aller Parteien festzusetzen. Wieder lesen Sie richtig. Aller Parteien. Es ist das erklärte Ziel dieser Bewegung, den Parlamentarismus in Deutschland zu beseitigen. Beabsichtigt ist die Rückkehr zur absolutistischen Monarchie, natürlich unter Führung Seiner Majestät. Das Ganze soll im Handstreich geschehen, um den Widerstand des Volkes gar nicht erst entflammen zu lassen. Zudem sollen alle linken Parteiführer sofort nach Militärrecht als Verräter abgeurteilt und bestraft werden.
Wir müssen uns umgehend treffen, Herr Uhlfeldt. Natürlich muss es dabei auch um die Summe gehen, die Sie mir zu zahlen bereit sind. Ich gehe durch mein Handeln erhebliche Risiken ein. Auch werde ich nach Bekanntwerden der ruchlosen Pläne meine jetzige Anstellung verlieren. Über eine Entschädigung hierfür – auch in Raten – werden wir uns sicher einig werden. Sie können bei dieser Gelegenheit die Papiere einsehen, über die ich verfüge. Sie werden erkennen, dass sie jeden Aufwand und jede Summe Geldes lohnen.
Ergebenst,
A. L. (ein besorgter Bürger, der sich Ihnen später zu erkennen geben wird)
Max interessierte sich mehr für Sportnachrichten und Lokales, wenn er überhaupt einmal Zeitung las. Hier jedoch musste man kein politischer Stratege sein, um zu erkennen, dass die Behauptungen im Brief haarsträubend waren. Der Kaiser sollte zurückkehren und die Truppe sich gegen das eigene Volk stellen! Max überflog die anderen Papiere. Es sah aus, als wären sich der Unbekannte und der tote Verleger bei ihrem Treffen einig geworden. Es handelte sich um den Briefwechsel einiger Politiker. Ein Schreiben war sogar an General Ludendorff gerichtet. Der Mann galt – soviel wusste Max – neben Hindenburg als Kriegsheld und eigentlicher Chef der Heeresleitung. Alle Briefe und Abschriften waren auf eine Zeit von August bis November des vergangenen Jahres datiert.
Schnee von gestern, dachte Max und legte den Papierstapel zum Ofen. Uhlfeldt war tot. Und mit den Plänen der feinen Generäle hatte es wohl auch nicht ganz geklappt. Die Revolte draußen war ja in vollem Gange.
Er wandte sich wieder der Schachtel zu. B. J. Brandes – Ihr Juwelier im Westen war in winzigen Buchstaben in die Pappe gepunzt. Max war unwohl bei dem Gedanken, dass der Tote jemandem eine Freude hatte machen wollen. Schnell riss er die Schleife herunter und öffnete die Box. Es war ein winziger Anhänger mit Kette. Ein kleiner Schmetterling. Auf einer Geschenkkarte standen die Worte Für meine liebe Schwester Ilse.
So een Dreck, dachte er. Den Kerl fressen die Fische, und seine Familie weiß noch nicht einmal davon. Verluste konnten verdammt schmerzhaft sein. Wer wusste das besser als er? Vor fast zehn Jahren war ihm ein Hund zugelaufen. Das Tier hatte die Räude und lahmte. Max hatte ihn mit ein paar Abfällen wieder aufgepäppelt. Einige Zeit hatte er einen treuen Gefährten, der sich sogar in die Schlacht warf, wenn er sich auf der Straße boxte. Sie wohnten damals in einem heruntergekommenen Viertel südlich der Münze. Er durfte den Hund nicht mit in die Wohnung bringen, das hatte sein Vater verboten. Also hatte Max ihm eine kleine Hütte mit »Garten« drum herum gebaut. Eines Morgens war das übliche Bellen ausgeblieben, und er lief besorgt in den Innenhof. Aus einer Mülltonne ragten zwei Hundebeine. Max hatte derart geweint und getobt, dass sein Vater schließlich herunterkam. Er nahm den schlaffen Körper aus der Tonne. Jemand hatte das Tier erschlagen. Wie einen räudigen Hund. Und dann entsorgt. Wie Abfall.
Diese Stadt, dieses Leben macht aus uns allen Abfall, dachte Max grimmig. Wir fressen so lange Scheiße, bis wir selbst danach stinken. Und irgendwann erschlägt uns jemand. Oder sticht uns ab. Vielleicht hat unsere Nase dann einfach genug von unserem eigenen Gestank, und wir verrecken ganz von selbst.
Er beschloss, die Tasche mit dem Geschenk beim Fundbüro abzugeben. Es brachte Unglück, die Geschenke von Toten für ihre Liebsten zu verscherbeln. Auch wenn es sich nur um die Schwester handelte. Max war sicher, dass die Sachen an die richtige Stelle kommen würden. Ins Leder war ein Namensschild eingenäht. Und das Briefpapier zeigte Ludwig Uhlfeldts Adresse. Seine Schwester Ilse würde also wenigstens ihren Anhänger bekommen. Fünf Mark. Die würde er behalten. Finderlohn.
*
Max war stolz auf seinen kleinen Tabakwarenladen. Kaum größer als ein Windfang, war es immerhin sein erstes eigenes Geschäft. Zwar konnte er sich nicht vorstellen, mit dieser langweiligen Arbeit alt zu werden, aber es war ein Anfang. Heute wollte er mit seinem jüngeren Bruder über die Zukunft der Clique sprechen. Über die Sache mit dem Gepäckschein und der Tasche verlor er kein Wort. Schnee von gestern.
»Ich werde aufhören bei der Bruderschaft«, sagte er.
Franz saß auf einem billigen Holzschemel und kaute an einer Leberwurstschrippe. Der Bock diente auch als Leiter, wenn im Geschäft seines Bruders eine Glühbirne getauscht oder die Fensterscheiben geputzt werden mussten. Die anderen Jungs der Bruderschaft hatten Hausverbot, seit sie sich einmal ungefragt an den Zigaretten bedient hatten. Peter war erst zwölf und hatte das erste Mal ein paar Züge auf Lunge genommen. Prompt hatte er Max in den Laden gekotzt. Später hatte er sich auch noch in die Hose geschissen, aber da waren sie gottlob schon draußen.
»Wat?« Franz hustete, da er sich vor Überraschung an den Krümeln verschluckt hatte. »Spinnst du? Gerade jetzt?« Er hatte zwar geahnt, dass sein Bruder andere Pläne hatte. Aber nun war er doch überrascht. Gerade lief es in der Clique rund. »Wir sind jut dabei, Max. Wegen den Unruhen und so. Die Leute sind abgelenkt. Gibt eene Menge zu verdienen. Peter hat neulich zwei Pullen aus eenem Laden gezogen, nur weil der Besitzer sich die Spartakisten angeguckt hat.«
»Ick bin zu alt, Franz«, erwiderte Max. »Wenn sie mich erwischen, geh ich richtig in den Bau. Und dann hängen sie mir noch wat mit organisierte Bande oder Berufsverbrecher an. Nee, ick bin imma für euch da, ihr habt meene Unterstützung. Aber euer Bulle kann ick nich mehr sein.«
Franz nickte. Er selbst konnte Anführer werden. Mumm und Köpfchen hatte er. Jedoch war Uli ziemlich scharf darauf, Max als Bullen zu beerben.
»Ziemlich wenig los hier«, wechselte er das Thema und zeigte ins Rund. Seit einer Stunde war kein Kunde in den Laden gekommen.
Eigentlich gehörte das Tabakwarengeschäft seinem Bruder gar nicht. Noch nicht. Max Sass war gelernter Dachdecker, aber mit schwerer Arbeit hatte er es nicht so. Dennoch brauchte er eine Anstellung, damit er endlich zu Hause ausziehen konnte. Mit ihrem Vater Andreas gab es ständig Ärger.
»Ist wie bei den Hirschen. Der junge Bock und der alte, das verträgt sich nicht«, hatte ihre Mutter nach dem letzten Zoff weise angemerkt.
Anstellung oder ein eigenes Geschäft. Sonst bekam man die Meldepapiere nicht. Es blieb sein Geheimnis, wie Max an die Adresse in der Eylauer Straße gekommen war. Aber jetzt hatte er sogar seine eigene Butze! Zehn Quadratmeter für sich allein, gleich über dem Tabakladen.
»Bei Schultheiss ist Streik«, erwiderte Max. »Die Jungs in der Kaserne haben Ausgangssperre. Und die Reisenden vom Anhalter verirren sich selten hierher. Aber warte ab, bis sie erst den Flughafen bauen, dann brummt das Geschäft. Vielleicht kriege ich sogar eine Lizenz für die neue Halle. Fliegen ist die Zukunft stand in der B.Z.«
»Quatsch mit Soße!«, erwiderte Franz. »Wer baut denn uffm Tempelhof een Flugplatz? In zehn Jahren haste hier noch immer keene Kundschaft, Max. Und heute hat doch jeder seene jeheimen Quellen für de Qualmtüten«, gab er zu bedenken und schob sich den letzten Bissen der Schrippe in den Mund. Er spielte auf Jugendbanden wie die Bruderschaft an, die für große Hehler gern die geklauten oder unversteuerten Zigaretten vertickten. Dafür gab es ein paar Groschen pro Stange.
»Ist aber alles Mist«, ergänzte er. »Läufst und stehst den ganzen Tag. Und hast immer das Risiko, dass dich einer verpfeift oder beobachtet. Die letzten zwei Wochen Arrest reichen mir. Haben mir angedroht, dass ich das nächste Mal in Brandenburg einfahre.«
»Für zwei Mark? Zehn Stunden Maloche? Und dann noch in den Kahn?«, fragte sein Bruder scherzhaft. »Hast recht, ist wirklich Mist.«
»Wir müssen was Neues ausbaldowern, Max. Wie wäre es, wenn wir dir eine große Menge Stängel besorgen, die du dann hier billiger als sonst anbietest. Spricht sich schnell herum, und wir haben alle was davon.«
»Was stellst du dir da vor?«, fragte Max skeptisch. »Wenn wir eine größere Sache durchziehen und versauen, dann fahre ich in den Bau ein. Und wenn du in die Erziehungsanstalt kommst, dann schlägt mich Vater hinterher tot.«
»Wir beklauen einfach die Diebe«, entgegnete Franz und nahm sich eine Zigarette. »Kümmert die Polente nicht.«
»Du willst die alten Männer hinters Licht führen?«, fragte sein Bruder entgeistert. »Dich mit den Vereinen anlegen? Du hast sie nicht alle, Franz.«
»Nein, nicht die Vereine. Bin doch nicht blöd.« Natürlich wussten die Brüder, dass man sich besser nicht mit einem Ringverein anlegte. Diese Herren, die »alten Männer«, hatten meist reichlich Knasterfahrung und waren nicht zimperlich bei der Wahl ihrer Methoden. Brutale Schläger, die sie oft hinter den Metallgardinen kennengelernt hatten, gaben den Bossen die nötigen Argumente bei Verhandlungen. Diesen Leuten kam man lieber nicht schräg. Und schon gar nicht kam man auf die Idee, sie zu beklauen.
»Weißt du, wo die im Moment die Zigaretten herbekommen, Max?«, fragte Franz geheimnisvoll. Als sein Bruder zögerte, fuhr er fort: »Das Heer hockt auf riesigen Beständen von Rauchwaren und Branntwein. Hab ich in der Rückerklause aufgeschnappt.«
»Du hängst immer noch in dieser schmierigen Pinte rum? Hat Vater dir doch verboten.«
Das billige Speiselokal war ein beliebter Treff bei den Jugendcliquen der Innenstadt. Hier wurde man für zwanzig Pfennig satt, für weitere zwanzig betrunken, und bis drei Uhr früh konnte man sich im kruden Gemisch von Körpermief und Küchendämpfen aufwärmen.
Franz überhörte die Bemerkung. »Die Vereine schmieren in den Kasernen die zuständigen Quartiermeister und schon wechseln zwei Laster mit Stippen und Klarem den Besitzer. Bücher umschreiben, und die Sache merkt keener.«
»Und mein kleiner Bruder kennt natürlich die Herren Quartiermeister«, amüsierte sich Max Sass.
»Nee, aber ich weiß, dass sie beim Garderegiment zur Zeit den Nachschub über den Güterbahnhof in Moabit bekommen. Da haben sie Lagerhallen, weil die Kaserne für so große Lagerbestände zu klein ist.« Franz grinste. Er selbst und ein paar Jungs der Bruderschaft hatten sich mehrere Nächte in der Bahnhofsgegend um die Ohren geschlagen, um hinter das Geheimnis des Transportsystems zu kommen.
»Hast mir nichts von erzählt, Bruder«, meinte Max in scharfem Tonfall. »Aktionen ohne den Bullen durchziehen, das bedeutet Keile.«
»Willst doch sowieso aufhören. Da habe ich eben schon ein bisschen geluschert, wie man es macht.« Franz grinste. »Bleibt unter uns. Wird dein letzter großer Wurf als Bulle der Bruderschaft. Ist doch ein guter Abgang.«
Das Ulanen-Regiment hatte seine Kaserne in der Nähe des Lehrter Bahnhofs. Es hatte dort in den letzten Tagen erhebliche Unruhe gegeben, denn offenbar wusste niemand, wer in Zukunft den Sold der Männer bezahlte. Man hörte Gerüchte, dass die Siegermächte Deutschland verbieten wollten, überhaupt eine Armee zu unterhalten. Das hielten die Sass-Brüder für Quatsch, aber die Verunsicherung unter den Soldaten war groß. Vor allem die Mannschaften drängte es nach Hause. Angeblich waren auch viele Berliner Soldaten zu den Revolutionären gewechselt.
»Auf der Landseite haben sie die Hallen gut bewacht«, fuhr Franz nach einer Weile fort. »Am Güterbahnhof Moabit laufen jede Menge Bahnpolizisten herum. Aber dass jemand über den Westhafen hoppen könnte, haben sie übersehen.«
Max überlegte. Er hatte schon lange akzeptiert, dass er unter den Sass-Jungs nicht der hellste Kopf war. Er bewunderte seinen Bruder für dessen geistige Beweglichkeit und ungezwungenen Frohsinn. Es war für jeden, der Franz kannte, schnell klar: Er wollte raus aus der Gosse. Er wollte nach oben. Und er sprühte vor Ideen, wie er dies schaffen könnte. Leider waren diese allesamt dazu angetan, ihn lange Zeit hinter Gitter zu bringen. Max selbst war zwar kein unbeschriebenes Blatt – er hatte einige Brüche gemacht – und dem schnellen Geld nicht abgeneigt, aber er hatte das, was sein jüngerer Bruder »Schiss« nannte. Also brauchte er jetzt einige Minuten, um den Vorschlag zu überdenken.
»Du willst mit dem Boot über den Schifffahrtskanal, richtig?«, fragte er, um sich zu orientieren. »Bei Nacht. Schuppen auf, rein und raus«, fügte er hinzu. Einfache Planungen gefielen ihm. Einfache Pläne waren die besten, hieß es. Das letzte Mal jedoch, als er sich darauf verlassen hatte, ging es dafür sechs Monate in den Bau.
Franz nickte. »Ich muss noch rauskriegen, auf welcher Seite die Soldaten stehen.«
Max blickte ihn fragend an.
»Mensch, biste schwer von Kapee!« Franz stöhnte. »Ob das Regiment zu den Roten übergelaufen ist«, erklärte er dann. »Oder ob es noch Kaisertreue sind.« Der junge Sass hatte in den vergangenen Tagen den Gesprächen älterer Jungs gelauscht und in Zeitungen geblättert, die in der Rückerklause liegen geblieben waren. Die Machtverhältnisse in der Stadt waren verworren. Da gab es den Spartakus-Bund, die Revolutionsräte und offen bolschewistische Gruppen. Auch einige Truppenteile und Kasernierte hatten sich ihnen angeschlossen. Auf der anderen Seite standen Leute, denen es gar nicht gefiel, dass der Kaiser abgehauen war wie ein Dieb in der Nacht. Und dass dafür die Roten auf der Straße lärmten. Es hatte heftige Kämpfe zwischen den Fraktionen gegeben, und es waren Tote zu beklagen.
»Wenn es Nationale sind, dann lassen wir einfach ein paar Arbeiterflugblätter und eine Mütze bei den Schuppen zurück. Dann denken die, das waren die Bolschewisten. Oder wir machen es eben umgekehrt. Das Ganze organisiere ich schon. Auch das Boot. Meine Jungs rudern, wir beide schleppen. Muss ja nicht gleich ein Laster voll sein.«





























