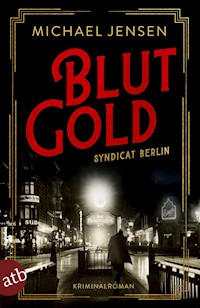9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Brüder Sass
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Die Jagd nach dem Roten Erbe.
Herbst 1925. Ein ungewöhnlicher Mord lässt Franz Sass und sein Syndicat aufhorchen. Auf dem Ufa-Gelände in Potsdam ist ein russischer Diplomat ermordet aufgefunden worden, ein Bekannter des Regisseurs Sergej Eisenstein, der gerade seinen Revolutionsfilm »Panzerkreuzer Potemkin« abgedreht hat. Offenbar sind Spione in Berlin unterwegs, die nach dem »Roten Erbe«, dem Geld russischer Adeliger, suchen. Franz Sass wittert ein Geschäft – warum sollte nicht er sich um das Vermögen der russischen Exilanten kümmern? Doch nicht nur Susanne, die Frau an seiner Seite, sondern auch die anderen Mitglieder des Syndicats ahnen, in welche Gefahr er sich damit begibt ...
Hochspannend und unterhaltsam – die Zeit der Weimarer Republik aus einem ganz anderen Blickwinkel erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 529
Ähnliche
Über das Buch
Herbst 1925: Nach dem Scheitern des Opium-Abenteuers ist das Geld wieder einmal knapp beim Syndicat. Zumal sich Franz Sass auch noch ein sündhaft teures Automobil bestellt hat und seine Verlobte Susanne auf einem ausgedehnten Capri-Urlaub besteht. In Neapel lernt er das Oberhaupt einer Camorra-Familie kennen und plant, in Berlin ein Spielkasino zu eröffnen. Doch dann erregt ein Mord seine Aufmerksamkeit. Auf dem Gelände der Ufa in Babelsberg ist ein russischer Diplomat ermordet worden. Anscheinend hat er den berühmten Regisseur und Landsmann Sergej Eisenstein gewarnt. Franz Sass erfährt, dass russische Spione nach den Reichtümern exilierter Landsleute suchen – und er wittert ein großes Geschäft. Könnte es in der Botschaft der Sowjetunion Tresore voll mit Schmuck und Gold geben? Alle Mitglieder des Syndicats warnen Franz: Diese Sache sei eine Nummer zu groß für ihn, doch damit ist sein Ehrgeiz erst recht geweckt.
Über Michael Jensen
Michael Jensen wurde im Norden Schleswig-Holsteins geboren. Im Hauptberuf ist er als Arzt tätig und interessierte sich früh für jüngere deutsche Geschihcte und deren Folgen für die Nachkriegsgeneration. Für sein literarisches Schreiben hat er ein Pseudonym gewählt. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg und im Kreis Schleswig-Flensburg.
Über die Sass-Brüder erschienen im Aufbau Taschenbuch bisher »Blutgold«, »Blutige Stille« und »Blutiger Schnee«.
Außerdem sind hier seine Kriminalromane »Totenland«, »Totenwelt« und »Totenreich« lieferbar.
Mehr zum Autor unter www.autor-jensen.de.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Michael Jensen
Blutiges Erbe
Syndicat Berlin
Kriminalroman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
I Berlin 1925
Kapitel 1 — Neapel, Anfang Oktober 1925
Kapitel 2 — Berlin, Mitte Oktober 1925
Kapitel 3 — Berlin, Ende Oktober 1925
Kapitel 4 — Neapel & Amalfi-Küste, Ende Oktober 1925
Kapitel 5 — Berlin, Anfang November 1925
Kapitel 6 — Potsdam & Berlin, Ende November 1925
Kapitel 7 — Gerichtsmedizinisches Institut
Kapitel 8 — Polizeipräsidium, Anfang Dezember 1925
Kapitel 9 — Nowawes/Babelsberg
Kapitel 10 — Charlottenburg, Anfang Dezember 1925
Kapitel 11 — Neuer Westen
Kapitel 12 — Wilmersdorf
Kapitel 13 — Generalszug
II Berlin 1926
Kapitel 14 — Alexanderplatz, Anfang Januar 1926
Kapitel 15 — Kupfergraben & Scheunenviertel, Ende Januar 1926
Kapitel 16 — Gesundbrunnen
Kapitel 17 — Oranienburger Vorstadt, Anfang Februar 1926
Kapitel 18 — Halensee, Ende Februar 1926
Kapitel 19 — Gerichtsmedizinisches Institut
Kapitel 20 — Untersuchungsgefängnis Moabit
Kapitel 21 — Spandauer Vorstadt
Kapitel 22 — Charlottenburg, Februar 1926
Kapitel 23
Kapitel 24 — Sowjetische Botschaft
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28 — Berlin-Lichtenberg, Mai 1926
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31 — Sowjetische Botschaft, Ende Mai 1926
Epilog
Nachwort
Impressum
Wer von diesem Kriminalroman begeistert ist, liest auch ...
Nach wahren historischen Begebenheiten. Einige Namen, Ereignisse und Schauplätze sind aus dramaturgischen Gründen fiktiv.
I Berlin 1925
1
Neapel, Anfang Oktober 1925
Susanne schrie plötzlich auf. Und in ihr Kreischen stimmten nur Augenblicke später drei Dutzend andere Frauen ein. Vielleicht sogar einige Männer. An diesem Ort konnte nur Grausames geschehen. Franz hätte es wissen müssen. Sofern sie diese Sache heil überstanden, würde sie dem Paar ewig in Erinnerung bleiben. Die Klaviermusik setzte, einem Raubtier gleich, zu einem letzten Sprung an; aus dem Pianissimo erhob sich die Drohung und schlich gespannt auf das mörderische Crescendo zu. Als die junge, blonde Frau nach vorn griff, neugierig wie eine ewige Eva am Apfelbaum, endete das Spiel abrupt in einem erweiterten, aufgeladenen Moll-Akkord. Niemand in der Höhle wagte mehr zu atmen. Die Enthüllung des Entstellten war zu entsetzlich. Hinter der Maske des Klavierspielers verbarg sich eine grausame Fratze, die den Betrachtern das Blut in den Adern gefrieren ließ. Susanne grub ihre Fingernägel in den Unterarm ihres Begleiters.
Nur ein Film, ermahnte sich Franz und versuchte, dem beklemmenden Gefühl, das sich in ihm ausbreitete, zu widerstehen. Hier unten umfing sie ein kühl-muffiger Geruch. Luft, die bereits vor Jahrhunderten geatmet worden war. In Gängen, die noch zur Zeit der Römer in die Tiefe getrieben worden waren. Katakomben, in denen sich erst frühe Christen, dann die Ärmsten der Armen und schließlich allerlei Gaunerpack versteckt hatten. Manch Leprakranker mochte stöhnend in einer Nische gestorben sein, sicherlich lag auch das ein oder andere Opfer unguter Taten hier verscharrt im Dreck. Und nun war dieser findige Neapolitaner auf die Idee gekommen, in Sotteranea – so nannten die Einheimischen ihre Unterwelt – ein Kino einzurichten. Wunderbar! Il Fantasma dell’Opera. Dass die Zwischentitel auf Italienisch waren, war für das Verständnis der Handlung unerheblich. Nach mehreren Wochen, die sie bereits hier waren, beherrschten Susanne und er außerdem schon ein paar Brocken.
Franz war fasziniert vom Kino. Bereits zu Hause hatte er in den letzten Monaten jeden wichtigen Film gesehen. Er liebte es, in andere Welten entführt zu werden. Mal waren es Liebesschnulzen, dann wieder Zukunftsvisionen. Der Film sprengte die Enge, die er in seinem eigenen Leben empfand. Ihm schienen Pflichten und Sorgen mittlerweile alles zu vergiften, was Spaß machte. Im Kintopp hingegen empfand er Leichtigkeit.
»Du bist süchtig nach Illusion«, hatte Susanne genörgelt, als er sie zu dem Abend im Palazzo del Cinema sotteraneo nahe der Piazza San Gaetano überreden wollte.
Süchtig nach der perfekten Illusion, dachte er jetzt, als das Phantom gerade zum wiederholten Mal seine scheinbar unendlich langen Finger nach dem Publikum ausstreckte.
»Ich muss unbedingt mit dem Besitzer sprechen«, sagte er etwa eine Stunde später, als sich das Paar bei Bruschetta und Wein von den Schrecken der Tiefe erholte. Die Piazza war trotz der bereits vorgerückten Stunde stark belebt. Es war Oktober und immer noch angenehm warm. In Berlin trug man jetzt sicherlich schon Pelz. Franz betrachtete die Menschen, die sich hier tummelten. Da gab es jene bedauernswerten Kreaturen, denen die Lumpen fast vom Leib fielen. Lebende Mumien, wie es schien. Stumm wanderten sie umher, ergatterten einen Zigarettenstummel vom Boden oder ein wenig Wein aus einer stehen gelassenen Flasche. Dann gab es Myriaden von Arbeitern, Fischern und Handwerkern, die ausgelassen und erregt gestikulierend miteinander sprachen. Immer wirkte es so, als stritten oder feilschten sie um irgendetwas. Franz wunderte sich, wie viele Geistliche zu sehen waren. Manche in schlichten Roben, manche fast pompös ausstaffiert. Letztere ließen sich offenbar von den wohlhabenderen Bürgern aushalten, die in den besseren Lokalen zu Abend aßen. Neapel war anders als Berlin ein Schmelztiegel der Schichten. Zwischen oben und unten gab es hier noch ein unsichtbares Band, das in der deutschen Hauptstadt – in der sich die Klassen meist sorgsam voneinander fernhielten – bereits zerrissen war. Noi siamo napoletani, scelti da Dio. Wir sind Neapolitaner, von Gott auserwählt. An Selbstbewusstsein mangelte es den Leuten hier wahrlich nicht.
»Weshalb willst du mit ihm reden?«, fragte Susanne, die wieder einmal aufmerksam die jungen Männer musterte.
»Diese Leute haben einen besonderen Geschäftssinn. Ist dir auf Capri aufgefallen, wie sie das Hotel geführt haben?«
»Das Locanda Pagano war einfach zauberhaft«, schwärmte Susanne. Dabei wirkte sie etwas abwesend und genoss die Blicke der Italiener.
»Es war keineswegs ein Edelschuppen, hatte seine besten Tage wohl in der Römerzeit«, meinte Franz. »Aber alle taten so, als ob es kein zweites Haus dieser Klasse gäbe.«
»Grandezza, mein Lieber. Ein Lebensgefühl, das sie hier zu kultivieren scheinen«, erwiderte seine Partnerin. »Größe zeigen, selbst wenn sie gar nicht da ist. Täte unseren jammernden Landsleuten zu Hause ganz gut.«
»Wenn du meinst. Egal, ich werde den Besitzer zu einem Geschäftsessen einladen. Vielleicht wäre es keine schlechte Idee, zu Hause auch einen Kinopalast zu eröffnen. Der Palazzo di Napoli auf dem Kurfürstendamm. Die neuesten Filme. Eine Bar für die Schauspieler. Vielleicht gibt es unter der Gedächtniskirche auch ein paar Katakomben? Was meinst du?«
»Kino im Abwasserkanal. Prima«, zog ihn Susanne auf. »Treten Sie ein, Herrschaften, und staunen Sie! Nasenklammern gibt es umsonst dazu!«
Sie schwiegen eine Weile. Franz warf den aufdringlichen Männern böse Blicke zu. Sie sprachen in einem Kauderwelsch, das nichts mit Italienisch zu tun hatte. Er ahnte jedoch, dass jede anständige Frau wahrscheinlich rot werden musste, wenn sie die Worte verstanden hätte. Andererseits hatte Susanne auch ihre eigene, durchaus anstößige Vorgeschichte, speziell mit den Herren. Und es gab kaum etwas, das sie schnell aus der Fassung brachte. Vielleicht abgesehen von verunstalteten Phantomgestalten, die in Katakomben ihre Oper aufführten. Er scheuchte die Burschen mehrmals fort, aber sie zeigten ihm nur – wie er annahm – obszöne Gesten.
»Noch besser!«, meinte er plötzlich. »Wir könnten ins Filmgeschäft einsteigen. Nicht nur Kino, sondern wir lassen die Streifen in unserem Auftrag drehen. Katja, du und Toni. Die besten Frauenrollen wären schon besetzt.«
»Sicher«, erwiderte sie und warf ihm wegen des versteckten Kompliments einen Handkuss zu. »Und du als deutscher Valentino. Da kann nichts schiefgehen. Die Ufa kann einpacken.«
2
Berlin, Mitte Oktober 1925
Das – ehemals Königliche – Preußische Untersuchungsgefängnis an der Ecke Alt-Moabit und Rathenower Straße war seit gut zehn Monaten das unfreiwillig zugewiesene Zuhause von Iwan Baruch Kutisker. Der aus Russisch-Polen stammende Geschäftsmann lebte seit fast sieben Jahren in Berlin. Er hatte nach dem Krieg die Zeichen seiner Zeit, sämtlich Zeichen der Auflösung und des Chaos, schnell erkannt und riesige Gewinne mit »herrenlosen Gütern« gemacht. Herrenlos, das waren die alten Waffenbestände, Tuche, Gerätschaften und Chemikalien des gerade beendeten Wahnsinns. Kutisker hatte sie zu einem Spottpreis erworben, gelistet, aufgeteilt und an Interessenten wieder verkauft. Bereits zur Zeit des Versailler Vertrags war er auf recht einfache, nicht immer legale Weise mehrfacher Millionär geworden.
»Elendes Schmutzblatt«, fluchte der beleibte Mann und geriet bereits infolge dieser winzigen Anstrengung außer Atem. Friedrich Hussong, ein rechtsnationaler Keifer im Gefolge Hugenbergs, hatte im Berliner Lokal-Anzeiger einen Leitartikel über Kutisker verfasst.
Wehrt euch! Der Jude Iwan Baruch frisst sich fett am Eigentum des Volkes. Eure Kinder hungern, während er wie eine Made im Speck … stand darin zu lesen.
»Es war zu erwarten«, meinte Dr. Alfons Renger, der als sein offizieller Strafverteidiger auftrat. »Die Rechten machen Stimmung.« Renger, der auch als eine Art Justiziar und Rechtsberater des Syndicats arbeitete, hatte das Mandat auf Bitte eines guten Freundes übernommen, der selbst nicht in Erscheinung treten wollte. Erich Frey war der berühmteste Anwalt der Republik. Er war Liberaler und Jude, aber verstand es mit viel Geschick, sich nicht in eine Ecke drängen zu lassen. Kutisker konnte sich Freys Honorare leisten, doch der wollte negative Publicity – er war auch im Sprachgebrauch ganz auf der Höhe der Moderne – unbedingt vermeiden. Also war man übereingekommen, dass Renger an die Front ging, während Frey in der Etappe blieb.
»Ich zahle viel Geld, damit ihr mich hier herausboxt.« Leider war Kutiskers Art nicht unbedingt dazu angetan, die Vorurteile, die manche Leute gegen ihn hegten, zügig zu widerlegen. Als Kind und Jugendlicher hatte er »Dreck gefressen«, wie er es nannte. Für eine Kopeke wäre er bereit gewesen, mit dem Teufel zu tanzen. Nun, da er mit rücksichtsloser Spekulation zu Erfolg gekommen war, ging er wie selbstverständlich davon aus, dass alle Menschen käuflich waren. Und meistens behielt er damit sogar recht. Er hatte Politiker, Verwaltungsbeamte und andere Unternehmer bestochen. Dass Frey sich ihm entzog, hatte seinen Unmut ausgelöst.
»Wir haben die Kontakte hergestellt«, sagte Renger, ohne auf die beleidigende Provokation einzugehen. Er schob seine Nickelbrille nach oben. Sein Gesicht war im Alter hager geworden, und der Nasenrücken derart abschüssig, dass keine Sehhilfe richtig sitzen wollte. »Wie Sie es wünschten.«
Kutiskers Anwälte hatten drei Dutzend einflussreiche Männer angeschrieben, die an Kutiskers Geschäften beteiligt gewesen oder aber in Absprachen verwickelt waren. Elf von ihnen hatten mit Verleumdungsklagen gedroht, der Rest ließ sich verleugnen. Als Renger diese ernüchternde Bilanz aller Anstrengungen schilderte, fluchte Kutisker erneut.
»Höfle hätte Sie ganz sicher entlasten können«, meinte der Anwalt. »Er war bereit, vor Gericht auszusagen.«
Anton Höfle hatte Kutiskers Konzernen als Minister ein paar Millionen als ungedeckte Kredite der Reichspost verschafft. Und dafür ein ordentliches Sümmchen in die eigene Tasche gesteckt. Unter mysteriösen Umständen hatte er im Frühjahr, kurz nach seiner Verhaftung, ein ganzes Röhrchen Luminal-Tabletten geschluckt. Nachdem ihm sein Gewissen geraten hatte, ein umfassendes Geständnis abzulegen.
»Was ist mit Bauer?«, fragte der Häftling unwirsch. »Dem Kerl kann ich alles nachweisen.«
»Wir sprechen immerhin vom ehemaligen Reichskanzler. Der Staatsschutz sorgt dafür, dass wir ihm nicht an den Karren fahren können.«
Alfons Renger zuckte mit den Schultern. Er hätte nie gedacht, dass er mal einen Mandanten vertreten würde, der so viele Hinweise für die Verwicklung von Honoratioren des Reichs in Mauscheleien in den Händen hielt. Hinweise, die sich zunehmend als wertlos erwiesen hatten. Weil sie eben keine Beweise waren. Politik und Wirtschaft deckten sich gegenseitig. »Ich kann mich nicht erinnern. Ich glaube aber nicht, dass es stimmt, Herr Vorsitzender.« Zur Not wurde mit dieser schlichten und eigentlich törichten Aussage jeder Ausschuss abgespeist. Kleinganoven hätte man vorgeworfen, es handelte sich dabei um eine Schutzbehauptung. Großen Gaunern hingegen nahm man es ab. Reichsanwalt und Richterschaft nickten jedes Mal nur ergeben und fegten damit alle Indizien, die Kutisker vorgebracht hatte, vom Tisch.
»Wenn Sie ein Geständnis ablegen, wird sich dies strafmildernd auswirken«, schlug Renger zum wiederholten Mal vor. »Wenn Sie auf Vorwürfe gegen Dritte verzichten, können wir sicherlich noch verhandeln. Ich denke, vier oder fünf Jahre …«
»Ich soll gestehen und alles auf mich nehmen?«, unterbrach ihn Kutisker. »Ich habe geschätzt eine Million Mark an diese Herren gezahlt, und jetzt sollen sie davonkommen? Einfach so? Die Leute haben mir die Kredite förmlich aufgedrängt. Natürlich gegen eine hübsche Provision. Wie Bauer.«
Renger schwieg. Ein Geständnis schien ihm und Frey die einzige Möglichkeit zu sein, ein etwas milderes Urteil zu erwirken. Der Reichsanwalt wollte fünfzehn Jahre für Kutisker fordern. Der Mann würde bei einem solchen Urteil wahrscheinlich im Gefängnis sterben.
»Ich habe noch ein Ass im Ärmel, wie die Amerikaner so schön sagen«, sagte Kutisker nach einer Weile.
»Besser zwei«, erwiderte Renger und schaute auf die Uhr. Gleich würde der Wärter kommen, um den Gefangenen abzuholen.
»Ich habe einen guten Bekannten«, sagte Kutisker. »Er ist Buchhalter. Sie verstehen, Herr Dr. Renger? Diese Leute schreiben alles auf. Es ist eine Art Zwang bei ihnen. AEG, Krupp, Borsig, Siemens. Mit diesen Konzernen habe ich gute Geschäfte gemacht, und sie haben meine illegale Ware gern genommen. Mein Mann hat zudem Belege für Zahlungen an mindestens fünfzig Beamte bei der Polizei, Gewerbeaufsicht, Steuerbehörde und in der Stadt- und Reichsverwaltung. Zwanzig Abgeordnete der SPD und des Zentrum standen auf meiner Gehaltsliste. Dazu Bauer und Höfle. Ich werde alles an die Presse geben. Buchung für Buchung. Ich spreche von handfesten Beweisen!«
Der Anwalt war überrascht und entsetzt zugleich. Wenn es einen glaubhaften Zeugen und belastbares Beweismaterial gab, dann konnte dieser Skandal die Republik zu Fall bringen. Links und rechts außen lauerten die Aasgeier, die sich nur allzu gern über ihren Leichnam hermachen würden.
»Er heißt Annuscheit. Finden Sie ihn! Dieser untreue Kerl war schon immer ein Hasenfuß. Er ist einfach abgehauen, als es brenzlig wurde.« Kutisker grinste hämisch. »Aber seine Lebensversicherung hat er sicherlich mitgenommen. Ohne seine Zahlen fühlt er sich nackt. Und seine Aufzeichnungen können beweisen, dass dieser Skandal bis nach ganz oben reicht.«
»Der Mann muss doch befürchten, dass man ihn ebenfalls zur Rechenschaft zieht«, meinte Renger skeptisch.
»Er war nur ein Weisungsempfänger.« Kutisker schüttelte den Kopf. »Sie sind der Anwalt, Herr Dr. Renger! Machen Sie ihm klar, dass er lediglich als Zeuge gebraucht wird und keine Anklage zu erwarten hat.«
»Er sieht es wohl anders. Warum sonst ist er verschwunden?«, fragte Renger, ahnte jedoch die Antwort.
»Er hatte Angst vor Konsequenzen anderer Art.« Kutisker fuhr sich mit seinem fleischigen Zeigefinger quer über den Hals. »Und wir beide wissen, dass er sie nicht zu Unrecht hat. Denken Sie an Höfle. Schnell könnte man über eine Packung Schlaftabletten stolpern und aus Versehen auch schlucken.« Er trat dicht an Renger heran. »Lassen Sie Ihre Beziehungen spielen. Finden Sie Annuscheit! Und sorgen Sie dafür, dass er beschützt wird.«
3
Berlin, Ende Oktober 1925
»Murnau ist ein Idiot«, schimpfte Antonia Sass. »Er sieht mich in der Rolle einer Marketenderin oder Zofe. Allenfalls mochte er sich noch die Figur einer älteren Mätresse vorstellen.«
»Du hast doch nicht allen Ernstes erwartet, dass er dich für die Rolle des Gretchen in seiner Faust-Verfilmung vorsieht?« Katja verkniff sich ein Grinsen. Mit Toni war nicht gut Kirschen essen, wenn sie aufgebracht war. Die junge Russin, die während der Oktoberrevolution nach Berlin geflohen war, hatte gute Beziehungen zu dem bekannten Zeitungsmagnaten Alfred Hugenberg, der seit Jahren vergeblich versuchte, die Ufa zu kaufen. Hugenberg, der in Katja eine Art Ziehtochter sah, hatte ihr mehrere kleine Filmrollen vermittelt. Nicht, dass sie das Geld brauchte, schließlich war sie Teilhaberin des Syndicats. Aber es hatte ihr schon immer Spaß gemacht, in andere Rollen zu schlüpfen.
»Abgetakelt hat er gesagt!« Toni ereiferte sich immer mehr. Sie war mit Ende vierzig immer noch sehr attraktiv. Aber eben nicht zwanzig. Im Filmgeschäft galt jede Frau ab dreißig als weiblicher Methusalem. »Er sagte wörtlich abgetakelte Mätresse oder Zofe. Unverschämtheit! Er spricht von der Rolle, aber er meint mich! Er hält mich für abgetakelt.«
»Soll ich ihn verhaften?«, murmelte Paul Konter aus Richtung Wintergarten des gemeinsamen Hauses am Charlottenpark. Ihr Lebensgefährte wusste, dass es eigentlich besser war, zu schweigen, wenn sie wütend wurde. Andererseits war er auch froh, dass ihre Bemühungen, ähnlich wie Katja beim Film unterzukommen, bisher gescheitert waren. Dort liefen nach seinem Geschmack zu viele Taugenichtse herum, die es nur darauf abgesehen hatten, ehrbare Frauen zu verführen.
»Halt den Mund«, kam prompt die Quittung.
In den folgenden Minuten trudelten die anderen Partner des Sass-Unternehmens bei Toni und Paul ein. Es hatte sich unter ihnen die Tradition entwickelt, Besprechungen im geräumigen Wintergarten der Jugendstilvilla abzuhalten, von dem aus man ins Grün blickte und der bei Bedarf geheizt werden konnte.
»Der Juniorchef ist mit seiner Angebeteten immer noch auf Reisen im sonnigen Italien?«, fragte Josef Sternwein, ein Kaufmann jüdischer Abstammung. Er wirkte gealtert seit dem Verlust seines geliebten Neffen vor etwa einem Jahr.
»Lass ihn das mal hören, mein Lieber.« Katja nickte. »Wir erwarten ihn aber bald zurück. Er hat nämlich ein neues Spielzeug in Mailand gekauft.«
»Ein sündhaft teures Automobil möchte ich wetten«, sagte Sternwein.
»Natürlich. Wenn er damit noch über die Alpen will, bevor der Schnee fällt, muss er sich beeilen.«
»Wie sieht es mit den Plänen bei der Filmgesellschaft aus?« Wilhelm Meyer, früher als »Messer-Willi« bekannt, hatte sich vom einfachen Kneipenwirt zum Ringboss gemausert. Beim Syndicat hielt er eigentlich nur eine stille Beteiligung, so dass er oft bei den Besprechungen fehlte. Aber er mischte sich hin und wieder doch ein, denn sein Kapital sollte selbstverständlich ordentliche Zinsen bringen.
»Vielversprechend«, antwortete Katja. Sie hatte ihrem Mentor Hugenberg einen Vorschlag unterbreitet. Aufgrund alter Feindschaften zwischen den Verantwortlichen war der Zeitungsverleger und Industrielle bisher bei der Ufa-Filmgesellschaft nicht zum Zuge gekommen. Ein Umstand, der ihn mächtig wurmte. »Man nennt es ein Strohmann-Geschäft«, fuhr sie fort. »Wir leihen der Ufa Geld und steigen als Teilhaber bei ihnen ein, wenn sie es nicht zurückzahlen kann. Hugenbergs Buchhalter haben einen Firmenmantel für uns aus der Taufe gehoben.« Sie reichte einen Auszug aus dem Handelsregister herum, auf dem drei Zeilen markiert waren. »Wir sind nun stolze Besitzer der Cinema-Syndicat-Holding GmbH.«
»Vielleicht hätten wir darüber beraten sollen«, meinte Toni leicht skeptisch. »Wie hoch ist das Risiko?«
»Wir stecken nicht mit einer einzigen, eigenen Mark drin«, entgegnete Katja. »Renger hat die Unterlagen prüfen lassen. Ich wollte euch nicht damit behelligen.« Sie lächelte. »Denn es gibt keinen Haken, und der Gewinn wird geteilt.«
»Und?«, fragte Meyer. Er war bekannt für seine bodenständige Art, Geschäfte zu machen. Ware gegen Geld. Was er nicht anfassen konnte, existierte für ihn nicht. »Neumodischer Kram. Holding. Banken. Kinematograph. Firlefanz aus Amerika. Mich interessiert nur, ob es Geld bringt.«
»Erstens wurde das Kino in Europa erfunden, mein Lieber. Und zweitens hat die Ufa bis vor zwei Jahren Millionen gemacht. Die Leute lieben Filme.«
»Bis vor zwei Jahren?«, hakte Meyer misstrauisch nach. »Und heute? Weshalb brauchen sie Geld, wenn es doch so ein blendendes Geschäft ist?«
»Warte es einfach ab, Willi. Hugenberg will die Ufa unbedingt kaufen. Er besitzt in Zukunft knapp die Hälfte der Anteile an unserer Holding. Wir bieten den Finanzheinis vom Film einen Kredit an, und unser ruppiger Alfred wird uns das Geld dafür zur Verfügung stellen. Wenn sie dann nicht zahlen können, verlangen wir Firmenanteile an der Ufa.«
»Die wir später komplett an Hugenberg verkaufen«, ergänzte Toni. »Jetzt verstehe ich.«
Alle wussten aus den Zeitungen, dass das Filmunternehmen seit Einführung der neuen, stabilen Rentenmark vor zwei Jahren zunehmend in Zahlungsschwierigkeiten steckte. Misswirtschaft und teure Produktionen zehrten an Nerven, Renommee und Kapitalstock der Ufa.
»Ich habe mit Livana gesprochen«, meinte Sternwein. Er hatte familiäre Beziehungen zum Bankhaus Rosenbaum & Cie, das mittlerweile von seiner Nichte geführt wurde. »Sie werden als Hausbank auftreten und eine steuerverträgliche Lösung ausarbeiten.«
»Dass wir mal mit Hugenberg zusammenarbeiten«, mischte sich Anna Bäumer ein und schüttelte missbilligend den Kopf.
»So läuft das«, erwiderte Katja, ihre Lebensgefährtin. »Ohne Beziehungen geht heute nichts mehr. Und manchmal muss man auch einen Stenz wie Alfred ertragen.«
»Was ist, wenn die Ufa wider Erwarten keine Schwierigkeiten bekommt?«, fragte Meyer.
»Dann erhalten die Holding-Eigner einen guten Zins und wir zudem eine ordentliche Provision von Hugenberg. Du siehst, wir können nicht verlieren.«
Toni verdrehte die Augen. Es wurde zunehmend schwieriger für sie, den Überblick zu behalten. Das Syndicat verdiente sein Geld auf vielen Feldern. Neben den Lokalen gab es noch offene oder stille Beteiligungen, ein legales Wettbüro und ein paar weniger legale Glücksspielstätten. Ware wurde – zum Teil aus dubiosen Quellen – billig eingekauft und mit gutem Gewinn wieder veräußert. Im Baugeschäft bestach und betrog man bei jedem öffentlichen Auftrag. Aber all diese Aktivitäten waren nicht ihre Welt. Darum musste sich sonst ihr Neffe kümmern, denn sie war für den Zusammenhalt, das große Ganze, die Beziehungen und die Repräsentation der »Firma« zuständig. Der Geschäftsalltag langweilte sie.
»Wir sollten uns im Frühjahr bei Franz revanchieren«, meinte ihr Lebensgefährte. Paul Konter hatte ein Gespür für Tonis Stimmungslage. Ihre Gefühle, Trauer, Angst und Ärger gingen immer tief. Auch in dieser Hinsicht machte sie keine halben Sachen. Und er versuchte, sie aufzufangen, bevor sie – oder ihre Umgebung – Schaden nahm.
»Wie meinst du das?«, fragte sie.
»Wenn er mehrere Wochen durch die Welt reisen kann.« Konter lächelte sie an und strich über ihre Hand. »Dann sollten wir vielleicht eine Reise nach Paris in Erwägung ziehen.«
Toni hatte mit einem französischen Geschäftsmann fast zwanzig Jahre in der französischen Hauptstadt gelebt. Bis der Hass dieses unseligen Kriegs sie von dort vertrieben hatte. Konter wusste, dass trotz der unschönen Erfahrungen auch eine große Sehnsucht nach dieser Stadt in ihrem Herzen verblieben war. Ihre Augen leuchteten für einen Moment, aber sie gab keine Antwort.
Kurze Zeit später erhielt Konter einen Anruf vom Präsidium. Toni funkelte ihn böse an, als er sich bereit erklärte, für den diensthabenden Kollegen einzuspringen.
»Hagen ist mit einem Selbstmörder beschäftigt, der sich am Güterbahnhof vor einen Zug werfen will«, sagte er und griff nach einer Schrippe. »Und Kollege Buber wurde zu einem Leichnam auf der Fischerinsel gerufen, der laut Aussage eines Zeugen noch gar nicht tot ist. Am Schlachthof ist ein betrunkener Vorarbeiter in den Wolf gefallen und konnte nur halb gerettet werden. Also, nichts Besonderes. Der übliche Berliner Wahnsinn eben.«
»Du willst doch nicht zum Viehhof!«, fuhr ihn Toni an. »Es ist Sonntag, und wenn du zurückkehrst, wirst du drei Tage lang stinken.«
»Nein, meine Zuckerstange.« Paul Konter nahm ihre Hände und küsste sie. »Ich muss in die Oberlandstraße.« Er hielt inne und ließ die Worte wirken. »Dort im Ufa-Union Atelier wurde nämlich ebenfalls ein Leichnam entdeckt. Und der scheint im Gegensatz zu Bubers Scheintoten wirklich hinüber zu sein. Soll ich den Damen eine Autogrammkarte mitbringen?« Er gab sich weltmännisch. »Von Willy Fritsch vielleicht?«
»Pah! Interessiert mich alles überhaupt nicht«, meinte Toni trotzig und fegte mit einer kecken Handbewegung die Haare aus der Stirn.
˚˚˚
Die Studios im Bereich Tempelhof waren ein Sammelsurium aus der Frühzeit des deutschen Kinofilms. Kommissar Konter, der mittlerweile unter dem Leiter der Mordinspektion Ernst Gennat zu dessen rechter Hand aufgestiegen war, genoss jetzt einige Vorteile. Er hatte ein größeres Büro erhalten, und ihm war sogar stundenweise eine Schreibkraft zugewiesen worden. Außerdem musste er sich um Spesen wie die Kosten für das Taxi, das ihn in die Oberlandstraße brachte, nicht mehr kümmern. Er hatte sich durch den Pförtner des Präsidiums beim Filmstudio ankündigen lassen. Und ein Kollege der Ordnungspolizei war vom Bereitschaftsdienst angewiesen worden, Konters Assistenten Jens Druwe zum Tatort zu bringen.
Der ältere Kripobeamte traf als Erster bei der genannten Adresse ein und nutzte die Zeit für eine schnelle Zigarette. Nachdem er drei Züge genommen hatte, ratterte ein seltsames Wägelchen aus Richtung Knesebeckstraße heran. Es hatte einen grünen Anstrich, einen Polizeiwinker seitlich am Dach und sah mit seinem einzigen Scheinwerfer vorn aus wie die Miniatur eines Zyklopen. Konter brach in schallendes Gelächter aus, so dass der Glimmstängel zu Boden fiel.
Druwe saß gebeugt und mit eingezogenem Kopf in dem Vehikel und starrte grimmig zu seinem Chef, als er sich mühsam aus der Beifahrertür schälte. Danach stieg ein Wachtmeister aus und warf sich stolz vor dem Wagen in Pose. Dabei klopfte er aufs Wagendach, als tätschelte er einen Schoßhund.
»Was ist das denn?«, fragte Konter den Kollegen von der Orpo, nachdem er ihn und seinen Mitarbeiter gegrüßt hatte. Der deutlich jüngere Druwe schüttelte nur den Kopf und steckte sich seinerseits eine Zigarette an.
»Ein Hanomag.« Der Streifenbeamte nahm Haltung an und streckte die Brust vor, so dass sein Dienstwagen noch kleiner wirkte. »Ein Tauglichkeitstest. Alltagseinsatz und so. Sie verstehen, Herr Kommissar?«
Natürlich kannte Konter das Fahrzeug. Er bekam von Franz Sass, der ein Autonarr war, regelmäßig die ausgelesenen Magazine und Motorzeitschriften. Das Fahrzeug hatte bereits bei der Pressevorstellung vor einigen Monaten den Spitznamen »Kommissbrot« erhalten. Zu Recht, wie der Kripobeamte fand. Das Teil sah eher aus wie eine Keksdose auf Rädern. Zu allem Überfluss war es eine Keksdose mit nur einer Tür auf der linken Seite. Und dem Lenkrad auf der rechten Seite. Wenn der Fahrer also aussteigen wollte, musste erst der Begleiter hinaus an die Luft. Niemals hätte er für möglich gehalten, dass die Berliner Polizeibehörde eine Verwendung als Einsatzfahrzeug in Erwägung ziehen würde.
»Sind Sie sicher, dass dieser …« Konter grinste spöttisch. »Dass dieser Wagen die Kollision mit einer Hutschachtel aushält?« Er zeigte auf den engen Innenraum. »Im Übrigen scheint es mir ungemein praktisch, dass der Fahrer etwas länger zum Aussteigen braucht, weil es nur eine Tür gibt. Sehr hilfreich bei der Verfolgung von Straftätern.«
Der Wachtmeister wurde gerade zehn Zentimeter kleiner. Sein Stolz schmolz dahin wie Wachs in der Sonne. Und auch er begann plötzlich, an jeder Ecke und Kante des Hanomag zu ziehen und zu drücken. Als hätte ihm Konter die Freude an seinem Spielzeug verdorben.
»Lassen Sie das, Kollege!«, befahl Konter mit übertriebenem Ernst und konnte sich kaum das Lachen verkneifen. »Sie beschädigen Reichseigentum.« Er wandte sich an seinen Assistenten. »Was erwartet uns, Jens?«
Es war Aufgabe eines Kriminalassistenten, sich möglichst schnell ein Bild zu machen. Konter erwartete, dass sein Mitarbeiter sich bereits vorher bei den Kollegen am Alex erkundigt hatte.
»Ich weiß auch nicht viel mehr als Sie, Chef«, antwortete Druwe. »Sie kennen ja die Leute vom Film. Immer wichtig, immer laut. Die Kollegen vom Bereitschaftsdienst haben keine vernünftige Beschreibung bekommen. Stattdessen hat irgendein Produktionsleiter hysterisch ins Telefon gekeift, dass der Polizeipräsident und der Bürgermeister kommen müssten.«
In diesem Augenblick kam ein aufgeregter Angestellter über das Werksgelände gelaufen und winkte ihnen hektisch zu.
»Hierher, meine Herren!«, rief er. »Mein Gott, ein Toter! Kommen Sie doch!«
Seine eher dickfelligen Kollegen Grote und Buber hätten wahrscheinlich mit der Bemerkung »Tot? Dann eilt es sicher nicht« reagiert und dämlich gegrinst, als wäre es der Witz des Jahrzehnts. Aber Paul Konter schaltete in solchen Situationen innerlich um. Ein Verbrechen war kein Scherz. Nichts daran war lustig. Und ein Mensch war keine Sache. Folglich war jede Art von Humor in diesem Zusammenhang unangebracht.
»Meine Herren, hier entlang, bitte«, sagte ein weiterer Mitarbeiter der Ufa, der sie an einer Seitentür erwartete und gekleidet war wie ein englischer Butler. »Mein Name ist Krüger, Hans Krüger. Ich bin der Maître d’ensemble und hier zuständig für die Organisation.« Er wedelte nervös mit einem chinesischen Fächer vor seinem Gesicht, obwohl es hier unangenehm kühl war. Selbigen nutzte er offenbar auch, um seinen Anweisungen den Ausdruck gelangweilter Wichtigkeit zu geben, denn seinen Kollegen scheuchte er mit einem Wedeln fort wie eine lästige Fliege.
»Der Maître d’ensemble«, wiederholte er, als befürchtete er, die Kripobeamten könnten ihn nicht verstanden haben. »Ohne mich geht gar nichts.« Er fächerte sich Luft zu. »Aber wer dankt es einem? Manchmal springe ich sogar als Komparse ein. Wie heute.« Er wies auf seine Livree. »Entschuldigen Sie diesen unwürdigen Aufzug.«
Konter und Druwe standen jetzt vor einem Glasatelier. So nannten die Filmemacher alle Bauten, die über ein Glasdach verfügten. Das Licht der Kunstlampen war für die geringe Empfindlichkeit der fotografischen Emulsion oft zu schwach, folglich nutzte man auf diese Weise das Tageslicht. Manchmal handelte es sich bei den Gebäuden nur um eine Art besseres Gewächshaus, hier jedoch war es eine Fabrikhalle, deren obere Glasflächen auf riesigen Stahlträgern ruhten.
»Ich dachte, die Ufa wäre nach Babelsberg umgezogen«, sagte Druwe erstaunt.
»Das Fußvolk, ja«, erwiderte Krüger sichtlich erfreut, über sein Lieblingsthema sprechen zu können. »Für die feinen, technisch sehr aufwändigen Aufnahmen braucht man hingegen uns. Man nennt es jetzt Tricktechnik. Wir sind derart gut, dass sogar die Konkurrenz unsere Ausstattung mietet. Auch aus dem Ausland kommen Produzenten, um sich beraten zu lassen. Erst neulich war ein russischer …«
»Schön, sehr interessant. Aber wie wäre es, wenn wir uns der Sache widmen?« Konter sah seinen Assistenten mahnend an. Er wusste, dass Jens Druwe – wie fast alle jungen Leute – ganz vernarrt war in alles, was mit Kintopp zu tun hatte. »Die Angaben Ihres Mitarbeiters am Telefon schienen doch recht verwirrend. Als wäre der Mann betrunken gewesen.« Oder er hatte Koks gezogen, dachte Konter, aber diese Vermutung behielt er für sich.
»Nehmen Sie es uns nicht übel, Herr Kommissar«, sagte der Butler-Assistent. »Hier stehen alle Mitarbeiter unter einem enormen Druck. Zeit ist Geld, heißt es. Drei tödliche Unfälle letztes Jahr bei Dreh- und Bauarbeiten. Immer wieder Verletzte. Dazu Filmszenen, in denen gelitten und gestorben wird. Man stumpft irgendwie ab.«
»Moderne Zeiten, Chef«, meinte Druwe und sah sich um.
Die Deckenhöhe der Halle musste über zwanzig Meter betragen. Das Dach schien vorwiegend aus einer Stahlkonstruktion errichtet, bewegliche Wände trennten einzelne Bereiche ab. Im Inneren befand sich eine Art Skelett, ebenfalls aus Stahl, an dem Scheinwerfer, Spiegel und Kabel hingen. Ein kleiner Kran konnte mehrere Sitzschalen in luftige Höhen heben. Paul Konter vermutete, dass die Kameramänner ihre tollkühnen Einstellungen von diesen Positionen aus drehten.
»Eine Handkamera!«, rief Druwe begeistert und ging zu einem Tisch, auf dem ein Kasten aus Holz und Metall stand, an dessen Seite eine Kurbel herausragte.
»Bitte fassen Sie nichts an«, fuhr ihn der Assistent an, als der Kripobeamte gerade ehrfürchtig mit der Handfläche über eine riesige, ihm in ihrer Funktion unbekannte Maschine strich und dann deren Oberfläche abklopfte. »Herr Lang ist da sehr eigenwillig. Er sieht am Morgen, wenn eine Requisite um ein paar Zentimeter verschoben wurde.«
»Das Ding ist aus Pappe«, sagte Druwe verwundert, ohne sich um die Rüge zu kümmern.
»Illusion ist die neue Wirklichkeit.« Der Maître hob die Schultern. »Wir hatten Reporter hier, die über Neuerungen der Filmtechnik berichten wollten. Echte Handkameras sind nicht mit Gold zu bezahlen. Da haben wir für die Führung eine Attrappe bauen lassen.«
Wie zur Bestätigung führte der Mann die Polizisten zu einem Raum, in dem eine Reihe von Schaufensterpuppen zu stehen schien. Als er den Lichtschalter betätigte, waren dunkelgrau bemalte Gestalten zu erkennen, deren Körper mit Kabeln und Schläuchen versehen waren. Der Kopf bestand nur aus einem Helm, aus dem Glasaugen starrten.
»Die Maschinenmenschen«, erklärte der Assistent mit Stolz in der Stimme. »Herr Lang braucht sie für seinen neuen Film. Er dreht zwar überwiegend draußen in Babelsberg. Aber wie gesagt, für die Feinarbeiten und Tricktechnik sind wir zuständig.«
»Maschinen … Menschen? Können sie sich bewegen? Ich meine, steuern Sie sie?«
»Im Drehbuch steht es zwar so, aber nur für die Reporter der Magazine. Technisch wäre es viel zu aufwändig. Meistens stehen die Pappkameraden ohnehin im Hintergrund. Oder wir machen nacheinander Aufnahmen. Sehen Sie!« Er hob den Arm einer Puppe langsam an. »Wenn wir jede Einstellung einzeln aufnehmen, dann wirkt es später im Film, als hätte sich der Kerl selbst bewegt.« Er zeigte auf eine Figur, die sich am Rücken öffnen ließ. »Zwei sind so gearbeitet, dass ein kleiner, schlanker Mensch hineinpasst. Er bewegt sich, und es sieht aus, als wäre es eine Maschine. In Metropolis ist die Hauptdarstellerin eine Maschinenfrau.«
»Könnten wir vielleicht zur Sache kommen?« Konter wurde ungeduldig.
»Hier hinten ist es.«
In der Ecke lag ein halb umgekippter Maschinenmensch.
»Wir hätten wahrscheinlich nichts bemerkt, wäre der Fahrer nicht unachtsam gewesen.«
»Fahrer?«, fragte Druwe.
»Die meisten Figuren stehen auf einem Podest mit Rollen. Sie werden mit einem Wagen dorthin gefahren, wo man sie braucht. Wäre das Ding nicht umgefallen …« Der Mann zeigte auf eine Figur. »Aber sehen Sie selbst.«
Konter trat näher an die seltsam verrenkte Gestalt heran. Sein Assistent nahm eine Taschenleuchte, wies jedoch ihren Begleiter an, für besseres Licht zu sorgen. Konter, der seine Gummihandschuhe übergezogen hatte, zog ein Stück Pappmaschee zur Seite.
»Was …?« Er fuhr erschrocken auf und schlug dabei seinem jungen Kollegen die Leuchte aus der Hand.
Ein leichter Duft von Eukalyptus stieg beiden Männern in die Nase. Daneben noch eine stechend-beißende Note.
»Ich kenne den Geruch«, meinte Druwe plötzlich. »Formalin. Bei meinem Schwager in der Gerichtsmedizin riecht sogar der Schnaps danach.«
Der Assistent kam mit einem Scheinwerfer zurück, der kurz darauf die makabre Szene gut ausleuchtete. Offenbar befand sich ein Leichnam in der Filmpuppe. Als der Ufa-Arbeiter mit seinem Hubwagen dagegen gefahren war, hatte die Papphülle nachgegeben und war in der Mitte zerbrochen. Das obere Teil lag am Boden, der Rumpf und die Beine standen noch auf der Grundplatte. Eine Art Sack hing über die Hüfte gebeugt aus dem Maschinenmenschen heraus.
»So etwas habe ich noch nicht erlebt«, entfuhr es Konter. »Die Leiche ist weder frisch, noch wird der Täter sie hier vor Ort derart vorbereitet haben.«
»Präpariert, Chef«, unterbrach ihn Druwe.
»Von mir aus. Jemand muss den Kerl präpariert haben. Aber warum hat er ihn danach in eine solche Attrappe modelliert?«
»Nicht modellieren«, kam es von hinten. Der Maître hielt ein Taschentuch vor die Nase und wedelte hektisch mit dem Fächer. »Es ist der zweite Körper, in den ein Mensch passt. Falls der erste Schaden nimmt.«
»Weshalb gibt es zwei Puppen, in die ein Schauspieler passen muss?«, fragte Konter.
»Die Hauptdarstellerin, das Fräulein Helm, wird in einigen Szenen darin stecken«, erklärte der Mitarbeiter. »Nur dann wirken die Bewegungen natürlich. Wie gesagt, dieses Modell ist die Ausweichpuppe. Sie wird nur gebraucht, falls das Original Schaden nehmen sollte. Der Rest unserer Maschinenmenschen ist sehr viel gröber gearbeitet, was jedoch im Film nicht auffallen wird.«
»Werden die Dinger hier gebaut?«, fragte Druwe den Assistenten und zeigte auf die Reihe der Pappkomparsen. Der Mann hielt zwar etwas Abstand, sah den beiden Polizisten jedoch immer wieder neugierig über die Schultern.
»Keine Ahnung. Der Requisitenbau ist im alten Atelier. Und einige Sachen kommen aus Werkstätten, die über die Stadt verteilt sind. Die Zulieferer fallen nicht unter meine Zuständigkeit.«
»Finden Sie heraus, wann sie das letzte Mal in Gebrauch waren, Jens«, wies Konter seinen Assistenten an. »Wer hat hier wann herumgewerkelt? Und gehen Sie die Lieferlisten der letzten Wochen durch. Eine Leiche bringt man schließlich nicht in der Aktentasche hierher. Unser Majordomus kann Ihnen sicherlich behilflich sein. Wir wollen ja keine große Anfrage daraus machen, nicht wahr?«
»Maître, bitte.« Der Angestellte nickte. »Aber ja, machen Sie bloß wenig Aufhebens darum. Herr Lang und Herr Pommer wären nicht begeistert. Selbstverständlich haben Sie meine volle Unterstützung. Nur keinen Skandal, bitte.«
»Wir können im Moment nicht viel tun«, unterbrach Druwe den Redeschwall des Mannes und wandte sich direkt an Konter. »Die Sache muss sich erst der Erkennungsdienst ansehen, sonst ruinieren wir die Spuren.«
Konter nickte. Es war keine Gefahr in Verzug. Weder konnten sie ein Leben retten noch würden sie den Täter schneller dingfest machen, wenn sie jetzt weiterhin hier herumliefen. Es bestand kein Grund, die Arbeit der Spurensicherung zu behindern. Er sah auf seine Handschuhe und überlegte kurz. Dann glättete er die Hülle, die sich in der Art eines dünnen Leichensacks um den darin befindlichen Körper legte. Im oberen, nach vorn gekippten Bereich werkelte er an Leinenbändern herum, bis er endlich den Stoff über den Kopf des Toten schieben konnte. Er fuhr vor Entsetzen zurück.
Der Formalin-Geruch stieg als Welle aus dem Sack und raubte ihm kurz den Atem. Doch schrecklicher war, was er sah.
»Mein Gott!«, entfuhr es Druwe, der hinter ihm stand. »Was ist das denn?«
Beide Männer hatten im Lauf der Jahre viel gesehen. Konter war mit dem Innen und Außen des Menschen durch seine Jahrzehnte bei der Polizei wohl vertraut. Und der junge Druwe hatte im Krieg in einer Art Zeitraffer ähnliche Erfahrungen gesammelt. Dennoch gab es immer wieder Momente, die den abgebrühtesten Kriminologen und abgestumpftesten Veteranen überraschten. Beide Männer blickten auf ein Gesicht, das mit einer milchig durchscheinenden Schicht bedeckt zu sein schien. Die Augen des Toten waren geöffnet und seltsamerweise nicht trübe. Ein glasklares Blau der Iris starrte ins Nichts. Konter nahm seinen Bleistift und drückte mit der stumpfen Seite vorsichtig in die Weichteile der Wange. Mit einem Plopp gab die Schicht nach, und der Stift verschwand im Gewebe. Ebenso verfuhr er vorsichtig mit einem Auge. Ein helles Klicken erklang.
»Glas«, murmelte er erstaunt.
»Eine Frau«, meinte Druwe. »Sehen Sie sich die Lippen und Augenbrauen an, Paul.«
»Lippenstift und Lidstrich.« Konter nickte. »Muss zwar in Berlin und vor allem beim Film nichts heißen, aber die Größe des Körpers und die Gesichtsform weisen ebenfalls daraufhin, dass es sich um ein weibliches Opfer handelt.«
»Irgendwo Blut?«
Konter schüttelte den Kopf. Dann versuchte er, einen Blick auf den Hals der Toten zu werfen. Erwürgen war immer noch die häufigste Art, durch die Frauen gewaltsam zu Tode kamen.
»Keine Würgemale, Schädelknochen scheinen intakt, keine Einstichstellen an Hals und Brustbereich«, sagte er. »Die Sache ist oberfaul, Jens. Sperren Sie den Fundort der Leiche ab. Und ich will die Namen aller Angestellten und Arbeiter, die in den letzten zwei Wochen auch nur in die Nähe dieser Maschinenpuppen gekommen sind. Selbst den Bäckerjungen, der morgens die Brötchen bringt, will ich auf der Liste sehen. Klar, Jens?«
Druwe nickte und gab die Anweisungen an den Wachtmeister weiter, der etwas verloren am Eingang des Ateliers stand und dort aufmerksam einen Damenstrumpf musterte, der an einer Türklinke hing.
Präpariert, dachte Konter und untersuchte die Hülle der Maschinenpuppe. Wie in der Anatomie oder Gerichtsmedizin. Der intensive Geruch nach Formalin und Eukalyptus drang bei jeder winzigen Bewegung des toten Körpers an seine Nase. Es mochte auch Campher dabei sein. Wenn Druwes Schwager, Dr. Schmid, ihnen bei den Obduktionen Befunde an Leichnamen erläuterte, roch es ebenso. Die Figur selbst war aus einer Art Holzleim gefertigt, innen rau mit kleinen Spänen. Außen fein geschliffen, poliert und offenbar mit Schellack überzogen. Der äußere Eindruck von Metall war täuschend echt gelungen. Konter riss sich von dem Anblick los. Er konnte zunächst nichts weiter tun als warten. Dieser Körper war tot, daran bestand kein Zweifel. Vor Ort den oder die Täter zu erwischen, erschien aussichtslos. Also gab es keinen Grund, weitere Spuren zu verwischen oder gar zu zerstören.
Eine halbe Stunde später erschien der Kriminalkollege vom Erkennungsdienst mit seinem Gehilfen. Die Fachinspektion I hatte sich – auf Druck Gennats – von der »Idiotenabteilung« zur respektablen Säule der Mordermittlung gemausert. Konter tauschte sich mit seinem Kollegen kurz aus und verließ danach das Gebäude, um sich ein wenig umzusehen. Er stand gerade wieder im Freien, als über ihm eine Fokker F.VII des Aero Lloyd in Richtung Tempelhofer Flugfeld donnerte.
»Mensch, Jens, vor ein paar Jahren sind hier noch Husaren des Kaiserlichen Heeres geritten«, meinte er versonnen zu seinem Assistenten, der ihm die Liste der Mitarbeiter zeigte.
»Meine Inge meint, dass irgendwann Hunderte Passagiere in den Dingern sitzen werden.« Druwes Verlobte war bekannt für ihr Faible, kaufte sich oft Magazine und Illustrierte. Sie verschlang alles Gedruckte, das mit Adelsfamilien und Schauspielern, aber auch mit Reisen in ferne Länder zu tun hatte.
»Unsinn.« Konter schüttelte den Kopf. »In die Fokker passen acht Leute. Stellen Sie sich vor, die Dinger werden größer! Und dann starten und landen fünfzig oder sechzig Maschinen am Tag! Nein, Berlin ist so schon laut genug. Es wird ein Vergnügen für die Betuchten bleiben. Irgendwann ist es ihnen zu viel, und man wird die Flugfelder wieder abbauen.«
»Was halten Sie von der Mumie?«, fragte Druwe und zeigte mit dem Daumen Richtung Atelier.
»Mumie«, murmelte Konter und nickte. Er hatte ebenfalls kurz an die mittlerweile berühmte Ägypten-Ausstellung im Neuen Museum denken müssen, als er den eingewickelten Leichnam betrachtet hatte. »Wir müssen abwarten, was der ED sagt«, meinte er dann. »Und danach ab zum Institut für Gerichtliche Medizin. Bis dahin bleibt alles reine Spekulation. Oder mit den Worten des Dicken: Heiße Luft taugt für Ballonfahrten, aber nicht für gute Kriminalarbeit.«
4
Neapel & Amalfi-Küste, Ende Oktober 1925
»Parla il Papa!«, erklang der Ruf durch das Lokal. Augenblicklich wurde es still in dem kleinen Saal. Selbst jene, denen eben noch ein Stuhlbein über den Schädel gezogen oder ein Messer in den Unterarm gestoßen worden war, verstummten ehrfürchtig. Die Schwarzhemden standen sofort allesamt stramm. Kommunisten und Sozialdemokraten schienen noch einen Moment zu überlegen, wie sie durch eine Haltung, die sich von jener ihrer Gegner unterschied, dem wichtigen Ereignis gerecht werden konnten. Fast wirkte es, als blickten sie neidvoll auf die dem Anlass scheinbar würdigeren Uniformen der Faschisten.
»Der Papst spricht!« Wieder durchschnitt der Bariton des Gastwirts das Chaos. Er besaß ein Ungetüm von Fernsprecher, das die halbe Speisekammer hinter dem Schanktresen einnahm. Sein Schwiegersohn, der im Weltkrieg Funktechniker bei den Deutschen gewesen war, hatte das Ding so umgebaut, dass man damit auch Nachrichten und den Rundfunk aus Rom empfangen konnte. Etwas illegal zwar, aber Gesetze hatten in Italien ohnehin mehr die Funktion von Straßenschildern. Sie waren eher beratend, jedoch nicht verpflichtend. Man konnte ihnen folgen, wenn es einem gerade passte. Oder man wählte einen anderen Weg. Una soluzione italiana eben. Im Lautsprecher krachte es bedenklich, als der Wirt an einem Regler drehte. Dann marterten kurzes Rauschen und schrilles Kreischen die Ohren der Anwesenden. Aber sie verharrten in jener Andächtigkeit, die ebenfalls diesem Land und seinen Bewohnern in so typischer Weise zu eigen war. La devozione italiana.
Susanne und Franz verstanden kaum ein Wort. Sie waren seit mehr als einem Monat in der Region Neapel unterwegs und hatten manche Redewendung schnell verinnerlicht. Der schnarrenden Stimme, die jetzt in einem seltsam sphärischen, akustischen An- und Abschwellen den Raum füllte, konnten sie nicht folgen.
»Seltsame Menschen«, flüsterte Susi ihrem Gefährten kaum hörbar zu. »Gerade noch bekämpfen sie sich bis aufs Blut, dann aber spricht der Papst, und alle lauschen, als würde die Geburt des Heilands verkündet.«
Das Lokal war ihnen von ihrer Vermieterin empfohlen worden.
»Beste Pasta von Mama«, hatte sie gesagt und diese typische Handbewegung – der Daumen wurde an Zeige- und Mittelfinger gelegt und zum Mund geführt – gemacht. Franz, der die Regeln des Landes schnell begriffen hatte, vermutete allerdings, dass sie mit dem Wirt verwandt war und einen Obolus für jeden vermittelten Touristen bekam. Er hatte jedoch zugeben müssen, dass das Essen in der Spelunke nahe des Castel dell’Ovo tatsächlich gut war. Da an diesem Abend ein starker Wind in die Bucht blies, hatten Susi und er einen ruhigen Tisch im hinteren, inneren Bereich gewählt. Als dann Mussolinis Schlägertrupp eingetroffen und sofort auf jeden männlichen Gast eingeprügelt hatte, war den beiden kein Fluchtweg geblieben. Sie hockten in einer Nische, und Franz hatte einen Tisch zum Schutz vor sie gezogen. Jetzt allerdings lauschten alle gemeinsam den Worten von Papst Pius.
»… il popolo italiano può essere orgoglioso della sua unità …« Irgendetwas mit Stolz und Einigkeit. Franz blickte sich um. Diese Gelegenheit bot sich vielleicht nur einmal.
»Komm«, meinte er zu Susanne, ergriff ihre Hand und zog sie sanft zum Ausgang.
Ein am Kopf blutender Arbeiter hielt andächtig seine Mütze vor die Brust und lauschte den Worten des Stellvertreters Christi. Neben ihm hielt ein camicia nera, ein Schwarzhemd, wahrscheinlich den Knüppel, mit dem er dem Kommunisten gerade vorher die jetzt vom Papst beschworene Einheit hatte verständlich machen wollen.
Vollkommen verrückt, diese Italiener, dachte Franz und atmete auf, als sie den Ausgang erreichten. In der Hand hielt er fünf Dollarnoten und suchte Blickkontakt zum Wirt. Esel konnte man vielleicht mit Karotten locken, italienische Geschäftsleute ganz sicher mit amerikanischer Währung. Ein paar Sekunden später wurde ihm das Geld aus der Hand gerissen.
»Bravu«, murmelte ihr Gastgeber mit der ihm eigenen mürrischen Höflichkeit. »Turnà crài.«
»Certo. Wir kommen wieder, du alter Gauner«, erwiderte Franz nur.
Vor der Tür standen drei fascisti Wache. Sie hielten ungeniert Revolver in den Händen, um sicherzustellen, dass das Kräfteverhältnis der Maßregelung im Inneren nicht durch Verstärkung aus dem Gleichgewicht gebracht wurde.
»Diese Idioten sind genauso schlimm wie Röhrbeins Leute«, flüsterte Franz. Dabei lächelte er die Männer an, die ihn musterten. Paul Röhrbein leitete in Berlin den Frontbann Nord, allesamt Straßenkämpfer und Randalierer für die rechtskonservativen Parteien. »Hier heißen sie Faschisten. Bei uns nennen sie sich jetzt Nationalsozialisten.«
»Mit dem Unterschied, dass sie in diesem Land das Sagen haben«, erwiderte Susanne. »Ich dachte, dass Mussolini hier im Süden ohnehin recht beliebt ist.«
»Offenbar will er ein paar zusätzliche Streicheleinheiten verteilen lassen, um die noch zögerlichen Linken zu überzeugen.«
˚˚˚
»Lass uns doch noch etwas in Italien bleiben«, wechselte Susanne kurz darauf das Thema. »Aber wir sollten wieder auf diese Insel zurück.«
»Capri?«, fragte Franz. »In dieses Dreckloch kriegen mich keine zehn Pferde mehr!«
Sie schlenderten Arm in Arm zu ihrem Hotel Palazzo Decumani südlich der Piazza San Gaetano zurück. Es roch strenger als zu Hause in den engen Gassen von Alt-Kölln, aber als Gast nahm man solche Dinge offenbar anders wahr. Das Paar war durch Wein und die immer noch sommerlich warme Abendluft beinahe beschwingt unterwegs.
»Es hat dir gutgetan. Du kommst dort viel mehr zur Ruhe als hier.« Susanne lächelte. »Da widmest du dich wieder den wichtigen Dingen des Lebens. Il vino e l’amore.«
»Wenn man Penunze hat, dann geht es einem auf der ganzen Welt gut«, erwiderte er. »Hast du dir die abgerissenen Leute mal angesehen, die hier herumlaufen? Gegen die ist Zündholz-Ludwig vom Spittelmarkt ein reicher Mann.«
»Ich sagte doch, wir müssen bleiben. Du bist immer noch ein ungehobelter Stenz. Du hast das Prinzip der Grandezza noch nicht verstanden. Es braucht noch ein paar Wochen Vino und Amore, bis du endlich begreifst, was wichtig ist.«
»Der neue Wagen ist seit Langem bestellt«, maulte er. »Und schon bezahlt. Wenn ich Pech habe, nehmen diese Ganoven das schöne Ding wieder auseinander, wenn wir es nicht rechtzeitig abholen. Außerdem müssen wir über die Alpen, bevor die Pässe zuschneien.«
Auf Susannes Drängen hatte sich Franz schweren Herzens von seinem Bugatti Brescia getrennt. Ein steinreicher Schwede hatte ihm das Gefährt für einen guten Preis abgekauft. Es wurde leider enger auf den Berliner Straßen, ständig wurden neue Vorschriften erfunden. Franz vermisste die Zeiten, als er mit achtzig durch das Brandenburger Tor donnern konnte. Außerdem hatte er zwei Prozesse verloren, in denen ihm Nachbarn Ruhestörung vorgeworfen hatten. Dabei hatte er nur sichergehen wollen, dass der Sportwagen auch kurz nach Mitternacht noch ansprang. Schließlich hatte Susanne darauf bestanden, ein Automobil zu erwerben, dass eher tauglich für Ausfahrten zu zweit war. Sie hatte mehrere teure Hüte bei Fahrten im Bugatti eingebüßt. Und der Ölnebel ruinierte ihr immer wieder die Kleider. Also hatte sich Franz bei den deutschen Herstellern umgesehen. Aber nach Hausmannskost stand ihm nicht der Sinn. Mercedes fehlte es bisher an Esprit, und die Qualität ließ zu wünschen übrig. Für nächstes Jahr war zwar eine neue Baureihe angekündigt, aber so lange wollte Franz nicht warten. Also hatte er sich von Susanne ohne viel Widerstand zu der lang erträumten Neapel-Reise überreden lassen. Nicht ohne Hintergedanken allerdings, denn anfangs hatte er ihr verschwiegen, dass er zu diesem Zeitpunkt bereits mit einem Isotta Fraschini Tipo 8 A liebäugelte.
»Valentino fährt den gleichen Wagen.« Mit diesem Argument hatte er Susanne, die den Schauspieler beinahe vergötterte, schließlich herumgekriegt. Noch am selben Tag konnte er endlich den begehrten Wagen bestellen. Das Geld wollte er auf der Zugreise nach Süden selbstverständlich nicht mit sich herumschleppen, und italienische Banken hatten einen besonderen, nicht allzu guten Ruf. Also wählte er lieber ein Schweizer Geldinstitut, das dem Mailänder Automobilbauer diskret und sicher zwanzigtausend Rentenmark anwies.
»Sagtest du nicht, dass du hier nach Geschäftskontakten suchst?«, unternahm seine Lebensgefährtin wenig später einen erneuten Versuch, ihre geplante Abreise doch noch hinauszuzögern. Sie saßen auf der Dachterrasse ihres Hotels und genossen dieses seltsam bittere, rote Getränk. Der Blick über das Treiben der Stadt, die trotz vorgerückter Stunde zu pulsieren schien, war atemberaubend.
Italienisches Wetter in Berlin, dann wäre die Welt perfekt, dachte Franz und räkelte sich auf seiner Bank. Wieder einmal war ihm der Wein zu Kopf gestiegen. Aus irgendeinem Grund fiel das Träumen hier im Süden sehr viel leichter. Trotz des berüchtigten respiro di Napoli, des Atems der Stadt. Während ihrer Fahrt entlang der Amalfi-Küste hatte es nach Zitrusblüten geduftet. Hier jedoch stach einem selbst im fünften Stock der Geruch von Fisch und Müll in die Nase.
»In Mailand oder Rom wäre das möglich«, erwiderte Franz. »Dort gibt es viele Unternehmer. Mode, Möbel und Wein. Aber hier? Soll ich Fische nach Berlin liefern?«
»Da war doch diese Idee mit dem Casino.«
Tatsächlich hatte sich Franz vor zwei Wochen mit einem gewissen Franco Puccini getroffen, der sich von seinen Gefolgsleuten Re di Napule, König von Neapel, nennen ließ.
»Dieser Gockel in Pluderhose?«, fragte er belustigt. »Der Kerl würde mit seinem süßen Popo am Nollendorfplatz bei den interessierten Herren sicherlich ein Vermögen absahnen.« Er lachte und schenkte sich vom Fiano nach.
»Denk doch mal nach, Franz«, meinte Susanne in barschem Tonfall. Sie mochte es überhaupt nicht, wenn sie in geschäftlichen Fragen nicht ernst genommen wurde. »Die Leute beherrschen hier seit fünfzig Jahren das Glücksspiel. Erst war alles illegal, aber jetzt haben sie drei offiziell geführte Spielbetriebe. Sicherlich vernünftiger als deine Schnapsidee mit dem Kino.«
»Und? Sollen wir aus Berlin ein preußisches Baden-Baden machen und den verbliebenen reichen Russen ihr Geld abnehmen?«
»Amerikaner, du Holzkopf! Ich habe gelesen, dass allein im letzten Jahr über vierzigtausend steinreiche Touristen nach Berlin gekommen sind. Die Typen geben hundert Mark für eine Zigarre aus und verspielen an einem Abend zehntausend Dollar. Wir sollten versuchen, daran mitzuverdienen.«
»Diese Cowboy-Flitzpiepen können mir gestohlen bleiben.« Franz bemerkte, wie sich in der Magengegend ein ungutes Gefühl ausbreitete, wenn er an sein Zusammentreffen mit diesem US‑Gangster Dutch Schultz und dessen schießwütigen Kumpanen, die sich Regulatoren nannten, dachte. Aus der Nummer war das Syndicat erst vor einem Vierteljahr mit zwei blauen Augen und reichlich Miesen herausgekommen. Paul Konter vom Polizeipräsidium hatte ihm gerade einen Brief geschrieben und erklärt, dass es jetzt sogar eine »Abteilung für Organisierte Kriminalität« bei der Kripo gab. Berlin wurde von Rauschgift geradezu überschwemmt. Es hatte in nur drei Monaten sieben Tötungsdelikte gegeben, die man mit dem Opium- und Heroinhandel in Zusammenhang brachte. Ganz unschuldig war die Familie Sass an dieser Entwicklung nicht. Und es würde in Zukunft schwerer werden, auf klassische Art und Weise krumme Geschäfte zu machen.
»Es geht doch nur ums Geld«, meinte Susanne. »Ich habe mich mit Puccinis Frau getroffen. Bei caffè e liquore hat sie ein wenig geplaudert. Die Gute ist ziemlich ordinär, unser Zille hätte seine Freude an ihrem Mundwerk und Busen. Aber angeheitert war sie recht gesprächig. Und ihren kleinen König hat sie auf ihre Weise fest im Griff.«
»Du hast wat?« Franz sprang auf. Wie immer, wenn er sehr erregt war, glitt er ins Berlinern ab. Meist wurde er dann noch aufgebrachter.
»Beruhige dich. Von Frau zu Frau lässt sich vieles regeln. Der König von Neapel hat ein paar Geldsorgen. Allerdings auf hohem Niveau.«
»Sollen wir diesem abgerissenen Halunken auch noch Geld leihen?«
Susanne verdrehte die Augen. »Er hat zu viel Geld. Zu viel, nicht zu wenig.« Sie blickte ihn an und amüsierte sich darüber, als er vor Überraschung sein Weinglas randvoll goss. »Mit der Lira steht es wohl nicht zum Besten. Und Puccini sucht nach Möglichkeiten, sein Geld im Ausland zu waschen.«
»Ick kapier jar nüscht. Er will Geld waschen? Uffm Brett und ab inne Mangel?«
Susanne zog ein Blatt Papier aus ihrer Handtasche. Franz wunderte sich immer wieder, was Frauen alles in diesen kleinen Beuteln und Täschchen verstauten. Es musste etwas mit Magie zu tun haben, da war er sich sicher.
»Hier, ich habe alles aufgeschrieben und eine Skizze gemacht. Vielleicht verstehst du es ja, wenn du es gemalt siehst.« Sie zeigte auf mehrere Kreise und Pfeile. »Mit diesen Sachen verdient die Bella Società Riformata ihr Geld.« Um seiner Frage zuvorzukommen, hob sie die Hand. »Wir nennen unsere Firma Syndicat, sie heißen eben Schöne Reformierte Gesellschaft. Was ist dabei?«
»Ich dachte, du wolltest nur Urlaub machen.« Franz wirkte müde. Er fühlte sich oft vom Leben regelrecht überrumpelt und eingeengt. Vielleicht rührte seine Vorliebe für schnelle Automobile daher, dass er den Belastungen einfach entkommen wollte.
»Vor allem du hast Erholung gebraucht.« Sie lächelte ihn an. Ihre Züge hatten sich in den letzten Wochen deutlich entspannt. Zudem unterzog sie sich irgendeiner antiken Hautkur, die bereits die römischen Edeldamen genutzt hatten. Die Narben, die die abgeheilte Syphilis-Erkrankung in ihrem Gesicht hinterlassen hatte, waren kaum noch erkennbar.
»Müssen wir jetzt über das Geschäft sprechen?« Franz beugte sich nach vorn und schlürfte wenig anmutig aus dem randvoll gefüllten Weinglas, bis er sich wieder traute, es anzuheben.
»Natürlich, typisch!«, rief Susanne aufgebracht. »Wenn eine Idee nicht vom Hausherrn selbst kommt, ist er gleich beleidigt und will vom Thema ablenken. Wohin uns die tollen Männergeschäfte des Syndicats bringen, durften wir ja gerade erst erleben.«
Franz verspürte dieses Prickeln, das sich bei ihm nur in Gegenwart von Frauen einstellte, die ihm widersprachen. Seltsamerweise war es ein ähnliches Gefühl wie bei den Geldschränken, die er dann unbedingt knacken wollte. Er sah auf sein Weinglas, das er bereits schon wieder zur Hälfte geleert hatte.
Ich muss weniger trinken, beschloss er zum tausendsten Mal. Was half es, dass er zwar auf seinen geliebten Kognak verzichtete, dafür jedoch über Tag ein bis zwei Flaschen von diesem Traubensaft leerte? »Ich bin ganz Ohr«, gab er ein Friedensangebot ab.
Susanne erläuterte ihm, wie die Schöne Gesellschaft ihr Geld verdiente. Darunter Erpressung, Prostitution, Kreditwucher, manipulierte Wetten, Kartenspiel, Alkohol, Rauschgift. Alles klang nach einem klassischen Lehrbuch für Ganoven. Und somit durchaus vertraut. Aber sogar vor Auftragsmorden schreckten diese Leute nicht zurück. Hauptsache, es brachte Moneten.
»Die sind ja schlimmer als die Amerikaner!«, gab sich Franz etwas übertrieben entsetzt. Das Syndicat war gewiss kein Bibelverein. Aber immerhin hatten die Sass-Familie und die Teilhaber beschlossen, von gewissen Dingen die Finger zu lassen. Prostitution und Mord kamen für sie nicht infrage. Dass jeder Ringverein in Berlin seinen eigenen Ehrenkodex hatte, war nicht weiter ungewöhnlich. Adolf Leib handelte nicht mit Fleisch. Und Willi Meyer machte einen Bogen um den Geldverleih.
»Nicht weiter verwunderlich. Denn diese Burschen in Chicago und New York haben ihr Handwerk bei Männern wie Puccini gelernt«, sagte Susanne ungerührt. »Und viele Italiener sind in den letzten Jahrzehnten in die Staaten ausgewandert.« Sie klopfte mit dem Finger aufs Papier. »Puccini sitzt wohl auf fünf Millionen Lire. Und da der Staat pleite ist, wird ihm seit Kriegsende mächtig auf die Finger geschaut. Er kann das Geld in Italien nicht nutzen, sonst kommt ihm die Steuerpolizei auf die Schliche. Wie soll er erklären, dass seine Familie so viel Geld hat, wenn er nur eine Trattoria und ein paar Felder mit Olivenbäumen besitzt? Jetzt sucht er Partner, die das Geld für ihn investieren und es legal als Gewinn an ihn zurückzahlen. Damit wäre es dann sauber.«
»Gewaschen, jetzt verstehe ich.« Franz nickte. Als er von der hohen Summe hörte, hatte sich etwas in seinem Kopf geklärt. Als wäre ein Schalter umgelegt worden. Oder als hätte sich ein Nebel gelichtet. Die Lira verlor zwar durch Manipulationen am Goldstandard ständig an Wert, aber fünf Millionen waren dennoch etwa zwei Millionen neue Rentenmark. Franz entschied, dass es sich bei einer solchen Zahl lohnte, doch noch über Susannes Idee nachzudenken. Ein Teil seines Verstands blieb offenbar dauerhaft nüchtern.
˚˚˚
»Nicht Don«, meinte der Italiener nachsichtig. Er trug einen eleganten, dunkelblauen Nadelstreifen. In der Westentasche die obligatorische Taschenuhr. So sehr diese Männer im Alltag lärmten und um Aufmerksamkeit jeder Art buhlten, so sehr hielten sie sich mit dezenter Mode auch zurück. Franz war beeindruckt. Er selbst trug noch einen Anzug mit typischer Stundenglas-Silhouette, aber zurück in Berlin würde er dem Schneider sofort Anweisungen erteilen, sich die neuen Mailänder Schnitte zu besorgen. Er sah sich um. Die Villa an den Hängen der Amalfiküste war nach allen angelegten Maßstäben atemberaubend. Celio Romano, der Duca di Napoli, hatte sie auf den Fundamenten einer alten Kaiservilla aus der Zeit des Römischen Reichs errichten lassen. Und er lebte hier tatsächlich wie ein Herzog. Sein Sekretär hatte die Gäste vor dem Empfang herumgeführt und mehrmals auf antike Statuen verwiesen, die aus einer durch einen Vulkanausbruch zerstörten Stadt in der Nähe von Neapel stammten. Offenbar musste man dort nur ein wenig in der Erde graben und fand zweitausend Jahre alte Schätze.
»Ich bin Capofamiglia, der Erste unter Gleichen«, korrigierte Romano nochmals. »Aber nennen Sie mich bitte einfach Principe.«
Susanne und Franz hatten auf Vermittlung Puccinis eine Audienz bei Romano erhalten. Der Sekretär war nicht müde geworden, zu betonen, welche große Ehre dies für Fremde war. Franz hatte ein Buch über Süditalien gelesen und es deshalb bei der Begrüßung mit Don Romano versucht. Ein Reinfall im doppelten Sinn, wie sich herausstellte. Der Mann hieße Don, wenn er ein Oberhaupt der Cosa Nostra auf Sizilien gewesen wäre. Aber in der Gegend um Neapel herrschten Clans, die sich als gleichberechtigt sahen. Zudem lagen diese Leute in ständigem Streit mit den Gaunern aus dem südlichsten Süden. Einerlei. Von und zu. Herzog, Graf, Genosse. Italien hatte neuerdings sogar einen Duce an der Spitze. Bei diesen Dingen hielt es Franz mit Goethes Götz-Zitat. Nur durfte er hier keinesfalls zeigen, wohin sich diese Leute ihre Titelei stecken konnten.
»Ihr Sekretär sagte, er hätte Sie über unser Anliegen in Kenntnis gesetzt?«, fragte Susanne. »Wir möchten Ihre Zeit nicht über Gebühr beanspruchen, Principe.«
Franz war immer wieder erstaunt, wie wandelbar die weiblichen Mitglieder des Syndicats doch waren. Seine Lebensgefährtin kam aus einfachsten Verhältnissen. Gleiches galt für seine Tante Toni. Dennoch konnten sie sich schlafwandlerisch sicher in allen Lebenslagen souverän behaupten. Romano lächelte und deutete ihr gegenüber eine Verbeugung an.
»Ihre Familie kennt sich in Berlin mit dem Glücksspiel aus?« Ihr Gastgeber streichelte eine Katze, die nur aus silbrig glänzendem Fell zu bestehen schien.
»Sehr richtig, Herr Ro … Principe«, antwortete Franz. »Zeitweise hatten wir die Aufsicht über die vier bedeutenden Rennplätze der Stadt.« Er entschied, die Eigenart der Italiener, bei allem zu übertreiben, einfach zu übernehmen. »Ein Teilhaber hat ein eigenes Wettsystem ausgeklügelt.« Dass Max Klante mittlerweile im Knast saß, musste er Romano nicht auf die Nase binden. »Dazu noch Würfel- und Kartenspiel, das an kleinen, aber feinen Orten ausgetragen wird.« Unter anderem rund um den schmuddeligen Nollendorfplatz und am Spittelmarkt. Aber auch solche Einzelheiten würden den Mann nur verwirren.
»Nun, wenn ihr im Geschäft seid, weshalb dann das Interesse an einer Zusammenarbeit?«
»Waren Sie schon einmal in Baden-Baden, Herr Romano?« Susanne hatte offenbar entschieden, sich an dem Titel-Gehabe nicht mehr zu beteiligen. »Ein ganz nobler Ort. Dort spielen die Herrschaften in Casinos, und es geht dabei um tägliche Einnahmen in Höhe von Zehntausenden Mark. Alles mit staatlicher Genehmigung.«