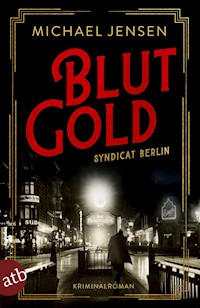9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Brüder Sass
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2022
Kriminelle Geschäfte.
Unruhige Zeiten in Deutschland, doch die Sass-Brüder haben sich mit ihrem Syndicat nicht nur in der Unterwelt einen Namen gemacht. Sie handeln mit allem: Schnaps, Autos – und Waffen. Durch einen irischen Mittelsmann beliefert das Syndicat sogar die IRA. Dann jedoch wird 1922 der deutsche Außenminister Walter Rathenau erschossen, und eine Spur führt auch zum Syndicat. Für Franz Sass wird die Sache allmählich zu heiß. Wenig später steht er selbst unter Mordverdacht ...
Spannend und zugleich höchst unterhaltsam: ein Blick in die zwanziger Jahre, so wie man ihn noch nie gesehen hat. Nach wahren Begebenheiten erzählt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 600
Ähnliche
Über das Buch
Die Sass-Brüder versuchen, sich in Berlin zu etablieren. Besonders Franz Sass geht keinem guten Geschäft aus dem Weg. Doch die Kontakte, die sein Freund und Partner Ian McCullen nach Irland pflegt, sind ihm suspekt. Es geht um Waffen, die ein im Weltkrieg verdienter Flieger mit Namen Hermann Göring der IRA überbringt. Dann scheinen auch in Berlin die Dinge aus dem Ruder zu laufen. Nicht nur, dass rechtsradikale Kreise um Hermann Ehrhardt, der an etlichen Putschversuchen beteiligt war, das Syndicat ins Visier nehmen. Nach dem Mord an den deutschen Außenminister Rathenau interessiert sich auch die Polizei verstärkt für Franz Sass und seine Brüder.
Über Michael Jensen
Michael Jensen wurde im Norden Schleswig-Holsteins geboren. Im Hauptberuf ist er als Arzt tätig und interessierte sich früh für jüngere deutsche Geschihcte und deren Folgen für die Nachkriegsgeneration. Für sein literarisches Schreiben hat er ein Pseudonym gewählt. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg und im Kreis Schleswig-Holstein. Bisher ist ein Roman über die Sass-Brüder erschienen: »Blutige Stille«.
Im Aufbau Taschenbuch sind außerdem seine Kriminalromane »Totenland«, »Totenwelt« und »Totenreich« lieferbar.
Mehr zum Autor unter www.autor-jensen.de.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Michael Jensen
Blutige Stille
Syndicat Berlin
Kriminalroman
Übersicht
Cover
Titel
Inhaltsverzeichnis
Impressum
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Motto
Prolog — Dublin, November 1920
I Berlin 1921
Kapitel 1 — Berlin – Friedrichshain, August 1921
Kapitel 2 — Berlin – Luisenstadt, Ende August 2021
Kapitel 3 — Berlin – Pariser Platz
Kapitel 4 — Berlin – Luisenstadt, Anfang September 1921
Kapitel 5 — Berlin – Potsdamer Bahnhof
Kapitel 6 — Berlin – Wilmersdorf, September 1921
Kapitel 7 — Berlin – Klinikum Charité, Oktober 1921
Kapitel 8 — Berlin-Westend
II Berlin 1922
Kapitel 1 — Berlin – Alt-Kölln, Januar 1922
Kapitel 2 — Berlin – Friedrichshain, Ende Januar 1922
Kapitel 3 — Berlin – Neuer Westen
Kapitel 4 — Berlin – Mariannenplatz
Kapitel 5 — Saatwinkel, nördlich vom Hohenzollern-Kanal
Kapitel 6 — Berlin – Hamburger Bahnhof
Kapitel 7 — Berlin – Nollendorfkiez
Kapitel 8 — Hamburg – St. Pauli, März 1922
Kapitel 9 — Lychen, Brandenburg
Kapitel 10 — Hamburg – St. Pauli
Kapitel 11 — Berlin – Mitte, April 1922
Kapitel 12 — Berlin – Neukölln
Kapitel 13 — Berlin – Alexanderplatz, Mitte April 1922
Kapitel 14 — Berlin – Spandauer Vorstadt
Kapitel 15 — Berlin – Charlottenburg, Mai 1922
Kapitel 16 — Berlin – Alexanderplatz
Kapitel 17 — Berlin – Neuer Westen
Kapitel 18 — Berlin – Mitte
Kapitel 19 — Berlin – Luisenstadt
Kapitel 20 — Berlin – Schöneberg
Kapitel 21 — Berlin – Friedenau, Anfang Juni 1922
Kapitel 22 — Stolpe bei Berlin, 23. Juni 1922
Kapitel 23 — Berlin – Wittenbergplatz
Kapitel 24 — Berlin – Mitte, 24. Juni 1922
Kapitel 25 — Berlin – Gefängnis Moabit
Kapitel 26 — Berlin – Wilhelmstraße
Kapitel 27 — Berlin – Luisenstadt, 18. Juli 1922
Kapitel 28 — Berlin – Charlottenburg, August 1922
Kapitel 29 — Nowawes bei Berlin
Kapitel 30 — Berlin – Luisenstadt, September 1922
Kapitel 31 — Berlin – Alexanderplatz, November 1922
III Berlin 1923
Kapitel 1 — Berlin, Moabit / Dorotheenstadt, 5. Januar 1923
Kapitel 2 — Berlin – Schöneberg, Februar 1923
Kapitel 3 — Berlin – Charlottenburg
Impressum
Wer von diesem Kriminalroman begeistert ist, liest auch ...
Nach wahren historischen Begebenheiten. Einige Namen, Ereignisse und Schauplätze sind aus dramaturgischen Gründen fiktiv.
Ich habe begriffen, dass es reicht,
wenn man mit den Menschen zusammen ist, die man mag.
(Walt Whitman, 1819–1892)
Prolog
Dublin, November 1920
»Der Mann hat Mut, das muss man ihm lassen«, meinte Patrick O’Neill. »Stockholm, Riga, Hamburg, Dublin. Sein Arsch muss doch völlig durchgesessen sein.«
»Göring ist ein Fliegerass aus dem Krieg«, bestätigte Ian McCullen und kaute weiter an seiner Hartwurst. »Mit der Fokker tanzt er Walzer in der Luft und schießt dir die Eier aus hundert Metern weg.«
Man merkte ihm an, dass er sich pudelwohl fühlte. Er war zu Hause. Heimat. Es schien für ihn mehr ein Gefühl als ein Ort zu sein. Vor einigen Tagen war er aus den Mooren um Dubhais, westlich von Belfast zurückgekehrt. Irische Luft atmete man nicht nur, man schmeckte sie, trank sie, nahm sie mit dem ganzen Körper in sich auf. Trotz des grauen Himmels und des beständigen Nieselregens, der seit Tagen Boden und Kleidung durchweichte, ließ McCullen seinen Blick über die weiten Felder schweifen, auf denen noch ein Rest des satten, spätsommerlichen Grüns zu erahnen war.
Éire, mo chroi. Tá mé sa bhaile áit ar bith eile, ging es ihm zum wiederholten Mal durch den Kopf. Irland, mein Herz. Nirgendwo anders bin ich zu Haus.
»Eigentlich keine schlechte Idee«, unterbrach O’Neill die Träumereien seines Schulfreunds aus früheren Tagen. »Wir könnten doch diese deutschen Bastarde einfach hier weiter beschäftigen. Sie mögen den Krieg, wir brauchen ihn. Sollen sie doch Collins und sein katholisches Dreckspack ordentlich eindecken.«
Ian verspürte bei diesen Worten einen Stich im Herzen, aber er ließ sich nichts anmerken.
»Der Feind meines Feindes ist mein Freund? Meinst du das?«, fragte er stattdessen. Er nickte, als wollte er bestätigen, dass er die Sache ebenso sah. »Alle wollen die Waffen haben, die die Preußen nach den Friedensverträgen nicht behalten dürfen«, fuhr er fort. »Aber im Moment sieht es eher so aus, als ob Collins und die IRA den Zuschlag bekommen, Patrick. Die Regierung in London ist einfach zu langsam, zu weich. Und vor allem zu geizig.«
O’Neills Verbindungsmann aus England hatte ihnen unlängst mitgeteilt, dass man kein Geld für illegale Waffenkäufe bereitstellen wollte. Für Waffen, die die Deutschen laut den Bedingungen des Versailler Vertrags ohnehin abgeben mussten, wollten diese kurzsichtigen Politiker nicht einen Penny bezahlen. Eine verhängnisvolle Entscheidung, da waren sich O’Neill und McCullen einig gewesen.
»Woher hat Collins überhaupt das Geld, um die Deutschen zu bezahlen?«, fragte O’Neill. »Da geht es doch um weit mehr als hunderttausend Pfund Sterling.«
»Bankraub, Überfälle auf englische Ländereien, Erpressung«, erwiderte McCullen und grinste. »Alles, was wir Iren eben für legal und unser Geburtsrecht halten.«
»Du verwechselst das mit den Schotten, mein Lieber. Du bist außerdem nur halber Ire. Wir von der Insel sind vollkommen ehrliche Leute.«
Jetzt lachten beide, packten – wie zur Bestätigung eines alten Blutbunds – ihre rechten Unterarme und schlugen sich mit der Linken auf die Schultern.
»Michael Collins hat zudem ein paar wichtige Freunde in den Staaten«, sagte Ian McCullen. »Viele irische Hungerleider sind da drüben zu Reichtum gekommen und unterstützen jetzt die alte Heimat. Außerdem nimmt man den Limeys dort immer noch krumm, dass die Vereinigten Staaten mal eine Kolonie des Empire waren.«
»Wie viel transportiert dieser Göring in seiner Maschine bei einem Flug? Die Dinger sind nicht gerade riesig.«
»Zuladung nur etwa 550 Pfund«, bestätigte McCullen. »Ein paar Kisten Sprengstoff, Granaten und Gewehre. Wir bräuchten zehn Teufelskerle wie ihn. Und das jede Woche.«
»Collins will an die großen Sachen ran«, mischte sich jetzt Lieutenant Colonel Walter Wilson ein, der seit einem Jahr die Cairo Gang befehligte. »Deutsche MGs, kleine Haubitzen und sogar Panzerwagen. Aber da müsste Göring schon mit einem Zeppelin kommen. Andererseits müssen wir sie bei Laune halten, sonst kommen wir nie an die großen Fische ran. Für Kleinkram wagen sich die Führungsleute der IRA nicht aus der Deckung.«
Die Cairo Gang trug offiziell eigentlich die Bezeichnung Dublin District Special Branch und war ein Teil des britischen Nachrichtendienstes. Sie bestand aus knallharten Kerlen, die sich während des Kriegs im Nahen Osten kennengelernt und so ihren Spitznamen erhalten hatten. Die DDSB war ein Haufen Söldner, der mehr der Fremdenlegion als regulären Einheiten glich. Die Männer wussten, dass sie für zwielichtige Ränkespiele benutzt wurden, dass sie im Zweifelsfall entbehrlich waren und dass man in der englischen Hauptstadt leugnen würde, überhaupt von ihnen gewusst zu haben. Und dafür ließen sie sich fürstlich bezahlen. Ian McCullen war zwar als Lieutenant der Royal Marines erst ein Jahr vor Kriegsende zu der Gruppe gestoßen, hatte sich jedoch durch seinen Einfallsreichtum und seine Risikobereitschaft schnell zu einem festen Bestandteil in der Einheit emporgearbeitet. Als Sohn eines schottischen Einwanderers und einer Irin aus Belfast war McCullen den Verantwortlichen in London dann auch sofort als eine perfekte Ergänzung der Spezialeinheit erschienen. Sein Fachgebiet war die Gegner-Infiltration, die verdeckte Arbeit in Feindesland. Der Halbire spionierte bei den Aufständischen um Michael Collins und galt als besonders glaubwürdig, denn er sprach das Gaedhilge, die alte irische Sprache, fließend und war von einer beinahe missionarisch anmutenden Liebe zu seiner Heimat beseelt. Dass ihn Collins bei ihrer ersten Begegnung sofort durchschaut und dann für seine Bewegung begeistert und somit umgedreht hatte, stand auf einem anderen Blatt. Und es machte die Sache nicht eben einfacher. Bereits mehrfach hatte sich McCullen im Spiegel betrachtet und gefragt, wer er eigentlich war, was er war. Ein Verräter, der die Verräter verriet? Die Wahrheit war in der irischen Frage bereits derart oft verbogen worden, dass vielen die Lüge als eine ehrliche Alternative schien.
»Also, noch einmal«, sagte Wilson jetzt und zog sein Notizbuch hervor. »Dank Ian wissen wir, dass es in allen größeren, deutschen Städten Truppenteile gibt, die sich der Befehlsgewalt der Regierung entziehen. Allein in Berlin sitzen sie auf riesigen Waffenbeständen, zum Teil unbenutzte und neuartige Entwicklungen. Teile davon wurden für Einsätze im Baltikum, in Schlesien und im Ruhrgebiet gebraucht. Der große Rest wartet auf Käufer. Die Türken sind ganz wild darauf, die Sinn Féin und IRA haben Interesse angemeldet, die Araber ebenfalls, und sogar in Indien will man deutsche Gewehre. Unsere Geheimdienste haben dem Minister geraten, den Kerlen einfach den besten Preis zu bieten. Schließlich könnte man das auf die Reparationen anrechnen. Und dann wären die Waffen vom Markt. Aber nein, die alten Knochen im Parlament bestehen darauf, dass die Arsenale beschlagnahmt werden. Ohne Gegenleistung. Das finden die Fritze wiederum gar nicht witzig.«
»Mein alter Herr pflegte zu sagen, dass Politik nichts anderes ist als Sandkastengerangel«, meinte O’Neill. »Nur dass sich dort greise Männer streiten, keine Kinder.«
»Also bleibt nur die Variante mit dem meisten Ärger und Blutvergießen«, warf McCullen ein. »Es wird Tote geben, wenn Collins an die Waffen kommt.«
»Leider wahr.« Wilson nickte. »Wie wir wissen, ist London derzeit nicht an einer Deeskalation in der irischen Frage interessiert. Im Gegenteil, je schlimmer die Burschen es treiben, desto härter kann das Königreich zurückschlagen.«
»Nicht die feine englische Art«, sagte O’Neill. »Aber dafür gibt es ja uns! Ohne die Cairo Gang stünde das Empire hier doch schon mit dem Rücken zur Wand!«
Er war ebenfalls gebürtiger Ire. Nachdem seine Familie vor fünf Jahren durch einen Bombenanschlag der Freiheitskämpfer, der Irish Republic Army, ums Leben gekommen war, hatte er sich der britischen Spezialeinheit angeschlossen.
»Genau so lenkt man eine Weltmacht«, fuhr er in verbittertem Tonfall fort. »Zwietracht säen unter den Einheimischen. Dann als Retter eingreifen und die Ernte einfahren.«
Unentschlossenes Gemurmel. Diese Männer waren Elitesoldaten. Krieger, keine Politiker. Auch wenn jeder hier im Raum die irischen Unabhängigkeitsbestrebungen zu hassen schien, so wussten doch alle, dass es viele unschuldige Leben kosten würde, die Interessen des britischen Königreichs auf diese Weise durchzusetzen. Der Rebellenführer Michael Collins sollte also Geld aus Amerika und Waffen aus Deutschland erhalten. Dann würde der britische Premierminister vor dem Parlament in unnachahmlich bigotter Betroffenheit erklären, dass man ein solches Vorhaben nicht dulden könnte und leider mit ganzer Härte zurückschlagen müsste.
»Ich habe Kontakt zu Berliner Ganoven aufgebaut, die durch Zufall eine Wagenladung Waffen abgestaubt haben«, meinte McCullen. »Nicht viel, aber genug um als Lockmittel das Interesse der Aufständischen zu wecken und sie bei Laune zu halten.«
Er ging in den Zwischenflur des verlassenen Dubliner Kaufmannshauses, in dem sie sich in dieser Woche trafen, und kam mit einem kleinen Koffer zurück, den er neben sich unter den Küchentisch stellte. In der Hand hielt er ein Blatt Papier.
»Ich habe hier eine Aufstellung. Wir sollten Ihnen das Zeug abkaufen. Erstens gerät es dann nicht in falsche Hände. Und zweitens haben wir einen Überblick hinsichtlich des Angebots, das auf dem Markt ist. Gute Waffen. Ich habe das geprüft. Sie sollten eigentlich an die Weißen, die Gegenrevolutionäre in Russland gehen, aber durch ein Versehen ist eine Ladung in Berlin geblieben. Der Kram liegt jetzt in einer alten Kutschhalle am Stadtrand. Vielleicht können wir einiges später sogar selbst brauchen oder als Köder benutzen. Wie gesagt, es ist nicht sonderlich viel. Aber wenn wir Collins’ Männern weismachen, dass wir zehn oder zwanzig Ladungen davon haben, beißen sie vielleicht an.«
»Gute Idee«, sagte Wilson und betrachtete die Liste. »Waffen bauen können sie, die Deutschen«, murmelte er. Er sah sich um. »Sind jetzt alle da?«, fragte er schließlich.
Neun ehemalige Offiziere der British Army saßen kurz darauf in der Wohnküche der Hausmeisterwohnung, die im hinteren Teil des Kaufhauses lag. Die Einsatzbesprechung war wichtig. O’Neill hatte Informationen über das Versteck von Michael Collins erhalten. Und vom Kriegsminister in London war der Befehl gekommen, den Mann zu liquidieren. Dadurch würde die irische Bewegung gespalten werden. Collins war maßgeblich für die irischen Forderungen nach Unabhängigkeit und die Unruhen der letzten Zeit verantwortlich. Der inoffizielle Krieg dauerte nun bald zwei Jahre. Und die Lords des Oberhauses redeten nur, zauderten, wirkten müde nach dem großen Weltkrieg. Collins besaß Kontakte zur Sinn Féin und IRA, den politischen und militärischen Armen der irischen Bewegung. Und er war eine Symbolfigur des Aufbegehrens gegen die Fremdherrschaft. Ohne ihn würde der Widerstand entweder schnell zusammenbrechen, oder die Burschen würden anfangen, sich selbst zu bekämpfen. Besser konnte es für Britannien eigentlich nicht laufen.
»Ich hole Connor, Peter und Shorty«, meinte McCullen. »Muss sowieso noch mal pissen.«
Er sah auf die Uhr und ging nach hinten. Der Abort lag zum Garten hinaus. Die drei Kameraden waren Kettenraucher und standen auf der kleinen Terrasse. Sie hatten ihn nicht bemerkt. Er zog seinen Webley VI aus dem hinteren Hosenbund. Beinahe im selben Moment zerbarst der vordere Teil des Hauses in einer mächtigen Explosion. Obwohl McCullen davon nicht überrascht wurde, warf ihn die Druckwelle fast um. Peter und der Mann, den alle Shorty nannten, wurden von Glassplittern getroffen und fielen, als hätte sie ein Faust getroffen. Nur Connor Douglas konnte sich wegdrehen und ging in die Hocke.
»Was zum Teufel …?«
Weiter kam er nicht, als er sich wieder aufgerichtet hatte und verwirrt umsah. McCullen schoss ihm direkt ins Gesicht. Peter Dembley schien nicht bemerkt zu haben, was geschehen war, und betastete seine blutende Wange. Ein Schuss traf ihn in den Hinterkopf. Eine Exekution.
»You bloody bastard!«, schrie Shorty, ein kleiner, aber sehr kräftiger Frontkämpfer.
Obwohl ein Auge durch Glassplitter verletzt war, stürzte er sich sofort auf seinen Widersacher. Der Schuss aus McCullens Revolver verfehlte ihn. Er warf sich breitbeinig auf ihn und drückte die Schusshand mit einem Knie zu Boden, so dass sein Gegner unmöglich noch einmal die Waffe heben konnte. Shorty Philisters Pranken waren wie Schraubstöcke am Hals des Halbiren. Ian bekam fast augenblicklich keine Luft mehr. Er wusste, dass Philister kräftig genug war, um ihm den Kehlkopf zu zerquetschen. Mit größter Anstrengung konnte er mit der linken Hand den Druck etwas lindern. Er schnappte nach Luft. Blut und Gewebereste tropften ihm ins Gesicht. Shortys verletztes Auge war nur noch Brei. Und aus dem anderen funkelte ihm mörderischer Hass entgegen. McCullens Sinne schwanden. Er hörte Schüsse aus dem Haus. Vielleicht hatte jemand die Sprengbombe doch überlebt, dann war ohnehin alles aus. Plötzlich ein Schuss ganz in der Nähe. Heißes Rot schoss als Fontäne über Ians Hals. Kurz schien Philisters Druck sogar noch zuzunehmen, dann brach der Mann über ihm zusammen.
»Danken kannst du mir später, Nathair.«
Nathair, Schlange. McCullen wollte etwas erwidern, brachte jedoch nur ein Röcheln zustande. Er erkannte Eoin O’Duffy, einen Anführer der IRA, der offenbar den rettenden Schuss abgegeben hatte. Der Kerl war Ian etwa so sympathisch wie ein Hundehaufen, aber diese Einschätzung beruhte wohl auf Gegenseitigkeit. Denn O’Duffy spuckte jetzt direkt vor ihm aus. Nur wenige wussten von Ians Vereinbarung mit Collins, und O’Duffy gehörte nicht dazu. In den Augen des IRA-Kämpfers war er nur ein Verräter seiner eigenen, englischen Kameraden. Wahrscheinlich nahm O’Duffy an, dass Ian sich hatte kaufen lassen. Wie so viele andere. Also durfte er in Zukunft nicht wählerisch sein, was Gesellschaft anging. In den Augen der meisten Briten war er fortan ein Gejagter, ein Ausgestoßener, ein Enemy of the Empire.
Und auch die eigenen Landsleute würden ihn misstrauisch beäugen. Jeder wusste, wer sich zu oft um sich selbst drehte, dem wurde irgendwann schwindlig. Und der vergaß dann oft, wohin er eigentlich gehörte.
Ian ließ sich zurücksinken auf die kalten Steine. Er spürte das warme Blut des Toten in Nacken und Achseln sickern. Eine Rechnung war beglichen worden. Seine persönliche Rechnung an die britische Krone. Hatten die Engländer wirklich geglaubt, er hätte vergessen, woher er stammte? Hatten sie gedacht, er könnte ihnen jemals den Tod seiner Schwester vergeben? McCullen betrachtete die Verwüstungen, die der von ihm gelegte Sprengsatz angerichtet hatte. Ein solches Chaos herrschte in vielen Seelen Irlands. Und in seiner eigenen. Irgendwo in den Trümmern lag sein ehemaliger Freund O’Neill. Wie weit war ein Mann, der hasste, bereit zu gehen? Nun kannte England die Antwort.
Seltsam, wie sehr Patrick und ich uns ähnelten, dachte Ian und hielt einen Moment inne. Der eine verliert Angehörige durch die Anschläge der neuen IRA, der andere durch die Vergeltungsmaßnahmen der alten Besatzer. Alle sind wir in Blut geboren und durch Blut gewatet. Und in diesem verdammten Krieg werden wir allesamt darin sterben.
Auge um Auge hieß es im Alten Testament. Die Briten hatte die Entscheidung, Ian in ihren Reihen aufzunehmen, heute viele gute Männer gekostet. Aber die Rache schmeckte schal, denn dieses Blut würde für immer an ihm kleben bleiben. Rache und Verrat vergifteten die Seele eines Menschen, deformierten das Gute in ihm, bis es schließlich unkenntlich wurde. O’Duffy hatte ausgesprochen, was Ian fortan war: eine Schlange. Wer traute einem Verräter, den der Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge nicht mehr interessierte? Welcher Freund würde sich je wieder auf einen Mann wie Ian McCullen verlassen können?
Erst jetzt, da die grausige Tat getan war, konnte er einen letzten Blick auf den Jungen werfen, der er vor vielen Jahren einmal gewesen war. Und es schien, als wollte sich dieser Junge von ihm verabschieden. Der Teil in ihm, der die Felder, den Himmel, die Seen Irlands so liebte. Und der Teil, der die schottischen Highlands durchstreift, die schroffsten Felshänge erklommen hatte. Er ahnte, dass das Bild nun verblassen würde. Der Schmerz, die Wunden, die Schuld und die Trauer würden es in Zukunft verdecken. Wie Tücher einen Leichnam bedeckten. Seine letzte Zuversicht, Frieden zu finden, war heute gestorben, das spürte Ian nun überdeutlich. Da konnte er noch ein wenig hier auf dem kalten Boden liegen bleiben. Denn für ihn gab es in einer Welt ohne Hoffnung keinen Grund mehr zur Eile.
I Berlin 1921
1
Berlin – Friedrichshain, August 1921
In der Wohnung roch es unangenehm. Es war eher eine Kammer, eines der Löcher, in denen rund um den Schlesischen Bahnhof viele Leute hausten. Küche mit Schlafgelegenheit. Wer hier angekommen war, hatte es – auf dem Weg nach unten – fast geschafft. Viel tiefer ging es kaum noch.
Ratten, ging es Paul Konter durch den Kopf, als er sich umsah. Bereits im Treppenhaus war ihm aufgefallen, dass diese ausgemergelten Menschen den Nagern auffällig ähnelten. Die Nasen übermäßig spitz nach vorn gerichtet, schienen sie stets zu schnuppern. Nach Essbarem und allerlei anderen Gelegenheiten. Die Augen immer wachsam, das Gehör geschult, sofort alles Verdächtige und Bedrohliche wahrzunehmen, huschten sie aus ihren Bauten, über die Treppen. Um bei der kleinsten Erschütterung ihrer engen Welt sofort wieder darin zu verschwinden. Paul Konter zwang sich, den Gedanken abzuschütteln. Er mochte diese Vergleiche nicht, die vor allem in konservativen Zeitungen immer wieder bemüht wurden. Menschen waren keine Ratten. Er kam selbst aus einer bettelarmen Familie. Seine Eltern waren Gelegenheitsarbeiter gewesen, die mit ihren Kindern übers Land gezogen waren. Nur Glück und der Segen eines Mentors hatten ihm den Aufstieg ins mittlere Beamtentum ermöglicht. Er hatte als junger Mann gute Chancen gehabt, so zu enden wie die Bewohner dieser überteuerten Stadthöhlen.
»Was tun wir hier?«, fragte er seinen Kollegen Gennat.
Kommissar Ernst Gennat war Konters großes Vorbild. Obwohl er fast zwanzig Jahre älter als der Leiter der Mordbereitschaft war, bewunderte er den Mann für seine kriminalistische Begabung und Zielstrebigkeit. Gennat war mit einem nach seinen Vorschlägen umgebauten Polizeiwagen vorgefahren. Wer das dunkle Fahrzeug sah, konnte vermuten, der kleine Transporter wäre nur hergerichtet, um die drei Zentner des Leiters der Mordabteilung samt dessen kugelrunder Statur zu fassen. Jedoch befand sich darin alles, was ein Kriminalbeamter brauchte, um einen Tatort zu untersuchen. Fotoapparate, Behältnisse für Beweismittel, Maßbänder, Handschuhe, verschiedenes Zeichenmaterial, um Skizzen anzufertigen. Unwissende, die in den schwarzen Adler Standard blickten, mochten denken, es handelte sich um das makabre Krankenmobil eines fahrenden Baders, der Hühneraugen schnitt. Oder aber um die besondere Dienstleistung eines findigen Bestatters, der gleich vor Ort seine Kunden verschönern wollte. In Wahrheit war es die Erfindung eines Künstlers im Geiste. Eines Analytikers und Virtuosen der Kriminalarbeit. Berlin tuschelte bereits und nannte das Fahrzeug respektvoll das Mordauto.
Paul Konter hatte den Anruf von Gennats Sekretärin erst vor vierzig Minuten erhalten, als er am Alex über einigen Akten brütete. Er war Mitarbeiter der Politischen Abteilung der Kripo und meistens mit eher langweiligen Fällen betraut. Nun jedoch hatte man ihn zu einem Tatort gebeten. Die Fassade sämtlicher Häuser in der Langen Straße waren rußgeschwärzt, düster, bedrückend. Die Gegend um den Andreasplatz hatte einen schlechten Ruf. Ein Kollege hatte herausgefunden, dass in der nahen Umgebung siebenundvierzig Tötungsdelikte in zehn Jahren verübt worden waren. Selbst Polizisten trauten sich nach Einbruch der Dämmerung nur zu zweit hierher. Konter war in den vierten Stock des Hauses Nummer 88 geeilt.
Und dort hatte ihn Gennat lediglich aufgefordert, sich die Wohnung anzusehen.
»Schauen Sie sich um, Herr Kollege«, hatte er gesagt. »Nehmen Sie sich die Zeit, die Sie brauchen.«
Er muss schon eine Stunde früher hier gewesen sein, dachte Konter jetzt, als er den beleibten Kollegen still im Türrahmen der Wohnkammer stehen sah. Jede Anstrengung führte bei dem übergewichtigen Kriminalisten zu einem minutenlangen Schnaufen, aber der Mann stand seelenruhig da und betrachtete den Ort des Grauens. Konter ahnte sofort, worum es hier ging. Seit Monaten wurden im Engelbecken und im Luisenstädtischen Kanal Leichenteile von jungen Frauen gefunden. Ernst Gennat, dessen neue Methoden in den Führungsetagen der Polizei auf Ablehnung stießen, stand mächtig unter Druck. Wenn er den oder die Mörder nicht bald fasste, dann würde er sich nicht viel länger auf seinem Sessel halten können.
»Zwölf Menschen«, sagte er unvermittelt. »Wahrscheinlich handelt es sich ebenfalls nur um Frauen. Wir haben Zähne und Knochen in der Asche des Ofens gefunden. Und Stoffreste. Dazu ein paar Schnallenschuhe und weibliche Unterkleidung, die von dem Mann aufs Widerwärtigste beschmutzt wurde.«
»Zwölf?«, entfuhr es Konter. »Hat er also endlich gestanden?«
Gennat schüttelte den Kopf.
»Ein ebenso lehrreicher wie krankhafter Kasus«, sagte er. »Großmann ist dumm und schlau zugleich. Er entzieht sich der freundschaftlichen Befragungsmethode ebenso wie dem Ausüben von Druck. Mal droht er und wird laut. Dann wimmert und bettelt er wie ein vernachlässigtes Kind.«
»Großmann? Der Name des Täters?«, fragte Konter.
»Er wurde auf frischer Tat gestellt«, sagte Gennat und nickte. »Schon gestern Abend. Ich habe ihn persönlich vernommen und bin jetzt bereits das dritte Mal hier. Da wird er sich nicht herausreden können.«
Konter fand, dass der Gestank in dem Raum eher zunahm. Es gab Gerüche, an die sich die Nase gewöhnte. Man kam in eine Kneipe, und der Mief nach Brutzelfett, Bier und Schweiß trieb einem die Tränen in die Augen. Nach zwei Minuten hatte man sich vertraut gemacht und zur Reihe der Ausdünster gesellt. Hier jedoch war es anders.
Tierisch, dachte Konter und erinnerte sich an eine frühere Ermittlung auf dem zentralen Schlacht- und Viehhof in Lichtenberg. Tagelang hatte er dort Arbeiter befragt und die Abläufe beobachtet. Käme er selbst jemals in die Not, einen Leichnam beseitigen zu müssen, er würde die »Mühle« nehmen, einen riesigen Fleischwolf, an dessen Ende nur noch Brei zur Wurstherstellung herauskam. Während der gesamten Zeit hatte er sich nicht an den Gestank gewöhnt. Süßlich-herb, dazu eine drüsige Note wie von brünstigen Keilern, Tierschweiß und das Metallische von Blut. Und genau so roch es hier. Ihn schauderte. Großmanns Wohnung war ein Schlachthaus.
»Er behauptet, mit einem anderen Kerl hier gewohnt zu haben«, fuhr Gennat fort. »Er sagt, dieser Mann wäre für alles verantwortlich. Er selbst habe seit der Sache in Bayreuth nie wieder ein Mädchen angefasst.«
Paul Konter las den kurzen Bericht, den der Kollege ihm in die Hand gedrückt hatte. Carl Großmann war vor acht Jahren aus langer Haft entlassen worden. Er hatte in Süddeutschland zwei Kinder brutal geschändet, eine Vierjährige war später an ihren Verletzungen gestorben. Vierzehn Jahre Zuchthaus. Also nicht gerade ein Mann, dem man Ammenmärchen abkaufte.
»Sie halten die Aussage für eine Schutzbehauptung?«, fragte er. »Er will wahrscheinlich nur von sich ablenken.«
»Es ist egal, wofür ich es halte«, erwiderte der beleibte Mann. »Am Ende zählt nur, was wahr ist.«
»Also, was kann ich für Sie tun, Kollege Gennat?«, wollte Konter wissen.
Nicht nur der Leiter der Mordbereitschaft war deutlich jünger als er, fast alle Kollegen auf dem Polizeipräsidium waren das. Vielleicht abgesehen vom Faktotum, das noch alle drei Kaiser kannte. Paul Konter hatte sich mit Anfang vierzig entschieden, seinen sicheren Posten als Leitender Gendarm einer Berliner Wache gegen das Haifischbecken im Präsidium zu tauschen. Kriminalpolizei, seine späte Berufung, für die er noch einmal von vorn beginnen musste. Und jetzt wollte er unbedingt in Gennats Abteilung. Stattdessen war er jedoch auf eine Art Springerposten der Politischen Polizei beordert worden. Mal hier, mal da eingesetzt, war er mittlerweile nur noch unzufrieden. Viele Kollegen belächelten seine Beharrlichkeit.
»Ich möchte, dass Sie sich den Tatort ansehen, Konter. Sehen Sie hin, lauschen Sie, nehmen Sie die Gerüche wahr. Sie müssen das Ganze hier in sich aufsaugen. Prägen Sie sich das Gefühl ein, damit es so lange in Ihnen präsent ist, bis der Fall gelöst ist. Sehen Sie es als erste Prüfung.«
Gennat hatte die Augen geschlossen, stand da wie ein Kirchgänger, der keinen Sitzplatz mehr erwischt hatte und nun versunken war in sein Gebet.
»Ein Kriminalist muss alle Sinne schulen«, fuhr er fort. »Ein Orchester, das Sie dirigieren, Herr Kollege. Nehmen Sie nicht nur Pauken und Trompeten wahr, achten Sie auch auf Harfe und Flöte. Manchmal sind es die unaufdringlichen Töne, die einem Stück erst die Vollendung geben.«
Kohlsuppe. Faulige Kartoffelschalen. Hering. Und etwas anderes. Konter trat ein paar Schritte vor, schloss die Augen. Fäkalien. Was noch? Auf dem Esstisch lag ein langer Holzlöffel. Reste von Brei waren darauf angetrocknet. Er nahm ihn und stöberte damit in dem ungewaschenen Bettzeug, im Wäscheschrank, unter dem Bettkasten.
»Sehr gut, Herr Kollege!«, rief Gennat wie aus weiter Ferne.
Kein Hering. Konter unterdrückte den Ekel, der in ihm aufstieg. Der Geruch stammte von Samen. Das Bett, die Unterwäsche, selbst der Boden roch nach eingetrocknetem Ejakulat. Unglaublich große Mengen, als hätte der Mann fortwährend und wahllos onaniert. Und etwas anderes. Was? Konter trat an die kleine Tür neben dem Ofen, öffnete sie. Vergammelte Äpfel lagen in der winzigen Speisekammer. Und da war noch etwas. In der Luft. Dieser typische Geruch von Metall, ein Hauch nur. Ein Mediziner hatte ihm erklärt, dass Eisen und Kupfer zusammen mit Eiweißen so rochen.
»Ja!« Der rundliche Kommissar schien begeistert. »Weiter, weiter!« Er hatte bemerkt, dass sein Kollege Witterung aufgenommen hatte. Sie waren jetzt beide auf der Jagd.
Blut. Konter schob vorsichtig eine kleine Holzkiste zur Seite. Dahinter lagen fünf Päckchen, in Zeitungspapier gewickelt und verschnürt. Er zog sein Taschenmesser hervor und angelte eines nach vorn, durchschnitt das Band. Er schob das Papier zur Seite und wich sofort einen Schritt zurück. Vor ihm lag ein prächtiges Stück Fleisch, die Schnittfläche noch frisch, fast hellrot.
»Sie sind ein Spürhund, Konter. Ich wusste es. Ich werde beim Präsidenten Druck machen, damit Sie endlich zu mir versetzt werden. Ich brauche Sie unbedingt in meiner neuen Abteilung.«
Ein wunder Punkt. Paul Konter hatte die Hoffnung auf eine Versetzung zum Mordbereitschaftsdienst schon beinahe aufgegeben. Seit fast zwei Jahren wurde sein Antrag nicht bearbeitet. Wilhelm Richter, der jetzige Polizeipräsident, fand immer wieder Ausflüchte. Konter war im letzten Jahr bei seinen Ermittlungen gegen einige alte Gardeverbände der kaiserlichen Armee schlicht zu vielen Leuten auf die Füße getreten. Und die hatten sich offenbar prompt revanchiert und bei Richter vorgesprochen.
»Irgendetwas stimmt nicht, Herr Kollege«, fuhr Gennat fort. »Zwölf Menschen. Der Reichsanwalt wird Großmann sogar die Tötung von dreiundzwanzig Frauen zur Last legen. Der Mann hat die Opfer wie ein Raubtier in seinen Bau gebracht. Mit ihnen eine Zeitlang gelebt, sie dann missbraucht. Ein triebgesteuerter Irrer könnte man meinen. Aber auf seine Weise auch ein schlauer Fuchs. Wer rund um den Andreasplatz jahrelang solche Taten begeht und unentdeckt bleibt, hat eine Art sonderbarer Intelligenz.«
Konter musste zugeben, dass die Umstände von Großmanns Verhaftung merkwürdig schienen. Er las die entsprechende Passage in dem Bericht, den Gennat ihm gereicht hatte.
»Nach vielen Jahren, in denen er sorgfältig unentdeckt blieb, soll er ganz plötzlich also so dumm gewesen sein, ein Opfer rufen und schreien zu lassen? Es zu entkleiden, zu schänden und dann neben dem Leichnam einzuschlafen? Nachdem er vorher nur einige Kleidungsstücke der Frau mit viel zu wenig Kohle in den Ofen gestopft hat?«
»War er betrunken?«, fragte Konter, auf der Suche nach einer Erklärung. Für einen Serientäter war das Verhalten Großmanns tatsächlich merkwürdig. Fast, als wäre er seiner Taten überdrüssig und wollte endlich erwischt werden.
Gennat schüttelte den Kopf.
»Vielleicht hat die Frau sich dieses Mal gewehrt und ihn niedergeschlagen? Im Bericht steht etwas von einer Prellung am Hinterkopf«, schlug Konter vor.
»Laut Polizeiarzt hat er sich zwei Mal an der Leiche vergangen. Wohlgemerkt, an der Leiche«, erwiderte Gennat. »Wäre doch merkwürdig, wenn ein Schlag erst nach dieser Widerwärtigkeit Wirkung gezeigt hätte. Noch merkwürdiger allerdings wäre, wenn der Schlag von einer bereits Toten ausgeführt worden wäre.«
Konter wusste, dass es Fälle gab, bei denen ein Schlag auf den Kopf erst nach Stunden zur Bewusstlosigkeit führte. Aber Großmann wäre dann sicher nicht kurz nach seiner Festnahme wieder putzmunter gewesen.
»Es ist eine Schande, dass wir so wenig wissen«, meinte Gennat. »Wir haben hier und an der Leiche so viel Sperma gefunden, aber können nicht sagen, ob es wirklich von Großmann stammt.«
»Sie glauben ihm?«, fragte Konter erstaunt. »Ich meine, dass ein zweiter Mann mit ihm hier gehaust hat?«
»Ich glaube nicht, ich ziehe Möglichkeiten in Betracht.« Wieder schüttelte Ernst Gennat den Kopf. »Der Glaube hat viele Unschuldige das Leben gekostet. Allein Wissen zählt. Und bis wir Gewissheit haben, sollten wir alle Annahmen in Betracht ziehen. Das, mein Lieber, ist gute Kriminalarbeit.«
»Danke für die Lehrstunde«, sagte Konter leicht pikiert.
»Gern geschehen. Bevor Sie mir jetzt den Teufel an den Hals wünschen, ich habe Sie herrufen lassen, weil ich eine Bitte habe.«
Konter war plötzlich wieder hellwach. Und dankbar. Jede Kleinigkeit wäre im Moment eine Erlösung.
»Halten Sie in der Politischen die Ohren für mich offen. Was wird gemunkelt? Wer erkundigt sich nach dem Fall? Gibt es versteckte Interessen? Trifft sich Ihr Chef Weiß mit der Presse, um die Artikel abzusprechen?«
»Ich soll für Sie …?« Konter traute sich nicht, den Vorwurf ganz auszusprechen. Aber eine solche Spitzeltätigkeit empfand er doch als ziemlich erniedrigend.
»Nennen wir es doch interne Ermittlungen, Herr Kollege«, versuchte Gennat, ihn zu beschwichtigen. »Carl Großmann ist ein kranker Mensch, kein Zweifel. Vielleicht hat er all diese Taten begangen. Aber die Umstände seiner Verhaftung sind zumindest seltsam. Nackt und bewusstlos neben einer Toten. Die Verletzung am Hinterkopf, die nur halb verbrannte Kleidung des Opfers. Wäre er so dumm, dann hätten selbst die kaiserlichen Polizeibeamten ihn schon viel früher erwischt.«
Konter überlegte, schloss noch einmal die Augen und ließ die Eindrücke der vergangenen halben Stunde auf sich wirken. Dann wandte er sich wieder an Gennat.
»Ein zweiter Mann«, sagte er sehr leise.
»Vielleicht«, meinte Gennat. »Und ich will wissen, warum jetzt der Fall ganz schnell abgeschlossen werden soll. Großmann ist keine vierundzwanzig Stunden in Haft, und alle sprechen schon vom Prozess, vom Urteil, vom Abschluss des Falls. Reichsanwalt, unser Polizeipräsident, die Presse, selbst Ihr Chef Weiß. Alle wollen die Sache vom Tisch haben. Tun Sie mir den Gefallen, Paul. Bitte.«
Es war das erste Mal, dass Gennat seinen älteren Kollegen mit Vornamen ansprach. »Vielleicht erfahren Sie etwas, das mir weiter hilft. Uns.« Er schwieg kurz und tippte sich dann an die Stirn. »Mit dem Kopf denken wir. Viele Spuren und noch mehr Theorien, die ins Nichts führen. Es sind Fäden, die unseren Geist verwirren und verknoten, die den Blick auf das Unwichtige lenken. Aber die eine Wahrheit, die uns ruhig schlafen lässt, spüren wir nur hier.« Er zeigte auf seine linke Brustseite.
2
Berlin – Luisenstadt, Ende August 2021
»Det Brot zu zwei Märker. Eene Unverschämtheit!«, schimpfte eine ältere Frau, die Franz und Susanne beinahe umstieß, als sie wütend aus der Backstube Kodtke stürmte, die an der Oranienbrücke in der Nähe ihres Hauses lag. »Elende Lumpen! Wie soll ick mit dene paar Kröten Kostjeld fünf Mäuler stopfen?« Das Gezeter hielt noch einen Moment an, bis die Frau in Richtung Cottbus Tor verschwand.
Auf dem Luisenstädtischen Kanal war nur ein kleiner Lastkahn zu sehen, der in den anliegenden Straßen Kohle lieferte. Der Wasserweg wurde kaum noch befahren, die Schleusen wurden nur wenig benutzt. Es roch nach Bracke, Kot, Abfällen und Algen. Berliner Luft eben. Der Luisenstädter Bürger oder Arbeiter scherte sich wenig darum, dass es ihn eigentlich seit über einem Jahr nicht mehr gab. Mit der Berliner Gebietsreform hatte »Luise« offiziell aufgehört zu existieren. Ein Teil des alten Stadtteils gehörte jetzt zu Kreuzberg, der andere zu Mitte.
»Schnurz piepe«, pflegte man hier, darauf angesprochen, zu erwidern. »Eenmal Luise, imma Luise, wa?«
Auf Luise zu wohnen hatte etwas untypisch Berlinerisches. Hier war es auf leisere Art laut. Hier roch es auf angenehme Weise streng. Das Dekadente aus Dorotheenstadt traf auf die Enge Alt-Berlins und Alt-Köllns, vermählte sich mit ihr und brachte Gören hervor, die es liebenswert faustdick hinter den Ohren hatten. Franz legte den Weg zum Open House – ganz entgegen seiner sonstigen Vorlieben als Automobilist – gern zu Fuß zurück. Das erste Lokal, das die Sass-Brüder vor zwei Jahren eröffnet hatten, lag ihm immer noch besonders am Herzen. Es rückte ihm den Kopf zurecht, füllte sein Herz, ließ ihn spüren, woher er kam. Zwar nicht aus der Gosse – dafür hatten die Eltern mit harter, ehrlicher Arbeit gesorgt. Aber von unten. Und wer von unten kam, wusste, wie gut zwei Tage altes Brot schmeckte. Wusste, dass eine heiße Kohlsuppe im Magen besser war als die gefüllten Wachteln in den Träumen. Wer unten war, nahm das Paar Schuhe, ließ sogar den Bugatti oder Benz dafür stehen. Hin und wieder.
»In den Lokalen malen sie die Preise nur noch auf Tafeln, weil die sich ständig ändern«, sagte Susi Bentmann, die der Frau hinterher blickte, und riss Franz aus seinen Gedanken.
Sie hakte sich bei ihrem Lebensgefährten unter und legte die andere Hand an den Mantelkragen. Am Moritzplatz war es immer zugig, egal ob im März, Juli oder September. Sie fröstelte. Sie verstand die Leute gut, die jeden Groschen umdrehten. Es war noch nicht lange her, da war sie selbst mit knurrendem Magen zu Bett gegangen. Jetzt wohnte sie in einem schönen, kleinen Haus unweit des hiesigen Kanals und hatte eine Mamsell, die die alltäglichen Dinge erledigte. Obwohl Susanne Bentmann älter war als ihr Verlobter, wirkte sie aufgrund ihrer zarten Statur und ihres feinen Teints, auf den sie immer stolz war, wie eine Sechzehnjährige.
»Der Vermieter vom Open House ist bankrott«, sagte Franz und nickte, als hätte er damit auf eine Frage geantwortet. »Sternwein meint, er hat sich aufgehängt.«
»Der Krämer erzählt immer so schaurige Geschichten«, meinte Susanne.
Sie bogen in die Stallschreiber Straße ein, in der es immer hoch her ging. Hier wohnten die Leute, hier arbeiteten sie. Und hier tranken sie. Eine neue Redewendung hatte sich dafür in der Stadt gebildet. Ick kieze hieß es nun und war Beschreibung und Anspruch zugleich. Wohnen, lieben, lachen, weinen, leben. Und viel Arbeit. Alles an einem Ort. Kiezen eben.
»Hatte der Mann Schulden?«, fragte sie beiläufig, denn das Geschäftliche interessierte sie kaum.
»Ach was«, erwiderte Franz. »Im Gegenteil, der Kerl hatte zu viel Geld gehortet. Ein Haufen Papiermark, lange Wechsel und Kriegsanleihen, die alle nichts mehr wert sind. Mit den Spargroschen kannst du jetzt bald Straßen pflastern. Und die Scheine nimmst du als Tapete. Nee, Susi, wegen zu hoher Schulden bringt sich heute keener mehr um. Dat is jut, sacht der Jude.«
Er tat wissend, musste sich jedoch eingestehen, dass er die Argumente des Kaufmanns selbst nicht ganz verstanden hatte. Sein Vater hatte ihm eingebläut, dass nur kaufen konnte, wer etwas in der Tasche hatte. Schulden sind Diebstahl war die immer Devise von Andreas Sass gewesen. Aber was wusste der alte Lohnschneider schon von der neuen Zeit? Sternwein war ein gewiefter Geschäftsmann, Partner im Syndicat und erahnte Möglichkeiten und Veränderungen lange vor allen anderen.
»Wir sollten auch Schulden machen«, fuhr Franz großspurig fort, ohne Susannes Schmunzeln zu bemerken. »Sie sind in Zukunft die beste Art, um Gewinne einzufahren. Sagt jedenfalls Josef. Und bisher hatte er immer recht.«
»Versteh ick nich«, meinte sie kokett. Sie wusste, dass Franz die Berliner Schnauze ärgerte. Obwohl er bei innerer Verunsicherung – ohne es zu merken – selbst in den Jargon abrutschte. »Man muss dat Jeld doch habn, um et uffm Kopp zu haun.«
Es mochte seltsam klingen, aber Franz machte sich nicht allzu viel aus Geld. Dabei hatte es die Familie Sass in kurzer Zeit zu einigem Wohlstand gebracht. Er jedoch hatte sich einen kindlich naiven Bezug zum Mammon bewahrt. Wenn es dazu diente, dass es allen gut ging, dann war es eben gut, es zu besitzen. Und tatsächlich verspürte Franz nur dann ein Prickeln, wenn es darum ging, Geschäftsideen zu entwickeln und auszuprobieren. Aber Besitz allein langweilte ihn eher. Schon gar nicht konnte er verstehen, dass es Leute gab, die das Zeug horteten. Drachen, die auf ihren Schätzen hockten, kamen hinsichtlich ihrer charakterlichen Bewertung ja meist auch nicht gut weg. Also hatte Franz frühzeitig entschieden, sich in Geldangelegenheiten auf seinen Teilhaber Josef Sternwein zu verlassen. Der Mann hatte sich als guter Mentor erwiesen. Und immer den richtigen Riecher gehabt, wenn es ums Geld ging. Franz war immer noch ein Kind der Straße. Zwei Zimmer in Moabit. Für eine achtköpfige Familie. Da trieb man sich, so oft es ging, draußen herum.
»Zwei Sechser in der Hand sind doch besser als jeder Kronleuchter an der Decke«, sagte er jetzt nachdenklich.
Susanne schwieg. Sie hatte beobachtet, dass ihr Partner in letzter Zeit sehr oft abgelenkt war und seinen Gedanken nachhing. Insbesondere machte er sich fürchterliche Sorgen um seine Tante Antonia, die sich immer noch von ihrer schweren Operation erholte.
Nein, überlegte sie. Eigentlich sorgt er sich um alle. Und genau dafür liebte sie ihn.
»Der Block in der Stallschreiber Straße gehört jetzt der Zentral-Bodenkredit«, meinte er zu ihr. »Die Kerle streichen die Wände und bauen Zentralheizung in die Wohnungen. Danach vermieten sie für das Dreifache. Und das Gewerbe trifft es ganz übel. Von uns wollen sie zweitausend für die Räume. Für ein Kellerloch, das wir selbst umgebaut haben! Der neue Mietpreis gilt schon ab nächstem Monat. Oder raus. Die Leute rücken sonst mit Anwalt, Polente und een paar Muskelmännern an. Werfen dir einfach alles auf die Straße.« Franz Sass zeigte zum Bäckergeschäft. »Und das passiert überall. Vielleicht haben sie dem armen Kodtke auch die Miete für seine Backstube erhöht. Da muss er das Brot eben teurer machen. Steht ja auch in der Zeitung. Josef meint, dass einige Makler an der Börse Mehl auf Kredit kaufen und einen Teil vergammeln lassen. Dadurch steigt die Nachfrage. Spekulation nennt man det heute. Und alle müssen die Preise erhöhen, um noch über die Runden zu kommen.«
»Uns doch ejal, wa? Du sagst doch, kühle Molle und warme Schenkel, die jehn immer«, meinte Susi, grinste anzüglich und rückte näher an ihn heran.
Franz sah sie gespielt vorwurfsvoll an. Er wurde nur ungern daran erinnert, dass Susanne Bentmann vor einem Jahr selbst noch als Horizontale gearbeitet hatte. Die allgemeine Not nach dem Krieg hatte sie dazu getrieben. Ihr Vater war für die Ehre eines Kaisers, der ihn gar nicht kannte, gefallen. Und die Mutter hatte sich von einem schönen, russischen Grenadier trösten lassen und war über alle Berge. Also stand Susanne plötzlich allein da mit ihrer kleinen Schwester, die ständig Hunger gehabt hatte. Da war die adrette Rote Susi – ihre Haare leuchteten in natürlichem Karmesin – eben schnell auf ein verlockendes Angebot hereingefallen. Tänzerin gesucht – zehn Mark am Abend. So stand es damals auf vielen Schildern. Vor vielen zwielichtigen Lokalen. Es war zwar nicht so schlimm gewesen wie bei den billigen Nutten vom Nollendorfplatz. Aber Freier war Freier. Und manchen Dreck wurde man nur schwer wieder los. Neulich erst hatte ein vornehmer Stutzer sie in einem Varieté, in dem sie und Franz den Abend verbrachten, erkannt und Witze darüber gerissen. Und sich prompt eine blutige Nase eingefangen. Da verstand der junge Sass keinen Spaß.
Er hatte gehofft, im Open House seinen ältesten Bruder anzutreffen, der die einfachen Lokale unter seinen Fittichen hatte. Max Sass verhandelte jedoch gerade bei Schultheiss über neue Lieferbedingungen fürs Bier. Mittlerweile wurde in den drei Arbeiterkneipen, die dem Syndicat gehörten, so viel gesoffen, dass sie eigentlich Feuerwehrschläuche von der Brauerei hätten legen können.
Wir brauchen unbedingt überall Fernsprechapparate, überlegte Franz und seufzte laut. Er notierte den Gedanken in seinem abgegriffenen Geschäftsbuch, das er immer mit sich führte. Wieder eine Sache, um die er sich kümmern musste. Ihm wurde es langsam zu viel.
Das Paar schlenderte also kurz darauf unverrichteter Dinge wieder zu seinem Haus am Luisenstädtischen Kanal zurück. Am Oranienplatz machten sie Halt, um den herrlichen Blick übers Wasser hinüber zur Kirche zu genießen. Franz hatte in der Frühe viel Zeit. Sein Arbeitstag begann meist gegen drei Uhr nachmittags.
»Die Gauner an der Börse und in den Bankhäusern arbeiten, wenn es hell ist«, pflegte sein jüdischer Geschäftspartner lachend zu sagen. »Wir ehrlichen Leute fangen erst danach an.«
Zu ihrem Haus an der Ecke Naunynstraße war es nicht mehr weit, als plötzlich eine Motordroschke mit überhöhtem Tempo in ihre Straße einbog. Das heiser röhrende Horn verschreckte zwei Straßenköter, die vor dem Gartenzaun herumlungerten und sich um ein Fettpapier angingen. Noch bevor der Wagen hielt, hatte Jekaterina, die in der Familie alle nur Katja nannten, bereits dessen Tür aufgestoßen.
»Überraschung!«, rief sie und wedelte mit einigen Karten in der Hand. »Ich habe vier Einladungen für heute Abend. In der Akademie der Künste finden eine Ausstellung und Modenschau statt. Künstler aus Paris und sogar New York sollen da sein. Es heißt, Coco Chanel kommt. Und Vollmoeller liest aus seinem Gedichtband. Toni wird begeistert sein.«
»Wirklich? Klingt nach einem sterbenslangweiligen Abend«, meinte Franz und erhielt umgehend einen Seitenhieb von seiner Angebeteten.
»Wenn du nicht bald aus deinen Kaschemmen herauskommst, wirst du nie die wichtigen Leute kennenlernen«, erwiderte die Russin.
Jekaterina Romanowa war nach der Revolution in ihrem Land in Berlin gestrandet und hatte sich mit ein wenig Hochstapelei und einigen Diebstählen angenehme Monate in der feinen Gesellschaft gemacht. Mittlerweile war sie, da sie über gute Kontakte verfügte, eine Teilhaberin des Syndicats geworden.
»Du kommst auf keinen grünen Zweig, wenn du den armen Schluckern das Bier für die Hälfte gibst, Franz. Und willst du auf ewig bei deinen Saftläden und Würfelbuden bleiben? Oder willst du dickes Geld verdienen? Dafür musst du dich mal bei den wichtigsten Anlässen zeigen. Und zu den besten Partys gehen.«
»Du und deine P‑a‑r-t‑y-s.« Susanne verdrehte die Augen und dehnte das letzte Wort, an das sie sich noch nicht wirklich gewöhnt hatte.
Sie selbst liebte das Nachtleben ebenfalls, aber verglichen mit Katja war sie ein Mauerblümchen. Katja war das Enfant terrible der Berliner Gesellschaft. Die junge Russin stand immer noch in dem Ruf, eine entfernte Verwandte der gemeuchelten Kaisersippe zu sein. Zwar leugnete sie solche Behauptungen mittlerweile, aber die Gerüchte waren dennoch nicht ganz verstummt. Sie ging immer nur auf »Partys« oder »Events«, nie zu einer schnöden Feier. Und dort trank sie selbstverständlich nur »gemixte Drinks« und »Cocktails«. Eine sprachliche Marotte, die sie sich während einer kurzen Liaison mit dem amerikanischen Journalisten Hemingway angewöhnt hatte. Katja trug das Haar kurz, fast burschikos gescheitelt. Oft erschien sie im Männeranzug, wobei sie ihre Weiblichkeit jedoch nie gänzlich verbarg. Ihre Haut war makellos, und sie trug nur meisterhaft aufgetragene, dünne Striche von weißem und schwarzem Kajal um die Augen. In ihnen schien sich die unschuldige Magie der Verderbnis zu spiegeln, die viele in ihrer Umgebung – egal ob Mann oder Frau – in den Bann zog. Dass sie zwischenzeitlich Mutter geworden war, mit einer Tänzerin zusammenlebte und selbst reichlich Kokain konsumierte, nährte die Gerüchteküche um sie zusätzlich und schürte allerlei Fantasien.
Franz wollte etwas erwidern. Schließlich brachten der illegale Alkohol- und Zigarettenverkauf an den Straßenecken und das fliegende Würfelspiel bereits ordentliche Summen ein. Zapfsäulen, Saftläden und Glücksbretter waren zu normalen, nächtlichen Vergnügungen geworden, sie gehörten zur Berliner Allnacht wie Molle und Boulette. Und an ihnen konnte das Syndicat ordentlich mitverdienen. Franz liebte es, sich durch die Straßen der Hauptstadt treiben zu lassen. Er lebte zwar gern auf großem Fuß, aß im Wintergarten für vierhundert Mark, tanzte zu Champagner in der Weißen Maus oder im Schwarzen Kater den Shimmy. Aber insgeheim sehnte er sich nach jener Einfachheit und Ehrlichkeit, die sein Leben in der Cliquen-Zeit bestimmt hatten. Manchen frühen Morgen streifte er allein und übermüdet durch die Friedrichstadt Richtung Spittelmarkt. Er spendierte »den Jungs« ein Glas Roten oder einen Becher Kaffee. Und natürlich kräftige Bouillon. Mit den ausgezehrten Alten, die das Leben zerstört hatte, kippte er oft ein Berliner Gedeck zum Frühstück. Niemandem war in solchen Momenten nach Reden zumute. Man blieb im Stillen hocken und verstand sich auch ohne Worte.
»Franz? Der is knorke! Uff den lass ick nüscht kommen«, hieß es in ganz Mitte.
Dit is meen Berlin, dachte er selbst oft wehmütig. Tagsüber hatten die Leute doch nur deshalb eine große Klappe und machten jede Menge Radau, weil sie sich in ihrem Inneren unerträglich einsam fühlten. In der deutschen Hauptstadt war immer Karneval. Ihre Bewohner trugen immer Masken. Und der ewige Lärm sollte nur die Geister vertreiben, die die Stille zu beschwören drohte. Die schmutzigen, verlebten Gesichter am Straßenrand waren ehrlicher. Und Franz erinnerte sich nur zu gut daran, wie fürstlich eine altbackene Schrippe und heiße Suppe um vier Uhr morgens sein konnten.
Vielleicht rührte seine Sehnsucht nach dieser Art von Ruhe daher, dass es beim Syndicat niemals bedächtig zuging. Vor allem nicht, wenn die Frauen da waren. Wie so oft kam Franz auch dieses Mal bei der jungen Russin kaum zu Wort.
»Hörst du mir eigentlich zu, du Rekel?« Katja stand jetzt vor ihm und schnippte mit dem Finger gegen seinen Hut. »Die Geschäfte der Zukunft machst du nicht mit Willy Meyer, Sternwein oder den Götzes«, sagte sie. »Wir müssen an den neuen Geldadel ran, wenn wir auf Dauer mitmischen wollen. Bei denen schlägt das Herz hier.« Katja rieb ihren Daumen an Zeige- und Mittelfinger. »Außerdem haben wir auch noch die Vereinbarung mit Paul. Er hat erst vor kurzem bei mir nachgefragt, ob wir Informationen für ihn haben. Es ist wie beim Poker. Und gerade werden in der Stadt die Karten neu gegeben. Entweder wir sind mit einem guten Blatt dabei, oder wir bleiben Zuschauer.«
Susanne schien fasziniert von ihrer Freundin und deren Eloquenz, mit der sie beinahe jeden in ihren Bann zog. Aber Franz stöhnte erneut. Diese Frau hatte mehr Energie, als ihm um diese Zeit gut tat.
»Und heute Abend wird Bürgermeister Böß da sein, dazu einige Abgeordnete«, fuhr sie fort. »Die Leute vom Film und von den Zeitungen kommen sicher. Dieser Stenz Hugenberg wird sich bestimmt ebenfalls zeigen. Er ist zwar ein spießiger Langweiler, aber wichtig für uns.«
»Hast du die Hoffnung auf eine Filmrolle immer noch nicht aufgegeben?«, stichelte Franz müde und kassierte einen weiteren Hieb.
»Und die höheren Offiziere von der Reichswehr lassen sich meist auch nicht lange bitten.« Jekaterina ignorierte die Bemerkung. »Wir müssen uns dort einbringen. Das Syndicat muss auf Dauer auf den Feldern Geschäfte machen, wo Betrug als legal gilt. Bauen, Banken, Börse. Diese Leute öffnen uns die Türen.«
Jeder ihrer Freunde wusste, dass sie tatsächlich hoffte, durch Hugenberg an eine Filmrolle zu kommen. Der Verleger versuchte seit geraumer Zeit, ins Kinogeschäft einzusteigen, und nach seinen Vorstellungen sollte die glamouröse Deutschrussin dort ein Star werden. Klang alles nach einer billigen Masche, um sie ins Bett zu bekommen, aber der Mann mochte Katja – aus welchen Gründen auch immer – auf eine väterliche und freundschaftliche Weise.
Franz erkannte, dass Widerstand hier zwecklos war. Wenn seine Susanne erst überzeugt war, hatte er in solchen Dingen nichts zu melden. Er hasste den Smoking, das gestärkte Hemd und dieses affektierte Gehabe, das sich mit der Kleidung offenbar sofort einstellte. Irgendwo hatte er gelesen, das Kleider Leute machten. Auf jeden Fall veränderten sie sie. Es war, als streifte man eine neue Haut über, die dann das Wesen beeinflusste. Er nickte nur ergeben.
»Also gut.« Er nahm Katja die Einladungen aus der Hand. Sie hatte vier, erinnerte er sich. »Wie geht es Tante Toni? Kann sie auch mitkommen?«, fragte er deshalb, als die drei ins Haus gingen.
»Recht gut«, antwortete die junge Russin. »Sie regt sich nur so verdammt schnell auf.«
Franz lief ein Schauer über den Rücken, als er an seine Tante dachte. Lange hatte sie allen den Tumor verschwiegen, der in ihrem Kopf gewachsen war und sie jahrelang mit heftigsten Schmerzen gequält hatte. Dann war sie letztes Jahr auf der Rennbahn zusammengebrochen, und nur eine gefährliche Operation hatte sie retten können.
»Drei Monate hat die Arme geschielt«, meinte Susanne. »Und geredet wie ein besoffener Treidelbursche. Da wäre es um deine Geduld auch nicht zum Besten gestellt. Und für ihr Temperament war sie ja schon immer bekannt.«
»Also, abgemacht. Wir vier. Besorgst du ein Automobil, Franz?«, fragte Katja, nachdem sie ein Glas Milch getrunken und die Schlagzeilen der Mittagszeitung überflogen hatte. Franz nickte stumm.
»Ich werde noch bei Paul vorbeischauen«, meinte sie. »Dem Mann ist diese Mordsache auf den Magen geschlagen. Beißt sich da richtig fest. Der bräuchte eine Frau, um mal auf andere Gedanken zu kommen. Immer nur Akten, da vertrocknen die besten Gewächse.«
Katja zeigte auf die Schlagzeilen. Seit zehn Tagen ging es auf den Titelseiten aller Gazetten nur um den Frauenmörder Carl Großmann. Wieder hatten die Beamten Leichenteile gefunden.
»Ich traue mich nicht mehr allein aus dem Haus«, erwiderte Susanne. »Drüben im Engelbecken haben sie schon wieder neue Knochen gefunden. Im Kanal auch. Fürchterlich.«
»Wenn einem Stutzer oder Politiker der Schädel eingeschlagen worden wäre, hätten sie den Mörder viel früher gefasst«, meinte Katja, als sie ihren Mantel wieder überzog. »Aber so? Nur ein paar mittellose, liederliche Weibsbilder, da legt sich doch kein Beamter krumm.«
»Paul und Toni, das wäre es doch. Die beiden würden gut zusammenpassen«, wechselte Susanne das Thema.
»Und ihr Lümmelchen, der große Ritter, würde aufs Pferd steigen und seine Dulcinea aus den Fängen des Teufels befreien.« Katja lachte.
»Habt ihr sie eigentlich noch alle?« Franz wurde ungern an die amourösen Irrwege seiner Tante erinnert. »Klante ist ein wichtiger Teilhaber! Er macht ordentlich Umsatz.«
Allerdings klang sein Protest halbherzig, und er blickte aus dem Fenster. Er bekam noch mit, dass beide Frauen kicherten und in ihrer Fantasie seine Tante mit dem alternden Kripomann verkuppelten. Er selbst fand die Idee gar nicht abwegig, aber dazwischen stand dieser Traumtänzer und selbsternannte Don Quichotte Klante, in den sich Toni unbedingt vergucken musste. Ihr Lümmelchen. Franz versuchte, die aufsteigenden Bilder zu verdrängen.
Ein offener Viertürer, das sollte gehen, dachte er im nächsten Moment, um sich abzulenken. Automobile waren seine neue Leidenschaft. Nicht zu gediegen mit sportlicher Note. Er hatte solche Texte in den Werbeprospekten der Händler gelesen. Mit unseren Automobilen wird aus einem Mann ein Mann von Welt. Der Packard – das Kraftpaket. Einen Ford zu fahren bedeutet frei zu sein. Benz – deutsch und solide. Sei Patriot, nimm einen Steyr!
Mit etwas Glück kann ich einen Maybach bekommen, entschied er nach ein paar Minuten.
3
Berlin – Pariser Platz
Im äußerlich eher schlicht gehaltenen Palais Arnim, das sich direkt seitlich an das Nobelhotel Adlon anschloss, war die Preußische Akademie der Künste untergebracht. Das Gebäude strahlte eine angenehme Bescheidenheit aus; ein Wesenszug, der den Berlinern näher lag als die Großmannssucht und Prahlerei der wilhelminischen Zeit. Es wurde schier erdrückt vom Adlon in seiner unpassenden Größe auf der einen und dem Palais Wrangel mit den geschmacklosen Kolossalpilastern auf der anderen Seite.
Große Plakate und Stoffbanner wiesen auf die internationale Ausstellung Farbe-Mode-Neuzeit hin, für die Jekaterina die Einladungen erhalten hatte. Das Ereignis war groß angekündigt, denn es sollte als Fanal einer Wiederaufnahme Deutschlands in die Kulturwelt gefeiert werden. Entsprechend hochkarätig war die Gästeliste. Einige Besitzer hochwertiger Automobile hatten aus ihren monetären Engpässen eine Tugend gemacht und vermieteten die teuren Fahrzeuge für Hochzeiten und Filmaufnahmen. Gelegenheiten wie die Ausstellung im Arnim waren jedenfalls geradezu prädestiniert, um sich der Öffentlichkeit in Prunk und Geberlaune zu zeigen. Und was vermochte ein – vorhandenes oder vorgegebenes – Vermögen mehr zu betonen als ein gutes Automobil? Wichtig in diesen Kreisen war es, den Schein zu wahren. Wer pleite war, gab das Geld nur umso großzügiger aus, denn er wollte ja von jedem Verdacht ablenken. Wer – wie die Familie Sass – von unten kam, umgab sich ebenfalls gern mit dem größtmöglichen Glanz. Eine Zeitlang hatte Franz dieses Spiel gefallen, aber im Grunde widerte es ihn an. Nur von den großen Automobilen konnte er nicht lassen. Maschinen faszinierten ihn von klein auf. Erst Eisenbahnen, dann auch Werkmaschinen. Dass man seit zwanzig Jahren auf ihnen reiten konnte und dabei am Steuer saß, hatte sein Kinderherz von jeher erfreut. Wenn drei Liter Hubraum ihren Bass auf die Straße warfen, dann durchströmte ihn dieses angenehme Gefühl von Leichtigkeit und Freiheit.
»Um Geschäfte zu machen, ist es nicht wichtig, das Geld zu haben«, hatte Tante Toni ihrem Neffen gepredigt. »Die Leute müssen nur fest glauben, dass du es hast.«
Sie verfügte über jene reife Weisheit, gegen die man sich in jungen Jahren mit Händen und Füßen wehrte. Franz und seine Brüder hatten zwar längst akzeptiert, dass sie das heimliche Oberhaupt des Syndicats war. Aber sie war klug genug, ihren Neffen und den anderen beteiligten Herren die Illusion zu lassen, sie hätten die Hosen an.
Franz hatte, dem Credo seiner Tante folgend, die in einer Annonce geforderten hundert Mark nebst Kaution bezahlt, so dass er jetzt mit den drei Damen stilvoll am Pariser Platz vorfahren konnte. Mit dem Wetter hatte er sich gründlich verschätzt. Wieder ein lausig kalter Maiabend mit Ostwind. Also froren sie jämmerlich im offenen Mercedes 16/45, aber der beige-braune Wagen glänzte beeindruckend mit den Lackschuhen der Gäste um die Wette. Toni grüßte die Reporter vor dem Gebäude winkend aus dem Fond heraus, als wäre sie die heimgekehrte Kaiserin Auguste.
Zu seiner Überraschung wurde Franz gleich hinter dem Empfang von Kriminalkommissar Konter angesprochen. Paul Konter war zwar mittlerweile ebenfalls stiller Teilhaber des Syndicats, legte jedoch Wert auf eine gewisse Distanz, zumindest in der Öffentlichkeit. Seine Rechtschaffenheit hatte der Familie in schweren Zeiten aus der Patsche geholfen. Sie war allerdings auch ein Hindernis gewesen, die Zusammenarbeit mit Toni und Franz zu vertiefen. Letztlich hatte er Frieden mit diesem Widerspruch gemacht, indem er seine kleinen Abwege mit dem Erreichen höherer Ziele rechtfertigte.
»Die Kleinen fängt man, die Großen lässt man laufen. Ab jetzt drehe ich den Spieß um«, hatte er vor wenigen Monaten beschlossen.
Paul Konter bedeutete Franz, ihm auf die Herrentoilette zu folgen. Dort wartete er beim Händewaschen, bis sie einen Moment unter sich waren.
»Wie ich sehe, willst du wohl jetzt ganz oben mitspielen, Franz?« Konter lachte. »Na, bei den vielen Begabungen deiner Tante wundert mich nichts mehr.«
»Sie hier, Paul?«, fragte Franz erstaunt. Er hatte noch immer gehörigen Respekt vor dem älteren Polizeibeamten, der vor zwei Jahren seinen Vater aus dem Gefängnis herausgehauen hatte. »Seit wann interessiert sich die Kriminalpolizei denn für Mode? Oder liegt wieder etwas in der Luft? Ich hoffe doch sehr, dass die Kommunisten nicht etwas Sprengstoff für uns dekadente Kapitalisten übrighaben.«
»Nein, reine Routine«, erwiderte Konter. »Die Schutzpolizei ist hier offiziell für die Sicherheit der Gäste zuständig, und zwei Kriminalbeamte haben die Leitung der Sache. Wir dürfen hinterher auch den Bericht schreiben. Die Kripo passt nur auf, dass die jungen, ausgehungerten Kollegen nicht über das Buffet herfallen.« Er lachte und musterte Franz durch den Spiegel. »Aber im Ernst, der Bürgermeister ist hier, ein paar Politiker und steinreiche Knacker prahlen und strahlen um die Wette. Da könnten Wirrköpfe oder Ganoven auf komische Ideen kommen.«
Franz schwieg. Er war nicht überzeugt, dass Konter ihn nur angesprochen hatte, um ihn zu begrüßen und Freundlichkeiten auszutauschen.
»Und bei der Gelegenheit kann ich mir gleich einen Überblick darüber verschaffen, wer in diesem Jahr mit wem die Köpfe zusammensteckt. Es war in den letzten Wochenvergleichsweise ruhig. Eine Tatsache, die mich schon fast wieder beunruhigt. In Berlin gibt es keine Ruhe, außer man liegt unter der Erde. Und ich dachte …« Er richtete seine Frisur und zog den pomadierten Scheitel nach, so dass kein Verdacht aufkommen konnte, wenn jemand die Tür öffnete. »Da ihr auch hier seid, könntet ihr mich ein wenig unterstützen.«
»Denken Sie an etwas Bestimmtes?«, fragte Franz. »Gibt es Gerüchte? Drohungen?«
»Nein, wie gesagt. Haltet nur die Augen und Ohren offen.« Kommissar Konter schüttelte den Kopf. »Und ich muss euch vorwarnen. Es heißt, dass Kapitän Ehrhardt ebenfalls kommt. Die Ratten trauen sich also schon wieder ans Tageslicht.«
»Man konnte ihm also wirklich nichts nachweisen?«, fragte Franz. »Erst der Putschversuch, die Morde und Anfang des Jahres die Sache mit Ebert. Unglaublich, da müssen Sie doch etwas gegen den Dreckskerl in der Hand haben.«
»Nein«, antwortete Konter. »Oder besser gesagt, man will gar nicht, dass wir ihm auf die Füße treten. Er wird von ganz oben gedeckt. Er hat sich nur ein paar Wochen in Schlesien aufgehalten und dort den Polen eingeheizt. Damit schafft man sich Freunde bei den Konservativen. Er hat eidesstattlich versichert, dass er von dem Aufstand nichts wusste. Und das reichte. Im Gegenteil, er wurde belobigt, da seine Männer die Unruhen in der Wilhelmstraße beendet haben.«
»Das kann doch nicht wahr sein!«
Franz war nicht begeistert von der Aussicht, an diesem Abend Ehrhardt über den Weg zu laufen. Alle wussten mittlerweile, dass das Schwein der geheimnisvolle Consul war. Dass er eine Organisation aus alten Frontkämpfern und neuen Nationalisten anführte, die sich sogar für Auftragsmorde bezahlen ließ. Der Mann war so geschickt, dass alle Hinweise, die ihn belasten konnten, vage blieben. Und da er über Freunde ganz oben verfügte, ließ man ihn in Ruhe. Natürlich ärgerte Franz diese Tatsache, aber er hätte damit leben können. Doch der Consul hatte seinen Bruder Georg entführen lassen, der dabei fast ums Leben gekommen wäre. Und das Syndicat war dem Marineoffizier gewissermaßen vierhunderttausend Mark schuldig, die man ihm – im wahrsten Sinn – vor zwei Monaten unterm Hintern entwendet hatte. Keine guten Voraussetzungen also für eine Aussöhnung und einen gemütlichen Plausch heute Abend.
»Zeugen haben ihn damals mit Kapp gesehen!«, fing Franz wieder an. »In den Notizen dieses toten Schatzmeisters wurde er erwähnt.«
»Auf dem rechten Auge ist der Oberreichsanwalt offenbar blind.« Paul Konter hob die Schultern. »Ich bin beruflich und menschlich in dieser Hinsicht so oft enttäuscht worden, dass ich mir eine andere Haltung zugelegt habe. Statt mich über Dinge zu ärgern, die ich nicht ändern kann, setze ich meine Arbeitskraft da ein, wo ich was tun kann.«