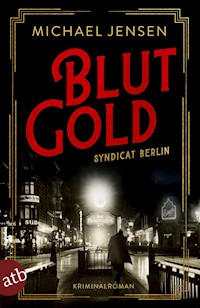14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2024
Die ersten beiden Fälle von Inspektor Jens Druwe in einem E-Book Bundle!
Totenland
Von Opfern und Tätern.
Ende April 1945. Der Krieg geht zu Ende. Nachdem er schwer verwundet wurde, ist Jens Druwe aus Berlin nach Schleswig-Holstein abkommandiert worden. Hier soll er als Polizist für Ordnung sorgen. Als ein hoher Funktionär der NSDAP ermordet wird, wollen seine Vorgesetzten sogleich den ersten Verdächtigen, einen entflohenen Häftling, aburteilen. Doch Druwe stellt sich gegen die Profiteure des untergehenden Regimes. Ihm zur Seite steht allein die Schwester des Verdächtigen, die wie er voller Mut und Hoffnung den Kampf gegen einen übermächtigen Gegner aufnimmt ...
Ein Mordfall vor einer ungewöhnlichen historischen Kulisse – und ein Ermittler, der dem Grauen des Krieges eines entgegenhält: die Liebe zur Wahrheit.
Totenwelt
Die tödlichen Gefahren des Neuanfangs.
Der Zweite Weltkrieg ist seit ein paar Stunden beendet, als Inspektor Jens Druwe zum Marinestützpunkt in Flensburg gerufen wird. Er soll helfen, eine neue Polizeieinheit aufzubauen. Dann erhält er eine seltsame Nachricht - von Werner Grell, einem untergetauchten Geheimdienstagenten. Grell berichtet von brisantem Material, das er über ehemalige Nazi-Größen besitzt. Zögernd vertraut Druwe sich britischen Militärs an. Das erste Geheimtreffen zwischen Grell und einem Captain der Briten endet jedoch in einem Fiasko. Beide werden tot in einer Lagerhalle gefunden. Es sieht aus, als hätten sie sich gegenseitig erschossen. Doch Druwe hat da seine Zweifel ...
Ein Doppelmord im Mai 1945 – ein hochspannender Roman vor einer ungewöhnlichen historischen Kulisse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1039
Ähnliche
Über das Buch
Totenland
Von Opfern und Tätern.
Ende April 1945. Der Krieg geht zu Ende. Nachdem er schwer verwundet wurde, ist Jens Druwe aus Berlin nach Schleswig-Holstein abkommandiert worden. Hier soll er als Polizist für Ordnung sorgen. Als ein hoher Funktionär der NSDAP ermordet wird, wollen seine Vorgesetzten sogleich den ersten Verdächtigen, einen entflohenen Häftling, aburteilen. Doch Druwe stellt sich gegen die Profiteure des untergehenden Regimes. Ihm zur Seite steht allein die Schwester des Verdächtigen, die wie er voller Mut und Hoffnung den Kampf gegen einen übermächtigen Gegner aufnimmt ...
Ein Mordfall vor einer ungewöhnlichen historischen Kulisse – und ein Ermittler, der dem Grauen des Krieges eines entgegenhält: die Liebe zur Wahrheit.
Totenwelt
Die tödlichen Gefahren des Neuanfangs.
Der Zweite Weltkrieg ist seit ein paar Stunden beendet, als Inspektor Jens Druwe zum Marinestützpunkt in Flensburg gerufen wird. Er soll helfen, eine neue Polizeieinheit aufzubauen. Dann erhält er eine seltsame Nachricht - von Werner Grell, einem untergetauchten Geheimdienstagenten. Grell berichtet von brisantem Material, das er über ehemalige Nazi-Größen besitzt. Zögernd vertraut Druwe sich britischen Militärs an. Das erste Geheimtreffen zwischen Grell und einem Captain der Briten endet jedoch in einem Fiasko. Beide werden tot in einer Lagerhalle gefunden. Es sieht aus, als hätten sie sich gegenseitig erschossen. Doch Druwe hat da seine Zweifel ...
Ein Doppelmord im Mai 1945 – ein hochspannender Roman vor einer ungewöhnlichen historischen Kulisse.
Über Michael Jensen
Michael Jensen wurde im Norden Schleswig-Holsteins geboren. Im Hauptberuf ist er als Arzt tätig und interessierte sich früh für jüngere deutsche Geschichte und deren Folgen für die Nachkriegsgeneration. Für sein literarisches Schreiben hat er ein Pseudonym gewählt. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg und im Kreis Schleswig-Flensburg.
Über die Sass-Brüder erschienen im Aufbau Taschenbuch bisher »Blutgold«, »Blutige Stille« und »Blutiger Schnee«.
Außerdem sind hier seine Kriminalromane »Totenland«, »Totenwelt« und »Totenreich« lieferbar.
Mehr zum Autor unter www.autor-jensen.de.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Michael Jensen
Totenland & Totenwelt
Zwei hochspannende Jens-Druwe-Kriminalromane
Inhaltsverzeichnis
Informationen zum Buch
Informationen zum Autor
Newsletter
Totenland
Kapitel 1
4348 Tage12. April 1945
Goldfasan14. April 1945
Valkyrja18. April 1945
Heldenfall22. April 1945
Kapitel 2
Endzeit27. April 1945
Nornengesang28. April 1945
Munin
Gegensätze
Kapitel 3
Zweifel
Begegnungen
Thing
Nordmannen29. April 1945
Kapitel 4
Agonie
Entscheidungen
Offenbarungen
Fluchten
Erkenntnisse30. April 1945
Ragnarök
Kapitel 5
Freiheiten
Gericht
Pläne
Anderwelt
Einsichten
Entscheidung
Kapitel 6
Amour fou
Zufälle
Viel Feind
Deutscher Tod
Wunden1. Mai 1945
Kapitel 7
Enttäuschungen
Hel
Unter der Welt2. Mai 1945
Morgennebel
Kapitel 8
Gjöll
Herren und Hunde
Endspiel
Pyrrhussieg
Epilog …5. Mai 1945
… und Abgesang
Nachwort
Totenwelt
Prolog
12. November 1944
Kapitel 1
5. Mai 1945
Kapitel 2
6. Mai 1945
7. Mai 1945
Kapitel 3
Kapitel 4
8. Mai 1945
9. Mai 1945
Kapitel 5
10. Mai 1945
11. Mai 1945
Kapitel 6
12. Mai 1945
Kapitel 7
13. Mai 1945
Kapitel 8
14. Mai 1945
15. Mai 1945
Kapitel 9
17. Mai 1945
Kapitel 10
18. Mai 1945
19. Mai 1945
20. Mai 1945
Epilog
23. Mai 1945, Flensburg
Nachwort
Impressum
Michael Jensen
Totenland
Ein Jens-Druwe-Roman
Kriminalroman
1
Und sieh! die tage die wie wunden brannten
In unsrer vorgeschichte schwinden schnell.
Doch alle dinge die wir blumen nannten
Versammeln sich am toten quell.
Stefan George (1868–1933), Das Jahr der Seele
4348 Tage12. April 1945
Eintönig und seltsam hohl klang das Klappern der Holzschuhe auf dem Katzenkopfpflaster. Hunderte Füße stolperten vorwärts. Weniger Glückliche trugen nur Lumpen an den Füßen, vereinzelt sah man die Knochenmänner sogar barfuß. Um fünf waren sie in Fuhlsbüttel aufgebrochen. Die Langenhorner Chaussee hinauf nach Norden, heraus aus Hamburg. Am alten Ochsenzoll hatten sie die Stadtgrenze erreicht, waren in den kleinen Schmuggelstieg abgebogen. Nun schleppte sich der Zug auf der Ulzburger Straße in ländliches Gebiet. Die Häuser wurden seltener. Die verstohlenen Blicke hinter den Vorhängen auch. Ebenso das rasche Abwenden, wenn Leute auf die Kolonne trafen. Lieber einen Umweg nehmen, als diesen Menschen in die leeren Augen zu sehen. Menschen. Knochenmänner. Todgeweihte. Tote. Der Aprilmorgen war kalt. Aus den Hecken und Gräben griffen Nebelfinger nach den mageren Knöcheln der Häftlinge. Jeder Schritt schien ihnen noch den letzten Rest Leben auszusaugen. Der Nebel war schon die Verheißung ihres kalten Grabs. Endlich die lang ersehnte Ruhe in Frieden. Dabei tobte draußen noch immer der Krieg. Hielt die Welt umarmt in seinem letzten, irrwitzigen Veitstanz.
Plötzlich Unruhe im Zug. Ein Stolpern. Schreie und Befehle. Eine kleine Nebelbank über der Straße. Ein Mann im Graben. Kurz gesprungen. Das fahle Gesicht im gefrorenen Gras. Warten auf die Erlösung.
Schlafen. Nur schlafen. Steinfeld wusste, dass es falsch war. Sie würden ihn finden. Aber egal. Nur ein wenig ausruhen. Seine Lider waren schwer, die Augen brannten. Er lag am Rand einer Wallhecke, den Rücken gegen einen kleinen, knorrigen Weidenstamm gelehnt. Er hörte sein Keuchen, das Rasseln in seiner Brust. Immer wieder unterdrückte er ein Husten, wollte sich nicht verraten. Die Kälte kroch von unten in seinen ausgemergelten Körper. Kein Gramm Fett schützte ihn. Nur ein grober Wollfetzen trennte die feuchte, kalte Erde von seiner Haut. Grau und verschlissen. Wie sein Leben. Es war, als wollte der Boden ihn schon holen. Ihn aufnehmen. Umwandeln. Dort konnte er dann endlich schlafen.
In der Ferne ein Schuss. Steinfeld hob kurz die Lider. Ihn schreckte nichts mehr auf. Zu lange war die Angst schon Teil von ihm. Sie waren ein altes Paar geworden in dieser langen Zeit, er und die Furcht. So ließ er sie gewähren, seine zänkische Alte. Noch ein Schuss. Oben an der Ulzburger Straße. Sie hatten vor etwa einer Stunde das Hamburger Gebiet verlassen. Es war nur langsam vorangegangen, da viele in einem noch erbärmlicheren Zustand waren als er selbst. Er hatte gewusst: Wenn er noch weiterliefe, würde er immer schwächer werden. Ein letztes Mal hatte sich sein Lebenswille aufgebäumt. Und als drei Reihen vor ihm jemand ins Stolpern geraten war, als sich ein Haufen murrender Leiber gebildet hatte, da war er einfach gesprungen. Hatte die vielleicht letzte Gelegenheit genutzt, um zu entkommen. Nebel. Ein kleiner Hang am Feldrand. Rein ins Gebüsch und fallenlassen. Liegenbleiben. Warten.
Der Rote Ludwig. Er lächelte müde. So hatten ihn die Parteigenossen in der KPD und später in der SPD genannt. Wer von ihnen war wohl noch am Leben? War er es selbst eigentlich noch? Jahrelang hatten sie versucht, ihm seine Gesinnung herauszuprügeln. Er hatte die rote Soße ausgekotzt, ausgehustet und ausgeschissen. Sie war ihm aus allen Körperöffnungen gekommen. Aber noch immer war genug davon da.
Wieder lächelte Steinfeld. Er war ein Linker, ein Roter. Die vielen Liter Blut, die er im Laufe der Jahre verloren hatte, waren dafür der Preis, den Hitlers Schergen von ihm verlangten. Mit der trockenen Zunge fuhr er über die wenigen Zähne, die ihm geblieben waren. Ludwig Steinfeld. Schutzhäftling Nr. 317. Verhaftet am 17. Mai 1933. Schutzhaft. Wer schützte wen vor wem? Den Grund erfahren Sie, wenn Sie vor den Richter kommen, hatte der Justizbeamte gesagt. Papiere, Kleidung, Wertsachen. Alles sauber notiert. Halt die Schnauze, sonst setzt es was. Das war die weniger freundliche, inoffizielle Übersetzung durch seine Wärter, später in der Zelle. Drei Jahre danach war seine Schwester gekommen. Der erste Besuch. Ihm wurde Angriff auf Partei und Staat mit besonderer Heimtücke im Zusammenhang mit dem Reichstagsbrand vom Februar 1933 vorgeworfen. Das war im August 1936. Olympische Spiele in Berlin. Und bis zur Verhandlung vor Gericht sollte er eben in Schutzhaft bleiben.
Den Prozess hatte es nie gegeben. Aber dafür viele kleine Tode. Beinahe zwölf Jahre Kolafu. Das Konzentrationslager Fuhlsbüttel. Fast zärtlich sprach das Wachpersonal von seiner Arbeitsstätte im Hamburger Norden. Dabei war das Zärtlichste, das Ludwig in seiner Haftzeit kennenlernte, der Betonboden gewesen, den er so oft zu spüren bekam. Wie oft hatte er sein zerschlagenes Gesicht am Stein gekühlt, um etwas Linderung zu erfahren! Der Boden war ebenso wie die Wände mit billiger Lackfarbe gestrichen. Da blieb nichts haften. Und die misshandelten Insassen mussten nach den Prügeln ihr Blut, ihre Tränen und ihre Exkremente selbst aufwischen.
Steinfeld wurde aus seinen Gedanken gerissen, aber er hielt die Augen weiter geschlossen. Nur schlafen. Etwas bewegte sich. Sein Fuß. Er kannte das. Seit Jahren schon war jede Nacht eine Flucht vor seinen Peinigern. Albträume verfolgten ihn. Er fiel immer in die Tiefe. Er lief davon, ohne vorwärts zu kommen. Immer erwachte er dann mit einem Zucken von Armen und Beinen. Aber diesmal war es anders. Da, wieder eine Bewegung. Er war es nicht selbst. Mühsam öffnete Steinfeld die Augen, blinzelte gegen die tiefer stehende Sonne. Noch einmal. Sein Fuß. Ein großer Schatten stand vor ihm. Sie hatten ihn. Endlich war es vorbei. In der Ferne wird man einen Schuss hören, dachte er.
»Was willst du hier?« Der Schatten sprach zu ihm. »Du bist einer von denen, oder?« Der Schatten kam näher. »Bist du Jude?«
Aus den Umrissen schälte sich ein klobiges Gesicht. Wettergegerbt. Faltig. Alt.
»Bist du Jude?«
Ludwig versuchte mühsam aufzustehen, aber etwas hielt ihn zurück. Sein Gegenüber drängte ihn mit einer Heugabel zurück an den Baumstamm. Ludwig wollte sprechen, doch zunächst gelang ihm nur ein Krächzen. Dann endlich schaffte er es, einige Worte herauszubringen.
»Nein. Ich war … Ich will …«. Mehr wurde es nicht. Er überlegte. Der Mann gehörte nicht zum Wachpersonal. Dann wäre er schon tot. Unterführer Kohnsen hatte es ihnen eingehämmert, als sie vor dem Tor von Kolafu abmarschbereit standen. Wer zurückbleibt, wird erschossen. Wer versucht zu fliehen, wird erschossen. Wer spricht, wird erschossen.
»Du kommst aus dem Knast. Jemanden umgebracht?« Die Zinken der Gabel drückten durch Ludwigs Hemd. Nur ein Kitzeln, kein Schmerz. Schmerz fühlte sich anders an.
»Politischer. Ich bin Sozi.« Steinfeld hob schwerfällig den Arm und deutete auf sein rotes Abzeichen an der Brust. Ein umgedrehtes Dreieck, der berüchtigte Winkel. Darüber seine Häftlingsnummer. Abgerieben. 317. Er war der Insasse mit der längsten Haftzeit. Die nächsthöhere Nummer war zuletzt 1419. Dazwischen lagen 1102 Schicksale. Schläge. Folterungen. Erniedrigungen. Tode.
»Wie heißt du?«
»Steinfeld. Ludwig Steinfeld.« Er schreibt dich auf und meldet dich, dachte er. So machen sie es in diesem korrekten Land immer. Tritt in den Arsch. Notiert. Drei Zähne raus. Notiert. Steinfeld, Ludwig. Notiert. Tot. Notiert.
»So kannst du dich auf der Straße nicht blicken lassen.« Der Druck der Gabel ließ nach. »Geh nach Hamburg rein. Da kannst du irgendwo in einem Keller unterkommen.«
»Ich will nach Norden.« Steinfeld spürte etwas Ungewöhnliches. Dieser Mann hatte Macht über ihn. Er konnte ihn töten. Sofort. Abstechen wie ein Schwein. Er konnte ihn verpfeifen. Er konnte ihn schlagen oder festbinden. Ludwig würde sich nicht wehren. Macht brüllt. Laut und ordinär. Und sie fügt dir Schmerzen zu. So war es in den vergangenen zwölf Jahren immer gewesen. Aber dieser Mann sprach normal mit ihm. Leise. Und etwas unbeholfen.
»Warte hier, bis es dämmert. Geh dann am Feld hoch bis zum Weg. Da steht der alte Heuwagen. Musste etwas für die Pferde holen. Das Gras ist noch zu wenig. Zu kalt. An der Seite findest du was zum Anziehen.«
Ludwig schwieg. Hatte er sich verhört? Der Mann wollte ihm Kleidung geben? 317 war also entlassen? Konnte er diesem Bauern trauen? Er wusste es nicht. Aber was blieb ihm anderes übrig? Ludwig Steinfeld kam in seiner Haftkleidung keinen Kilometer weit.
»Wo willste hin? Dänemark?«
»Meine Schwester. Bei Schleswig. Sie arbeitet da auf einem Hof.«
»Wenn sie dich anhalten, sag, dass du gerade Diphtherie hattest. Siehst ja so aus. Unser Heiner hatte das im Oktober. Zwei Monate Fronturlaub deswegen. Und dann, sagste, haben sie dich einfach dienstverpflichtet vom Arbeitsamt. Sollst zu dem Hof von Franz Petersen bei Rendsburg. Merk dir den Namen. Petersen, den kennt in Holstein jeder. Ist ein Großbauer, braucht jetzt immer Helfer. Papiere haste bei nem Tieffliegerangriff verloren. Klar?«
Der Mann sah so aus, als habe er eben mehr gesprochen als in den letzten zwei Jahren zusammen.
»Warum helfen Sie mir?« Ludwig kam sich dumm vor, aber die Frage war heraus.
»Wir haben seit drei Monaten nichts von unserem Sohn gehört.«
»Tut mir leid.« Wieder hätte er sich auf die Lippen beißen können.
»Er hat uns da ein paar Sachen erzählt. Heiner haut so schnell nichts um. Aber da hat er geweint. Und es passt zu dem, was sie aus den Vierlanden und aus Kaltenkirchen berichten. Und jetzt euer Marsch. Sie haben drei Leichen gefunden am Ochzenzoll. Waren wohl Kerle wie du.« Der Mann deutete mit dem Zeigefinger in den Nacken. »Genickschuss.« Er wirkte erschöpft. Atmete zweimal tief durch. Dann kramte er in einer Seitentasche seines riesigen Mantels. Und warf Steinfeld schließlich eine Tüte hin.
»Drei Stullen. Hast sicher Hunger. Und hier noch 'ne Pulle.« Er holte aus einer anderen Tasche ein Gröninger. Eine Flasche Bier. Dann wandte er sich ab. »Vergiss nicht. Erst bei Dämmerung. Und morgen früh weiter. Viel Glück.«
Das letzte Wort hallte nach. Wann hatte er sich zuletzt glücklich gefühlt? Als er mit Hanne im Roten Teufel auf St. Pauli getanzt hatte? In diesem anderen Leben. Als er mit seiner Schwester Eva an den Landungsbrücken Kaffee getrunken hatte? Sie wollte mit ihm nach Holland oder Belgien. So, wie einige Schriftsteller es im Frühjahr 1933 getan hatten. Steinfeld saß da. Er konnte es nicht glauben. Dann riss er die Tüte auf. Der Duft von Brot und Leberwurst. Gierig verschlang er die erste Stulle, dann noch die zweite. Den Bügelverschluss der Flasche bekam er vor Schwäche fast nicht auf. Schließlich gelang es ihm, und in hastigen Schlucken stürzte er den halben Inhalt herunter. Kurze Zeit später saß er zufrieden da und blickte in Richtung Sonne, die sich langsam dem Knick am Horizont näherte. Vielleicht noch ein bis zwei Stunden, dann musste er zum Heuwagen. Druck im Bauch. Er musste pinkeln. Nur kurz ausruhen.
Kommando-Pissen. So nennen wir es. Der einzelne Mensch wird herabgewürdigt, selbst in seinen Abortbedürfnissen. Auch das Pinkeln ist in diesem Staat Gemeinschaftsverrichtung. Hitler regiert selbst die Notdurft. Blasenfüllung und Entleerung auf Befehl. Kolafu ist berüchtigt für seine Brutalität. Hier atmest du nicht, ohne dass es dir befohlen wird. Kolafu ist die Mühle, in der sie dich zermahlen. Jeden Tag holen sie kleine Stücke aus den Gefangenen heraus. Sie haben Nonnermann dazu gebracht, nackt zu tanzen. Und dabei Heil Hitler zu rufen. Das Horst-Wessel-Lied musste er auch noch dazu schmettern. Unser guter Nonnermann. Er war der Roteste von uns allen. Wir nannten ihn Nase, weil er am Altonaer Blutsonntag 32 drei SA-Gröhlern die Gesichtszinken abgeschnitten hatte.
Also pinkeln. Alle Mann zum Latrinengang. Und alle wissen von Willi. Er ist bei der SA, dümmer als ein Stück Hartbrot. Aber hier ist er ein kleiner Gott. Er ist unser Pinkel-Aufseher. Jeder merkt, dass er gern zuschaut. Wenn wir alle an der Rinne stehen, reibt er sich notgeil mit seinem Gewehrschaft im Schritt. Schon seltsam. Hier stehen wir in intimer Gemeinschaft. Der rote Winkel, der schwarze, der grüne. Und lila ist auch dabei. Sie kriegen die meiste Prügel. Die Braunhemden hassen die warmen Brüder. Dabei war ihr Anführer, der dicke Röhm, ja selbst einer. Vielleicht deshalb? Wir stöhnen, weil wir endlich pissen dürfen. Und unser Willi stöhnt immer ganz zum Schluss. Wie geht es weiter? Die Tage sind immer gleich. Sie wollen, dass du jedes Interesse verlierst. An deiner Vergangenheit, deinen Freunden, deiner Geliebten. Am Leben. Wenn es soweit ist, dann bist du tot. Irgendwie merken sie es immer. Wenn du tot bist, können sie dich nicht mehr schikanieren. Ihre Methoden sind dann wirkungslos. Das macht sie wütend. Dann hängen sie dich auf. Sie wollen sehen, ob du wirklich tot bist. Das Gurgeln und Würgen. Das Zappeln und Strampeln. Dann darfst du ein letztes Mal pissen. Ohne Kommando. Deine letzte kleine Freiheit. Genieße sie.
Steinfeld erwachte. Er musste tatsächlich dringend sein Wasser loswerden. Es drückte gewaltig. Langsam, leise stöhnend erhob er sich und drehte sich zum Busch, der seitlich der Weide stand. Die Gelenke schmerzten. Die Sonne war untergegangen. Aber noch war es zu hell. Er wartete auf den Befehl. Na, los ihr Scheißkerle, wartet ihr auf Mama? Ach, nein. Er durfte jetzt selbst entscheiden. Aber plötzlich kam alles auf einmal. Ihm war übel. Er übergab sich. Krümmte sich. Der Urin lief über seine Beine. Wie so oft kotzte er sich die Seele aus dem Leib. Dann brach er zusammen. Zwei Brote. Ein halbes Bier. Zu viel für seinen geschrumpften Magen, der nur dünne Suppen und altes, gestrecktes Brot gewohnt war. Dämmerung. Dunkel.
Irgendwie bin ich immer beim Aufräumen dabei. Die Erhängten bringen sich ja alle selbst um. Erst fesseln sie sich die Hände auf dem Rücken, dann steigen sie auf den Schemel und legen den Kopf in die Schlinge. Ein kleines Stück Tampen, das am Fleischerhaken hängt. Dann stoßen sie den Stuhl weg. Immer und immer wieder steht es so in den Berichten. Seltsam, ich bin immer im Selbstmordkommando. Ich muss aufwischen. Und unterschreiben, dass ich den Gefangenen in seiner Zelle gefunden habe. Ordnung muss sein. Neulich habe ich Nonnermann weggeräumt. Er war ja schon tot, als er tanzte. Ja, so ist das in Kolafu. Ich habe aufgeräumt, als der Flughafen gebaut wurde. Dann habe ich aufgeräumt, weil sich so viele arme Schweine aufhängten. Und jetzt am Schluss räume ich Trümmer weg. Seltsam. Die Schläge der Aufseher schmerzen. Aber noch mehr schmerzt es, meine Stadt so zu sehen. Sie ist ebenso zerschunden wie wir. Jetzt brennen die Tommys die braune Pest aus Deutschland heraus. Und es wird Narben hinterlassen, fürchte ich.
Neulich war ich in der Häuser-Abteilung eingeteilt. Durchsuchen und sichern. Einige Steine waren immer noch glühend heiß. Wir arbeiteten ohne Handschuhe. Altmetall sichern. Leichen bergen auf Leichenbergen. In der Diagonalstraße in Hamm rauchte es. Volltreffer. Keller frei schaufeln. Los, ihr Abschaum, grabt! Da unten sitzt die deutsche Mutter mit ihrem Kind. Ich war seitlich auf ein unzerstörtes Zimmer gestoßen. Küche, jetzt mit Ausblick ins Freie. Friedlich saß die Alte am Tisch. Vor ihr ein Bild. In ihrer Hand. Daneben ein Becher Ersatzkaffee. So kalt wie sie. Aber ganz rosa schimmerte die eingefallene Haut. Sie wirkte so lebendig. Sie war die Tote, nicht ich. Oder? Wie zur Bestätigung spürte ich den Knüppel auf meinen Rücken eindreschen. Die deutsche Mutter wartet. Grab weiter, du Hund!
Steinfeld erwachte. Es war jetzt dunkel. Verdammt, zu spät, dachte er. Wie soll ich jetzt den Weg finden? Er stank erbärmlich. Zusammengebrochen und eingeschlafen in seiner Kotze und seinem Urin. Das letzte Brot und die halbvolle Buddel lagen etwas abseits. Ludwig Steinfeld bückte sich mühsam danach. Dann versuchte er, sich zu orientieren. Was hatte der Alte gesagt? Am Feld entlang. Bis zum Weg. Es würde wieder Frost geben heute Nacht. Jetzt halfen ihm die Erfahrungen aus Kolafu. Wenn du denkst, nichts geht mehr, dann geht noch eine ganze Menge. Ein Schritt vor den anderen. Ein Sekundenzeiger, der sich nicht im Kreis dreht, sondern geradeaus läuft. Schritt, Tick, Schritt, Tick. 317 ist der Sekundenzeiger, der nicht stehenbleibt. Noch ein Schritt. Und noch einer. Stehenbleiben. Aufziehen. Weitergehen. Sekunde um Sekunde. So übersteht ein Schutzhäftling die Jahre. Jene 4348 Tage. Indem er geht und geht und geht.
Anfang April ist es plötzlich hektisch in Kolafu. Es gibt schon seit Tagen Gerüchte. Die Briten kommen. Sie sind schon bei Stade. Der Küchendienst hat etwas aufgeschnappt. Sie wollen das Lager räumen. Nach Norden. Nach Schleswig-Holstein. Entweder brauchen sie uns dort für irgendwelche Arbeiten. Oder sie lassen uns einfach in einer Kiesgrube verrecken. In Buchenwald hatten sie das auch geplant. KL Buchenwald. Sie hatten mich im Januar dorthin verlegt. Rote und schwarze Winkel sollten zu einem Sonderbataillon ausgebildet werden. Kriegseinsatz für Politische und Verbrecher. Wehrbewährung nannten sie das. Das letzte Aufgebot. Mich haben sie gleich ausgemustert. Zu schwach. Der Geistliche, mit dem ich die Zelle teilte, sagte dann, ich hätte Schwein gehabt. Diese Bataillone würden alle verheizt. Und viele der Untauglichen hätten sie einfach erschossen. Im März haben sie mich dann wieder hierher nach Hamburg verlegt. Wie war der Urlaub?, hatte Willi gefragt. Gut erholt? Na, dann wollen wir doch gleich mal sehen, was du aushältst. Ich lebe noch. Gerade so viel, dass es ihnen auch nach all den Jahren noch Spaß bringt, mich zu schikanieren und das Leben aus mir herauszuprügeln. Aber ich lebe noch. Das bisschen brauche ich jetzt. Jetzt oder nie.
Ludwig Steinfeld wurde wieder aus seinen Gedanken gerissen. Da vorn, ein schemenhaftes Schwarz. Als er näher herankam, bemerkte er, dass es tatsächlich der Heuwagen war. Glück gehabt. Vorsichtig versuchte er, sich umzublicken. Er horchte auf verdächtige Geräusche. Dabei wusste er, dass er sowieso nichts tun könnte. Ein Fünfjähriger würde ihn in seinem Zustand einfach umhauen. Nummer 317 war am Ende. Langsam begann er, seitlich im Heu zu wühlen. Nichts. Verzweiflung und Enttäuschung begannen sich in ihm auszubreiten. Aber da. Eine Wolldecke. Darin eingewickelt ein paar Schuhe, eine Hose, ein Hemd und eine Jacke. Drei Mark und ein paar Groschen. Ein kleines Stück Kernseife. Ludwig Steinfeld ging in die Knie, rutschte mit dem Rücken am Wagenrad hinunter. Er klammerte dieses kleine Bündel an sich. Er weinte. Zwölf Jahre. Sie hatten es fast geschafft, ihn zu brechen. Ihm allen Glauben an das Menschliche zu nehmen. Aber nicht ganz. Mit einem Ruck und letzter Kraft stemmte er sich hoch. Trotz der Kälte schleppte er sich zur Viehtränke. Dort entkleidete er sich. Er rieb die raue Seife über die Haut, bis jede Stelle brannte. Es war, als wollte er jede Zelle abschrubben, die mit Fuhlsbüttel in Kontakt gewesen war. Zum Schluss stieg er in den Trog. Baden. Welch ein Vergnügen! Diese Kälte war anders als die Kälte seiner Haftzeit. Diese Kälte zeigte ihm, dass er noch lebte. Er summte die Internationale. Sollten sie ihn doch hören. Die ganze Welt sollte es hören.
Erschöpft kleidete sich Steinfeld schließlich nach einer gefühlten Ewigkeit an. Er zitterte und glühte zugleich. Seine Haut prickelte. Der Gestank war fort. Die schlichte Kleidung gab ihm einen Teil seiner Würde zurück. Er richtete sich auf, spürte das Knacken der Wirbel in seinem krummgeschundenen Rücken. Er war so müde. Und noch war Zeit. Er überlegte. Dann kletterte er auf den Wagen und vergrub sich in seiner Decke im Heu. Gierig sog er den Duft des Grases ein. Es war, als ließen seine Lungen den Odem des Grauens aus sich heraus. Nur ein bisschen schlafen. Dann weiter, zu Eva. 317 war tot. Ludwig Steinfeld lebte.
Goldfasan14. April 1945
Die Schänke in Kattrup kannte nur wenige Gäste, die von außerhalb kamen. Das Dorf lag in der Mitte von Nirgendwo in der Angeliter Landschaft. Zwischen Sörup und Mohrkirch. Nördliches Schleswig-Holstein. Zehn Höfe, Kaufmann, Postamt, Bäcker, Schmied und Schuster. Und natürlich der Pastor. Ein Ort wie viele Tausend andere Orte in Deutschland. An einer Seite der Kirche schienen die Häuser in einer Art Wettbewerb um die Nähe göttlichen Beistands bemüht. Es war, als wollten deren Erbauer und Bewohner sichergehen, dass sie wenigstens bei ihrem Herrgott zum Schluss nicht leer ausgingen. Klein und geduckt blickten die einfachen Gebäude schüchtern auf zum schlichten, großen Kirchenschiff aus Backstein. Hier wohnten schon immer die ärmeren Landarbeiterfamilien, der Schneider, die Näherin und die Tagelöhner. Zur anderen Seite des Gotteshauses erhob sich die Pracht der wenigen Bürgerhäuser. Das – ehemals kaiserliche – Postamt hatte bessere Tage gesehen und war seit zwanzig Jahren nur schlecht instandgehalten worden. Das dreistöckige Gebäude von Kaufmann Leversen gab sich städtisch, bedeutsam und weltmännisch. Nur das Haus des Bürgermeisters buhlte mit ihm in diesen Eigenschaften um die Wette. Seit zehn Jahren wohnte dort nun schon der Ortsleiter der Partei, Adolf Rücker. Mitte der dreißiger Jahre hatte die NSDAP das Gebäude von der Familie Mannstein erworben. Zu einem lächerlichen Kaufpreis. Die Mannsteins waren jüdischer Herkunft und hatten dem Druck des braunen Systems letztlich nachgegeben. Auch in Kattrup fanden sich deutsche Schicksale wie hunderttausend andere. Der Parteileiter und Bürgermeister Rücker war ein ganz Strammer. Er verfasste Berichte über die Ernte, das Wetter, über das Verhalten der Zwangsarbeiter, die Stimmung der Einheimischen. Ja, selbst Bierkonsum und Gottesdienstdauer wurden von ihm vermerkt. Die vom vorderen Balkon seines Hauses herabhängende, rote Fahne mit der schwarzen Swastika hatte in diesem Winter Risse bekommen. Stoff war knapp in Zeiten des nahen Endsiegs, so dass Helga Reimers, die Dorfschneiderin, mehrmals zum Flicken kam.
Ein paar Kleinigkeiten waren aber doch anders geworden. In letzter Zeit schlichen nachts Gestalten über die Feldwege. Die Kattruper tuschelten über allerlei Gründe dafür. Da vergraben einige ihren Besitz, sagten die einen. Damit die Tommys nichts finden. Die Abergläubigen und Ängstlichen raunten etwas über die ruhelosen Geister der in der Ferne Gefallenen. Der Rücker verscharrt seine Bücher, sagten wieder andere. Dann kann er später behaupten, er sei schon immer gegen die ganze Sache gewesen. Mit der letzten Vermutung hatten die Kattruper durchaus Recht. Adolf Rücker war in höchster Sorge. Der Brief eines alten Freundes hatte ihn aufgeschreckt. Darin hatte der beschrieben, dass die Russen in den eroberten Dörfern jeden Bürgermeister aufhängten. So hatte sich Rücker entschieden, einige Kisten und Koffer mit allzu belastenden Dokumenten zu vergraben. Auch Stotter-Uwe, der Dorftrottel, war nächtlich oft unterwegs. Und er wurde tatsächlich von Geistern verfolgt, von den Dämonen seiner eigenen Vergangenheit.
Der Dorfkrug lag an der Straße nach Mohrkirch. Weit genug entfernt vom Kirchbau, dicht genug am Friedhof. Wurde einer von ihnen unter die Erde gebracht, dann wollten die Leute im Winter keine langen Wege gehen und nicht lange frieren, wenn sie auf den Verblichenen ein Glas heben wollten. Der Tod gehörte zum Leben. Wo wusste man das besser als auf dem Land? Seit fünf Jahren wurde auch auf die getrunken, die nicht mehr nach Hause kamen. Die in fremder Erde lagen. Johann vom Sanner-Hof. Bernhart und Klaus von den Jansens. Thorwald aus Alt-Kattrup. Und Jürgen »Mugge« Reimers, der Sohn der Schneiderin. Sie hatte kein Geld, um den Klaren für alle zu bezahlen. Getrunken wurde dennoch. Die Wirtsleute verdienten ihr Geld mit Bier, Köm und Schmalzbroten. Aber die Schankgeschäfte gingen schlecht dieser Tage. Der Ruf Wirt, bring nochn Lütt un Lütt erklang viel seltener als vor dem Krieg. Die Arbeiter aus dem Osten und auch jene aus Frankreich, Holland oder Belgien durften hier nicht einkehren. Ausschank nur für arische Kehlen. Als würde es den Kümmel oder das Bier stören. Die Alten plagte das Rheuma, sie tranken auch nicht mehr so viel. Der oberste Ringrichter hatte sie schon angezählt, sie hatten nur noch ein paar Jahre. Jetzt wollten sie plötzlich gesünder leben. Und kippten nur noch drei Bier am Abend. Sie spielten aber immer noch Karten, würfelten, redeten, lachten ihr zahnloses Lachen. Junge, trinkfeste Burschen, die Umsatz brachten, gab es in Kattrup derzeit wenige.
Der Wirt, Henning Weber, war ein sehr schweigsamer Mensch. Das war nicht immer so gewesen. Lungendurchschuss und Bauchschuss. Das ganze Paket. Der rechte Fuß versteift. Sie hatten ihn bei Charkow nach einem Mörsertreffer aus dem Panzer gezogen. Ach ja, seinen linken Arm hatten sie dabei drin gelassen. Nebensache. Jetzt war er eben wieder Wirt. Und diente dem Vaterland als Wehrführer der Feuerwehr von Kattrup. Mit einer Handpumpe und drei Eimern. Der Rest war für Frontzwecke requiriert. Gegen Quittung. Weber hatte viel gesehen. Er schlief nicht mehr gut. Seine Frau nahm ihn nachts oft in die Arme, dann verstummte sein Wimmern für ein paar Stunden. Sie war froh, ihn wieder zu haben. Und dennoch war er ihr fremd, dieser in sich gekehrte Mann. Er war immer fröhlich gewesen, der Letzte auf allen Festen.
Frieda Weber kümmerte sich um die kleine Pension, die zum Krug gehörte. Dort gab es nur vier winzige Zimmer. Sie lagen im Ober- und Dachgeschoss der Wirtschaft. Aber Besuch in Kattrup, der nicht bei den Familien unterkam, war in den letzten Jahren immer seltener geworden. Gerhard Lessling war allerdings Stammgast hier. Und obwohl beide Webers ihn nicht mochten, konnten sie das Geld, das er brachte, gut gebrauchen. Seit Anfang des letzten Jahres kam er alle vier bis sechs Wochen für eine Nacht, manchmal blieb er auch länger. Die Leute tuschelten anfangs. Schließlich war Lessling ein hohes Tier. Stellvertretender Kreisleiter von Flensburg-Land. Als er das erste Mal auftauchte, war er kurz bei Ortsleiter Rücker vorbeigegangen und hatte ihm untersagt, sein Erscheinen in Kattrup in den Berichten zu erwähnen. Geheime Parteisache, haben wir uns verstanden, Rücker?, hatte er den Mann angekeift. Jawoll, Herr Kreisleiter!, war die devote Antwort. Gerhard Lessling war zwar nur stellvertretender NSDAP-Leiter in Flensburg-Land. Aber er gab sich dennoch wie ein Fürst aus altem Adelsgeschlecht. Wenn er seine Haushälterin bumste, musste sie ihn Graf nennen. Und Lessling war ein Goldfasan. So lautete der Spottname beim einfachen Volk für jene Parteibonzen, die sich fein herausputzten und aufplusterten. Es waren NSDAP-Mitglieder in Führungspositionen, deren Uniformen in typischem Kackbraun mit Lametta und Gehänge tatsächlich entfernt an die Vögel erinnerten. Und so kannte man Lessling zu offiziellen Anlässen. Dann trug er seine Phantasieuniform mit Tressen und Orden. In den vergangenen Jahren war er immer breiter geworden. Seine Villa in Glücksburg glich eher einem feudalen Herrensitz. Kleiner Hermann. Das war hinter vorgehaltener Hand sein Spitzname beim Landvolk, seit die Begeisterung für die braune Sache bei den Leuten etwas nachgelassen hatte. In Anspielung auf den trägen und korpulenten Reichsfeldmarschall Hermann Göring, der ebenfalls in Saus und Braus lebte, große Gesten und wichtigtuerisches Gehabe liebte. Göring und Lessling brauchen sicherlich für ihre Sachen doppelt so viel Stoff wie andere Leute, sagte Helga Reimers, die Schneiderin, leise.
»Bring mir den Matjes, Henning. Ich hoffe, dass sie diesmal länger eingelegt waren. Das letzte Mal habe ich mich an den Gräten verschluckt«, blaffte Lessling. Er saß in der Wirtsstube am Ecktisch. Auf die Stühle passte sein Hintern nicht, deshalb nahm er immer die Bank. Dann musste Henning, der Wirt, den Tisch weiter in den Raum ziehen, damit Lesslings Bauch dahinter Platz fand.
»Und die Bratkartoffeln. Mehr Speck drin, sag das deiner Frau.«
Henning Weber kannte diesen Typus Mensch. An der Front herrschte ein rauer Ton, alle traten nach unten und buckelten nach oben. Echte Kameradschaft war selten, auch wenn die Wochenschauen das Bild vom rauen, aber herzlichen Landser malten. Gerhard Lessling war jedoch noch eine Spur anders. Gemeiner. Widerwärtiger.
Die Kartoffeln waren nach kurzer Zeit fertig, und Weber wollte den Teller füllen. Aber seine Frau hielt seinen Arm kurz fest.
»Warte, Henning. Es fehlt noch die besondere Würze.« Unvermittelt spuckte sie in die Kartoffeln und rührte den Speichel unter den Speck.
»Das Schwein hat es verdient, besonders behandelt zu werden. Er besteht doch immer darauf, also bitte.« Frieda sah ihrem Mann in die Augen.
Henning Weber kannte den Grund für die Abneigung seiner Frau. Es war nicht ihre Art, aber niemand mochte den Fettsack, und sie war von ihm belästigt worden. Vor einigen Monaten hatte sie Lesslings Gästezimmer betreten, und er hatte versucht, sie ins Bett zu ziehen. Weinend hatte sie ihrem Mann erzählt, wie sie sich von dem schwabbeligen, schwitzenden Körper und dem ungeniert gezeigten, erigierten Glied weggerungen hatte. Nun sollte er wenigstens vorzüglich speisen.
»Was willst du denn hier, du sabbernder Bastard?«, drangen Lesslings Worte gedämpft aus dem Schankraum.
Weber nahm rasch den Teller mit den Kartoffeln, seine Frau folgte mit zwei Tellern Matjes. An der Theke stand Uwe Ranken, den alle nur Stotter-Uwe nannten. Er sah ängstlich zu Lessling hinüber. In seinen Augen schimmerte es feucht.
»E-E-Entschuldig-, g-g-gung, H-H-Herr …« Uwe war vor über zehn Jahren nur knapp dem Tod entgangen, als er bei Gleisarbeiten an der Bahnstrecke Hamburg–Rendsburg von einem Güterzug gestreift worden war. Seitdem stotterte er und weinte oft ohne ersichtlichen Grund.
»Halt dein Maul, du verdirbst mir den Appetit. Leute wie dich hätten sie auch …« Lessling unterbrach sich, als er die drei Teller sah. Seine Augen leuchteten gierig. Henning Weber schob den verunsicherten Uwe in die Küche und gab ihm ein halbes Glas Bier.
»Na endlich. Wurde auch Zeit.« Lessling grunzte.
Einen Augenblick danach nahm er den größten Hering vom Teller, legte den Kopf in den wulstigen Nacken und verschlang den Fisch mit einem genüsslichen Schmatzen. Die übriggebliebene Schwanzflosse warf er achtlos neben sich auf den Tisch. Wenig später liefen Fetttropfen an seinen Mundwinkeln herab, als er die Bratkartoffeln in sich hineinschaufelte. Frieda Weber lächelte still.
Henning Weber war ein Wirt, der keine Fragen stellte. Er befolgte damit die Grundregel, die in Kneipen auf der ganzen Welt galt. Der Wirt war das zweite Ohr Gottes. Das erste fanden die Leute in der Kirche. Aber sie wollten immer sichergehen, dass sie auch gehört wurden. Deshalb kamen sie zu Henning. Trinken. Beichten. Und Absolution finden im Vergessen. Henning war noch verschwiegener als Pastor Voller. Darauf konnte man sich verlassen. Was er hörte, schloss er weg. Vergrub es in seinem säkularisierten Herzen. Beichtgeheimnis mit Reinheitsgebot. Ein bisschen gesprächiger könnte er sein, der Henning, sagten die Leute. F-f-früh-her w-war er a-a-anders, sagte Stotter-Uwe. Aber man konnte nicht alles haben, dachten sie und zuckten die Schultern. Auch bei Gerhard Lessling stellte Weber keine Fragen. Ein Gast, der zahlte, konnte sich da oben mit Josef Stalin treffen. Und niemand würde ein Wort von Henning Weber erfahren.
Kreisleiter Lessling kam aber nicht, um sich im Dorfkrug von Kattrup mit dem russischen Diktator zu treffen. Er wollte auch nicht dem ländlichen Volk aufs Maul schauen. Er verachtete die einfachen Leute. Und er ließ sie seine Verachtung spüren.
»Wer mit Scheiße und Pisse düngt, hat das Zeug irgendwann auch im Blut.« So hatte er betrunken bei Webers gegrölt.
»Der deutsche Bauer muss nicht denken, er soll das Volk ernähren.«
Einmal war es bei einem Streit mit dem alten Sanner, der gerade die Nachricht erhalten hatte, dass sein Sohn gefallen war, fast zu einer Prügelei gekommen. Es war Frieda Webers Geschick zu verdanken, dass Sanner nicht verhaftet worden war. Sie hatte eine Flasche uralten Cognac aus dem Keller geholt. Ein Geschenk zu ihrer Hochzeit. Damit hatte sie Lessling derart abgefüllt, dass dieser sich am nächsten Morgen an rein gar nichts hatte erinnern können. Es gab im Dorf fast niemanden, mit dem sich der Parteibonze nicht anlegte.
»Männer wie ich sind der neue Adel. Stolz und aufrecht. Reines deutsches Blut schafft reine Menschen.« Seine eigene Hakennase, die fliehende Stirn und die gedrungene, kleine Statur übersah er dabei geflissentlich.
Gerhard Lesslings Bruder Paul führte ganz in der Nähe von Kattrup den Hof der Familie. Er war Bauer wie seine Väter vor ihm. Die Felder und Gebäude lagen einige hundert Meter westlich von Kattrup. Paul Lessling kam nur selten ins Dorf. Er ist ein Sonderling, sagten die Leute. Gerhard fuhr bei seinen Besuchen in Kattrup meistens gegen Vormittag mit seinem schmucken Mercedes vor. Zu offiziellen Anlässen hatte er einen Fahrer, aber hierher fuhr er selbst. Nach dem Mittagessen machte er sich zu Fuß auf den Weg zum Gehöft seines Bruders. Offenbar wollte er den kostbaren Wagen auf dem Feldweg, der dorthin führte, nicht strapazieren. Jedenfalls bot er manches Mal einen seltsamen Anblick, wenn er, rund wie eine Kugel, in geputzter Parteimontur über diesen Weg in westliche Richtung stapfte. Dabei hatte er dort bei seinem Bruder offiziell ein kleines Haus und zwei Scheunen gemietet. Es war das kleine Altenteilerhaus des Hofs, das nach dem Tod der Eltern leer gestanden hatte. Rücker gegenüber hatte er erklärt, dass er die Landluft so liebe. Und außerdem sei er der Scholle seiner Vorfahren derart verbunden, dass er in Zukunft immer ein paar Tage hier ausspannen werde. Vorher müssten die Gebäude jedoch umfangreich renoviert werden. Rücker hatte ihm kein Wort geglaubt, aber genickt. Jeder in Kattrup wusste, dass die beiden Brüder sich nicht ausstehen konnten. Der ältere Paul hatte den Hof vor etwa sechzehn Jahren übernommen und seinem Bruder dessen Erbanteil ausgezahlt. Gerhard Lessling hatte das Geld mit Frauen, Alkohol und windigen Geschäften innerhalb von drei Jahren durchgebracht. In der Wirtschaftskrise war er dann bankrott gewesen. Daraufhin war er immer wieder bei Paul angekommen und hatte um Geld gebettelt. Er hatte ihm mit Klagen gedroht, da er sich beim Erbe der Eltern betrogen sah. Nach der Machtübernahme Hitlers war er in die NSDAP eingetreten. Er war ein typischer Märzgefallener, wie alte Parteigenossen jene nannten, die der Partei erst nach dem Wahlsieg im März 1933 beitraten. Schnell schossen die Mitgliedszahlen damals dank solcher Opportunisten in die Höhe. Hätte die KPD gewonnen, würde er heute wohl den Text der Internationalen auf seinen fetten Arsch gemalt umhertragen, so hatte es sein Bruder einmal im Zorn ausgedrückt. Gerhard Lessling nutzte damals sofort erste Verbindungen zu den neuen Parteifreunden, um seinen Bruder unter Druck zu setzen. Schließlich endete ein richterliches Schiedsverfahren mit einem Vergleich. Zähneknirschend musste Paul Lessling seinem Bruder nochmals eine Geldsumme ausbezahlen. Danach sahen und sprachen sich die Brüder zehn Jahre nicht. Gerhard machte Parteikarriere, bis er schließlich bei der Kreisleitung der NSDAP in Glücksburg landete. Auch hier zeichnete er sich durch eine Unlauterkeit aus, die selbst hartgesottenen Parteimitgliedern ein Dorn im Auge war. Von bevorstehenden Enteignungen jüdischen Besitzes im Landkreis wollte er als Erster informiert werden. Und er gab oftmals unverschämt niedrige Gebote für Häuser, Inventar, Kunstgegenstände oder Ländereien ab. Dabei untersagte er etwaigen anderen Interessenten mitzubieten. Sein Bruder Paul bewirtschaftete unterdessen weiterhin den Bauernhof. Im Frühjahr 1943 war Gerhard Lessling dann mit großem Pomp unangekündigt auf dessen Hof erschienen. Die beiden Brüder hatten sich so laut angeschrien, dass noch auf den Feldern ringsherum jedes Wort zu hören gewesen war. Volksverräter, Judenfreund und Kommunistenschwein waren die Kosenamen gewesen, die Gerhard für seinen Bruder fand. Parasit, Speckmade, Parteigewinnler und Etappenkasper, hatte Paul entgegengehalten. Offenbar hatte der Jüngere mit einer Durchsuchung des Gehöfts und penibler Prüfung der Buchhaltung gedroht. Schließlich hatte sich Paul Lessling bereit erklärt, seinem Bruder das Altenteilerhaus und zwei Scheunen zu vermieten.
Seit über zwei Jahren spielten sich nun jeden Monat seltsame Szenen in Kattrup und auf Lesslings Hof ab. Lessling kam, aß zu Mittag und begab sich dann zu seinem Haus. Etwa zwei Stunden später trafen dann mehrere Lastkraftwagen der Wehrmacht in Kattrup ein. Ohne Halt ratterten sie den Feldweg zu Paul Lesslings Hof weiter. Beim ersten Mal dachte noch jeder an die Renovierung des Altenteilerhauses. Die Partei nutzte gern ihre Beziehungen zum Militär, um kostengünstig an Arbeitskräfte und Material zu kommen.
Als dann jedoch weitere LKW-Ladungen eintrafen, Monat für Monat, weckte das doch die Neugier der Kattruper. Stotter-Uwe wollte hinter einer verrutschten Plane einige Koffer gesehen haben. Und der Sohn von Dietrich Pengler, einem Landarbeiter, hatte einen riesigen Besteckkasten gefunden. Darin befanden sich drei Dutzend silberne Vorlegelöffel. Der Lessling gibt wohl ein Fest für uns, sagte Pengler, als er die Fundsache bei Rücker abgab. Sei bloß still, antwortete dieser nur. Wie es schien, kamen die Renovierungsarbeiten an Gerhard Lesslings neuer Sommerfrische auch nach über zwei Jahren immer noch nicht zu einem Ende. In schöner Regelmäßigkeit rollten die Laster durch Kattrup. Und in den Wochen dazwischen verließen immer wieder kleinere Transportfahrzeuge den Lessling-Hof. Das Hin und Her erregte die Gemüter der Ortsansässigen schon längst nicht mehr.
Valkyrja18. April 1945
Der Frühling ist schön in Flandern. Druwes Träume begannen immer so. Oder so ähnlich. Über dreißig Jahre waren inzwischen vergangen. Als Jüngling war er in den ersten großen Krieg gezogen. Und als Mann war er zurückgekehrt. In früheren Jahrhunderten wurden daraus Legenden, große persönliche Heldengeschichten. Aber für Jens Druwe blieben nur Erinnerungen an Leid und Tod.
In Flandern blühen alle Blumen zur selben Zeit. Denn alles ist möglich in Träumen. Schneeglocke und Mohn. Narzisse und Fingerhut. Küchenschelle und Dahlie. Der Duft. Die Farben. Manchmal kann er die Szenerie sogar spüren. Er kann berühren und schmecken, was er träumt. Aber er hört es nicht. Druwe mag kein Windgeflüster in seinem Traum, kein Vogelgezwitscher, kein Bienensummen. Er mag es still. Seine tiefe Sehnsucht nach Ruhe lässt ihn sein Kunstwerk ohne Ton komponieren. Weich, warm, rund und leicht. In guten Träumen ist nichts hart, kalt, kantig und schwer.
Und doch zieht in Flandern ein Gewitter auf. Donnergrollen in der Ferne kündet dem Träumer vom nahen Ende seiner Idylle. Ein Beben geht über den Grund. Wo eben noch fest das Vertrauen, regiert jetzt die Angst mit zittriger Hand. Druwe will schreien, doch er hat sich selbst zum Schweigen gebracht. Er will laufen, doch er hat sich gekettet. Er will die Augen schließen, doch die Lider harren offen. Dann kommen sie. Graue Gestalten marschieren, eine Flut der Körper bricht herein, sie stoßen und zerren an ihm, aber er steht nur da. Verdammt, den Marsch der Toten zu betrachten. Sie singen aus stummen Mündern ihr Lied. Und nur er vermag die Botschaft zu hören, in seinem Inneren zu spüren: Wir alle kehren mit leeren Händen zurück. Wir zerfallen alle zu Asche. Sieger und Besiegte. Und am Ende sind wir alle eins.
Druwe wusste nicht, warum ihm diese Worte immer wieder durch den Kopf gingen. Sie waren Bestandteil unzähliger Träume, die ihn seit so vielen Jahren heimsuchten. Immer wollte er die Idylle und die Schönheit festhalten. Aber ein ums andere Mal entglitten sie ihm. Wichen dem düsteren Grauen.
Wir. Im Graben, da liegen wir. Leben wir? Da keiner von ihnen die Restzeit kennt, die ihnen in diesem beschissenen Loch bleibt, haben sie alle aufgehört, vom Leben zu sprechen. Sie sind einfach nur da. Das muss reichen. Am nächsten Tag rauchst du mit anderen. Weil Hinrich oder Grubbe in irgendeiner Schlammpfütze zerfetzt wurden. Die erste Granate erkennt man am hohen Pfeifen, mit dem sie näher kommt. Sollst du hoffen, dass es eine andere Stellung trifft? Macht dich das mitschuldig am Tod der Kameraden dort, wenn dies deine einzige Hoffnung ist? Die erste Granate singt das Hohelied der Hoffnung. Schlägt sie weitab ein, dann kannst du reagieren. Deckung suchen, ausweichen oder beten. Schlägt sie bei dir ein, brauchst du nichts weiter tun. Nur warten, dass es dunkel wird. Schlägt sie aber ganz nah ein, dann ist das, was danach kommt, noch viel schlimmer. Jeder weitere Treffer reißt etwas aus deinem Inneren heraus. Stück für Stück wirst du weniger. Und weniger. Wenn es vorbei ist, jubeln einige. Andere bekommen hysterische Weinkrämpfe. Und du? Stehst da und siehst dich davonfliegen. Viele kleine Teile deiner Seele tanzen über dir und sind dann fort. Du atmest und bist doch schon tot. Das Herz schlägt und pumpt Blut durch deinen Leichnam. Kein Kratzer am Körper, aber der Schmerz frisst dich auf. Langsam. Und unaufhaltsam.
Wieder und wieder brechen die Granaten über sie herein. Die schon Toten laufen aus den Gräben, stürmen in stählerne Gewitter. Erst dann sterben sie ein letztes Mal, im Blick die Blitze gieriger Mündungen. Die Erde ist schon längst nur noch Dreck und Blut. Gepflügt und geschändet von Abertausenden Nagelstiefeln. Wie hältst du das bisschen Leben fest, das dir bleibt? Druwe liegt still da. Das Bersten der Bunkerbohlen, das Aufspritzen der verwundeten Erde, die Schreie der Kameraden. Er ist ruhig. Der Himmel könnte klar sein über ihm, wäre er nicht schwarz. Schwarz von Rauch und Asche, Dampf und Dunst. Neben ihm liegt Konrad. Wie lange ist er tot? Sekunden? Oder Jahre? Druwe sieht seinen Kameraden, erstarrt im Todesakt. Die Hand am Gewehr, die andere an der Patronentasche. Es ist alles eins. Ein Soldat geht, einer bleibt. Die Todeshand wird wieder nachladen. Und andere sterben lassen. Ob in diesem Moment ein neues Leben gezeugt wird? Irgendwo. Sicher. Es ist alles eins. Der Himmel ist blau über Flandern. Anderswo. So tief unten, muss es ein Oben geben. Druwes Gedanken gehen zu seinen Eltern. Hatten sie recht? Ihr Entsetzen, als er ihnen mitteilte, dass er in den Krieg gehen würde. Freiwillig. Es ist alles eins. Ehre und Stolz. Dreck und Demut. Am Ende nur zerfetztes Fleisch. Mehr nicht. Oder? Konrad und seine Tasche. Er hat alles, was ein Soldat braucht. Er liegt in Deckung, bereit zum Sprung. Das Gewehr geladen, die Patronen griffbereit. Er sieht aus, als warte er auf den Befehl. Es ist alles eins. Nur sein Kopf fehlt, der kleine Krater auf seinen Schultern hat einen letzten roten Schwall ausgestoßen. Eine letzte, verzweifelte Eruption des Lebens, die nun geronnen und gallertartig den Dreck bedeckt. Bereit zum Gegenangriff. Die Tasche. Druwe wendet den Blick nicht ab. Sekunden. Oder Jahre. Es ist alles eins. Die Tasche ist aus Leder. Das arme Tier. Tot. Druwe betrachtet fasziniert die kleinen Punkte und Striche an der Oberfläche. Ziege oder Rind. Sind es Bremsenstiche? War es der Weidezaun? Konrads Finger haben die Taschenkappe speckig glänzend werden lassen. Tasche auf, Tod rein. Tasche zu. Tasche auf, Tod raus. Der Verschluss ist rostig. Konrad hätte sie besser pflegen müssen. Die Kanten abgestoßen. Hoch. Raus. Laufen. Rein. Runter. Und wieder hoch. Leben geht in Kreisen. Der Tod beendet nichts. Er bringt nur Taschenträger zum Stolpern. Wie gut. Druwe und die Tasche sind eins. Er hält sie fest, sie umfasst seine Seele. Und sie hält fest, was noch von seinem Menschsein übrig ist. Er fühlt die Geborgenheit. Der Frühling ist blutig in Flandern. Im Herbst 1914.
Immer erwachte Druwe nach diesem Traum schweißgebadet. Oft war es dann noch mitten in der Nacht, gegen drei oder vier Uhr. An Schlaf war nicht mehr zu denken. Rauchen. Nachdenken. Ein Glas Korn. Oder zwei. Manchmal konnte er die Kraft aufbringen zu lesen. Die Zeiten ändern sich nicht wirklich, dachte er. Flandern lag jetzt nahe Berlin. Die Jungs waren andere als damals. Aber es waren wieder Jungs, die Dreck fraßen. Druwe rieb sich seinen rechten Unterarm. Verdammte Schmerzen! Sein Dachzimmer lag in der Nähe des Glücksburger Schlosses, unweit der Polizeiwache. Öfter ging er um den See am Schloss herum, wenn er klare Gedanken fassen wollte. Viel zu tun gab es in dieser Kleinstadt am Rande der Flensburger Förde nicht. Und es war eine Strafe für ihn, hier zu sein. Berlin und davor Hamburg. Dort schlug sein Puls. Dafür hatte er gelebt. Jetzt war er hier Revierleiter. Oberleutnant Druwe, bald wieder Hauptmann, weil er dieses Jahr fünfzig wurde. Nach allem, was er erlebt hatte, gefiel ihm der Polizeidienstgrad besser: Inspektor. Aber jeder Mann in diesem Land schien einen militärischen Rang innehaben zu müssen. So hatten es Hitler und Himmler verfügt. Also war er nun Oberleutnant Inspektor Druwe von der Ordnungspolizei. Wer hatte sich diesen beschissenen Namen bloß ausgedacht? Ordnungspolizei. Ruhe und Ordnung. Ein Possenspiel in diesen Zeiten des Weltenbrands. Wie sehr er die Arbeit bei der Berliner Kripo vermisste. Kriminalpolizei. Kommissar Druwe. Ja, zu jener Zeit war er Polizist gewesen. Jetzt aber war er nur ein Stuben- und Amtskasper.
»Was hast du gesehen, Paul?« Koks-Paule war Druwes bester Spitzel in Berlin. Er wusste, dass Druwe ihn jederzeit verhaften konnte. Mindestens ein halbes Pfund Kokain bunkerte er auf seiner Bude. Die Sternchen und Herrschaften bezahlten es in Gold. Aber Kommissar Druwe war nicht dumm. Denn er wusste seinerseits, dass er seinen besten Mann hier draußen verlieren würde. Also nahm er Paul nicht hopps, sondern nutzte ihn, um an brandheiße Informationen heranzukommen. Quid pro quo. Paul blieb unbehelligt, solange er plapperte.
Der Anschlag auf Josephine Baker und Karl Vollmoeller im Sommer 1926. Eine Handgranate hat Vollmoellers Wohnung verwüstet. Täter unbekannt. Da die illustre Gesellschaft aber um zwei Uhr morgens noch gar nicht zu Hause ist, wird niemand verletzt. Vollmoellers legendäre Partys am Pariser Platz. Und er, Druwe, mittendrin in den Ermittlungen. Um vier Uhr morgens empfängt ihn Vollmoeller in einem anderen, flugs angemieteten Palais. Das Feiern muss schließlich weitergehen. Sein Treffen mit Künstlern soll trotz der Widrigkeiten stattfinden. Druwe ist durch seine Arbeit einiges gewohnt. Aber die Damen, die hier, nur mit etwas dünner Leinwand bekleidet, vor ihm tanzen, lenken ihn doch etwas ab. Und zwei Frauen im Smoking, darunter sind sie allerdings nackt, spuken ihm längere Zeit im Kopf herum. Nur gut, dass er seiner Frau Inge nichts davon berichten wird. Inge ist immer schnell eifersüchtig. Und die ewigen Streitereien nerven Druwe. Sogar Staatsrat Kemmer wird sich später in dieser Sache einschalten. Die Regierung ist besorgt um ihr Ansehen. Wilhelmstraße gibt sich weltmännisch und liberal. Schließlich argwöhnt die ganze Welt, dass dieses Deutschland sich für die Niederlage im Weltkrieg eines Tages rächen wird. Und diesen Verdacht will man von oberster Stelle zerstreuen. Immerhin ist Karl Gustav Vollmoeller so eine Art inoffizieller Kulturattaché. Ein Aushängeschild der neuen, offenen und toleranten Weimarer Republik. Immer in Bewegung. Mal New York, mal Berlin. Ja, Berlin hat es geschafft. Es ist ganz oben. Eine kleine Filmwerkstatt bei Los Angeles fragt immer wieder bei den Ufa-Studios in Babelsberg nach talentierten Regisseuren und Schauspielern an. Die Kunstszene schaut, was macht Berlin.
»Machs Maul auf, Paul, sonst gehst du in die Minna. Da kannst du deinen rosafarbenen Arsch verkaufen. Aber mit dem Schnupfzeug ist es dann vorbei.« Hans. Druwes Assistent. Immer forsch und direkt drauf los. Zarte Gemüter wie Ganoven und Nutten verschreckt man auf diese Weise nur.
»Lass mich machen, Hans.« Druwe schiebt seinen blutjungen Kollegen zur Seite. »Also, Paul. Was weißt du über Vollmoeller?«
»Herr Druwe, ick wees nüscht, ehrlich. Nur, dat er und de Schokopraline mit ne Type aneinander sind. Dat war in de Nelson-Theater. Der hatte schon wat intus, gloob ick. War so n Glubscher, verstehn se, was ick meene?«
Schokopraline. Josephine Baker. Mit ihrer Revue Nègre. Die berühmte afroamerikanische Tänzerin, die zu jener Zeit jedes Varieté in Berlin haben will. Druwes bester Fall. Und seine größte Pleite. Später kommt heraus: Deutschnationale sind die Täter. Sie wollten ein Zeichen setzen gegen die Verjudung der Hauptstadt. Nun waren zwar weder Frau Baker noch Herr Vollmoeller Juden, aber wirre Geister flogen schon damals durch manche deutschen Köpfe. Kommissar Druwe war zurückgepfiffen worden, als die Spur zu Alfred Hugenberg, dem größten deutschen Verleger, führte. Er hatte damals überlegt, ob er …
Druwe erwachte erneut. Der Nacken schmerzte, da er im Sessel eingeschlafen war. Wieder ein Brandfleck auf den Dielen. Die Zigarette. Glücksburg. April 1945. Der Arsch der Welt. Und er steckte mitten drin.
Heldenfall22. April 1945
Der SS-Arzt und Gruppenführer Dr. Karl Gebhardt leitete auch in den letzten Kriegstagen das Sanatorium Hohenlychen nördlich von Berlin. Hier ließen seit Jahren die Granden des Regimes ihre Malaise pflegen und kurieren. Görings Hautausschläge und Morphinsucht. Himmlers nervliche Zerrüttung und Angstattacken. Hitlers Magenkrämpfe und starkes Muskelzittern. Streichers Neurosyphilis und Hämorrhoiden. Franks Tobsuchtsanfälle und Ohnmachten. Nichts war bei den braunen Herren anders als beim einfachen Volk.
Nun war überraschend Gebhardts Freund aus Jugendtagen, der Reichsführer-SS Heinrich Himmler, dort eingetroffen. Gebhardt war erschüttert über den Zustand seines obersten Vorgesetzten. Der ranghöchste SS-Offizier war bleich, litt an einem nervösen Zucken des rechten Augenlids, und seine Hände zitterten leicht. Gebhardt war bekannt für seine Kaltblütigkeit. Die vom System Ausgesonderten, die Kranken, die Krüppel und natürlich die sogenannten Untermenschen waren für ihn stets nur Gegenstände. Er experimentierte an ihnen herum, operierte, verstümmelte, infizierte und tötete. Er war ein skrupelloser Vollstrecker in Weiß. Ein Arzt, der keine Menschlichkeit kannte. Noch vor ein paar Wochen hatte er gesunden Gefangenen Schulterblätter und Oberschenkelknochen entfernt. Um sie anschließend deutschen Kriegsversehrten zu implantieren. Er verursachte bei Roma, Juden und anderen »rassisch Minderwertigen« ganz bewusst Gasbrand, indem er auf die armen Geschöpfe schießen oder sie mit Holzsplittern durchbohren ließ. Dann beobachtete er akribisch den Krankheitsverlauf.
»Heinrich, Sie müssen sich schonen. Die Erkältung klingt gerade erst ab. Eine Überforderung kann das Herz schädigen.« Gebhardt bemühte sich um eine besorgte Miene. Wusste er doch allzu gut, dass Himmler jeden Anflug einer Erkrankung verabscheute.
Der Angesprochene rieb sich den entzündeten Hals. »Ich weiß Ihre Fürsorge zu schätzen, mein Lieber. Es ist schon arg. Ich konnte zwei Tage kaum schlucken. Der Rachen brennt wie Feuer. Aber Ihr Kollege versicherte mir, dass es ein Virus ist, keine Diphtherie oder gar Schlimmeres.«
Noch vor sechs Monaten hatte er in Ostpreußen den Volkssturm ausgerufen. Ohne Rücksicht auf das eigene Leben und Wohlergehen hatte jeder Volksgenosse zwischen sechzehn und sechzig Jahren die unbedingte Pflicht, deutschen Boden vor den heranrückenden Russen zu verteidigen. Der Reichsführer schickte bedenkenlos Jugendliche und Greise in den Tod. Er forderte Treue und Standfestigkeit bis in den Untergang. Aber schon einfache Halsschmerzen und Schnupfen waren für ihn selbst schier unerträglich.
»Mein lieber Karl, wir alle müssen jetzt fest zusammenstehen. Schwäche wird uns das Schicksal nicht durchgehen lassen«, krächzte er theatralisch. Dieser Mann liebte die großen Attitüden. Immer noch sah er sich in besonderer Beziehung zum mittelalterlichen König Heinrich I. Er hatte auch nichts dagegen, wenn ihn seine Nebenfrau Hedwig als »König Heinrich« bezeichnete. »Das Reich braucht mich mehr denn je. Es entscheidet sich alles jetzt, Karl. Der Führer hat auf diesen Moment hingearbeitet. Ich muss sein Werk nun vollenden. Bernadotte ist weichgekocht. Für ein paar hundert Häftlinge und Juden aus Schweden bekommen wir unseren Frieden mit England. Die Amerikaner brauchen uns. Und die Franzosen sind eh nur Marionetten.«
Himmler hatte sich heute mit Graf Folke Bernadotte getroffen. Bernadotte war Vizepräsident des schwedischen Roten Kreuzes. Der Reichsführer-SS wollte mit den Verhandlungen Zeit gewinnen. Einerseits mussten seine Männer möglichst alle Spuren der rassischen Säuberungen in den Konzentrationslagern beseitigen. Die Krematorien wurden vielerorts gesprengt, die Erde wurde umgepflügt, und Akten wurden verbrannt. Andererseits brauchte Himmler die KL-Insassen als Faustpfand. Sollten doch einige tausend von ihnen in die Welt gehen, wenn Großdeutschland dafür einen Separatfrieden mit den Westalliierten haben konnte. Leider war das Treffen mit dem Grafen für Himmler nicht erfolgreich gewesen. Bernadotte hatte keine eigene Handlungsvollmacht. Er konnte nur versprechen, das Angebot Himmlers – Häftlinge gegen Frieden – weiterzugeben. Er selbst gab dem Reichsführer aber zu verstehen, dass er dafür nicht viele Chancen sehe. Also war Himmler wieder zu Punkt eins seiner Taktik übergegangen. Zeit gewinnen. Um Spuren zu verwischen und die Zukunft der SS und der besten deutschen Menschen – allen voran seine eigene – zu planen. Die Ideen der arischen Volksgemeinschaft, der rassischen Reinheit und der germanischen Überlegenheit mussten fortbestehen. Auch in einer neuen Welt nach Hitler. Wer käme da als Garant für die Umsetzung solcher Pläne besser in Frage als er?
»Ganz recht, Heinrich. Aber es könnten unruhige Zeiten auf uns zukommen. Diese schwachen und verjudeten Amerikaner werden nicht verstehen, was wir alles geleistet haben. Die Engländer sehen wie immer nur ihren eigenen Vorteil und träumen von einem neuen Empire. Und die Schneckenfresser wollen einfach nur Rache für die erlittene Schmach. Was haben Sie also vor, Heinrich? Sollten wir nicht einige Zeit in Deckung gehen?« Noch vor ein paar Monaten wäre Gebhardt für solche Äußerungen an die Wand gestellt worden. Aber auch Himmler wusste jetzt um den Ernst der Lage.
»Sie werden erkennen, dass sie uns brauchen, Karl. Es gibt auch unter ihnen viele, die uns unterstützen. Wir haben einige bedeutende Kontakte zu amerikanischen Firmen und Familien. Denken Sie nur an Henry Ford. Die Entjudung und die Niederschlagung des Bolschewismus treffen da auf viel Verständnis. Wir müssen ihnen nur ein paar entbehrliche Handlanger liefern, die sie für alles verantwortlich machen können. Nach ein oder zwei Jahren kehren wir dann zurück und arbeiten weiter. Vielleicht etwas diskreter, aber mit den gleichen Zielen.«
»Ein paar Handlanger?« Gebhardt blickte seinen Freund fragend an. Himmler schmunzelte, aber er ähnelte dabei eher einer bissbereiten Schlange.
»Unser verehrter Göring hat sich beim Führer unbeliebt gemacht. Der Dicke wird den Amerikanern ein schönes Schauspiel liefern. Außer ihm können wir auf diese Weise auch noch ein paar andere loswerden. Bormann, Seyß-Inquart, Frank. Und den Schmierfinken Streicher. Kleine Opfer für das große Vorhaben.«
»Und wo bleiben wir, Heinrich?«
»Als Arzt Ihres Formats müssen Sie sich nicht sorgen, mein lieber Karl. Man wird Sie befragen und schnell den Reichtum Ihrer Forschungen und Fähigkeiten wertschätzen. Dann können Sie fortan auch ein paar Herrschaften aus Washington behandeln. Oder Sie eröffnen dort eine Klinik. Professor Dr. Karl Gebhardt, Berlin, London, Washington. Na, wie hört sich das an?«
»Ich weiß nicht, Heinrich. In Köln haben sie angeblich Tauber verhaftet, in Straßburg Götze. Die Russen haben Schneider in Königsberg erschossen. Allesamt fähige Kollegen. Ich will mir nicht in einem feuchten Kellerloch Gelenkrheuma einfangen.« Der SS-Chirurg rieb sich demonstrativ die Hände, als wollten seine wertvollsten Instrumente bei diesem Gedanken protestieren.
»Wenn es Sie beruhigt, dann kommen Sie eben mit mir. Die Briten haben etwas mehr Stil als die Amerikaner. Sie können nicht umhin, unserer Organisation den Kombattantenstatus zuzuerkennen. Ich als Reichsführer gehe dann in Ehren-Kriegsgefangenschaft. Sie als mein Leibarzt begleiten mich. Sollten sich die Dinge anders entwickeln, so habe ich mit Bernadotte noch ein As im Ärmel. Dann gehen wir eben für einige Zeit nach Schweden. Was halten Sie davon?« Himmler blinzelte hinter seiner Brille. Die Frühlingssonne schien durch das hohe Fenster von Gebhardts Privatpraxis. Draußen wurde ein letzter LKW mit den Überresten von Gebhardts Experimenten beladen. Leichenteile und überflüssige, verräterische Akten landeten auf der Ladefläche. Das grelle Licht schmerzte den SS-Führer in den Augen. Der grausame Schnupfen und das Halsweh.
»Das hört sich gut an. Wollen Sie nach Niedersachsen oder nach Schleswig-Holstein?« Gebhardt wirkte nun etwas erleichtert.
»In den Norden. Angeblich hat Dönitz dort eine Art Verwaltungsrat gebildet. Es ist besser, wenn wir beim Waffenstillstand auf Reichsgebiet sind, Karl. Dann können wir verhandeln, wann und wem wir uns ergeben. Sonst erschießt uns irgendein unwissender Sergeant aus Cornwall. Nein, nein. Wir gehen zu Dönitz.« Wieder blinzelte Himmler, hustete. »Außerdem …« Verschwörerisch senkte er die Stimme, darauf bedacht, Interesse bei seinem Gegenüber zu wecken.
»Ja?« Gebhardt war ungeduldig. Zwar hatten ihn die Bemerkungen Himmlers etwas beruhigt, aber noch waren sie in der Nähe von Berlin. Und es war entmutigend, was man von der Ostfront hörte. In wenigen Tagen werden die Russen hier sein, dachte er. Ich muss meine Arbeit fortführen können.
»Es hat ein paar Vorbereitungen gegeben. Für den Fall, dass wir untertauchen müssen. Wir wollen ja dann nicht wie streunende Hunde auf Almosen angewiesen sein. Glücks und Höß haben seit längerer Zeit etwas ausgearbeitet.«
SS-Gruppenführer Richard Glücks war seit 1939 Leiter der SS-Dienststelle »Inspektion der Konzentrationslager«. Somit war er der Vorgesetzte aller KZ-Kommandanten innerhalb und außerhalb des Reichs. Er war direkt verantwortlich für die akribische Umsetzung aller Pläne, die zur Ermordung von Millionen Menschen führten. Und ein besonders fleißiger Vollstrecker dieser Pläne war SS-Obersturmbannführer Rudolf Höß, der bis Ende 1943 das Konzentrationslager Auschwitz leitete. Beide Männer waren sehr eng befreundet und genossen den persönlichen Respekt Himmlers.
»Männer wie Richard und Rudolf brauchen besonderen Schutz, Karl. Sie haben mir und dem Führer treu gedient. Ihre Arbeit war leider schmutzig. Aber diese Arbeit musste von Männern getan werden, die sich über persönliche Skrupel und menschliche Schwächen hinwegsetzen konnten. Gerade Richard hat immer wieder betont, dass die Männer der SS die innere Stärke von Titanen brauchten, um die notwendigen …« Himmler suchte nach einem Wort. »… Säuberungen durchzuführen. Es mag vielleicht ein oder zwei Generationen dauern, bis man den Wert dieser Arbeit erkennt. Bis dahin wird sich bei Bekanntwerden gewisser …« Wieder hielt er inne und räusperte sich. »… Maßnahmen die internationale Judenpresse wie eine Meute gieriger Hunde auf sie stürzen. Da könnte von dem Dreck, den das aufwirbelt, auch etwas an uns hängenbleiben. Deshalb habe ich vor etwas mehr als zwei Jahren entschieden, ein paar Vorkehrungen zu treffen.«
Gebhardt kannte diese beiden Männer nicht persönlich. Aber er war ihnen dennoch etwas schuldig. Glücks und sein SS-Wirtschafts- und Verwaltungshauptamt hatten ihm bereitwillig Menschenmaterial aus den KL für seine Forschungen überlassen. Höß hatte ihm sogar geschrieben, dass er persönlich in Auschwitz die besten Juden für Gebhardts Experimente ausgesucht habe. Männer wie Glücks und Höß würden es in naher Zukunft nicht leichthaben. Keinesfalls durften sie in die Hände der Russen fallen. Sie konnten Dinge ausplaudern, die dem internationalen Ansehen eines Forschers seines Formats abträglich waren.
»Ich darf Ihnen jetzt meinen Sonderadjutanten in dieser Sache vorstellen, Karl.« Himmler öffnete die Tür zum Gang. »Kommen Sie herein, Grenger.«
Ein etwa dreißigjähriger Mann im Rang eines SS-Untersturmführers betrat den Raum. Er grüßte mit erhobenem Arm.
»Reichsführer.« Die Stiefelabsätze schlugen laut hörbar zusammen. Himmler jedoch winkte ab.
»Gut, gut, Grenger. Stehen Sie bequem. Bitte erläutern Sie meinem geschätzten Professor Gebhardt kurz unsere Pläne hinsichtlich Sandkorn.«
»Jawohl, Reichsführer.« Wieder wollte Grenger den Arm zum Gruß heben, entschied sich aber anders. Er blickte Karl Gebhardt kurz in die Augen und verneigte kaum merklich den Kopf. Dann wandte er sich wieder Himmler zu.
»Reichsführer, wenn Sie erlauben, würde ich gern den Kameraden Hauptsturmführer Hilmarsson dazu bitten. Wie Sie wissen, Reichsführer, ist er der Sonderbeauftragte von Gruppenführer Glücks und Obersturmbannführer Höß in dieser Angelegenheit.«
Himmler nickte ungeduldig. Daraufhin öffnete Grenger erneut die