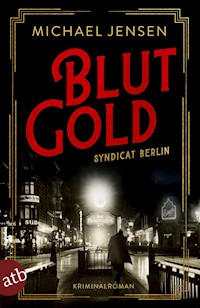9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Die Brüder Sass
- Sprache: Deutsch
Opium fürs Volk.
Berlin im aufregenden Jahr 1925. Die Sass-Brüder, ehemals Kleinkriminelle, die sich ganz nach oben gearbeitet haben, planen den nächsten Coup. Mit einem chinesischen Partner wollen sie Opium in die Hauptstadt bringen. Ihre Rechnung scheint aufzugehen. Der Stoff wird ihnen förmlich aus den Händen gerissen, doch immer wieder werden Überfälle auf ihre Transporte verübt. Offenbar sind auch andere Kreise an den Drogen interessiert. Und dann taucht auch noch ein zwielichtiger Politiker auf, der von Franz Sass Informationen will und auch vor Erpressung nicht zurückschreckt. Seine Name: Joseph Goebbels ...
Ein Roman über die berühmteste Verbrecherbande Berlins – und zugleich ein packendes Bild über Deutschland in den zwanziger Jahren.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 599
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Über das Buch
Toni Sass und ihre Neffen machen sich Sorgen. Die Geschäfte ihres Syndicats laufen nicht mehr so gut. Deshalb nimmt Franz Sass Kontakt zu dem Chinesen Zhi in Hamburg auf, um ins Opiumgeschäft einzusteigen. Tatsächlich werden dem Syndicat die ersten Lieferungen förmlich aus der Hand gerissen. Doch bald wird die Sache ungemütlich. Auch andere scheinen ins Drogengeschäft einsteigen zu wollen und überfallen die Transporte. Franz Sass begreift, dass die Sache eine Nummer zu groß für ihn ist. Gleichzeitig entdeckt er, dass neben amerikanischen Mafiabossen auch namhafte deutsche Firmen in das Drogengeschäft verwickelt sind. Er möchte aussteigen, auch wenn er weiß, dass er sich damit bei Zhi zum Verräter macht. Und dann verschwindet obendrein noch der Sohn eines reichen Bankiers, und ein zwielichtiger Politiker taucht auf, der Franz aus einer Notlage befreit und dem er damit einen Gefallen schuldet. Er heißt Joseph Goebbels und scheint völlig skrupellos zu sein.
Über Michael Jensen
Michael Jensen wurde im Norden Schleswig-Holsteins geboren. Im Hauptberuf ist er als Arzt tätig und interessierte sich früh für jüngere deutsche Geschichte und deren Folgen für die Nachkriegsgeneration. Für sein literarisches Schreiben hat er ein Pseudonym gewählt. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg und im Kreis Schleswig-Holstein.
Bisher sind zwei Romane über die Sass-Brüder erschienen: »Blutgold« und »Blutige Stille«.
Im Aufbau Taschenbuch sind außerdem seine Kriminalromane »Totenland«, »Totenwelt« und »Totenreich« lieferbar.
Mehr zum Autor unter www.autor-jensen.de.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlage.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Michael Jensen
Blutiger Schnee
Syndicat Berlin
Kriminalroman
Übersicht
Cover
Inhaltsverzeichnis
Inhaltsverzeichnis
Titelinformationen
Informationen zum Buch
Newsletter
Motto
Zitat
Prolog — Shanghai, August 1923
I Berlin 1923
Kapitel 1 — Mitte, Ende November 1923
Kapitel 2 — Charlottenburg
Kapitel 3 — Potsdamer Straße, Hauptkanal 3/SO
Kapitel 4 — Luisenstadt, Anfang Dezember 1923
Kapitel 5 — Grunewald und Charlottenburg
Kapitel 6 — Oranienburger Vorstadt, Mitte Dezember 1923
II Berlin 1924
Kapitel 1 — Wilmersdorf, Anfang Januar 1924
Kapitel 2 — Alexanderplatz
Kapitel 3 — Wedding, Mitte Januar 1924
Kapitel 4 — Borsigwalde, Wittenau
Kapitel 5 — Brandenburg, Havelland, Anfang Februar 1924
Kapitel 6 — Scheunenviertel und Friedrichstadt
Kapitel 7 — Leverkusen, Ende Februar 1924
Kapitel 8 — Friedrichstadt, März 1924
Kapitel 9 — Hamburg – Chinesenviertel, Mitte April 1924
Kapitel 10 — Klinik Charité und Köpenick, Mai 1924
Kapitel 11 — Grunewald, Anfang Mai 1924
Kapitel 12 — Schmargendorf, Ende Mai 1924
Kapitel 13 — Charlottenburg
Kapitel 14
Kapitel 15 — Friedrichstadt, Juni 1924
Kapitel 16 — Moabit, Anfang Juli 1924
Kapitel 17 — Charlottenburg
Kapitel 18 — Luisenstadt, Ende Juli 1924
Kapitel 19 — Wedding, August 1924
Kapitel 20 — New York, Five Points, Oktober 1924
III Berlin 1925
Kapitel 1 — Alexanderplatz, Januar 1925
Kapitel 2 — Charlottenburg, Mitte Februar 1925
Kapitel 3 — Tegel, Ende Februar 1925
Kapitel 4 — Prenzlauer Berg & Neuer Westen
Kapitel 5 — Klinik Charité, März 1925
Kapitel 6 — Charlottenburg
Kapitel 7 — Berlin-Mitte, Mai 1925
Kapitel 8 — Tegel
Kapitel 9 — Polizeipräsidium & Klinik Charité
Kapitel 10 — Tiergarten, Juni 1925
Kapitel 11 — Neuer Westen & Scheunenviertel
Kapitel 12 — Spandauer Vorstadt & Grunewald
Kapitel 13 — Alt-Kölln, Anfang August 1925
Kapitel 14 — Alexanderplatz
Kapitel 15 — Pankow, Ende August 1925
Kapitel 16 — Prenzlauer Berg
Kapitel 17 — Moabit
Kapitel 18 — Schöneberg, September 1925
Epilog — Herbst 1925
Nachwort
Impressum
Wer von diesem Kriminalroman begeistert ist, liest auch ...
Nach wahren historischen Begebenheiten. Einige Namen, Ereignisse und Schauplätze sind aus dramaturgischen Gründen fiktiv.
Für seine Handlungen sich allein verantwortlich fühlen
und allein ihre Folgen, auch die schwersten, tragen,
das macht die Persönlichkeit aus.
(Ricarda Octavia Huch, 1864–1947)
Prolog
Shanghai, August 1923
Suchowljanski war beeindruckt. Das Leben hatte ihn gelehrt, dass Brutalität und Grausamkeit ewige Konstanten des Daseins waren, die überall auf dieser Welt in die Gleichungen zwischenmenschlicher Beziehungen einflossen. Und hier in der Hafenstadt am Delta des Jangtse erhielt der junge Mann eine weitere Lektion. Man konnte einem unvermeidlichen Schicksal jammernd und wimmernd entgegentreten. Oder aber mit letzter Würde und stolzem, wenn auch sinnlosem Trotz.
Der Chinese, der vor ihm auf einem Stuhl saß, starb langsam. Tief in seinen Augen war zwar die Qual zu erkennen, die er in dieser langen, letzten Minute seines Lebens durchlitt. Die Äderchen der Bindehaut füllten sich wie Krampfadern, schwollen zu kleinen Strängen, einige platzten. Die Pupillen verengten sich. Aber kein Laut kam über die Lippen des Mannes. Er wehrte sich nicht, dabei war er nicht einmal gefesselt. Lediglich sein Brustkorb verkrampfte sich in dem reflexhaften Versuch, doch noch Luft in die Lungen zu saugen.
Männer sind doch überall auf der Welt gleich, dachte Mejer Suchowljanski fasziniert. Niemand wollte winselnd und um sein Leben bettelnd abtreten. In Europa wie in Asien galten die Ideale vom Heldentod in der Schlacht. Der Kapitän, der von der Brücke seines untergehenden Schiffes seine zornige Faust ein letztes Mal der See entgegen reckte. Japanische Adlige, die sich eher mit dem Schwert entleibten, als einen Gesichtsverlust zu erdulden. Dass letztlich doch der Großteil jämmerlich und unehrenhaft an Krankheit, Auszehrung oder auf dreckigen Schlachtfeldern verreckte, tat diesem Wunschbild offenbar keinen Abbruch.
Und nun dieser einfache Händler. Er trug den Drachen auf der Schulter. Als Warnung für jeden chinesischen Beamten, sich nicht mit der Gesellschaft der Drei Harmonien anzulegen. Und am Unterarm war das tätowierte Dreieck zu sehen. Mit den Schriftzeichen für Himmel und Erde. Er wurde durch einen kräftigen Burschen, der hinter seinem Opfer stand, mit dem traditionellen Hóng Sı- Dài, dem Roten Band, stranguliert.
»Er hat sich durch ein Geständnis und seine Reue die Gnade verdient, nach der ehrenhaftesten der Fünf Alten Strafen gerichtet zu werden«, erklärte Shen Li in gutem Englisch.
Sein Gast erschauderte, ließ sich jedoch nichts anmerken. Die Fünf Strafen. Er wusste, die schrecklichste Art war das Häuten bei lebendigem Leib. Da erschien das Strangulieren in der Tat als ein gnädiges Sterben. Beide Männer beobachteten eine Zeit lang stumm den Todeskampf des Mannes.
»Aber Ihr fragt gar nicht, was er getan hat, werter Herr Suchowljanski.«
»Man lernt in eurem Land schnell, nicht zu viele Fragen zu stellen. Wer fragt, ist unwissend. Wer unwissend ist, gilt als schwach und entbehrlich. Sagtet Ihr das nicht, Herr Shen?«
»Wären doch alle Gwáilóu derart verständnisvoll und weise wie Ihr.« Shen verbeugte sich und lächelte. »Ich werde es Euch dennoch verraten, damit Ihr seht, dass manche Fehler nicht geduldet oder verziehen werden können.« Der Chinese entblößte seinen Unterarm und zeigte dieselbe Tätowierung wie der Mann, der gerade erdrosselt wurde. Er nahm dessen Arm, und beide Zeichen berührten sich einen kurzen Moment.
»Seine Kraft geht auf mich über. Sein Verderbnis stirbt mit ihm«, sagte er und löste den kurzen Kontakt. »Ihr kennt das Zeichen, Herr Suchowljanski. Und Ihr wisst, dass wir die kleinste Gesellschaft in Shanghai sind.«
Suchowljanski nickte. Er war hier, um Geschäfte zu machen. Und die Geschäfte, die ihm vorschwebten, liefen in Asien sämtlich über Familien, Geheimbünde und Gesellschaften. Schnell hatte er begriffen, dass die Sa-nhéhuì, die Triaden, ihre Mitglieder mit Haut und Haar besaßen. Es gab bei ihnen kein Zurück mehr. Betrug, Untreue oder der Wunsch, sich loszusagen, bedeuteten den Tod. Shanghai wurde von der Roten Bande und der Grünen Bande beherrscht. Erstere arbeitete mit den Briten zusammen, letztere mit den Franzosen. Opium, Waffen, Seide, Rohstoffe, Staatsgeheimnisse. Man handelte mit allem, was Geld und Vorteile brachte. Für Neuankömmlinge wie Suchowljanski war da kein Platz. Er lief sogar Gefahr, als vermeintlicher Spitzel der anderen Seite in den Trögen der Schweinefarmen zu landen. Also hatte er sich gleich zu Beginn entschieden, einen Kontakt zur kleinsten Triade, der Liga des Himmels und der Erde aufzubauen. Sie bekam zwar bei den Absprachen der Familien nur die Brosamen, die vom großen Tisch abfielen. Aber nach Shens Andeutungen erwirtschaftete die Liga jährlich Gewinne in Höhe von immerhin dreihundert Tonnen Silber. Und sie suchte nun Möglichkeiten zu expandieren. Die beiden großen Triaden hatten ihrem Juniorpartner die Verlierer des Großen Kriegs in Europa als Operationsgebiete und Absatzmärkte zugesprochen: Russland, Deutschland, Österreich und die Balkanregion schienen ihnen für die eigenen Pläne zu uninteressant. Und genau hier hoffte Suchowljanski, sein Wissen gewinnbringend beisteuern zu können. Er stammte aus einer jüdischen Familie, die in dem seit Ewigkeiten umstrittenen polnisch-lettisch-russischen Grenzgebiet gelebt hatte. Er hatte dort immer noch Kontakte. Und seit seiner Auswanderung waren noch viele Verbindungen zu Italienern und Serben hinzugekommen.
Die beiden Männer beobachteten, wie doch noch ein letztes Aufbäumen durch den Körper des Verurteilten ging. Obwohl sich seine Augen verdrehten und der Kopf zur Seite sank, krampften die Arme, und die Beine zuckten nach vorn und hinten, so dass der Mann seine Schuhe verlor. Dann nässte er schließlich ein, und auch dieser finale Kampf endete. Der Henker zog weiter an dem Band und blickte nun zu Shen. Nach einigen Sekunden nickte dieser, und der tödliche Griff löste sich.
»Dieser Mann hat die Familien schändlich hintergangen. Und dadurch unsere Vereinbarungen mit Chang Hsiao Lin aufs Spiel gesetzt. Er hat Matrosen von englischen und holländischen Schiffen dafür bezahlt, für ihn kleinere Mengen Opium abzuzweigen. Nicht so viel, dass es uns wirklich hätte schaden können. Aber es geht um das Prinzip. Nun, da wir seine Komplizen kennen, werden wir sie einen nach dem anderen richten. Und sie werden nicht die Ehre haben, durch das Rote Band zu sterben.«
˚˚˚
Nur wenig später saßen Shen Li und sein Gast beim Tee. Der Balte war aus seiner Jugendzeit ganz andere – beinahe milde anmutende – Arten der Verhandlung gewohnt. Fäuste, Messer und Knüppel. Auf diese Weise wurde oft entschieden, wer am Abend einen vollen Bauch hatte und wer leer ausging. Letztlich siegte mal die eine Seite, mal die andere. Prellungen und gebrochene Nasen. Gegen die Methoden der Triade waren diese Konsequenzen nur Kinderkram. Aber Suchowljanski war bereit, Neues zu lernen. Im Umgang mit seinen Gegnern würde er in Zukunft ebenfalls jede falsche Zurückhaltung ablegen. Nur wer überlebte, konnte Recht behalten. Und hatte er doch Unrecht, dann war es egal. Andererseits schienen Reserviertheit und Gemeinschaft bei den Chinesen von einem hohem, moralischen Wert zu sein. Und er war fest entschlossen, nach seiner Rückkehr in die Heimat ebenfalls eine Art Familie aufzubauen. Eine Gesellschaft, in der wenige Männer die Strippen zogen, nach denen die anderen zu tanzen hatten. Er hatte gehört, dass auch in Italien die Banden derart organisiert waren. Und in Zukunft würde er die Drecksarbeit auch nicht mehr selbst erledigen.
»Die Zeit ist noch nicht reif«, meinte Shen Li. »Gerade erst bauen wir unsere Kontakte in Berlin und Wien auf.«
»Vielleicht könnte ich Euch beim Schutz der Transporte nützlich sein. Es sind gefährliche Zeiten, und Europa ist weit weg.«
»Verzeiht meine Direktheit, aber Ihr scheint mir recht jung, Herr Suchowljanski. Welche Erfahrung habt Ihr bei so etwas? Wie viele Männer könntet Ihr aufbieten?«
Suchowljanski spannte sich an. Er mochte es nicht, in die Schranken gewiesen zu werden. Die Welt seiner Kindheit war eng gewesen, und er hatte sich geschworen, dass es in Zukunft keine Grenzen mehr für ihn gab. Dass seine bisherige Expertise aus einer kleinen Autovermietung bestand, die er zum Whiskyschmuggel nutzte, musste in diesem Gespräch nicht interessieren. Whisky oder Opium. Automobile, Sklaven oder Schiffe. Was sollte ihn aufhalten?
»Ob ein Dutzend oder einhundert Männer«, erwiderte er. »Anwalt oder Schläger. Ich kann Euch alles und jeden zur Verfügung stellen, Herr Shen.«
»Wir werden sehen. Später vielleicht. Der Weise wartet auf seine Zeit, heißt es bei uns. Vielleicht solltet auch Ihr noch warten. Im Moment sehe ich nämlich den Nutzen einer Vereinbarung zwischen uns nicht. Die Töpfe, in denen wir rühren, sind noch zu klein. Wir verfügen bereits über Kontakte. Und zu viele Köche verderben das Gericht.«
»Aber Ihr seht doch, dass die Roten und Grünen sich die großen Brocken schnappen!« Suchowljanski sprach jetzt mit erregter Stimme. »Dabei sind sie selbst nur Befehlsempfänger der Briten und Franzosen. Sie sind Krämer, Verteiler von fremdem Opium im eigenen Land. Ich hingegen biete Eurer Gesellschaft eine echte Partnerschaft an! Ihr beschafft die Ware, und ich verkaufe sie überall auf der Welt. Und Ihr kommt den anderen Familien mit ihren Geschäften in China, Macau und Hongkong gar nicht in die Quere. Euch bietet sich die Chance, zu wachsen und der Roten und Grünen Bande ebenbürtig zu werden.«
»Und eben die Ware ist das Problem, werter Freund. Noch immer kontrollieren die Engländer den Anbau. Selbst die Mohnfelder in unserem Land werden von korrupten Beamten verwaltet, die das Opium nur an Chang Hsiao Lin verkaufen.«
»Was ist mit Qingdao? Die Deutschen haben doch dort eine Fabrik gebaut, in der das Opium veredelt wurde.«
»Die Deutschen haben ja noch nicht mal in ihrem eigenen Land das Sagen. Geschweige denn in ihrem ehemaligen Schutzgebiet. Es ist mühsam geworden. Wir schaffen das Opium nach Europa, damit es dort verarbeitet wird. Dann kommt die Ware zu uns zurück. Sehr kompliziert. Viele Taschen, die gefüllt werden müssen.«
»Dann ändert es, verdammt! Hier der Rohstoff, hier die Verarbeitung, dann der Export in die ganze Welt. Was ist so schwer daran, zu begreifen, dass dies der einfachste Weg ist?«
»Ich sehe, Ihr müsst noch einiges über unser Land lernen. Der Tiger jagt im Licht des Morgens heißt es im Buch des Gelben Kaisers. Und noch ist es Nacht. Unser Tiger erwacht gerade erst. Und er wird jagen. Wir warten nur auf die erste Dämmerung. Bis dahin müssen wir uns in Geduld üben. Und Ihr ebenfalls.«
Wir werden sehen, dachte Suchowljanski und vermochte nur mühsam seine Enttäuschung und Wut zu verbergen.
I Berlin 1923
1
Mitte, Ende November 1923
Der Spätherbst war bereits seit Tagen schneidend kalt. Und Ostwind trieb kleine Eisnadeln durch die großen Straßen der Stadt. Sie tanzten erst um die neuen Laternen vor Wertheim und suchten sich dann ihre Opfer. Sie stachen Rudolf Berleberg ins Gesicht, und nach kurzer Zeit im Freien schien es, als fräßen sie sich unter seine Haut. Er brauchte einen Schutz vor Kälte und Graupel. Die Notunterkünfte der städtischen Verwaltung waren wieder überlastet, und eine halbe Mark war plötzlich viel Geld. Geld, das er nicht hatte. Der Stumpf schmerzte. Bei Minusgraden wurde die Narbe dunkelblau, begann fürchterlich zu pochen, wurde taub und erwachte dann in einem Inferno zu neuem Leben. Gott sei Dank, es war nur der linke Arm. Aber die Kriegsverwundung machte Berleberg dennoch wehrlos. Oft schon hatten ihn zwei oder drei jüngere Treber beraubt und zusammengeschlagen. Sobald er seinen schäbigen Koffer abstellte, um an einer Kasse zu zahlen oder Ware auf dem Markt zu prüfen, konnte er ihm gestohlen werden. Siebzig Mark Rente war dem Vaterland sein linker Arm wert gewesen, der jetzt irgendwo bei Verdun im Dreck verrottete. Durch die beschissene Inflation waren auch noch die Spargroschen, die er für Notzeiten zurückgelegt hatte, wertlos geworden. Und mit Einführung der neuen Mark musste das Versehrtengeld vom Amt erst neu berechnet werden. Bis dahin hieß es einfach: Armenspeisung und Platte, denn seine Vermieterin hatte ihn kurzerhand hinausgeworfen. Vielleicht hoffte man da oben bei der Stadtkasse, dass bis zur ersten Auszahlung wieder ein paar Krüppel verhungert waren.
Berleberg erkannte Hugo Mettmann, der sich am Leipziger Platz auf einer Bank ausgestreckt hatte. Beiderseits der Straße gab es zwei kleine Parks, die in der Nacht für Alte und Versehrte bedeutend sicherer waren als der Zoologische Garten, in dem sie erst vor vier Tagen einen Obdachlosen abgestochen hatten. Hier war wenigstens etwas Licht, und selbst nach Mitternacht traf man noch vereinzelt auf Passanten, und Autos fuhren vorbei. Der klassizistische Bau der Volkswohlfahrt lag etwas entfernt und schien die beiden obdachlosen Männer mit seiner prachtvollen Fassade beinahe zu verhöhnen. Von den wärmeren, meist überdachten Zugängen vor großen, öffentlichen Gebäuden waren sie mehrfach durch eigens dafür angestellte Ordnungskräfte verwiesen worden. Armut störte das Stadtbild, obwohl sie es in mehr als der Hälfte aller Berliner Bezirke ganz grundsätzlich prägte. Die Obdachlosen und Treber waren in der gesellschaftlichen Hackordnung ganz unten angekommen und mahnten selbst die abgerissenen Hilfsarbeiter und schwindsüchtigen Gestalten aus dem Wedding oder dem Scheunenviertel, dass es immer noch tiefer ging. Und niemand wurde gern daran erinnert.
»Hugo, hier kannste nich bleeben! Wird ordentlich kalt, da biste steifjefrorn bis inne Frühe.« Berleberg griff seinem Kumpel an die Schulter. Mettmann war sofort hellwach und griff blitzartig nach seinen Jutebeuteln. Reflexe, die Armut und Not schulten. Der alte Mann litt an Schüttellähmung. Sein Gesicht wirkte teigig und irgendwie glattgebügelt. Speichel lief ihm aus den Mundwinkeln. Als er sich stöhnend aufrichtete, begannen Kopf und Unterarme zu zittern.
»Gehn wir inne Kanal«, schlug Berleberg vor. »Mieft, aber is warm.«
Die Stadt hatte fast alle Wärmehallen in Mitte geschlossen. Aus den Bahnhöfen und U-Bahn-Zugängen wurden Obdachlose, Hausierer und Bettler vertrieben. Das Vorgehen gehörte zu einem neuen Konzept der Verwaltung. Die Stadt sollte schöner und lebenswerter werden. Berlin, ick liebe dir!, stand auf Plakaten an den Litfaßsäulen. Eine Werbekampagne, die zwanzigtausend Mark gekostet hatte. Irgendein Witzbold hatte das Schild an der Ecke Leipziger Straße beschmiert. Dort stand jetzt Berlin, ick verrecke in dir! Berleberg kannte einen Einstieg in die Kanalisation, der – vor neugierigen Blicken geschützt – in der Nähe des Reichswirtschaftsamts lag. Darunter befand sich neben den Abwasserrohren auch ein Auffangbecken für Regenwasser. Und dort war es einige Grad wärmer als hier draußen, da gleich daneben der Fäkalienstrom aus der Innenstadt vorbeigeführt wurde.
»Ob arm, ob reich, Scheiße stinkt immer gleich.« Mettmann brachte diesen Spruch jedes Mal wieder, wenn sie nach unten stiegen. Er zitterte stark, und ohne Hilfe wäre er die Stahlstufen hinabgestürzt. Tatsächlich war die Luft zum Schneiden, der Gestank legte sich förmlich auf die Zunge. Am Fuß der Leiter angekommen, entzündete Berleberg ein billiges Talglicht. Nicht ganz ungefährlich, das wusste er. Hier unten gab es Gasblasen, die zu Verpuffungen führen konnten. Aber im Dunkeln wollte er weder in den Pilzkleister an den Wänden greifen noch mit den Schuhen knöcheltief in Kot versinken. Nach knapp fünfzig Metern zweigte vom Hauptabflussrohr der Zugang zu einer Art Zisterne ab. Berleberg und Mettmann suchten darin nach einer trockenen Ecke.
»Kiek dir det an«, rief der Ältere plötzlich. »Vor een paar Jahren hätten wir mit de janze Penunze ausjesorcht!«
Berleberg hob die kleine Lampe und erblickte einen Berg von Geldscheinen. Die Reichsbanknoten mussten aus der Endphase der Inflation stammen, denn da hatte man es aufgegeben, die Nullen auf das Papier zu drucken. Stattdessen lagen hier zweihundert, fünfhundert oder tausend Milliarden und sogar mehrere Billionen Mark herum.
»Wertloser Dreck«, motzte er. »Eene Schrippe mit Bouillon und ’ne Molle wär mia jetze lieba.«
»Wie kommt det inne Kanal?«, fragte Mettmann und begann bereits, sich sein Lager mit Papiergeld auszupolstern.
»Als ick dat letzte Mal mit Hindenburg jejessen hab«, gab Berleberg in amüsiertem Tonfall zurück. »Da sacht er, dat se det olle Jeld uff Rollen ziehn wolln. Fürs Scheißhaus. Nu isses eben hier.«
»Mach mal een Feuerken, Rudi.« Nach Berlebergs Bemerkung untersuchte Mettmann jeden Schein auf Ausscheidungsreste. Man konnte nie wissen.
Das Zeug brannte nicht besonders gut, rußte stark und roch ranzig-säuerlich. Dennoch schien es, als wären ihre Nasen froh, sich vom Fäulnisgestank etwas erholen zu können. Und der Inflationsscheiterhaufen spendete tatsächlich ein wenig Wärme. Gerade hatte Berleberg es sich bequem gemacht, als sein Begleiter aufschrie.
Ratten!, ging es ihm sofort durch den Kopf. Der Schrecken der Kranken und Geschwächten. Und Besoffenen. In der Stadt liefen einige Gestalten herum, denen die Viecher im Schlaf Stücke aus dem Gesicht gebissen hatten. Er sprang auf und lief zu Mettmann hinüber. Der Mann zeigte auf eine Stelle im Geldhaufen. Dabei zitterte er so heftig, dass man bei der groben Richtungsangabe glatt Nord und Süd hätte verwechseln können.
»Wat is? Hat dich eene jebissen?«
»Nee. Da liegt eener, Rudi!«
Berleberg fegte mit dem Fuß Geldscheine zur Seite. Dann nahm er Mettmanns Gehstock und stocherte in dem Haufen herum. Und tatsächlich stieß er an einer Stelle auf etwas Hartes. Nach kurzer Zeit hatte er den Leichnam eines jungen Mannes freigelegt, der bis auf die Unterwäsche entkleidet war. Seine Haut war blass-bläulich und an einigen Stellen bereits braun. Der Bauch wölbte sich unnatürlich, und als Berleberg mit dem Stock dagegen stieß, gab der Tote einen sonoren Furz von sich.
»Lebt der doch noch?«, fragte Mettmann ungläubig und hielt sich den Ärmel vor die Nase. Der Verwesungsgeruch war derart infernalisch, dass er sogar Kot und Urin vergessen machte.
»Quatsch nich«, antwortete Berleberg. »Als meene Großmutter starb, brach sich der Dorfbestatter een Been. Hat jedauert, bis sie inne Kiste jewesen is. Und die Olle hat vier Tage lang in ihrem Zimmer Blaskonzerte jejeben.«
»Is bei dem wat zu holn?« Mettmann begann vorsichtig, den Boden neben dem Toten abzusuchen, indem er mit der Schuhspitze Geldscheine und Dreck wegschob.
»Saubrer Pinkel, denk ick mir. Kiek uff die Schietbüchs. Und de Herr trägt een Hemde von Feenripp. Wolle, meen Lieber. Keene raue Jute.«
Beide Männer gruben sich durch die Banknoten und schoben den Leichnam sogar zur Seite.
»Nüscht«, stellte Mettmann enttäuscht fest. Er hatte dem Toten die Socken ausgezogen und hielt sie in die Höhe. »Bringt zwee Jroschn. Eene fette Börse wär mir lieba jewesn. Müssn wir dat nu meldn?«
»Morjen is der ooch noch tot«, erwiderte Berleberg. »Und ick bin müde. Wenn wir jetzt Radau machen, dann is vorbee mit de Nacht.«
»Hast recht, Rudi. Ick muss nur da rüber.« Er zeigte zur gegenüberliegenden Wand. »Der Kerl stinkt zu dolle. Und die Viecher ham ihn ooch schon anjenagt.«
»Is doch jut. Und wir ham unsere Ruhe.«
»Jute Nacht.«
2
Charlottenburg
»Stahl ist Stahl«, meinte Max und zuckte mit den Schultern. »Wenn wir ihn billig kriegen, können wir ihn teuer verkoofen. Berlin baut imma, wa?«
»Nein!« Franz sprang auf und warf seinem Bruder eine halbleere R6‑Packung ans Revers. »Eene Zweier raucht sich ooch nich wie ’ne Zehner, du Flitzpiepe.«
Josef Sternwein, ihr Partner im Syndicat, nickte verdrossen und warf den Vorwärts auf den Tisch. Eben hatte er den Artikel gelesen, der vom zunehmenden Pfusch am Bau handelte.
»Seit die neuen Stadtteile dazugekommen sind, brummt das Geschäft«, meinte er. »Zehn Tote auf einer Baustelle in Spandau.« Er deutete mit seiner Hand auf den Artikel. »Die Zwischendecke hat den Beton nicht gehalten. Die Kerle haben minderwertiges Material verbaut.«
»Stahl ist eben nicht gleich Stahl«, sagte Franz und nickte verdrossen. »Güteklassen! Schon mal jehört?«
»Die armen Schweine«, murmelte Georg, der den Artikel überflogen hatte. »Haben den Krieg überlebt und sterben jetzt uffm Bau. Haben wir diese Baustelle beliefert?« Er deutete auf die Zeitung.
Sternwein schüttelte den Kopf. »Gott sei Dank nicht. Aber wir müssen grundsätzlich eine Entscheidung treffen. Unsere Abnehmer wollen es immer billiger. Wenn sie das Material bei uns nicht zum geforderten Preis bekommen, gehen sie zur Konkurrenz. Sogar die Götze-Brüder mischen schon mit und verscherbeln Schwefelstahl als Baustahl.«
»Ich habe keine Probleme damit, falsche Banderolen auf die Glimmstängel zu kleben«, ereiferte sich Franz. »Oder Kognak mit etwas Branntwein zu strecken. Wir können Würfel und Karten zinken lassen, Buchmacher und Jockeys schmieren. Auch eene Null kann man in den Büchern bei der Steuer mal vergessen.« Er war jetzt richtig in Fahrt. »Aber uffm Bau jeht eener armen Socke dat Licht aus, wenn wir Dreck liefern!«
Alle im Raum wussten, dass mit ihm nicht gut Kirschen essen war, wenn er ins Berlinerische abglitt. Dann war bei jedem weiteren Wort Vorsicht geboten. Seine Tante Toni erhob sich und schenkte ihm Kaffee nach. Die Familie und einige Teilhaber saßen im Wintergarten ihres Hauses, den sie mittlerweile sogar beheizen konnte. Draußen graupelte es, drinnen blühte ein Zitronenbaum, den ihr ein italienischer Weinhändler aus dem Süden mitgebracht hatte.
»Alle stehen in den Startlöchern«, sagte Sternwein. »Wenn die neue Währung stabil ist, dann geht in der Stadt die Post ab. Die Verwaltung hat angeordnet, Grundstücke für über zehntausend Wohnungen bereitzustellen. Kiesel, Sand, Zement. Es fehlt an allem.«
»Den Scheiß sollen andere fahren«, erwiderte Max. »Wir liefern die Lastkraftwagen. Weniger Dreck, hoher Gewinn. Ick hab gerade in Aachen einen Fuhrpark uffjetan. Jute Armeeware mit zwanzig LKW von Stoewer, Dürrkopp und Büssing. Dazu Trommelmischer aus den Schützengräben. Wir müssen nur vier Reichsbahnwagen mieten und ab nach Berlin!«
»Hast ja recht«, meinte Franz, den Kaffee und Zigarette etwas besänftigt hatten. »Aber die Ladung mit minderwertigem Stahl, den sie nachträglich gestempelt haben, nehmen wir nicht. Nicht mit mir! Basta.«
»Hättest du bloß nicht die Lehre bei Siemens gemacht«, stöhnte sein ältester Bruder. »Immer diese Oberlehrer-Vorträge.« Er hob den Zeigefinger und tat, als dozierte er mit schnarrender Stimme vor einer Schulklasse. »Die Güte bestimmt den Einsatzzweck. Legierung und Kohlenstoffgehalt haben dabei den entscheidenden Einfluss. Eine Beruhigung des Stahls kann durch … Bla, bla.«
»Wir brauchen neue Einnahmequellen«, sagte Sternwein, ohne in das allgemeine Gelächter einzustimmen. Er führte die inoffiziellen Bücher des Syndicats. Darin befanden sich nur Kürzel und Zahlencodes. Aber er schien sie lesen zu können, als wären sie Groschenhefte. »Das Glücksspiel wirft gute Margen ab, die jedoch kleiner werden. Die Schmiergelder und Aufwendungen für die Sicherheit schmälern den Ertrag. Die Wetteinnahmen auf den Rennbahnen bleiben ein solides Standbein, allerdings sind sie nicht mit Klantes goldenen Zeiten vergleichbar.« Er schwieg betreten. Alle wussten, dass er gerade in ein Fettnäpfchen von der Größe des Gartenteichs getreten war. In Tonis Haus galt jede Erwähnung ihres früheren Liebhabers Max Klante, der wegen Betrugs im Zuchthaus saß, als Fauxpas.
»Deine Predigten kennen wir, Josef«, meinte Toni prompt in gereiztem Tonfall. »Wir sind doch breit aufgestellt. Die Inflation hat unser Huhn zwar ordentlich gerupft, aber nicht umgebracht.«
»Natürlich.« Sternwein räusperte sich verlegen und blätterte in seiner Kladde. Dann fuhr er mit seinem Bericht fort: »Mit Alkohol lässt sich noch verdienen, aber nur mit dem guten Zeug aus Frankreich, mit schottischem Whisky und den besten Likören. Zigaretten gehen nur noch als Schmuggelware am Zoll vorbei. Hohes Risiko, geringer Gewinn. Besser sind loser Tabak und vor allem kubanische Zigarren. Durch die Inflation haben wir ein paar Beteiligungen an Zinshäusern als Sicherheit. Dazu noch Pfandleihen, Uhren, Autos, Schmuck. Aber das Feld bricht weg, sobald die neue Währung sich als stabil erweist. Die Lokale selbst laufen gut, die Konkurrenz holt allerdings bei den Mädchen sehr viel mehr heraus.«
»Da lassen wir nicht mit uns reden. Basta.« Toni sah die anderen Frauen am großen, runden Tisch an. Alle nickten entschieden. Wilde Bordelle gab es beim Syndicat nicht mehr, seit Toni nach ihrer Operation und den Querelen um ihre Tochter wieder das Heft in die Hand genommen hatte. Es durften in den Lokalen keine Minderjährigen beschäftigt werden. Und jede Frau, die horizontal tätig war, genoss eine Art Mindestschutz und konnte einen Großteil der Einnahmen für sich behalten.
»Das Syndicat steht allein bei mir mit über zwanzigtausend Dollar in der Kreide«, schloss Sternwein seinen Bericht. »Was bedeutet, dass ich Schuldner und Gläubiger in einer Person bin. Unüblich. Aber es sind eben seltsame Zeiten. Leider kommen aber noch weitere fünfzigtausend bei anderen Geldgebern als Verpflichtungen hinzu. Und aufgeschobene Reparaturen in den Klubs, an den Häusern. Ich könnte noch ein paar Dinge aufzählen, die uns richtig Geld kosten in nächster Zeit.«
»Unheilsprophet und Schwarzmaler«, murmelte Toni.
»Realist«, entgegnete der jüdische Geschäftsmann und klappte sein Büchlein zu.
»Wir brauchen neue Einnahmequellen«, wiederholte Franz, wohl eher unbewusst, die Schlussfolgerung des älteren Teilhabers.
»Koks läuft gut«, schlug Max vor.
»Ein unübersichtliches Geschäft«, erwiderte Katja. Die junge Russin, die ihr Land in den Wirren der Oktoberrevolution verlassen hatte, kannte sich in der Berliner Gesellschaft bestens aus. »Ian hatte ein paar Kontakte, aber selbst ihm fiel es schwer, Ware von gleichbleibender Qualität zu bekommen. Und Kunden werden schnell sauer, wenn sie nicht wissen, ob sie Spreewasser oder Champagner für ihr Geld kriegen.« Sie unterbrach sich und sah Franz unvermittelt an. »Tut mir leid, ich wollte ihn nicht erwähnen.«
Franz starrte in seine leere Kaffeetasse. Die Erinnerung an den toten Freund schmerzte immer noch. »Schon gut. Du hast recht. Ian hat sich mit dem Kokain übel verzettelt. Zu viele Leute, die daran beteiligt waren. Dadurch immer höheres Risiko. Und manchmal hat er völlig wertloses Zeug bekommen. Einmal war es sogar nur Milchzucker.«
»Letztlich hat ihn aber die Waffensache den Kopf gekostet«, erklärte Max und handelte sich böse Blicke der anderen Familienmitglieder ein. »Was denn? Ist doch wahr! Der Waffenverkauf ist hochgefährlich geworden. Davon möchte ich die Finger lassen.«
»Das Tschandu verkauft sich gut«, mischte sich Georg jetzt ein. Er lebte mit seiner Frau bei einer Zigeunerfamilie, die seit ein paar Jahren ihr Lager in der Einöde nördlich des Hohenzollern-Kanals aufgeschlagen hatte. Die Harussels gaben einen Teil ihres Rauchopiums mit gutem Gewinn ab. »Allerdings können wir uns nicht gegenseitig Konkurrenz machen.«
Franz war mit seinen Gedanken jedoch bereits woanders. Er erinnerte sich an das Treffen mit Meister Zhi vor über einem Jahr im Hamburger Chinesenviertel. Der Mann hatte ihm damals einen Handel angeboten. Seine Verlobte Susanne Bentmann hatte von einem chinesischen Arzt Medikamente für ihre Krankheit bekommen, und das Syndicat hatte als Gegenleistung die Möglichkeiten ausgelotet, Opium in der Hauptstadt zu verkaufen. In den vergangenen Monaten waren es allerdings nur sehr kleine Liefermengen gewesen. Franz nahm an, dass die ständige Geldentwertung den deutschen Markt für die Chinesen uninteressant gemacht hatte. Man konnte sich schließlich nicht für alles in Naturalien bezahlen lassen. Ein Abnehmer des Opiums hatte Franz vor zwei Monaten allen Ernstes sogar eine Standuhr für ein Päckchen angeboten.
»Ein Opiumpfeifchen geht immer. Einige Leute wollen Spaß«, meinte Georg. »Andere wollen vergessen. Leben, Liebe, Leid. Alles dicht beieinander, und das Tschandu verheißt Ruhe. Es macht den Blick frei für das wirklich Wichtige.«
Franz hatte beides probiert. Kokain verengte die Welt. Alles schien möglich, alles greifbar nahe. Wer das Zeug nahm, brauchte niemanden, denn er war sich selbst Gott genug. Fernes war nah, Nahes fern. Der Tag hatte hundert Stunden, und Schlaf war für die Schwachen. Tschandu, der Opiumrauch, hingegen machte alles weiter und durchsichtiger. Man sah Gott, aber ließ ihn einfach für sich schuften. Sollten sich doch andere um die Probleme der Welt kümmern. Schweres wurde leicht. Und in Leichtem löste sich der Mensch schließlich auf. Franz hatte weder der eine noch der andere Zustand gefallen. Er blieb bei seinen Lastern, feinsten Zigaretten und gutem Kognak.
»Ist eine Idee, Franz«, meldete sich wieder Josef Sternwein zu Wort. »Wie heißt der Chinese, der als Kontakt für Zhi in der Stadt ist?«
»Shen Li.« Franz wurde ungern an den Mann erinnert. Zhi Chao war ihm sogar in gewisser Weise sympathisch gewesen. Aber Shen war undurchschaubar.
»Die Zeit ist reif für Neues. Wenn die neue Mark ihren Wert behält, dann geht es im Land rund, glaub mir. Und wir wollen doch dabei sein, oder?«
Franz und Susanne hatten den Chinesen viel zu verdanken. Und dennoch war ihm jedes Mal unwohl gewesen, dass er ihnen dafür einen Gefallen schuldete. Seit sein Freund Ian durch die Abhängigkeit vom Kokain erst den Überblick über seine Waffengeschäfte und schließlich sein Leben verloren hatte, sah Franz das Rauschgiftgeschäft mit einigem Widerwillen. Dabei war ihm klar, dass die Goldgräberzeit hinsichtlich des Schmuggels und illegalen Glücksspiels in der Stadt langsam ihrem Ende entgegen ging. Selbst die Ringvereine bemühten sich, ihre illegalen Geschäfte zu etablieren. Sie kauften sich in Bauunternehmen ein, man ging in die Politik oder gründete Kartelle, um problemlos die Preise diktieren zu können. Das Glücksspiel wurde plötzlich legal, sofern dem Staat brav die Steuern gezahlt wurden. Sternwein hatte der Familie die Bilanzen vorgelegt. Alkohol und Zigaretten warfen kaum noch etwas ab. Der Schmuggel von Reichsgütern und vor allem Waffen stand unter schwersten Strafen.
»Bordelle oder Opium.« Sternwein hatte eine enervierende Art, die Dinge auf den Punkt zu bringen. »Wir könnten uns in Zukunft auch nur auf die Klubs beschränken. Ganz solide, aber dann hat das Syndicat in zehn Jahren immer noch Schulden. Und ihr solltet dann besser in kleinere Häuser umziehen und etwas sparsamer leben.«
Die letzte Bemerkung verfehlte ihre Wirkung nicht. Katja murrte. Franz dachte an Susannes Reaktion, wenn die Schecks für Gersons neueste Kleider aus Paris plötzlich nicht mehr gedeckt wären. Und selbst Toni wirkte angespannt und blickte sich wehmütig in ihrem Wintergarten um. Eine Wiederbelebung der Prostitution nach alten Regeln würde es allerdings mit ihr nicht geben.
»Ja, schon gut, Toni! Sieh mich nicht so vorwurfsvoll an.« Franz schielte sehnsüchtig zu der Kognakflasche, die auf der Anrichte stand. Aber für einen beruhigenden Schluck war es definitiv noch zu früh. »Die Regeln für die Mädchen in den Klubs bleiben bestehen.«
»Keine Bordelle«, stellte Josef Sternwein trocken fest und hob die Schultern. »Bleibt also nur das Opium.«
3
Potsdamer Straße, Hauptkanal 3/SO
»Herr Gott, Druwe!«, rief der ältere Kommissar. »Hier geht es zu wie bei den Hottentotten. Jagen Sie jeden raus, der am Tatort nichts zu suchen hat!« Paul Konter hielt sich die Hand vor die Nase. Der Pestilenzhauch hier unten in der Kanalisation war infernalisch, unerträglich, und der Rest von Rasierwasser, der noch von der Morgentoilette an ihm haftete, machte es nicht viel besser. Normalerweise hätte er diese Drecksarbeit vollständig einem Untergebenen zugewiesen und sich einen Bericht geben lassen. Aber erstens handelte es sich bei dem Fall wahrscheinlich um ein Tötungsdelikt. Es wäre peinlich, wenn er bei einer späteren Befragung durch Gennat eingestehen musste, dass er nicht vor Ort gewesen war. Zweitens war Konters neuer Mitarbeiter ein wenig übereifrig und musste gebremst werden. Intelligent zwar, jedoch schien er sich mit seiner Penibilität oft selbst im Weg zu stehen. Und gerade die eifrigen Anfänger übersahen in ihrem Bestreben, nichts zu übersehen, besonders viel.
Der junge Kriminalassistent Jens Druwe, der gerade aus Hamburg nach Berlin versetzt worden war, stand fluchend am Rand des unterirdischen Rückhaltebeckens und rieb den Rand seines Mantels mit einem Taschentuch ab. Tatsächlich ähnelte das Hin und Her eher einem Taubenschlag als einem Tatort. Jeder beteiligte Schupo war neugierig und angewidert in die Katakomben hinabgestiegen, um den außergewöhnlichen Fundort der Leiche in Augenschein zu nehmen. So etwas sah man auch in Berlin nicht alle Tage. Schaurig war im Kintopp gerade in Mode. Da schien es passend, wenn man eine wahre Geschichte beim nächsten Kneipenbesuch zu erzählen hatte. Verschiedene Theorien machten die Runde, von Selbstmord bis zu Graf Orlok. Und alle Anwesenden überboten sich in Kraftausdrücken hinsichtlich der Sinneseindrücke, die die Szene auslöste. Druwe begann, die Anordnung seines Chefs umzusetzen, und verscheuchte die schaulustigen Kollegen aus dem hallenartigen Rückhalte- und Staubecken, in dem die Leiche gefunden worden war. Sogar drei Arbeitslose und einige Reporter waren sich nicht zu fein gewesen, diesen verkoteten Hades aufzusuchen.
»Jetzt ist es zu spät, Mann!« Sein Chef Paul Konter war erbost und wies auf die vielen Fußspuren, Zigarettenkippen, das Bonbonpapier und die fallengelassene Zeitung. »Wenn der Dicke davon erfährt, dann gehen wir vier Wochen auf Streife. Abgestellt zur Bahnpolizei!«
Der Dicke. Der wohlgenährte Leiter der Mordbereitschaft, Ernst Gennat. Druwe nickte unsicher. Er nahm sein Notizbuch aus der Tasche und las die Anordnungen, die neuerdings für eine ordentliche Tatortarbeit galten. Daneben schrieb er mit einem Bleistiftstummel seine eigenen Notizen.
»Ja, nun liegt Tante Luise schon im Brunnen. Lesen sollten sie vorher, Druwe.« Konter betrachtete die Spuren am Boden. Hier mussten Dutzende Leute durchmarschiert sein. Jemand hatte eine Zeitung verloren, und das Bonbonpapier lag sogar neben einer angebissenen Stulle. Zwei Haufen Erbrochenes – offenbar hatte der eifrige Esser alles wieder von sich gegeben – unterlegten den unerträglichen Gestank mit einer sauren Note. Der erfahrene Kripobeamte schloss die Augen und versuchte, sich auf die nicht fassbaren Eindrücke zu konzentrieren.
»Trauen Sie sich, Ihre Gefühle wahrzunehmen«, hatte der Leiter der Mordinspektion zu ihm gesagt. »Dann können Sie sie später sauber von den Fakten trennen.«
An Orten wie diesen brachte Intuition tatsächlich oft einen entscheidenden Hinweis. In Räumen war manchmal noch die Todesangst des Opfers spürbar. Oder die Brutalität und Wut des Täters. Der Duft nach Seife, Rasierwasser oder Parfum konnte die Aufmerksamkeit auf übersehene Kleinigkeiten lenken. Überhaupt predigte Gennat immer wieder, auf die scheinbar unwichtigen Dinge zu achten. Aber hier war beim besten Willen nichts zu holen. Die Kumulation der Produkte großstädtischer Notdurft ließ keinen Raum für jene feinen Wahrnehmungen, nach denen Konter in sich suchte.
»Zeugen?«, fragte er seinen neuen Assistenten.
»Irgendein Bengel hat unserem Pförtner am Alex einen Zettel hingeworfen.« Jens Druwe schüttelte den Kopf. »Der Junge ist sofort stiften gegangen.«
»Was schließen Sie daraus?«
»Ich denke, jemand hat hier übernachtet.« Der jüngere Beamte wies auf eine Ecke. Dort war ein Haufen halb verbrannter Geldscheine zu erkennen. »Ein kleines Feuer. Daneben zwei ausgepolsterte Schlafstellen. Obdachlose. Ich denke, die Kerle wollten unseren Fragen aus dem Weg gehen. Dem Jungen haben sie einen Sechser und den Zettel in die Hand gedrückt. Und auf dem Präsidium ist so viel los, dass ein solcher Botenjunge nicht auffällt. Rein, raus, weg.«
»Weiter.«
»Zufallsfund. Die Männer waren nicht die Täter. Sie haben hier unten Schutz gesucht. Sie entdeckten einen Leichnam, der schon ein paar Tage hier liegt. Vielleicht haben sie ihm die Sachen weggenommen. Oder das Geld. Aber es waren sicherlich nicht die Mörder.«
»Schon mal versucht, einem Toten oder Bewusstlosen die Hose auszuziehen?«, fragte Konter. Als Druwe ihn verblüfft ansah, fuhr er fort: »Gar nicht so einfach. Fast immer schiebt sich dabei die Unterhose mit runter. Außer man berührt den Körper. Oder die Männer haben sie aus Pietät wieder nach oben gezogen. Beides halte ich bei diesem Verwesungszustand für unwahrscheinlich.«
»Könnte immer noch ein normaler Raubmord oben gewesen sein.« Druwe deutete mit dem Bleistift an die Decke. »Danach hat der Mörder die Leiche hier entsorgt.«
»Schauen Sie sich den Leichnam an. Entweder haben ihn vier kräftige Kerle ganz vorsichtig hierher getragen. Denn es finden sich keinerlei Fäkalien an ihm. Der Körper weist auch keine Schürfungen oder ähnliches auf.«
»Oder er wurde hierhergebracht, als er noch lebte«, fuhr Druwe fort. »Er musste sich entkleiden und wurde erst dann getötet.«
»Hinweise auf die Todesursache?«
»Keine Schusswunde, kein Schlag auf Kopf oder Hals«, erwiderte Druwe. »Vielleicht erstickt?« Er zeigte auf das Gesicht des Toten. Aus dem Mund ragten jede Menge Banknoten. Offenbar hatten die Täter das Geld zerknüllt und ihrem Opfer danach in den Mund gestopft. »Könnte auch nach Eintritt des Todes erfolgt sein.«
Die Haut des Toten wirkte durch die Verwesung bereits schwammig aufgedunsen. Auf der rechten Gesichtshälfte hatten sich Druckstellen gebildet, da der Leichnam auf der Seite gelegen hatte. Die linke Hälfte wies Bissspuren auf. Ratten hatten Fleischstücke aus der Wangenpartie und Nase gebissen. In den Wunden waren bereits Fadenwürmer und kleine Maden zu erkennen.
»Das Geld spielt eine Rolle«, murmelte Konter. »Vielleicht als Symbol. Wozu sonst diese Mühe?« Er zeigte auf den Papierhaufen. »Mindestens zwei Handkarren voll. Das Opfer darin eingebettet. Und zwei Handvoll Scheine ins Maul gestopft.«
»Wertlos«, meinte Druwe plötzlich. Sein Vorgesetzter sah ihn fragend an. »Ich meine, hier liegt nur Papiermark aus der Inflationszeit. Vielleicht handelt es sich ja um eine Art Botschaft. Der Tote war ebenso wertlos wie das Geld. Etwas in der Art.« Er blickte Konter an, als erwartete er jeden Moment eine weitere Zurechtweisung. »Nur so ein Gedanke, Herr Kommissar.«
»Gut, Druwe«, sagte der ältere Polizist stattdessen. »Gut! Lassen Sie ein paar Fotografien machen. Fertigen Sie eine Skizze des Tatorts an. Vergessen Sie dieses Mal nicht, die Abstände zu messen! Sie wissen, dass der Dicke Sie sonst wieder faltet.«
»Und der Leichnam? Da könnten wichtige Spuren zu finden sein. Wenn der Bestatter erst einmal dran war, können wir das vergessen.«
»Sie laufen heute zu Höchstform auf, junger Kollege. Sehr gute Idee. Rufen Sie in der Charité an. Verlangen Sie einen Dr. Schmid aus der Chirurgie. Der Kerl ist ganz versessen darauf, für uns Leichen aufzuschneiden. Bisschen gruselig, was er so treibt. Aber er scheint mir ein recht fähiger Arzt zu sein. Unsere Polizeiärzte und Leicheninspektoren taugen nichts. Und Schmid kann Ihnen sagen, in welchen Keller Sie den Toten dann zur Untersuchung bringen lassen.«
»Schmid? Berthold Schmid?« Druwe stand da, als hätte Konter ihm gerade einen Heiratsantrag gemacht.
»Was ist? Kennen Sie ihn?«
»Er ist mein Schwager.« Druwe wusste zwar, dass Schmid in der berühmten Klinik arbeitete. Aber die beiden Männer hatten sich nach dem frühen Tod von Druwes Schwester aus den Augen verloren. Dass sein Schwager nebenbei für die Kriminalpolizei Leichen untersuchte, war ihm völlig neu.
»Na bestens!«, erwiderte Konter. »Die ganze Familie beisammen. Dann ist Berlin ja bald sicher.« Er lachte. »Wenn er Ihr Schwager ist, machen Sie ihm ein bisschen Dampf. Und in Zukunft fahren Sie zu ihm und hören sich seine Berichte an. Dem Kerl macht es jedes Mal Spaß, mir den Appetit auf mein Mittagessen zu verderben.«
Der Kriminalassistent nickte fast ein wenig zu beflissen. Konter mochte keine Streber. Druwe schien wissbegierig, eifrig und korrekt zu sein. Vielleicht etwas neunmalklug. Besonders ärgerte seinen Vorgesetzten, dass er dabei auch noch gewieft und begabt war. Sein voriger Assistent war ein freundlicher, fähiger Kollege gewesen. Jens Druwe war hingegen eine Art Spürhund, der alles vergaß, wenn er Witterung aufgenommen hatte. Noch war er ein Welpe, aber bald konnte er zu einem hervorragenden Kripomann werden. Konter, der selbst spät zur Kriminalpolizei gekommen war, gestand sich ein, dass er den jungen Kollegen beneidete. Um die vielen Jahre, die er noch vor sich hatte.
»Geben Sie ihm eine Chance, Paul«, hatte Gennat vor einigen Tagen lächelnd gesagt. »Er ist wie Sie. Nur ist er beinahe dreißig Jahre jünger. Und das, mein Lieber, nagt an Ihnen.«
Paul Konter bewunderte seinen Vorgesetzten für dessen Menschenkenntnis. Er hatte auch in diesem Fall recht. Und dennoch – Konter wollte es dem jungen Mann nicht zu leicht machen.
Während sein Chef den Rückzug antrat, stellte sich Druwe auf weitere Stunden hier unten ein. Seine Nachlässigkeit bei der Tatortsicherung ärgerte ihn. Er war derart fasziniert von der Fundstelle gewesen, dass er zunächst alle Regeln außer Acht gelassen hatte. Nun jedoch war er fest entschlossen, es wiedergutzumachen. Alles sollte stimmen, wenn ihn dieses Mal der dicke Gennat ausquetschte. Er zeichnete, notierte, maß Abstände, gab dem eingetroffenen Fotografen Order.
Seltsame Sache, dachte er und sicherte die Geldscheine, die er aus dem Mund des Opfers gezogen hatte, in einer Papiertüte. Wer starb schon mit einer Billion Mark im Hals? Daran konnte man in der Tat ersticken.
4
Luisenstadt, Anfang Dezember 1923
Entgegen seiner Gepflogenheit empfing Franz den Chinesen bei sich zu Hause. Shen Li war einige Zeit lang Zhi Chaos rechte Hand in Hamburg gewesen. Gemeinsam hatten sie die Routen des Schmuggels aus Asien über Rotterdam, Antwerpen, London und die deutsche Hansestadt ausgearbeitet. Sie hatten Kapitäne und Mannschaften bestochen und die ersten Geschäfte mit dem Opium gemacht, das ihnen auf dem Kontinent förmlich aus der Hand gerissen wurde. Jetzt war Shen der Kopf der Berliner Unternehmung, denn der Rat der Gesellschaft des Himmels und der Erde, der kleinsten Triade in Shanghai, wünschte nun, in die deutsche Hauptstadt zu expandieren. Folglich hatte Zhi Chao von Franz den Gefallen eingefordert, den dieser ihm schuldig war.
»Meister Zhi ist sehr zufrieden mit den Geschäften, Herr Sass«, sagte Shen Li. Mittlerweile hatte sich das höfliche Gehabe des Chinesen im Umgang mit den Brüdern etwas eingeschliffen. Franz hatte ihm irgendwann erklärt, dass ständiges Verbeugen seinem Rücken schade und ein dauerhaftes Lächeln Gesichtsfalten verursache, er folglich in Zukunft gedachte, darauf zu verzichten.
»Die Lieferungen verkauften sich beinahe von allein«, meinte Franz. »Wir mussten nicht viel tun.« Ihm war unwohl bei dem Gedanken, den Mann um eine Ausweitung des Opiumschmuggels zu bitten. Bisher waren die Mengen eher eine Nebensache gewesen. Kleine Pakete, die zwischen Schnaps, Kohle und Getreidelieferungen nicht aufgefallen waren. Einige Boten hatten das Rauschgift sogar einfach in Taschen versteckt und waren mit der Reichsbahn gefahren.
»Nicht so bescheiden, Meister Sass! Der weise Bauer befreit das Feld von Steinen, bevor er es bestellt. Der Pflug geht dann wie von selbst durch die Erde.«
Shens Weisheiten gingen Franz nicht minder auf die Nerven, aber er lächelte gequält. Der Mann war eine Art Berliner Gesandter und Kontaktmann für die chinesischen Kaufleute aus Hamburg, denen Zhi Chao vorstand. Dort gab es ein winzig kleines China Town, das eigentlich nur aus einer Straße bestand. Franz war Zhi zu besonderem Dank verpflichtet, seit ein von ihm empfohlener Arzt im vorigen Jahr mit Kräutern, Pilzen und Salben Susanne, seine Lebensgefährtin, von einer überaus misslichen Hautkrankheit geheilt hatte. Neben kostbaren Tuchen und Gewürzen waren es vor allem Opium-Produkte, die Zhi in die Hauptstadt liefern wollte. Das Kokain war zwar weiterhin das beliebteste Rauschmittel nächtlicher Ausschweifungen, aber dem betuchten Berliner stand auch zunehmend der Sinn nach jener Form von Entspannung, die der Mohnsaft in so einzigartiger Weise versprach.
»Ich weiß es zu schätzen, dass Ihr mich in Euer Haus eingeladen habt, Herr Sass.« Shen verbeugte sich wieder. »Ein Zeichen des Vertrauens. Andererseits zeigt es mir, dass eine Sorge auf Euch lastet.«
Hinterlistiger, schlauer Fuchs, dachte Franz.
»Es waren schwierige Monate, Herr Shen«, erwiderte er. »Die Geldentwertung hat uns viele Kunden vergrault.« Mit Grausen dachte er an das vergangene Vierteljahr. Die Papiermark verlor zum Schluss stündlich an Wert. Wer in der Nacht Ware verkaufte, bekam am nächsten Tag für das Geld nur noch die Hälfte. Kurzerhand waren wichtige Geschäfte eben in harter Währung abgeschlossen worden. Gleiches galt für Koks und Opium, die mancher gegen das Geschmeide der Angetrauten eintauschte. »Nicht jeder konnte in Dollar oder Franc zahlen.«
»Jeder Kapitän kommt durch ruhige See. Nur derjenige, der das Schiff wohlbehalten durch die Stürme steuert, ist des Vertrauens hoher Herren würdig.« Shen Li schien Gefallen daran zu finden, sein Gegenüber durch die aufgesetzten, höflichen Gesten und Weisheiten aus seiner Heimat auf die Geduldsprobe zu stellen.
Aber Franz war gewarnt. Sternwein hatte in früheren Jahren mit den Chinesen in Holland und Hamburg zu tun gehabt und ihm eingeschärft, immer die Fassade aufrechtzuerhalten.
»Wie auch immer«, fuhr Franz fort. »Die neue Mark scheint werthaltig zu sein. Ich denke, dass wir in kurzer Zeit die zehnfache Menge Opium absetzen können. Sofern Sie liefern.«
»Natürlich«, meinte der Chinese. »Sehr schön. Meister Zhi wird erfreut sein, dies zu hören. Aber der Verkauf des Opiums in Europa ist nur ein Nebenverdienst im Vergleich zu den wahren Schätzen, die im Reich der Mitte zu heben sind. Wir besprachen vor einiger Zeit, dass die Familien gedenken, das Geld auch wieder vermehrt in unserem Heimatland zu verdienen. Es kann nicht sein, dass die Engländer dort den Anbau des Opiums verbieten, aber es dann aus ihren eigenen Kolonien einführen und umso teurer an unsere Landsleute verkaufen.«
Shen Li zog ein Papier aus seinem Stoffbeutel und breitete es auf dem Tisch aus. »Die Gesellschaft des Himmels und der Erde war nicht untätig während der deutschen Krise. Seht her.« Er zeigte auf die Namen einiger Firmen, von denen Franz nur einige kannte. »Die Firma Bayer erwirbt Opium als Arzneirohstoff und veredelt es zu Morphium. Und seit vielen Jahren zu dem noch wesentlich wirksameren Heroin. Alles vollkommen legal, da ja eine Arznei entsteht. Heroin ließ sich zwanzig Jahre wunderbar als Schmerzmittel und Hustensaft, als Aphrodisiakum und Muntermacher verkaufen. Leider haben die Amerikaner es verboten. Aber in Eurem Land ist man erfinderisch, Herr Sass. Einige Forscher erfanden ein neues Mittel. Es werden ein paar Wirkstoffe zum Heroin hinzugegeben, die zwar medizinisch sinnlos sind, aber die Wirkung des Heroins nochmals steigern. Und alles zusammen stecken sie in ein Medikament, das sie Anti-Opiumpille nennen. Und wir werden es in ganz Asien vermarkten!«
»Ja, ich erinnere mich«, meinte Franz. »Sie haben mir bereits vor einigen Monaten von diesen Plänen berichtet.« Er schüttelte den Kopf. »Das Anti-Opium ist also Heroin. Es ist, als wollte man jemandem das Rauchen von Zigaretten abgewöhnen, indem man ihm Zigarren anbietet.«
»Wir könnten damit in China und den Nachbarländern einen Markt bedienen, der vierhundert Millionen Dollar abwirft«, sagte Shen. »Jährlich. Die deutsche Arznei ist dabei sogar in mehrfacher Hinsicht wirksam. Sie wirft für alle Gewinn ab. Sogar Steuern werden hier gezahlt! Sie macht zudem die Ärmsten der Armen glücklich. Eine Zeit lang jedenfalls. Und sie schadet den Engländern. Was den Engländern schadet, erfreut die Deutschen. Und so schließt sich ein wunderbarer Kreis. Nacht und Tag. Unten und oben. Yin und Yang.«
»Wer?« Franz ahnte, dass Shen Li gerade wieder eine seiner durchgeistigten Anwandlungen hatte. Chinesen mochten das offenbar. »Egal, Politik interessiert mich nicht.«
»Aber doch sicherlich das Glück der Menschen.«
Franz widerte es an, wenn der Chinese sich eine brutale Welt mit seinen Wortspielen und Weisheiten schönredete. Diese Leute trieben anderen Menschen den Dolch langsam ins Herz und lächelten dabei noch freundlich. Rauschgift brachte jetzt in Berlin eine Menge Geld ein. Und dennoch war es in seinen Augen nur Dreck. Er konnte damit leben, wenn nur verwöhnte Industriellensöhne das Zeug rauchten, sich durch die Nase oder in die Adern jagten. Aber sogar die Hungerleider kauften von ihren letzten Kröten Rauschgift und verzichteten lieber auf Essen und Unterkunft.
»Es treibt Menschen in den Ruin«, meinte Franz halbherzig. Wieder musste er an den toten Freund denken. Ian hatte sich mit Kokain zugedröhnt und nicht bemerkt, dass seine Mörder ihn in eine Falle gelockt hatten. Das Opium schien ihm sogar noch gefährlicher, denn es entführte die Süchtigen in ihre schönen Traumwelten, wodurch sie oft völlig handlungsunfähig wurden.
»Bitte, Herr Sass. Es sind die Pole des Lebens. Der Mensch wünscht sich ein wenig Freude, ein bisschen Wohlstand, ein paar Stunden ohne Sorge. Und wir, die Geschäftsleute der modernen Welt, bieten dieses kleine Glück an, um Geld zu verdienen. Denken Sie an Alkohol, Zigaretten, Glücksspiel und käufliche Liebesdienste, aber auch an Theater oder Kinematograph. Ein Stück Torte beim Konditor, das Spitzenhöschen für die Dame von Welt, die Freude des Hausherrn, wenn ein Genussschein oder der Zins das Vermögen mehrt. Ersetzen Sie die kleine Moral durch die großen Zusammenhänge, dann leben Sie leichter, werter Freund! Das Konsortium der Opiumhändler ist der Heilsbringer für viele, die sonst nie ein solches kleines Glück erleben.«
»Verschonen Sie mich mit Ihren Weisheiten«, erwiderte Franz. »Wenn Sie das so sehen wollen, ist das Ihre Sache. Ich habe allerdings einen Freund an das Kokain verloren. Und ich kenne diese verdreckten Opiumhöhlen, in denen die Leute ihr sogenanntes Glück genießen. Aber lassen wir das Taktieren. Mein Unternehmen muss Geld verdienen, und die Zeiten ändern sich rasant. Was sagten Sie? Diese deutsche Firma stellt ein neues Opium her?«
»Heroin. Wie ich schon sagte, ganz neu ist es nicht. Bayer darf es allerdings in Deutschland nicht mehr produzieren oder in den Handel bringen. Das Unternehmen besitzt aber noch riesige Mengen davon.«
»Wenn es doch angeblich wesentlich wirksamer ist als das herkömmliche Opium und als Medikament eingesetzt wurde, wieso hat man es verboten? Und wie sieht es mit den Gefahren bei dem Zeug aus?«, fragte Franz.
»Nun ja. Die Amerikaner übertreiben da etwas.« Shen wirkte zum ersten Mal leicht verlegen. »Sie sagen, es macht die Leute schneller abhängig, und die Auswirkungen auf die inneren Organe wären katastrophal. Aber ich halte das für einen geschickten Schachzug.«
»Weshalb denn das?«
»Nun ja, es sind deutsche Unternehmen, die hier Geld verdienen können. Und ich muss Euch nicht erklären, was die Siegermächte mit dem Vertrag von Versailles erreichen wollten. Das stärkere Raubtier frisst immer zuerst.«
Franz erinnerte sich an verschiedene Werbeanzeigen im Vorwärts, in der Vossischen Zeitung und in Mosses Annoncen. Hustensaft mit Heroin. Angeblich für Säuglinge bestens geeignet. Und jetzt verkauften sie das Zeug vielleicht bald an Millionen süchtige Chinesen.
»Meister Zhi hat einen Fachmann in seine Dienste genommen, der die Qualität der Rohstoffe und die Zubereitung in den Fabriken überwachen wird.« Shen kam jetzt offenbar direkt zur Sache. »Er wird auch die Kontakte zu wichtigen Herren an der Charité halten.«
»Zur Charité?«, fragte Franz verblüfft.
»Bedenkt, dass es offiziell ein Medikament sein wird«, meinte der Chinese. »Es ist gut, wenn die Wirksamkeit durch angesehene Männer bestätigt ist. So gibt es keinen Ärger mit den Ämtern.«
Er begann, die genauen Zusammenhänge zwischen Herstellern, Zulieferern und Vertrieb zu erklären. Und bereits nach kurzer Zeit war alles derart verworren, dass Franz beide Hände hob und sich abwandte.
»Da blickt ja keener mehr durch!«, schnaubte er.
»Eben«, erwiderte Shen.
»Noch einmal ganz einfach: Die deutsche Chemiefabrik Bayer hat den internationalen Verträgen zugestimmt, kein Heroin mehr herzustellen«, fasste Franz zusammen. »Sitzt aber auf riesigen Beständen, die sie an eine Firma namens Luxol verkauft. Dort stellt man zusammen mit den Rohstoffen einer anderen Firma die Pillen her, die dann über einen Berliner Düngemittelhersteller nach China verschifft werden.«
»Die Last ist auf viele Schultern verteilt.« Shen nickte. »Ich sehe, Ihr habt verstanden, Meister Sass. Natürlich wird das Syndicat nichts mit der Produktion zu tun haben. Ihr seid für einen störungsfreien Transport der Chemikalien und der Ware zuständig.«
»Gut, ich sorge über meinen Bruder und die Familie Harussel für den Schutz von Fabrik- und Lagerhallen. Einen Transport über Wasser oder Land sichern unsere Leute ebenfalls.«
Franz wusste, dass er mit dieser Option einen entscheidenden Trumpf gegenüber Shen in der Hand hielt. Die Triaden verfügten in Deutschland gar nicht über die notwendige Anzahl an Männern, um diese Aufgaben zu bewältigen. Und die notwendigen Kontakte zu Polizei und Verwaltung besaßen sie wahrscheinlich ebenfalls nicht. Hinzu kam, dass sich kaum ein deutscher Arbeiter von einem Asiaten wie Shen anheuern und herumkommandieren lassen würde. Auf die Vorurteile des europäischen Menschen war eben immer Verlass.
»Eure Leute schaffen die Ware auf unterschiedlichen Wegen in den Hamburger Hafen«, bestätigte Shen und nickte. »Die Anti-Opiumpillen werden dort verladen, und dafür nehmt Ihr dann Rohopium wieder mit zurück in die Hauptstadt. Das Ganze natürlich gut getarnt in Fässern und Säcken mit Düngemitteln oder den besagten Rohstoffen. Wir verstecken jeweils zehn Kilogramm unserer Ware in einer Tonne Volldünger.«
»Weshalb diese Geheimnistuerei bei den Pillen?«, fragte Franz. »Ich dachte, es ist eine offizielle Arznei.«
»Sagen wir, der Anteil des Heroins unterliegt gewissen Schwankungen«, erwiderte der Chinese und lächelte. »Es gibt eine Spezifikation zur Prüfung durch Charité, Gesundheitsamt und Zoll. Die von uns vertriebene Dosis liegt allerdings leicht über diesen Vorgaben. Der Chemiker wird übrigens alle Vorgänge strengstens überwachen. Eurem Syndicat obliegt die Sicherheitsfrage und der Vertrieb des Opiums in der Stadt. Ihr habt Eure Löffel also sogar in zwei Töpfen.«
»Oder den Kopf in zwei Schlingen. Wie man es nimmt.« Franz hielt inne. »Wer ist der Chemiker?«
»Ein Fachmann, der seit Jahren nur mit dem Heroin und seinen Zubereitungen arbeitet. Gerade am Anfang müssen wir den Facharbeitern auf die Finger schauen. Damit eine Ware gleichbleibender Qualität erzeugt wird.«
Beide Männer besprachen noch weitere Einzelheiten, und Franz machte sich Notizen, welche Fragen noch zu klären und welche Vorbereitungen zu treffen waren.
»Ihr erhaltet jeweils durch einen Boten die Angaben, die Ihr braucht.« Der Chinese stand auf und kam zum Ende seines Vortrags. »Lastkraftwagen, Binnenschiffe oder Reichsbahn. Wir müssen beständig die Frachtwege verändern, damit niemand auf dumme Gedanken kommt. Bereitet Euch bitte darauf vor, dass die ersten Lieferungen im nächsten Monat beginnen werden.«
Shen Li gab Franz zum Abschied die Hand, und sein Gastgeber meinte einen Augenblick lang, die Spannung zu spüren, die von dem Mann ausging. Keine Verbeugung, kein Lächeln.
Er weiß, dass viel auf dem Spiel steht, vermutete Franz zunächst. Dann aber wurde ihm klar, was er eben gespürt hatte. Angst. Shen Li hatte Angst. Und Franz empfand diese Erkenntnis keinesfalls als tröstlich.
˚˚˚
Eine Stunde später saß Franz im Klub Berlin, der bis vor einem Jahr von Ian McCullen geleitet worden war. Hierher zog es ihn immer dann, wenn ihm zu unpassender Zeit der Sinn nach einem – oder zwei – Kognaks stand. Hier gab es genügend melancholische Erinnerungen, die ihn alle guten Vorsätze über Bord werfen ließen. Gerade spürte er, wie sich die wohlige Wärme des Hennessy in ihm ausbreitete, als die Tür zum hinteren Privatzimmer aufgerissen wurde und ein sichtlich aufgelöster Josef Sternwein erschien. Er hatte sich nicht angekündigt und machte sich ohnehin in letzter Zeit rar auf den Straßen und bei den Treffen des Syndicats. Für Franz war er in den vergangenen Jahren zu einer Art väterlichem Freund und Mentor geworden, obwohl – oder gerade auch weil – sie in vielerlei Hinsicht Konkurrenten waren.
»Ich brauche deine Hilfe«, meinte der jüdische Geschäftsmann ohne Umschweife. Er war völlig außer Atem, und Franz hatte ihn noch nie derart aufgebracht erlebt. »Etwas Schreckliches muss geschehen sein. Ich spüre es! Ich habe den Herrn erzürnt! Und nun erhalte ich die gerechte Strafe. Nein, nein. Warum er? Warum nicht ich?«
Fast fühlte sich Franz jetzt an das Wehklagen erinnert, das er in seiner Bandenzeit oftmals in dem von vielen Ostjuden bewohnten Scheunenviertel beobachtet hatte. Sternwein wiegte seinen Körper nach vorn und hinten, hob die Arme zum Himmel und jammerte immer wieder: »Nein, nein, nein, warum nur er?«
»Beruhige dich erst einmal, Josef.« Franz winkte dem Barmann zu, dem Gast ebenfalls einen Kognak zu bringen.
»Aaron wird vermisst!«, sagte Sternwein und leerte den Schwenker gierig in einem Zug, als hätte er Limonade bekommen. »Seit einigen Tagen ist er nicht nach Hause gekommen. Und seine Familie hat nichts von ihm gehört.«
»Das muss doch nichts heißen. Vielleicht hat er eine nette Gojte kennengelernt und überlegt noch, ob er sie seinen Eltern vorstellen soll.«
»Mach keine Scherze, Franz. Du kennst Aaron doch. Wir sind Liberale, aber er ehrt dennoch Vater und Mutter. Wie es der Brauch ist. Er würde niemals einfach verschwinden, ohne Nachricht zu geben. Ich habe an der Universität nachfragen lassen. Er ist dort seit einer Woche nicht zu seinen Vorlesungen und Seminaren erschienen. Es muss etwas passiert sein. Oh, Herr verzeih mir!«
Aaron Rosenbaum war der älteste Sohn von Josef Sternweins Schwester. Sein Vater, ein angesehener Bankier aus der weit verzweigten Familie Oppenheim, war ein politisch rühriger Republikaner, der seine Beziehungen nach Paris und London genutzt hatte, um die Regierung Gustav Stresemann bei ihren Bemühungen um eine Stabilisierung der deutschen Wirtschaft zu unterstützen. Dadurch hatte er sich den Hass nationaler Radikaler im Reich zugezogen, die sich einmal mehr in ihrer Ansicht bestätigt sahen, Deutschland wäre nur Opfer einer jüdischen Weltverschwörung.
»Wer sollte Aaron schaden wollen?«, fragte Franz leicht unsicher. »Er ist doch eher ein Künstler und Philosoph, kein Geschäftsmann.«
Besser gesagt, ein Nichtsnutz, dachte Franz leicht amüsiert. Der Kerl war Ende zwanzig und studierte munter vor sich hin, ohne Anstalten zu machen, sich einen anständigen Beruf zu suchen. Graf Geld, den ein Weltschmerz befallen hatte.
»Bei seinen Hauskreisen ist er ebenfalls seit über einer Woche nicht erschienen«, meinte Sternwein. »Er hat sogar eine Lesung aus seinem Gedichtband versäumt, ohne abzusagen. Dabei hatte sich Vollmoeller angekündigt! Und Kommilitonen haben ihn in dieser Woche nicht bei den Vorlesungen an der Universität gesehen.« Sternwein schien wirklich besorgt zu sein. »Du weißt, dass mein Schwager ein bedeutendes Bankhaus führt. Er vermittelt Hypotheken für die angesehensten Familien.«
»Solche Leute haben Feinde.« Franz nickte. »Aber Aaron? Und es steht doch ohnehin nicht zum Besten zwischen ihm und seinem Vater. Hast du das nicht mal gesagt? Vielleicht gab es nur einen Streit zwischen den beiden. Oder Aaron will sich mal wieder für einen neuen Studiengang einschreiben. Vielleicht hat ihm sein Vater den Geldhahn abgedreht. Eine Frau. Eine längere Feier außerhalb der Stadt. Es gibt hundert Gründe, weshalb ein Mann in seinem Alter für ein paar Tage verschwindet.«
»Er ist ein äußerst korrekter Mensch«, widersprach Sternwein. »Fast ein wenig zwanghaft für die Art Freigeist, die er eigentlich sein möchte.«
»Wohl wahr.« Franz lachte. »Da kenne ich ganz andere Kerle. Trinken, singen und den Weibern unter den Rock fassen. Manchmal denke ich, dass einige Burschen sich nur deshalb der Kunst zugewandt haben, um von mehr als einer Muse geküsst zu werden. Aber Aaron scheint mir tatsächlich in dieser Hinsicht etwas steif und altmodisch.«
»Du könntest doch Konter auf die Sache ansetzen! Und diesen Detektiv gleich dazu.«
»Paul arbeitet jetzt bei der Mordbereitschaft! Da kann er doch nicht einfach dem überfälligen Sprössling eines Bankiers hinterherlaufen.«
»Er soll sich nur umhören. Mehr verlange ich doch gar nicht. Und du solltest deine Cliquenjungs mit ein paar Mark versorgen und sie ein wenig auf Streife schicken. Sie müssen sich auf der Straße umhören. Dieser Detektiv, der schon einmal für dich gearbeitet hat. Beauftrage ihn! Hier ist eine Liste mit den Namen von Aarons Bekannten und seinen Lieblingslokalen. Du musst etwas tun!« Sternwein reichte Franz das Papier und fasste seinen Oberarm. »Bitte, es ist mir wichtig. Du weißt, er ist wie ein Sohn für mich.«