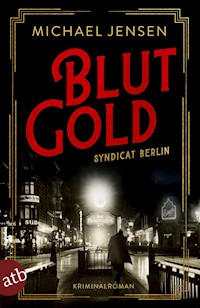9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspektor Jens Druwe
- Sprache: Deutsch
Die tödlichen Gefahren des Neuanfangs.
Der Zweite Weltkrieg ist seit ein paar Stunden beendet, als Inspektor Jens Druwe zum Marinestützpunkt in Flensburg gerufen wird. Er soll helfen, eine neue Polizeieinheit aufzubauen. Dann erhält er eine seltsame Nachricht - von Werner Grell, einem untergetauchten Geheimdienstagenten. Grell berichtet von brisantem Material, das er über ehemalige Nazi-Größen besitzt. Zögernd vertraut Druwe sich britischen Militärs an. Das erste Geheimtreffen zwischen Grell und einem Captain der Briten endet jedoch in einem Fiasko. Beide werden tot in einer Lagerhalle gefunden. Es sieht aus, als hätten sie sich gegenseitig erschossen. Doch Druwe hat da seine Zweifel ...
Ein Doppelmord im Mai 1945 – ein hochspannender Roman vor einer ungewöhnlichen historischen Kulisse.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 511
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Über das Buch
Die tödlichen Gefahren des Neuanfangs.
Der Zweite Weltkrieg ist seit ein paar Stunden beendet, als Inspektor Jens Druwe zum Marinestützpunkt in Flensburg gerufen wird. Er soll helfen, eine neue Polizeieinheit aufzubauen. Dann erhält er eine seltsame Nachricht – von Werner Grell, einem untergetauchten Geheimdienstagenten. Grell berichtet von brisantem Material, das er über ehemalige Nazi-Größen besitzt. Zögernd vertraut Druwe sich britischen Militärs an. Das erste Geheimtreffen zwischen Grell und einem Captain der Briten endet jedoch in einem Fiasko. Beide werden tot in einer Lagerhalle gefunden. Es sieht aus, als hätten sie sich gegenseitig erschossen. Doch Druwe hat da seine Zweifel.
Ein Doppelmord im Mai 1945 – ein hochspannender Roman vor einer ungewöhnlichen historischen Kulisse.
Über Michael Jensen
Michael Jensen wurde 1966 im Norden Schleswig-Holsteins geboren. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg und Flensburg. Im Hauptberuf ist er als Arzt und Therapeut tätig. Seine beruflichen Erfahrungen hat er in zwei Sachbüchern zusammengetragen. Dabei interessieren ihn besonders die seelischen Spätfolgen des Zweiten Weltkriegs, vor allem bei den Nachkommen von Opfern und Tätern. Bisher erschien von ihm ein Roman um den Inspektor Jens Druwe: »Totenland«.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Michael Jensen
Totenwelt
Ein Jens-Druwe-Roman
Kriminalroman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
12. November 1944
Kapitel 1
5. Mai 1945
Kapitel 2
6. Mai 1945
7. Mai 1945
Kapitel 3
Kapitel 4
8. Mai 1945
9. Mai 1945
Kapitel 5
10. Mai 1945
11. Mai 1945
Kapitel 6
12. Mai 1945
Kapitel 7
13. Mai 1945
Kapitel 8
14. Mai 1945
15. Mai 1945
Kapitel 9
17. Mai 1945
Kapitel 10
18. Mai 1945
19. Mai 1945
20. Mai 1945
Epilog
23. Mai 1945, Flensburg
Nachwort
Impressum
Prolog
12.November 1944
Eine Gestalt schleicht um die feuchten Baracken. Sie kommt allein. In der Nacht hat es Frost gegeben, am Tag zuvor geregnet. Der Schatten huscht zwischen den rauen, hölzernen Bettgestellen entlang. Ein Keuchen hier, ein Stöhnen da. Und dort auf dem Strohsack in Reihe drei, unten Stille. Um drei Minuten nach vier schlug jenes Herz ein letztes Mal. Kaum eine Minute vorher war ein Seufzer durch den ausgemergelten Körper gegangen, der sich stundenlang in Krämpfen und Zuckungen gewunden hatte. Endlich war der Atemzug entwichen, der den Übergang besiegelte. Nur der dunkle Besucher weiß davon, die anderen, die Schläfer dämmern dahin. Zufrieden nimmt er die stumme Parade der Todgeweihten ab. Sie werden morgen den kalten Körper auf den Karren zerren und zur Grube fahren. Ihre Hüllen verfaulen schon im Leben, aber ihre Seelen warten nur auf ihn, den dunklen Messias.
René Fabron stammt aus Toulouse. Seine Mutter war Jüdin. Er ist Techniker. Jüdin, es bedeutete ihren Tod. Techniker, es rettete ihm das Leben. Der Erzfeind war der Deutsche, so ist es für René und seine Familie immer gewesen. Die Welt schien in Ordnung, in jenem fernen Frankreich nach dem großen Krieg und dem Vertrag von Versailles. Die Kanaille war am Boden. Doch dann kamen die Deutschen wieder. Wie ein Fieber, das überwunden schien, kroch die Welle diesmal bis Paris. Und die Grande Dame hielt ihren alten Arsch nun willig dem teutonischen Phallus hin. Unzählige Kollaborateure fanden sich, die deutsche Sache zu unterstützen. Marschall Pétain und sein Vichy-Frankreich ließen sich besteigen vom arischen Herrenwahn. Es folgten Bespitzelung, Verrat und Deportation. Nein, es war kein Deutscher, der René und seine Familie denunziert hatte. Es waren die Durands. Sie waren die Nachbarn der Fabrons. Seit ewigen Zeiten, immer freundlich und höflich. Und dann hatte François Lefevre sie abgeholt. Ausgerechnet die Durands. Ausgerechnet François. René hatte seinem Sohn eine Lehrstelle verschafft, den Traktor und Lieferwagen der befreundeten Familien mehr als einmal repariert. Sie hatten viele Gartenfeste miteinander gefeiert. Und François war sein bester Freund aus Schulzeiten. Er hatte ihn abschreiben lassen, sich für ihn geprügelt. So war es seit Urzeiten gewesen. Man half sich. Und nun? Man verriet einander. Das Gleichgewicht der einfachen Welt war zerstört. Der Faden des Vertrauens war gerissen. Renés Familie kam ins Lager Kulmhof im Osten. Arbeit. Vernichtung. Vernichtung durch Arbeit. Und selbst der Tod war bar jeder Menschlichkeit. Seine Mutter hatte ihn angelächelt, als die Wachen sie fortrissen. Ihr letzter Gruß. Das Lebewohl an den Sohn. René hatte schnell herausgefunden, was mit jenen geschah, die nicht ausreichend arbeiten konnten. Die nicht wertvoll genug waren in den Augen der SS. Die Nazis hatten den Tod lukrativ gemacht. Wer aber hatte seine Mutter wirklich getötet? Ein deutscher Hermann oder Kurt? Oder waren es doch Claude Durand und François Lefevre gewesen?
Schmerz ist gut. Er zieht vom Körper in das Gehirn. René Fabron ringt mit seinem Hass. Die innere Glut versengt, aber der Schmerz läutert. Er erdet. Stimmt ein auf einen weiteren Tag. Endlich fährt er herum, als ihn der Stock ein drittes Mal trifft.
»Wirst du Dreckschwein endlich anfangen? Wenn ich eine Verwarnung kriege, dann zahle ich es dir zehnmal zurück, das verspreche ich dir, du Judensau.« Der Kapo steht ganz dicht bei Fabron. Ein Holländer. Kommunist. Man kann seinen fauligen Atem riechen, die braunen Zahnreste im Mund sehen. Die Lippen sind aufgeplatzt. Auch im tiefsten Abort gibt es immer noch ein Oben und Unten.
»Halt die Fresse, Adolf«, entgegnet René trocken, und sofort treffen ihn zwei weitere Schläge in Höhe der Schulterblätter. Das haben sie den Kapos beigebracht. Dort schmerzt es, aber die Leute können weiterarbeiten. Wenn sie einen arbeitsunfähig prügeln, dann kommen sie selbst in den Bau und verlieren ihre Privilegien.
Fabron taucht seine Hände in das stinkende Bad. Er muss die Bakelit-Separatoren prüfen. Seit einiger Zeit experimentiert die Accumulatoren-Fabrik AFA mit neuen Materialien, um die Lebensdauer und Kapazität der von ihr hergestellten Batterien zu verbessern. Deshalb hatte man ihn aus dem Lager Kulmhof weggeholt. René Fabron ist Ingenieur, er kennt sich mit Elektrotechnik aus. Also ist er wertvoll für die SS, die Arbeiter an Industriebetriebe verleiht. Gegen Geld. Rassenwahn und Vernichtung sind eben auch ein großes Geschäft. Wer wertvoll ist, stirbt nicht. Jedenfalls nicht sofort. So war Fabron vor vier Monaten in dieses Werk bei Hannover verlegt worden. Die AFA baut diese wichtigen Akkumulatoren. In U-Booten, Flugzeugen, Panzern, in den V-Waffen und sogar in den Lagern werden sie verwendet. Das Reich braucht diese Batterien überall. Der Krieg braucht Strom. Neben dem Treibstoff ist er der Lebensfunke der ganzen Todesmaschinerie. Es ist, als belebe er Frankensteins Monster. Oder als drehe Fritz Lang hier im KZ-Außenlager Stöcken ein neues Metropolis, aber diesmal mit echten Maschinenmenschen.
René hat Glück. Weil er wertvolles Wissen besitzt, darf er Handschuhe bei der Arbeit tragen. Und eine Schutzbrille. Denn immer wieder tauchen seine Hände in das Bad aus hoch konzentrierter Schwefelsäure. Er richtet die Separatoren neu aus, misst Abstände, prüft mit einem Säureheber den ersten Ladungszustand. Er arbeitet sorgfältig, aber zwölf Stunden sind lang. Immer wieder lässt seine Aufmerksamkeit nach. Schon ein kleiner Spritzer könnte ihm die Augen verätzen. Stattdessen treffen die Tröpfchen nur sein Gesicht. Manchmal merkt er es erst, wenn die Hitze kommt. Dann ist es schon zu spät, denn dann ätzt sich die Säure schon in ihn hinein. Bereits nach einem Vierteljahr gleicht seine Haut einer Kraterlandschaft aus pockenähnlichen Säurenarben. Und er weiß, dass er sterben wird. Er atmet die tödlichen Dämpfe ein. Das Blei wird sich in seinem Körper verteilen und ihn langsam hinrichten. Andere müssen sogar ohne Atemschutz die Bleiplatten gießen und mit bloßen Händen an den heißen Elektroden arbeiten. Sie erwischt es schnell. Kaum ein Arbeiter in der Gießerei hält länger als drei Monate durch. Es ist für alle nur geborgte Zeit. Auch für René. Nicht, dass dies etwas Besonderes wäre. Jeder Mensch stirbt. Irgendwann. Aber die Deutschen haben mit ihrem Todessystem den Schöpfer und sein ewiges Uhrwerk überlistet. Sie bestimmen die Lebenszeit der Unterjochten. Hier fährt der Sensenmann seine Ernte früher ein. Aber vorher holen die Schinder alles aus ihren Opfern heraus.
Sie haben die Zeit vorgestellt für uns Juden, denkt Fabron.
Fabron weiß, dass es den anderen Häftlingen schlechter ergeht. Täglich verrecken zwei oder drei Männer an Bleivergiftung. Sie arbeiten ohne Schutz mit den Platten, sie schleifen, schneiden, gießen, löten. Das Schwermetall zerstört ihr Gehirn. Mehrmals schon sind Gefangene wie von Sinnen durch das Lager gelaufen, haben geschrien, sich die Haare ausgerissen und die Haut blutig zerkratzt, bevor sie erschossen wurden. Oft erbrechen sie dann noch das Bleiweiß, denn das Metall hat in ihrem Magen mit der Säure einen weißen, unauflöslichen Schleim gebildet.
Fabron zeichnet gern. Zeichnen ist sein Halt in einer Welt des beständigen Fallens. Mit seinen kleinen Kohlezeichnungen krallt er sich in die Wände des Abgrunds, verzögert er sein Abgleiten in die Tiefe. Er sammelt kleine Papierfetzen, die der Wind heranträgt, die er eintauscht gegen ein Stück Brot. Und auf ihnen zeichnet er Lagerinsassen, Szenen, Gesichter. Um hier zu überleben, braucht man eine Strategie. Und da gibt es gute und schlechte Strategien. Die Nazis und Kapos wollen, dass du dich aufgibst. Dass du nur noch ans Fressen, Scheißen und Schlafen denkst. Dann ist es für sie am leichtesten. Da gibt es diejenigen, die schon nach einem Monat tot sind. Sie atmen zwar noch, und ihr Herz schlägt weiter, aber sie sind bereits fort. Man erkennt sie am Blick. Leer, ohne Hoffnung. Diese Wesen sind innerlich abgestorben, bevor sie tot sind. Vielleicht überstehen sie das Ganze sogar bis zum Ende, weil sie kein Schlag, kein Hunger, keine Kälte, keine Erniedrigung trifft. Aber sie werden auch niemals wieder das menschliche Licht sehen, Wärme spüren oder Freude empfinden.
Und dann gibt es noch diejenigen, die meinen, sich nach innen flüchten zu können. Sie trauen der äußeren Welt nicht mehr, die so viel Leid über sie gebracht hat. Sie finden Halt nur noch in sich selbst. Sie glauben, dass sie tief in sich ihre Erinnerungen und Werte aufbewahren für die Zeit danach. Aber sie sind mit sich selbst allein, isoliert, verletzbar.
Nein, da ist sich René Fabron sicher, um Mensch zu bleiben in der Hölle, muss man Kontakt halten. Nicht nur zu sich selbst, sondern auch zu den anderen. Fabron sieht in die müden Gesichter, sieht die Kämpfe, die diese Kreaturen austragen. Die Läuse, die schon in so dicken Schichten auf ihnen sitzen, dass sie bereits wärmen. Das kurze Haar, die Wangenknochen, die Höhlen, in deren Tiefen Augen verzweifelt nach dem Leben suchen. Und René schaut in die Herzen der Menschen. Er erkennt das Wesen seiner Leidensgenossen. Er sieht das Sehnen nach ein wenig Glück. Der Kaffee auf der Promenade. Die Hand der Angebeteten. Ein Sonnenstrahl, der durch dunkle Gewitterwolken bricht. Der Wind im Haar.
Das vereint uns alle, denkt er. Schmerz gehört zum Leben, auch und gerade bei den kleinen Leuten. Aber niemand darf uns den Glauben nehmen, dass auch wir etwas Schönes verdient haben. Nur eine warme Suppe, ein nettes Wort, ein sanftes Streicheln. Fabron kennt noch den Jungen in sich, der sich dem liebenden Kuss der Mutter entwand. Und jetzt würde er alles geben, diesen noch einmal zu spüren. René Fabrons Zeichnungen sind schon Thema bei den leisen, knappen Gesprächen am Abend. Kurz vor der Nachtruhe werden sie herumgereicht. Und sie zeigen den Leuten, dass bei aller Entmenschlichung noch Würde in ihnen steckt. Dass sie nicht vergessen sind. Dass ein Stück Papier von ihrem Leben berichten wird. Fabrons Geschick hat sich sogar bis zu den Aufsehern herumgesprochen. Und so hat er im Frühherbst den Lagerleiter, Hauptsturmführer Klebeck, und dessen Familie porträtieren müssen. Ein Ereignis, das ihn völlig verstörte. Klebeck, der sonst die Insassen brutal schinden ließ, saß im Garten hinter seinem Haus. Er war mit seiner Frau und seinen Kindern liebevoll und fürsorglich umgegangen. Fabron hatte den Unmenschen erwartet, er wollte den Schlächter, das deutsche Tier zeichnen. Stattdessen war es ein netter, entspannter Nachmittag gewesen. Der französische Jude aus Toulouse malte den deutschen kaufmännischen Angestellten aus Berlin. Der eine war jetzt Untermensch, der andere gehörte zur Herrenrasse. Bevor sich für ihn die Pforten zur Hölle wieder geöffnet hatten, war Fabron Schokolade überreicht worden, die Kinder hatten ihn Onkel Rainer gerufen und gewinkt. Fünf Minuten später hatten zwei Kapos die Normalität wieder aus ihm herausgeprügelt. Er konnte zwei Wochen nicht zeichnen.
Aus seiner Erinnerung fertigt er später ein kleines Porträt von Klebeck an. Sein geheimes Archiv besteht bald aus über fünfzig winzigen Zeichnungen von SS-Wachleuten, Kapos und Angestellten der AFA. Und noch einmal so viele, die er bereits in den Lagern Kulmhof und Neuengamme zeichnete. Einhundert kleine Bilder von den Handlangern des Grauens. Fabron malt gegen das Vergessen, denn oft liegt er wach und fragt sich, ob ihn nur ein böser Traum quält. Er will festhalten, was doch so flüchtig scheint. Seine Bilder zeigen die Wachmänner, die Schinder und Mörder. Immer mit Namen und Dienstgrad. Manchmal schreibt er eine Geschichte mit Datum dazu. Ein Zigarrenröhrchen, das er beim Reinigen gefunden hat, dient zur sicheren Verwahrung seines Schatzes. René weiß noch nicht, was er damit anfangen wird, aber er spürt, das Zeichnen gibt ihm Kraft.
Sie flattern im Wind. Die Muselmänner machen allen Angst. Fabron hatte sie schon im Todeslager Kulmhof kennengelernt. Es sind Männer, die die Schwelle überschritten haben. Hier in Stöcken bei Hannover leiden sie neben einer Entkräftung an den Vergiftungserscheinungen des Bleis. Sie sind seltsam bleich, manchmal fast weiß. Deshalb nennen die Kapos sie Schneewittchen. Sie krümmen sich unter Bauchschmerzen, da das Metall Koliken verursacht. Selbst die SS-Wachleute machen einen Bogen um sie. Als befürchteten sie, der Tod könne auf sie überspringen. So müssen die Ausgemergelten, die Abgemagerten, die zerstörten Menschen irgendwo an einer Bretterwand lehnen. Sie werden geschont. Jedoch nur, weil es so kostengünstiger ist. Niemand muss sie töten. Und weil diese Kreaturen selbst jetzt noch einen Dienst verrichten. Sie sind ihren Mithäftlingen Menetekel für das, was kommen mag. Stille Zeugen drohenden Unheils. Sie schüchtern mehr ein, als es Gebrüll und Prügel je könnten. So harrt der Muselmann seinem Ende entgegen, unfähig, sich mit den verkrümmten, im Bleikrampf fixierten Gliedern niederzulegen. Er lehnt sich gebeugt an klammes Holz und stirbt im Stehen.
Und wieder geht ein Tag für Fabron und seine Mithäftlinge zu Ende. Die Gestalten wanken den elektrisch gesicherten Weg von den Werkshallen zum Lager. Ein Verwaltungsangestellter der AFA steht im Schein der Natriumdampflampen am Tor, die Aktentasche mit den eben unterzeichneten Verträgen in der Hand. Er bespricht sich mit einem Mitarbeiter des SS-Wirtschaftsamts. Man lacht. Man ist sich einig geworden. Häftlinge aus dem Osten sind jetzt günstiger zu haben. Vierhundert weitere Kreaturen bis März. Die Bilanzen stimmen. Der SS-Offizier streichelt seinen Hund. Fast zärtlich wirken seine Bewegungen. Die sogenannte Schleuse, der schmale Weg zwischen dem Werk und den Schlafbaracken, führt die geschundenen Lagerinsassen über den Roßbruchgraben durch das Tor. Müdes Abzählen im Halbdunkel auf dem Appellplatz. Wegtreten. Die Novembersonne des Tages konnte die Baracken nicht mehr aufwärmen. Vom Marienwerder Wald im Süden weht zudem ein kühler, feuchter Wind. Eine Gestalt schleicht um die feuchten Baracken. Sie ist zufrieden, hier gibt es nichts für sie zu tun. Das Purgatorium frisst die Unschuld. Einsamkeit und Verzweiflung fahren ihre Ernten ein. Eine gute Zeit. Für den Tod. In Deutschland.
1
Wir tragen viele Lasten
Der Tag wird Ewigkeit
Wir tragen was auch kommen mag
Wir tragen unser Leid
(Lied aus dem KZ Sachsenhausen; Text: W.Hammer, 1942)
5.Mai 1945
Was taten die Menschen in den ersten Tagen nach diesem Krieg? In den meisten vom deutschen Joch befreiten Ländern gab es in diesen Wochen zwar auch Jubel und Freude. Aber ganze Landstriche, die zerstört, entvölkert und verbrannt waren, verharrten in banger Erwartung des Kommenden. Im Osten hatte fast jede Familie ihren Blutzoll zahlen müssen. Das alte Europa war am Ende, eine neue Zeit brach an. Die Sieger waren gleichzeitig auch Verlierer. Denn der deutsche Wahn hatte nicht nur Leben genommen, Landschaften verschlungen. Er hatte Tabula rasa in den Seelen der Menschen gemacht, und dieses Vakuum musste gefüllt werden. Womit jedoch füllt man Leere, wenn man selbst ohne Hoffnung ist? Antworten mussten gefunden werden von verwundeten Wesen, die umherirrten, ihre Welt nicht mehr kannten; die gequält wurden durch ihre Erinnerungen; deren seelische Narben für immer bleiben würden.
Was taten die Menschen also nach dem Krieg? Die Unterlegenen atmeten kurz auf, aber sie ahnten wohl, dass nun das Pendel zurückschlug, das sie angestoßen hatten. Im Norden des ehemals Großdeutschen Reichs versuchten sie, in ihr normales Leben zurückzufinden. Was aber war Normalität überhaupt? In den ländlichen Regionen um Flensburg veränderte sich nicht viel. Hier war man vom Vernichtungskrieg, wie er im Osten geführt wurde, verschont geblieben. Hier schwiegen die Waffen sogar ein paar Tage früher als anderswo. Plötzlich trug der NSDAP-Ortsleiter in Dörfern wie Kattrup wieder Zivil statt Parteiuniform, und er sammelte Unterschriften, die ihm eine schon immer im Herzen gefühlte Widerstandsbereitschaft gegenüber dem Regime bestätigen sollten. Hakenkreuz und Führerbild verschwanden aus den Amtsstuben im Kreis Flensburg-Land. Laut und lärmend war die braune Sache gekommen, auf leisen Sohlen schlich sie davon. Der Spuk war nun vorüber, dunkle Wolken wichen dem Licht. Man musste jetzt nur fegen und aufräumen. Weitermachen nach dem unseligen Kater des Erwachens. Vielleicht mochten einige Leute es gern so sehen, aber die Wunden waren überall zu tief. Sie schmerzten. Die Söhne und Väter. Stumm und klagend blickten sie von den Bildern. Warm die Erinnerung an sie. Kalt und tot ihr Leib, verscharrt in fremdem Land. Überrollt von den Wogen eines Kriegs, den doch der Einzelne nie gewollt hatte. Und in den dann alle willig mitgezogen waren.
Inspektor Jens Druwe irrte etwas verloren durch die Innenstadt. Er hing seinen Gedanken nach. Vor zwei Wochen hatte er noch gedacht, er würde das Kriegsende als Revierleiter in einer dörflichen Polizeistube abwarten können. Der ehemalige Kripo-Mann war vor knapp zwei Jahren zu einem Ordnungspolizisten degradiert worden. Versunken in Selbstmitleid, betäubt durch Fusel und Luminal hatte er danach seinem eigenen Ende entgegengedämmert. Dann war vor acht Tagen der Mord an einem NS-Parteibonzen geschehen. Druwes kriminalistischer Spürsinn war plötzlich wiedererwacht. Sein Jagdinstinkt aus den alten Berliner Zeiten, als er noch als Kriminalkommissar gearbeitet hatte. Alles in seinem Leben hatte sich seither verändert. Er war wieder in der Spur, lädiert und verbeult zwar, aber im Rennen. Druwe fragte sich, ob es tatsächlich der Fall gewesen war, der seinen Lebenswillen wieder geweckt hatte. Oder Eva Steinfeld, die Frau, die jetzt an seiner Seite stand.
Seltsam, dachte er. Die Welt um mich herum zerbricht. Und ich richte mich gerade wieder auf. Zu einer Unzeit. Neubeginn in einem Zwischenzustand bangen Hoffens. Als wäre ich verschüttet gewesen, jahrelang unter Trümmern verschollen. Und Eva hat mich ausgegraben. Druwe lächelte bei diesem Gedanken.
In der Stadt herrschte an diesem Samstagvormittag eine ungewöhnliche Atmosphäre. Sie ähnelte einer lauten Stille. Zum Maifeiertag hatten noch viele Geschäfte und alle Amtsstellen geflaggt. Jetzt waren plötzlich die Porträts vom Führer, das Hakenkreuz und alle anderen Symbole der NS-Volksgemeinschaft verschwunden. Bei der Buchhandlung Rühling hatte gestern noch Mein Kampf im Schaufenster gelegen. Jetzt zierten Schiller, Herder und Kleist die Auslage. Im Lichtspieltheater am Holm sollte heute eigentlich der Film Kolberg laufen. Über dem heroisch anmutenden Plakat mit den Gesichtern Heinrich Georges und Kristina Söderbaums klebte quer der rote Schriftzug Heute keine Aufführung. Gerüchten zufolge hatte Goebbels persönlich Hand an das Drehbuch des Durchhalte-Streifens gelegt. Druwe hatte sich den Film vor einem Monat in Glücksburg angesehen, als dort die wandernden Volks-Zeltlichtspiele gastiert hatten.
»Ich glaube, der Krieg wird bald zu uns kommen. Wir brauchen ihm nicht nachzulaufen.« Diesen Satz eines Akteurs aus dem Film hatte er sich eingeprägt.
Auf eine spezielle Weise waren der Propaganda-Minister Joseph Goebbels und seine Leute in den letzten Monaten erstaunlich ehrlich geworden. Man musste nur genau hinsehen und hinhören.
Überall in den Straßen der Flensburger Innenstadt sah Druwe Menschen umhereilen. Zerlumpte Gestalten, die auf den Schiffen aus den Ostgebieten des Reichs geflohen waren. Zehntausende waren in den Hafenstädten angekommen. Sie stanken nach Schweiß und Angst, Schiffsdiesel und Meersalz. Tote Augen blickten ihn an. Augen, die zu viel Schreckliches gesehen hatten. Daneben flanierten Damen der Flensburger Kaufmannsfamilien und hielten sich affektiert ein parfümiertes Tuch vor die Nase. Betrunkene Flittchen aus den SS-Lokalen wankten an ihm vorbei. Eine Hafennutte aus dem Oluf-Samson-Gang lächelte ihm zahnlos zu. Nur die jungen Frauen aus dem Bund deutscher Mädel und einige Marinesoldaten trugen noch ihre Uniformen. Schon gestern hatte Druwe erstaunlich wenige Wehrmachtssoldaten in der Innenstadt gesehen. Die engen schwarzen Uniformen und die Lackstiefel der SS-Leute waren sogar vollkommen aus dem Straßenbild verschwunden. Der Bürgermeister und der Kampfkommandant hatten Flensburg am Nachmittag einvernehmlich zur »Offenen Stadt« erklärt. Es würde keine militärischen Maßnahmen zu ihrer Verteidigung geben. Man hoffte auf die Milde der Briten.
»Damned Kraut!«, drang es plötzlich laut an Druwes Ohr. In seine Gedanken versunken hatte er einen jungen Mann übersehen, der aus der Nikolaistraße auf den Holm abgebogen war. Er stieß mit ihm zusammen und blieb erschrocken stehen. Erst jetzt erkannte er, dass ihm ein Gewehrlauf vor die Brust gehalten wurde. Der Mann war britischer Soldat. Neben und hinter ihm zuckten die nervösen Finger seiner Kameraden an ihren Waffen. Es war ein angenehm warmer Tag, aber den jungen Männern stand der Schweiß unter den Helmen, die Salatschüsseln ähnelten. Druwe trug keine Polizeiuniform, und wahrscheinlich rettete ihm seine alte Angewohnheit aus Berliner Kripo-Tagen in diesem Moment das Leben. Bei seinen Ermittlungen war er immer in Zivil unterwegs gewesen. Langsam hob er die Arme. Der Engländer blickte ihm in die Augen, bemerkte dann Druwes braune Lederhand. Er spuckte verächtlich auf den Boden und gab seinem Sergeant ein Zeichen. Die Soldaten wechselten einige Worte, die Druwe kaum verstand. Dann wurde er rüde zur Seite gestoßen und atmete im nächsten Augenblick erleichtert auf.
Britische Vorhut, dachte er. Himmelfahrtskommando, denn überall konnte ein Heckenschütze oder angetrunkener Fanatiker des besiegten Feindes lauern. Seit gestern galt de facto eine Waffenruhe für Norddeutschland. Andererseits hatten Hitler und das Oberkommando schon im März die Anweisung gegeben, Alliierte nach dem Einmarsch hinterrücks zu erschießen. Das Unterfangen wurde martialisch Werwolf getauft, aber bisher scherte sich im Norden offenbar niemand um diesen Wahnsinn. Entsprechend tief saß jedoch die Angst der ersten Truppen, in einen Hinterhalt zu geraten. Und entsprechend locker lagen die Finger der jungen Soldaten am Abzug ihrer Gewehre. Solche Vorposten sollten eine zu besetzende Stadt erkunden und Meldung machen, wenn die Luft rein war.
Druwe entschied sich nach diesem Vorfall, auf sein Revier in Glücksburg zurückzukehren. Er war unkonzentriert und unentschlossen. Und das konnte im Moment verheerende Folgen haben. Hier in Flensburg herrschte die seltsame Atmosphäre eines Zwischenzustands. Es wurde zwar im Norden nicht mehr gekämpft, aber eine Waffenruhe war noch lange kein Frieden. Das konnte für ihn gefährlich werden. Immerhin hatte er noch seinen klapprigen Dienstwagen, den er vor vier Tagen in der Flensburger Direktion entwendet hatte. Wenn er Pech hatte, würden die Briten das Ding beschlagnahmen, dann konnte er die zehn Kilometer bis zur Dienststelle zu Fuß gehen. Oder sie würden ihn einfach seines Postens als Polizeichef in Glücksburg entheben. Im schlimmsten Fall kam er vielleicht sogar in Kriegsgefangenschaft, denn als Polizist hatte er offiziell auch den militärischen Rang eines Hauptmanns inne. Polizeibeamte waren vor einigen Jahren entweder in die SS oder in die Wehrmacht übernommen worden. So hatte die Weisung des Reichsführers Himmler gelautet.
Im Grenzpolizeikommissariat der Gestapo in Harrislee standen die Telefone schon am frühen Morgen nicht still. Es waren keine besorgten Bürger, die hier anriefen, um Verdächtige zu melden oder Vergehen anzuzeigen. Es waren Stabsoffiziere und Adjutanten, die für ihre besorgten Vorgesetzten Quartiere, Schutz und Fahrzeuge verlangten. Die Rote Armee hatte in den vergangenen Wochen nicht nur die Reste der Wehrmacht vor sich hergetrieben. Vor ihr flohen auch sämtliche höheren Verwaltungsstrukturen des braunen Terrors nach Westen. Kommandanten der Konzentrationslager traf man nun in der kleinen Gemeinde bei Flensburg ebenso wie Schreibtischtäter des Reichssicherheitshauptamtes.
»Steller, ich habe eine Sonderaufgabe für Sie«, sagte der Leiter des Kommissariats, Hans Bothmann, zu dem Mann, den er zu sich in den allgemeinen Besprechungsraum befohlen hatte.
Hauptsturmführer Steller hatte Anfang Mai die Flucht des gesamten Führungsstabes der Ordnungspolizei überwacht und koordiniert. Vorher war der Offizier jahrelang bei der Waffen-SS eingesetzt gewesen.
»Die Umgliederung der OrPo ist abgeschlossen«, erwiderte er. »Die Männer stehen für den Reichsführer bereit, und meine Aufgabe ist erledigt. Ich stehe voll zu Ihrer Verfügung, Hauptsturmführer Bothmann.«
»Es geht um diesen Kerl.« Bothmann legte eine Fotografie auf den Schreibtisch und schob sie zu Steller. Sie zeigte das Porträt eines älteren Mannes von der Seite und von vorn. Die Aufnahmen waren drei Jahre alt. Auf einem Schild standen die erkennungsdienstlichen Angaben der Feldpolizei.
»Druwe, Jens Hannes«, las Steller. »Sagt mir nichts.« Er wollte das Foto zurückgeben, jedoch schüttelte Bothmann den Kopf.
»Behalten Sie es. Sie werden es noch brauchen. Der Mann hat unrechtmäßig eine wichtige Liste in seinen Besitz gebracht und damit einige Personen stark verärgert. Darunter auch den Reichsführer. Zudem ist er in Besitz eines Notizbuches, in dem die Verwahrung von – nennen wir sie so – Sparguthaben dieser Personen geregelt ist.«
»Liste?«, fragte Steller. »Können Sie mir Genaueres sagen, Hauptsturmführer Bothmann?«
»Das eben Gesagte muss reichen. Der Kerl hat uns bereits eine Menge Ärger gemacht.«
»Soll ich ihn liquidieren?«, hakte Steller nach.
»Nein!«, rief Bothmann. »Zumindest nicht sofort. Setzen Sie ihn unter Druck. Machen Sie ihm Angst. Wenn er uns die Liste und das Buch ausgehändigt hat, dann …«
»So etwas braucht Zeit, Herr Bothmann. Vorbereitungen. Akteneinsicht. Und ich befürchte, dass die Kameraden von der Stapo mir nicht mehr helfen können. Ich muss zunächst seine Schwachstelle finden.«
Sein Gegenüber zog eine weitere Fotografie aus einer Mappe und legte sie vor sich ab. Er tippte mit zwei Fingern darauf. »Wir kennen seinen wunden Punkt bereits. Der Kerl wurde mehrfach mit dieser Frau gesehen. Ein Zeuge berichtete, dass sie sich geküsst hätten. Wir wissen sogar, wo sie ihren Unterschlupf haben.« Bothmann wirkte verärgert. »Ganz dreist mitten in der Innenstadt, fünf Minuten vom Präsidium entfernt. Leider fehlen uns die Männer, um beide einfach festnehmen zu lassen. Wir müssen uns wohl daran gewöhnen, in nächster Zeit eher unerkannt und verdeckt zu arbeiten.«
»Was soll ich tun?«
»Jagen Sie dem Mann Angst ein. Benutzen Sie die Frau, verletzen Sie sie, Steller. Dann machen Sie Druwe klar, dass sie stirbt, wenn er nicht unsere Forderung erfüllt. Wie schon gesagt, danach werden beide beseitigt. Betrachten Sie es als Standgericht wegen Hochverrats. Und …« Ein durchdringender Blick traf seinen Gesprächspartner. »Es muss schnell gehen. Uns läuft die Zeit davon.« Mit diesen Worten drehte er das Foto, auf dem bisher seine Finger geruht hatten, herum.
Steller grüßte seinen Vorgesetzten halbherzig, als dieser den Raum verließ. Er starrte danach lange gebannt auf das zweite Foto. Er kannte diese Frau. Und er liebte sie.
»Inspektor Druwe am Apparat.« Jens Druwe nahm den Telefonhörer von seinem Wachtmeister, Otto Hülser, entgegen. Er war noch am Samstagnachmittag auf sein Revier in Glücksburg zurückgekehrt. Er hatte sich zwar gefragt, welche Befugnisse er jetzt noch hatte. Und ob seine Leute überhaupt noch zum Dienst kommen würden. Aber irgendwie hatte er das Gefühl, dass er sich hier nützlich machen konnte. Keiner seiner Wachleute wusste, ob es überhaupt noch vorgesetzte Dienststellen gab, ob sie bezahlt wurden und ob ihre Arbeit noch erwünscht war. Druwe hatte seine Männer befragt, und alle wollten zunächst weitermachen. Sein Stellvertreter berichtete ihm von einigen Straftaten in der Umgebung. Zwei Raubüberfälle auf Höfen, eine versuchte Vergewaltigung auf offener Straße und mehrere Schlägereien. Plötzlich schien sich jene Gewalt in den Menschen Bahn zu brechen, die vor den drakonischen Strafen der Nazi-Bürokratie nur abgetaucht war. Hinzu kam, dass verzweifelte Zwangsarbeiter von den Bauernhöfen und aus Flensburger Betrieben geflohen waren, ziellos umherirrten und auch auf Rache für erlittenes Unrecht sannen. Displaced Persons. So nannten die Briten jene Menschen, die jetzt zwar frei, aber heimatlos waren.
»Streckwein hier«, erklang es vom anderen Ende der Leitung. »Mein Name ist Dr. Hans Streckwein, Regierungsrat beim Reichsinnenminister.«
Der Name sagte Druwe nichts. Augenblicklich versuchte er jedoch, sich ein Bild von der verworrenen Lage der Regierungsgeschäfte zu machen. Der Führer war tot, Berlin von den Russen eingenommen. Durch einen Kollegen und aus dem Radio hatte er erfahren, dass Großadmiral Karl Dönitz von Hitler mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragt worden war. Da es jedoch kaum noch Platz in den unbesetzten Teilen Deutschlands gab, hatte sich der Oberbefehlshaber der Marine entschieden, nach Flensburg auszuweichen. Wie hätte er auch seine blauen Jungs von der Alpenfestung oder der Region um Prag aus befehligen sollen?
»Herr Druwe, ich bin vom Innenminister beauftragt, die Umstrukturierung unserer Polizei zu koordinieren. Ich habe in den letzten zwei Tagen die Personalakten von leitenden Beamten der Stadt Flensburg und des Landkreises durchgesehen. Ich würde gern mit Ihnen ein persönliches Gespräch führen. Es geht dabei um Ihre berufliche Zukunft, Herr Inspektor. Und um den Neuaufbau einer unpolitischen Polizei. Vielleicht kann ich Ihnen da eine leitende Position anbieten. Aber die Zeit drängt, da der Feind …« Streckwein unterbrach sich. »Wir wollen den Westalliierten zeigen, dass Deutschlands Staatsorgane arbeitsfähig sind. Ich wäre Ihnen sehr verbunden, wenn wir uns kurzfristig treffen könnten.«
Druwe war verblüfft und ein wenig überrumpelt. Er hatte eher mit seiner sofortigen Entlassung gerechnet. Immerhin hatte er in den letzten Tagen viel Wirbel verursacht und war dabei einigen NS-Funktionären auf die Füße gestiegen. Zudem besaß er ein paar brisante Informationen, bei deren Bekanntwerden noch mehr Unmut in den Reihen der strammen Volksgenossen aufkommen würde. Nun sollte er bei einem Neuaufbau dabei sein? Er wusste nicht recht, ob er das überhaupt wollte. Die Tätigkeit bei der Ordnungspolizei war ihm von seinen Vorgesetzten eher aufgezwungen worden. Nach der Sache in Russland galt er für die Kriminalpolizei als untragbar. Und dass er sich geweigert hatte, in die Schutzstaffel Himmlers einzutreten, war seiner beruflichen Karriere ebenfalls nicht förderlich gewesen. Zögernd stimmte er zu, sich nach dem Wochenende mit Streckwein am neuen Regierungssitz in Mürwik zu treffen. Dort hatte die Marine mehrere Schulungsgebäude und auch eine eigene Kommandantur. Zudem lag im Hafen seit Jahren der Hapag-Dampfer Patria mit den Annehmlichkeiten einer maritim-komfortablen Unterbringung. Es gab das Gerücht, dass sogar der Führer bei einem Flensburg-Besuch vor einigen Jahren auf dem Luxusschiff übernachtet hatte.
Druwe wechselte noch ein paar Worte mit dem Regierungsrat und brachte ein paar grobe Details in Erfahrung. Die Männer verabredeten ein Treffen für den Montagvormittag. Offenbar sollte Druwe eine Schlüsselrolle beim Aufbau einer neuen Polizeitruppe übernehmen. So viel konnte er den Andeutungen Streckweins entnehmen. Am Telefon war der Beamte jedoch nicht bereit, nähere Einzelheiten zu erläutern. Nachdem Druwe das Gespräch beendet hatte, gab er dem diensthabenden Hülser Anweisungen für die Wochenendschichten. Er wollte den Sonntag bei Eva in Flensburg verbringen und seinen schwer verletzten Kollegen Hans Oberbauer im Krankenhaus besuchen. Vor allem musste er sich aber darüber klar werden, ob er am Montag überhaupt noch Polizist sein wollte.
»Otto, ich fahre heute Abend nach Flensburg. Ich muss in dieser Mordsache Lessling den Kripo-Kollegen noch einige abschließende Fragen beantworten und die Berichte ergänzen«, log er.
Alle wussten, dass auf dem Polizeipräsidium in der Innenstadt im Moment das reinste Chaos herrschte. Die Führungsebene um Polizeidirektor Hans Hinsch hatte sich abgesetzt. In den letzten Wochen hatte man dort massenhaft gefälschte Dokumente für hochrangige SS-Offiziere, Wachleute der Lager und Verwaltungsbeamte des Reichssicherheitshauptamts ausgestellt. Plötzlich wurden aus diesen Männern entlassene Wehrmachtssoldaten, einfache Feldpolizisten, Feuerwehrleute, Sanitäter und Mitarbeiter technischer Hilfswerke. Neue Kennkarten ließen alte Identitäten verschwinden. Viele Mitarbeiter von Reichskriminalpolizei und Gestapo hatten sich abgesetzt oder waren mit Unterstützung der Flensburger unter falschem Namen abgetaucht.
Wachtmeister Hülser nickte, er kaute auf seiner Stulle. Dabei verzog sich sein Gesicht auf unnatürliche Weise, denn ein russischer Gewehrkolben hatte vor zwei Jahren seinen linken Kiefer zertrümmert. Der Feldarzt hatte im Suff beschissen gearbeitet, so dass der arme Hülser sein Essen fortan eher zermahlen musste. Er sah dabei jedes Mal aus wie eine Kuh beim Wiederkäuen.
Druwe fuhr mit seinem alten Wanderer von Glücksburg aus zurück in die Hafenstadt. Die Kiste klapperte und rauchte, aus dem Vergaser tropfte Benzin auf den heißen Motor, so dass Druwe befürchtete, mit dem Teil jeden Moment in die Luft zu fliegen. Auch dies war typisch für die Kriegswirtschaft. Gute Fahrzeuge waren längst durch Wehrmacht, NS-Fahrzeugkorps oder kriegswichtige Betriebe requiriert worden. Dafür durften sich Polizei, Feuerwehr und Hilfswerk bei Privatleuten aussuchen, was noch übrig war. Der Wanderer der Autounion war nur widerwillig angesprungen. Immerhin war der Tank noch zur Hälfte voll. Druwe fuhr am Glücksburger Schloss vorbei. Hier herrschte seit drei Tagen eine emsige Geschäftigkeit. Marinesoldaten überwachten den Zugang über die kleine Seebrücke. Sogar Möbelwagen hatte man vorfahren sehen. Hier hatte sich Rüstungsminister Speer in den edlen Räumlichkeiten einquartiert. Gerüchten zufolge sollte der ehemalige Monumentalarchitekt und Speichellecker des Führers irgendeine Rolle in der neuen Regierung übernehmen. Wahrscheinlich wollte er durch die Distanz zum Regierungssitz in Mürwik ein Zeichen gegenüber den Alliierten setzen. Er hatte sich immer schon für etwas Besseres gehalten.
Die Landschaft zwischen der verschlafenen Kleinstadt Glücksburg und dem völlig überfüllten Flensburg lag friedlich da. In den Wäldern klaubten einige Leute Feuerholz. Vielleicht hofften sie auch auf einen unvorsichtigen Hasen für den heimischen Teller. Am Strand von Meierwik sah Druwe sogar Kinder im Schlick des Fördestrands spielen. Er dachte an die Nachrichten aus Berlin, Dresden und Hamburg. Im Moment war es eindeutig von Vorteil, im ländlichen Teil Deutschlands zu wohnen. Ein paar Kilometer konnten darüber entscheiden, ob das Dach über dem Kopf intakt und der Bauch gefüllt war. Am Twedterholz nahm die Bebauung langsam zu, und wenig später kam Druwe an der Marine-Sportschule Mürwik vorbei. Hier wollten sich Druwe und dieser Regierungsrat Streckwein am Montag treffen. Vor den Gebäuden des Kasernengeländes war aufwendig geflaggt worden, jedoch sah Druwe nur die Reichskriegsflagge, keine Swastika.
Das ist also die neue Wilhelmstraße, dachte Druwe. Der neue Regierungssitz. Von hier aus wurde jetzt die Zukunft des Reichs bestimmt. Der größte Feldherr aller Zeiten hatte dieses Land wirklich tief in die Scheiße geritten. Da nur wenig Verkehr auf der Straße war, fuhr Druwe langsamer und ließ die Eindrücke auf sich wirken.
Die Gebäude hinter Zaun und Absperrung hatten den Charme aller Kasernen. Der Backstein konnte vom Leid der geschundenen Rekruten berichten, und der Beton zeigte den jungen Männern gleich, dass hier eine Ästhetik der Härte und Kälte wirkte, die fortan ihr Leben beherrschen sollte. Als Druwe den weitläufigen Komplex umfahren hatte, bog er rechts in die steil abfallende Ziegeleistraße ein. Das Bild, das sich ihm darbot, hätte an diesem sonnigen Maimorgen prächtig sein können. Er hatte einen Panoramablick über den Hafen bis zum Westufer der Stadt. In der Schiffswerft war ein halb fertiger Frachter festgemacht. Und fast die gesamte Förde schien durch ankernde Schiffe, Schuten und Lastkähne belegt. Man hätte trockenen Fußes von Ost nach West über das Wasser laufen können. Einzig der Bereich des Marine-Stützpunkts war freigehalten worden. Hier patrouillierte ein Torpedoboot und verscheuchte ankerwillige Schiffe aus dem Militärbereich. So lag der Luxusdampfer Patria friedlich und ungestört vom Elend an seinem Anleger, der Blücherbrücke, in Sichtweite der ehemals kaiserlichen Marineschule.
Druwe fuhr weiter in die Innenstadt und stellte den Wagen in der Nähe des Südermarkts ab. Hier war kein Durchkommen mehr, da die Leute mit ihrem Hab und Gut, mit Säcken und Karren die Straßen verstopften. Manche kauerten sogar unter Segeltuch in den Nischen und Gebäudegängen. Das Haus der Familie Jørgensen befand sich an der Roten Straße, in deren Hinterhöfen einige alte Handelskontore kleinerer Kaufleute lagen. Hier wurden Säcke mit Kaffee und Tee noch mit dem Handkarren vorgefahren, mit der Seilwinde in das Dachlager gezogen und dort verstaut. Mit besonderer Vorsicht galt es, die Rumfässer und Flaschen zu lagern. In allen Krisenzeiten war Hochprozentiges Gold wert. Druwe kannte das aus der Zeit, als er kriegsversehrt aus dem ersten großen Krieg zurückgekehrt war. In Hamburg und Berlin war man damals für drei Zigaretten oder eine halbe Flasche Fusel abgestochen worden.
So war es auch Jørgensens Kontoraufseher selbst, der die beiden Schauerleute vom Hafen hierher misstrauisch beäugt und begleitet hatte. Dem Kaufmann füllte der Schnaps die Börse, dem Arbeiter schenkte er Vergessen. Da konnte schnell ein Fässchen verschwinden.
»Moin, Kaj«, sagte Druwe, als er an dem Mann vorbeiging, um die schmale Treppe zur Wohnung des Kontorhauses emporzusteigen. Hier war Eva Steinfeld untergekommen, die als Aufseherin auf einem Bauernhof bei Kattrup arbeitete. Er hatte sie im Rahmen seiner Ermittlungen in der Mordsache Lessling kennengelernt. Magda Lessling, die Schwägerin des Toten, und Eva waren hier bei Verwandten untergetaucht, um einer Verfolgung durch die Gestapo zu entgehen. Zwar glaubte Druwe nicht, dass für die beiden Frauen noch eine Gefahr bestand. Trotzdem hatte er Eva geraten, sich möglichst nicht in der Stadt blicken zu lassen.
Eva saß in der geräumigen Küche vor dem Radio. Die Jørgensens hatten keinen billigen Volksempfänger, sondern ein englisches Modell, das sie in Kopenhagen gekauft hatten. Die »Goebbels-Schnauzen« waren einfache Geradeausempfänger, die den Empfang der Auslandssender erschwerten. Um das dänische Rundfunkprogramm oder die BBC zu empfangen, musste man an der leistungsschwachen Antenne herumfummeln, was höchst illegal war und manchen Schwarzhörer ins Zuchthaus oder an den Galgen gebracht hatte. Aus dem Gerät klangen flotte Tanztöne, die ganz sicher nicht den Freigabestempel der Reichskulturkammer erhalten hatten.
Als sie Jens Druwe erblickte, erhob Eva sich und eilte freudestrahlend auf ihn zu. Sie war deutlich jünger als er und hatte sich trotz persönlicher Schicksalsschläge eine gewisse Lebensfreude bewahrt, die sie nun mit ihm teilte. Es schien, als wäre ein Funke auf ihn übergesprungen, der seinen Elan und Willen belebt hatte. Er konnte immer noch nicht fassen, dass diese Frau ihn liebte. Sie umarmten und küssten sich. Es war in diesem Moment keine leidenschaftliche, sondern eher eine vertraute, zärtliche Geste. Gerade das rührte Druwe tief an. Sein Leben war in den letzten Jahren eine Katastrophe gewesen. Mehr als einmal hatte er daran gedacht, sich das Leben zu nehmen. Beruflich gescheitert, körperlich und seelisch verkrüppelt hatte er die Tage vor sich hinvegetiert. Seine Ehe war zerbrochen, seine Kinder hatte er seit über einem Jahr nicht gesehen. Seinen Beruf, die Arbeit bei der Kripo, hatte man ihm genommen. Stattdessen durfte er Hühnerdiebe in Glücksburg fangen. Die Erinnerungen und Alpträume an drei Jahrzehnte Krieg quälten ihn. Mit Eva Steinfeld hatte er endlich einen Menschen gefunden, der ihm Wärme und Geborgenheit geben konnte. Es war ein unbeschreibliches Gefühl, das größte Glück.
»Ich werde verrückt, wenn ich noch weiter hier drin bleibe«, sagte Eva plötzlich. »In der BBC sagen sie, dass nur noch im Osten gekämpft wird. Die meisten Truppen im Westen verhandeln über eine Kampfpause. Es ist aus. Wir sind die Schweine los. Ich will nach draußen, dabei sein, Jens.«
»Not und Verzweiflung am Hafen. Ungewissheit überall, selbst in den Villen auf der Westlichen Höhe«, entgegnete Druwe, als er sich von ihr löste. Es lag ein bitterer Unterton in seiner Stimme. »Mehr gibt es da draußen nicht. Die armen Teufel wissen nicht, wie sie weiterleben sollen. Und die Bonzen hoffen, dass ihnen niemand wegnimmt, was sie zusammengerafft haben. So enden doch alle Kriege für die Verlierer.«
Sie schwiegen einen Moment. Druwe spürte, dass es eine Menge zu sagen gab. Aber in vielen Menschen brach sich nun eine verzweifelte Erschöpfung Bahn. Sie machte kraftlos, sprachlos.
»Hast du Neuigkeiten von deinem Bruder?«, fragte Druwe schließlich, um die Atmosphäre etwas zu entspannen. Er sah eine Postkarte auf dem Küchentisch.
Eva Steinfeld schüttelte den Kopf. »Nein, es ist die Karte von Lupo, die du schon kennst. Ich habe sie nur immer wieder gelesen. Einerseits bin ich so froh, dass er es nach Dänemark geschafft hat. Andererseits macht es mich traurig, dass er offenbar auch dort drüben wieder in einem Lager sitzt.«
»Er ist eben Deutscher«, sagte Druwe. »Dass er zwölf Jahre zu Unrecht hier im Zuchthaus saß, interessiert die Dänen im Moment nicht. Aber er schreibt ja, dass sie die Leute nicht misshandeln. Wenigstens etwas. Er kommt sicher bald frei.« Er versuchte, zuversichtlich zu klingen.
Eva begann zu weinen. Diese Reaktion machte ihn jedes Mal hilflos. Er hatte jede Form der Trauer in sich abgetötet, daher fiel es ihm schwer, Eva zu trösten. Sie drückte sich verzweifelt an ihn, und er nahm sie etwas unbeholfen in den Arm.
»Es muss doch irgendwann aufhören, Jens«, schluchzte sie. »Der Hass, das Morden.«
Druwe wollte gern selbst daran glauben. Aber in seinem Inneren ahnte er, dass nun eine Welle der Gewalt ins Reich zurückkam, die das selbst ernannte Herrenvolk über alle Länder Europas gebracht hatte. Er befürchtete, dass für viele Menschen das Leiden noch nicht zu Ende war, aber er schwieg.
»Hast du schon entschieden, was du mit dieser Namensliste machst?«, fragte Eva, nachdem sie einen einfachen Ostfriesen-Tee getrunken hatten.
Druwe war bei den Mordermittlungen vor einigen Tagen auf eine Liste von Personen gestoßen, die sich unter falschem Namen absetzen wollten. Es waren hochrangige Offiziere aus den Reihen von Schutzstaffel und Gestapo sowie NS-Parteimitglieder, die befürchten mussten, für ihre Vergehen von den siegreichen Alliierten zur Rechenschaft gezogen zu werden.
»Wem kann ich im Moment vertrauen?« Er schüttelte den Kopf. »Heute Mittag bin ich drüben am Holm über einen Vorposten der Briten gestolpert. Soll ich denen die Liste in die Hand drücken? Oder soll ich aufs Präsidium gehen und hoffen, dass jetzt alle einen neuen Sinn für Gerechtigkeit entwickelt haben? Nein, ich muss abwarten, Eva. Vielleicht ist ja in der neuen Regierung jemand, dem ich vertraue. Oder ich wende mich an die Militärpolizei der Tommys. Die MP hat fast immer Kontakte zu den Geheimdienstabteilungen. Da muss ich aber auch noch Geduld haben.«
»Und in der Zwischenzeit hauen die Kerle ab«, entgegnete Eva. »Du darfst nicht zu viel Zeit verlieren. Ich frage Lasse. Vielleicht kannst du über die dänischen Sozialdemokraten …«
»Bitte noch nicht, Eva«, unterbrach Druwe sie. »Ich will dich, die Lesslings und Jørgensens nicht in Gefahr bringen. Alles ist im Moment zu verworren. Keiner traut dem anderen.«
»Einer muss damit anfangen!«, rief Eva. »Diese Mörder tauchen einfach unter. Mit der Liste kann man viele aufspüren. Das weißt du selbst, Jens.«
»Du hast ja recht.« Er nickte. »Aber die Kerle kommen nicht weit. Ihnen fehlt das Geld. In die Suppe habe ich ihnen kräftig hineingespuckt.« Er überlegte einen Moment. »Ich werde sehen, dass ich so bald wie möglich Kontakt zu einem englischen Offizier aufnehme. Natürlich werden die uns nicht trauen. Aber wenn ich ihnen von dem Mordfall berichte, dann glauben sie mir vielleicht. Ich will mir diese Namensliste auch so schnell wie möglich vom Hals schaffen.«
Es folgte ein unangenehmes Schweigen zwischen beiden. Um die angespannte Atmosphäre aufzulockern, entschied sich Druwe nach einer Weile, Eva einen Gefallen zu tun.
»Ich mach dir einen Vorschlag. Wir gehen eine halbe Stunde raus. Du kannst dir das ganze Chaos ansehen. Und vielleicht gibt es bei Bartelsen Grießkuchen mit Invertzucker. Dazu eine schön dünne Lorke. Na, klingt das nicht verlockend?«
Bereits wenige Minuten später waren beide auf dem Weg zum Südermarkt, der gleich um die Ecke lag. Die Nikolaikirche ragte in den Himmel und wirkte in Gesellschaft der vielen kleinen Altstadthäuser etwas zu groß geraten. Tatsächlich hatte sich auf dem großen Platz vor der Kirche in einigen Bereichen ein reger Tauschhandel entwickelt. Oft waren den Vertriebenen, die hier in Zelten hausten, nur recht seltsame Dinge geblieben, die für den Alltag und das Überleben in der neuen Stadt keinen direkten Wert hatten. Frauen waren mit ihren Kindern und mit nur einer Porzellanschüssel gekommen. Kriegsversehrte hatten sich verzweifelt an einen Kasten mit Uhrmacherwerkzeug oder an einen Ballen Stoff geklammert.
»Es ist noch schlimmer geworden«, flüsterte Eva. Sie war mehrere Tage nicht draußen gewesen. Nun betrachtete sie die Menschen, die oft direkt auf ihren wenigen Habseligkeiten hockten und schliefen. Ihre Kleidung war meist schmutzig und verschlissen.
»Ich habe dich gewarnt. Und am Hafen sieht es ebenfalls übel aus«, sagte Jens Druwe.
Beide drängten sich über den Marktplatz zum Holm. Hinter ihnen stand der imposante Kirchbau. Druwe wurde durch die Spiegelung der Sonne in einem geöffneten Fenster kurz geblendet und verlor Eva Steinfeld aus den Augen. Plötzlich nahm er an seinem linken Ohr ein Zischen wahr, als würde Papier schnell zerrissen. Im nächsten Moment fuhr ein scharfer Schmerz durch seine Gesichtshälfte. Hinter ihm, bei der Kirche fluchte ein Mann. Druwe hatte die Geräusche aller möglichen Waffen verinnerlicht. Instinktiv wusste er, dass auf ihn geschossen worden war. Aber es war kein Knall zu hören gewesen. Und das konnte nur bedeuten, dass …
»Wo steckst du denn, Jens?« Eva hatte ihn wiedergefunden.
Druwe wirbelte herum und zog sie hinter ein größeres Zelt, in dem Suppe ausgeteilt wurde. Seitlich am Tuch vorbei blickte er zu den Gebäuden auf der anderen Seite des Marktplatzes. Er konnte an den Fenstern niemanden erkennen.
»Du blutest. Hast du dich wieder beim Rasieren geschnitten?«, fragte Eva und suchte in ihrer Tasche nach einem Tuch.
Druwe tastete an seinem Ohr, und tatsächlich lief dort Blut seitlich am Hals hinab. »Ja. Ich dachte, es hätte sich geschlossen. Mal wirkt das Alaun, mal nicht.« Seit seiner Verwundung vor Stalingrad musste er sich mit links rasieren, und oft rutschte er dabei mit dem Messer ab. Er war froh, jetzt eine Ausrede zu haben, denn er wollte Eva nicht beunruhigen. Er drückte sein Taschentuch auf die kleine, brennende Wunde und rang sich ein unverfängliches Lächeln ab.
»Geh schon mal vor, Eva. Wir treffen uns bei Bartelsen. Ich will schnell in die Apotheke und ein kräftiges Heftpflaster holen.« Ohne eine Antwort von ihr abzuwarten, zwängte sich Druwe durch die Menschenmenge wieder in Richtung Friesische Straße. Unauffällig beobachtete er Eva dabei aus dem Augenwinkel. Sie sah ihm zunächst verblüfft hinterher, drehte sich dann um und verschwand in Richtung Holm. In diesem Moment bog er in Richtung Kirche ab. Nach kurzer Zeit hatte er den Mann wiedererkannt, der nach dem Schuss auf Druwe geflucht hatte. Ohne Rücksicht auf die Proteste zu nehmen, zog Druwe die Plane von der Kirchenmauer weg. Er brauchte Gewissheit. Das Licht schien durch ein Loch im Jutestoff. Und im Backstein dahinter steckte ein Projektil. Druwe nahm sein Feldmesser und hebelte das Teil aus dem Ziegel. Es handelte sich um typische Infanterie-Spitz-Munition.
Jetzt hatte er Gewissheit. Es war kein Schuss zu hören und niemand zu sehen gewesen. Das Projektil konnte zu einem Mauser-Karabiner passen. Es gab für ihn keinen Zweifel. Ein Scharfschütze musste auf ihn geschossen haben. Und er hatte ihn knapp verfehlt. Bei diesen letzten Gedanken stieg Panik in Druwe auf. War es Vergeltung? Weil er der SS in die Suppe gespuckt hatte? Oder wollten die Schweine immer noch an ihr Geld herankommen? Vielleicht hatte die Kugel auch Eva gegolten. Wollte man ihren Bruder einschüchtern, damit er nicht wieder politisch aktiv wurde? Sicher schien Druwe nur, dass Eva und er in Gefahr waren.
Der Nachmittag war angenehm auf dem Oberdeck des Luxus-Passagierschiffs Patria. Seit Jahren lag das Schiff an der Blücherbrücke in den Hafenanlagen des Marinestützpunkts Mürwik. Kurz nur hatte es die Welt gesehen, denn ursprünglich war es von der HAPAG als Südamerika-Linienschiff geplant gewesen. Mit Kriegsbeginn jedoch waren zivile Schiffe zu einer leichten Beute geworden. Die Tonnage des Feindes sollte auf den Meeresgrund geschickt werden. Schiffe waren fortan nur noch »BRT«, Bruttoregistertonnen, die es zu versenken galt. Frachtraum war wichtiger als Menschenleben. Während viele Schwesterschiffe ein solches Schicksal ereilte, konnte die Patria, gut verborgen unter Tarnnetzen, zunächst im Hafen von Stettin, dann hier in Flensburg friedlich Muscheln am Rumpf ansetzen. Nun waren Dönitz und sein Kabinett da. Seit der Großadmiral telegrafisch angekündigt hatte, an Bord Quartier zu beziehen, hatte der Erste Offizier in drei Wochen klar Schiff machen lassen. Die Besatzung hatte die Tarnnetze entfernt, den großen Swimmingpool auf dem Achterdeck neu befüllt, und den Holzböden war man mehrere Male mit dem Decksbär zu Leibe gerückt.
»Ein sehr angenehmer Mai, finden Sie nicht, Herr von Krosigk?«, fragte ein etwas hagerer Mann, der zusammen mit drei Regierungsmitgliedern an einem ovalen Tisch saß.
Obwohl das oberste Schiffsdeck durch eine große Markise vor der Sonne geschützt war, blendete das Weiß des Tischleinens die Gäste, die fast alle Sonnenbrillen trugen. Der Mann hatte eine Aktentasche auf dem Schoß, aus der er mehrere Mappen hervorholte. Statur und Aussehen mochten die Anwesenden an eine Verwandtschaft mit Joseph Goebbels denken lassen. Die hohe, fliehende Stirn und ein Gesicht, das an eine Ratte erinnerte, unterstrichen diesen Eindruck. Allein, der Mann hatte keinen Klumpfuß und verfügte nicht über jenes diabolische Charisma, welches die Leute in den Bann des Ministers für Propaganda gezogen hatte.
»Ganz recht, Herr Dr. Löhr.« Graf Schwerin von Krosigk war seit zwei Tagen Leitender Minister und Außenminister der geschäftsführenden Reichsregierung. »Obwohl dunkle Wolken und Regen eher zum Zustand des Reichs passten.« Er nahm einen tiefen Zug von seiner Zigarette, die er an einer Spitze aus Elfenbein hielt. Den Rauch blies er zur Seite in Richtung der wartenden Ordonnanz. Sein leicht nach hinten geneigter Kopf schien etwas zu schmal für die weit auseinander stehenden Augen. Der akkurate Linksscheitel und ein Maßanzug mit feinsten Lederschuhen unterstrichen seinen Junker-Stil.
Am Tisch neben ihm saßen Innenminister Wilhelm Stuckart und Großadmiral Karl Dönitz, den Hitler vor sechs Tagen zu seinem Nachfolger ernannt hatte. Etwas abseits nach achtern standen Generalfeldmarschall Wilhelm Keitel und der Kommandeur der hiesigen Marinekriegsschule, Kapitän Wolfgang Lüth. Keitels herausragendste militärische Begabung war immer das servile Abnicken der Ideen des Führers gewesen. Er hatte Hitler als Oberkommandierender der Wehrmacht bis zu dessen Selbstmord in Berlin zur Seite gestanden. Besser gesagt, er war ihm in den Arsch gekrochen. Lüth hingegen war ein Aushängeschild der NS-Propaganda. Knapp über dreißig war er einer der erfolgreichsten U-Boot-Kommandanten, hoch dekoriert und selbst vollkommen überzeugt von der nationalsozialistischen Sache. Beide Offiziere unterhielten sich lautstark über militärische Optionen im Kampf um Großdeutschland. Lüth waren dabei bereits zwei Cognacschwenker zu Bruch gegangen, als er Keitel an der Reling eine Seeschlacht hatte nachstellen wollen.
»Kommen wir zum Ende, Herr Löhr«, sagte Dönitz knapp.
»Zwei Punkte darf ich mit den anwesenden Herren Ministern und Ihnen, Herr Reichspräsident, noch klären.« Das hagere Rattengesicht blickte Dönitz devot an. Der Admiral nickte kaum merklich gelangweilt.
»Herr Kapitän Lüth möchte, dass vor dem Eintreffen feindlicher Streitkräfte in der Stadt eine Bekanntmachung an die Truppen und die Zivilbevölkerung ergeht«, fuhr der Mann fort. Er schob mehrere Abschriften eines Dokuments über den Tisch. Dann verlas er den Inhalt der Verfügung.
»Alle Soldaten und die Zivilbevölkerung sind sofort darauf hinzuweisen, dass es mit der aufrechten Haltung eines deutschen Menschen und dem Stolz eines Nationalsozialisten nicht zu vereinbaren ist, wenn der vordringende Feind durch Tücherwinken und ähnliche Handlungen begrüßt wird.« Er legte das Schriftstück zur Seite.
»Tücherwinken? Welch abscheuliche und ordinäre Wortwahl«, murmelte von Krosigk leise, so dass ihn Lüth keinesfalls hören konnte. »Aber bitte, soll er seine Erklärung doch abgeben. Was meinen Sie, Herr Reichspräsident?«
Dönitz nickte wieder nur geistesabwesend. Er war mit seinen Gedanken woanders. Er war im Herzen kein Politiker, kein Wortschacherer. Er liebte Schiffe und die See. Er genoss das sanfte Wiegen an Bord der Patria. Er hatte in den letzten zwei Nächten so gut geschlafen wie lange nicht mehr. Sein Leben war das Meer. Er hatte auf fast allem gedient, was schwamm. Und Adolf Hitler hatte seine Talente früh erkannt. Erst war er der Oberbefehlshaber der U-Bootflotte gewesen, dann erster Mann der Kriegsmarine. Großadmiral. Und jetzt sogar Reichspräsident. Der Preis für diese letzte Ehre war allerdings hoch genug. Hitler, sein geliebter Führer, war tot. Berlin war verloren. Wehrmacht und Marine wurden von der ausländischen Presse mit Schmutz beworfen und der abscheulichsten Verbrechen beschuldigt. Sein Lebenswerk war in Gefahr. Er musste retten, was zu retten war. Es ging um die Marine. Seine Marine. Und um Deutschland. Das Leben konnte erbarmungslos sein für einen Offizier wie ihn. Die Vorsehung hatte ihn bei rauem Wetter ans Ruder gestellt. Nun musste er diese Last tragen und das Schiff durch schwere See bringen. Er seufzte und nahm sich noch ein Lachs-Kanapee vom kleinen Silberteller.
»Also lassen Sie es drucken und an die Dienststellen in der Stadt verteilen«, sagte von Krosigk ungeduldig. Schon im Kabinett Hitler war er Finanzminister gewesen, hatte jedoch kaum etwas zu melden gehabt, da der Führer gern selbst die Millionen verteilte. Und was an Geld nicht da war, wurde einfach gedruckt. Und jetzt sollte er Deutschland als Kabinettsleiter mit diesem Haufen verbliebener NS-Politiker in den Frieden geleiten. Er entstammte uraltem Adel, der zwar mit dem konservativen Weltbild der Nationalsozialisten gut zurechtkam. Der andererseits jedoch das ordinär-pöbelhafte Auftreten der Bewegung verabscheute. So wahrte man immer einen gewissen Abstand zum »kleinen Gefreiten« Hitler. Er roch zu sehr nach Volk.
Lutz von Krosigk blies eine weitere Rauchwolke über Deck. »Was sonst noch, Dr. Löhr?«, fragte er schließlich.
»Verschiedene Truppenteile melden vermehrte Unmutsäußerungen von Soldaten, und vereinzelt wurden Befehle hinterfragt oder verweigert. Einige Elemente haben offenbar sogar die Waffen niedergelegt und sind desertiert«, sagte der Mann und legte weitere Dokumente zur Bestätigung vor. »Hier sind einige Anfragen meiner zivilen Richterkollegen, wie mit diesen Männern verfahren werden soll. Wie die Herren ja sicher wissen, bin ich in der Doppelfunktion als stellvertretender Gerichtspräsident am hiesigen Landgericht und als Marineoberstabsrichter verantwortlich für die Koordination von zivilen und militärischen Rechtsfragen.«
Dönitz war plötzlich hellwach und schlug mit der Faust auf den Tisch. »Ohne Waffenstillstand darf es keine Schwäche der militärischen Führung geben!«, donnerte er los. »Flensburg ist zwar offene Stadt, und es gibt vereinzelt Kampfpausen, aber jeder Soldat muss auf seinem Posten bleiben.«
»Also sind solche Elemente weiterhin nach Militärrecht abzuurteilen, Herr Reichspräsident?«, fragte Löhr.
»Jawohl. Ausnahmslos und mit voller Härte!«, bestätigte Dönitz. »Ohne Ordnung in Marine und Heer bricht das Reich zusammen. Oder wie sehen Sie das, Keitel?«
Der Chef des Oberkommandos des Heeres war an den Tisch getreten. »Ich bin vollkommen Ihrer Ansicht, Herr Dönitz.«
»Dann müssen wir mit dem Leiter Ihres Sonderzugs, Kapitänleutnant Jepsen, ein Zeichen setzen, das von allen verstanden wird«, sagte Löhr.
Innenminister Stuckart rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Er wollte am Nachmittag noch einige persönliche Dinge erledigen. Ein Schneider in Flensburg hatte Anzüge für ihn angefertigt. Er musste zum Fotografen, damit sein neues Soldbuch und die Kennkarte möglichst echt wirkten. Sie lauteten auf den Namen Peter Engerlein. Die passende Biografie dazu musste er noch auswendig lernen. Er war gewiss kein Feigling, die Vorbereitungen sollten nur eine Art Rückversicherung sein, falls der Feind ihm krumm kommen wollte. Als SS-Obergruppenführer in leitender Position konnte ihm seine Beteiligung an der sogenannten Endlösung schnell zum Verhängnis werden. Entsprechend nervös war er in den letzten Tagen gewesen.
»Was ist mit diesem Jepsen, Dr. Löhr?«, fragte er sichtlich verärgert. »Muss jetzt die Reichsregierung jeden Gerichtsfall einzeln absegnen, oder was?«
»Todesurteile gegen Offiziere der kämpfenden Truppe sind vom Staatsoberhaupt gesondert zu bestätigen, Herr Innenminister. Führererlass vom …« Weiter kam Richter Löhr nicht, da Stuckart aufgesprungen war.
»Diesen belehrenden Ton verbitte ich mir, Herr Löhr!« Er hatte einen leichten Sprachfehler, der erkennbar war, wenn er sich in höchster Erregung befand. Das D und T kamen dann besonders hart. »Natürlich kenne ich den Erlass. Und natürlich hat unser verehrter Herr Großadmiral nun die Pflicht der Entscheidung. Aber Sie plustern sich hier gefälligst nicht so auf. Kommen Sie zur Sache, Mann.«
»Jawohl, Herr Innenminister«, sagte Löhr kleinlaut. »Wie der Herr Reichspräsident bereits wissen, ist der Sonderzug Auerhahn im Bahnhof Sörup, zwanzig Kilometer von hier zum Halt gekommen. Auf Befehl oder mit Duldung von Kapitänleutnant Jepsen haben die Marinesoldaten ihren Dienst beendet. Der Zug wurde von Zivilisten geplündert, Reichseigentum entwendet, wichtige Apparate für Fernmeldetechnik und Nachrichtendienst sind verschwunden. Ebenso große Anteile des privaten Eigentums des Herrn Reichspräsidenten.«
Dönitz nickte. Unangenehme Sache. Er selbst war vor einigen Tagen aus Berlin nach Plön abgefahren und vorgestern hier angekommen. In diesem Sonderzug der Reichsbahn waren wichtige Dokumente, Geheimdienstunterlagen, Dechiffriermaschinen und viele persönliche Gegenstände, die er und sein Stab benötigten. Kaleun Jepsen hatte den Befehl über den Zug gehabt. Und gestern war das Ding ausgeraubt worden und nur mit Lokführer, Heizer und einer Fernmeldesekretärin am Bahnhof angekommen. Ein Affront. Unentschuldbar. Einerseits waren Missverständnisse in diesen unruhigen Zeiten nie auszuschließen. Vielleicht hatte dieser Jepsen wirklich geglaubt, der Krieg wäre vorbei. Andererseits mussten Auflösungserscheinungen unbedingt vermieden werden.
»Und? Wie lautet das Urteil?«, fragte Stuckart.
»Desertion eines befehlshabenden Offiziers, Anstiftung zur Fahnenflucht, Plünderung und Diebstahl von Reichseigentum, Behinderung kriegswichtiger Operationen. In allen Punkten schuldig. Tod durch Erschießen.« Löhr schob Dönitz ein Dokument zu. »Mein Vorgesetzter, Admiralstabsrichter Dr. Rudolphi, war als neutraler Beobachter beim Prozess zugegen. Er bestätigte mir gegenüber den einwandfreien Ablauf der Verhandlung. Ein Umstand, den ich Ihnen, Herr Reichspräsident, unbedingt zur Kenntnis bringen sollte.« Er fuhr mit dem Finger über das Papier. »Wenn Sie bitte hier unterzeichnen. Dann werde ich das sofort weiterleiten. Vollstreckung des Urteils heute Abend oder morgen früh.«
Dönitz überlegte nur kurz. Er konnte die Vollstreckung zwar aussetzen, sogar das Urteil in Haft umwandeln. Jedoch war Jepsen Marineangehöriger. Wie mochte es auf Keitel oder die Zivilisten wirken, wenn er Milde gegen eigene Truppenangehörige walten ließ? Es musste seine Autorität untergraben. »Ich kann keinen zwei Moralen dienen«, sagte er schließlich und seufzte leise. »Ich kann den Volksgenossen nicht Härte oder Opfer abverlangen, selbst aber gütig und weich handeln. Wir dürfen gerade jetzt keine Schwäche zeigen. Die militärische Ordnung sichert das Überleben der Volksgemeinschaft«, ergänzte er und griff den Füllfederhalter, den ihm ein Ordonnanzoffizier von der Seite reichte. Keitel nickte. Stuckart und von Krosigk blickten aufs Wasser, als der Admiral seine Unterschrift als Bestätigung des Urteils unter das Schreiben setzte. Standhaft und unbarmherzig. Gegen sich und andere. Um eines höheren Zieles willen. Das war schon das Prinzip seines verehrten Führers gewesen. Durch Männer wie ihn, Großadmiral und Reichspräsident Karl Dönitz, würde er weiterleben. Und nach ihm kämen andere. Nein, der Führer war nicht tot, er war ewig geworden.
Friedrich »Fiete« Möller stand vor dem Blaumann in dem kleinen Ort Harrislee nahe der Grenze zu Dänemark. In der Kneipe ging es hoch her. Laute Stimmen drangen aus dem Schankraum. Kein leises Flüstern. Keine verstohlenen Blicke. Fast wie in alten Zeiten. Die linken Genossen hatten wieder zusammengefunden.
Genossen, dachte Fiete. Nicht Volksgenossen. Zwölf Jahre haben wir uns verkrochen, als stünde der böse Wolf vor der Tür. In die Hose haben wir uns gepisst. Die Sache verraten. Und nicht nur die Sache, auch unsere eigenen Leute. Wie konnte es so weit kommen?
Ein anderer Mann riss Fiete Möller aus seinen Gedanken. Er trug eine Schiebermütze aus Leder, die ihm ebenso schief auf dem Kopf saß wie die Nase im Gesicht. Den Zinken hatten ihm die SA-Schläger vor fast zwanzig Jahren verbogen. Die Saalschlachten Ende der Zwanziger. Rot gegen braun. Parolen und Fäuste. Knüppel und Blut. Nein, sie waren nicht zimperlich gewesen, auf beiden Seiten.
»Fiet, wir brauchen dich drinnen. Die Komintern-Genossen machen schon wieder Stunk. Und unsere sind auch nicht viel besser. Als hätten sie nichts gelernt«, sagte Ralf Hucke, den alle nur »Gorilla« nannten. Er besaß Oberarme, die bei anderen als Schenkel durchgingen. Er hatte damals einem Braunen einfach die Hand zerquetscht, als der ihn schlagen wollte. Später war er dafür fünf Jahre in den Bau gegangen.
»Ist gut, Gorilla. Ich komme.« Fiete warf den Rest der Zigarette in den Rinnstein. Zigarette? Eher der letzte Schnitt vom Bahndamm. Oder Ziegenhaare. Nur kein Tabak. Die Dreckskerle haben alles kaputt gemacht, was Spaß bringt, dachte er. Die Jungs vom Fußballverein verrecken an der Front. Das Bier ist dünn. Sperrstunde, beschissene Lieder im Radio, und selbst die Huren haben Angst. Die Kumpel vom Skat waren tot oder wurden vermisst. Moser, Petersen, Hinrichs, Hansen. Es war Zeit, dass sich etwas änderte. Fiete Möller betrat den großen Raum, in dem sich beinahe fünfzig Leute versammelt hatten, die früher zur SPD oder KPD gehört hatten.
»Wir müssen ein Komitee gründen!«, rief einer.
»Moskau unterstützt uns. Zwanzig Mark für jeden, der zur neuen Rotfront kommt!«, schrie ihn ein anderer nieder.
»Räterepublik! Diesmal richtig. Alle Adligen aufhängen und die Nazi-Bonzen ertränken.«
»Wir brauchen Wahlen. Und einen SPD-Kanzler. Dann Friedensverhandlungen.«
»Ein Parlament? Hast du sie noch alle? Die Schwächlinge haben uns das doch eingebrockt!«
So ging es noch eine Weile weiter, bis Fiete seinem Freund ein Zeichen gab. Gorilla schlug mit seiner Pranke auf einen Tisch und brüllte: »Ruhe im Puff!«