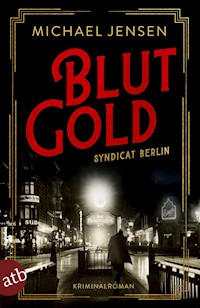9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Aufbau digital
- Kategorie: Krimi
- Serie: Inspektor Jens Druwe
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2021
Der Preis der Freiheit. Jens Druwe, der glaubte, als Polizeiinspektor nach 1945 ein neues Leben beginnen zu können, wird als Kriegsverbrecher inhaftiert und verurteilt. Man wirft ihm vor, bei Säuberungsaktionen im Osten dabei gewesen zu sein. Auch seine Freundin Eva, die von ihm schwanger ist, kann ihn nicht retten. Doch da eröffnet sich eine neue Chance. Im Auftrag des britischen Geheimdiensts soll Druwe verdeckt im Zuchthaus arbeiten, um untergetauchte Nazis aufzuspüren. Es geht vor allem darum, einen Mann zu finden, der für Tausende von Tötungen im Osten verantwortlich ist. Druwe nimmt diese Aufgabe an – und er weiß genau, dass er nicht scheitern darf, will er seinen Frieden und seine Freiheit wiedererlangen. Spannend und gründlich recherchiert – ein einzigartiger Roman über die Zeit unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Vom Autor des Bestsellers „Totenland“.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 609
Ähnliche
Über das Buch
Der Preis der Freiheit.
Jens Druwe, der glaubte, als Polizeiinspektor nach 1945 ein neues Leben beginnen zu können, wird als Kriegsverbrecher inhaftiert und verurteilt. Man wirft ihm vor, bei Säuberungsaktionen im Osten dabei gewesen zu sein. Auch seine Freundin Eva, die von ihm schwanger ist, kann ihn nicht retten. Doch da eröffnet sich eine neue Chance. Im Auftrag des britischen Geheimdiensts soll Druwe verdeckt im Zuchthaus arbeiten, um untergetauchte Nazis aufzuspüren. Es geht vor allem darum, einen Mann zu finden, der für Tausende von Tötungen im Osten verantwortlich ist. Druwe nimmt diese Aufgabe an – und er weiß genau, dass er nicht scheitern darf, will er seinen Frieden und seine Freiheit wiedererlangen.
Spannend und gründlich recherchiert – ein einzigartiger Roman über die Zeit unmittelbar nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. Vom Autor des Bestsellers »Totenland«.
Über Michael Jensen
Michael Jensen wurde 1966 im Norden Schleswig-Holsteins geboren. Er lebt mit seiner Familie in Hamburg und Flensburg. Im Hauptberuf ist er als Arzt und Therapeut tätig. Seine beruflichen Erfahrungen hat er in zwei Sachbüchern zusammengetragen. Dabei interessieren ihn besonders die seelischen Spätfolgen des Zweiten Weltkriegs, vor allem bei den Nachkommen von Opfern und Tätern. Für sein literarisches Schreiben hat er ein Pseudonym gewählt.
Im Aufbau Taschenbuch sind seine Kriminalromane »Totenland« und »Totenwelt« lieferbar.
ABONNIEREN SIE DEN NEWSLETTERDER AUFBAU VERLAGE
Einmal im Monat informieren wir Sie über
die besten Neuerscheinungen aus unserem vielfältigen ProgrammLesungen und Veranstaltungen rund um unsere BücherNeuigkeiten über unsere AutorenVideos, Lese- und Hörprobenattraktive Gewinnspiele, Aktionen und vieles mehrFolgen Sie uns auf Facebook, um stets aktuelle Informationen über uns und unsere Autoren zu erhalten:
https://www.facebook.com/aufbau.verlag
Registrieren Sie sich jetzt unter:
http://www.aufbau-verlag.de/newsletter
Unter allen Neu-Anmeldungen verlosen wir
jeden Monat ein Novitäten-Buchpaket!
Michael Jensen
Totenreich
Kriminalroman
Inhaltsübersicht
Informationen zum Buch
Newsletter
Prolog
Teil I
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Teil II
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Teil III
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Teil IV
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
Kapitel 26
Kapitel 27
Epilog München, 23. Mai 1949
Nachwort
Fußnoten
Impressum
Prolog
Bad Mondorf, Juli 1945
»Hervorragend, mein lieber Doktor. Ich habe geriebenen Trüffeln auf zerlaufenem Parmesan schon immer den Vorzug gegeben.« Göring tauchte gierig das letzte Stück Brot in den Käserest. Es war leider nur eine winzige Portion gewesen. Verdammte Diät.
»Sehen Sie es als kleinen Dank«, antwortete der Arzt, auf dessen Hemd sich Schweißflecken abzeichneten.
Die Stimmung des schwülen Hochsommerabends hatte sich auf das Gemüt von Mensch und Tier gelegt. Ein alter Dackel lief unruhig umher auf der Suche nach Wasser. Die Katze des Concierge lag träge auf dem Fenstersims. Der kleine Gartentisch im Hofgarten war mit einer gelben Schicht von Blütenpollen bedeckt. Zwei Männer saßen hier. Sie tranken jetzt Tee und Zitronenwasser mit Eis. In Erwartung des erlösenden Gewitters hatten die beiden schwitzenden Gäste eine Weile geschwiegen. Der Platz schien eher für ein verliebtes Paar geeignet, weniger für eine Vernehmung. Im Schatten hinter dem Palasthotel, an einer Schleife des Flüsschens Gander gelegen, war der schwere Rosenduft fast greifbar. Immerhin brachte das träge fließende Wasser etwas Kühlung zu den Männern herüber. Im Westen waren die Hanglagen des Moseltals im Dunst des frühen Abends zu erahnen. Jedoch, es fand sich keine Wolke am Himmel.
Wäre ein Beobachter in diesem Moment nichtsahnend aus einem sechsjährigen Schlaf erwacht, hätte ihn in der ländlichen Region Luxemburgs nichts an einen verheerenden Krieg denken lassen. An einen Krieg, der halb Europa verwüstet und achtzig Millionen Menschen getötet oder verwundet hatte. Die Männer, die in diesem Haus logierten, waren Gefangene. Sie waren die Überbleibsel eines mörderischen Regimes, von den Alliierten versammelt, um sie auf ihre Prozesse vorzubereiten. Trotz der idyllischen Lage und der komfortablen Unterbringung waren die Gäste also zwangsläufig unzufrieden. Schließlich sahen sie sich als Staatsmänner. Immerhin hatten sie zur Elite jenes Dritten Reichs gehört, dessen Volksangehörige sich für auserwählt und überlegen gehalten hatten. Die mehr als fünfzig hochrangigen Nazis wurden nun von einfachen, amerikanischen Soldaten bewacht, die fluchten, Kaugummi kauten und oft verdächtig jenen Menschen ähnelten, die vor etwa drei Jahren in den östlichen Lagern verschwunden waren.
Der bekannteste unter ihnen war lange Zeit sogar zweiter Mann im Staat gewesen. Dem Volk war er in Erinnerung durch seine markigen Sprüche und seine Großmannssucht. Letztere hatte im Lauf der Jahre auch Ausdruck in entsprechender Leibesfülle gefunden. Nun allerdings musste er sich auf Anordnung der Militärführung an Abmagerungskost halten.
»Können Sie nicht dafür sorgen, dass ich mir endlich eine neue Uniform anfertigen lassen kann?«, fragte Hermann Göring. Er trug schwarze Reitstiefel nach Gutsherrenart und eine weiß-graue Fantasieuniform mit Tressen, Kordel und diversen Orden und Abzeichen. Die Epauletten waren – wenn man den Gerüchten Glauben schenkte – aus purem Gold. Man hatte ihm alles belassen, lediglich den Blutorden hatte ihm ein Sergeant unsanft von der rechten Brusttasche gerissen. Göring hatte umgehend ein Protestschreiben an den US-Oberbefehlshaber verfasst: Mein lieber Eisenhower, ein edles Erinnerungsstück wurde mir unrechtmäßig genommen … Eine Antwort hatte er nicht erhalten.
Jacke, Schärpe und Hose waren ihm – nachdem er in den letzten Wochen dreißig Kilo eingebüßt hatte – viel zu groß und schmälerten etwas die würdevolle Eleganz, mit der er aufzutreten wünschte.
»Herr Marschall, ich bin Ihr Arzt, nicht Ihr Zeugwart«, erwiderte Dr. Douglas Kelley kühl.
»Ja, aber Sie sind doch verantwortlich dafür, dass ich seit Wochen nur Suppe und Gemüse esse«, lamentierte sein Gegenüber. »Ich habe fast sechzig Pfund verloren. Und da muss man einem Mann in meiner Stellung zugestehen, sich anständig und passend zu kleiden. Ich zahle auch dafür.« Er schwieg einen Moment. »Im Übrigen habe ich den Rang eines Reichsmarschalls inne, Herr Doktor«, ergänzte er dann, fast ein wenig beleidigt.
Göring hatte sich manche Annehmlichkeit gesichert, seit er in dem mondänen, ehemaligen Palasthotel im Kurort Mondorf angekommen war. Er sah sich als Gast, nicht als Gefangener. Er war es gewohnt, sich die Welt so zu schaffen, wie er sie haben wollte. Anfangs hatte er versucht, sich aus seinen sechzehn Schrankkoffern ein luxuriöses Leben einzurichten. Immerhin hatten die Amerikaner ihm zugestanden, seinen Kammerdiener Robert und fast hunderttausend Reichsmark mitzubringen. Aus dem Barvermögen finanzierte er sich munter den Bezug von Rauchwaren, Zeitschriften und Spirituosen. Diese gönnerhafte Art eines Lebemanns beeindruckte denn auch manchen einfachen GI.
Es würde ihm nicht schwerfallen, sich auch zusätzliche Verpflegung zu verschaffen, dachte der Psychiater. Aber Göring hatte stolz erklärt, dass er in der kommenden Zeit Deutschland vertreten müsste. Und eine hundertdreißig Kilo schwere Kugel wäre in einem Land der Not nicht glaubwürdig, hatte er befunden. Die Amerikaner nannten die ausgemergelten Menschen in Europa – speziell auch die aus den Lagern Befreiten – nur Bone People, Knochenmenschen. Oft waren die Holzschuhe an ihren Füßen schwerer als ihr Körper. Derart schlimm stand es jedoch um den Reichsmarschall keineswegs.
Kelley war von seinem Schützling ebenso fasziniert wie abgestoßen. Der Mann war ein Prahler und Fantast. Er kannte kein Maß und war glaubhaft überzeugt, in der Politik weiterhin eine große Rolle spielen zu können. Und dennoch – oder gerade deshalb – hatte er es in der Hitler-Diktatur weit gebracht. Göring litt zudem an einer – unter zu Macht gekommenen Adligen und Geistlichen im Mittelalter oft verbreiteten – Fresssucht. Es schien, als ob solche Männer im wahrsten Wortsinn alles in sich hineinstopfen mussten. Nach dem Psychoanalytiker Sigmund Freud, den Dr. Kelley bewunderte, waren solche »Mund-Menschen« von einem tiefen, inneren Wunsch nach Vereinnahmung und Versorgt-Sein bestimmt. Zudem hatte Göring mithilfe von »Morphium-Kuren« immer wieder versucht, seine Nerven zu beruhigen. Letztlich aber war er nur ein Mann, der der Welt entfliehen wollte, wenn sie nicht zu seinem Wunschdenken passte. Und in den letzten drei Jahren war das immer öfter der Fall gewesen. Andererseits war Göring auch ein charmanter Plauderer. Er wirkte im ersten Moment sympathisch und schien jeden Zuhörer um den Finger zu wickeln. Er suchte nonchalant Erklärungen für ein Chaos, das er schon einmal – nach dem Ende des ersten großen Kriegs – erlebt hatte. Er war witzig und schlagfertig und konnte auf fast hypnotische Weise über Pläne und Visionen sprechen. Dabei zog er nicht nur seine Landsleute, sondern auch den Amerikaner Kelley in seinen Bann.
»Ist das Zittern nun besser, Herr Reichsmarschall?« Kelley achtete auf die korrekte Rangbezeichnung, denn Göring weigerte sich, mit ihm oder anderen Amerikanern zu sprechen, wenn sein Titel nicht genannt wurde.
»Ja, Herr Doktor. Die Vitaminspritzen haben nun doch geholfen.« Zur Bestätigung hielt Hermann Göring die Hände nach vorn. Durch seinen Entzug vom Morphium hatte er über viele Wochen heftige Körpersymptome gezeigt.
Kelley war zufrieden. Sein offizieller Auftrag, Göring und die anderen Gefangenen in eine gute, gesundheitliche Verfassung zu bringen, war fast erfüllt. Ihnen konnte in Nürnberg der Prozess gemacht werden. Der Arzt hatte hier keinen wirklich schweren Fall mehr zu betreuen. Er dachte an die ärztlichen Kollegen, die in England mit dem schwer gestörten Rudolf Heß beschäftigt waren. Er hatte sie mehrfach telefonisch beraten. Der Stellvertreter des Führers war offenbar geisteskrank. Oder aber er simulierte, um einem Prozess zu entgehen. Jedenfalls wäre mit dem Kerl wissenschaftlich kein Blumentopf zu gewinnen, und Kelley war froh, dass er nach Mondorf beordert worden war.
Er hatte hier mit lösbaren Problemen zu tun gehabt. Der frühere Generalgouverneur Hans Frank, der »Schlächter von Polen«, hatte zwar einige Selbstmordversuche hinter sich. Dass er sich auf diese Weise dem Gerichtsverfahren entzog, war durch Kelley und sein Ärzteteam jedoch verhindert worden. Der Leiter der Arbeitsfront, Robert Ley, war massiv alkoholkrank. Um einem Delir und Krampfanfällen vorzubeugen, hatte Kelley ihm drei Mal am Tag eine kleine Menge Whiskey verordnet. Und Gauleiter Streicher litt offenbar unter einer aggressiven Psychose. Er schrie oft grundlos, schlug um sich und sah überall Juden und deren Verschwörungen. Vielleicht war es fortgeschrittene Syphilis, die sein Gehirn zerfressen hatte. Phenobarbital in kleiner Dosierung hatte den Mann endlich ruhiggestellt.
Douglas Kelley hatte alles im Griff, seine Hauptarbeit war getan, der Abschlussbericht an Eisenhowers Stab fast fertig. Jetzt konnte er sich einen weiteren Monat der Befragung Görings und anderer NS-Granden widmen. Erst dann würden sie das ehemalige Hotel in Luxemburg verlassen und verlegt werden. Er wollte an den Männern eine wissenschaftliche Untersuchung durchführen. Was machte einen Menschen zum Nazi? War das eine Charakterfrage? Oder war es einfach nur eine typisch deutsche Eigenschaft? Konnte jeder zum Nazi erzogen werden, wenn es das Umfeld zuließ und förderte? Oder musste man zum Nazi geboren sein? Kelley hatte aufmerksam die Arbeiten zur Vererbung und Genetik verfolgt. Gab es vielleicht ein Nazi-Gen? Mit den Antworten auf diese Fragen und einem entsprechenden Aufsatz würde Dr. Douglas Kelley Aufsehen in der Fachwelt erregen, da war er sicher. Vieles hatte er bereits aus den Krankenakten erfahren, aber hier vor Ort hatte er die Figuren aus dem Zentrum des Bösen. Eine einmalige Gelegenheit, die sich nicht noch einmal bieten würde. Er wollte einen Zugang zu Leuten wie Göring finden, sie verstehen. Die Zeit drängte jedoch. Colonel Andrus, der Befehlshaber des hiesigen Gefangenencamps, hatte ihm mitgeteilt, dass die Gefangenen schon Ende August nach Nürnberg verlegt werden würden, wo sie der Prozess erwartete. Und im Vertrauen hatte er erwähnt, dass die meisten Gefangenen wahrscheinlich mit der Todesstrafe rechnen mussten. Somit gäbe es für Kelley dann vielleicht keine Möglichkeit, nach der Verhandlung noch weitere Befragungen durchzuführen.
»Herr Reichsmarschall, ich möchte gern das Thema von gestern zu Ende bringen«, sagte der Psychiater.
Göring nickte. »Ich denke zwar, dass sich das Problem erledigt hat, aber bitte. Nur zu, Doktor.«
»Was haben die Deutschen gegen die Juden?«
»Da müssen Sie wohl siebzig Millionen Interviews führen.« Hermann Göring lachte und nahm sich Tee. »Aber Scherz beiseite«, fuhr er fort. »Ich persönlich denke, dass die Vorsehung die Juden einfach zur falschen Zeit an den falschen Ort gestellt hat. Das ist eben das Schicksal dieses Volkes.«
»Wie meinen Sie das?«
»Nun ja, es ging immer nur um die Bedrohung aus dem Osten. Der Führer musste dem deutschen Volk einen Grund geben für seinen Plan, den slawischen Menschen in seine Schranken zu weisen und den Bolschewismus zu vernichten. Er persönlich und ein paar andere Parteigenossen hatten eben diese obsessive Vorliebe für das Antisemitische.« Göring hielt kurz inne. »Schauen Sie nicht so überrascht, Doktor Kelley! Als ob nicht überall, auch in Ihrem Land diese Geisteshaltung verbreitet war. Und ist. Denken Sie nur an Ihren braven Roosevelt, der uns den Dampfer St. Louis mit fast tausend Juden zurückgeschickt hat, obwohl er schon vor Kuba war. Sie wollten diese Leute auch nicht haben. Oder nehmen Sie den guten Henry Ford, der uns mit seinen antisemitischen Schriften einen großen Gefallen getan hat. Und dann brauchen Sie nur zu überlegen, wo in den letzten fünfhundert Jahren die meisten Pogrome gegen Juden stattgefunden haben. Da müssen Sie wohl in sämtlichen Fällen nach Osten schauen. Also bitte, Doktor, seien Sie nicht scheinheilig.«
Kelley fiel es schwer, gegen diese ideologische Strategie Görings zu argumentieren. Ablenken von der eigenen Schuld und Verantwortung, indem man verallgemeinerte und andere mit ins Boot holte. Als Psychiater sollte er sich laut Lehrmeinung von Diskussionen mit Patienten fernhalten, sich nicht emotional hineinziehen lassen. Als Mensch fiel ihm dies angesichts der Ungeheuerlichkeiten schwer, die immer noch täglich über die Nazi-Herrschaft ans Licht kamen.
»Und was meinen Sie konkret damit, die Juden wären zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen?«, fragte er.
»Der Mensch braucht immer ein Motiv für sein Handeln«, erwiderte Göring. »Warum sollten der Schlosser Karl aus München und der Schauermann Hannes aus Bremen in einen Krieg ziehen? Sie tun das nur, wenn sie sich, ihre Lieben und ihre Heimat durch einen schrecklichen Feind bedroht sehen.«
»Und dieser Feind waren die Juden?«
Göring nickte. »Hitler brauchte einen Gegner, der zahlenmäßig groß genug war, um beängstigend zu wirken. Der sich auf der ganzen Welt unerkannt zu verstecken schien. Und dem man im Osten einen Todesstoß versetzen konnte. Angeblich …«
»Und Sie? Glaubten Sie auch an dieses Schauermärchen, Herr Reichsmarschall?«
»Der Führer und Leute wie Streicher, Frank oder Rosenberg haben daran geglaubt.« Der Reichsmarschall zuckte mit den Schultern. »Andere wie ich haben diesen Glauben benutzt. Er war wie ein Wirtschaftsgut. Enorm gewinnbringend. Roher, gewalttätiger, sinnloser Antisemitismus ist mir zuwider. Nutzbringend ist er aber sinnstiftend. Und einend. Denken Sie wirklich, Dr. Kelley, wir hätten die deutsche Volksgemeinschaft zu dieser übermenschlichen Leistung und Opferbereitschaft anstacheln können ohne ein solches Feindbild? Der Ewige Jude hat uns all die Jahre gut gedient.« Göring lehnte sich zurück, nahm ein kleines silbernes Etui aus seiner Jackentasche und bot Kelley eine Zigarette an.
Der Arzt lehnte mit einem Kopfschütteln ab. Er wäre in diesem Augenblick gern an einem anderen Ort gewesen. In San Francisco oder Chicago. Sein Schädel schien regelrecht zu platzen. Abartig und von unmenschlicher Logik waren die salopp vorgetragenen Antworten dieses Mannes, der zur Führungsriege des besiegten Deutschlands gehört hatte. Der Ewige Jude. Der nutzbringende Antisemitismus. Man hatte dem deutschen Esel das Feindbild des jüdischen Menschen wie eine Möhre vor die Nase gehalten, damit er brav in alle Kriege und Massaker zog. Kelley spürte die Wut, die in ihm aufstieg. Aber Profi, der er war, analysierte er die Empfindung kurz. Es ging um Gewalt. Also ging es um Macht. Oben und unten. Herren und Diener. Uralte Muster. War also jeder Mensch für so etwas empfänglich? Konnte vielleicht auch er selbst zum Nazi und Mörder werden?
»Ich persönlich habe ja wirklich nichts gegen Juden«, schoss Göring seinen nächsten Pfeil ab.
»Sie waren der zweite Mann im Staat, Herr Reichsmarschall!« Kelley versuchte, seine Empörung zu zügeln, aber es gelang ihm nicht ganz. Göring wäre ein hervorragender Agent provocateur gewesen. »Die Deportation dieser Menschen, die Lager. Da sind Sie doch verantwortlich in Ihrer Position.«
»Wissen Sie, ich hatte mehr als dreißig Ämter inne. Da kann man nicht den Überblick haben über jeden Untergebenen, der sich an Aktionen beteiligt, die ich bei Kenntnis nicht gutgeheißen hätte.«
»Aber als Vorgesetzter sind Sie für solche Aktionen zumindest mitverantwortlich«, sagte Kelley.
»Zu dieser Verantwortung stehe ich. Meine Position im Reich war zentral und wichtig. Obwohl ich betonen möchte, dass ich nur Staatsämter, nie Parteiämter bekleidet habe.« Göring schob seinen Stuhl etwas mehr in den Schatten. »Mit der Parteiplanung dieser Juden- und Zigeunersache hatte ich also nie zu tun.«
»Aber an der Gestaltung der Verordnungen und Gesetze zur Gleichschaltung und Verfolgung oppositioneller Politiker waren Sie unmittelbar beteiligt«, sagte der Psychiater. »Und an deren Umsetzung als Ministerpräsident von Preußen und Leiter der Polizei doch …«
»Die Polizei hatte mir dieser bebrillte Hühnerzüchter Himmler schon recht früh weggenommen«, widersprach Göring. »Mir war das ja ganz recht, denn da gab es zu viel Zank und Streit. Nein, nein, mein lieber Doktor, von mir hat es nie einen Befehl zu diesen Deportationen und diesen Morden gegeben. Sie werden da nicht ein Dokument finden. Ich war und bin vor allem Soldat.«
»Sie weisen demnach alle Schuld von sich?«, fragte Kelley.
»Die Schuld? Ja. Die Verantwortung bin ich hingegen bereit zu tragen«, antwortete der ehemalige Reichsmarschall und strich sich manieriert über das pomadisierte Haar, als säße er vor einer Kamera der Deutschen Wochenschau. »Ich kann das deutsche Volk in dieser entscheidenden Stunde nicht alleinlassen. Anders als Hitler werde ich die Gemeinschaft nicht im Stich lassen. Nach seinem Willen bin ich der neue Führer nach seinem Ableben. Alle anderen Behauptungen sind Intrigen. Von Bormann und Himmler böswillig in die Welt gesetzt! Ich bin gewillt, diese Last zu tragen. Ein Führer stellt sich nach einem verlorenen Krieg zwischen sein Volk und die Sieger. Als neues Staatsoberhaupt werde ich bald den Friedensvertrag aushandeln. Wir werden die Schuldigen an den Ausschreitungen finden und aburteilen. Dann bauen wir unser Vaterland wieder auf.«
Der Mann zog an seiner Zigarette, legte den Kopf in den Nacken und blies eine Rauchwolke in Richtung Himmel. Kelley war sicher, dass Göring glaubte, was er sagte. Das waren keine Verteidigungsreden oder Schutzbehauptungen, das waren Überzeugungen. Der Grat war schmal. Und ihn zu gehen, war gefährlich. Auf der einen Seite die so sicher geglaubten Werte von Humanismus und Aufklärung. Auf der anderen Seite die Verführungen des Faschismus. Der Mensch war Einzelwesen. Und er war gleichzeitig eine Massenkreatur. Hinter sanftem Naturell lauerte im Rudel allzu oft die brutale Bestie.
I
Wenn der Mensch doch aufhörte sich auf die Grausamkeit der Natur zu berufen, um seine eigene zu entschuldigen! Er vergisst wie unendlich schuldlos auch noch das Fürchterlichste in der Natur geschieht.
Rainer Maria Rilke, 1875–1926
1 Flensburg, Juli 1945
Seit mehr als zwei Monaten wartete Druwe auf eine Verlegung in das Gefängnis beim Landesgericht Flensburg. Luftlinie waren das lediglich fünfhundert Meter, aber die deutsche Verwaltung arbeitete unter den neuen Machthabern noch träger als früher. Sein Anwalt konnte nicht sagen, ob es sich bei den Verzögerungen gar um eine britische Schikane handelte. So saß er im Hochsommer immer noch in dem muffigen, dunklen Kellerloch des Flensburger Polizeipräsidiums ein.
»Die Prüfung der Haftbedingungen für einen verdächtigen Kriegsverbrecher gehört wohl nicht zu den Prioritäten britischer Besatzungspolitik. Und bei den deutschen Richtern haben Sie sich ebenfalls nicht beliebt gemacht, Herr Druwe«, meinte der Jurist Strehler schulterzuckend und versprach, weiterhin Eingaben bei der Kontrollkommission vorzulegen. Für einige Tage im Mai war die norddeutsche Stadt Schauplatz des Ringens zwischen Siegern und Verlierern gewesen. Und Druwe hatte mittendrin gestanden. Sogar mitgemischt in dem dreckigen Spiel, das man Politik nannte. Er war dabei zwischen die Fronten geraten. Für einen Tag war er sogar Chef der hiesigen Polizei gewesen. Aber dieser Spuk war vorüber, die letzte Nazi-Regierung verhaftet, der Alltag wurde allerorten bestimmt von Elend und Trauer. Und nun hatte Druwe die eigene Vergangenheit eingeholt.
Das kleine Kasematten-Fenster seines Kellergefängnisses war in diesen Wochen Druwes Verbindung zur Welt. In den feuchten Putz an den Gitterstäben hatte ein ehemaliger Häftling der Gestapo einen Sinnspruch geritzt. Die Hölle wird dich dereinst ausspucken, mein Führer.
Druwe sah lediglich ein winziges Stück vom Himmel. Und auch nur, wenn er auf seinen wenigen Quadratmetern an einer bestimmten Stelle stand. Er lauschte den Geräuschen und Gesprächen aus dem Innenhof, in dem er selbst einmal täglich für eine halbe Stunde Freigang hatte. Den Verlauf der ersten Friedenswochen konnte er den Schilderungen der Wachleute entnehmen. Anfangs waren es nur Engländer, die zum Dienst eingesetzt waren. Aber er sprach deren Sprache gut, so dass er sich nicht allzu isoliert fühlte. Seit zwei Wochen taten auch wieder deutsche Polizisten hier unten Dienst. Sie trugen ihre Uniform und eine große, weiße Armbinde mit der Aufschrift Ordnungstruppe Flensburg. Die britischen Soldaten hatten sich oft angeregt mit ihm unterhalten. Und manchmal konnte er sogar eine Zigarette schnorren. Es schien dann, als ob beide Seiten froh waren, die Eintönigkeit für einen Moment zu durchbrechen. Der eine war gefangen in seiner Zelle, der andere in der Monotonie seines Wachdienstes. Die deutschen Wachleute waren hingegen weniger gesprächig. Mancher Hauptwachtmeister kannte ihn zwar noch persönlich, aber schwieg dann dennoch beharrlich. Vielleicht aus Angst, er könnte etwas Falsches sagen. Druwe konnte über die Motive dieses verlegenen Schweigens nur spekulieren. Möglicherweise sorgten sich die Leute, dass vom Aussatz des Gefangenen – er war immerhin diverser Kriegsverbrechen angeklagt – etwas auf die vermeintlich Unschuldigen überspringen würde? Eben hatte man doch erst den Krieg heil überstanden. Da konnte ein solcher Kontakt den Schmutz aufwühlen, den man so eifrig vor den Besatzern – oder vor sich selbst – zu verbergen suchte. Vielleicht war es auch einfach nur Scham, welche die Männer schweigen ließ. Erinnerte Druwe die Leute doch an Zeiten und Taten, die man nur allzu gern vergessen wollte.
»Sie werden den schlimmsten Strolchen im Herbst den Prozess machen«, sagte ein Oberwachtmeister leise. Er gehörte zu den wenigen Landsleuten, die mit dem Gefangenen ein paar Worte wechselten. Der junge Polizist bot Druwe eine Zigarette an. Der Tabak sah aus wie getrocknete Brennnessel, und er schmeckte wie Pferdemist. Aber das war egal.
»Wenn Sie mich fragen, ist das viel zu viel Aufwand«, fuhr der junge Mann fort. »Der Bande haben wir das doch zu verdanken. Was haben die uns alles versprochen! Und jetzt? Sind wir die Büttel der Amis und Tommys! Und dann diese Sachen, die im Osten passiert sind. Mit den Juden und so. Nee, Kerle wie Streicher, Frank und Keitel sollte man gleich aufhängen. Stattdessen muss unsereiner die Suppe auslöffeln, dabei haben wir nichts verbrochen.«
Strolche. Bande. Sachen im Osten. Druwe hatte solche Worte schon oft gehört in der letzten Zeit. Den meisten Menschen war nach Neuanfang zumute, nicht nach innerem Ausmisten. Er schwieg und inhalierte den schlechten Tabakrauch. Er konnte die Zigarette jetzt auch rechts halten. Seine Lederprothese hatte er sich vor zwei Jahren so arbeiten lassen, dass sie ihm als geballte Faust gute Dienste in körperlichen Auseinandersetzungen leisten konnte. Sein Fausthieb konnte tödlich sein. Es hatte zwar beim Prothesenbauer auch die Varianten Schreiben, Handschlag und Deutscher Gruß gegeben. Diese drei Handformen sahen ab Werk auch stets ein Zigarettenloch vor. Das Modell Lederfaust hatte hingegen keines. Druwe hatte jedoch herausgefunden, dass bei ihm zwischen Zeigefinger und Mittelfinger ein winziger Spalt gearbeitet war, in den zumindest eine Zigarettenspitze passte. Wenn er rauchte, konnte man meinen, er wollte sich selbst eine Rechte verpassen. Und er ähnelte mit der Spitze irgendwie den dekadent verblödeten Russen in den Dreißigern an den Tischen im Berliner Wintergarten. Aber er hatte jetzt wenigstens die linke Hand frei, wenn er seine Sargnägel inhalierte. Während er noch auf seine Prothese blickte, hatte der Wachmann weitergeredet.
»Soldaten wie Sie«, ereiferte sich der Oberwachtmeister weiter, »und alle Polizisten haben doch nur ihren Dienst gemacht. Krieg ist Krieg, da sterben Menschen. Ist doch immer so gewesen. Und jetzt muss Schluss sein.« Er zögerte und sah Druwe an. »Ich meine, Kollegen und Kameraden gehören nicht auf eine Anklagebank. Wir hatten alle unsere Befehle.«
Jens Druwe nickte geistesabwesend und begann wieder, darüber nachzudenken, wie er die Rechte beim Rauchen halten sollte. Welche Stellung der Faust er auch versuchte, es sah immer dämlich aus. Vielleicht konnte er irgendwo eine Spitze aus Elfenbein eintauschen?
Ich verblöde hier drinnen noch, dachte er.
An einem späten Vormittag Ende Juli bekam Druwe die Nachricht, dass man ihn nun doch verlegen würde. Im Polizeipräsidium am Hafen sollten die Zellen künftig nur noch zur kurzzeitigen Unterbringung von Betrunkenen und Kleinkriminellen genutzt werden. Die Zahl minderer Vergehen hatte in den letzten Wochen stark zugenommen. Man brauchte Platz.
Das Landesgericht am Südergraben, oberhalb des Kirchspiels St. Nikolai gelegen, hatte immerhin einen eigenen Gefängnistrakt und sollte Druwes neues Zuhause werden. Er war froh über die Abwechslung. Die Monotonie seiner Tage im ehemaligen Gestapo-Keller hatte ihn noch stiller werden lassen, als er es ohnehin bereits war. Und die beklemmende, hoffnungslose Atmosphäre dieser Zellen übertrug sich auf sein Gemüt. Die Staatspolizei war nie zimperlich gewesen, was die Behandlung von Verdächtigen anging. Druwe meinte, am Boden und an den Wänden braune Flecken zu erkennen. Er deutete sie als Spritzer und Schlieren von eingetrocknetem Blut. War hier jemand brutal verhört worden? Und dann auf dem Boden zusammengebrochen? Kritzeleien im Holz der Tür und im Putz sprachen von Hoffnung und Leid. Wie groß war das Heer der Verdammten, das durch diese Hölle gehen musste? In allen großen Städten hatte es Dienststellen der Staatspolizei gegeben. Allein in Berlin waren im Polizeiamt der Gestapo nach Druwes Schätzungen mehrere Tausend Häftlinge befragt, gequält und sogar ermordet worden. Während seiner Kripo-Zeit hatte er in den Kneipen der Hauptstadt unfreiwillig den Prahlereien betrunkener Gestapo-Beamten zugehört. Bei dem Gedanken, dass es sich bei diesen Kerlen offiziell um Kollegen gehandelt hatte, war Druwe regelmäßig übel geworden. Viele von ihnen schienen eindeutig Sadisten zu sein. Sie hatten Spaß daran, andere zu quälen, zu erniedrigen und zu entwürdigen. Zum Reden bringen war oft nur eine andere Beschreibung für Folter. Manchmal hatte Druwe einen Ganoven aufgegriffen, der dann richtig erleichtert gewesen war, dass ihn nicht die Staatspolizei erwischt hatte.
Schloss Rotenstein, wie die Flensburger im Straßenjargon den Backsteinbau am Osthang des Friesischen Bergs nannten, war recht klein und von einer hohen Mauer umgeben, deren Krone mit Stacheldraht gesichert war. Druwes Zelle lag im dritten Stock mit einem angenehmen Ausblick in Richtung südliche Altstadt. Er empfand die sommerliche Wärme anfangs als angenehm. Der Keller unter dem Präsidium war kühl und feucht gewesen. Er hatte meistens mit Mantel und Decke geschlafen, um nicht zu frieren. Am nicht verputzten Stein der Zellenwände wuchsen schwarz-graue Gebilde, zu denen er einen Kontakt lieber vermied. Seine neue Unterkunft hingegen war trocken und warm, Pritsche, Tisch und Stuhl machten sie fast wohnlich. Druwe ertappte sich dabei, wie er mit den Fingern vorsichtig über den frischen Wandkalk strich.
Wer nur lange genug im Dreck sitzt, wird bescheiden, dachte er. Knast oder Krieg. Irgendwann ist Weiß nur noch eine verblassende Erinnerung.
Druwe hatte bisher nur einmal täglich für eine Viertelstunde in den Innenhof gedurft. Und so blendete ihn jetzt das Sonnenlicht stark. Auf seine Bitte hin erhielt er bereits am Nachmittag der Verlegung eine altmodische Sonnenbrille. Nach einigen Tagen war dann die Kälte, die in den Knochen saß, offenbar vertrieben. Die Sommertemperaturen begannen, unangenehm zu werden. Aus der wohltuenden Wärme wurde schließlich eine unerträgliche Hitze. Der Mensch war eben nie zufrieden.
Aber auch in einer weiteren Hinsicht erwies sich neue Umgebung als unvorteilhaft. Die Nähe des Landesgerichts bot dem Leitenden Amtsrichter die Möglichkeit, sich öfter bei Druwe einzufinden und ihn persönlich zu befragen. Dr. Hans-Joachim Löhr hatte sich erst der Dönitz-Regierung angedient, dann aber schnell erkannt, dass man sich vor allem mit den Siegern gut stellen musste. Löhr saß als Richter bereits wieder fest im Sattel der neuen Rechtsprechung. Der Mann hatte geschickt die Anklage gegen Druwe eingefädelt. Eine Art Bauernopfer für die Engländer.
Druwe hatte über Gespräche und einige Zeitungsartikel erfahren, dass die alliierten Sieger eine Art angeborenes Vertrauen in die Berufsgruppen der Richter und Anwälte setzten. Und sein Anwalt berichtete ihm, dass man sich gegenseitig bescheinigte, wie milde, zurückhaltend und kritisch, kurzum wie ablehnend gegen den Nationalsozialismus man gewesen war. Sofern ein Jurist in den Befragungen beteuerte, er hätte sich von Willkür und Ideologie der Nazis weitgehend ferngehalten, war er fast umgehend wiedereingestellt worden.
Druwe hatte Löhr bei Kriegsende Anfang Mai kennengelernt, als beide in der Marineschule Mürwik kurze Zeit für die neue Reichsregierung unter Admiral Dönitz gearbeitet hatten. Er empfand eine starke Abneigung gegen den Mann. Löhr war ein Opportunist und emsig bemüht gewesen, die alte Riege um den Hitler-Nachfolger Dönitz juristisch zu beraten. Später hatte er dann die Seiten gewechselt und sich als Mitarbeiter beim Leiter der britischen Militärpolizei eingeschmeichelt.
»Machen Sie sich die Sache doch nicht unnötig schwer, Herr Druwe«, sagte Dr. Löhr, nachdem er in Begleitung eines stämmigen Vollzugsbeamten in Druwes Zelle getreten war. Es war dabei deutlich erkennbar, dass er sich seitlich hinter den Muskelprotz stellte.
Tatsächlich war Löhrs Vorsicht nicht ganz unangebracht, denn Druwe verspürte jedes Mal, wenn der Kerl auftauchte, das typische Kribbeln an seiner Narbe. Ihm war die Ehrlichkeit eines eingefleischten SA-Schlägers oder strammen Kommunisten immer noch lieber als die geheuchelte Korrektheit solcher Kerle wie Löhr. Sein alter Vorgesetzter in Berlin hatte solche Männer schon vor zwanzig Jahren Gummihälse genannt. Sie drehten den Kopf dahin, wo sie einen Vorteil für sich witterten. Und wenn sie jemandem in den Hintern krochen, dann kamen sie damit oft ganz weit nach oben …
»Mein Anwalt hat mir untersagt, mit irgendjemandem über die Anklage zu sprechen, ohne dass er zugegen ist«, leierte Jens Druwe den Satz herunter, den er seit seiner Verlegung bereits ein halbes Dutzend Mal aufgesagt hatte, wenn dieser Kerl ihn befragen wollte. Aber Löhr blieb hartnäckig.
»Überlegen Sie, Herr Druwe. Wenn Sie in der Kriegssache gestehen und ein paar Einzelheiten zu Protokoll geben, dann kann ich die Anklagen wegen Mordes an Dähler und an diesem KL-Häftling fallen lassen. In zwei Jahren wird dann eine neue, souveräne Reichsregierung sicherlich eine Generalamnestie für alte Kämpfer beschließen. Und Sie sind dann wieder draußen, Druwe.« Löhr lächelte verschlagen.
Dähler. Der Marineoffizier hatte Druwe in der Kaserne am anderen Fördeufer aufgelauert und auf ihn geschossen. In Notwehr und durch einen Zufallstreffer hatte Druwe den Mann schließlich getötet. Er war seit seiner Handamputation ein miserabler Schütze und hatte keinen Pfifferling darauf gegeben, dass er den Schusswechsel mit dem ehemaligen U-Boot-Kommandanten überleben würde. Der Kerl war völlig durchgedreht und hatte außerdem zuerst geschossen.
Und der KL-Häftling? Die Sache war eine noch größere Farce. Der Mann hieß Ludwig Steinfeld, der sich vor drei Tagen, als er mit Druwes Strafverteidiger vorbeigekommen war, bester Gesundheit erfreute. Denn Druwe hatte ihn vor knapp drei Monaten nicht erschossen, sondern freigelassen. Von angeblichen Morden an Dähler und Steinfeld konnte also keine Rede sein. Jedoch war das, was Löhr »Kriegssache« genannt hatte, erheblich komplizierter, und Druwe vermochte sich dafür nicht so einfach moralischen Dispens zu erteilen. Er hatte bei Kriegsbeginn gegen die Sowjetunion – ungewollt zwar – in einem Polizeibataillon Dienst tun müssen. Seine Einheit war als Teil der Einsatzgruppen mittelbar an einigen der grausamsten Mordaktionen des Ostfeldzugs beteiligt gewesen. Säuberungen hießen sie in der Sprache der Nazis. Und es war in Wirklichkeit ein wahlloses Töten von Russen, Zigeunern, Juden und Politkommissaren gewesen. Druwe hatte sich mit Deckung seines Vorgesetzten in Berlin beinahe immer aus diesen Verbrechen herausgehalten. Bis auf dieses eine Mal, als …
»Gerichtsschreiber!«, riss ihn Löhr aus seinen Gedanken. Ein schlaksiger Mann mit grauem Haarkranz und abgetragenem Anzug erschien in der Zelle. Er griff sofort zu Bleistift und Notizblock. »Nehmen Sie ins Protokoll auf: Gefangener lehnt es ab, sich zu den Anklagepunkten zu äußern. Angesichts der Schwere der ihm zur Last gelegten Taten empfehle ich, das Schweigen als Schuldeingeständnis zu werten.« Löhr hielt inne und blickte Druwe durch seine Brille an. »Vielleicht gebe ich Ihnen nächste Woche noch eine Chance, Angeklagter. Vielleicht auch nicht.«
Der nächste Tag verlief deutlich angenehmer für Druwe. Eva Steinfeld hatte ein Besuchsrecht dreimal in der Woche erstritten. Da sie und Druwe nicht verheiratet waren, hatten die Briten ihr Ersuchen zunächst abgelehnt. Letztlich befand er sich in Einzelhaft, hatte keinen Kontakt zu anderen Gefangenen, und sein Anwalt kam in die Zelle statt in den Besucherraum. Aber Eva ließ sich nicht einschüchtern und war schnurstracks zum Sitz der britischen Militärverwaltung am Holm marschiert. Dort hatte sie sich vor dem Gebäude bis auf die Unterwäsche entkleidet, und ihr Bruder Ludwig hatte ihr ein Schild umgelegt. Druwe hatte sich die Szene genau beschreiben lassen. Es musste sich um jene Reklametafeln handeln, mit denen im Berlin der Weimarer Zeit viele Leute Werbung für ein Kino, ein Lokal oder eine Kabarettnummer gemacht hatten. Vorn und hinten am Körper ein Schild, zusammengehalten von Bändern, so dass sie über die Schulter gelegt werden konnten. Eva hatte jedoch nicht beabsichtigt, für eine Revue Reklame zu laufen. Auf dem vorderen Schild stand: I am a pregnant mother. And Colonel Andrews won’t let me visit my husband! Das hintere Schild wies alles nochmals auf Deutsch aus: Ich bin eine schwangereMutter. Und Colonel Andrews will mich meinen Ehemann nicht besuchen lassen!
Immer noch musste Druwe schmunzeln, wenn er an Ludwigs Beschreibung dachte. Schwangere Mutter. Als hätte Eva schon eine Fußballmannschaft zu Hause. Und Colonel Andrews hatte rein gar nichts damit zu tun, dass sie ihn nur selten besuchen durfte. Dennoch sah sich der britische Offizier den vorwurfsvollen Blicken seiner Mitarbeiterinnen und dem Drängen seines Stabsoffiziers ausgesetzt. Halbnackte, schwangere Mütter, denen es nur um ein Besuchsrecht ging. So etwas war schlecht für das, was die Engländer Image nannten. Andrews hatte seufzend seine Unterschrift unter eine Sondergenehmigung gesetzt. Und ein paar Minuten später hatte plötzlich wieder heißer Tee auf seinem Schreibtisch gestanden, dem ihm seine Sekretärin zwei Tage demonstrativ verweigert hatte.
Druwe konnte sich immer noch nicht an den Gedanken gewöhnen. Eva und er. Er wurde Vater. Sie war fast fünfzehn Jahre jünger. Sie hatte noch so viele Pläne. Die Nazis hatten ihr vor über zehn Jahren verboten, weiterhin Philosophie zu studieren. Nicht einmal einen Beruf hatte sie erlernen dürfen, da ihr Bruder in den Augen des NS-Systems ein inhaftierter Volksschädling war. Und da sie sich zudem geweigert hatte, mit einem arischen Jüngling ihrer heiligen Pflicht als deutsche Mutter nachzukommen, war sie vollends in Ungnade gefallen.
Einen Jüngling hat sie ja nun, dachte Druwe und strich sich über den Bauch. Sein früheres, träges Leben auf dem Revier in Glücksburg hatte ihn fett werden lassen. Die unfreiwillige Schonkost, die er nun seit Ende Mai erhielt, kam ihm in dieser Hinsicht zwar ganz gelegen. Zudem hatte er versucht, sich an das Training aus dem Polizeisport zu erinnern. Das Angebot bei der Kripo Berlin war Pflicht gewesen, aber er hatte sich meistens vor den Turnübungen gedrückt. Jetzt allerdings vertrieb er sich die Zeit, indem er jeden Tag eine Stunde trainierte. Ärgerlich nur, dass dies seinen Speckgürtel nicht zu interessieren schien.
»Was treibst du da?«, fragte eine vertraute Stimme hinter Druwe. Der Wärter hatte die Tür bereits vor einigen Minuten aufgeschlossen, so dass er Eva nicht hatte kommen hören. Er stand vor dem Fenster und rieb sich den Bauch.
»Ich bin schwanger, nicht du.« Sie küsste ihn.
»Ich frage mich, wie das passieren konnte.« Druwe tat, als brütete er über einem akademischen Problem. Ein Tritt vor das Schienbein riss ihn jedoch aus seiner vorgetäuschten Grübelei. Vor der Verhaftung hatten Eva und er gerade mal einen Monat zusammen gehabt, allerdings einen äußerst leidenschaftlichen Monat.
Er stand vor ihr und fühlte sich an eine Szene aus seiner Kindheit erinnert. Seine Tante aus Hamburg hatte wunderbare Schokoladenpasteten gebacken. Wenn sie zu Besuch war, gab es für jedes Kind eine Leckerei. Dann stand er davor und hätte am liebsten gleich davon probiert. Leider war die Ernüchterung immer groß gewesen, wenn das süße Teil plötzlich weg war. Denn danach war Schluss. Und ebenso fühlte er sich in diesen Tagen, wenn Eva kam. Er hätte sie sofort mit Haut und Haar vernaschen wollen. Aber dann wäre die Süßigkeit fort. Was also tun? Als Junge von damals hatte er eine besondere Taktik entwickelt. Der Traum aus Schokolade wurde nur angefasst, gestreichelt und gedreht. Er sog den süßen Duft ein, der nach einer Weile auch an seinen Fingern klebte. Aber das Objekt der Verlockung wurde nicht genascht. Dadurch blieb die ganze Freude – zumindest einige Stunden – erhalten. Instinktiv wählte Jens Druwe auch jetzt diese Strategie. Was blieb ihm in dieser Zelle auch anderes übrig? Er streichelte und küsste Eva hauchzart und erschauderte selbst unter ihren Berührungen.
»Ich habe gerade an dich und die Leckereien meiner Tante gedacht. Sie konnte wunderbar backen.«
»Nimmt deine Wunderlichkeit noch weiter zu?«, fragte Eva gespielt gekränkt. »Haftzeit und Alter scheinen dich auf seltsame Gedanken zu bringen. Ich meine, welches Kompliment könnte größer sein, als eine Frau mit dem Gebäck der Tante zu vergleichen?«
Druwe murmelte etwas Unverständliches. In der Tat machte er sich Sorgen um seinen Geisteszustand. Ständig kamen ihm Überlegungen in den Kopf, die er nicht zu Ende führte. Er grübelte über Dinge, die ihm kurze Zeit später bedeutungslos erschienen. Er schlief viel, ohne dass der Schlaf erholsam war. Sein Tag war reine Routine, die er hasste. Und dennoch brachte es ihn durcheinander, wenn sie durchbrochen wurde. Evas Bruder hatte versprochen, mit Büchern Abhilfe zu schaffen. Allerdings befürchteten die Engländer, es könnte alles Nazi-Schrifttum sein. Nach kurzer Durchsicht hatte man Druwe jedoch immerhin seine Sammlung von Sherlock-Holmes-Romanen belassen. Die meisten Ausgaben besaß er in zwei Sprachen. Jetzt las er gerade Der Hund von Baskerville, um den Text nach jedem Absatz nochmals im Original zu rezitieren.
»Lupo geht wahrscheinlich nach Hamburg«, sagte Eva unvermittelt. »Die SPD organisiert sich gerade neu. Ihm ist Flensburg zu eng. Viele Leute glauben, dass die Stadt bald dänisch wird. Und außerdem kommt unsere Familie ja aus der Hansestadt. Wir haben beide unsere Kindheit und Jugend dort verbracht.« Sie schwieg einen Augenblick. »Jens, ich mache mir Sorgen um Lupo. Er hat niemanden außer mir. Er will zurück in eine Politik, die es so vielleicht gar nicht mehr gibt. Er hat ein paar Freunden aus der Zeit vor seiner Haft geschrieben. Es haben doch recht viele Genossen die Sache überstanden. Aber zwei seiner engsten Vertrauten sind tot.«
»Dein Bruder hat im Konzentrationslager zwölf Jahre seines Lebens verloren. Ich kann ihn verstehen«, erwiderte Druwe. »Er will etwas bewegen und beim Neuanfang dabei sein. Sonst müsste er sich am Ende seines Lebens fragen, wofür er dieses Opfer gebracht hat.«
Er sah Eva an, und sie schien seine Frage zu erraten.
»Ich bin da, wo du bist«, sagte sie leise.
»Eva, wir wissen nicht, wie das hier ausgeht.« Druwe wies mit der Hand im Halbkreis in den Raum. »Es könnten Jahre werden. Vielleicht bin ich ein alter Mann, wenn sie mich herauslassen.«
Eva streichelte über ihren Bauch. Auch unter der dünnen Kleidung des heißen Sommers konnte man nur mit viel Fantasie die Andeutung einer Wölbung erkennen.
»Wir müssen daran glauben, dass es gut ausgeht, Jens. Das sind wir ihr schuldig«, sagte sie.
»Ihm, Eva. Es wird ein Junge«, entgegnete Druwe.
»Blödsinn. Eine Mutter spürt das.«
»Und ein Vater weiß es.« Beide lachten und umarmten sich.
»Im Ernst, Eva«, sagte Druwe. »Du musst für den Fall planen, dass sie mich zu einer langen Haftstrafe verurteilen. Dein Leben …« Er unterbrach sich und berührte sanft ihren Bauch. »Euer Leben muss weitergehen. Wenn du studieren willst und kannst, dann tu es. Die Zeit der Zwänge und Verbote muss vorbei sein. Ich hoffe, es sind genügend junge Leute übrig, um die alten Kommissköpfe zum Teufel zu jagen. Ich habe ein wenig Geld zurückgelegt. Damit kannst du euch etwas aufbauen.« Er merkte, dass ihm die Stimme versagte. Er versuchte, hier den starken Mann zu markieren, aber er musste vor sich selbst eingestehen, dass er sich nichts sehnlicher wünschte, als bei Eva und ihrem gemeinsamen Kind sein zu können.
»Hör jetzt endlich auf, Jens!«, fuhr Eva ihn plötzlich an. »Du hast eine wirklich nervtötende Art, dich im Selbstmitleid zu suhlen. Wir werden kämpfen. Du, ich, der Anwalt, Ludwig. Und bis ein Urteil gesprochen ist, darfst du die Hoffnung nicht aufgeben. Strehler sagt, dass die Anklage wegen Mordes an dem Marinekerl lächerlich ist. Und Lupo ist lebendiger denn je. Er wird als angebliches Mordopfer vor Gericht aussagen. Das wird sogar die Briten überzeugen. Also müssen sie zwei Verfahren einstellen. Und für die dritte Sache muss Strehler mit dir eine Strategie entwerfen.« Eva Steinfeld nahm Druwes Hand. Ihr Tonfall wurde sanfter, blieb dabei jedoch eindringlich. »Ich weiß, wie du darüber denkst, Jens. Am liebsten würdest du dich gleich schuldig bekennen. Und nur aus einem Grund. Weil du dich nämlich schuldig fühlst und die Strafe förmlich herbeisehnst.«
»Ich bin schuldig, Eva«, unterbrach Druwe sie. »Es ist nicht nur ein Gefühl. Nein, ich bin es.«
»Es geht nicht mehr nur um dich und mich.« Sie sah ihn an, und ihre Hand glitt erneut über den Bauch. »Unsere Tochter braucht einen Vater. Also reiß dich gefälligst zusammen und steig in den Ring. Wenn du kneifst, hast du auf jeden Fall verloren.«
Gegen Abend kam Druwes Anwalt, um ihn über die Entwicklungen auf dem Laufenden zu halten. Dr. Kurt Strehler schien auf den ersten Blick wie ein unscheinbarer Bürokrat, dessen verkniffene und vorgealterte Gesichtszüge wenig sympathisch wirkten. Hinter einer dicken Hornbrille huschten wache Augen hin und her, als spähten sie nach Beute. Obwohl von Statur schmächtig, verfügte der Mann über eine sonore, fast donnernde Stimme. Ludwig »Lupo« Steinfeld, Evas Bruder, hatte den Anwalt im Umfeld seiner alten Genossen ausfindig gemacht. Druwe hatte schnell gemerkt, dass Strehler über einen messerscharfen Verstand verfügte. Der Jurist hatte die Gesetzestexte und Verordnungen der Nazis derart eingehend studiert, dass er die voreingenommenen Staatsanwälte und selbstherrlichen Richter häufig mit deren eigenen Waffen geschlagen hatte. Schließlich war er nach mehreren Eklats aus dem NS-Rechtswahrerbund geworfen worden und hatte die Zulassung als Anwalt verloren. Und man hatte sogar gedroht, ihn ins KL zu stecken. Am Ende hatte man ihn zum Patentamt abgeschoben, wo er nach Ansicht der NS-Justiz in der Abteilung Gartenbau keinen Schaden anrichten konnte. Fortan hatte Strehler jedoch noch verbissener die Juristerei der Nazis analysiert. Für die Zeit nach dem Spuk, wie er Druwe einmal erklärt hatte.
»Ich konnte endlich in Erfahrung bringen, wie die Engländer den Prozessablauf planen.« Strehler beobachtete seinen Mandanten. Er hatte gelernt, die weniger guten Nachrichten umsichtig zu überbringen. »Ein Militärrichter teilte mir mit, dass Ihr Prozess wahrscheinlich in Hamburg stattfinden wird, Herr Druwe.«
»Hamburg?«, fragte Druwe entgeistert. »Wieso Hamburg?« Das erste Erstaunen wich schnell der Einsicht, dass Eva dadurch ihrem Bruder folgen konnte, ohne den Kontakt zu ihm abbrechen zu müssen. Fast schon freute er sich über die Neuigkeit.
Strehler zuckte mit den Schultern. »Ich denke, die Briten wollen ihre Ressourcen nicht zu sehr aufteilen. Allein die Anfertigung der Abschriften für ein anderes Gericht nähme Tage in Anspruch. Und originale Dokumente können auf dem Botenweg verloren gehen. Es ist durchaus sinnvoll, nur wenige Verhandlungsorte zu haben. Schon jetzt spricht ja die ganze Welt von Nürnberg, obwohl der Prozess gegen Göring und die anderen Verbrecher erst im Oktober beginnen soll. Die Amerikaner machen es vor. Publicity nennen sie das. Vierundzwanzig braune Schmeißfliegen auf einen Streich. Ich hörte, dass die Engländer ebenfalls etwas auf die Beine stellen wollen.«
»Und was bedeutet das für mich?«
»Kann ich noch nicht sagen«, erwiderte der Anwalt. »Große Prozesse mit vielen prominenten Angeklagten bergen natürlich die Gefahr, dass Sie schlechter dastehen, Herr Druwe. Die Amerikaner und Briten wollen sicherlich ein Exempel statuieren und der Welt zeigen, dass die Kerle nicht einfach davonkommen werden. Ich persönlich denke, dass die Urteile gegen die Hauptverantwortlichen hart ausfallen werden.«
»Und dabei scheren sie alle über einen Kamm«, sagte Druwe. Mitgefangen. Mitgehangen. »Wenn ich in Hamburg mit ein paar Großen auf der Anklagebank sitze, wird der Strick vorsichtshalber auch gleich für mich geknüpft.« Obwohl er sich bereits öfter seine Strafe ausgemalt hatte, war ein konkretes Gespräch über das Thema doch stark belastend. Er spürte einen Druck in der Brustgegend und eine leichte Übelkeit.
Strehler nickte verlegen. »Könnte aber auch sein, dass die Richter beweisen wollen, wie gerecht sie sind. Dann fallen die Urteile für die weniger bedeutsamen Täter vielleicht milder aus.«
»Und für Hamburg ist so etwas wie in Nürnberg geplant? Ein großer Prozess? Eine Art Volksgerichtshof, nur dass diesmal die Nazis nicht Richter, sondern Angeklagte sind?«
»Bitte, nicht so laut, Herr Druwe. Ich kann Ihre Erregung verstehen. Aber eine solche unbedachte Äußerung könnte sehr schnell missverstanden werden.« Strehler blickte ihn kühl an und sprach leise weiter. »Tatsächlich gibt es in der Presse erste Stimmen, die von alliierten Schauprozessen im Stile von Freisler oder Stalin sprechen.«
Undurchschaubar, der Mann, dachte Druwe. »Aber die großen Tiere landen doch in Nürnberg. Was wird denn in Hamburg überhaupt verhandelt?«
»Die Briten werden die Muskeln spielen lassen«, antwortete Strehler. »Jetzt wollen sie zeigen, dass sie es auch können. Ich denke, sie werden die Akteure aus den Lagern Bergen-Belsen und Neuengamme aburteilen. Es soll gegen einige Ärzte und Lagerkommandanten Prozesse geben. Die Tommys müssen eben nehmen, was der große Bruder übrig lässt.«
»Wie sieht es mit einer möglichen Auslieferung aus?« Druwe versuchte, sich seine Besorgnis nicht anmerken zu lassen. Polen und Russland verlangten, dass Angeklagte an sie ausgeliefert wurden, sofern die Tat auf ihrem Gebiet verübt worden war. Und Witebsk lag sehr weit im Osten …
»Keine Sorge, Herr Druwe«, sagte Strehler. »Da hat Ihnen der übereifrige Richter Löhr einen Dienst erwiesen, ohne es zu wissen. Solange Sie nämlich verdächtig sind, einen deutschen Marineangehörigen getötet zu haben, kann niemand Sie ausliefern.«
Absurdes Theater in absurder Zeit, dachte Druwe. Ich muss dankbar sein, dass dieser alte Nazi-Richter mich eines Verbrechens anklagt, dass ich nicht begangen habe.
»Wir werden unsere Gegenbeweise also erst in der Verhandlung präsentieren«, fuhr der Anwalt fort. »Sonst kommt irgendein Schlauberger auf die Idee, Sie doch noch zu Stalin zu schicken.«
»Ich habe beschlossen, mich hinsichtlich Punkt drei schuldig zu bekennen«, sagte Druwe.
Strehler sah ihn an und schob die Brille zurecht. »Sind Sie lebensmüde? Wollen Sie unbedingt an den Strang? Oder zwanzig Jahre ins Zuchthaus?« Er unterbrach sich. »Ich dachte, Ihre Frau ist schwanger? Das muss Ihnen doch wichtig sein!«
»Ja, aber …«
»Ich kenne Ihre Ansicht in der Sache«, unterbrach ihn Strehler. »Und es ehrt Sie, dass Sie Ihre Verantwortung annehmen wollen. Aber hier kommt es auf Nuancen an. Ein schnelles Schuldbekenntnis wirkt wie eine falsch verteilte Ladung auf einem Lastkahn. Legen Sie alle Waren auf eine Seite, dann wird er kentern. Verteilen Sie die Sachen, bleibt er schwimmfähig. Also, Herr Druwe, wenn Sie am Anfang des Prozesses alle Schuld bekennen, dann wird Ihr Boot mit Sicherheit sinken.«
»Können Sie bitte konkreter werden? Was werden Sie tun?«, fragte Druwe barsch.
»Nur Geduld«, antwortete der andere Mann. »Wir haben viel Zeit. Wenn ich den zuständigen britischen Richter richtig verstanden habe, dann werden die Hamburger Prozesse im Laufe des nächsten Jahres stattfinden.«
Wütend drehte sich Druwe um und trat vor das vergitterte Fenster. Wieder musste er warten. Dabei hasste er es, nicht zu wissen, woran er war. Aber er konnte in seiner Situation nichts erzwingen, nichts beschleunigen. Ihm war klar, dass eine Zeit langer Qual vor ihm lag. Als Häftling hatte er die Kontrolle über sein Tun abgeben müssen. Alles war hier drin vorherbestimmt. Wecken, Essen, Schlafen, der Freigang; sogar die Zeiten zur Verrichtung der Notdurft wurden vorgegeben.
»Eva. Das Kind.« Er sprach dabei mehr zu sich selbst, denn Strehler war sein Anwalt, kein Vertrauter oder Freund.
»Vielleicht ist es gut, wenn etwas Zeit ins Land geht.« Der Mann schien verlegen, als ahnte er, was in seinem Mandanten vorging. »Noch ist überall die Empörung groß. Da könnte ein Urteil hart ausfallen.« Er schwieg einen Moment. »Sogar sehr hart.«
Druwe wusste, was Strehler meinte. Es war gut möglich, dass der Strang auf ihn wartete.
Wieder einmal alles versaut, dachte er. Eva allein mit dem Kind. Nicht einmal verheiratet waren sie. Er hatte das Gefühl, seit einigen Jahren in seinem Leben nur Spuren der Verwüstung hinter sich zu lassen.
Wehmütig erinnerte er an seine Kripo-Arbeit in Berlin. Da hatte er sich selbst noch gespürt, war angetrieben gewesen vom Pulsschlag der Stadt. Er hatte sich nie groß um Dienstpläne und Vorschriften geschert. Und war oft erst um die Mittagszeit am Werderschen Markt erschienen. Er schlief auf der Pritsche in seinem Dienstzimmer, wenn andere Kollegen Feierabend machten. Und um acht Uhr abends begann seine Jagdzeit. Dann war Jens Druwe auf der Straße, befragte Informanten, quetschte Koks-Köppe aus und nahm die schweren Jungs hoch. Das Adrenalin wurde seine Droge. Improvisation und Spontanität waren das Regelwerk, nach dem sein Leben ablief. Er brauchte das Chaos, damit er sich in seinem Inneren irgendwie zurechtfand. Und nun würden ihn jahrelang Gefängnisalltag und Routine lähmen. Vielleicht war aber auch alles schnell zu Ende. Er zwang sich, an etwas anderes zu denken.
»Wie sieht Ihre Strategie für den Prozess aus?«, fragte er nach einer Weile, ohne sich umzudrehen. »Soll ich alles leugnen? Soll ich aussagen, dass diese Leute mich bedroht haben? Der zahnlose Greis aus diesem weißrussischen Dorf. Die Mutter mit dem Kind an der Brust. Ja, Herr Strehler?« Seine Stimme klang jetzt eisig. »Diese Menschen standen an den Gruben und haben mir so fürchterlich zugesetzt, dass ich gar nicht anders konnte, als …«
»Ich sehe, wir kommen heute nicht weiter«, meinte Strehler resigniert. »Ich gehe immer einen Schritt nach dem anderen. In Ihrem Fall heißt das, wir werden Zeugen unter den Truppenangehörigen Ihrer Einheit suchen. Wir brauchen wenigstens deren eidesstattliche Aussagen. Besser, wir laden die Leute vor, wenn es so weit ist.«
Und die Opfer gleich dazu, dachte Druwe zynisch. Die weißen Gestalten, aus deren Mündern die Maden krochen und denen die Arme und Beine abfaulten. Sie kommen sowieso jede zweite Nacht. In meinen Träumen. Dann kann ich ihnen Strehlers schriftliche Vorladung in die von Kalk verstopften Ohren rufen.
*
Einige Tage später erhielt Druwe Besuch von seinem ehemaligen Kollegen. Hans Oberbauer hatte mit ihm in Berlin bei der Kripo gearbeitet, damals als sein Assistent. Mit Beginn des Kriegs waren sie getrennte Wege gegangen.
»Tut mir leid, dass ich erst jetzt komme«, sagte Oberbauer etwas verlegen. »Es waren einige Dinge zu erledigen.«
Druwe winkte ab. »Was macht die Verletzung?« Er zeigte auf Oberbauers Schulter. Dass sich sein Kollege zwei Monate Zeit für einen Besuch gelassen hatte, nahm er ihm nicht krumm. Schließlich war auch Oberbauer frisch verliebt. Außerdem wusste er von Eva, dass jeder im Moment versuchen musste, irgendwie zurechtzukommen.
»Fast verheilt.« Oberbauer hob zum Beweis den Arm, dabei verzog er jedoch sein Gesicht und stöhnte. Anfang Mai war er angeschossen worden und hatte nur knapp überlebt.
»Und Ruth?«, fragte Druwe weiter. Das Leben hinter Gittern war derart langweilig, dass ihm jeder Klatsch willkommen war.
»Wir werden heiraten«, erwiderte Oberbauer. »Wahrscheinlich geht es dann nach Hamburg. Ruth hat ein Angebot, dort im Marienkrankenhaus zu arbeiten. Und Daniel Tanner will mich offiziell bei der Städtischen Verwaltung anstellen. Im Rang eines Amtsrats.«
»Glückwunsch, Hans.« Druwe wusste, dass sein ehemaliger Kollege über das Geschick verfügte, die Dinge optimal für sich einzurichten. Dabei spielte ihm auch oft das Glück die Bälle zu. Den britischen Offizier Daniel Tanner hatte er im Flensburger Krankenhaus kennengelernt, als der Geheimdienst-Mann dort eine Blinddarm-OP auskurierte. Dabei drehte Hans Oberbauer seine Fahne gar nicht bewusst in den Wind. Er ließ sie einfach vom vorherrschenden Lüftchen in die passende Richtung wehen.
»Diese Frau wird dir zeigen, wo Norden ist.« Druwe grinste, dann wurde er jedoch ernst. »Amtsrat? Ich dachte, du machst weiterhin Polizeiarbeit, Hans.«
»Ich werde dort ohne Geschäftsbereich tätig sein. Zur besonderen Verfügung der Tommys.« Oberbauer zwinkerte ihm zu. »Amtsrat bin ich nur für die Hamburger Besoldung. Inoffiziell arbeite ich für die Field Security Section. Ich bin nur Daniel, also Major Tanner unterstellt.«
»Major? Er ist offenbar nach oben gefallen«, stellte Druwe trocken fest. Als er Tanner das letzte Mal getroffen hatte, war dieser noch Captain gewesen. Er konnte nicht umhin, Oberbauer zu beneiden. Immerhin kam die Arbeit bei der Field Security dem Polizeidienst recht nahe. Tanner und sein Team jagten Nazis und deren Unterstützer. Und sie waren Kunstwerken, Dokumenten und Unterschlagungen auf der Spur. Druwe hätte einiges dafür gegeben, jetzt ganz unbefangen an Oberbauers Seite stehen zu können. Wind hin oder her. Langsam war er bereits so zermürbt, dass er sich fast den öden Dienst als Inspektor bei der OrPo zurückwünschte. Hühnerdiebstahl war allemal interessanter als diese Zelle.
»Die Beförderung hat er letztlich dir zu verdanken, Jens«, sagte Oberbauer. »Deine Liste hat die FSS auf die Spur einiger wichtiger Strippenzieher und SS-Leute gebracht. Die Verhaftungen haben Aufsehen erregt und Tanner in ein gutes Licht gerückt. Er soll sogar mit Churchill gegessen haben.«
Beide Männer schwelgten in ihren Erinnerungen. Sie sprachen über die Berliner Zeit bei der Kripo und ihre gemeinsamen Fälle. Fast ein Jahrzehnt waren sie ein Ermittlerteam in der Hauptstadt gewesen.
»Kannst du dich noch an diese Autoräuber erinnern?«, fragte Oberbauer. »Haben uns ganz schon in Atem gehalten.«
»Die Götze-Brüder«, erwiderte Druwe und nickte. »Ja, so hießen sie. Einer dumm wie Brot, der andere schlau wie ein Fuchs. Und Nebe hat uns die Hölle heißgemacht.«
»Heute weiß ich, dass wir knapp davor waren, selbst im KL zu landen, Jens«, meinte Oberbauer. »Goebbels war damals stinksauer, dass zwei Mordbuben in seinem sonst so sauberen Reich frei herumliefen. Und Heydrich wollte uns auch abservieren.«
Mordbuben. Strolche. Fast konnte sich Druwe ein Lächeln nicht verkneifen, als er an die kurze Begegnung mit dem Propagandaminister dachte. Goebbels hatte eine Wortwahl und Betonung gehabt, die sich wie ein Brandzeichen ins Gehirn der Leute einbrannte.
»Fangen Sie mir diese Mordbuben, die es wagen, ehrbaren Frauen aufzulauern und sie zu töten. Solche Strolche haben in unserem Deutschland keinen Platz«, hatte Goebbels laut gefordert. Für die Strafpredigt hatte er beide Kripo-Männer in seine Berliner Villa auf Schwanenwerder zitiert. »Sonst bleibt von den Schandtaten dieser schamlosen Banditen noch etwas an Ihnen hängen, meine Herren.« Das Wort Hängen hatte er dabei auf seine typische, schrille Weise betont. Und es war Druwe und Oberbauer klar gewesen, was er damit gemeint hatte.
Erinnerungen waren immer auch eine Verklärung. Sie waren Umdeutungen und Adaptationen des Geistes. Obwohl Druwe schmunzelte, ahnte er, dass beide Männer mit etwas Pech auch in der Hölle hätten landen können. Der Grat, auf dem sie damals gewandert waren, war schmal gewesen.
»Und was ist aus diesen Tresorknackern geworden, die Dänemark an uns ausgeliefert hat?«, fragte er, um das Thema zu wechseln.
»Die Brüder Sass?« Oberbauer wurde ebenfalls ernst. »KL. Und später dann …« Er fuhr sich mit dem Daumen angedeutet über den Hals.
Die Männer schwiegen eine Weile. Es war unmöglich, von alten Zeiten zu sprechen, ohne dass man irgendwann auf eine Tretmine lief. Jüdische Kollegen, die plötzlich verschwunden waren. Alteingesessene Geschäfte und Lokale, die den Besitzer gewechselt hatten. Bücher, die man nicht mehr kaufen konnte. Unrecht, bei dem man die Weisung erhalten hatte, wegzusehen. Weil es von jemandem mit Beziehungen begangen worden war. Und dazu Zeitung und Radio, die nur noch Hass und Lügen in die Welt geiferten.
»Übrigens«, sagte Oberbauer und senkte die Stimme. »Ich habe das gesamte Dossier über Fiedler an Daniel weitergereicht. Wie du es wolltest.«
Druwe nickte zufrieden. Er hatte kurz vor seiner Verhaftung eine Akte aus dem Canaris-Archiv retten können. Diese unselige Sache um das Geheimarchiv des Admirals hatte ihn vor zwei Monaten fast das Leben gekostet. Und außer einer Akte war ihm nichts geblieben. Aber immerhin, diese Akte war ihm persönlich wichtig. Ernst Fiedler hatte im Russland-Feldzug ein Einsatzkommando geleitet, das für die Morde an vielen Zivilisten im Hinterland verantwortlich gewesen war. Sonderaktionen und Säuberungen nannten die Nazis solche gezielten Tötungen. Leben wurde ausgelöscht, als würde man ein Haus auskehren. Druwe war Fiedler unterstellt gewesen und hatte an diesen Kommandoaktionen teilnehmen müssen. Er hatte gehofft, Fiedler mithilfe der Unterlagen selbst aufspüren zu können. Durch seine Haft war dieses Vorhaben jedoch unmöglich geworden. Aus diesem Grund hatte er Eva frustriert gebeten, das gesamte Dossier an Hans Oberbauer weiterzuleiten.
»Die Informationen sind ziemlich interessant«, meinte sein ehemaliger Kollege. »Allerdings wird es komplizierter als bei der Liste mit den anderen, flüchtigen SS-Leuten.«
Druwe sah ihn fragend an.
»Die Kerle mit den falschen Identitäten gingen uns recht unbedarft ins Netz. Viele fühlten sich absolut sicher. Also konnten wir sie unter ihrem neuen Namen aufspüren und haben sie eine Weile beobachtet. Und dann schnappte die Falle zu. Bei der Akte Fiedler müssen wir anders vorgehen. Irgendetwas stimmt da nicht. Der Mann ist nicht aufzufinden, seine Spur verliert sich schon nach dem Attentat auf Hitler.«
»Das war vor einem Jahr, Hans«, warf Druwe ein. »Der Kerl ist strammer Nazi, der Führer war für ihn unantastbar. Meinst du, er war an dem Anschlag beteiligt?«
»Nein, da hast du mich falsch verstanden«, antwortete Oberbauer. »Er hatte gewiss nichts mit dem Widerstand zu tun.«
»Ist er vielleicht jemandem auf die Füße getreten? Oder haben ihn andere Leute schon geschnappt und beseitigt?«, fragte Druwe. »Nach dem Anschlag wurden ja alle paranoid. Fiedler könnte auf der falschen Seite gestanden haben. Dann hat ihn sich der SD unter einem Vorwand geholt und verschwinden lassen.«
Oberbauer schüttelte den Kopf. »Wir haben die Akten vom Sicherheitsdienst und aus der Gestapo-Leitstelle geprüft. Selbst kleine Blockwarte wurden ja damals gehängt, weil sie sich mit links den Hintern abgewischt hatten. Aber über Fiedler gibt es keine Aufzeichnungen.«
»Jeder zweite Satz handelte bei ihm vom geliebten Führer«, sagte Druwe eher zu sich selbst. »Er war ein ganz treuer Anhänger. Vielleicht ist er im Endchaos doch noch gefallen?«
Wieder schüttelte Oberbauer den Kopf. »Nein. Aber einige schlaue Köpfe haben schon damals erkannt, dass es besser ist, sich früh auf eine Zeit nach Hitler einzustellen.«
»Seine Stellung und sein Dienstrang waren doch gar nicht so bedeutsam«, gab Druwe zu bedenken. »Könnte er für jemanden gearbeitet haben? Hatte er Hintermänner? Ich meine, vielleicht hat er nicht nur die Säuberungsaktionen durchgeführt, sondern noch andere Dinge getan. Uns ist doch klar, dass es vielen Bonzen nur um Geld und Macht ging. Dieser ideologische Kram war oft nur Vorwand.«
Oberbauer schwieg eine Weile. »Es könnte auch sein, dass ihn jemand deckt«, fuhr dann fort. »Keine Ahnung. Zu viele Fragen. Wir wissen ja noch nicht einmal, ob Fiedler etwas besitzt, das ihn wertvoll machen könnte. Aber wir sind dran, Jens. Ich weiß, wie wichtig die Sache für dich ist. So etwas braucht leider Zeit.« Oberbauer betrachtete seinen Exkollegen und legte dann seine Hand an die Zellenwand. »Ich bin dir noch etwas schuldig. Und Tanner ebenfalls. Die Sache mit der Nazi-Liste haben wir dir nicht vergessen. Ich habe zwei Briten darauf angesetzt, dich hier herauszuholen. Tanner will sehen, was er tun kann. Aber dieser Richter Löhr ist penetrant, die Vorwürfe gegen dich sind schwerwiegend.«
»Mich hat nur die Vergangenheit eingeholt, Hans«, sagte Druwe. »Du weißt, dass ich Tricks und Täuschungen nicht mag. Als Polizist war es meine Aufgabe, so etwas aufzudecken. Und darüber waren wir oft unterschiedlicher Meinung.« Er schwieg und sah aus dem vergitterten Fenster. »Ich will wieder ruhig schlafen können. Meine Entscheidung steht fest. Keine Kompromisse oder Absprachen. Keine Gefälligkeiten. Ich werde die Konsequenzen tragen. Und in die Verhandlung gehe ich mit offenem Visier.«
Oberbauer stöhnte. »Dann sei aber wenigstens bereit, für dich einzustehen, Jens. Und für deine Familie. Kampflos wirst du mit Sicherheit untergehen. Niemand wird Rücksicht auf dich nehmen.«
Er schwieg. Druwe wusste, dass sein alter Kollege über viele Themen anders dachte. Sein Motto war eher: Wer im Dreck wühlte, machte sich notgedrungen schmutzig. Und als Kripo-Männer hatten sie wahrlich oft genug im Dreck gestanden. Die Bewertung seiner Aufgaben und Methoden hatte Oberbauer dabei immer strikt von seinem Gewissen getrennt. Hans Oberbauers Schlaf war ruhig, da hatte Druwe keine Zweifel.
2 Berlin, Oberharz, August 1945
Kohle war kaum noch zu bekommen. Schon gar nicht für Papier-Reichsmark. Und seine Uhr, ein Hochzeitsgeschenk seines Schwiegervaters und der letzte echte Wertgegenstand, den er besaß, hatte er vor zwei Monaten bei einem Russen gegen sein Leben eingetauscht.
Ein fairer Handel, dachte Heimann zynisch. Die Welt war in diesen Wochen furchtbar nachtragend. Ganz besonders im Osten. Als Antwort auf den deutschen Vernichtungskrieg waren Zerstörung und Erniedrigung nun über das Reich und die Hauptstadt gekommen. Richard Heimann war nicht gerade gottgläubig, aber das, was Berlin in diesen Wochen widerfuhr, musste der Zorn eines Höheren sein.