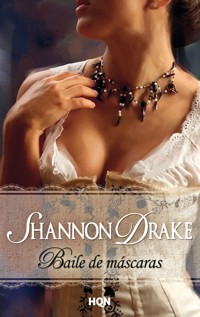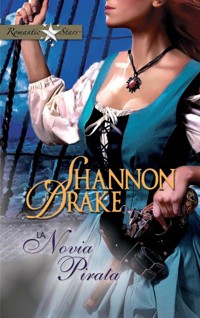4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 2,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Midnight Kiss
- Sprache: Deutsch
Denn die Liebe überwindet selbst den Tod! Der Urban-Fantasy-Roman »Blutrote Nacht« von Bestseller-Autorin Shannon Drake jetzt als eBook bei dotbooks. Seit über einem Jahrhundert hütet die atemberaubend schöne Vampirin Maggie Montgomery ihr dunkles Geheimnis. Doch dann wird in New Orleans eine enthauptete Leiche gefunden – und eine Blutspur führt den Ermittler Sean Canady direkt vor Maggies Tür! Vom ersten Moment an fühlt sich die Unsterbliche zu ihm hingezogen – und riskiert, dass Sean sie als Tochter der Nacht enttarnt. Als weitere Leichen entdeckt werden, hat Maggie keine andere Wahl: Sie vertraut Sean ihr Geheimnis an … und bringt ihn dadurch in tödliche Gefahr! Kann sie ihn retten und den Vampir, der in New Orleans auf die Jagd geht, aufhalten? New-York-Times-Bestseller-Autorin Shannon Drake bietet in ihren Erotic-Fantasy-Romanen alles, was die Fans dieses Genres lieben! »Die Autorin kombiniert Mystery mit knisternder Romantik.« Publishers Weekly »Eine unglaubliche Geschichtenerzählerin.« Los Angeles Daily News Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Urban-Fantasy-Roman »Blutrote Nacht« von Shannon Drake. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 629
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch:
Seit über einem Jahrhundert hütet die atemberaubend schöne Vampirin Maggie Montgomery ihr dunkles Geheimnis. Doch dann wird in New Orleans eine enthauptete Leiche gefunden – und eine Blutspur führt den Ermittler Sean Canady direkt vor Maggies Tür! Vom ersten Moment an fühlt sich die Unsterbliche zu ihm hingezogen – und riskiert, dass Sean sie als Tochter der Nacht enttarnt. Als weitere Leichen entdeckt werden, hat Maggie keine andere Wahl: Sie vertraut Sean ihr Geheimnis an … und bringt ihn dadurch in tödliche Gefahr! Kann sie ihn retten und den Vampir, der in New Orleans auf die Jagd geht, aufhalten?
»Die Autorin kombiniert Mystery mit knisternder Romantik.« Publishers Weekly
»Eine unglaubliche Geschichtenerzählerin.« Los Angeles Daily News
Über die Autorin:
Hinter dem Pseudonym Shannon Drake verbirgt sich die New-York-Times-Bestseller-Autorin Heather Graham. Bereits 1982 veröffentlichte sie ihren ersten Roman. Seitdem hat sie über zweihundert weitere Romane und Novellen verfasst, die in über dreißig Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern in Florida.
Von Shannon Drake erscheinen bei dotbooks ebenfalls:
Bei Anbruch der Dunkelheit
Verlockende Finsternis
Das Reich der Schatten
Der Kuss der Dunkelheit
Unter ihrem Namen Heather Graham veröffentlicht sie bei dotbooks:
In den Händen des Highlanders
***
eBook-Neuausgabe März 2019
Dieses Buch erschien bereits 2007 unter dem Titel Unter dem Blutmond in der Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 1999 by Shannon Drake
Published by Arrangement with KENSINGTON PUBLISHING CORP., NEW YORK, NY 10018 USA
Die amerikanische Originalausgabe erschien 1999 unter dem Titel Beneath a Blood Red Moon bei Zebra Books
Copyright © der deutschen Ausgabe 2007 Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Vector Tradition, Arthur Studio 10 und Sean Pavone
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ca)
ISBN 978-3-96148-750-9
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Blutrote Nacht an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Shannon Drake
Blutrote Nacht
Roman
Aus dem Amerikanischen von Angela Schumitz und Heinz Tophinke
dotbooks.
Den Jungen – und Mädchen – des Sommers gewidmet(weil sie darum gebeten haben!)
Für Eddie Forehand, Suzanne Hance, Sean Meyers, Efrain Canellas, Big Serge und Little Serge (Mehalichanco und McKenzie), Mike Anderson, Bobby Merrill, James Cintron, Matt, Mike und Danielle Marrache, Roger Lopez, Suzanne Medina, Alex Mehalichanco, Jamie, Tanya und Nick McKenzie, Hector Hernandez, Johnny Mok, Eddie Hung, Aurora Muniz und Stephanie Smith. Für die Jungs von Pariah: Brian Keller, Robert und Tony Rodriguez, Ben und Jason Pozzessere – und den Hungry Sailor, wo lokale Bands eine Chance bekommen. Für Shayne, Bryee-Annon und Derek Pozzessere (und Chynna, obwohl sie zum Ausgehen noch nicht alt genug ist!).
Und mit besonderen Wünschen für Linda, Tom und Andrew Dixon.
Prolog
New Orleans, 1840
»Gegen Comte DeVereaux ist doch nun wirklich nichts einzuwenden«, erklärte Magdalena, die Füße fest auf den Boden aufgesetzt und den Rücken entschlossen durchgedrückt. Sie saß auf dem Sofa im großen Salon des prächtigen Herrenhauses, das – mit weißen Säulen geschmückt – inmitten der Plantage ihres Vaters in New Orleans lag.
Jason Montgomery betrachtete seine Tochter und schüttelte dann mit einem traurigen Seufzer den Kopf. Er wollte ihr nur ungern wehtun, aber in diesem Fall war es unumgänglich. Ja, wenn er sie so dasitzen sah, das füllige, dunkle, leicht rötlich schimmernde Haar hochgesteckt – nur ein paar Strähnen hingen reizvoll herab–, dann fühlte er sogar ein wenig Angst in sich aufsteigen. Er musste einfach hart bleiben. Sie war sein einziges Kind, und wenngleich er sie mit dem voreingenommenen Blick eines Vaters sah, war sie doch zweifellos ein sehr schönes Mädchen. Sie hatte ein klassisch geschnittenes Gesicht und eine perfekte Figur, ihre zarte Haut schimmerte wie Alabaster, die großen Augen leuchteten goldbraun. Sie wirkte erhaben und würdevoll, hatte einen eisernen Willen und war blitzgescheit. Zudem verfügte sie über die Anmut einer Gazelle, ihre Bewegungen waren von einer natürlichen Eleganz, und in unbeobachteten Momenten konnte sie weich, zart und verführerisch sein – die naive Unschuld in Person. Und sie war jung, leidenschaftlich und leicht zu beeindrucken. Er hatte ihr beigebracht, stark zu sein. Als seine Tochter, seine Erbin, musste sie das auch sein. Denn Jason Montgomery war der Herrscher über alles, was sie in dieser Welt der Plantagen umgab, und die Männer Louisianas achteten ihn – Männer, die inzwischen Amerikaner waren, mochten sie auch ihrer Herkunft nach Franzosen oder Briten sein. Er war klug, gebildet und mächtig, und er hatte alles versucht, um auch seiner Tochter mitzugeben, was ihn selbst auszeichnete.
Und nun benutzte sie all dies gegen ihn.
»Du magst den Comte nur nicht, weil er Franzose ist«, warf sie ihm leise vor.
»Ich mag den Comte nicht, das stimmt, aber nicht, weil er Franzose ist, sondern ...« Beinahe hätte Jason zu viel preisgegeben. Er wollte schließlich nicht, dass sie ihn für verrückt hielt. Er verlangte lediglich, dass sie seine Meinung und seine Anweisungen allein deshalb respektierte, weil er ihr Vater war.
»An diesem Ort leben überwiegend Franzosen, und trotzdem habe ich mich dafür entschieden, hier zu leben«, brachte er hervor. Nein, nicht trotzdem – vielmehr aus eben diesem Grund hatte er sich für diesen Ort entschieden. Hier gab es Männer und Frauen aus den vormaligen Kolonien, dazu Franzosen und Briten, dann die Insulaner, die Kreolen. Menschen verschiedener Rassen und unterschiedlicher Hautfarbe, kaffeebraune Alte und jüngere, kraftvolle, dunkle Schönheiten, und sie alle besaßen Wissen ... Wissen über das Dunkel.
Er war nicht überzeugend genug gewesen. Energisch schüttelte er die Faust in Richtung seiner Tochter. »Ich bin dein Vater. Du wirst Alec DeVereaux nicht wiedersehen! Du wirst Robert Canady heiraten, und zwar in den nächsten Monaten, so schnell die Hochzeitsfeier arrangiert werden kann!«
»Nein!« Magdalena war mit einem Satz auf den Beinen. Wut und Leidenschaft loderten in ihrem Blick. Die Schönheit und Anmut ihrer Bewegungen war nie deutlicher als in Momenten des Zorns – so wie jetzt. »Das werde ich nicht tun, Vater.« Plötzlich schluchzte sie. »Noch nie hast du mich so behandelt! Du hast mir beigebracht, zu denken und zu fühlen ...«
»Aber du denkst nicht!«, konterte Jason. »Wenn du nur nachdenken würdest, dann käme dieser Comte auch dir seltsam vor. Dann würdest du etwas wissen wollen über seine Eltern, dich fragen, wer er ist und woher er kommt ...«
»Vater, du klingst wie ein arroganter Narr!« Magdalena war bestürzt. »Du solltest dich reden hören! Du hast doch selbst einmal gesagt: Dies hier sind die Vereinigten Staaten von Amerika. Wir beugen uns keinem König, keiner Königin mehr. Hier nimmt jeder sein Schicksal selbst in die Hand ...«
»Auch hier geraten dumme junge Mädchen in Verzückung, sobald sich irgendein Kerl bei einem hochtrabenden Titel nennt!«
»Vater, ich bin kein dummes Mädchen, ich bin nie in Verzückung geraten, und Titel beeindrucken mich nicht. Dass mein eigener Vater ein Baron des Bayou ist, reicht mir vollkommen!«, versuchte sie einen schwachen Scherz. Doch dann wurde sie wieder ernst. »Du kennst ihn nicht, Vater. Alec ist so belesen! Er eröffnet mir neue Welten, durch ihn lerne ich ferne Orte kennen, er erklärt mir die Geschichte und die Menschen, die Vergangenheit und die Zukunft. Ich liebe ihn, weil ...«
»Nein!«, fuhr Jason entsetzt dazwischen.
»Er ist tapfer. Ernsthaft. Heftig – und dann wieder unglaublich zärtlich. Und ...«
»Er will dich lediglich verführen!«
»Nein, er ist ein rechtschaffener Mann. Er will mich heiraten.«
»Niemals!«, erklärte Jason eisern. »Niemals, hast du gehört? Nie!« Inzwischen brüllte er. »Tyrone! Bring meine Tochter auf ihr Zimmer, und dort bleibt sie!«, befahl er mit lauter Stimme dem Diener, der den Streit vom Flur aus gehört hatte und nun mit unglücklicher Miene herbeigeeilt kam. Tyrone war ungewöhnlich dunkelhäutig, ein Nachkomme von Sklaven, der als freier Mann im Bayou aufgewachsen war. Seine Eltern waren von den Inseln gekommen, und deren Vorfahren aus dem südlichen Afrika. Er war über einen Meter neunzig groß und äußerst muskulös. Traurig trat er auf Magdalena zu. »Tut mir leid, Miss«, murmelte er.
Magdalena blickte in das schöne, sorgenvolle Gesicht des Mannes. Tyrone war die rechte Hand ihres Vaters. Sein einziger Fehler war die unerschütterliche Treue zu Jason. Wenn es sein musste, würde er sie nach oben tragen.
Sie blickte zu ihrem Vater zurück, noch immer unfähig, dessen unerbittlichen Hass auf den jungen Mann, den sie liebte, zu begreifen. »Kein König, keine Königin, Vater! Niemand, der über alles erhaben ist und uns beherrscht – das ist Amerika. Ich werde mich nicht dem Willen eines anderen beugen!«
Damit machte sie zornentbrannt kehrt und stapfte die Treppe hinauf, dicht gefolgt von Tyrone.
»Magdalena!«, rief Jason ihr nach.
Er war ihr Vater – und ihr bester Freund, den sie innig liebte. Magdalena drehte sich um.
»Aus Liebe, mein Kind – kannst du dich meinem Willen beugen, wenn er der Liebe und Sorge eines Vaters entspringt?«
»Ich werde dich mein Leben lang lieben, Vater. Mein Leben lang. Aber es muss auch noch eine andere Liebe geben, und dieser Liebe wegen muss ich mich dir widersetzen.«
»Du wirst Robert Canady heiraten, innerhalb der nächsten Monate!«
»Das werde ich nicht tun, Vater.«
»Doch, das wirst du!«
Sie zog elegant eine Augenbraue nach oben. »Willst du mich bis dahin in meinem Zimmer einsperren?«
»In der Tat, mein Kind, so sicher, wie es jeden Abend dunkel wird, das schwöre ich dir!«
Sie beobachtete ihn reglos, doch mit schier unglaublicher Würde. »Nenn mich nicht Kind«, erwiderte sie schließlich leise und setzte ihren Weg die Treppe hinauf fort.
Dieses Mal blickte Magdalena nicht zurück. Ihr Herz war im Begriff zu brechen. Sie liebte ihn so sehr – seinen gestutzten, grau melierten Bart, seine hochgewachsene, schlanke Gestalt. Immer war er für sie da gewesen. Manchmal hatte er geschimpft, aber meistens war er überaus liebevoll gewesen. Er liebte sein Land und noch mehr seine Bücher, verbrachte viel Zeit in seinem Studierzimmer, über alte Texte gebeugt, immer am Forschen, Lernen und Weitergeben. Er hatte seine alten Freunde; manche davon waren seltsam und verschroben: Männer, die sich gelegentlich mit ihm in seine Bücherwelt zurückzogen. Aber sie waren alle nett und freundlich und hilfsbereit – und manchmal studierten sie Magdalena so wie ihre alten Bücher. Ihr ganzes Leben lang hatten sie ihr Güte und Wärme entgegengebracht; vielleicht war dies ein Abglanz der Verehrung, die sie für ihren Vater hegten. Jason und seine Freunde hatten sie immer dazu ermutigt, zu lernen, zu denken, ihre eigenen Entscheidungen zu treffen. Und nun ...
Tränen traten ihr in die Augen. Einen Mann für die Tochter auswählen – das taten andere Väter. Nicht jedoch Jason. Er war ein Leben lang nicht nur ihr Vater, sondern auch ihr bester Freund gewesen. Er hatte ihr alles bedeutet.
Wie konnte es sein, dass er sie plötzlich nicht mehr verstand? Auch er hatte einst die Liebe gekannt, das hatte er ihr oft genug erzählt. Bisweilen hatte er ihr ihre Mutter so lebhaft und eingehend geschildert, dass die Vergangenheit für Magdalena beinahe greifbar wurde. Jason hatte Marie d'Arbanville angebetet, er hatte ihr Herz im Sturm erobert und sie nach Hause gebracht. Magdalena glaubte, dass er sich in New Orleans niedergelassen hatte, damit sich Marie möglichst wie daheim in Frankreich fühlte, unweit von Paris.
Doch das schien jetzt keine Rolle mehr zu spielen. Wenn er einst gewusst hatte, was Liebe war, dann hatte er es inzwischen wohl vergessen. Ihr Herz begann heftig zu pochen. Robert Canady war ein feiner Kerl, ein gut aussehender, junger Witwer mit einem blonden Schnurrbart, dunkelblonden Locken und sinnlichen blauen Augen. Er war zuvorkommend, charmant, manchmal ein wenig zu ernst und weise, aber sie mochte ihn, sehr sogar. Beinahe hätte sie sich sogar in ihn verliebt. Früher einmal hätte sie ihn vielleicht geheiratet, doch jetzt ging das nicht mehr. Denn Alec hatte sie berührt. Sie hatte seine geflüsterten Worte vernommen, seine Augen gesehen. Sie hatte die Liebe gespürt, mit der er sie umhüllte. Seit er nach New Orleans gekommen war, seit sie beim Gouverneursball zusammen getanzt hatten, seit sie miteinander gelacht und geplaudert hatten und ausgeritten waren, gab es für sie keinen anderen mehr. Keiner hatte ein solches Feuer in den Augen, keiner gebrauchte solch süße Worte, die all ihr Verlangen entfachten.
Als sie die Tür ihres Zimmers hinter sich zuschlug, erschauderte sie. Sie hatte ihm gesagt, dass sie kommen würde. Dass sie über das Bayou reiten, durch die Nacht fliegen würde, wenn es sein musste, um zu ihm zu gelangen. Magdalena starrte auf die Balkontür. Sie musste schnell sein.
Sie zerwühlte ihr Bett, formte aus den Kissen einen Körper und breitete die Zudecke und die Tagesdecke darüber. Dann schlich sie auf Zehenspitzen zur Tür und lauschte. Sie wusste genau, dass Tyrone im Flur an der Wand lehnte, wo er die ganze Nacht über bleiben und sie bewachen würde. Sie nahm ihren samtenen Umhang von dem Haken neben dem Bett und ging fast lautlos zur Balkontür.
Magdalena!
Verblüfft blieb sie stehen, denn ihr war, als hätte sie seine – Alecs –Stimme an ihrem Ohr gehört. Als wäre er in der Nähe und riefe nach ihr.
Der laue Nachtwind streifte sie, fuhr durch ihr Haar, bewegte die weiche blaue Seide ihres Kleids.
Ich komme, Geliebter!, antwortete sie in Gedanken.
Von dem schmiedeeisernen Balkon aus konnte sie nach dem starken Ast der alten Eiche greifen, der ihr schon als Kind dazu gedient hatte, in die Nacht zu entwischen. Er würde ihr auch jetzt von Nutzen sein.
Behände kletterte sie den Baum hinunter und sprang den letzten Meter zu Boden. Durch das Fenster des Salons sah sie ihren Vater; das Haupt gebeugt und die Schultern eingefallen, stand er vor dem Kamin. Das Herz tat ihr weh. Sie liebte ihn so sehr.
Meine Liebe, meine Liebe ...
Wieder hörte sie das Flüstern. Spürte, wie es sie liebkoste. Sie wandte sich vom Haus ab und eilte auf leisen Sohlen zu den Ställen, legte Demon, ihrem Lieblingshengst, die Zügel an und führte ihn hinaus in die Nacht.
Eine Wolke trieb vor den Sternen vorüber. Der Mond war rund und voll. Er zog seine Bahn über den samtenen, rötlichen Nachthimmel; vielleicht zog ein Sturm auf. Der Anblick war wunderschön, wenn auch ein wenig schauerlich. Es sah beinahe aus, als sei der Mond in Blut getaucht.
Sobald Magdalena das Haus hinter sich gelassen hatte, sagte sie sich, dass ihre Liebe keine Furcht kenne. Und wenn ihr Vater endlich verstand, dass sie Alec liebte und sich mit ihm eingelassen hatte, würde er nachgeben und ihrer Heirat zustimmen.
Sie saß auf, jagte mit Demon über die Felder und suchte dann vorsichtig den Weg durch den Sumpf vor der Küste. Er war ihr vertraut; sie kannte das Bayou. Sie war hier geboren und hatte davor ebenso wenig Angst wie vor den Geschöpfen der Nacht.
In dem rötlichen Mondlicht kam sie gut voran; es war, als würden Demons Hufe über die Erde fliegen. Während sie mit schwerem Herzen in Gedanken noch bei ihrem Vater weilte, erreichte sie schließlich Stone Manor, den alten Herrensitz, den Alec bei seiner Ankunft in New Orleans gekauft hatte. Der Mond schien das Gebäude in blutrotes Licht zu tauchen. Ein rötlicher Schatten umfing die hohen, weißen Säulen, und aus dem Schornstein stieg Rauch auf, in dem goldrote Funken zu fliegen schienen.
Er erwartete sie ...
Alec DeVereaux stand am Schlafzimmerfenster und spürte die Erregung in seinem ganzen Körper. Heiße, sinnliche Schauer durchliefen ihn.
Eine Ewigkeit lang hatte er auf sie gewartet. Und vom ersten Augenblick an, als er sah, wie sie am anderen Ende des Raums stand und lachte, hatte er gewusst, dass er sie lieben würde. Dann hatte er sie berührt, mit ihr getanzt, sich sanft an sie gedrückt. Es hatte ihn nach ihr gelüstet, so sehr, so quälend, dass man von Verlangen oder Begehren nicht einmal mehr sprechen konnte. Nachts war er vor brennender Begierde wach gelegen. Er hätte sie nehmen, sie verführen können; darin war er ein Meister. Aber sie musste ihn lieben, so wie er sie liebte. Und deshalb hatte er gewartet.
Bis heute Nacht.
Heute Nacht ...
Heute Nacht war sie gekommen. Sie war auf der jähen Anhöhe erschienen, auf dem Rücken des pechschwarzen Demon, war ins Licht des Mondes getaucht. Alec beobachtete gebannt, wie sie vom Pferd sprang. Er hörte sie unten am Eingang mit Thomas sprechen und dann ihre leisen Schritte, als sie die Treppe heraufeilte.
Er riss die Tür seines Schlafzimmers auf, und da war sie. Endlich konnte er sie berühren. Er streifte sanft die Kapuze ihres Umhangs nach hinten. »Du bist gekommen«, flüsterte er, trat einen Schritt zurück und zog sie in sein Reich. Ihre Hand schien so klein in der seinen. Klein, zierlich, elegant. Er nahm ihr den Umhang ab, ließ ihn zu Boden gleiten, und sein Blick verschlang sie von oben bis unten – ihren zarten Hals, die Wölbungen ihrer Brüste, ihren schlanken, anmutigen Körper –, während sie durch das Zimmer eilte, hin zum Kamin, wo längst ein Feuer loderte. Sie streckte die Hände aus, um die Wärme der Flammen zu spüren; er folgte ihr, ergriff sie – voll Verlangen und doch zärtlich – an den Schultern, atmete den Duft ihres Haars ein.
»Was glaubt dein Vater, wo du bist?«, fragte er.
»In meinem Bett«, antwortete sie.
Er sah ihre Halsschlagader pulsieren und platzierte vorsichtig einen Kuss darauf.
Sie wirbelte herum, leidenschaftlich, lebhaft. »Alec, ich konnte ihn nicht anlügen! Wir haben furchtbar gestritten. Ich ...«
»Schon gut.«
»Ich habe ihm gesagt, dass wir heiraten wollen.«
»Ma belle, alles ist gut.«
Mit einem Seufzer schlang sie die Arme um ihn. »Er muss es akzeptieren. Weil ich dich liebe.«
»Wirklich? Kannst du mich wirklich lieben?«, flüsterte er. »Das bedeutet mir so viel. Du weißt nicht annähernd, wie viel ...«
Verblüfft trat sie einen Schritt zurück. Großer Gott, er war in der Tat ein außergewöhnlicher Mann. So stattlich, so eindrucksvoll mit seinem pechschwarzen Haar und den fast schwarzen Augen, den breiten Schultern, der schmalen Taille und dem markanten, kantigen Kinn. Es gab keine Frau in Louisiana, die mit ihm getanzt und ihn nicht für den gefährlichsten Mann gehalten hätte, den sie je getroffen hatte. Sie wusste nur wenig über ihn – was er ihr eben erzählt hatte. Der größte Teil seiner Familie war in den Wirren der französischen Revolution umgekommen, aber es hatte auch Überlebende gegeben, die der Guillotine entgangen waren. Er selbst hatte in der Schlacht um New Orleans gekämpft – als Junge natürlich, nachdem er von zu Hause fortgelaufen und in die Dienste des Piraten Jean Lafitte gelangt war. Er war weit gereist, hatte, wie er einräumte, mit Pistolen und Schwertern Duelle ausgefochten und war ein exzellenter Schütze. Was er getan hatte, wer er war, das alles erschien ihr wunderbar.
Unvermittelt wandte er sich von ihr ab und trat an ein Tischchen, auf dem ein silbernes Tablett mit einer Flasche Wein bereitstand. Mit dem Rücken zu ihr füllte er zwei Kelche. Sie sah sich in seinem Zimmer um, in seinem privaten Reich. Die Tagesdecke war vom Bett genommen worden, die Decke mit schwarzem Satin bezogen – ein auffallender Kontrast zu den schneeweißen Laken darunter. Am Kopfende waren zahlreiche Kissen aufgebauscht. Neben dem Bett stand in einem silbernen Sektkübel eine Flasche französischer Champagner. Es war eindeutig, weshalb er gewollt hatte, dass sie hierherkam. Er trug einen bodenlangen schwarzen Morgenmantel mit rotem Satinfutter. Magdalena war sicher, dass er nichts darunter trug. Dennoch schien es, als würde er sich ihr entziehen.
»Vielleicht hat dein Vater recht. Vielleicht solltest du mich nicht lieben.«
»Liebst du mich denn?«, flüsterte sie.
Er drehte sich feierlich zu ihr um. »Mit ganzem Herzen. Mein ganzes – nein, in alle Ewigkeit.«
»Dann kann es keinen Grund geben, weshalb ich dich nicht lieben sollte.«
»Und was, wenn ich ein Ungeheuer wäre?«, fragte er.
»Weil du Franzose bist?«, neckte sie ihn.
Er lächelte ein wenig, und dafür liebte sie ihn umso mehr. »Weil ich in der Dunkelheit umherstreife«, erwiderte er leise. »Weil ich nachts spuke. Ich habe getötet ...«
»Viele Männer haben getötet«, erinnerte sie ihn.
Wieder lächelte er leicht. Er beobachtete sie. Sie spürte seine Augen. Spürte sie. Ihr Feuer schien in Magdalena einzudringen, bis in ihr Blut. Sie fühlte sich schwindlig, lüstern, köstlich. Sie wollte ihn mehr, als sie in ihrem Leben je etwas gewollt hatte. Sie spürte ein so quälendes Verlangen nach ihm, dass es schmerzte. Sie musste ihn spüren, seine Hände auf ihrem Körper. Seine Lippen, die sie überall küssten. Ihn selbst, in ihr, als Teil von ihr.
Der Atem wurde ihr schwer, und sie benetzte sich die Lippen. Ihre Finger glitten wie aus eigenem Entschluss an den Knöpfen ihres Kleides auf und ab.
»Ma belle amie, ma petite chérie!«, flüsterte er fast unhörbar. Der Klang seiner Stimme berührte sie, umfing sie wie ein sanfter roter Dunst, der aus dem Feuer aufstieg, vom Mondlicht herniederfiel. »Du kannst einfach in niemandem das Böse sehen.«
»Ich weiß, dass an dir nichts Böses ist.«
Knopf für Knopf öffnete sie ihr Oberteil und ließ es zu Boden gleiten. Sie schauderte kurz, als sie, nur mehr in Korsett und Röcke gekleidet, dastand. Der rote Nebel war wie eine milde, weiche Brise, die über ihre nackte Haut strich, die sie brauchte wie seinen Blick, der über sie streifte. Du denkst nicht, hatte ihr Vater gesagt, und es stimmte: Sie dachte nicht. Alec war seltsam heute Abend; fast hätte man glauben können, er wollte sie wieder fortschicken. Doch das schien ihr nichts auszumachen. Sie wusste, was richtig war und was falsch, und so wahr ihr Gott helfe, sie wollte das Falsche. Aber – konnte es falsch sein, so sehr zu lieben?
Er kam auf sie zu und drückte ihr einen silbernen Kelch mit Wein in die Hand. So dicht vor ihm sah sie den Schmerz in seinen Augen, die gequälte Leidenschaft. Eine schwarze Locke fiel ihm in die Stirn. Magdalena starrte in sein Gesicht. Sie hob den Kelch an ihre Lippen und trank. Die nächtliche Brise, die sich im Raum umherzubewegen schien, stieg und sank in roten Wellenbewegungen auf und ab.
»Was, wenn ich böse wäre?«, flüsterte er.
»Du bist nicht böse.«
»Ich wollte nie ...«
Der Nebel stieg höher. Der Weinkelch war aus ihrer Hand verschwunden. Magdalena konnte sich nicht erinnern, ihn abgestellt zu haben. Sie blinzelte. Sein Morgenmantel war ebenfalls verschwunden; im Mondlicht und in dem zarten, rötlich wabernden Dunstschleier stand er nackt vor ihr. Die Arme ausgestreckt, blickte er sie aus seinen schwarzen Augen an. Ein Beben durchlief ihren Körper, sie spürte es in ihren Gliedern, in ihrem Blut, in ihrer Seele, in ihrem ganzen Wesen. Sie hatte sich nach ihm gesehnt und ihn begehrt, aber sie hatte nicht gewusst, was genau sie begehrt hatte. Jetzt wusste sie es. Sein Körper war geschmeidig, die Brust von dunklem Haar bedeckt. Eine perfekte Gestalt, kraftvoll und stark, die sich von den breiten Schultern hin zur Taille und den Hüften verjüngte, die Beine muskulös. Ihr Blick glitt von seinen Augen bis zu seiner Erregung, und sie hatte dabei ein Gefühl, als würde sie im Nebel schweben, der soeben wieder aufzusteigen schien.
»Es ist mir egal, was du bist!«, sagte sie benommen. »Es ist mir gleichgültig!«
»Ich könnte dir Schmerzen zufügen ...«
»Ich bin schon jetzt voller Qual«, unterbrach Magdalena ihn. Sie konnte es nicht länger ertragen; sie stürzte auf ihn zu, schlang die Arme um ihn, presste ihren Mund auf seinen. Sie hatte noch nie richtig geküsst, doch sie wusste, wie sie ihn entflammen, ihre Zunge spielen lassen, ihn verführen und erregen konnte. Er hob fast hilflos die Arme, kämpfte hart mit sich selbst und drückte sie schließlich an seine Brust, hob ihr Kinn an und erwiderte ihren Kuss. Seine Zunge erforschte ihren Mund, badete ihre Lippen, erfüllte sie mit Feuer. Sie lag in seinen Armen, schwebte im Dunkel, in der samtenen Nacht. Sie sank auf die Satinlaken, spürte, wie kühl sie waren, spürte seinen heißen Körper. Seine langen, geschmeidigen Finger rissen an den Schnüren ihres Korsetts und befreiten sie davon. Magdalena schloss die Augen und bemerkte, wie er ihr die Schuhe abstreifte, die hinderlichen Unterröcke, die Strümpfe. Seine Ungeduld schien ins Unermessliche zu wachsen, und sie sehnte sich so sehr nach seiner Berührung, dass ihr das Entkleiden eine Ewigkeit zu dauern schien. Mit jedem Kleidungsstück entblößte er sie mehr seinem heißen Flüstern und seinen leidenschaftlichen Liebkosungen; seine Finger streichelten sie, und jedem Streicheln folgten heiße, verzehrende Küsse. Er berührte ihr Knie, ihren Schenkel. Ein rhythmisches Pochen nahm ihren Körper ein – ein Puls, der immer schneller wurde. Der rote Nebel durchdrang ihr Fleisch; sie zitterte, verspürte Furcht. Doch ihr Verlangen war zu groß, sie ignorierte das Schaudern. Seine Hand bewegte sich langsam über das dunkle Dreieck zwischen ihren Schenkeln. Heiße Nässe versengte sie, und dann das marternde, intime Streicheln eines Fingers ...
Ihr Puls raste. Sie schrie auf. Er war wieder neben ihr, die dunklen Augen rot wie das Mondlicht, seine Worte gepresst, gequält. »Kannst du mich lieben?«, fragte er fordernd. »Kannst du eine Bestie lieben?«
»Oh, Alec, warum glaubst du mir nicht? Ich liebe dich! Ein Mann, der mich zum Lachen gebracht hat, der mich spüren lässt, dass ich lebe, der mehr Sehnsucht in mir entfacht hat, als ich es mir je vorstellen konnte! Ein Mann, der gelebt und gekämpft und erfahren hat. Ein Mann, der befiehlt, der zuhört, der hart und zärtlich zugleich ist. Ich liebe dich!«
Sie wollte ihn, sie wollte den Nebel und das Versprechen der Ekstase, die sie erfüllte. Sie wollte ihn festhalten, ihm diesen gequälten Blick nehmen, ihm versichern ...
»Bestie«, wiederholte er. »Ich weiß nicht einmal, ob Gott sich an mich erinnert!«
Sie zog seinen Kopf nach unten, presste ihren Mund auf seinen, küsste ihn auf die Lippen. Legte seine Hände auf ihre Brüste, wand sich, um ihm noch näher zu sein, mit ihm zu verschmelzen.
»Gott hat uns gelehrt zu lieben, und ich liebe dich. Es gibt nichts Böses, das ich nicht überwinden könnte! Was ist nur – was ist mit dieser Bestie, als die du dich bezeichnest?«
»Ein Vampir!«, rief Charles Godwin aus. Der Deutschprofessor war an diesem Abend ebenso zu Jason Montgomery gekommen wie auch Gene Courtemarch, der alternde kreolische Doktor, und der junge Master Robert Canady, der Jasons schöne Tochter so sehr verehrte.
Canady war neu in dieser Runde – ein »Ungläubiger«. Godwin und Courtemarch hatten bereits einige Erfahrung mit Phänomenen aus dem Reich der Finsternis. Viele Jahre lang hatten sie nachts bei Montgomery gewacht. Die schöne Marie war längst verschieden, doch die Dunkelheit war geblieben – sie würde immer bleiben, und deshalb war Magdalena in Gefahr.
»Jawohl, das glaube ich«, erklärte Jason, erschöpft vor Kummer und Pein. Bald nachdem Magdalena auf ihr Zimmer gegangen war, hatte er nach seinen Freunden geschickt. Er hatte das Böse schon immer gefürchtet und gewusst, dass es existierte. Sie hatten alle gewartet und beobachtet und gebetet, dass es nicht kommen möge. Und nun ...
»Wir müssen bei Tagesanbruch zuschlagen«, sagte Courtemarch. »Dann finden wir die Wahrheit vielleicht heraus.«
»Gentlemen«, erklärte Robert Canady mit fester Stimme, »ich kann dieses verrückte und übereilte Vorgehen nicht gutheißen. Sie werden uns alle hängen, einen nach dem anderen! Und auch wenn ich für Ihre Tochter frohen Herzens sterben würde, Jason, möchte ich doch, dass mein Tod ihr etwas Gutes bringt. Der Comte ist neu hier in der Gegend, er ist mysteriös, wenn Sie so wollen, aber er hat sich noch bei jeder Gelegenheit als Gentleman erwiesen ...«
»Sind Sie übergeschnappt, junger Mann?« Godwin, der Professor mit dem weißen Haar und dem weißen Schnurrbart, tobte. »Er nimmt sich die Frau, die Sie lieben!«
Robert atmete langsam aus. »Gott sei mir gnädig, ja, ich liebe sie! Aber ich kann nicht einen Mann ermorden, nur weil er die Frau liebt, die ich haben will – und dann auch noch erwarten, dass sie meine Liebe erwidert.«
»Begreifen Sie denn nicht?«, rief Jason Montgomery zornig.
Schwere Schritte eilten die Treppe herunter und unterbrachen die Runde.
»Mr. Montgomery, Mr. Montgomery!«, schrie Tyrone. »Sie hat uns ausgetrickst, Sir!«
»Ausgetrickst?«
»Sie hat die Decke über die Kissen gelegt. Sie ist fort.«
»Fort?«, keuchte Jason.
»Hinterher!«, rief Godwin. »Hinter ihr her! Tyrone, es ist so weit. Bring die Pfähle, bring die Schwerter, schnell! Gott steh uns bei, dass wir noch rechtzeitig kommen!«
»Gentlemen! Selbst wenn sie sich dafür entscheidet, ihn zu lieben – wir können deshalb nicht einen Mord begehen!«, versuchte Robert Canady vergeblich, die anderen drei zur Vernunft zu bewegen. Herr im Himmel, merkten denn diese alten Narren nicht, worauf sie sich einließen? Niemanden schmerzte dieser Verrat mehr als ihn. Er liebte sie, er begehrte sie. Sie hätte seine Frau werden sollen. Dieser Schmerz war wie ein Messer, das wieder und wieder in der Wunde gedreht wurde. Doch sie liebte den Franzosen.
»Verdammt, Robert!«, fauchte Jason. »Sie hören einfach nicht zu!«
»Auf einen Haufen alter Narren ...«
»Auf den Wind! Auf den Mond, den Nebel, das Geräusch der Brandung! Haben Sie mal nach oben gesehen? Der Himmel weint blutige Tränen. Aber Sie begreifen das einfach nicht.«
»Und das müssen Sie!«, behauptete Godwin.
»Bei der Liebe Gottes, das müssen Sie!«, pflichtete Courtemarch bei.
»Er ist ...«, begann Jason.
»Ein Vampir!«, beendete Courtemarch seinen Satz. »Bei allem, was Ihnen heilig ist, das müssen Sie doch erkennen! Magdalenas Geliebter ist ein Vampir!«
Ihr Geliebter beugte sich über sie, setzte sich rittlings auf sie. Geschmeidig, kraftvoll, schön, dachte sie. Seine Gesichtszüge sind so maskulin, so klar und harmonisch, die Augen so dunkel ... Ein seltsames Feuer schien darin zu leuchten.
»Vampir«, sagte er sehr leise.
Zuerst lächelte sie ein wenig. Dann schüttelte sie den Kopf. »Nein. Irgendjemand hat dir eingeredet, dass du böse bist.«
»Ich bin ein Geschöpf der Finsternis, der Nacht«, beharrte er.
Ein Schauder durchlief sie. Er betrachtete sie so ernst. Und er zitterte, als er ihr Gesicht berührte. »Vielleicht kann deine Liebe mich befreien; so verspricht es die Legende. Und ich liebe dich so sehr! Als hätte ich hundert Jahre lang darauf gewartet, dein Flüstern zu hören, deinen Liebreiz zu schmecken. Versteh doch, dass ich Angst habe – Angst davor, dass die Legende eine Lüge sein könnte, dass das Versprechen falsch ist. Ich könnte es nicht ertragen, dir wehzu...«
»Liebster, hör auf!« Sie setzte sich auf und presste einen Finger auf seine Lippen. »Du kannst nicht böse sein, du kannst es nicht! Ich glaube das nicht und werde es niemals glauben!« Sie schob ihn von sich, ging auf die Knie und schmiegte sich an ihn, küsste sein Gesicht, seinen Hals, seine Brust. Ihre Finger gruben sich in sein Fleisch, und ein gequältes Stöhnen entstieg seiner Brust; wieder presste er sie an sich.
»Vielleicht bringe ich dir Höllenfeuer, Verdammnis ...«
»Dann bring es mir, mein Liebster, denn ich werde dich nicht verlassen. Ich könnte es nicht ertragen, dich zu verlassen! Sie werden mich nicht von dir fernhalten, was auch immer kommen mag!«
Was auch immer kommen mochte ...
Es war ihr gleichgültig. Mit seinem rauen Aufschrei war die Welt um sie herum vergessen, Magdalena umgeben von dem sinnlichen Satin, in das er sie drückte. Oh, guter Gott, seine erregende Berührung, leicht wie ein Hauch, ein Flüstern, und dann brennendes Verlangen. Seine harten, fordernden Arme. Seine Lippen, sie waren überall, drangen bis in ihr Herz. Trommelschläge pochten, wurden stärker, lauter. Ihr Blut kochte. Er berührte sie, bis sie schrie und stöhnte und versprach, ihn auf immer und ewig zu lieben. Dann legte er sich abrupt auf sie, starrte ihr in die Augen und drang in sie ein. Langsam. Sie schauderte ob des Schmerzes, hielt sich an ihm fest, begegnete seinem Blick, wand sich voller Verwunderung, selbst als der bohrende Schmerz noch stärker wurde ... und plötzlich nachließ. »Küss mich«, flüsterte sie.
Er senkte den Kopf, seine Lippen trafen ihre. Als er sich zu bewegen begann, kam das herrliche Pochen erneut. Er küsste sie mit offenem Mund. Seine Finger strichen durch ihr Haar, seine Lippen streiften über ihre Wange, nach unten, zu ihrem Hals.
Die Trommelschläge explodierten in ihr. Sie fühlte sich wie in einem magischen Höhenflug, wand sich in seltsamer Qual, begehrte mehr. Sie konnte es fast greifen, berühren, jedes Mal, wenn er sich bewegte.
Sie spürte seine Zähne an ihrem Hals. Ein scharfer, durchdringender kleiner Schmerz ...
Ein Schrei löste sich von ihren Lippen, und sie erschauderte, keuchte, zuckte. Schmerz und Lust waren vereint in einem Sturm köstlichster Empfindungen, so herrlich, dass sie samtene Schwärze sah, die Röte des Nachthimmels, einen Sternenschauer. Für Sekunden wurde alles schwarz, dann kehrten die Sterne zurück. Wie der Schmerz und die Lust.
Er war in ihren Körper eingedrungen, hatte ihn erobert. Hatte Verlangen, Leben, Blut daraus gesogen.
Vampir ... Er hatte es ihr gesagt.
Vampir ...
Wenn sie ihren Hals berührte, würde sie daran Blut finden. Bei Gott, vielleicht ...
Er ist nicht böse!, schrie ihr Herz. Oh Gott, sie spürte ihn noch immer, spürte das Wunder, die Erregung, die Erfüllung des Verlangens. Es überwältigte und schüttelte sie. Ein Schauder nach dem anderen ergriff sie. Sie spürte ihn, seinen Körper, und wie er ihr Leben und Leidenschaft spendete.
Sie wäre fast gestorben vor Lust, war in eine solche Ekstase verfallen, dass sie kurz ohnmächtig geworden war. Sie hatte sein sengendes Höllenfeuer geschmeckt, und es war unbegreiflich herrlich gewesen. Verzückung hatte sie so heftig ergriffen, dass sie vollkommen aufgelöst war. Seine geflüsterten Worte schienen sie noch immer zu umgeben, sein Gewicht und seine Stärke drückten sie nieder.
»Ich liebe dich!«, flüsterte sie.
Er setzte zu einer Erwiderung an. Sie sah seine ebenholzschwarzen Augen mit dem betörenden Funkeln, sein schönes Gesicht, sein Lächeln, das langsam um seinen sinnlichen Mund entstand ...
Dann war er stumm, still.
Totenstill.
Sekundenlang starrte sie verständnislos auf, und dann sah sie ihn, den zugespitzten Pfahl. Er war in seinen Rücken gestoßen worden und ragte aus der Brust. Ein roter Fleck entstand auf seinem Fleisch, und Blut troff auf sie herab.
»Vampir!«, schrie jemand.
Lautes, schrilles, hysterisches Kreischen löste sich aus ihrer Kehle. Alec sackte über ihr zusammen, doch im nächsten Augenblick zog ihn jemand in die Höhe. Aus dem Augenwinkel sah sie, wie er nach hinten gerissen wurde, sah das glänzende Schwert durch die Luft schwingen.
Sie enthaupteten ihn!
Intuitiv schloss sie die Augen.
Sie spürte, wie sein Blut sich warm und klebrig über sie ergoss, und begann erneut zu schreien.
Der Körper wurde von ihr heruntergezogen. Magdalena richtete sich ein wenig auf, bestürzt, schockiert, fassungslos. Sie sah, was geschehen war, ohne es im Mindesten begreifen zu können. Ihr Vater war hier, mit seinen seltsamen Freunden – mit dem weißhaarigen Godwin und dem großen, dürren Courtemarch. Und auch Robert war hier. Ernst und traurig betrachtete er sie; sein Herz lag in seinem Blick. Entschlossen streckte Robert den starken Arm nach ihr aus.
Es war ein Albtraum, es konnte nicht wahr sein. Doch sie spürte das Blut ihres Geliebten auf ihrer Brust – auch ihr eigenes, wie es aus der Wunde an ihrem Hals rann. Dies war zu entsetzlich, um es verstehen zu können. Vielleicht begriff sie es wirklich nicht. Und doch war das Blut Wirklichkeit.
So wirklich wie Alecs Tod.
»Magdalena. Magdalena!«, flüsterte Robert, zog den Gehrock aus, um ihn ihr umzulegen, und schloss sie dann in seine Arme. Ihr war kalt, so bitterkalt, doch sie konnte seinen Trost nicht annehmen. Sie schrie und schrie. Er umfasste sie noch fester.
»Sie ist jetzt auch ein Vampir!«, beharrte Godwin, die Hände fest um den Griff des Schwerts gelegt.
»Lasst sie in Ruhe!«, schrie Robert heiser, wild entschlossen. »Der Teufel soll euch holen, was wollt ihr ihr noch antun?«, brüllte er mit einer Stimme, die so mächtig klang wie das Geräusch tosenden Wassers.
»Sie ist meine Tochter, sie ist nicht tot, und sie ist kein Vampir, ich kann sie heilen!«, rief Jason.
Sie heilen ...
Nichts und niemand würde sie heilen können. Nicht nach dieser Nacht. Sie hatte die Liebe kennengelernt, und nun nannten sie ihren Geliebten ein Monster. Dort lag er, tot, blutüberströmt, den Kopf vom Rumpf getrennt. Sie hatten ihn ermordet, und dieser schreckliche kleine Mann, Godwin, gedachte mit seinem Schwert auch ihr den Kopf abzuschlagen, sobald Courtemarch sie mit einem seiner Pfähle durchbohrt hatte. Sie wusste nicht, ob es ihr etwas ausmachte oder nicht. Sie hatte einen so immensen Zauber kennengelernt, und nun war dieser Zauber tot. Das Leben spielte keine Rolle mehr ...
Und in der Tat schien sie das Leben zu verlassen, fortzurinnen mit dem Blut, das langsam ihren Hals hinunterlief. Das war gut. Sie fühlte nichts mehr. Nur noch Taubheit. Nur der Tod konnte die schreckliche Qual lindern. Sie versuchte, sich aufzurichten, sich von Robert zu lösen, ihren Geliebten ein letztes Mal zu sehen. Doch ihr Vater trat an ihre Seite und hielt sie fest. »Nein, Magdalena!«, flüsterte er.
Aber sie konnte es sehen.
Oh Gott.
Es war kein Leichnam da. Kein Toter.
Kein Körper, kein Blut. Wo ihr Geliebter liegen sollte, schien der Boden verbrannt; nur schwarze Asche in der Kontur eines geflügelten Wesens war zurückgeblieben.
Wieder begann sie zu schreien.
Ihr Schrei verklang, und mit ihm die Welt.
»Sie ist gestorben, sie wird eines dieser Geschöpfe!«, erklärte Godwin mit voller Überzeugung.
»Sie schläft!«, protestierte Jason.
»Den Schlaf des Todes.«
»Sie schläft!«, donnerte Robert Canady.
»Den Schlaf des Lebens! Sie ist mein Kind, mein Fleisch und Blut, und ich werde sie heilen!«
Jason entriss sie Robert und legte seine Arme schützend um sie, trug sie fort. Er verließ die Villa, die der Mond in Rot getaucht hatte. Er stolperte, fiel beinahe, fing sich schnell wieder und trug sie weiter. Das blutrote Licht des Mondes schien ihn zu blenden.
Als er jedoch aufblickte, bemerkte er, dass der Mond bereits verblasste.
Es war ein erster roter Sonnenstrahl, der seine Augen plagte.
Die Sonne. Das Licht des Tages kehrte wieder.
Er rannte zu seiner Kutsche.
***
Sie lag in einer seltsamen, eisigen Welt voller Dunkelheit. Sie wusste, dass sie gegen die Empfindung absoluter Schwärze und Kälte ankämpfen sollte, die sich über sie legte wie ein schauerliches Tuch. Man rief ihren Namen, doch die Stimmen schienen unendlich fern. Von irgendwoher kam ein schwacher Lichtstrahl, aber sie meinte, ihn nicht erreichen zu können. Jemand hielt sie fest. Sie wollte aufschreien, wollte das Licht erreichen und konnte es nicht. Lasst mich gehen!, dachte sie. Aber es war eine lautlose Bitte in dem unendlichen Dunkel, in der Leere, in der Einsamkeit jenseits des Todes ...
Wieder spürte sie eine Empfindung. Wie seltsam. Sie dachte, die Kälte, die sie überkommen hatte, würde nie mehr verschwinden, und doch umgab sie eine Art Wärme, etwas, das der bis in die Knochen dringenden Kälte entgegenstand. Sogar die Schwärze war anders; sie war mit Grautönen vermischt.
Zeit, dachte sie vage.
Zeit.
Schatten, Licht, Dunkel, Schatten, Licht, Dunkel ...
Die Nächte ... sie kamen und gingen.
Schließlich kam der Moment, in dem sie die Hände ihres Vaters spürte und wusste, dass er bei ihr war. Sie spürte etwas Flüssiges, Warmes durch ihre Kehle strömen. Sie spürte, ja, sie fühlte, sie fühlte, dass diese Dinge wirklich waren, wahrhaftig.
Zeit ...
Die Zeit verstrich jetzt leichter. Magdalena wurde kräftiger. Sie konnte den Kopf anheben. Spürte die Tasse, aus der sie trank, berührte die Finger ihres Vaters. Sie lag in ihrem Bett, von weichen Kissen und Decken umgeben. Kerzenlicht flackerte, berührte sanft ihren Blick. Sie trank und trank, ohne zu wissen, was er ihr eingeflößt hatte, während sie so krank gewesen war, welche Wärme es war, die sie aus der Kälte zurückgeholt hatte.
Schließlich fand sie die Kraft zu fragen.
»Was ist das?«, flüsterte sie. »Was trinke ich da?«
»Blut«, antwortete Jason unumwunden.
Sie drehte das Gesicht in die Kissen und weinte, doch es kamen keine Tränen.
»Bei der Liebe des Allmächtigen, Vater!«, wisperte sie.
»Nein«, entgegnete er leise, »aus Liebe zu meinem Kind. Still jetzt. Schlaf!«
Ihre Augen schlossen sich wieder. Sie lag in einem Elend, das schlimmer war als der Tod.
Aber mit der Zeit schlief sie, wie er es befohlen hatte.
Jason stand schweren Herzens auf und zog ihr die Decke
bis über die Schultern. Sie brauchte diese Wärme so sehr.
Er ging nach unten, wo seine Freunde warteten, trat vor den Kamin und begegnete ihren fragenden Blicken.
Er wählte seine Worte sehr sorgfältig.
»Ich glaube, dass sie am Leben bleibt«, sagte er sehr leise. Dann zögerte er, seine Fingerknöchel waren weiß, und er betete, dass er mit dem, was er nun sagte, das Richtige tat. Er atmete tief ein. »Und ich glaube, sie bekommt ein Kind.«
Kapitel 1
»Du lieber Himmel!«, keuchte Jack Delaney, drehte sich von der Leiche weg und geradewegs in die Arme seines Partners. Sein Gesicht war seltsam fahl und bleich. Er war ein gut aussehender, junger Polizist, gerade fünfundzwanzig geworden, etwa eins achtzig groß, mit hellbraunen Augen und rötlichen Haaren.
»Lasst unseren Neuen vorbei, Jungs, seid so gut«, sagte Sean Canady und stützte seinen jungen Partner für einen Moment.
»Alles in Ordnung mit dir?«, fragte er ihn, so leise, dass niemand außer Jack es hören konnte. Sean war älter und etwas größer als Jack, vierzig, ein breitschultriger und muskulöser Typ, eine beeindruckende Erscheinung mit pechschwarzem Haar und scharfen, dunkelblauen Augen. Normalerweise hielt er seine Gefühle unter Verschluss und reagierte seinen Frust im Fitnessstudio ab.
Jack atmete tief durch. Er war froh über die Verschnaufpause. Sean gab ihm Kraft; er nickte, wohl wissend, dass sich der Spott der anderen in Grenzen halten würde, weil er unter Seans Fittichen stand.
»Alles bestens«, sagte Jack.
Sean nickte. »Macht mal Platz hier, Leute. Delaney befragt die Nachbarn. Und stellt sicher, dass wir genügend Männer haben, die die Straßen durchkämmen! Irgendjemand muss schließlich etwas gesehen haben«, erklärte Sean ruhig und stellte sicher, dass sein Partner durch die Reihen von Polizisten kam, die in Regenkleidung das enge Straßenstück überwachten, in dem die Leiche gefunden worden war. Das gesamte Areal war inzwischen mit gelbem Absperrband umgeben. Jack war am Tatort angekommen, kurz bevor Sean die Leiche zu Gesicht bekommen und sich ebenfalls erst einmal weggedreht hatte. Er war neu in der Mordkommission und überhaupt erst seit wenigen Jahren im Polizeidienst: ein junger Ire, den man Sean seiner Herkunft wegen anvertraut hatte. Das waren jedenfalls die Worte von Captain Daniels gewesen. Man solle die »hicks« zusammenstecken, hatte er gemeint. Sean hatte seine irischen Wurzeln nie geleugnet, doch der Mann, der den Namen Canady einst nach New Orleans gebracht hatte, hatte dies bereits vor fast zweihundert Jahren getan. In der Zwischenzeit war viel passiert – Sean selbst war eine Mischung, wie sie für diese Stadt typisch war: Er hatte französische und englische Vorfahren, dazu Cajuns und wer weiß was sonst noch alles. Wahrscheinlich fehlte bei ihm auch nicht ein Schuss karibisches Blut. Aber was spielte das schon für eine Rolle? Sean mochte Jack Delaney, und er wusste, dass auch der Captain ihn gut leiden konnte. Deshalb hatte er Delaney als Partner bekommen.
»Macht Platz für den Neuen!«, rief jemand, und Jack trat auf die andere Seite der Absperrung. Auch wenn er das Gegenteil behauptet hatte – Sean war sich sicher, dass Jack übel geworden war.
»Junge, Junge, das ist wirklich ein harter Anblick«, meinte einer der Streifenpolizisten, und Sean war froh zu sehen, dass die Männer es gut mit Jack meinten.
Eigentlich gab es so etwas wie eine gute Leiche nach einem Mord nicht. Aber manche waren eben schlimmer zugerichtet als andere.
Sean ging zu Pierre LePont hinüber, der sich über den Toten beugte und ihn eingehend betrachtete. Er kauerte neben dem Gerichtsmediziner nieder, der sich gerade mit den Fingern des Opfers beschäftigte, nickte ihm zu und richtete seine Aufmerksamkeit dann ebenfalls auf die Leiche.
Anders als Jack hatte Sean schon genug Tote zu sehen bekommen. Eigentlich waren es zu viele: Körper, die der Mississippi angeschwemmt hatte, menschliche Überreste, die kaum mehr als solche zu erkennen waren; das »Frischfleisch« – eben erst Ermordete, aus denen noch das Blut auf den Gehsteig rann. Und natürlich die Leiche, die so lange irgendwo verborgen geblieben war, bis der unerträgliche Verwesungsgeruch half, sie aufzufinden – oder die gar so lange versteckt gelegen hatte, dass außer Knochen nichts mehr da war.
Und dennoch war an dieser Leiche etwas seltsam.
Der Mann war noch nicht lange tot – hier, gleich an der Bourbon Street, konnte er nicht allzu lange so dagelegen haben. Die Geschäfte hatten gerade geöffnet, es war kurz nach neun. Er war vermutlich kurz vor Tagesanbruch ermordet worden. Oft schliefen Obdachlose auf der Straße; vielleicht hatte man ihn deshalb nicht eher bemerkt. Er war auch nicht übel zugerichtet – keine Blutlache auf dem Gehsteig, kein Hirn, das an die Mauer des Geschäfts gespritzt wäre, vor dem er lag. Der Kerl war einfach nur weiß – bis auf die rote Linie, die rund um den Hals verlief. Er war nicht blass, fahl oder grau. Nein, er war weiß – weiß wie ein Leichentuch, fast wie eine Karikatur des Lebens. Das Schreckliche – sicherlich das, was Jack ganz grün im Gesicht hatte werden lassen – war, dass er die Augen weit aufgerissen hatte, und diese Augen schienen maßloses Entsetzen widerzuspiegeln. Der Blick war von einem solchen Grauen erfüllt, dass Sean den Drang verspürte, sich umzudrehen, um zu sehen, was diese Augen in ihren letzten Momenten gesehen hatten.
»Mein Gott«, keuchte er.
»Mhm«, brummte Pierre zustimmend. »Willst du wissen, was wirklich witzig ist?«
»Ist hier irgendetwas witzig?«
Pierre schnitt eine Grimasse. »Na ja, sagen wir mal: merkwürdig. Es hat kein Kampf stattgefunden. Der Kerl hatte Angst, und zwar so sehr, dass er womöglich schon allein daran gestorben ist. Aber er hat sich nicht gewehrt. Ich muss zwar noch ein paar Tests durchführen und kann deshalb jetzt noch nichts Definitives sagen, aber anscheinend hat er nicht einen Finger gerührt, um seinen Angreifer abzuwehren.«
»Du meinst, er starb aus Furcht?«
»Herzstillstand, ja, das wäre theoretisch möglich – aber hier liegt kein Herzstillstand vor.«
»Nicht? Was war dann die Todesursache? Die Wunde am Hals?« Sean schüttelte schon den Kopf, noch während er die Frage stellte. Eine Halswunde hätte tödlich sein können, wenn der Gehsteig voller Blut gewesen wäre. Aber so wie es aussah, ohne jegliches Blut, musste die Wunde am Hals dem Opfer nach Eintritt des Todes beigebracht worden sein.
Auch Pierre, ein schlanker, kleiner Mann mit schütterem Haar – einer der besten seiner Zunft –, schüttelte den Kopf. »Weit und breit kein Blut – und es ist übrigens nicht nur eine kleine Wunde am Hals. Der Bursche wurde enthauptet.« Er bewegte den Kopf des Toten nur ein wenig, um Sean zu zeigen, dass er vollständig vom Rumpf abgetrennt war.
Sean drehte sich der Magen um.
Er holte sein Notizheft heraus. »Wie alt ist er? Ende zwanzig?«
Mike Hays, ein weiterer Beamter, trat zu den beiden Männern.
»Sein Name ist Anthony Beale, Lieutenant Canady. Wohnhaft in New Orleans, neunundzwanzig Jahre alt. Vorbestraft, aber lediglich ein kleiner Fisch. Fünf Verhaftungen – drei wegen Raubes, ein Einbruch, einmal Zuhälterei. Nur für einen der Raubüberfälle hat er gesessen – achtzehn Monate. Wovon er gelebt hat, weiß kein Mensch. Aber schlecht ging es ihm anscheinend nicht. Immerhin steckt er in einem Armani-Anzug.«
»Armani, ja?«, fragte Sean achselzuckend. Es gab nicht sonderlich viele Obdachlose, die in solchen Klamotten herumliefen.
»Ja, hübscher Anzug«, kommentierte Pierre trocken.
»Hey, Sean, ich brauche noch ein paar Bilder«, rief Bill Smith, der Polizeifotograf, ihnen zu.
Sean und Pierre traten gehorsam zur Seite.
Sean sah die Straße hinunter. Sie befand sich in einem netten Teil des Vieux Carré, dem berühmten French Quarter von New Orleans – wenn man denn eine Straße mit Dutzenden Sexshops als nett bezeichnen konnte. Auf dieser Höhe gab es jedoch nur Geschäfte und Wohnungen. Ein Stück weiter befanden sich zwei teure Hotels für Touristen; hier aber war die Straße von Läden mit Kunsthandwerk, Antiquitätengeschäften und Boutiquen mit schön dekorierten Schaufenstern gesäumt. Sean trat zurück. In den Fenstern über den Geschäften hingen Reklametafeln für Büroflächen, Tanzstudios, ein Fitness- und ein Sonnenstudio – eine der für das French Quarter typischen Straßen also, die dieses Viertel auf der ganzen Welt berühmt gemacht hatten: schöne Gebäude mit Bogenfenstern, schmiedeeisernen Balkonen, Pfeilern, Säulen und anderen charakteristischen Details.
Sean starrte wieder auf die Leiche am Boden. New Orleans, seine Stadt. Er liebte sie. Er war hier geboren, mitten in der Altstadt, ja tatsächlich in der Empfangshalle eines der schönen, alten Hotels – seine Mutter hatte nicht unnötig früh über Wehenschmerzen klagen wollen. Zum Studieren war er weggegangen, er wollte die Welt sehen, und dann war er wieder zurückgekommen. Diese Stadt hatte einfach etwas Besonderes. Seine Heimatstadt. Kein Ort, der frei von Verbrechen war. Sie war unanständig, aufgetakelt, sie war Jazz und Schönheit und die dunklen Wasser des mächtigen Mississippi. Sie war die Stadt der Crawfish-Etouffées – schlichtweg das beste Essen der Welt – und die Stadt der Spuk- und Geistergeschichten, der Voodoo-Queens und vieler anderer Dinge. New Orleans hatte mit denselben Problemen zu kämpfen, die heutzutage jede Großstadt heimsuchten – Drogen, Kriminalität, Obdachlosigkeit, Inflation, Arbeitslosigkeit. Manche nannten sie die Stadt des Bösen, die Stadt der Verdammten. Nun, das mochte sie sein, aber sie war seine Stadt, seine Stadt der Verdammten. Und was immer er tun konnte, um seine Stadt vor dem Zugriff der Hölle zu bewahren, würde er auch tun.
Dies hier schien ein Routinefall zu sein. Anthony Beale, ein kleiner Ganove, ein aufstrebender Zuhälter. Hatte sich wohl mit einem größeren Fisch angelegt und dabei den Kürzeren gezogen. Ein böser Mensch, den ein böses Ende ereilt hatte. Garantiert ein Fall, der bald zu den Akten gelegt würde.
»Irgendwie erinnert der mich an die Leiche vom Friedhof«, meinte Pierre plötzlich, und im selben Moment hatte Sean denselben Gedanken.
»Aber das war eine Frau«, wandte er ein. »Und sie war zerstückelt.« Eine Beschreibung, die man als Untertreibung bezeichnen musste. Die Unbekannte, eine Weiße, fünfundzwanzig bis dreißig Jahre alt, eins fünfundsechzig groß, etwa siebenundfünfzig Kilo schwer, war erst letzte Woche auf einem der alten Friedhöfe mit oberirdisch angelegten Gräbern außerhalb des French Quarter gefunden worden. Sie hatte auf einem Grab gelegen, nackt und mit aufgeschlitztem Bauch, fast als hätte ein moderner Jack the Ripper sich über sie hergemacht. Einzelne Körperteile und innere Organe waren sorgfältig neben die Leiche drapiert worden. Dieser Mord hatte die ganze Stadt in Schrecken versetzt; er war noch immer das Gesprächsthema Nummer eins bei Einheimischen wie Touristen. Natürlich führte ein solches Verbrechen – ohne einen festgenommenen Verdächtigen – zu wilden Spekulationen und schürte zahllose Ängste.
»So ein Gemetzel und fast kein Blut«, sagte Pierre niedergeschlagen. Er meinte die Unbekannte.
»Enthauptet«, fuhr Sean fort und pfiff leise durch die Zähne. »Vielleicht gibt es zwischen den beiden Morden einen Zusammenhang.«
»Eine Prostituierte und ein Zuhälter«, stimmte Pierre zu. »Wir müssen beten, dass es nur einen in der Stadt gibt, der übel genug ist, um solche Dinge zu tun. Schaffen wir den Kerl da in die Gerichtsmedizin, dann werden wir sehen, was ich noch alles finde.«
»Ist unsere Unbekannte noch im Kühlraum?«, fragte Sean.
Pierre nickte. »Ja, sie weilt noch unter uns.«
»Vielleicht sehen wir uns die beiden nebeneinander an und stecken dann mal die Köpfe zusammen.«
»Sicher«, stimmte Pierre achselzuckend zu. »Wir könnten auch ihre Köpfe zusammenbringen«, fuhr er gelassen fort. »Eines kann ich dir übrigens jetzt schon sagen.«
»Nämlich?«
»Unser Mörder ist Linkshänder.«
»Was?«
Er drehte den Kopf der Leiche ein Stück. »Siehst du, wie die Kehle durchtrennt ist? Von rechts nach links. Und es muss ein extrem scharfes Messer gewesen sein, das mit großer Kraft geführt wurde. Einen Kopf vom Körper eines Menschen abzutrennen ist gar nicht so leicht.«
»Gut zu wissen«, kommentierte Sean.
Pierre nickte, und die beiden richteten sich auf. »Gentlemen, sind wir hier fertig?«, fragte er Bill Smith und die anderen Polizisten. »Kann ich den Kerl ins Leichenschauhaus bringen?
»Sean ist hier der Boss«, meinte Bill. »Aber ich habe alle Bilder, die ich brauche, Sean. Wenn du so weit bist, kann LePont meinetwegen die Leiche haben.«
»Okay, dann gehört er dir, Pierre«, erklärte Sean.
Auf ein Zeichen LePonts hin brachten seine Mitarbeiter einen Leichensack. »Komm in ein paar Stunden bei mir vorbei, dann kann ich dir schon einiges mehr sagen.«
»Danke«, sagte Sean.
»An einem Tag wie diesem bin ich froh, dass ich nur der Fotograf bin«, meinte Bill.
Sean zog eine Augenbraue nach oben. »Hast du denn hübsche Bilder gemacht?«, fragte er skeptisch.
Bill schüttelte den Kopf. »Diese Bilder verfolgen dich. Sie bleiben dir im Gedächtnis. Manchmal wache ich mitten in der Nacht auf und sehe sie vor mir. Aber wenigstens muss ich nicht den Verrückten finden, der das angerichtet hat.«
»Den Verrückten?«, wiederholte Sean nachdenklich. »Als einen Verrückten habe ich mir unseren Täter ehrlich gesagt noch gar nicht vorgestellt.«
Bill blickte ihn ungläubig an. »Du meinst also, jemand, der normal ist, könnte so etwas tun?«
Sean zuckte die Achseln. »Was ist schon normal. Mein erster Gedanke war, dass dieser Typ hier einer größeren Nummer in die Quere gekommen ist. Das sieht nach einem sehr überlegten, planmäßigen Mord aus. Einen Kopf abzutrennen ist keine leichte Sache – das hat mir Pierre eben versichert –, und dieser Kopf ist nicht einfach nur abgetrennt, sondern es ist dabei auch noch absolut akkurat gearbeitet worden. Kein Blut, obwohl hier eigentlich jede Menge sein müsste. Man sollte meinen, dass der Mann woanders getötet und dann hierher geschafft wurde. Der Kopf wurde abgeschnitten und dann wieder so präzise aufgesetzt, dass ich es gar nicht bemerkt habe, bis Pierre mich darauf hinwies. Also, hier wurde mit System und Überlegung vorgegangen.«
»Verrückte arbeiten durchaus mit System und Überlegung«, meinte Bill. »Das hast du mir selbst gesagt, nach deinem Kurs über Serienkiller an der Akademie in Quantico, weißt du noch?«, erinnerte ihn Bill.
»Ich weiß vielmehr, dass wir nicht nach jemand Auffälligem suchen sollten – einem verrückten Leichenschänder oder dergleichen, der die Stadt heimsucht.«
»Diese Sache macht mir verdammt Angst. Direkt an der Bourbon Street!« Bill schüttelte angewidert den Kopf und fuhr im Flüsterton fort: »Bei dem Mädchen vom Friedhof war auch der Kopf abgetrennt!«
»Ja, ich weiß.«
»Vergiss nicht«, sagte Bill, »Jack the Ripper war, was Körperteile anbelangt, angeblich auch sehr methodisch!«
»Serienkiller kann man als methodische oder desorganisierte Täter einstufen oder auch als eine Kombination von beidem«, murmelte Sean vor sich hin. »Ein Mord wie dieser – eine Hinrichtung – ist normalerweise geplant und wird ordentlich ausgeführt. Das Ziel ist zwar immer der Tod des Opfers. Aber für manche Killer ist das wirklich Wichtige, was dem Tod vorausgeht. Bei Jack the Ripper waren die Körperteile mit Blut besudelt«, sinnierte Sean. »Zumindest einige.«
»Wie gesagt, Bilder zu schießen ist leichter, als so einen Verrückten zu erwischen.« Wieder senkte Bill die Stimme. »Den hier musst du bald fassen, Kumpel. Meine Frau stirbt schier vor Angst. Hast du die Schlagzeilen gelesen? Nicht nur die in der Times-Picayune. Der Friedhofsmord ist so spektakulär, dass er landesweit Furore macht!«
Sean seufzte schwer. Ja, er wusste Bescheid. Der Mord auf dem Friedhof war entsetzlich gewesen, sensationell, und zugegebenermaßen hatte er Ähnlichkeiten mit den Taten von Jack the Ripper. Die ganze Welt betrachtete ihn als ein barbarisches und furchterregendes Ereignis. Was die Welt jedoch nicht sah, war, dass die Polizei einfach nichts hatte, woran sie sich entlanghangeln konnte. Die junge Frau hatte sich nicht gewehrt – unter ihren Fingernägeln war nicht ein einziges Hautpartikel eines anderen Menschen gefunden worden, an ihrem Körper nicht ein Haar, nicht eine Faser. Sie hatte vor ihrem Tod Sex gehabt, Pierre zufolge lag jedoch keine Vergewaltigung vor. Man hatte Sperma gefunden, aber die Datenbank hatte keine Übereinstimmung geliefert. Das FBI hatte eine DNA-Analyse angefordert, doch die Resultate würden erst in Tagen oder gar Wochen vorliegen, und Sean befürchtete nun, dass der Mörder erneut zuschlagen würde, ehe die Rechtsmedizin ihnen weiterhelfen konnte.
Das Grab, auf dem die Prostituierte entdeckt wurde, war mit Fingerabdrücken und Fußspuren übersät gewesen. Aber nichts, womit man etwas hätte anfangen können, abgesehen von der mitleiderregenden und unbetrauerten Leiche einer Hure, von der noch nicht einmal der Name bekannt war.
»Ein Serienkiller, wie du gesagt hast«, meinte Bill.
Dieses unangenehme Gefühl hatte auch Sean. »Das habe ich nicht ausdrücklich gesagt. Dazu wissen wir noch zu wenig.«
Zwei enthauptete Leichen. Eine Verbindung erschien mehr als wahrscheinlich.
»Hey, mich macht das auch nicht gerade glücklich.«
»Bill, wir wissen noch gar nichts mit Sicherheit. Es gibt hier immer noch Unterschiede. Sobald wir von Pierre mehr nachprüfbare Informationen haben ...«
»Sean, du bist doch kein Cop, der sich streng ans Lehrbuch hält. Du gehst nach Gefühl vor. Genau deshalb bist du so ein guter Cop. Und du weißt, dass diese Morde anders sind.«
»Wir müssen trotzdem aufpassen, was wir den Medien sagen«, mahnte Sean. »Sonst wird man sich in New Orleans über diesen hier noch mächtig aufregen.« Über Bills Schulter hinweg sah er Jack zurückkommen und brachte ein Lächeln zustande. »Da kommt ja mein Junge wieder. Ich werde mit ihm zusammen die Nachbarschaft befragen. Vielleicht hat ja jemand etwas gesehen. Wir sehen uns dann später, Bill. Und denk daran: kein großes Aufsehen über das hier, klar?«
Bill nickte bedrückt. »Klar.«
Sean ging Jack entgegen, der noch immer aschfahl im Gesicht war, aber doch zunehmend entspannt aussah – und schrecklich verlegen. »Diese Augen waren es«, sagte er. »Ich hab ihn angesehen und hatte sofort das Gefühl, wenn ich mich umdrehe, dann sehe ich, was sich in seinem Blick spiegelt – was für ein Ungeheuer ihm das angetan hat.«
»Schon in Ordnung, Jack. Ich habe mehr Leichen gesehen, als mir lieb ist, aber der hier geht uns allen an die Nieren. Hast du auf der Straße irgendetwas herausbekommen?«
Jack nickte. »Mit Leichen mag ich ja meine Probleme haben, aber ich habe etwas entdeckt, das dich interessieren könnte – und vielleicht stellt es auch meine Würde wieder ein wenig her.«
»Deine Würde hat nicht im Geringsten gelitten, Jack, aber jede Entdeckung macht mich neugierig. Was ist es?«
»Komm mit«, sagte Jack.
Interessiert und voller Hoffnung folgte Sean ihm.
Maggie Montgomery schaute aus dem Fenster ihres Büros im ersten Stock. Von hier aus konnte sie den von der Polizei abgeriegelten Straßenabschnitt gut überblicken. Sie beobachtete die vielen Beamten diesseits und die Passanten jenseits der Absperrung, und ein leichter Schauer lief ihr über den Rücken. Nicht dass New Orleans eine Stadt ohne Kriminalität wäre – nein, sie war alles andere als das, besonders im Vieux Carré. Aber dies hier sah aus wie etwas fern aller Normen. Raubüberfälle waren an der Tagesordnung; die Geschäftsinhaber und Hotelmanager empfahlen den Touristen, bestimmte Straßen zu meiden. New Orleans war von der Drogenkriminalität ebenso betroffen wie der Rest des Landes, und dass illegale Freuden, fleischlicher wie sonstiger Art, überall käuflich waren, war nicht zu leugnen. Die Stadt hatte im Lauf der Jahre die unvorstellbarsten Morde erlebt, bis hin zu bizarren, okkultistisch motivierten Tötungen. Und dennoch ...
»Ein Toter!«, sagte Angie Taylor, Maggies rechte Hand, und ihre Stimme schwankte dabei zwischen Furcht und Faszination, als sie mit einer Tasse Kaffee in der Hand ins Büro ihrer Chefin rauschte. »Ermordet«, fügte sie langsam hinzu. Angie war trotz ihrer Größe von maximal eins sechsundsechzig – und das mit ihren höchsten Stöckelschuhen – ein schieres Energiebündel und hatte eine hinreißende Figur. Ihre Vorfahren waren Cajuns. Sie hatte deren üppiges, dunkles Haar geerbt und die riesigen gefühlvollen, sinnlichen Augen. Sie verfügte über eine überschäumende Lust am Leben, und sie war Maggies beste Freundin und die kompetenteste Assistentin der Welt.
»Hier sind schon häufiger Morde geschehen«, murmelte Maggie stirnrunzelnd, während sie versuchte, durch die Menschenmenge zu blicken. Viel konnte man jedoch auch von diesem erhöhten Standort aus nicht erkennen. Der Tote lag, in einen Leichensack gehüllt, auf einer fahrbaren Krankentrage und wurde gerade zum Sanitätswagen geschoben, der ihn in die Rechtsmedizin bringen würde. Die Menge löste sich langsam auf. Innerhalb der Absperrung arbeiteten allerdings noch immer Beamte: Spezialisten, Techniker und einige mehr.