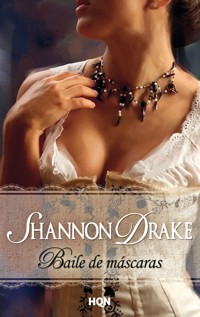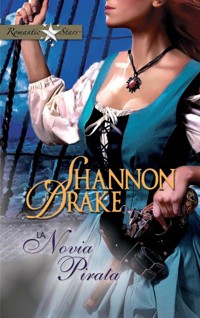4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Midnight Kiss
- Sprache: Deutsch
Denn die Liebe weckt eine leidenschaftliche Sehnsucht! Der Urban-Fantasy-Roman »Das Reich der Schatten« von Bestseller-Autorin Shannon Drake jetzt als eBook bei dotbooks. Ist es wirklich nur Neugierde, die die junge Grafikerin Tara Adair in die Katakomben einer Pariser Kirche treibt – oder wird sie von einer dunklen, unsterblichen Kraft gelockt, der sie nicht widerstehen kann? In den Tiefen der Krypta hört Tara den Todesschrei eines Mannes und gerät mitten hinein in einen uralten Kampf. Doch Tara weigert sich, dem undurchsichtigen Fremden Brent Malone zu glauben, dass eine überirdische Macht sie bedroht. Als sie hinter Brents Geheimnis kommt, muss Tara sich entscheiden, ob sie an seiner Seite gegen die Schatten des Bösen kämpfen wird, um ihre wahre Bestimmung zu erfüllen … New-York-Times-Bestseller-Autorin Shannon Drake bietet in ihren Erotic-Fantasy-Romanen alles, was die Fans dieses Genres lieben! »Die Autorin kombiniert Mystery mit knisternder Romantik.« Publishers Weekly »Eine unglaubliche Geschichtenerzählerin.« Los Angeles Daily News Jetzt als eBook kaufen und genießen: Der Urban-Fantasy-Roman »Blutrote Nacht« von Shannon Drake. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 562
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Über dieses Buch:
Ist es wirklich nur Neugierde, die die junge Grafikerin Tara Adair in die Katakomben einer Pariser Kirche treibt – oder wird sie von einer dunklen, unsterblichen Kraft gelockt, der sie nicht widerstehen kann? In den Tiefen der Krypta hört Tara den Todesschrei eines Mannes und gerät mitten hinein in einen uralten Kampf. Doch Tara weigert sich, dem undurchsichtigen Fremden Brent Malone zu glauben, dass eine überirdische Macht sie bedroht. Als sie hinter Brents Geheimnis kommt, muss Tara sich entscheiden, ob sie an seiner Seite gegen die Schatten des Bösen kämpfen wird, um ihre wahre Bestimmung zu erfüllen …
»Die Autorin kombiniert Mystery mit knisternder Romantik.« Publishers Weekly
»Eine unglaubliche Geschichtenerzählerin.« Los Angeles Daily News
Über die Autorin:
Hinter dem Pseudonym Shannon Drake verbirgt sich die New-York-Times-Bestseller-Autorin Heather Graham. Bereits 1982 veröffentlichte sie ihren ersten Roman. Seitdem hat sie über zweihundert weitere Romane und Novellen verfasst, die in über dreißig Sprachen übersetzt und mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet wurden. Sie lebt mit ihrem Mann und ihren fünf Kindern in Florida.
Von Shannon Drake erscheinen bei dotbooks ebenfalls:
Blutrote Nacht
Bei Anbruch der Dunkelheit
Verlockende Finsternis
Der Kuss der Dunkelheit
Unter ihrem Namen Heather Graham veröffentlicht sie bei dotbooks:
In den Händen des Highlanders
***
eBook-Neuausgabe März 2019
Dieses Buch erschien bereits 2008 unter dem Titel Reich der Schatten in der Verlagsgruppe Weltbild GmbH
Copyright © der amerikanischen Originalausgabe 2002 by Shannon Drake
Published by Arrangement with KENSINGTON PUBLISHING CORP., NEW YORK, NY 10018 USA
Die amerikanische Originalausgabe erschien 2002 unter dem Titel Realm of Shadows bei Zebra Books.
Copyright © der deutschen Ausgabe 2008 Verlagsgruppe Weltbild GmbH, Steinerne Furt, 86167 Augsburg
Copyright © der Neuausgabe 2019 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Dieses Werk wurde vermittelt durch die Literarische Agentur Thomas Schlück GmbH, 30161 Hannover
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/sakkmesterke und f11photo
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH (ca)
ISBN 978-3-96148-753-0
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort Das Reich der Schatten an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Shannon Drake
Das Reich der Schatten
Roman
Aus dem Amerikanischen von Angela Schumitz
dotbooks.
Für Moraima: ein riesiges Dankeschön für ihre Unterstützung.
Für Vanessa Molina, die so gerne singt. Ich wünsche ihr das Beste und glaube fest, dass sie es noch weit bringen wird.
Und für Sean Abreu, mit vielem Dank für die lustigen Stunden und den Tango!
Prolog
In den Schützengräben, DeutschlandSeptember 1944
Eine Granate explodierte, kaum drei Meter vor den Gräben. Obwohl die Männer schon viele Tage und Nächte in ihren Höllenlöchern verbracht hatten, fuhren einige heftig zusammen.
Andere rührten sich kaum.
Seit einer Woche hielten sie hier nun die Stellung und warteten auf Verstärkung. Immer wieder hatte es geheißen, dass Luftlandetruppen sie unterstützen würden, doch die hatten sich bislang nicht gezeigt. Manche Männer waren deshalb verbittert, Brandon Ericson aber zuckte nur wortlos die Schultern, wenn sie sich bei ihm beschwerten. Er glaubte fest daran, dass die versprochenen Truppen unterwegs waren.
Sie hatten sich nur noch nicht bis hierher durchgekämpft. Ericson hatte das unbestimmte Gefühl, dass man die Fallschirmspringer zwar planmäßig losgeschickt hatte, dass sich aber manche in den Bäumen verfangen hatten und andere abgeschossen worden waren, während sich ihre Fallschirme vor dem absurd blauen Himmel blähten. Manche waren wohl bei der Landung umgekommen, und manche darbten in den Gefangenenlagern des Feindes. Sie hatten es bestimmt nicht wegen eines Mangels an Zielstrebigkeit oder Tapferkeit nicht geschafft, sondern nur wegen der brutalen Entschlossenheit eines Gegners, der ganz Europa erobern wollte.
»Herr im Himmel, das war knapp!« Corporal Ted Myers bekreuzigte sich. Seine blassblauen Augen setzten sich leuchtend gegen den dunklen Schmutz auf seinem Gesicht ab. Neben ihm begann Jimmy Decker zu zittern, und aus dem Zittern wurde plötzlich ein richtiger Krampf. Jimmy warf sich gegen den Erdwall, der sie beschützte, und taumelte wieder zurück.
»Schafft ihn von der Front weg!«, befahl der Lieutenant ruhig. »Bringt ihn ins Lazarett.«
»Es gibt kein Lazarett mehr, Lieutenant«, erwiderte Sergeant Walowski, der an dem Erdwall lehnte. Nun glitt er in die Hocke und zog eine Zigarette aus der Tasche. »Ist gestern Nacht eingestürzt.«
»Die Ärzte haben doch bestimmt einen Notbehelf gezimmert. Myers, schaffen Sie Decker weg«, sagte der Lieutenant noch einmal. Er starrte auf das Terrain vor ihnen. Bald würde die Dämmerung einbrechen, doch bis dahin würden sicher noch weitere Granaten geworfen werden, und dann würde der Gegner direkt angreifen. Ein durchdrehender Soldat war hier nicht zu gebrauchen. Sie hatten die Stellung seit fast zwei Wochen unter widrigsten Umständen gehalten. Das war ihnen nur gelungen, weil die meisten Männer ausgezeichnete Schützen waren. Sie wichen keinen Millimeter, und von ihrer Position aus konnten sie angreifende Truppen hervorragend in Schach halten, selbst die bestens ausgebildeten deutschen Soldaten, die den Befehl hatten, sie zu vernichten.
Aber das konnte nicht ewig so weitergehen. Die feindlichen Soldaten – viele von ihnen Familienväter wie ihre französischen und amerikanischen Gegenspieler – hatten den Auftrag, ihrem Vaterland das Leben zu opfern, und zwar so viele Leben wie nötig. Nacht für Nacht waren neue Truppen geschickt worden. Selbst wenn auf jeden seiner Männer fünfzig tote Feinde kamen, würden sie irgendwann aufgeben müssen. Es sei denn, sie erhielten Verstärkung, und zwar bald.
Ein Heulen erschallte.
»Deckung!«, befahl der Lieutenant. Myers, der mit dem verwirrten Decker losgezogen war, duckte sich und rannte weiter. Die Männer im Graben machten sich so flach wie möglich. Die Granate schlug Gott sei Dank etwas weiter entfernt ein.
»Bleibt unten!«, warnte der Lieutenant, und tatsächlich folgten der ersten Explosion eine zweite und eine dritte. Beim letzten Einschlag regnete es Erdbrocken auf die Männer herab, aber es waren keine Schmerzensschreie und kein Kreischen zu hören, die auf den nahenden Tod einer der wenigen noch verbliebenen Kameraden gedeutet hätten.
»Sie kommen bestimmt in der Dämmerung«, warnte der Lieutenant. »Denkt daran, dass die Munition zur Neige geht. Schießt erst, wenn ich den Befehl dazu gebe!«
»Teufel noch mal, bei dem Staub werden wir nie das Weiße in ihren Augen sehen«, meinte Lansky. Lansky war ein richtiger Veteran, bei Kriegsausbruch war er schon fünfundvierzig gewesen. Er hatte sich trotzdem gemeldet, zwei Tage nachdem sein Sohn in Italien gefallen war. Zu der Zeit war den Anwerbern sein Alter egal gewesen. Er war ein hervorragender Mann für die Front. Beim Jagen in Montana hatte er Schießen gelernt und verfehlte kaum je sein Ziel, egal unter welchen Bedingungen.
»Jeder Schuss zählt«, erinnerte der Lieutenant seine Leute. Obwohl er kaum halb so alt war wie Lansky, nahm der seine Befehle ohne Murren entgegen. Lansky hatte sich hier draußen als ein väterlicher Freund und Berater erwiesen, denn gegen Ende des Ersten Weltkriegs hatte er noch viel darüber gelernt, wie man sich in einem Graben am besten verschanzte. Von ihm kamen immer verdammt gute Vorschläge, die er in aller Bescheidenheit äußerte. Selbst die Offiziere, die im Rang über dem Lieutenant standen, folgten gern seinem Rat.
Er sah Lansky in die Augen. »Sie kommen!«, sagte Lansky. »Ich spüre es.«
Der Lieutenant nickte ihm zu. Wenig später zeigte sich, dass Lansky recht gehabt hatte. In der Dämmerung, dem Pulverdampf und dem aufgewirbelten Staub tauchten plötzlich Soldaten auf. Sie wussten, dass sie zu sehen waren, und stießen seltsame Schreie aus, wie archaische Krieger. Vielleicht ist das Kämpfen immer und überall gleich, dachte der Lieutenant. Nur der Ort, die Zeit und der Anlass sind anders. Vielleicht mussten die Männer einfach schreien, wenn sie direkt in einen Kugelhagel stürmten, auch wenn sie selbst bewaffnet waren und bereit zu töten. Vielleicht war ein Schlachtruf das Letzte, was ein Mann dem Himmel oder der Hölle zubrüllte, um kundzutun, dass er noch lebte.
»Feuer!«, befahl der Lieutenant.
Beim Dröhnen der Gewehre schien sich der Boden aufzutun. Die Kette von Männern, die auf sie zukam, geriet ins Stocken und löste sich auf. Die unheimlichen Schlachtrufe wurden zu schmerzerfüllten Schreien, Männer gingen zu Boden, starben.
Dennoch schlossen andere Soldaten die Kette, wo sie gerissen war, und die Schlachtrufe der Neuen stiegen zum dämmrigen Himmel auf.
»Feuer!«, schrie der Lieutenant abermals. Wieder erfüllte eine Salve die Dämmerung, wieder gingen Männer zu Boden. Doch der Feind rückte unerbittlich näher, wie Gespenster füllten immer neue Soldaten die Lücken. Die Kette rückte näher und näher, und auch die feindlichen Soldaten schossen, obwohl sie blind in die Gräben feuerten.
»Feuer!«
Wieder das Peitschen von Kugeln. Pulverschwaden erfüllten die Dämmerung, so dicht, dass es fast unmöglich war, etwas zu sehen. Die Männer in den Gräben hörten Schreie, die ihnen zeigten, dass wieder Gegner getroffen waren.
Doch sie zeigten ihnen auch, dass der Feind immer näher rückte.
Ein Soldat stürmte vorwärts, warf sich in den Graben, zielte auf Lansky. Der Lieutenant setzte sein Gewehr instinktiv als Streitkolben ein und hieb es dem Gegner in den Nacken und auf den Rücken. Der Mann fiel, bevor er einen einzigen Schuss abfeuern konnte, doch weitere kamen, waren schon fast da.
»Schießt, wann ihr wollt!«, brüllte der Lieutenant. In wenigen Minuten würde das Chaos ausbrechen, der Feind würde in die Gräben eingebrochen sein, kein Mensch würde mehr wissen, auf was er schoss. Wie Explosionen dröhnten die Schüsse, während die Verteidiger fast blind auf den Feind feuerten, der immer näher rückte. Ein Soldat wurde in die Speiseröhre getroffen und fiel in den Graben, genau auf Lansky. Der schubste den Toten beiseite und suchte gleich wieder ein Ziel.
Auf einmal erhob sich ein Heulen – und es war nicht der Schlachtruf der Feinde. Es war unheimlich wie der Schrei von tausend Todesfeen, wie der Schrei derer, die in den tiefsten Schluchten der Hölle steckten. Das Geräusch war derart erschreckend, tief, ans Innerste rührend, dass beide Seiten einen Moment lang zu schießen vergaßen.
Die Stille war ebenso unheimlich wie der höllische Schrei, der sie hervorgerufen hatte.
MacCoy, der Junge aus Boston, flüsterte: »Mögen die Heiligen uns segnen und beschützen!«
Dann brach das totale Chaos los: wieder dieses bellende Heulen, daneben Schüsse, die aus den Gräben in die Dämmerung und ins Dunkel abgegeben wurden, Schüsse auf den herannahenden Feind, Schüsse, die in die Dunkelheit pfiffen.
Auf einmal erhob sich ein Donnern. Ein Donnern, als würde ein ganzes Kavallerieregiment auf sie zustürmen.
Schreie wurden laut, Schreie von deutschen Soldaten, während die Männer in den Gräben wegen des dichten Schleiers von Pulver, Staub und Dämmerung noch immer nichts sehen konnten.
»Heilige Jungfrau Maria, gesegnet seist du unter den Weibern ...«, fing MacCoy an.
»Herr im Himmel!«, schrie Lansky. Es war Gebet und Fluch zugleich, denn aus dem Nebel tauchte plötzlich ein deutscher Soldat auf, von oben bis unten blutverschmiert. Er stürzte in den Graben, lag da zu ihren Füßen. Alle Augen wanderten instinktiv zu dem Mann im Schlamm.
Und in diesem Moment kamen die Geschöpfe.
Geschöpfe ...
Wölfe, oder doch keine Wölfe? Manche silberfarben, andere schwarz, andere lohfarben. Sie hatten die Gestalt von Wölfen, aber sie waren größer, und ihre Augen ... ihre Augen waren anders. Diese Augen sahen alles, wussten alles, und alles, was diese Wölfe sahen und wussten und planten, zeigte sich in ihren Augen, während sie zum Sprung ansetzten. Sie schienen über die Soldaten hinweg in die Gräben zu fliegen. Und dann fielen sie über sie her.
»Feuer! Feuer!«, schrie der Lieutenant.
Schüsse dröhnten, Tiere fielen, Männer fielen. In den Gräben entstand ein Durcheinander von Männern und Blut: deutsche Uniformen, amerikanische Uniformen, Stoff, der so blutverschmiert und zerfetzt war, dass man seine Herkunft nicht mehr erkennen konnte. »Feuer! Feuer! Feuer!«, brüllte der Lieutenant wieder und immer wieder, und er hörte den ohrenbetäubenden Lärm, als seine Männer den Befehl ausführten. Lansky war direkt neben ihm, doch dann wurde er hochgerissen und weggezerrt. Er sah Lansky vor dem Graben zusammenbrechen, gerade als wieder ein blutverschmierter deutscher Elitesoldat zu ihnen in den Graben stürzte, die Augen im Tod weit aufgerissen.
»Lansky!« Er bückte sich, kroch möglichst geduckt vorwärts, entschlossen, Lansky in die relative Sicherheit des Grabens zurückzuholen. Kugeln zischten über ihn hinweg, während er zu seinem Freund robbte.
Dann traf ihn etwas. Er wusste nicht, was es war. Er spürte nur ein schrecklich schweres Gewicht im Rücken, dann einen stechenden Schmerz im Nacken. Eine Kugel? Ein Bajonett? Ein Messer? Er konnte es nicht sagen. Er spürte nur das Stechen. Es tat nicht einmal richtig weh, es war nur das Gewicht, und etwas stach ihn.
Etwas hatte ihn erwischt.
Feuer? Einer der tollwütigen Wölfe?
Aber er atmete. Er lebte und atmete. Und er kroch immer weiter.
Lansky lag ganz in seiner Nähe. Er lag auf der Seite. Lansky, der Superschütze. Er musste ihn zurückholen. Schweiß tropfte ihm in die Augen. Nein, kein Schweiß, Blut. Seine Sicht verschwamm. Er wollte nicht sterben, nicht hier im Schlamm. Auf diese Weise wollte er die Schlacht nicht verlieren. Also kroch er weiter, auch wenn sein Blick sich zunehmend trübte. Er sah auf Lansky, erkannte die Hand seines Landsmanns, griff danach und zerrte ihn zu sich.
Doch während er den Körper heranzog, schrie er plötzlich auf und wich instinktiv zurück: Lansky fehlte der Kopf.
Trotz seines Entsetzens war sein Schrei kaum zu hören. Seine Lunge brannte. Sein ganzer Körper schien zu brennen, doch innerhalb weniger Momente schien dieses Feuer einer seltsamen Kälte zu weichen. Ihm wurde bitterkalt.
Der Tod war kalt.
Er starb. Es war sein Blut, das ihm in die Augen tropfte, sein Blut, das durch den brennenden Riss in seinem Nacken aus den Adern quoll. Das schwache Licht wurde noch schwächer, und auch die Geräusche verblassten immer mehr. Kaum dass er noch die Schreie seiner Männer hörte, und auch die Gewehrschüsse wurden immer leiser. Die Zeit schien stillzustehen.
Dann kehrte völlige Stille ein. Er glaubte nicht, dass ihm die Sinne geschwunden waren, und auch nicht, dass er gestorben war.
Dennoch ...
Die Zeit verging, so schnell wie das Licht, so langsam wie eine träge Strömung.
Die Stille blieb.
Und dann regte sich wieder etwas in seinem Bewusstsein, wenn auch nur ganz schwach – Geräusche, Bewegungen.
Schritte, laute Schritte. Er versuchte, sich in die Richtung der Schritte zu drehen. Er spürte etwas auf dem Boden neben sich. Er hörte Worte in einer Sprache, die er nicht verstand.
Er blinzelte. Sein Sichtfeld hatte sich auf ein winziges Guckloch verengt, das umgeben war von rotem und schwarzem Nebel.
Doch neben ihm war etwas. Er blinzelte wieder, kämpfte um sein Bewusstsein, auch wenn er wusste, dass er den Kampf wohl gleich verlieren würde.
Dennoch war da etwas. Ja, ein Stiefel. Der schwarze Stiefel eines Mannes, den er deutlich sah, im Schmutz, im Morast, im Blut der Erde. Schwarz, und etwas glänzte unter dem Schlamm, mit dem er verkrustet war.
In dem Moment, in dem ihm die Augen wieder zufielen, wurde ihm klar, was das glänzende Emblem auf dem Stiefel gewesen war.
Ein Hakenkreuz.
Er registrierte diesen Gedanken.
Doch das war sein letzter Gedanke. Danach verblasste die Welt wieder, erst wurde sie von einem scharlachroten Schleier verhüllt, und dann ...
... wurde alles schwarz.
Kapitel 1
Seit eurer letzten Begegnung hat er sich verändert. Er hat sich wirklich verändert.«
Ann wedelte mit der Hand in der Luft herum, der Rauch ihrer Zigarette wurde zu einem kleinen Wirbel.
Tara starrte ihre Cousine verständnislos an. Sie war erschöpft. Auf ihrer Reise über den Atlantik in Richtung Osten hatte sie kein Auge zugetan, obwohl sie die ganze Nacht geflogen war. Sie wollte nur noch ankommen auf dem kleinen Château ihres Großvaters in der Nähe von Paris. Doch Ann, die sie vom Flughafen abgeholt hatte, wollte unbedingt noch frühstücken, bevor sie sich auf den Weg aus der Stadt machten.
Und jetzt versuchte Ann ihr gerade zu erklären, dass ihr Großvater senil sei, ja vielleicht sogar an Alzheimer leide, auch wenn sie es nicht ausgesprochen hatte.
Tara kniff die Augen zusammen, schüttelte den Kopf, trank einen großen Schluck Milchkaffee. »Ann, wenn Großpapa krank ist, sollte er vielleicht in die Staaten zurückkehren.«
»Puh!« Ann rümpfte die Nase. »Warum glaubst du ständig, dass in Amerika alles besser ist?«
»So habe ich das nicht gemeint.« Tara senkte den Blick und biss sich auf die Lippen. Sie wusste, dass die medizinische Versorgung in Frankreich ganz ausgezeichnet war. Doch sie neigte tatsächlich dazu, zu glauben, dass in Amerika alles besser war.
Bis auf die Croissants und den Café au Lait.
Sie grinste reumütig. »Tut mir leid.«
Ann zuckte großmütig die Schultern.
»Aber wenn du mir sagen willst, dass er übergeschnappt ist ...«
Ann seufzte tief. »Nein, das nicht. Wirklich nicht.«
»Aber du glaubst, dass er senil wird? Ein paar Überspanntheiten kann man ihm in seinem Alter allerdings schon zugestehen.«
Ann zuckte noch einmal die Schultern. »Mais oui. Er behauptet ja, dass er gar nicht weiß, wie alt er ist. Jedenfalls sagt er immer, dass er älter war als die meisten Jungs in der Résistance, und der Zweite Weltkrieg war 1945 zu Ende. Ja, er ist wohl schon ziemlich alt. Ich habe dir ja am Telefon von seinen Atemproblemen berichtet, und deshalb war er auch im Krankenhaus, aber seit einigen Tagen ist er wieder zu Hause. Ich mahne ihn ständig, auf sich aufzupassen, aber er bleibt einfach nicht im Bett. Er steht auf und zieht sich in seine Bibliothek zurück. Dort schließt er sich ein, und wenn er rauskommt, redet er ständig über irgendwas, was er die ›Allianz‹ nennt.«
»Vielleicht durchlebt er noch einmal seine Kriegszeit.«
Ann wirkte besorgt, übernächtigt, erschöpft, was sonst nicht ihre Art war. Für Tara war ihre Cousine eine der schönsten Frauen, die sie kannte: Sie hatte tiefblaue Augen, dunkle Haare und einen sehr hellen Teint – ein verblüffender, faszinierender Kontrast. Außerdem war sie groß und schlank, mit Rundungen an den richtigen Stellen.
Früher hatte es Tara manchmal richtig gehasst, wenn ihre französische Cousine sie besuchte. Viele ihrer Highschool- und Collegefreunde überschlugen sich schier bei Anns Anblick. Im Lauf der Jahre konnte sich Tara ihre Eifersucht eingestehen, aber trotzdem hatte sie ihre Cousine sehr lieb, und ihre Zuneigung wuchs, als sie älter wurde und die Highschool und das College längst hinter ihr lagen. In ihrer Jugend besuchte Ann ihre amerikanischen Verwandten so oft, dass ihre Rivalität fast wie die von Schwestern war, nur dass Taras ›Schwester‹ einen faszinierenden Akzent und das Flair einer exotischen Fremden hatte. Tara hingegen war in ihrer Jugend nur drei Mal im Jahr mit ihren Eltern nach Paris geflogen. Ann sprach Englisch genauso fließend wie ihre Muttersprache, Taras französische Sprachkenntnisse hingegen waren eher kümmerlich, ihr amerikanischer Akzent unüberhörbar.
Jacques DeVant, Taras und Anns Großvater, hatte sich gegen Kriegsende in Emily, eine amerikanische Krankenschwester, verliebt. Die beiden hatten geheiratet und sich in Amerika niedergelassen. Ihr Sohn David hatte sich während eines Auslandssemesters in Paris in eine französische Künstlerin, Sophie, verliebt. Er war dort geblieben. Emily und Jacques hatten auch eine Tochter, die einen irischstämmigen Amerikaner, Patrick, geheiratet und mit ihm zwei Kinder bekommen hatte, Tara und ihren Bruder Mike.
Trotz ihrer gemeinsamen Großeltern kamen Tara und Ann also aus zwei sehr unterschiedlichen Kulturen.
Nach dem Tod ihrer Großmutter war ihr Großvater nach Paris zurückgekehrt und hatte sich auf seinem Familiensitz niedergelassen, auf dem auch Ann aufgewachsen war. Anns Eltern hatten sich inzwischen zur Ruhe gesetzt und lebten nun den Großteil des Jahres in einem kleinen Haus an der Costa del Sol.
Das Haus ihres Großvaters als Château zu bezeichnen war vielleicht ein wenig hoch gegriffen, aber als der kleine Landsitz im achtzehnten Jahrhundert vergrößert worden war, hatte man es Le Petit Château DeVant genannt – und so hieß es noch heute.
Im Krieg hatte die Familie ihr kleines Vermögen fast ganz verloren, doch was übrig geblieben war, hatte man klug angelegt, und das kleine Anwesen war zwar etwas baufällig, besaß jedoch sehr viel Charme. Es hatte zwei Geschosse und eine altmodische Diele, die als Salon diente. Daneben gab es eine stattliche Bibliothek und wundervolle Schlafzimmer im ersten Stock, deren Balkone auf den Hof führten. In der Remise standen noch heute ein kleiner Einspänner und Daniel, ein unglaublich altes, sanftmütiges, graues Kutschpferd, das inzwischen allerdings fast nur noch friedlich auf der angrenzenden Weide graste.
Ann schüttelte plötzlich den Kopf, drückte ihre Zigarette aus und beugte sich vor. »Es hat nichts mit dem Krieg zu tun. Vielleicht ist ihm seine Schriftstellerei zu Kopf gestiegen, vielleicht hat er auch zu viele amerikanische Comics gelesen. Er ist beunruhigt, er glaubt, dass er etwas ... jemanden im Stich gelassen hat. Er spricht tatsächlich viel vom Krieg und meint, dass das, was damals passierte, ihn völlig vergessen ließ, was er war und wer er war. Und dann sein Umzug nach Amerika ... Aber er sagt ständig, dass er es hätte wissen müssen, weil es immer da war, selbst in Amerika.«
»Aber was war denn da, selbst in Amerika?«
Ann hob hilflos die Hände. »Ich weiß es nicht. Manchmal wirkt er plötzlich sehr aufgeregt, als ob er zu viel gesagt hätte. Vielleicht bekommst du mehr aus ihm heraus. Als er krank wurde, habe ich Urlaub genommen, aber jetzt muss ich wieder arbeiten, sonst bin ich meinen Job los. Ich verdiene zwar kein Vermögen, aber ich liebe meine Arbeit.«
Tara bekam ein schlechtes Gewissen, dass sie erst jetzt nach Frankreich gekommen war. Aber auch sie hatte noch einiges erledigen müssen.
Sie und Ann hatten unterschiedliche Wege eingeschlagen, doch nun arbeiteten sie seltsamerweise an ziemlich ähnlichen Projekten. Ann war Lektorin in einem Verlag, der englische und amerikanische Literatur einkaufte und übersetzte, Tara war Grafikerin und hatte viele Buchumschläge entworfen.
»Aber du kannst auch zu Hause arbeiten, oder?«, fragte Tara.
Ann lachte. »Oft genug arbeite ich lieber zu Hause, denn in der Arbeit klingelt ständig das Telefon. Und die ganzen Meetings ... Aber das ist es eben – um die komme ich nicht herum.«
Tara nickte. »Na gut, jetzt bin ich ja hier.« Sie gähnte. »Und ich bin wahnsinnig müde.«
»Soll das heißen, dass ich dich heute Abend nicht in eine Kneipe entführen kann, um deine Ankunft zu feiern? Momentan hängen ein paar ziemlich attraktive Kerle rum. Du hast mir doch erzählt, dass du dich von deinem Börsenmakler getrennt hast.«
Tara nickte. »Ja, wir haben uns getrennt. Aber willst du wirklich durch die Kneipen ziehen? Was ist denn aus der neuen Liebe deines Lebens geworden?«
Ann rümpfte die Nase. »Wir haben uns auch getrennt.«
»War es schwer für dich?«
»Schwer?« Ann zog verächtlich eine Braue hoch und seufzte. »Du weißt ja, dass ich Willem kennenlernte, nachdem er den Posten als Vertriebschef übernommen hatte. Vor ungefähr einer Woche fand in meinem Büro ein Meeting statt, das sich in die Länge zog. Willem wollte noch etwas mit der Grafikchefin und den Models für eine Anzeigenkampagne besprechen. Er sollte für mich mein Büro abschließen, und anschließend wollten wir uns in einem Hotel treffen. Ich zog los und besorgte etwas für ein romantisches Dinner, aber dann fiel mir ein, dass ich das Manuskript vergessen hatte, an dem ich noch hatte arbeiten wollen. Deshalb bin ich noch mal ins Büro. Er hatte nicht mit mir gerechnet, und das Model wohl auch nicht. Ich habe die beiden in einer kompromittierenden Stellung erwischt und bin gegangen.«
»Es war in deinem Büro?«
»Ich nahm an, dass er das Feld bis zum Montag geräumt haben würde«, meinte Ann trocken.
»Was er wohl auch getan hat, oder?«
»Jawohl.«
»Hat er denn angerufen und Anstalten gemacht, sich zu entschuldigen? Das Ganze zu erklären?«
»Er hat angerufen. Aber ich habe ihm versichert, dass er sich seine Worte sparen könne.«
Offenbar hatte der Mann ihre Cousine sehr verletzt. Aber Ann neigte dazu, die Welt schwarz-weiß zu malen, und sie konnte äußerst nachtragend sein. Ihr Stolz und eine klare Richtung waren ihr sehr wichtig.
»Das ist bestimmt nicht leicht für dich. Schließlich arbeitet ihr in derselben Firma. Ihr arbeitet doch noch zusammen, oder?«, fragte Tara.
»Er hat ein eigenes Büro.«
Tara dachte ein Weilchen nach. Ann hatte so von Willem geschwärmt. Sie hatte geklungen, als stünden sie kurz vor der Verlobung.
»Jetzt muss ich doch noch mal etwas genauer nachfragen«, meinte sie schließlich. »Was genau hat er denn getan, dort in deinem Büro?«
Ann verdrehte die Augen. »Das Mädchen lag auf meinem Schreibtisch, und er beugte sich über sie. Willst du mehr hören?«
»Ich will alles hören«, erwiderte Tara. »Waren die zwei ... bekleidet?«
»Ja, das waren sie wohl noch.«
»Dann war es ja vielleicht so, dass ...«
»Erfinde bloß keine Entschuldigungen für ihn«, fauchte Ann. »Sie haben sich jedenfalls geküsst und befummelt, und das hat mir völlig gereicht.«
»Ich will ihn nicht entschuldigen. Aber vielleicht hat das Model ihn ja genötigt, sich zu kompromittieren. Oder vielleicht hat er ihr nur gezeigt, wie sie sich fotografieren lassen soll.«
Tara schnitt eine Grimasse. Warum versuchte sie eigentlich, jemanden zu verteidigen, den sie gar nicht kannte, jemanden, der in einer Situation ertappt worden war, über die sie gar nichts wusste?
Ann lachte kurz auf. »Es waren keine Fotografen da. Und das männliche Model auch nicht. Deshalb ...«
»Deshalb hast du an Ort und Stelle mit ihm Schluss gemacht?«
»Ich habe ihm gesagt, dass ich ihn rauswerfe, wenn er noch einmal einen Fuß in mein Büro setzt. Das war mein voller Ernst, und er hat mir geglaubt. Außerdem habe ich ihm gesagt, dass ich ihn mit meinem Brieföffner erdolchen würde. Auch das war mein voller Ernst. Und was war nun mit dir und deinem Börsenmakler?«
Tara zögerte. Wie sollte sie Ann erklären, was sie dazu gebracht hatte, die Beziehung zu einem wirklich netten, attraktiven jungen Mann abzubrechen? Bestimmt würde Ann sie für völlig verrückt halten, für noch verrückter als ihren Großvater.
»Nun?«, beharrte Ann. »Ich habe dir meine Geschichte doch auch ganz offen erzählt!«
»Es hat einfach nicht gestimmt.«
»Was hat nicht gestimmt? Du hast doch gesagt, er sieht gut aus, er ist höflich, charmant und sexy. Hat er seinen Sexappeal verloren?«
»Nein.«
Ann schüttelte den Kopf. »Er verdient ordentlich, er ist kein darbender Künstler und tritt mit keiner lächerlichen Band in einer schrägen Bar auf, oder?«
Tara lachte. »Nein, Jacob ist wirklich ein anständiger Bursche. Ich kann es mir selbst nicht recht erklären. Er wollte mit mir zusammenziehen, sich fest an mich binden, aber ich habe einen Rückzieher gemacht. Es war einfach nicht ... nicht richtig. Ich weiß nicht, wie ich es sonst erklären soll«, beendete sie ihre Ausführungen lahm. Aber sie wusste wirklich nicht, wie sie Ann begreiflich machen sollte, warum sie mit Jacob Schluss gemacht hatte. Er hatte sogar volles Verständnis dafür aufgebracht, dass sie jetzt unbedingt nach Paris musste. Und dennoch ...
Sie hatte ein sehr seltsames Gefühl bei dieser Reise gehabt. Ihr war es vorgekommen, als ob sie ihr Leben lang darauf gewartet hätte.
Und außerdem dieser Traum ...
Sie hatte schon länger vorgehabt, nach Paris zu reisen, auch wenn sie ursprünglich später hatte fliegen wollen. Eines Abends – sie arbeitete zu der Zeit an einem wichtigen Auftrag und überlegte sich immer wieder, wann es denn am günstigsten sei loszuziehen – war sie eingeschlafen und ...
... und hatte sich über Paris wiedergefunden. Sie hatte die Stadt unter ihr liegen sehen, als das Flugzeug zur Landung ansetzte. Sie sah die Stadt, die sie liebte, die Kuppel von Notre Dame, den Eiffelturm. Sie sah sich zusammen mit Ann in einem Café sitzen und danach ins Dorf fahren. Und dann ... dann war Nebel aufgekommen, und sie war zu Fuß unterwegs. Sie lief durch die Wälder der Umgebung und wollte unbedingt einen ganz bestimmten Ort erreichen. Und auf diesem Streifzug hatte sie Angst.
Sie hatte Angst vor den Schatten, die überall herumgeisterten; Schatten, die sich verzerrten, die sich bewegten, die seltsame Umrisse hatten und zu flüstern schienen. Sie wusste nicht, ob ihr dieses Flüstern etwas sagen wollte, ob es sie weiterlocken oder warnen wollte. Aber sie musste unbedingt an ihr Ziel gelangen, ein Haus. Es hatte etwas mit ihrem Großvater zu tun. Mit jedem Schritt wuchs ihre Angst, aber auch ihre Entschlossenheit. Zwischen dichten Bäumen und Gestrüpp hindurch erblickte sie ein Gebäude. Es schien seltsam fahl zu leuchten, wie das Licht des Mondes, wenn er von Wolken und Dunst verhangen ist. In Gedanken wiederholte sie die Worte: »Hilf mir!«, wieder und immer wieder, auch wenn sie nicht wusste, wen sie um Hilfe bat; sie glaubte nur, ja sie musste fest daran glauben, dass er dort sein würde.
Beim Aufwachen hatte sie eine logische Erklärung für diesen Traum gehabt: Es war um ihren Großvater gegangen, den sie sehr liebte und der in Schwierigkeiten steckte. Sie musste zu ihm, weil er krank war. Sie schalt sich für ihren Egoismus und ihre Dummheit, dass sie nicht gleich mit dem nächsten Flugzeug zu ihm reiste. Der Traum war ein Zeichen, dass ihr Großvater sie brauchte, und ihre Angst vor den Schatten war eigentlich die Angst um ihn, weil er doch krank war.
Aber ungeachtet all ihrer vernünftigen Erklärungen hatte sie das Gefühl, dass ein bestimmter Lebensabschnitt zu Ende ging und ein neuer seinen Anfang nahm. Was kommen würde, wusste sie nicht, doch es kam ihr vor, als habe sie ihr Leben lang darauf gewartet und jetzt sei die Zeit reif.
An diesem Punkt war Jacob ins Spiel gekommen. Sie mochte ihn wirklich sehr, er war wunderbar, lustig, sinnlich, jemand, bei dem sie sich erden konnte, wenn ihre Fantasie wieder einmal zu Höhenflügen ansetzte. Aber es gab eben noch etwas anderes, und sie musste nach Paris, um herauszufinden, was es war.
Ziemlich verrückt. Und dennoch ...
... war es ihr richtig erschienen.
Verrückt, aber richtig. Sie hatte keine Ahnung, warum es ihr richtig erschien. Sie hatte nicht die Absicht, für immer in Paris zu bleiben. Es war nicht ihr Zuhause – New York war ihr Zuhause.
Doch der Ruf nach Paris und dem, wonach sie suchte, war unglaublich stark.
»Vielleicht sollte ich mit nach New York und Jacob kennenlernen«, meinte Ann und holte sie damit aus ihrer Grübelei.
»Vielleicht«, erwiderte Tara. »Ich nehme an, ich habe ihn nicht richtig geliebt.« Ann war immer wahnsinnig nüchtern und praktisch. Ihr solch vage Gefühle zu erklären war völlig ausgeschlossen.
Ann schüttelte verständnislos den Kopf. »Na toll! Du gibst dem perfekten Mann den Laufpass, und jetzt rückst du nicht mit der Sprache raus. Der Mann, den ich liebe, betrügt mich, und du bist der Meinung, ich soll ihm verzeihen. Du hingegen hast jemanden, der offen, ehrlich und treu ist, doch du liebst ihn nicht richtig.«
»Ich mag ihn, ich mag ihn sogar sehr. Aber eben nicht genug.«
Ann musterte sie eine Weile stumm, dann zuckte sie die Schultern. »Tja, wenn ich uns beide so ansehe ... Wir sollten wirklich durch die Kneipen ziehen. Dort findet man zwar kaum den Richtigen, aber bei der Arbeit findet man ihn wohl auch nicht. Und ich arbeite Tag und Nacht, oder zumindest kommt mir das so vor.«
»Ja, wir sollten ausgehen, und das werden wir auch ganz bestimmt. Wir müssen ja nicht auf Männerjagd gehen«, meinte Tara. »Aber nicht heute Abend. Ich bin wahnsinnig müde. Jetzt einen gut aussehenden Mann kennenzulernen würde ich wahrscheinlich nicht verkraften; selbst ein Netter, ja sogar ein Hässlicher, der mir nur einen Drink spendieren will, wäre zu viel.«
»Dann eben morgen Abend.«
»Warum nicht.«
»Na gut, dann fahren wir jetzt zum Château. Du kannst dir selbst anhören, was Großpapa zu sagen hat. Rede doch gleich heute Nachmittag mit ihm, ich fahre dann noch einmal ins Büro.«
»Vielleicht kannst du dich mit Willem aussprechen.«
»Ich habe meinen Brieföffner immer dabei.« Ann winkte den Kellner herbei und bestand darauf, die Rechnung zu übernehmen.
Sie hatten gerade ihre Stühle zurückgeschoben, als Ann plötzlich erstarrte, Taras Arm packte und sie wegzog.
»Was ist denn los?«
»Gehen wir. Schnell!«
»Was ist los?«
»Willem«, knurrte Ann.
»Willem? Wo?«
Tara versuchte, sich umzudrehen, sie hätte den Mann, in den ihre Cousine so verliebt gewesen war, zu gern gesehen. Doch Ann zog sie weiter. Trotzdem erhaschte sie einen flüchtigen Blick auf den Mann: Er war groß und blond und trug einen flotten Maßanzug. Als er kurz stehen blieb, um sich eine Zigarette anzuzünden, fiel ihm eine Haarlocke über seine dunkle Sonnenbrille. Er setzte sich an den Tisch, den sie soeben verlassen hatten.
»Hör auf zu gaffen! Lass uns gehen!«
»Na ja – du arbeitest doch noch mit ihm zusammen. Du könntest mich vorstellen, dann könnte ich mir wenigstens ein Bild von seinem Charakter machen.«
»Er hat keinen Charakter. Gehen wir!«
Ann zog sie fort.
Tara warf noch einmal einen Blick zurück. Sie hatte das sichere Gefühl, dass der Mann sie beobachtete, auch wenn seine Augen hinter der dunklen Brille versteckt waren. Er war attraktiv in seiner Eleganz und hätte in ihren Augen ausgezeichnet zu Anns kühlem Flair von Raffinesse und Intellekt gepasst.
Doch dann trat ein Mann zu ihm, dem er seine Aufmerksamkeit zuwandte. Willem kannte ihn offenbar. Er stand auf und schüttelte ihm die Hand. Der andere war ebenfalls hellhäutig, groß und blond. Unter seinem Anzug schien sich eine ausgezeichnete Figur zu verbergen, doch recht viel mehr konnte Tara nicht erkennen. Auch sein Gesicht war hinter einer Sonnenbrille verborgen.
Tara wäre fast gestolpert. Sie richtete den Blick wieder nach vorne. Dabei überkam sie plötzlich ein merkwürdiges Gefühl – das Gefühl, beobachtet, ja sogar verfolgt zu werden. Sie bekam eine Gänsehaut, eiskaltes Adrenalin schoss ihr durch die Adern.
Sie zitterte.
Und sah sich noch einmal um.
Keiner der beiden Männer saß mehr am Tisch. Tara blieb wie angewurzelt stehen und starrte verwirrt zurück. Die zwei hatten sich offenbar in Luft aufgelöst.
»Er hat jemanden getroffen«, meinte sie zu Ann.
»Er ist Vertriebsleiter, er trifft ständig jemanden«, erwiderte Ann ungeduldig. »Und ich muss dich jetzt heimbringen und wieder herkommen und ein bisschen Arbeit erledigen. Können wir jetzt bitte weiter?«
Tara gab sich einen Ruck. Sie war müde. Sie hasste den langen Flug über den Atlantik. Sie liebte Europa, aber der lange Weg war ihr wirklich ausgesprochen lästig. Sie lächelte reumütig. Der Morgen in Paris war wunderschön.
»Tara!«
»Ich komm ja schon.«
Wenig später saßen sie im Auto und verließen die Stadt.
»Er wirkt sehr interessant«, meinte Tara und beobachtete ihre Cousine.
»Ich habe keine Lust mehr, über ihn zu reden.« Ann wirkte geistesabwesend. »Es gibt Wichtigeres, als sich über einen verlogenen, untreuen Mann den Kopf zu zerbrechen. Großvater zum Beispiel.«
»Sollte ich mehr über ihn erfahren?«, fragte Tara.
»Ich habe dir doch gesagt, dass er ein verlogener Betrüger ist. Was willst du noch hören?«
»Ich meinte Großvater.«
»Ach so.« Ann warf ihr einen Blick zu. »Wir sind gleich da. Wenn du ihn siehst, wirst du alles verstehen.«
»Aber er ist jetzt wieder einigermaßen gesund?«
»Nicht so richtig, aber es geht ihm besser. Jedenfalls hat er sich von seiner Lungenentzündung erholt. Ich habe den Eindruck, dass er seine ganze Energie darauf verwendet hat, gesund zu werden und wieder zu Kräften zu kommen. Eines beunruhigt mich jedoch: Er beschäftigt sich die ganze Zeit mit einer archäologischen Ausgrabung, die momentan in unserem Dorf stattfindet. Offenbar hat man einen Gang zu den Grabkammern unter der alten Kirchenruine gebuddelt. Nach dem Aufwachen greift Großpapa jeden Tag als Erstes zur Zeitung, und er hat mich gebeten, nachzusehen, wie weit man mit den Ausgrabungen gekommen ist. Dann brütet er stundenlang über seinen alten Büchern und regt sich auf. Er wollte auch schon selbst zur Grabungsstelle, aber das hat ihm sein Arzt verboten, denn die Luft an einem solchen Ort ist sehr schlecht für ihn. Als er erfahren hat, dass es ihn das Leben kosten könnte, ist ihm klar geworden, dass er nicht selbst dorthin kann. Er ist nämlich wild entschlossen, am Leben zu bleiben. Er versucht, gesund zu bleiben und auf sich aufzupassen, aber er will unbedingt, dass ich dorthin gehe, und treibt mich damit schier in den Wahnsinn.«
»Bist du denn schon dort gewesen?«
Ann schüttelte den Kopf. »Ich habe nicht die Absicht, ihn in seinen Hirngespinsten zu unterstützen. Ich habe ihm gesagt, dass Touristen der Zutritt zur Gruft untersagt ist und dass auch ich nicht vorgelassen würde.«
»Stimmt das denn?«
»Eine Zeit lang hat es gestimmt«, gab Ann zu und setzte ein schuldbewusstes Lächeln auf. »Man machte sich Sorgen wegen der Stabilität der unterirdischen Anlage. Wie es momentan aussieht, weiß ich nicht. Als die Grabungen anfingen, erschienen ein paar Artikel in der Zeitung, aber inzwischen wird nur gelegentlich ganz kurz darüber berichtet.« Sie warf wieder einen raschen Blick auf Tara und zuckte mit den Schultern. »Na gut, ich glaube, inzwischen ist die Ausgrabung für Touristen zugänglich. Keine Ahnung, warum das so ist. Wir sind doch nur eine kleine Gemeinde am Rand von Paris. In der Stadt gibt es so viele Sehenswürdigkeiten, dass so eine kleine Ausgrabung wohl kaum viel Aufmerksamkeit verdient. Irgendein Professor, der dort arbeitet, ist allerdings überzeugt, dass sich dort eine wichtige historische Fundstelle befindet, aber bei seinen Kollegen stößt er damit offenbar auf wenig Begeisterung. Die meisten Leute kommen doch nach Paris, um die tollen Museen zu besichtigen. Wer einen Sinn fürs Morbide hat, kann ja in den Katakomben rumkriechen und sich Tausende von Knochen anschauen.«
»Vielleicht ist Großpapa deshalb so aufgeregt, weil die Ruine in unserem kleinen Dorf steht. Er ist hier aufgewachsen und hat den Großteil seines Lebens hier verbracht. Vielleicht denkt er, dass unsere Familie etwas mit den Ausgrabungen zu tun hat.«
»Das habe ich ihn auch gefragt«, erklärte Ann. »Doch er war richtig entsetzt und meinte, wir hätten mit entweihtem Boden wahrhaftig nichts zu tun. Na ja, du hast zwar von Paris noch nicht alles gesehen, aber das Berühmteste und Bedeutendste kennst du ja. Wenn du also in einer Gruft herumkriechen willst, kannst du das von mir aus gerne tun!«
»Aber du hast doch gemeint, du hättest Angst, dass ihn das in seinen Hirngespinsten bestärken würde.«
Ann zuckte wieder mit den Schultern. »Tja, das fürchte ich noch immer, aber ich versuche auch, den Rückstand im Büro aufzuholen. Und ich versuche zu verhindern, dass die alte Bude zusammenfällt, ohne mit großer Unterstützung rechnen zu können. Ich meine jetzt nicht dich, deine Familie, deinen Bruder oder meine Familie. Ich meine nur den Alltag – Bäder putzen, Aufräumen, das Dach in Ordnung halten, den Efeu bekämpfen. Katia ist für den Haushalt zuständig, Roland für das Grundstück. Debbie, Großpapas alte Assistentin in den Staaten, hat geschrieben, dass sie herkommen und sich um ihn kümmern möchte, aber es wird noch eine Weile dauern, bis sie alles geregelt hat. Wie du dir vielleicht vorstellen kannst, hatte ich nicht viel Zeit, um irgendwelche alten Ruinen zu besichtigen. Ich bin echt froh, dass du jetzt da bist. Du hast doch gemeint, dass du Lust hättest, hier ein paar Zeichnungen zu machen, zu denen du zu Hause nie kommst – also nicht das kommerzielle Zeug, mit dem du deine Rechnungen bezahlst, sondern was Künstlerisches. Vielleicht inspiriert dich ja die Gruft, und man lässt dich sogar eine Staffelei aufstellen. Ach, ich weiß nicht – ich liebe den guten alten Jacques von ganzem Herzen. Weißt du noch, wie es früher war? Er hat Unterhaltungsliteratur geschrieben, die sich gut verkauft hat, aber man hat ihn immer interviewt, als ob er ein großer Gelehrter oder ein hochliterarischer Schriftsteller wäre. Er kannte sich aus in der Welt und mit der menschlichen Natur. Ich will den Großvater, den wir unser Leben lang gekannt und geliebt haben, nicht verlieren.«
»Ich liebe ihn auch. Er ist einfach ein fantastischer Mensch. Ihm verdanke ich meine Liebe zur Kunst, und du hast bei ihm bestimmt eine Menge über das Schreiben und das Verlegen von Büchern gelernt. Er ist uns beiden wichtig, und auch er liebt uns bestimmt von ganzem Herzen.«
»Ja, aber du bist mit einem Faible für Geschichten, Märchen und Legenden gesegnet. Ich bin viel zu logisch und vernünftig für solche Dinge. Also rede du mit ihm. Sieh zu, ob du begreifst, was in ihm vorgeht.«
»Ich habe fest vor, alles zu tun, was nötig ist. Deshalb bin ich hier.«
Ann nickte, dann verstummte sie.
Sie hatten die Stadt hinter sich gelassen und fuhren nun durch eine wunderschöne Gegend, über die kleinere Ansammlungen hübscher älterer Häuser verstreut waren. Es dauerte nicht lange, bis Tara die Zufahrt zum Château erblickte und dann das Haus, das ihr als Kind wie ein Märchenland vorgekommen war. Die Zufahrt schlängelte sich scheinbar ziellos durch Blumenrabatten – Ann bezeichnete die Blumen als ihre Babys – zu dem kiesbedeckten Platz vor den alten steinernen Eingangsstufen.
Die Tür ging auf, und Roland, der etwa genauso alt war wie ihr Großvater, eilte die Stufen herab. Noch bevor Tara die Wagentür öffnen konnte, riss er sie auf und begrüßte sie stürmisch. Er sprach so schnell, dass Tara kaum etwas verstand, doch das spielte keine Rolle, sie wusste, sie war willkommen. Sie umarmte ihn und bestand darauf, ihr Gepäck selbst zu tragen. Inzwischen war auch Katia, die ein paar Jahre jünger war als Roland, an der Tür aufgetaucht. Sie wischte sich die Hände an der Schürze ab, eilte die Stufen herab und drückte Tara ebenfalls freudig an ihre Brust. Tara bemühte sich, die richtigen Worte auf Französisch zu finden, doch schließlich gab sie auf und erwiderte nur die Umarmung. Die beiden Alten wollten gar nicht mehr aufhören, sie zu drücken und zu küssen.
»Ich muss jetzt zurück ins Büro«, rief Ann. »Ich gehe nicht rein. Du übernachtest in deinem alten Zimmer.«
Tara packte wieder ihre Tasche, denn sie wollte sich weder von Roland noch von Katia helfen lassen.
»Dein Großpapa ist in der Bibliothek!«, erklärte Katia missbilligend und schüttelte den Kopf so heftig, dass sich dünne graue Strähnchen aus dem ordentlichen Knoten lösten und um ihr Gesicht wehten. »Man darf ihn nicht zu sehr aufregen, er kann stur sein wie ein alter Esel.«
»Ich fessle ihn, wenn er zu umtriebig wird«, versicherte Tara.
Ann fuhr die kreisförmige Zufahrt weiter und machte sich auf den Weg zurück in die Stadt. Roland und Katia folgten Tara ins Haus. In der einst prächtigen Eingangshalle blieb sie stehen und sah sich um: herrliche Holzarbeiten, fadenscheinige Wandteppiche und auf dem langen Tisch mit den Klauenfüßen Anns Computer inmitten von Bergen von Papier.
Tara lächelte. Es war schön, wieder hier zu sein.
Auf der anderen Seite des Atlantiks erwachte Jade DeVeau mit einem Ruck. Sie fragte sich, was sie so abrupt aus dem Schlaf gerissen hatte.
Die Nacht war ruhig gewesen, und wahrscheinlich war es schon früher Morgen. Einen Moment lang lag sie angespannt da, die Augen zusammengekniffen, und versuchte, die Gefahr zu erahnen, die ihre Überlebensinstinkte geweckt hatte. Doch es war nichts zu hören.
Sie machte die Augen auf und drehte sich leise um.
Mondlicht fiel durch das Fenster, das auf den hübschen Hinterhof ihres Hauses in Charleston führte. Lucian saß im Schaukelstuhl davor und blickte in die Nacht hinaus.
Sie wunderte sich nicht, ihn dort zu sehen. Zwar hatte sie ihren Schlafrhythmus inzwischen seinem angepasst, und er hatte gelernt, sich in der Dunkelheit hinzulegen und zu ruhen, doch in vielen Nächten sah sie ihn auf dem Schaukelstuhl sitzen, wenn sie aufwachte. Manchmal las er, dafür benutzte er eine kleine Leselampe, um sie nicht zu stören. Manchmal schaukelte er sachte auf und ab und betrachtete den Mond. Häufig saß er auch nur völlig entspannt da, wie eine Nachteule. Wenn er richtig rastlos war, ging er nach unten, um zu arbeiten oder sich im Fernsehen die Nachrichten oder einen alten Filmklassiker anzusehen.
Doch heute Nacht war es anders.
Jade setzte sich auf und angelte sich ihren Morgenmantel, der am Fußende des Bettes lag. Sie hatte noch immer Angst. Auch wenn sie nicht wusste, warum, fühlte sie sich seltsam verletzlich in ihrer Nacktheit, wie sie zu schlafen pflegte. Sie wusste, dass Lucian ihr Aufwachen sofort bemerkt hatte, er nahm alles wahr, was um ihn herum vorging.
Nun drehte er sich zu ihr, und selbst im schwachen Licht des Mondes sah sie, dass er entschuldigend lächelte.
»Ich habe dich aufgeweckt. Tut mir leid – ich dachte, ich wäre leise gewesen.«
Sie schüttelte den Kopf. »Du hast mich nicht geweckt. Ich bin einfach nur so aufgewacht.«
Er zog sie auf den Schoß. Sie fuhr ihm zärtlich durchs Haar. Oft fragte sie sich, ob es eine Sünde war, jemanden so sehr zu lieben.
»Was ist los?«, flüsterte sie.
Er schüttelte den Kopf. »Keine Ahnung.«
Sie erzitterte. Seine Umarmung wurde fester. »Keine Angst. Das ... was immer es ist ... ist weit weg. Aber gerade deshalb bin ich besorgt: Ich spüre etwas, aber ich weiß nicht, was.«
Als hätte er Angst, sie mit seiner Anspannung anzustecken, schob er sie von sich und stand abrupt auf. »Ich hätte Lust auf einen Hamburger.«
Sie betrachtete ihn fragend. »Um diese Uhrzeit?«
Plötzlich ertönte ein lautes Wimmern.
»Das Baby!«, sagte Jade, drehte sich um und eilte ins Nachbarzimmer. Sie wusste, dass Lucian ihr folgte, auch wenn sie seine Schritte nicht hörte.
Rasch schaltete sie das Licht an und trat an Aidans Wiege. Feine blonde Strähnchen standen von seinem Köpfchen ab, die Wangen waren gerötet, die Fäustchen flogen durch die Luft, das Gesichtchen war tränenüberströmt.
Jade nahm ihn zärtlich in die Arme und drückte ihn fest an sich.
Als sie Lucian geheiratet hatte, war es ihr schwergefallen, sich damit abzufinden, keine Kinder bekommen zu können. Sie hatte jedoch beschlossen, auch kein Kind zu adoptieren, weil sie so ein kleines Wesen nicht in Gefahr bringen wollte. Doch dann hatte sie von Aidan gehört, der, kaum ein paar Tage auf der Welt, seine Eltern verloren hatte. Inzwischen war der Kleine ein halbes Jahr alt.
Und jetzt ...
Jetzt spielte es überhaupt keine Rolle mehr, dass sie keine Kinder bekommen konnte. Aidan war ihr Kind, sie liebte ihn von ganzem Herzen. Selbst wenn sie ihn selbst geboren hätte, hätte sie ihn nicht mehr lieben können.
Sie wiegte ihn sanft und summte ein leises Lied.
Er begann sich zu beruhigen und wimmerte nur noch leise. »Ist ja schon gut, mein Kleiner. Mama ist da.«
Seine Schluchzer verebbten, doch dann fing er wieder an.
»Gib ihn mir!«, meinte Lucian und übernahm den Kleinen. Er blickte auf ihn und sprach leise auf Französisch zu ihm. Aidan sah seinen Vater an, wurde ruhig, machte die Augen zu und schlief gleich darauf tief und fest.
Jade nahm ihrem Mann den Kleinen aus den Armen und legte ihn behutsam in seine Wiege zurück. Dann ging sie wieder zu Lucian. »Eigentlich sollte ich eifersüchtig sein, dass du ihn so leicht beruhigen kannst«, meinte sie.
»Ich schummle. Ich spreche fließend Französisch, und diese Sprache wirkt beruhigend.«
Sie lächelte. »Keine Sorge. Mit all dem, was ich um die Ohren habe – ich kümmere mich um Aidan, ich versuche, weiter zu arbeiten, ich versuche, hier alles in Ordnung zu halten –, bin ich viel zu erschöpft, um eifersüchtig zu sein.«
Er küsste sie zärtlich auf die Stirn. »Leg dich wieder hin, Liebste. Schlaf noch ein bisschen.«
»Ich bin nicht mehr müde. Wir essen jetzt Hamburger.«
»Möchtest du nicht lieber ein Omelett? Allmählich ist es fast schon Zeit fürs Frühstück.«
»Ich habe Lust auf Rindfleisch, nur ganz kurz gebraten. Wie wär's mit Steak und Eiern?«
»Das klingt gut.«
Hand in Hand gingen sie ins Erdgeschoss. Jade war eine recht gute Köchin, und Rühreier gehörten zu ihren Spezialitäten. Während sie sich ans Werk machte, merkte sie, dass Lucian zwar scheinbar völlig gelassen mit ihr plauderte, doch dabei unaufhörlich aus dem Fenster starrte. Dort hinter dem Haus lag ein Pool – nicht sehr groß, aber groß genug, um sich zu erfrischen –, umgeben von einem Rankgitter und blühenden Kletterpflanzen, ein wirklich hübsches Fleckchen. Eine hohe Steinmauer, mehr als hundertfünfzig Jahre alt, schloss den Hinterhof ab. Jade verstand nicht, was Lucian so intensiv beobachtete.
Oder verstand sie es doch?
Er beobachtete den Mond.
Bald darauf stand sie am Esszimmertisch. »Steak und Rühreier und dazu ein köstlicher Burgunder.«
»Burgunder, um diese Uhrzeit?«, fragte er.
»Na klar, warum nicht?«
Sie setzten sich. Sie gab sich betont gelassen. Sie plauderte über Aidans Lächeln und das Buch, das sie gerade las. Er ging auf alles ein und sagte stets das Richtige, doch er hörte nicht richtig zu, das spürte sie.
Allmählich wich die Finsternis dem Morgengrauen.
Er stand auf und streckte sich. »Das war köstlich! Aber jetzt sollten wir vielleicht doch noch eine Runde schlafen.«
Jade nickte. Sie begann abzuräumen. Er nahm ihren Arm und blickte ihr tief in die Augen.
»Darum können wir uns später kümmern«, meinte er.
Sie nickte. Ihr Herz machte einen kleinen Sprung, ihre Sinne waren hellwach.
Ihr Mann war ein hervorragender Liebhaber.
Ein sehr erfahrener Liebhaber, aber ...
... er liebte sie, und sie wusste genau, wie sehr. Die Vergangenheit war völlig belanglos.
Hand in Hand gingen sie nebeneinander her ins Obergeschoss. Am Fußende des Bettes streifte sie den Morgenrock ab. Sofort spürte sie seine Hände auf ihrem Körper, und wie immer wurde ein Feuer in ihr entfacht, als ob sie schmelzen würde.
Als ob nichts anderes mehr wichtig wäre.
Egal, wie dunkel oder wie hell es war, sie spürte immer, wie sein Blick wie flüssiges Feuer über ihren Körper schweifte, in ihn eindrang.
Und am Ende wunderte sie sich stets, dass sie noch immer solche Leidenschaft verspürte, jedes Mal dieselbe Leidenschaft, als ob eine riesige Explosion die ganze Welt in ein goldenes Licht getaucht hätte. Und manchmal, nachdem der Höhepunkt sie ergriffen, erschüttert und befriedigt hatte, verschwamm das goldene Licht auch, und alles wurde schwarz.
Schließlich schlief sie ein, zutiefst befriedigt und erschöpft.
Er lag wach neben ihr, und nachdem er sich vergewissert hatte, dass sie komplett in die Welt der Träume eingetaucht war, stand er auf.
Er zog die Vorhänge zu und ging hinunter in den Keller.
Dort stand sein Computer, und dort in der dunklen Kühle des am tiefsten gelegenen Teil des Hauses fand er seinen Platz. Dort schloss er die Augen.
Und zog sich in die Tiefen seines Geistes zurück.
»Tara!«
Jacques DeVant wurde zwar älter, und um seine Gesundheit stand es nicht zum Besten, aber er konnte seine Enkelin noch immer so fest umarmen, dass es fast wehtat. Er erging sich nicht in eine lange Begrüßungsrede, sondern sagte einzig ihren Namen auf eine Weise, wie nur er es konnte, und umarmte sie. Und sie erwiderte seine Umarmung.
Danach kamen natürlich noch die Küsse – einer auf die rechte und einer auf die linke Wange –, und dann schob er sie auf Armeslänge weg und betrachtete sie eingehend.
Jacques war auch jetzt noch ein sehr gut aussehender Mann. Sein dichtes Haar hatte nichts von seiner Fülle eingebüßt, nur war es jetzt lohweiß und glänzte silbern. Seine Augen waren tiefblau, und, obwohl vom Alter gezeichnet, hatten seine Züge etwas Edles. Er strahlte eine immense Würde und Anziehungskraft aus.
»Deine Umarmung ist noch sehr kraftvoll!«, meinte sie und drückte ihn sanft auf seinen Sessel zurück. »Und du siehst prächtig aus. Aber du musst auf dich aufpassen, das weißt du ja. Du musst viel ruhen und mit deinen Kräften haushalten.«
Er zog eine buschige weiße Braue hoch und betrachtete sie skeptisch. »Mir geht es gut. Und glaub mir – ich achte auf meine Gesundheit. Ich habe fest vor, so lange zu leben, bis ... na ja, du weißt schon, bis ich ein gewisses Alter erreicht habe, ein höheres Alter.«
Er hat etwas anderes sagen wollen, dachte Tara. Ich habe fest vor, so lange zu leben, bis ... Das klang eher so, als ob er noch etwas Bestimmtes zu erledigen hatte.
»Du könntest wirklich noch als junger Kerl von knapp sechzig durchgehen!«, versicherte sie ihm.
Er zuckte die Schultern und quittierte das Kompliment mit einem Lächeln.
Tara schwang sich auf den Schreibtisch und betrachtete das alte Buch, das er gerade las.
Sie beschloss, nicht um den heißen Brei herumzureden. »Was geht dir momentan im Kopf herum? Ann macht sich Sorgen, weil du ihr gesagt hast, sie solle sich erkundigen, wie es um die Ausgrabung im Dorf bestellt ist.«
Sein Lächeln verblasste, wurde wehmütig. »Sie hält mich für einen verwirrten alten Trottel.«
»Nein, das würde sie nie tun. Aber sie macht sich Sorgen.«
»Ich muss unbedingt erfahren, was dort los ist. Aber Ann hat sich bislang geweigert, es für mich herauszufinden. Na, zum Glück bist ja jetzt du da!«
Er klang so aufgewühlt, dass Tara sofort klar wurde, warum sich ihre Cousine Sorgen machte. »Was hat es denn mit dieser Ausgrabung auf sich?«, fragte sie zögernd.
»Ich muss wissen, wonach sie dort suchen. Und was sie gefunden haben.«
»Einen Haufen alter Knochen, nehme ich an – schließlich buddeln sie in der Gruft einer säkularisierten Kirche.«
»Ich muss wissen, was genau sie ausgegraben haben. Ich brauche die Pläne der Gruft. Ich muss herausbekommen, ob der Professor noch von anderen Wissenschaftlern unterstützt wird und wer bei diesem Projekt mitarbeitet. Ich bin der Meinung, dass die Arbeiten eingestellt werden sollten. Aber wenn ich nicht gründlich informiert bin, kann ich nichts tun. Tara, du musst dorthin, du musst alles so prüfen, wie ich es tun würde, wenn ich nur könnte. Ich muss sehr vorsichtig sein – meine Enkelin glaubt, dass ich den Verstand verliere. Wenn ich nicht aufpasse, kann es geschehen, dass man mich in ein Irrenhaus steckt. Aber so weit darf es nicht kommen!«
»Großpapa, du bist ein Gelehrter, ein bekannter Schriftsteller!«
»Ein Schriftsteller, der Romane und fantastische Märchen verfasst hat.«
»Die aber wichtige Botschaften enthalten«, versicherte sie ihm.
Doch das ärgerte ihn nur. »Es sind Romane. Alle werden denken, dass ich mich in meiner Romanwelt verloren habe und verrückt geworden bin. Ausgerechnet jetzt bin ich alt und krank und schwach!«
»Ich verstehe nicht ganz«, meinte Tara.
Er schien sie nicht zu hören. Er starrte in den alten Kamin, in dem dicke Scheite brannten und die lodernden Flammen von blauen, orangefarbenen, gelben, roten und hellgrauen Rauchwölkchen gekrönt wurden.
»Großpapa ...«
»Du musst unbedingt für mich in diese Kirche«, sagte er.
»Ich gehe gleich morgen«, erwiderte sie. »Versprochen.«
»Morgen könnte es zu spät sein. Vielleicht ist es sogar heute schon zu spät, auch wenn meines Wissens bislang noch nichts Schlimmes passiert ist.«
»Was soll denn in der alten Kirchengruft passieren?«, fragte Tara. »Befürchtest du, dass dort etwas sehr Wertvolles verborgen ist, hinter dem jemand her ist? Schweben die Arbeiter in Gefahr? Weißt du etwas Konkretes?«
Er blickte von den Flammen auf und sah ihr in die Augen. Dann schüttelte er den Kopf. »Du würdest es nicht verstehen. Aber du musst für mich herausfinden, was dort los ist.«
»Ich habe dir doch schon gesagt, dass ich das tun werde. Doch du weißt ja, im Flugzeug bekomme ich kein Auge zu. Ich bin völlig erledigt. Aber gleich morgen ziehe ich los.«
»Heute!« Er musterte sie von Kopf bis Fuß. »Katia macht uns einen starken Kaffee. Solange du in Bewegung bleibst, schaffst du das schon. Die Zeitverschiebung macht sich erst bemerkbar, wenn du dich hinlegst und schläfst.«
»Du verstehst mich nicht – ich bin wirklich fix und fertig. Vor meinem Abflug musste ich noch ein Projekt zu Ende bringen, ich habe seit Tagen nicht mehr genug Schlaf bekommen.«
»Dann spielt ein Tag mehr auch keine Rolle.«
»Hey! Du bist mein Großvater, du solltest dir um meine Gesundheit und mein Wohlergehen Sorgen machen.«
»Glaub mir, das tue ich. Sehr sogar. Aber du wirst noch heute Nachmittag losziehen und mir sämtliche Informationen besorgen, die es über diese Ausgrabung gibt. Die Namen aller Beteiligter. Du musst direkt an die Stelle, an der sie arbeiten.«
»Womöglich lassen sie mich gar nicht ...«
»Himmel noch mal! Dann musst du eben deinen weiblichen Charme spielen lassen.«
»Du willst doch nicht etwa, dass ich meinen Körper verkaufe?«, neckte sie ihn.
Er schnaubte ungeduldig und setzte eine strenge Miene auf »Die Sache ist ernst!«
»Jacques!« Sie sprach ihn immer mit seinem Vornamen an, wenn sie so tat, als gehöre sie zu dem literarischen Zirkel, in dem er in New York zu verkehren pflegte. »Ich weiß nicht, was ich tue. Es wäre hilfreich, wenn ich es verstehen könnte. Was, glaubst du, geht dort vor und muss unbedingt gestoppt werden? Ann hat mir erzählt, dass du von einer Allianz gesprochen hast.«
»Ja, die Allianz. Ich gehöre zu dieser Allianz, aber es sind nicht mehr viele übrig. Den Ruf haben wahrscheinlich nur sehr wenige vernommen. Bestimmt gibt es noch andere, aber vielleicht wissen die noch nicht Bescheid. Vielleicht schaffe ich es, ein paar von ihnen zu mobilisieren. Aber zuallererst muss ich die Ausgrabung aufhalten!«
»Jacques, was ist das denn für eine Allianz? Eine Gruppe aus dem Krieg? Eine Gruppe von Schriftstellern?«
»Die Allianz ... die Zeit ist zu kurz. Vielleicht könnte man sagen, dass wir eine Gruppe aus dem Krieg sind. Aber darüber könnten wir endlos reden. Zuerst musst du deinen Auftrag erledigen. Wenn du das nicht tust, werde ich selbst aufbrechen müssen und mir womöglich eine weitere Lungenentzündung oder andere Atembeschwerden holen. Wenn ich mit meinen Befürchtungen recht habe, was man dort unten finden wird ... wen man dort finden wird ... dann musst du unbedingt hin.«
»Wenn du einen bestimmten Verdacht hast, solltest du die Polizei verständigen.«
»Die Polizei wird mich nicht verstehen. Sie würden mich ins Irrenhaus stecken. Bitte, Tara – wenn du mich liebst, musst du mir helfen. Ich brauche dich.« Er klang so verzweifelt, dass sie tatsächlich an seiner geistigen Gesundheit zu zweifeln begann.
»Die Polizei kann nichts tun«, fuhr er fort. »Jetzt nicht. Es geht nicht um einen Dieb oder einen gewöhnlichen Mörder.«
»Großpapa, worum geht es denn dann?«
»Es geht um das Böse, das Böse schlechthin. Tara, ich flehe dich an: Tu, was ich dir gesagt habe!«
Seine Worte überraschten sie. Sie wollte Einspruch erheben gegen das, was er da von sich gegeben hatte, doch plötzlich kam ihr kein Wort mehr über die Lippen.
Kälte hatte sie gepackt, eine Kälte, die durch Mark und Bein ging.
»Gehst du?«, fragte er. »Geh bitte für mich. Heute. Tust du das, bitte?«
»Ja, natürlich.«
Kapitel 2
In der Gruft war es düster und unheimlich. Trotz der vielen tragbaren Lampen an den Wänden des unterirdischen Gewölbes waren die Ecken dunkel. Finstere Schatten schienen sich in einem makabren Tanz zu bewegen und die Engel, Heiligen und steinernen Fratzen in einem unheimlichen Wechselspiel von Licht und Dunkel mit Leben zu erfüllen.
»Seid vorsichtig!«, mahnte Professor Dubois.
Vorsichtig! Wie sollte man bei dieser schlechten Sicht vorsichtig sein?
»Vorsicht! Vorsicht!«, wiederholte Dubois.
Der Mann war aufgeregt. Aber auf Jean-Luc machte er stets den Eindruck, als stünde er am Rande des Wahnsinns – als ob seine Erforschung der Gruft etwas Weltbewegendes wäre und seine Funde unser Bild vom Globus verändern würden!
Die Arbeiter waren müde, tief im Erdinnern, wo erst vor Kurzem die Fundamente der alten Kirche Saint Michel wiederentdeckt worden waren. Jean-Luc Beauvoir starrte den Professor mit seiner dicken Brille und dem wirren grauen Haar zornig an. Er biss sich auf die Lippen. Er und der Amerikaner, Brent Malone, waren seit Stunden hier drunten. Unermüdlich hatten sie die jahrhundertealten Erd- und Staubschichten um die Särge herum abgetragen. Professor Dubois rechnete mit einem unglaublichen archäologischen Fund. Er rechnete damit, für seine Ausgrabungen berühmt und mit Ehrungen und Auszeichnungen überhäuft zu werden, und glaubte wohl, ein Vermögen zu machen mit einem Buch und mit Vorträgen über die Funde. Offenbar war es ihm gleichgültig, dass ihn die meisten Gelehrten für verrückt hielten und er nur mittels Bestechungen und einer stattlichen Spende an die aktive Kirche Saint Michel die Erlaubnis bekommen hatte, zu graben. Für die ausgebildeten archäologischen Mitarbeiter, die Dubois unbedingt haben wollte, hatte das Geld jedoch nicht mehr gereicht. So hatte er nur zwei Männer, die er ständig herumkommandieren und zwingen konnte, weiter zu schuften, obwohl es bereits auf Abend zuging. Der Amerikaner schien den Professor zwar mit einem einzigen Blick aus seinen seltsamen goldgesprenkelten, mal bräunlich, mal grünlich schimmernden Augen zum Stillschweigen zu bringen, aber es dauerte nicht lange und der alte Sklaventreiber fing wieder von vorne an.