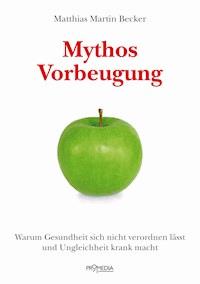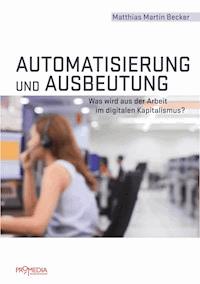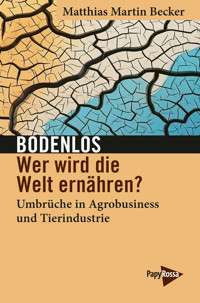
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: PapyRossa Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Die ökologische Krise setzt das weltweite Agrarsystem unter Druck. Niederschläge werden unregelmäßiger, Dürre, Stürme und Überflutungen weiten sich aus. Hinzu kommen Artensterben, Bodenverschlechterung und neue Pflanzenkrankheiten – Probleme, zu denen die profit-getriebene Landwirtschaft selbst erheblich beiträgt. Mit ihren Anbaumethoden untergräbt sie ihre eigenen Grundlagen. Agrarwissenschaft und Lebensmittelindustrie experimentieren deshalb mit neuen Produktionsmethoden: mit dem Anbau in Innenräumen, mit gentechnisch veränderten Organismen und einer automatisierten Tierzucht. Aber weder die biotechnische Modernisierung noch die Rückzugsversuche in kleinbäuerliche Nischen bieten einen Ausweg für die Landwirtschaft der Zukunft, in einer heißeren und unbeständigeren Welt. Gibt es Auswege, um die die Welt zu ernähren, ohne sie zu zerstören?
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2025
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Neue
Kleine Bibliothek 336
Folgende Ausgaben dieses Werkes sind verfügbar:
ISBN 978-3-89438-823-2 (Print)
ISBN 978-3-89438-917-8 (Epub)
1. Auflage 2025
© 2025 by PapyRossa Verlags GmbH amp; Co. KG, Köln
Luxemburger Str. 202, 50937 Köln
E-Mail: [email protected]
Internet: www.papyrossa.de
Alle Rechte vorbehalten – ohne ausdrückliche Erlaubnis des Verlages darf das Werk weder komplett noch teilweise vervielfältigt oder an Dritte weitergegeben werden.
Umschlag: Verlag, unter Verwendung einer Abbildung © by X-Poser | Adobe Stock #634497072
Satz: Die Werkstatt Medien-Produktion GmbH, Göttingen
Datenkonvertierung E-Book: Bookwire - Gesellschaft zum Vertrieb digitaler Medien mbH
Matthias Martin Becker
Bodenlos –Wer wird dieWelt ernähren?
Umbrüche in Agrobusiness und Tierindustrie
Inhaltsverzeichnis
1. Auftakt in der Küche
2. Die Heißzeit: Landwirtschaft im Anthropozän
3. In die Vertikale: Landwirtschaft ohne Land
4. Wie das Kapital Natur unterordnet
5. Eine kapitalistische Urproduktion?
6. In der Tretmühle: Wie der Familienbetrieb sich durchsetzte und dann in die Krise geriet
7. Gemischte Agrarwirtschaft – Lebensmittelpreise, Kapital und Staat
8. Wenn der Weltmarkt stottert
9. Fluchtversuche: Biotechnik in der Heißzeit
10. Bioökonomie: Agrarindustrielle Kreisläufe?
11. Propheten und Zauberer:Produktivkräfte entwickeln oder zügeln?
12. Auswege
13. Agrarunternehmer in der Heißzeit
14. Wer wird die Welt ernähren?
Glossar
Anmerkungen
1.Auftakt in der Küche
»Ach, das ist doch normal! Ist eben Sommer.«
Ganz leutselig sagt er das. Aber mein verkniffenes Gesicht macht ihn misstrauisch. »Du bist keiner von diesen Klimawandel-Typen geworden, oder?«
Ich will ihn am Kragen packen und schütteln. Ich will ihn anschreien.
Dieser Sommer ist so heiß wie keiner zuvor, seit die Temperaturen aufgezeichnet werden. Die Hitzewellen beginnen ungewöhnlich früh, dauern ungewöhnlich lange und endeten ungewöhnlich spät. Sie erfassen Nordamerika, Asien und Europa gleichzeitig. In den USA gehen manche Landwirte dazu über, ihre Felder nachts zu bearbeiten, weil die Hitze tagsüber unerträglich ist. Bauarbeiter tragen bei der Arbeit im Freien ein Kältepad unterm Schutzhelm.
Nein, das alles ist nicht normal. Muss ich ihm das wirklich erklären? Ich bin unsicher, wie ich reagieren soll. Ich könnte das Thema wechseln, um die Auseinandersetzung zu vermeiden. Aber das würde ihm auffallen, so schlau ist er schon. Oder ich könnte ihm einen Vortrag halten, um ihm grundlegende Zusammenhänge des Klimasystems darzulegen.
»Alles Panikmache!«, meint er, bevor ich mich entscheiden kann. Er holt sich noch ein Bier aus dem Kühlschrank. Draußen 37 Grad Celsius. Über der Stadt liegt eine Glocke aus Dunst und Staub. Die Kerze auf dem Balkontisch ist angeschmolzen. Hier drinnen in der Küche lässt es sich aushalten, weil: Klimaanlage! Im Sommer letztes Jahr hat er sich einen tragbaren Air Cooler bei Baumarkt gekauft. Das Gerät brummt in seiner schlecht isolierten Mietwohnung im dritten Stock vor sich hin und macht die Stromrechnung teurer.
Die Folgen des Klimawandels dringen in unseren Alltag vor. Große Flüsse wie der Rhein sind in den Sommermonaten kaum noch schiffbar, die Wälder ausdörrt. In den Ländern, wo wir Urlaub machen, wird das Wasser rationiert. Im August 2023 mussten zweihundert Kommunen in Südfrankreich mit Tankwagen oder Mineralwasser in Flaschen versorgt werden, weil es an Grundwasser fehlte.
Die Veränderungen entsprechen ungefähr dem, was die Klimawissenschaft vorausgesagt hat. Die Folgen für Vegetation und Tiere, Wasserkreisläufe, Boden und Meer übertreffen die schlimmsten Befürchtungen. Und trotz alledem, mein alter Freund will es nicht wahrhaben. Was muss noch passieren, bis er sich dazu durchringen wird? Wenn aus den Leitungen kein sauberes Wasser mehr kommt? Wenn seine Mutter an Dengue-Fieber gestorben ist?
Die Zeiten sind vorbei, als die Leute übers Wetter redeten, um nicht über Politik sprechen zu müssen. Die ökologische Frage spaltet Familien und stellt Freundschaften auf die Probe – so wie in dieser Küche.
Er empört sich über die Klimakleber. Sie schüren Angst, meint er. Ich finde, wessen Angst immer noch geschürt werden muss, weil er von alleine keine entwickelt, hat einen an der Waffel.
Er lehnt staatliche Maßnahmen für Klimaschutz ab. Mir gehen sie nicht weit genug.
Er fürchtet sich vor einer Ökodiktatur, ich vor dem Klimachaos.
Er kann es nicht mehr hören, ich kann an nichts anderes mehr denken.
Nur in einem sind wir uns einig: der andere hat den Kontakt zur Wirklichkeit verloren. Dummerweise kennen wir uns seit Jahrzehnten, noch aus der Schulzeit, viel zusammen erlebt. Wir wollen beide einen Bruch vermeiden.
Nennen wir ihn Tobi oder Murat. Oder André. Es ist egal, er wird sich ohnehin wiedererkennen. André, dieses Buch habe ich für dich geschrieben. Lies es gefälligst!
Was auf dem Spiel steht
Der Klimawandel ist keine wissenschaftlich begründete Erwartung mehr, er wird erfahrbar und spürbar. Aus »Umweltschutz«, nice to have, wird »Menschenschutz«, do or die. Und trotzdem setzt sich die Einsicht nicht durch, dass wir mit aller Kraft gegensteuern müssen.
Naomi Klein hat recht, wenn sie schreibt: »Der Klimawandel ändert alles.« Kaum etwas wird so bleiben wie bisher. Nahrungserzeugung und industrielle Produktion, das Staatensystem und der Welthandel, Migration und politische Herrschaft, all das wird neue Formen annehmen. Viele Gewissheiten werden bald überholt sein, einschließlich einige der sogenannten wissenschaftlich belegten.
Natürlich, die Gesellschaften werden sich so oder so an die neuen Verhältnisse anpassen, auch wenn die globale Durchschnittstemperatur um 2,5 Grad Celsius oder mehr ansteigt. »So oder so«, das bedeutet allerdings entweder eine Anpassung, bei der Bürgerrechte, Menschenwürde und der Lebensstandard der Bevölkerungsmehrheit einigermaßen gewahrt werden – oder eine Anpassung durch Krieg, Abschottung, Notstandsmaßnahmen und eine weiter wachsende Ungleichheit.
»Adaption« bezeichnet Anpassungsmaßnahmen, »Mitigation« das Abmildern, indem weniger Treibhausgase freigesetzt werden oder Kohlenstoff aus der Atmosphäre gebunden wird. Eine fehlgeleitete Adaption sabotiert die Mitigation. Kurzsichtige Reaktionen verschärfen das Problem, so wie das kleine Klimagerät in dieser Küche, das Strom frisst und die Wärme nach draußen schiebt. Oder wie die Unternehmen, die wegen der niedrigen Pegelstände der Flüsse ihre Fracht von Schiffen auf die Straße verlagern. Vieles, was kurzfristig hilft, schadet langfristig, weil es den Treibhauseffekt verstärkt. Viele Anpassungsmaßnahmen helfen (kurzfristig) den einen und schaden den anderen.
Wie human und gerecht die Anpassung an die Heißzeit sein wird, hängt davon ab, ob wir Menschen wie André überzeugen können. Das wird nicht einfach. Aber die Zukunft entscheidet sich auch in Küchengesprächen wie diesem, so pathetisch das klingt und so unangenehm es mir in diesem Moment ist.
Klimaleugner sind nicht geisteskrank
Der innere Widerstand gegen eine Wahrheit ist umso größer, je mehr Angst sie auslöst. Dabei kommt es gerade nicht darauf an, wie groß eine Gefahr ist. Entscheidend ist vielmehr, ob wir uns zutrauen, sie bewältigen zu können. Ein produktiver Umgang mit der Angst benötigt Selbst- und Fremdvertrauen.1 Muss uns da Verleugnung wirklich wundern? Der Klimawandel bedroht die kommenden Generationen – unsere Kinder und deren Kinder –, aber kaum irgendwo kommen Gegenmaßnahmen in Gang. Kaum jemand ist in der Lage, diese monströse Tatsachen wirklich zu begreifen. Noch weniger Menschen können sie in ihre Lebensführung integrieren.
In diesem allgemeineren Sinn sind alle »Klimaleugner«, die ihren Alltag weiterführen wie bisher, solange es eben noch geht. Zugegeben, einige bestehen unbedingt darauf, sich eine ausgefallene, aber angenehmere Naturwissenschaft ohne Treibhauseffekt zurechtzubiegen. Die übliche Form der Abwehr der »unbequemsten aller Wahrheiten« (Al Gore) besteht aber nicht darin, sie rundheraus zu bestreiten. Sie besteht in einer nur formellen Anerkennung, während emotionale Bedeutung und persönliche Betroffenheit abgespalten werden. Die Erkenntnis wird nicht konkretisiert, nicht auf die eigene Person und das eigene Leben bezogen.
Verdrängung gehört zu unserer Lebensform. Sie stellt sich wohlgemerkt kollektiv her. Verleugnung ist sozial erwünscht, das angepasste Verhalten und in diesem (sozialkonstruktivistischen) Sinn angemessen. Nur übertreiben darf man es nicht, zum Beispiel an einem heißen Sommernachmittag durch die Innenstadt joggen, das ist ungesund. Oder für die Winterferien einen Skiurlaub buchen, das wird teuer und enttäuschend.
Ich könnte André einen Vortrag halten, den ich mit dem Hinweis beginne, dass 99 Prozent der wissenschaftlichen Veröffentlichungen den anthropogenen Treibhauseffekt belegen. »Hör auf die Wissenschaft, die weiß es besser!«, rufe ich eindringlich. Nach einem harten Kampf bringe ich ihn dazu, dass er die Wirkung von Kohlenstoffmolekülen in der Erdatmosphäre einräumt. Aber gerade als ich ihn erfolgreich in die Ecke gedrängt habe, weicht er überraschend aus. Er schwenkt um auf radikalen Fatalismus: »Es ist ohnehin zu spät, Alter!« Und was mache ich jetzt?
In Wirklichkeit steht nicht der Klimawandel zur Debatte, sondern unsere Reaktionen auf seine Folgen.2 Wer Adaption und Mitigation für aussichtslos hält, wechselt verblüffend schnell von der Relativierung zum Defätismus und wieder zurück. »Da lässt sich nichts mehr machen«, heißt es dann. »Dann sterben wir eben aus!«
Ist das glaubwürdig? Es mag Menschen geben, die abgebrüht genug sind, um sich vor den kommenden Katastrophen nicht zu fürchten. Die Angehörigen der verschiedenen Klassen haben unterschiedliche Ängste zu verdrängen und unterschiedliche Möglichkeiten, um sich abzulenken. Wer schon seinen Alltag als Kampf empfindet, kann sich sagen: »Der Klimawandel kommt oder kommt nicht, wer kann das wissen? Wenn es so weit ist, werde ich das Beste daraus machen.«
Die Versuchung ist groß, den politischen Gegner auf die psychoanalytische Couch zu legen. Wenn ich das mit André versuche, wird er motzig. Aber vor allem würde bei seiner tiefenpsychologischen Untersuchung nicht mehr herauskommen als bei meiner eigenen. Wir beide haben mit Angst, Hoffnungslosigkeit und Zynismus zu kämpfen. Uns unterscheidet höchstens unser Verhalten. André leidet nicht unter einer mentalen Fehlleistung. Er folgt einer Ideologie.
Der späte Neoliberalismus: Zynismus als Norm
Fatalerweise gehört Zynismus zu den sich selbsterfüllenden Prophezeiungen. Wenn wir glauben, dass alles zu spät ist, ist es wirklich zu spät. Aber Hoffnung muss begründbar und plausibel sein. Sonst ist sie neurotisch. Worauf (und vor allem: auf wen) sollen wir unsere Hoffnung stützen?
Die Klimawissenschaft und die Klimabewegung wissen, dass ein grundlegender gesellschaftlicher Wandel notwendig ist, ein Systemwechsel. Die Zivilgesellschaft soll diesen Wandel herbeiführen, indem sie Druck auf den Staat ausübt.3 Enorme Anstrengungen richten sich darauf, die »Verantwortlichen wachzurütteln«. Aber wir können niemanden aufwecken, der sich nur schlafend stellt.1 Der politische Prozess erscheint wie ein Zweikampf, bei dem Aktivisten und Wissenschaft sich gegen »Sonderinteressen« durchsetzen, um dem Staat die richtige Politik aufzuzwingen.
Dass diese Hoffnung immer wieder aufs Neue enttäuscht wird, ändert nichts an der Fixierung auf den Staat. Er wird als Beschützer vorgestellt, als der Retter in der Not. Seine Handlungsmöglichkeiten werden umso stärker verklärt, je bedrohlicher sich die Klimakrise entwickelt. Wie im Herbst 2021, als junge Klimaaktivistinnen mit einem Hungerstreik ein Gespräch mit dem damaligen Kanzlerkandidaten der SPD erzwangen. »Olaf Scholz redet mit einer beängstigenden Ruhe über seine Pläne, die unser Land direkt in die Klimakatastrophe führen«, erklärte eine Teilnehmerin später. »Das macht mir große Angst.«
Der Wissenschaftliche Beirat der Bundesregierung Globale Umweltveränderungen (WBGU) nennt den Übergang zu einer Gesellschaft ohne fossile Brennstoffe einen Epochenwechsel, eine »Große Transformation« auf der Grundlage eines »neuen Gesellschaftsvertrags«. Zu dieser Transformation gehören die »Heizungswende«, »Energiewende«, »Bodenwende«, »Ernährungswende« und so weiter.2 Aber die staatlichen Maßnahmen sind ungenügend und widersprüchlich. Klimaschädliches wird nicht verboten, Geschäftsmodelle nicht abgewickelt. Alle sollen »mitgenommen werden«, vom Handwerker bis zum Stromkonzern und der Schlachtfabrik. Die ganz Große Transformation soll mit Zuschüssen für tonnenschwere Elektroautos und mehr Biokost im Kindergarten erreicht werden – mit Trippelschritten, obwohl die Zeit davonläuft. Das Missverhältnis wirkt grotesk.
In der ökoliberalen Ideologie bleibt die gesellschaftliche Arbeitsteilung letztlich unverändert. Die Lohnabhängigen arbeiten weiter wie bisher, die Unternehmer investieren und profitieren, die Verbraucher verbrauchen und arbeiten – nur eben fortan ökologisch nachhaltig. Maßnahmen gegen den Klimawandel dürfen Wirtschaftswachstum, Profitabilität der Unternehmen, Austerität und Weltmarktdominanz nicht behindern. Mitigation und Adaption sollen innerhalb der neoliberalen Ordnung stattfinden. Mit anderen Worten, sie finden nicht statt.
Viele Klimaaktivisten halten die halbherzigen und widersprüchlichen Wende-Manöver dennoch für »besser als nichts«, für »einen Einstieg in eine ambitioniertere Klimapolitik«. André, unseren personifizierten Anti-Ökologen, überzeugt das nicht. Er erwartet von »denen da oben« gar nichts oder jedenfalls nichts Gutes. Die idealistische Auffassung der parlamentarischen Demokratie findet er naiv. Von der Regierung fühlt er sich nicht beschützt, sondern gegängelt.
Sein Zynismus ist faktengesättigt: Die Schulen, die Krankenhäuser, sogar die Müllabfuhr, all das funktioniert doch kaum noch! Aber diese Regierung will globale Probleme lösen und die Welt verbessern … Ich kann ihm nur halbherzig widersprechen. Daseinsvorsorge, Gemeinwohl, die Worte klingen anachronistisch. Die sozialen Mindeststandards von früher sind längst nicht mehr gewährleistet. Gleichzeitig hält der Staat mit Krediten und Subventionen Banken, Unternehmen und ganze Branchen am Leben. Der Neoliberalismus ist alt geworden: Er lebt noch, aber er verhält sich immer merkwürdiger.
Letztlich wirtschaften sie doch alle in die eigene Tasche, sagt André (und wieder fällt es mir schwer, ihm zu widersprechen). Wer es anders macht, ist der Dumme. Das Gerede über Nachhaltigkeit hält er für bloße Werbung, eine grüne Verpackung für neue Geschäftsmodelle. Er hat keine Lust, die Große Transformation aus seinem schmalen Geldbeutel zu bezahlen.
Zielsicher verweist er auf die Widersprüche, Ungereimtheiten und Ungerechtigkeiten der Umweltschutzpolitik. Auf einmal zeigt er sich erstaunlich gut informiert. Einweggeschirr aus Plastik zu verbieten betrifft einen winzigen Anteil der Gesamtmenge, »nur 0,5 Prozent!«, erklärt er mir. Was ist mit den Autoreifen? Mit den Lebensmittelverpackungen? Klassischer »Whataboutism«. Aber dieses rhetorische Manöver ist gefährlich. Unausgesprochen hat er eingeräumt, dass das Ziel eigentlich vernünftig ist.
Andrés Denke zeigt in gewisser Weise, wie erfolgreich die neoliberale Konterrevolution seit den 1970er Jahren gewesen ist. Er misstraut allen Institutionen, da macht er kaum Unterschiede. Ihm fehlt der Glauben, dass kollektive Lösungen überhaupt möglich sind. Es mangelt ihm, um ein letztes Mal einen unpassend psychologischen Begriff zu bemühen, an »Selbstwirksamkeitserwartung«, an Selbst- und Fremdvertrauen. Seine Anteilnahme beschränkt er weitgehend auf seine Angehörigen und einen kleinen Freundeskreis, zu dem auch ich gehöre. Noch.
Eine Denke verändert sich nicht, wenn die Verhältnisse gleich bleiben. André ist voller Wut und Misstrauen. Aber er ist kein böser Mensch. Er liebt seine Kinder so sehr wie andere Leute. Er wäre sogar bereit, auf Flugreisen und Rindfleisch zu verzichten, meint er. Aber dann soll das bitte schön für alle gelten. Und weltweit muss es umgesetzt werden, aber da machen die Chinesen und die Amis nicht mit …
Vielfache Krise und Wende nach rechts
Ich habe die weitläufigen Ansichten meines alten Freundes so ausführlich dargestellt, um zu zeigen, dass seine Haltungen und seine politische Orientierung uneindeutig sind. Noch lässt er sich verunsichern, ist nicht ideologisch gefestigt. Aber es besteht durchaus die Gefahr, dass er sich (noch weiter) nach rechts wendet.
Das ungute Gefühl, dass es »so nicht weiter gehen kann«, greift um sich. Angst davor, den Halt zu verlieren. In den Apotheken gibt es wochenlang keinen Fiebersaft für Kinder. Das Mehl im Supermarkt ist rationiert (»Nur fünf Stück pro Person!«). Butter und Kartoffeln kosten doppelt so viel wie früher, die Heizung auch.
Hat das mit der Klimakrise zu tun? Die Gemengelage ist komplex, die Krisenschübe abrupt und unvorhersehbar. Die gegenwärtige Vielfachkrise umfasst nicht nur das Ökologische, sondern Geopolitik, Nationalökonomie und Welthandel. Sie zeigt sich (ohne Anspruch auf Vollständigkeit) an Kriegen und der beschleunigten militärischen Aufrüstung, am zunehmenden Protektionismus im Welthandel, an zerbrechenden Lieferketten, einem mageren Wirtschaftswachstum beziehungsweise der Rezession und der »Krise der sozialen Reproduktion«, das heißt: einer immer schlechteren Versorgung und Unterstützung durch öffentliche Dienste, Gesundheitssystem und Sozialstaat.4
Dass die Menschen sich da überfordert und unsicher fühlen, ist nur zu verständlich. Sie fürchten sich vor unterschiedlichsten Bedrohungen: vor Klimawandel, Krieg und politischem Extremismus, vor Russen und Chinesen, Einwanderern und Kriminellen, Altersarmut, steigende Lebenshaltungskosten und Mieten. Eine Rückkehr zur sogenannten Normalität der bundesdeutschen Gesellschaft, als Krisen und Katastrophen sich noch irgendwo anders ereigneten und brave Bürger nicht zu interessieren brauchten, ist versperrt. Aber je bedrohlicher die Zukunft wirkt, umso rosiger scheint die Vergangenheit gewesen zu sein.
Die Kehrseite von Angst ist Wut. Es wächst der Wunsch nach einem starken Beschützer, der durchgreift und Ordnung schafft, nach einem Beruhiger. Reaktionäre und faschistische Bewegungen sind im Aufwind. Zu ihrem Programm gehört unweigerlich die Blockade selbst maßvoller Anpassungsmaßnahmen, wodurch sie die krisenhafte Entwicklung weiter beschleunigen.
In Bezug auf die ökologische Krise ist die verzweifelt-reaktionäre Haltung schwer zu ertragen. Mich erinnert sie an Passagiere, die durch das Flugzeugfenster sehen, wie Rauch aus der Turbine quillt. Sie erwarten, dass der Kapitän eine beruhigende Durchsage macht. Sie ermahnen die Sitznachbarn, sich bloß nicht aufzuregen.
Trotzdem, ich werde André nicht überzeugen, indem ich ihn als »Besitzstandswahrer« anklage. Ihn für verhetzt zu erklären oder ihm den Mund zu verbieten, zementiert nur die politische Blockade zwischen rechter Verleugnung und ökoliberaler Symbolpolitik. In Wirklichkeit klammert er sich nicht an den Status quo, weil er davon profitiert. Sein Whataboutism ist janusköpfig, so wie auch seine Ablehnung der Verhältnisse. Ich muss ihn überzeugen, dass eine gerechte Anpassung möglich ist, ohne wolkigen Idealismus und falsche Hoffnungen.
Nicht verrückt werden, Hoffnung schöpfen
Die Veränderungen durch die Klimakrise kommen by disaster or design, heißt es oft – entweder chaotisch in katastrophaler Form oder geplant und abgemildert. Aber es ist zu spät, um die Katastrophen zu verhindern. Die Anpassung wird geprägt sein von Katastrophen und Planung, von Chaos einerseits und separaten Plänen auf Sichtweite der diversen Akteure (Behörden, Unternehmen, Haushalten und so weiter) andererseits. Menschen werden sterben, Infrastrukturen zusammenbrechen und Lücken hinterlassen. Staatliche Behörden werden mit dirigistischen Vorgaben und Adhoc-Maßnahmen versuchen, Produktion und Versorgung aufrechtzuerhalten. Die Anpassung wird bestimmt sein von Kontingentierung, Korruption und Improvisation: kein abrupter Zusammenbruch durch die eine Großkatastrophe wie im Kinofilm, aber auch keine vorausschauende Transformation. Die Auseinandersetzungen, wer sich wie vor den Folgen schützen kann, werden aber selbstverständlich weitergehen. Es ist nicht irgendwann zu spät, um für eine vernünftige, bessere Anpassung zu kämpfen.
Dieses Buch behandelt, wie sich die Landwirtschaft verändern wird, welche Anpassungsmöglichkeiten sie bietet und was ihnen im Weg steht. Im Ernährungssystem verbinden sich alle Widersprüche der gegenwärtigen Vielfachkrise. Ich beschreibe, wie die Agrarproduktion die ökologische Krise antreibt und gleichzeitig zunehmend unter ihr leidet. Die aktuellen Versuche, sie fabrikmäßig zu organisieren, stehen beispielhaft für die Entwicklung der Produktivkräfte, die in mehrfacher Hinsicht in eine Sackgasse geraten sind.
Die politische Ökonomie des Agrarsystems (die ich nur ganz oberflächlich und in Umrissen darstellen kann), ist eine notwendige Grundlage, um über sinnvolle Agrarreformen nachzudenken. Die Recherche zur Agrarfrage des 21. Jahrhunderts hat mir gezeigt, dass einfache Antwort nur falsch sein können. Mich hat immer wieder erstaunt, mit wie viel Überzeugung und Sendungsbewusstsein Wissenschaftler, Landwirte und Umweltaktivisten sehr simple Vorschläge machen, wie und wer die Welt ernähren kann.
Die Agrartechnik und die verschiedenen Anbaumethoden spielen dabei eine wichtige, aber widersprüchliche Rolle. In der ökoliberalen Ideologie ist Technik der deus ex machina: Innovative Produktionsverfahren wenden die Sache noch einmal zum Guten: »Rindersteak raus, Laborfleisch rein!« – »Sojaschrott raus, Insektenproteine rein!« Dann kann angeblich alles andere beim Alten bleiben, die Vertriebswege, der Preisdruck, die Armut. Die Reformideen aus der Umweltschutzbewegung sind allerdings selten ausgearbeiteter: »Monokultur raus, Permakultur rein!«
Mich haben weder diejenigen überzeugt, die auf Biotechnik und weitere Produktivitätssteigerungen setzen, noch die, die Veganismus, Direktsaat und Degrowth für die Lösung halten. Für die Landwirtschaft der Zukunft gibt es kein Allheilmittel, kein Patentrezept, nicht einmal eine Lösung, die gleiche Erntemengen mit weniger Arbeit und weniger Umweltverbrauch erzielen kann. Aber gibt es durchaus Möglichkeiten, um gute Nahrung mit guter Arbeit für alle zu erzeugen. Vieles wäre einfach umzusetzen, trotz der Klimakrise, und läge im unmittelbaren Interesse der breiten Bevölkerung.
Uns diese Möglichkeiten bewusst zu machen, trägt vielleicht dazu bei, dass wir uns von der Angst nicht lähmen lassen.
1Der Psychologe Albert Bandura spricht in diesem Zusammenhang von »Selbstwirksamkeitserwartung« und »Kontrollüberzeugung«, Aaron Antonovsky von »Kohärenzsinn«.
2Iris Beau Segers und Manès Weisskircher unterscheiden zwischen verschiedenen Formen der Klimaskepsis (›What is the relationship between the far right and environmentalism?‹ 2022, C-REX Compendium, online: www.sv.uio.no/c-rex) »Trend scepticism« bezweifelt den Klimawandel. »Attribution scepticism« bezweifelt, dass menschliche Aktivitäten ihn auslösen. »Impact scepticism« bezweifelt die Folgeschäden (und damit die Notwendigkeit, Gegenmaßnahmen zu treffen). »Process scepticism« bezeichnet die Ablehnung von Gegenmaßnahme.
3Der Begriff »Zivilgesellschaft« saugt Bedeutungen auf wie ein Schwamm. Meist werden darunter freiwillige politische Zusammenschlüsse verstanden, die einerseits Staat und andererseits Ökonomie gegenübergestellt werden. Sie liegen also zwischen oder neben der »Sphäre der Herrschaft« und der »Sphäre der Produktion und Verteilung«. Allerdings überlappen diese Bereiche in der Zivilgesellschaft, auch in der Klimabewegung selbst. Ihre Programmatik wird mitbestimmt von zwischenstaatlichen Organisationen (wie der UNO), Behörden (wie dem Umweltbundesamt), nationalen und internationalen Stiftungen (wie Umweltstiftungen oder der Open Society Foundation) und halbstaatlichen Forschungsinstituten (wie dem Potsdamer Institut für Klimafolgenforschung).
4Besonders verunsichernd wirken Inflation und Deflation. Rapide schwankende Geldwerte zerrütten kapitalistische Gesellschaften zuverlässig. Die inflationären und deflationären Tendenzen und die Veränderungen im Währungssystem werden für die weitere Krisenentwicklung entscheidend sein. Nahrungspreise spielen dabei eine wichtige Rolle.
2.Die Heißzeit:Landwirtschaft im Anthropozän
Bevor wir uns der Landwirtschaft der Zukunft und ihrer politischen Ökonomie widmen können, muss zunächst etwas Wichtiges festgehalten werden: Die Intensivierung und Rationalisierung der Agrarproduktion haben ein Ausmaß erreicht, das die natürlichen Ressourcen, die Bodenfruchtbarkeit und ihre ökologische Erneuerung überfordert. (Sorry, André, da musst du durch …) Die Landwirtschaft hat die Kreisläufe von Energie, Wasser und Nährstoffen tiefgreifend verändert. Die Kehrseite ihrer enormen Produktivität ist die Zerstörung der alten Bauernschaften und Agrarsysteme.
Der Klimawandel ist ein Aspekt der ökologischen Krise, aber bei weitem nicht der einzige. Die zunehmende Konzentration von Treibhausgasen lässt die Temperaturen steigen. Diese Veränderung, so schlimme Folgen sie auch hat, wäre zu bewältigen, wenn die Durchschnittswerte nur ein wenig angehoben würden und ansonsten alles bliebe wie bisher. Leider funktioniert das Erdsystem so nicht. Der verstärkte Treibhauseffekt verändert das ganze System, die Meeresströmungen und Höhenwinde, damit wiederum die Muster von Niederschlag und Pflanzenreifung. Die Schwankungen nehmen zu, das Klima wird unberechenbarer.
Darunter leidet auch die Produktivität des Bodens, für die Landwirtschaft letztlich das Entscheidende. Damit Erde fruchtbar bleibt, muss sie regelmäßig durchfeuchtet werden. Anhaltende Phasen von Hitze und Dürre lassen sie austrocknen. Sie verliert Durchlässigkeit und Humus (organisches Material). Ab einem gewissen Punkt der Verödung (Degradation) wird der Boden weggeweht oder von Niederschlägen oder gestautem Hochwasser weggespült (Erosion).
Hitze, Wassermangel und die gestörten jahreszeitliche Rhythmen führen dazu, dass Tiere und Pflanzen abwandern oder aussterben. In der Folge brechen Beute-Jäger-Systeme zusammen. In den destabilisierten Ökosystemen verbreiten sich bekannte und neue Schädlinge und Pflanzenkrankheiten.1
Zu diesen Entwicklungen trägt die Landwirtschaft selbst erheblich bei. Die Landwirte bewässern und düngen zu viel oder in falschen Rhythmen. Dem Boden wird keine Ruhepause gegönnt: Weniger Fläche bleibt für kürzere Zeiträume brach. Fruchtfolgen beschränken sich auf weniger Kulturen als früher. Die landwirtschaftlichen Erzeuger legen weiträumige Monokulturen an. Ackerflächen sind nicht mehr umgeben von Wald, Moor oder Wiese. Die Landschaften sind »ausgeräumt«, eintönig bis zum Horizont, ohne Strauch, Bach oder Baum. Lebensräume für Kräuter, Insekten, Vögel und Säugetiere schrumpfen, sie werden außerdem durch Agrarpestizide dezimiert.
So verschlechtern sich auch die Anbaubedingungen für die Landwirte. Die natürliche Schädlingskontrolle, die Regeneration der Bodenfruchtbarkeit und die Reinigung der Niederschläge auf dem Weg ins Grundwasser lassen nach oder fallen gänzlich aus. Treibhauseffekt, Artensterben, ausbleibende oder zu starke Niederschläge machen die Ernten unsicherer. Hochsommerliche Temperaturen im Frühjahr lassen die Obstbäume vorzeitig blühen. Wenn dann die Temperaturen einbrechen, kommt es zu Frostschäden. Eine mehrjährige Dürre kann von einer viel zu feuchten Saison abgelöst werden. Schäden durch Sturm, Hagel und Überschwemmungen nehmen zu. Mit den alten Bauernweisheiten lässt sich nichts mehr anfangen.
Eine Landwirtschaft mit planetarer Reichweite
Die Landwirtschaft hat die Erdoberfläche grundlegend umgestaltet. Um Neuland unter den (Traktor-)Pflug zu nehmen, werden Wälder abgeholzt, Feuchtgebiete und Heiden zu Acker- und Weideland gemacht. Etwa die Hälfte der Erdoberfläche wird mittlerweile agrarisch genutzt, von den eisbedeckten Landmassen und unbewohnbaren Wüsten einmal abgesehen. Etwa drei Viertel dienen als Viehweiden. Auf der restlichen Fläche werden Nutzpflanzen angebaut. Seit der Jahrtausendwende ist die Anbaufläche weiter gewachsen, vor allem um Palmöl, Zuckerrohr, Soja und Mais anzubauen.
Die Landwirtschaft umspannt nicht nur den Erdball, sondern nutzt auch einen erheblichen Teil der verfügbaren Ressourcen – Energie, Wasser, Nährstoffe. Sie ernährt die Menschheit, indem sie gewaltige Mengen (nicht erneuerbarer) Energie verschlingt, für die Herstellung von Agrarchemikalien (Pflanzenschutz- und Düngemittel), für den Einsatz der Landmaschinen und den Transport. Fuel, Fertiliser, Food – Treibstoff, Dünger und Nahrung – sind miteinander verwoben.
Etwa drei von vier Litern des Süßwassers fließt in die Agrarproduktion. Die Landwirtschaft entzieht es anderen Ökosystemen, ein weiterer Treiber des Artensterbens. So verändert sie die lokale und globale Wasserzirkulation, das heißt: die Muster von Niederschlag, Abfluss und Verdunstung. Grundwasser wird aus immer tieferen Schichten geholt. Ausbleibende Niederschläge führen dazu, dass größere Flächen künstlich bewässert werden. Aber in heißen und trockenen Regionen untergräbt eine falsche Bewässerung ebenfalls die Bodenfruchtbarkeit. Ein großer Teil des Bodens weltweit gilt als schwer geschädigt.2
Unser täglich´ Fleisch gib uns heute
Der Ressourcenhunger der Landwirtschaft entsteht zu einem Gutteil durch die Fleisch- und Milchproduktion. Seit 1961 hat sich die jährliche Weltschlachtmenge von Rindern annähernd verdoppelt, bei Schweinen fast vervierfacht und bei Masthühnchen ungefähr verzehnfacht. Die »Verfleischung der Ernährung« (meatification), wie der Umweltgeograph Tony Weis es nennt3, erfasste nach dem Zweiten Weltkrieg zunächst die frühindustrialisierten Länder in Nordamerika und Europa. Seit den 1980er Jahren ziehen Länder wie Brasilien und China nach.3
An Zahl und Körpergewicht übertreffen Schlacht- und Nutztiere ihre wilden Verwandten mittlerweile um ein Vielfaches. Über ein Drittel der globalen Biomasse – des Gesamtgewichts aller Lebewesen – machen allein die Rinder aus.4 Seit 2019 übertrifft die Biomasse der Brathähnchen die aller anderen Vögel.4 Im Jahr 2021 wurde die schwer vorstellbare und schwer auszuhaltende Zahl von 1,4 Milliarden Schweinen und 331 Millionen Rindern geschlachtet.
Nutztiere haben Hunger. Auf etwa drei Vierteln der landwirtschaftlichen Fläche wird Futter für sie angebaut (400 Millionen Hektar).5 Außerdem dienen über drei Milliarden Hektar als Weideland. Futtermittel wuchsen Jahrhunderte, eigentlich sogar Jahrtausende lang auf Weideland (»Grünland«). Diese Kulturlandschaften bieten vielen Arten einen Lebensraum, die Vegetation verlangsamt die Wasser- und Kohlenstoffkreisläufe und festigt den Boden. Aber Weidewirtschaft macht mehr Arbeit und bringt geringere Erträge als eine Stallhaltung mit Kraftfutter aus Mais- und Sojamehl. Deshalb geht der Anteil des Grünlands zurück, auch wenn insgesamt mehr Tiere auf Weiden gehalten werden.6
Dagegen wächst der Anteil der geschlossenen Mastanlagen (Confined Animal Feeding Operations, kurz CAFO). Die räumliche Konzentration in der Nutztierhaltung schreitet überall voran. Den bisherigen Rekord stellt eine Schweinemast-Anlage in der Stadt Enzou in China auf: 58.000 Sauen, verteilt auf 26 Stockwerken und eine Gesamtfläche von 800.000 Quadratmetern.
Fernbeziehungen in der Agrarproduktion
Durch die Trennung von Ackerbau und Viehzucht verändern die Nährstoffkreisläufe ihre Reichweite und Richtungen. In der Fleischproduktion sind eine industrielle Düngemittelerzeugung, landwirtschaftliche Monokulturen, die das Tierfutter erzeugen, und die fabrikmäßige Mast und Schlachtung über weite Distanzen miteinander verschaltet. Der Dünger kommt (beispielsweise) aus Russland, wird (beispielsweise) nach Brasilien geliefert und dort im Sojaanbau eingesetzt. Die Bohnen werden geerntet, gemahlen und exportiert. Die Nährstoffe im Sojamehl wandern abermals über den Atlantik (beispielsweise) nach Deutschland und werden dort für die Mast eingesetzt. Die Hühner (beispielsweise) verdauen sie und scheiden sie wieder aus. In Form von Gülle geht ihre Reise weiter.
Lokale Nährstoffkreisläufe wurden ersetzt durch »Telecoupling«, Fernwirkungen, die verschiedene Stationen der agrarindustriellen Erzeugung verbinden. In Gang gehalten werden diese Stoffströme mit fossilen Treibstoffen und setzen entsprechend Kohlendioxid frei. Telecoupling gibt es auch beim Wassergebrauch. Insbesondere für Sonderkulturen für den Export (cash crops) muss viel Wasser aufgewendet werden.7 Die Nahrung wird nicht vor Ort verzehrt, sondern exportiert. So zapfen Importnationen die Wasservorräte in Erzeugerregionen an (»virtuelles Wasser«).
Aus Gründen, die wir noch erläutern werden, sinkt die Vielfalt der Agrarprodukte. Die Ernährung ist für große Teile der Menschheit abwechslungsreicher geworden als früher, die Zahl der Agrarrohstoffe dagegen enorm geschrumpft. Der weltweite Bedarf an Kohlenhydrat, Fett und Eiweiß wird heute mit einer bemerkenswert kleinen Zahl von Nutzpflanzen gedeckt. Gerade einmal zehn verschiedene Pflanzen beanspruchen 58 Prozent der Ackerfläche. »In der menschlichen Geschichte wurden siebentausend verschiedene Nahrungspflanzen angebaut oder gesammelt«, betont Tony Weis. »Heute ernähren im Wesentlichen dreißig Feldfrüchte die Welt.«5
Die wesentlichen Zutaten der Welternährung sind Getreide (Weizen, Mais, Reis), Ölsaaten (Raps, Soja, Sonnenblumen), Zucker und Fruchtsäfte. Die Lebensmittelindustrie kombiniert und verfeinert sie trickreich und bringt neue Variationen in die Supermarktregale in den Metropolen, ergänzt durch die »Trendlebensmittel« der Saison.
Getreide aus Hochleistungssorten ist für die Welternährung unverzichtbar. Sie haben den Vorteil, dass sie Stickstoff und andere Nährstoffe aus synthetischen Düngemitteln schnell und zuverlässig in essbare Biomasse verwandeln.8 Dieser Dünger in der Form von Kügelchen oder Pulvern wird aus Ammoniak hergestellt (»mineralischer Dünger«). In einem äußerst energieaufwändigen Prozess wird Stickstoff aus der Luft mit Erdgas zur Reaktion gebracht. Diese Ammoniaksynthese ist für weltweit etwa zwei Prozent des jährlichen Energieumsatzes und etwa 1,4 Prozent der Kohlenstoffemissionen verantwortlich.6* »Die Stickstoffmenge, die in der Umwelt zirkuliert, hat sich durch Kunstdünger und durch Stickoxide, die beim Verbrennen von Kohle, Erdöl und Erdgas frei werden, verdoppelt«, erklärt der Umweltjournalist Christian Schwägerl.7
So bringt die Landwirtschaft unausgesetzt einerseits Kohlenstoffdioxid in die Atmosphäre und zieht andererseits aus ihr Stickstoff in den Boden. Dort bleibt der Nährstoff selbstredend nicht. Die Nutzpflanzen setzen einen Teil um in essbare Biomasse.8 Ein anderer Teil, durchschnittlich ein Sechstel, entweicht in der Form unterschiedlicher Gase in die Atmosphäre.10 Ein weiteres Sechstel wird ausgewaschen und gelangt als Nitrat ins Grundwasser, in die Flüsse und letztlich ins Meer. Der Nährstoffüberschuss (»Eutrophierung«) führt dazu, dass Cyanobakterien überhandnehmen, die andere Lebensformen verdrängen.9 Die natürliche Stickstoffbindung über die Feldpflanzen fällt dagegen immer spärlicher aus. Deshalb kommt die Agrarproduktion ohne Telecoupling gar nicht mehr aus.
Im Gegensatz zu Stickstoff kann das Phosphor, eine weitere unverzichtbare Zutat zu den Düngemitteln, nicht industriell-synthetisch hergestellt werden. Er stammt aus Phosphorit-Gestein, das im Bergbau gefördert und dann herausgelöst wird. Auch ein Teil des Phosphors wird (als Phosphat) aus dem Ackerboden ausgewaschen und wandert ins Meer. Der andere Teil nimmt einen Umweg, landet aber ebenfalls letztlich dort: Die Ackerpflanzen verwandeln ihn in Biomasse, die gegessen und ausgeschieden wird. Der Phosphor fließt mit dem Abwasser in die Kanalisation und geht verloren, obwohl es sich bei diesem Element um eine endliche Ressource handelt, die alle Lebewesen für ihren Stoffwechsel benötigen.
Eine Landwirtschaft mit immer weniger Landwirten
Wenn wir lediglich die geschlachteten und geernteten Mengen betrachten, nötigen die Erfolge der Landwirtschaft Respekt ab. Zwischen 1961 und 2022 vervierfachte sich die jährliche Fleischproduktion.11 Die globale Getreideernte verdreifachte sich. Die Landwirtschaft ernährt über acht Milliarden Menschen. Erstaunlich wenige davon beteiligen sich daran. Nur noch zwei Milliarden Menschen arbeiten in der Landwirtschaft, mit abnehmender Tendenz. Jahrtausendelang bearbeiteten mindestens drei von vier Menschen den Boden. Nun hat sich das Verhältnis umgekehrt. Nur noch einer von vier Menschen ist in der Landwirtschaft tätig.
Diese Entwicklung ist nicht neu. Schon im mittelalterlichen Europa nutzten die Landwirte neue Anbaumethoden und steigerten die Erträge. Ende des 19. Jahrhunderts entstand ein Weltmarkt für Agrargüter. Landwirtschaftliche Arbeitskraft wurde freigesetzt, weil ihr Anbau der Konkurrenz nicht standhalten konnte. Aber die Rationalisierung der Landarbeit – in welcher Form auch immer sie geleistet wird – hat sich Ende des 20. Jahrhunderts beschleunigt und die ganze Welt erfasst. Zwischen 1991 und 2020 sank der Anteil der Landarbeit an der Erwerbstätigkeit insgesamt von 44 Prozent auf 27 Prozent.12 870.000 Millionen Menschen kehrten der Landwirtschaft den Rücken. In China ging der Anteil von 60 auf 25 Prozent zurück. Lediglich in Afrika südlich der Sahara und in Südasien liegt er noch bei 40 Prozent.
Niemals zuvor hat die Arbeit von so wenigen Menschen so viele satt gemacht. Der Historiker Eric Hobsbawm sprach von einem »Untergang des Bauerntums im 20. Jahrhundert«10 – zugespitzt, aber im Kern richtig. Während die Zahl der Landwirte und Landarbeiter zurückgeht, wächst die Beschäftigung in anderen Sektoren. Aus Agrargesellschaften werden Industriegesellschaften, eine Entwicklung, die als Strukturwandel bezeichnet wird. Er ist die Kehrseite der landwirtschaftlichen Intensivierung (die Steigerung der Flächenproduktivität) und Rationalisierung (die Steigerung der Arbeitsproduktivität).
In vielen Weltregionen wurde allerdings mehr Landarbeit freigesetzt, als der industrielle und Dienstleistungssektor aufnehmen konnte. Es sei nicht verwunderlich, bemerkte Eric Hobsbawm, dass das Bauerntum in jenen Ländern verschwand, die eine rasche Industrialisierung durchlebten. Jedenfalls »weniger erstaunlich als ein ganz unerwartetes Phänomen: Die Anzahl der Bauern und Landarbeiter verringerte sich auch dort, wo die Industrialisierung ganz augenscheinlich ausgeblieben war.«11
Ehemalige Landarbeiter und Landwirte haben ihren Zugang zum Boden verloren. Sie sind lohnabhängig geworden, müssen ihre Arbeitskraft verkaufen. Aufgrund von industriellen und landwirtschaftlichen Überkapazitäten brauchen die Unternehmen diese »Bodenlosen« aber nicht wirklich.13 Damit verändert sich auch die Landflucht. »Es gibt nicht genug Jobs für diejenigen, die bereits in den Städten sind«, erklärt der Historiker Aaron Benanav. »Die ländlichen Armen, die kaum Beschäftigung vor Ort finden, sind dennoch gezwungen, dort zu bleiben, obwohl es kaum Arbeit gibt.«12
Viele finden nur ein prekäres Auskommen als unterbeschäftigtes Landproletariat, manche betreiben weiter Landwirtschaft zur Selbstversorgung. Dennoch ziehen etwa 200 Millionen Menschen jedes Jahr vom Land in eine Großstadt. In manchen Fällen führt die Landflucht weiter in die Metropolen, von Süd- nach Nordamerika, von Asien und Afrika nach Europa, in die Golfstaaten oder nach Südkorea, Singapur und Taiwan.14
Insgesamt leben gegenwärtig etwa 281 Millionen Menschen außerhalb der Nation ihrer Geburt, damit ungefähr einer von 20 Menschen. Deutlich mehr leben in Städten als auf dem Land (gut eine Milliarde). Die Urbanisierung hat auch ökologische Folgen. Städte benötigen ein Hinterland, das sie versorgt. Die Konzentration der Bevölkerungen führt dazu, dass die urbanen Zentren Wasser, Energie und Nährstoffe gleichsam aufsaugen. Die Nährstoffe und das Wasser fließen aber nicht zurück oder nur miteinander vermischt und verschmutzt.15
Naturbeherrschung außer Kontrolle
Erst die Intensivierung und Rationalisierung der Agrarproduktion hat möglich gemacht, dass der größere Teil der Menschheit in Städten lebt und anderen Beschäftigungen nachgeht, als den Boden zu bearbeiten. Intensivierung und Rationalisierung haben aber auch biologische, ökologische und klimatische Folgen. Mittlerweile führen die großen Kreisläufe des Erdsystems – Wasser, Kohlenstoff, Stickstoff, Energie – zu einem großen Teil durch Nutzpflanzen und Nutztiere hindurch. Die Biomasse aller Landlebewesen (unter Ausschluss der Gliedertiere) setzt sich zusammen aus vier Prozent Wildtieren, 34 Prozent Menschen und 62 Prozent Nutztieren.
Eben das meint der Begriff Anthropozän: Der Mensch und sein Stoffwechsel mit der Natur prägen das Erdsystem, bis hinein in die geologischen Strukturen. Im Anthropozän wird alles zur Kulturlandschaft, gewollt oder ungewollt. An sich ist daran nichts Verwerfliches. Natur anzueignen und den eigenen Bedürfnissen zu unterwerfen, macht den Menschen aus. Die Landwirtschaft hat immer schon das Erdsystem verändert.13 Aber mithilfe der im Erdöl gespeicherten Energie und der Petrochemie greift sie seit dem 20. Jahrhundert noch tiefer in die globalen Kreisläufe ein, verändert ihre Stärke und Richtung.
Die atemberaubenden Energie-, Stoff- und Produktmengen, die in diesem Kapitel angeführt wurden, sollen nicht nahelegen, dass die Menschheit es mit ihrer Naturaneignung »übertreibt«, obwohl sie durchaus mehr Rücksicht auf die anderen Lebensformen nehmen sollte, wie ich finde. Das eigentliche Problem ist, dass die agrarindustriellen Kreisläufe nicht stabil sind. Manche reißen ab, wie im Fall von Phosphor, das für die nächsten Jahrmillionen auf dem Meeresgrund liegt. Andere führen zu Ungleichgewichten, wie im Fall des Stickstoffs, der an manchen Stellen übermäßig vorhanden ist, während er anderswo fehlt. Der Treibhauseffekt verstärkt und beschleunigt die Verdunstung und die Wind- und Meeresströmungen. Die Kreisläufe fließen unregelmäßiger, stoßweise, in der Form von Unwettern und Stürmen.16
Kurz, diese Landwirtschaft ist ebenso produktiv wie destruktiv. Sie vermehrt einige wenige Pflanzen und Tiere und rottet eine Vielzahl anderer aus. Diese chaotischen Vorgänge Naturbeherrschung zu nennen, ist ungenau. Ebenso gut ließe sich jemand als der Herrscher des Gemüsebeets bezeichnen, weil er darüber trampelt. Wer unbedingt möchte, kann von einer »unbeherrschten Naturbeherrschung« sprechen, bei der sich die Kontrollmöglichkeiten höchstens auf eine Handvoll Jahrzehnte erstrecken. Die Landwirtschaft lenkt in gewisser Weise das Erdsystem. Dummerweise sitzt niemand am Steuer, denn die Agrarproduktion ist ja nur die Gesamtheit konkurrierender Landwirte, Unternehmen und Staaten.
Zielkonflikte und schwierige Abwägungen
Der Treibhauseffekt, die Übersäuerung der Meere, gestörte Nährstoffkreisläufe, Süßwasserübernutzung, Artenverlust, Versiegelung und Verödung des Bodens, all das wird auch für die Landwirtschaft selbst zum Problem. Diese klimatisch-ökologischen Verwerfungen dürfen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Wir können uns leider nicht »erst einmal« um den Treibhauseffekt kümmern und Bodenerosion und Artensterben danach angehen. Degradierte Böden speichern weniger Kohlenstoff, aber ohne Biodiversität degradieren sie schneller. Weniger Monokultur und Agrarchemie bedeuten weniger Ertrag, aber die Landwirtschaft kann nicht noch mehr Wälder und Grünland beanspruchen, um den Rückgang auszugleichen. Die verbliebenen intakten Biotope binden Kohlenstoff und beherbergen Pflanzen-Tier-Systeme (Biozönosen), sind daher kaum verzichtbar.
Werden weiter ungebremst Treibhausgase ausgestoßen, besteht wegen der Temperaturspitzen und der unregelmäßigen Wasserversorgung keine Chance, die Bodenfruchtbarkeit aufrechtzuerhalten. Der Umstieg auf erneuerbare Energiequellen benötigt aber ebenfalls mehr Fläche. Die Ursachen und die Folgen der ökologischen Krise sind miteinander verwoben.
Im Folgenden wird dieser Problemkomplex als »Heißzeit« bezeichnet.17 Ich benutze den Begriff aus stilistischen Gründen. Er ist einfach griffiger als »in einer Welt, in der die durchschnittliche globale Oberflächentemperatur zwei Grad Celsius oder mehr über dem vorindustriellen Niveau liegt, Biotope und Biozönosen dezimiert sind und die klimatischen Verhältnisse stärker variieren als im Holozän«. Gemeint ist mit dem Ausdruck Heißzeit aber genau das. Er verweist auf den Zusammenhang der Umweltveränderungen und ihren epochalen Charakter.
1Der sogenannte Schädlingsdruck wird außerdem durch mildere Winter verstärkt. Die Zerstörung von Lebensräumen sorgt dafür, dass sich die sogenannten Generalisten auf allen Ernährungsstufen durchsetzen, die robuster sind und sich vielseitiger ernähren können. Dadurch werden spezialisiertere Gattungen zusätzlich unter Druck gesetzt.
2Bodendegradation umfasst Erosion, Versalzung, Verdichtung, Versauerung und Verschmutzung. Die Schätzungen der Erosion liegen zwischen einem Drittel bis zur Hälfte der globalen Fläche. Agrarflächen sind überdurchschnittlich häufig betroffen – ein vernichtendes Urteil über die gegenwärtige Landwirtschaft. Vgl. Food and Agriculture Organization of the United Nations and Intergovernmental Technical Panel on Soils (2015) Status of the World’s Soil Resources. Main report. Rome, Italy. Online: www.fao.org/3/a-i5199e.pdf.
3In Brasilien stieg der Fleischkonsum in diesem Zeitraum auf das Dreifache, in China um das Sechsfache.
4Dabei handelt es sich sämtlich um Exemplare der Hühnerrasse gallus gallusdomesticus.
5Futtermittel werden weltweit gehandelt, aber die tierischen Produkte (Fleisch, Milch, Eier) überwiegend im Inland verbraucht. 90 Prozent, schätzen Tony Weis / Allison Gray (2021) The meatifiction and re-meatification of diets: The unequal burden of animal flesh and the urgency of plant-meat alternatives. Online: https://search.issuelab.org.
6Wo Weiden und Wiesen noch genutzt werden, düngen und mähen die Viehhalter häufiger als früher und säen nur noch eine Handvoll besonders schnell wachsender, eiweißhaltiger Gräser, mit negativen Folgen für den Boden und seine diversen ökologischen Funktionen.
7Sonderkulturen sind Nutzpflanzen, die nur in bestimmten Regionen angebaut werden können.
8Der Einsatz von Düngemitteln stieg laut der FAO zwischen 2000 und 2020 um 49 Prozent auf 201 Millionen Tonnen, der von Pestiziden um 30 Prozent auf 2,7 Millionen Tonnen. Durchschnittlich 15 Kilo Stickstoffdünger werden pro Person pro Jahr ausgebracht.
9Für das sogenannte Haber-Bosch-Verfahren sind hohe Temperaturen und Drücke nötig.
10Dabei handelt es sich um Lachgas (Distickstoffmonoxid), Ammoniak und Methan (ein Kohlenwasserstoff, der zum Beispiel aus Gülle entsteht). Solche Emissionen entstehen auch, wenn kompostiert und mit organischem Material gedüngt wird.
11Die regionale Verteilung ist bemerkenswert: In Europa verdoppelte sich die Produktion, in Nordamerika verdreifachte sie sich, in Asien wuchs sie um das 15-Fache. Die Mengenangaben sagen indes nichts über den Pro-Kopf-Verbrauch aus.
12Viele Beschäftigte leisten zudem Landarbeit nur einen Teil des Jahres und ergänzen so ihre Einkommen aus anderen Quellen.
13Vom Standpunkt des Kapitals betrachtet handelt es sich um »Überschussbevölkerung«. Vgl. MEW 23 (Karl Marx, Das Kapital, Band 1), Seiten 670-674. Die Masse der freigesetzten Landarbeit darf nicht mit den individuellen Landarbeiterinnen verwechselt werden. Aus einem ehemaligen Bauern kann durchaus ein Industriearbeiter oder auch ein Arzt werden.
14Auch hier darf die Gesamtmenge nicht mit den Individuen verwechselt werden. Der Weg führt manchmal von einer Provinz in der Peripherie in eine Großstadt in einem Metropolen-Land oder vom Dorf in eine mittelgroße Stadt in der Peripherie, während Stadtbewohner in der Peripherie wieder aufs Land zurückkehren oder im Gegenteil in die Metropolen abwandern.
15Die ökologischen Nachteile der Verstädterung müssen von dem gestiegenen Ressourcenverbrauch unterschieden werden. Die Agglomeration an sich kann zu einem höheren Wirkungsgrad bei der Nahrungsverwertung, der Wasser- und Energienutzung führen.
16Der Vollständigkeit halber: Die Landwirtschaft bringt synthetische Stoffe wie Mikroplastik in die Umwelt, das Jahrhunderte lang stabil bleibt und auf Tiere und Pflanzen toxisch oder hormonell wirkt.
17Dieser Begriff bezeichnet in der Klimageschichte eigentlich Perioden wie das »Paläozän/Eozän-Temperaturmaximum«. Dass der Planet längerfristig in eine solche Phase eintreten wird, ist möglich, aber keineswegs sicher.
3.In die Vertikale: Landwirtschaft ohne Land
»Die Tendenz der modernen Landwirtschaft ist die größtmögliche Reduzierung des zu bebauenden Raumes, die willkürliche Erzeugung der Erde und des Klimas, die Konzentration der Arbeit und die künstliche Vereinigung aller Bedingungen, die für das Leben der Pflanze notwendig sind.«
pjotralexejewitschkropotkin14
Von außen sieht das Gebäude aus wie eine mächtige fensterlose Lagerhalle, zusammengesteckt aus großen hellbraunen Rechtecken. Die größte vertikale Farm der Welt steht im Wüstensand Dubais in den Vereinigten Arabischen Emiraten, 40 Autominuten entfernt vom Internationalen Flughafen Dubai, 25 Minuten vom Strand des Persischen Golfs. »ECO« heißt die Anlage. Die Abkürzung steht für Emirates Crop One und gleichzeitig für ökologische Nachhaltigkeit. Vertikaler Anbau, das bedeutet: Anbau in Innenräumen, bei dem die Pflanzen übereinander in Regalen gestapelt werden. Von oben werden sie mit speziellen Lampen bestrahlt. Diese Art der Kultivierung wird als »bodenlose Landwirtschaft« bezeichnet, manchmal auch als »Null-Fläche-Farming« (Zero Acreage Farming).
ECO gibt dem Ausdruck »industrialisierte Landwirtschaft« eine neue Bedeutung. In den Hallen reichen sechsstöckige Metallregale bis zur Decke. Die Regalfächer sind voll grüner Sträucher: Petersilie, Rucola, Spinat, Blattsalat und Grünkohl. Die Pflanzen stehen ordentlich in Reih und Glied. Ihre Blätter und Stängel ragen aus runden Aussparungen in weißen Plastikbottichen. Durch diese Becken fließt eine Nährstoff-Wasser-Mischung, entlang der weißlichen dünnen Wurzeln. Die vertikale Landschaft arbeitet statt mit Erde mit Nährflüssigkeit (»hydroponisch«). Ohne den Widerstand des Bodens nehmen die Wurzelballen ungewöhnliche Formen an.
Die Nährstoffe fließen durch dicke blaue Gummischläuche, die die Becken miteinander verbinden. Energie kommt zu den Pflanzen über schwarze Stromkabel, die zu den LED-Leuchten an der Oberseite der Regalfächer führen. Die Lampen verbreiten ein diffuses violettes Licht, zumindest wenn sich gerade keine Mitarbeiter in der Halle aufhalten. Rotes Licht fördert die Photosynthese, blaues Licht ist notwendig für das Wachstum. Macht zusammen violett bis rosa.
In der ECO-Anlage kann bis zu fünfzehnmal im Jahr geerntet werden, unabhängig von Jahreszeiten und Wetterschwankungen. Dann klettern Arbeiterinnen mit weißen Schürzen und Gummihandschuhen auf fahrbare Hebebühnen, die an den Regalreihen entlang geschoben werden. Mit langen Messern schneiden sie die Salat- und Spinatblätter ab und lassen sie in große Plastikkisten fallen. Bei dieser Arbeit können die Beschäftigten aufrecht stehen: Ernten in der Pflanzenfabrik ist körperlich weniger belastend als im Freilandanbau.
Gemüse in geschlossenen Räumen heranzuziehen, klingt ungewöhnlich, geradezu spleenig. Aber die Landwirtschaft ohne Land hat Vorteile. In Innenräumen können die Gärtner den Pflanzen rund um die Uhr ideale Wachstumsbedingungen bieten. Sie optimieren den Säuregehalt im Wasser, die Nährstoffzusammensetzung, die Lichtfrequenzen, den Rhythmus der Beleuchtung, die Luftfeuchtigkeit, die Konzentration des Kohlenstoffs in der Luft. All diese Parameter werden auf die Bedürfnisse der Kulturen abgestimmt, um das größtmögliche Wachstum zu erzielen. »Controlled Environment Agriculture« (CEA) lautet der Fachbegriff für diese Methode, Anbau unter kontrollierten Umweltbedingungen.1
Kontrolliert wird mit Ventilatoren, Wasserpumpen, Gummischläuchen und Elektrokabeln. In einem Computernetzwerk laufen die Daten zusammen. Einige Parameter lassen sich per Software steuern, wie die Raumtemperatur. Bei anderen ist Handarbeit notwendig, beispielsweise um der Nährflüssigkeit Düngemittel zuzusetzen. In den Gewächshallen – grow rooms genannt – herrscht ein künstlicher Tag-Nacht-Rhythmus, das Computerprogramm schaltet die Beleuchtung automatisch an und aus.
Die Technik für ECO hat die Firma Crop One aus Boston, USA geliefert. »Unsere Mission ist der Anbau für eine nachhaltige Zukunft, um den weltweiten Bedarf an frischer, lokaler und sicherer Nahrung zu befriedigen«, wirbt das Unternehmen, einer der Marktführer im Bereich Vertical Farming (VF). Die Sensoren und das Computernetzwerk stammen von Siemens, Sparte Gebäudemanagement.
Auf drei Stockwerken, in 27 Hallen werden jährlich 900.000 Kilo Blattgemüse erzeugt. Alle Regalböden zusammengenommen misst die Anbaufläche gut 115 Hektar. Dazu kommen weitere Räume, in denen die Mitarbeiter Samen in die Plastikschalen setzen, düngen und wässern. In anderen Gebäudeteilen sortieren sie die Ernte und verpacken sie für die Auslieferung.
Selbstverständlich sind alle Räume von ECO klimatisiert. Die Durchschnittstemperatur in Dubai liegt im Sommer bei 36 Grad Celsius, mit Spitzenwerten weit über 40 Grad. Trotz der automatischen Belüftung und Entfeuchtung kondensiert gelegentlich Wasser, das über die Pflanzen in die Raumluft verdunstet. Dann bilden sich Pfützen auf dem grauen Linoleumboden. In den grow rooms dröhnt die Belüftung so laut, dass Besucher und Beschäftigte die Stimme heben müssen, um sich zu verständigen. Die Blätter der Kräuter wiegen sich sanft im künstlichen Wind. Auf den Regalen sind in regelmäßigen Abständen Schilder mit dem aufmunternden Firmenmotto aufgeklebt: »Mach jeden Tag ein bisschen besser!«
Wenn sich Natur und Technik, Stadt und Land versöhnen
Wer im Internet nach Bildern über den vertikalen Anbau sucht, findet unzählige Darstellungen idyllischer Stadtlandschaften, scheinbar fotorealistisch, in Wirklichkeit computergestützt gezeichnet. Die Bilder zeigen Wolkenkratzer, aus denen Bäume und Lianen wachsen, Plätze mit künstlichen Seen und Wasserfällen, Dächer in schwindelerregender Höhe mit üppigen Feldern und Obstgärten. Oft nehmen die Gebäude auf diesen Bildern selbst organische Formen an, abgerundet statt rechtwinklig, Stahl, Beton und Glas versöhnt mit Baum und Strauch – die hängenden Gärten von New York oder Singapur.
Der Gegensatz von Stadt und Land ist eine Hauptursache der ökologischen Krise. In diesen Phantasien ist er wundersam überbrückt. Stadt und Land widersprechen einander nicht mehr, sie sind zusammengewachsen zu einer Art gereinigtem, gesichertem Großstadtdschungel, einem aseptischen urbanen Dickicht.
Die Debatte über den vertikalen Anbau war von Anfang an geprägt von einem utopischen Überschuss, wie er in solchen Bildern durchscheint. Aber auch von dem Eindruck einer Bedrohung: »Die überfüllten städtischen Zentren sind stark auf die Versorgung mit Nahrung, Erzen und anderen Ressourcen angewiesen«, schreibt der US-amerikanische Ökologe Dickson Despommier, der das Konzept um die Jahrtausendwende populär machte. Die Urbanisierung in ihrer gegenwärtigen Form sei nicht haltbar, argumentiert er, die landwirtschaftliche Produktion gefährdet: »Tatsächlich straucheln viele landwirtschaftliche Regionen bereits, und anderen wird es bald ebenso ergehen.«
Glücklicherweise hat Despommier gute Nachrichten zu überbringen: Mit VF, im Verbund mit anderen Hochtechnologien, könnten die Städte problemlos in die Lage versetzt werden, sich selbst zu versorgen. »Wir haben schon alle Werkzeuge, die wir brauchen. (…) Wenn wir begreifen, wie Pflanzen und Tiere sich in Netzwerken gegenseitiger Abhängigkeit organisieren – in Ökosystemen –, dann werden wir verstehen, wie wir eine Stadt neu gestalten können, sodass sie diesen Prozess nachahmt.«15
Dickson Despommier spart in seinen Schriften nicht mit großen Verheißungen. In seiner Vision versorgt die Stadt der Zukunft sich mit einer Hightech-Landwirtschaft selbst mit Nahrung. Sie gewinnt die Energie, die sie benötigt, im eigenen Stadtgebiet, und gewinnt Wasser, indem sie den Regen auffängt. Mit einem Wort, sie braucht kein Hinterland mehr. »Im letzten Jahrzehnt haben wir so viele Fortschritte dabei gemacht, nachhaltig mit Ressourcen umzugehen, dass Städte nunmehr zu einer urbanen Entsprechung natürlicher Ökosysteme werden können, indem sie hochtechnologische Strategien für die Energiegewinnung aus Abfall, die Nahrungsproduktion und die Wasserwiederaufbereitung einsetzen. So können wir Abfall zu verwendbaren Ressourcen zu verarbeiten, ohne die Umwelt weiter zu schädigen.«16 Die technischen und biologischen Kreisläufe würden deckungsgleich, sämtliche industriellen Werkstoffe wieder verwendet, Natur und Kultur miteinander versöhnt – Technik macht’s möglich!