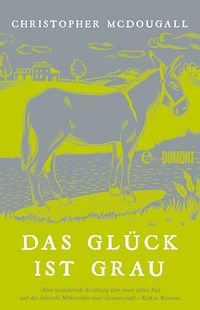Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Der Verlag behält sich die Verwertung der urheberrechtlich geschützten Inhalte dieses Werkes für Zwecke des Text- und Data-Minings nach § 44 b UrhG ausdrücklich vor. Jegliche unbefugte Nutzung ist hiermit ausgeschlossen.
Copyright © der Originalausgabe 2009 by Christopher McDougallThis translation published by arrangement with Alfred A. Knopf, a division of Random House Inc.Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2010by Karl Blessing Verlag, München,in der Penguin Random House Verlagsgruppe GmbH,Neumarkter Str. 28, 81673 MünchenWerbeagentur, ZürichCovergestaltung: Hauptmann und KompanieCovermotiv: Luis EscobarLayout und Herstellung: Ursula Maenner
ISBN 978-3-641-04336-0V005
www.blessing-verlag.dewww.penguinrandomhouse.de
Inhaltsverzeichnis
Widmung
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Kapitel 19
Kapitel 20
Kapitel 21
Kapitel 22
Kapitel 23
Kapitel 24
Kapitel 25
ERSTE SCHMERZLICHE WAHRHEIT: Die besten Schuhe sind die schlechtesten.
SCHMERZLICHE WAHRHEIT NR. 2: Füße mögen Belastungen.
LETZTE SCHMERZLICHE WAHRHEIT: Sogar Alan Webb sagt: »Die Menschen sind zum ...
Kapitel 26
Kapitel 27
Kapitel 28
Kapitel 29
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Danksagung
Copyright
Titel der Originalausgabe: Born to Run
Originalverlag: Alfred A. Knopf, New York
DER BESTE LÄUFER HINTERLÄSST KEINE SPUREN.
Lao-tse,Tao-te-king
Für John und Jean McDougall, meine Eltern, die mir alles gaben und immer noch geben.
1
Wer mit Geistern lebt, muss einsam sein.
Anne Michaels, Fluchtstücke
Tagelang hatte ich in der Sierra Madre in Mexiko nach dem Phantom gesucht, das als Caballo Blanco bekannt war – das Weiße Pferd. Schließlich war ich am Ende des Weges angekommen, an dem Ort, an dem ich ihn zu allerletzt vermutet hätte – nicht irgendwo in der Wildnis, die er der Legende nach durchstreifte, sondern im düsteren Empfangsraum eines alten Hotels am Rand eines staubigen Wüstenstädtchens.
»Sí, El Caballo está«, sagte die Empfangsdame und nickte dazu. Ja, das Pferd ist hier.
»Wirklich?« Nachdem ich an den bizarrsten Orten schon so oft gehört hatte, dass ich ihn gerade eben verpasst haben müsste, hielt ich Caballo Blanco bereits für eine Märchengestalt, für eine örtliche Variante des Ungeheuers von Loch Ness, das erfunden wurde, um Kinder in Schrecken zu versetzen und einfältige Gringos zum Narren zu halten.
»Er kommt immer um fünf Uhr zurück«, fügte die Empfangsdame noch hinzu. »Das ist wie ein Ritual.«
Einen Augenblick lang war ich unschlüssig, ob ich sie vor Erleichterung umarmen oder in einer Geste des Triumphes abklatschen sollte. Dann sah ich auf die Uhr. Das bedeutete, dass ich den Geist schon bald zu Gesicht bekommen würde, in weniger als … Augenblick mal!
»Aber es ist doch schon nach sechs.«
Die Angestellte zuckte mit den Schultern. »Vielleicht ist er weggegangen.«
Ich ließ mich auf ein sehr betagtes Sofa fallen. Ich war schmutzig, ausgehungert und niedergeschlagen. Außerdem war ich erschöpft, und dasselbe galt auch für die Spuren, denen ich bis an diesen Ort gefolgt war.
Manche Leute erzählten, Caballo sei ein Flüchtling; andere behaupteten, er sei ein Boxer, der sich mit seiner Flucht selbst bestraft habe, weil er bei einem Kampf einen Gegner zu Tode geprügelt habe. Niemand kannte seinen Namen, sein Alter oder den Ort seiner Herkunft. Er war wie ein Revolverheld aus dem Wilden Westen, der überall nur unglaubliche Geschichten und einen Hauch von Zigarillorauch hinterließ. Beschrieben und gesehen hatte man ihn an vielen Orten; Dorfbewohner, deren Heimatorte viel zu weit auseinanderlagen, schworen, sie hätten ihn an ein und demselben Tag zu Fuß seines Weges ziehen sehen. Die Schilderungen bewegten sich auf einer heftigen Schwankungen unterworfenen Skala, die von »lustig und simpático« bis »unheimlich und riesenhaft« reichte.
Bestimmte grundlegende Details glichen sich allerdings in sämtlichen Versionen der Caballo-Blanco-Legende: Er war schon vor Jahren nach Mexiko gekommen und in die wilden, unzugänglichen Barrancas del Cobre gezogen – die Copper Canyons -, um dort unter den Tarahumara zu leben, einem sagenumwobenen Stamm steinzeitlicher Superathleten. Die Tarahumara (der Name wird spanisch ausgesprochen, das »h« wird verschluckt: Tara-u-mara) sind möglicherweise das gesündeste und gelassenste Volk auf Erden – und die größten Läufer aller Zeiten.
Nichts und niemand kann einen Tarahumara-Läufer auf einer Ultralangstrecke besiegen – kein Rennpferd, kein Gepard und auch kein olympischer Marathonläufer. Nur sehr wenige Außenstehende haben die Tarahumara jemals in Aktion gesehen, aber schon seit Jahrhunderten sind erstaunliche Geschichten über ihre übermenschliche Zähigkeit und Gelassenheit aus den Canyons in die Außenwelt gelangt. Ein Forschungsreisender schwor, er habe selbst gesehen, wie ein Tarahumara ein Reh mit bloßen Händen fing, der Mann habe das flüchtende Tier so lange gejagt, bis es vor Erschöpfung tot zu Boden sank, »und seine Hufe fielen ab«. Ein anderer Abenteurer brauchte für die Überquerung eines Berges in den Copper Canyons auf dem Rücken eines Maultiers zehn Stunden; ein Tarahumara-Läufer legte dieselbe Wegstrecke in 90 Minuten zurück.
»Versuch das hier«, sagte eine Tarahumara-Frau einst zu einem erschöpften Forschungsreisenden, der am Fuß eines Berges zusammengebrochen war, und reichte ihm eine Kürbisflasche, die mit einer dunklen Flüssigkeit gefüllt war. Er nahm ein paar Schlucke und staunte über die wiedergewonnene Energie, die in seinen Adern pulsierte. Der Mann stand auf und zog gipfelwärts wie ein Sherpa, der zu viel Kaffee getrunken hatte. Die Tarahumara, so sollte der Forschungsreisende später dann berichten, hüteten außerdem das Rezept für eine besondere Energienahrung, die sie schlank, kräftig und unaufhaltbar macht: Ein paar Handvoll enthielten genügend Nährwert, um sie stundenlang ohne Pause laufen zu lassen.
Doch welche Geheimnisse die Tarahumara auch hüten mögen, sie haben sie gut gehütet. Bis zum heutigen Tag leben sie in Felswänden, die höher liegen als ein Falkennest, und in einem Land, das nur wenige Menschen je zu sehen bekamen. Die Barrancas sind eine vergessene Welt in der allereinsamsten Wildnis Nordamerikas, eine Art Festlands-Bermudadreieck, in dem schon viele Ausgestoßene und Desperados, die sich dorthinein verlaufen haben, verschwunden sind. Viel Böses kann einem dort widerfahren, und vermutlich kommt es dann auch so; wer menschenfressenden Jaguaren, Giftschlangen und der Gluthitze entkommt, kann immer noch dem »Canyonfieber« zum Opfer fallen, einem potenziell tödlichen psychischen Zusammenbruch, der von der öden Unheimlichkeit der Barrancas ausgelöst wird. Je tiefer man in die Barrancas vordringt, desto stärker kann das Gefühl werden, man bewege sich in einer Krypta, die sich ringsherum schließt. Die Felswände rücken näher, die Schatten werden länger, Phantomechos flüstern; jeder Ausgang scheint am nackten Felsen zu enden. Verirrte Kundschafter kann ein so heftiger Wahnsinn, eine so starke Verzweiflung überkommen, dass sie sich selbst die Kehle durchschneiden oder in felsige Abgründe stürzen. Es ist keine große Überraschung, dass nur wenige Fremde die Heimat der Tarahumara jemals zu sehen bekamen – von den Tarahumara selbst ganz zu schweigen.
Das Weiße Pferd jedoch hat es irgendwie geschafft, in die Tiefen der Barrancas vorzudringen. Und dort, so heißt es, wurde dieser Mann von den Tarahumara als Freund und verwandte Seele angenommen, als Geist unter Geistern. Mit Sicherheit hat er sich zwei Fertigkeiten der Tarahumara angeeignet – Unsichtbarkeit und außergewöhnliche Ausdauer -, denn er wurde zwar schon an vielen Orten in den Canyons gesehen, aber niemand schien zu wissen, wo er lebte oder als nächstes auftauchen würde. Wenn irgendjemand die uralten Geheimnisse der Tarahumara erklären könne, so erzählte man mir, dann sei es dieser einsame Wanderer der Sierras.
Mit der Zeit war ich so besessen von dem Gedanken, Caballo Blanco aufzuspüren, dass ich mir, als ich auf dem Hotelsofa vor mich hin döste, sogar den Klang seiner Stimme vorstellen konnte. »Vielleicht wie Yogi Bär, der bei Taco Bell Burritos bestellt«, sinnierte ich. Ein solcher Kerl, ein Wanderer, der überall hinkommt, aber sich nirgendwo einfügt, muss in seiner eigenen Vorstellungswelt leben und wird den Klang der eigenen Stimme nur selten wahrnehmen. Er würde seltsame Witze machen und sich dabei vor Lachen ausschütten. Er hatte eine dröhnende Lache und sprach ein grauenhaftes Spanisch. Er würde laut sein, ein Plappermaul und … und …
Augenblick mal. Ich hörte ihn tatsächlich. Ich öffnete die Augen und sah eine ausgezehrte Gestalt, die einen zerschlissenen Strohhut trug und mit der Empfangsdame scherzte. Der Reisestaub auf dem hageren Gesicht glich einer verwaschenen Kriegsbemalung, und der unter dem Hut hervorragende Haarschopf schien mit einem Jagdmesser zurechtgestutzt worden zu sein. Der Mann sah aus wie ein Schiffbrüchiger auf einer einsamen Insel, auch die Art, wie er nach einer Unterhaltung mit der gelangweilten Empfangsdame gierte, passte ins Bild.
»Caballo?«, krächzte ich.
Die Gestalt wandte sich um, lächelte dabei, und ich fühlte mich wie ein Idiot. Der Mann sah nicht argwöhnisch aus, er wirkte nur irritiert, so wie jeder andere Tourist auch, der es mit einem konfusen Typen auf einem Sofa zu tun bekommt, der ihn unvermittelt mit »Pferd!« anredet.
Das war nicht Caballo. Es gab gar keinen Caballo. Die ganze Sache war ein Schwindel, und ich war darauf reingefallen.
Dann sprach die Gestalt. »Du kennst mich?«
»Mann!« Ich explodierte und schnellte hoch. »Was bin ich froh, dich zu sehen!«
Das Lächeln verschwand. Die Augen des Ausgezehrten wanderten in Richtung Tür und machten deutlich, dass er selbst es in wenigen Augenblicken genauso halten würde.
2
Es begann alles mit einer einfachen Frage, die mir niemand beantworten konnte.
Es war ein Fünf-Wort-Rätsel, das mich zu einem Foto eines sehr schnellen Mannes in einem sehr kurzen Rock führte, und von da an wurde alles nur noch seltsamer. Wenig später hatte ich es mit Mord zu tun, mit Drogenguerillas und einem einarmigen Mann, der einen Frischkäsebecher auf dem Kopf trug. Ich stieß auf eine wunderschöne blonde Försterin, die aus ihren Kleidern schlüpfte und ihr Heil als Nacktläuferin in den Wäldern von Idaho suchte, und auf eine junge Surferin mit Zöpfen, die in der Wüste dem Tod direkt in die Arme lief. Ein talentierter junger Läufer sollte sterben. Zwei andere sollten nur knapp mit dem Leben davonkommen.
Ich forschte weiter nach und stieß auf den Barfüßigen Batman … den Naked Guy … Buschleute in der Kalahari … den Zehennagel-Amputierten … auf einen Kult, der sich dem Langstreckenlauf und Sexpartys widmete … auf den Wilden Mann der Blue Ridge Mountains … und, zu guter Letzt, auf den uralten Stamm der Tarahumara und seinen schattenhaften Jünger, der Caballo Blanco genannt wurde.
Schließlich bekam ich meine Antwort, aber erst nachdem ich in das größte Rennen geraten war, das die Welt niemals sehen sollte: in die Ultimate Fighting Competition unter allen Laufwettbewerben, einen sich in der Verborgenheit entwickelnden Showdown, der einige der besten Ultralangstreckenläufer unserer Zeit mit den besten Ultralangstrecklern aller Zeiten zusammenbrachte, bei einem 80-Kilometer-Lauf auf verborgenen Pfaden, auf denen bis dahin nur Tarahumara-Füße unterwegs gewesen waren. Zu meiner Verblüffung sollte ich entdecken, dass die uralte Weisheit aus dem Tao-te-king – »Der beste Läufer hinterlässt keine Spuren« – kein fadenscheiniges zenbuddhistisches Kõan war, sondern ein realer, konkreter, praktisch umsetzbarer Trainingsgrundsatz.
Und das alles, weil ich meinem Arzt im Januar 2001 diese Frage gestellt hatte:
»Warum tut mein Fuß weh?«
Ich hatte einen der besten sportmedizinischen Fachärzte des Landes konsultiert, weil sich ein unsichtbarer Eispickel durch meine Fußsohle gebohrt hatte. Eine Woche zuvor war ich zu einem einfachen Fünf-Kilometer-Lauf auf einem verschneiten Farmweg aufgebrochen, und plötzlich wimmerte ich vor Schmerzen, fasste mir an den rechten Fuß und fluchte laut, bevor ich in den Schnee purzelte. Als ich mich wieder gefasst hatte, sah ich nach, wie stark die Wunde blutete. Ich musste mir einen spitzen Stein in den Fuß gebohrt haben – oder einen Nagel, der im Eis verborgen gewesen war. Aber da war kein einziger Blutstropfen, nicht einmal ein Loch in meinem Schuh.
»Das Laufen ist Ihr Problem«, beschied mich Dr. Joe Torg, als ich einige Tage später in sein Untersuchungszimmer in Philadelphia humpelte. Er musste das wissen; Dr. Torg hatte nicht nur einen wichtigen Beitrag zur Entwicklung des Arbeitsbereichs Sportmedizin geleistet, sondern war auch der Koautor von The Running Athlete, der besten radiologischen Analyse aller nur denkbaren Laufverletzungen. Er machte Röntgenaufnahmen und sah sich mein Gehumpel an, dann diagnostizierte er eine Reizung des Würfelbeins, eines parallel zum Fußgewölbe verlaufenden Knochenbündels, von dessen Existenz ich bis dahin gar nichts gewusst hatte, bis es sich zu einer Elektroschockwaffe in meinem Körper entwickelte.
»Aber ich laufe doch nur ganz wenig«, wandte ich ein. »So etwa drei bis fünf Kilometer, alle paar Tage. Und das nicht einmal auf Asphalt, meistens auf unbefestigten Straßen.«
Das spielte keine Rolle. »Der menschliche Körper ist auf diese Art von Missbrauch nicht eingestellt«, antwortete Dr. Torg. »Für Ihren Körper gilt das ganz besonders.«
Ich wusste genau, was er meinte. Bei einer Körpergröße von 1,92 Meter und einem Gewicht von knapp 105 Kilo hatte ich mir schon oft anhören müssen, dass die Natur Burschen wie mir eigentlich einen Platz unter dem Basketballkorb zugedacht hatte, auch als Kugelfang für den Präsidenten sei ich geeignet, auf keinen Fall aber sollte ich meine massige Gestalt mit Läufen auf dem Bürgersteig belasten. Seit meinem 40. Geburtstag sah ich allmählich ein, woher diese Ratschläge kamen. In den fünf Jahren, seit ich mit dem Freizeitbasketball aufgehört und versucht hatte, mich in einen Marathonläufer zu verwandeln, hatte ich Kniesehnenrisse (zweimal) und Achillessehnenreizungen (wiederholt), hatte mir die Knöchel verstaucht (beide, abwechselnd), kämpfte mit Schmerzen im Fußgewölbe (regelmäßig) und musste die Treppe rückwärts und auf Zehenspitzen hinuntergehen, weil meine Fersen so heftig schmerzten. Jetzt hatte sich offensichtlich auch noch der letzte, bisher genügsame Teil meiner Füße dem allgemeinen Aufstand angeschlossen.
Das Unheimliche dabei war nur, dass ich ansonsten offensichtlich nicht kleinzukriegen war. Als Autor für die Zeitschrift Men’s Health und einer der ursprünglichen »Restless Man«-Kolumnisten von Esquire bestand ein großer Teil meiner Arbeit aus Experimenten mit semiextremen Sportarten. Stromschnellen des Schwierigkeitsgrades 4 hatte ich mit einem Boogieboard befahren, riesige Sanddünen mit einem Snowboard, und die Badlands von North Dakota hatte ich mit dem Mountainbike durchquert. Außerdem hatte ich für die Associated Press aus drei Kriegsgebieten berichtet und Monate in einer der gesetzlosesten Regionen Afrikas zugebracht, all dies ohne Kratzer oder Schrammen. Aber dann, bei einem Lauf über wenige Kilometer, wälze ich mich auf dem Boden, als wäre ich aus einem vorbeifahrenden Auto angeschossen worden.
In jeder anderen Sportart würde mich eine derartige Verletzungsanfälligkeit als ungeeignet erscheinen lassen. Beim Laufen macht es mich zum Normalfall. Die wahren Mutanten sind die Läufer, die sich nicht verletzen. Bis zu acht von zehn Läufern ziehen sich jedes Jahr Verletzungen zu. Es spielt keine Rolle, ob man schwer oder leicht, schnell oder langsam, ein Marathonmeister oder ein Wochenend-Hobbyläufer ist, bei allen Läufertypen besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sie sich die Knie, Schienbeine, Kniesehnen, Hüftgelenke oder Fersen verletzen. Wer am nächsten Thanksgiving an einem Turkey Trot teilnimmt, der merke sich vor dem Start die Läufer zu seiner Rechten und Linken: Statistisch gesehen wird nur einer von euch auch an Weihnachten zum Jingle Bell Jog antreten.
Bis heute konnte noch keine Erfindung der Sportartikelindustrie die Körperschäden eindämmen. Heute kann man Laufschuhe kaufen, in deren Sohlen Stahlfedern eingearbeitet sind, ein bestimmtes Fabrikat regelt die Dämpfung sogar per Mikrochip, aber die Verletzungsquote hat in 30 Jahren kein bisschen abgenommen. Wenn überhaupt, hat sie zugenommen. Bei den Achillessehnenrissen war eine Steigerung um zehn Prozent zu verzeichnen. Laufen schien so etwas wie die Fitnessversion von Alkohol am Steuer zu sein: Man konnte eine Zeit lang ungeschoren davonkommen, dabei vielleicht sogar ein bisschen Spaß haben, aber gleich hinter der nächsten Straßenecke lauerte die Katastrophe.
»Große Überraschung«, höhnt die sportmedizinische Fachliteratur in diesem Zusammenhang. Dem ist jedoch nicht ganz so. Eher trifft dies zu: »Athleten, in deren Sportart viel gelaufen wird, setzen ihre Beine enormen Belastungen aus.« So äußerte sich das Sports Injury Bulletin zum Thema. »Mit jedem Schritt wird eines der Beine einer Kraft ausgesetzt, die dem doppelten Körpergewicht entspricht. Wiederholte Hammerschläge werden auch einen vermeintlich unerschütterlichen Felsen schließlich in Staub verwandeln, und genauso kann die mit dem Laufen verbundene Belastung letztlich auch Knochen, Knorpel, Muskeln, Sehnen und Bänder brechen oder reißen lassen.« Ein Bericht der amerikanischen Orthopädenvereinigung kam zu dem Ergebnis, der Langstreckenlauf sei »eine unerhörte Bedrohung für die Unversehrtheit des Kniegelenks«.
Und diese Gefahr wirkt nicht auf einen »unerschütterlichen Felsen«, sondern auf einen der empfindlichsten Punkte des ganzen Körpers ein. Wussten Sie schon, welche Nerven für Ihre Füße zuständig sind? Es sind dieselben, zu deren Netzwerk auch die Genitalien gehören. Die Füße sind so etwas wie ein Ködereimer voller Neuronen, die auf der Suche nach Sinneseindrücken durcheinanderwuseln. Man reize diese Nerven nur ein bisschen, und der Impuls wird durch das gesamte Nervensystem schießen. Deshalb kann ein Kitzeln der Füße die Schaltzentrale überlasten und den ganzen Körper in Krämpfe versetzen.
Es ist keine Überraschung, dass südamerikanische Diktatoren zu Fußfetischisten wurden, wenn es hartnäckige Gegner zu brechen galt. Die Bastonade, eine Foltermethode, bei der das gefesselte Opfer auf die Fußsohlen geschlagen wird, ist eine Erfindung der spanischen Inquisition, die von den übelsten Sadisten dieser Welt begierig übernommen wurde. Die Roten Khmer und Saddam Husseins Sohn Udai waren große Anhänger der Bastonade, weil sie die anatomischen Zusammenhänge kannten. Nur das Gesicht und die Hände haben eine ähnlich starke und schnelle Reizleitung zum Gehirn wie die Füße. Die Zehen sind so fein innerviert wie die Lippen und die Fingerspitzen, deshalb übermitteln sie auch die Empfindung des sanftesten Streichelns oder des winzigsten Sandkorns.
»Also kann ich gar nichts tun?«, fragte ich Dr. Torg.
Er zuckte mit den Schultern. »Sie können weiterlaufen, aber Sie werden wiederkommen und noch mehr davon brauchen«, sagte er und tippte dabei sanft die riesige Injektionsnadel an, mit der er mir wenige Augenblicke später Cortison in die Fußsohle spritzte. Außerdem würde ich für meine seitlich stabilisierenden Laufschuhe (das Paar zu 150 Dollar und mehr, und da ich zum abwechselnden Gebrauch zwei Paar brauchte, machte das 300 Dollar) maßgefertigte Einlagen brauchen (für 400 Dollar das Paar). Aber das würde den allergrößten Kostenpunkt nur hinauszögern: meinen unvermeidlichen nächsten Besuch in seiner Praxis.
»Wollen Sie wissen, was ich Ihnen empfehlen würde?«, fasste Dr. Torg seine Diagnose zusammen: »Kaufen Sie sich ein Fahrrad.«
Ich dankte ihm, versprach, seinen Rat zu befolgen, und hinterging ihn umgehend, indem ich einen anderen Arzt aufsuchte. Doc Torg wurde langsam alt, sinnierte ich; vielleicht waren seine Ratschläge inzwischen ein bisschen zu konservativ, und vielleicht war er mit dem Kortison etwas zu schnell bei der Hand. Ein befreundeter Arzt empfahl mir einen Sportarzt und Fußspezialisten, der selbst Marathonläufer war. Mit ihm vereinbarte ich für die folgende Woche einen Termin.
Der Fußspezialist machte eine weitere Röntgenaufnahme, dann untersuchte er meine Füße mit dem Daumen. »Sieht ganz so aus, als hätten Sie ein Würfelbeinsyndrom«, erklärte er. »Ich kann die Entzündung mit Kortison behandeln, aber Sie werden auch noch Einlagen brauchen.«
»Verdammt«, grummelte ich. »Genau das hat Torg auch gesagt.« Der Arzt wollte gerade aus dem Raum gehen, um die Spritze zu holen, hielt jetzt aber inne. »Sie waren schon bei Joe Torg?«
»Ja.«
»Sie haben schon eine Kortisonspritze bekommen?«
»Ja.«
»Was machen Sie dann hier?«, fragte er und wirkte plötzlich ungeduldig und etwas misstrauisch, so als glaubte er, dass ich es wirklich genoss, wenn sich Injektionsnadeln in den empfindlichsten Teil meines Fußes bohrten. Vielleicht dachte er jetzt, ich sei so etwas wie ein sadomasochistischer Junkie, der nach Schmerzen und Schmerzmitteln süchtig war.
»Sie wissen, dass Dr. Torg die Leitfigur der Sportmedizin ist? Seine Diagnosen finden im Allgemeinen große Anerkennung.«
»Ich weiß. Ich wollte nur eine zweite Meinung einholen.«
»Ich werde Ihnen keine weitere Spritze geben, aber wir können einen Termin für das Anpassen der Einlagen vereinbaren. Und Sie sollten sich wirklich Gedanken über eine andere sportliche Aktivität machen, neben dem Laufen.«
»Das klingt gut«, sagte ich. Er war ein besserer Läufer als ich je sein würde, und er hatte eben erst das Urteil eines Arztes bestätigt, den er selbst ohne Umschweife als führende Autorität unter den Sportärzten bezeichnete. Es gab überhaupt keinen Zweifel an seiner Diagnose. Also sah ich mich nach jemand anderem um.
Es ist nun nicht so, dass ich besonders stur wäre. Ich bin nicht einmal besonders laufverrückt. Wenn ich alle Kilometer zusammennähme, die ich jemals gelaufen bin, wäre die Hälfte davon eine elende Schinderei. John Irvings Roman Garp und wie er die Welt sah hatte ich vor 20 Jahren gelesen, doch eine Szene ist mir im Gedächtnis geblieben, was einigermaßen aufschlussreich ist, und es ist nicht die Szene, die einem gewöhnlich in den Sinn kommt: Ich denke daran, wie Garp inmitten eines ganz gewöhnlichen Arbeitstages immer wieder aus der Tür stürzte, um zu einem Acht-Kilometer-Lauf aufzubrechen. Diese Wahrnehmung hat etwas Universelles, die Art, in der das Laufen unsere beiden urtümlichsten Antriebskräfte zusammenbringt: Furcht und Freude. Wir laufen, wenn wir Angst haben, wir laufen, wenn wir höchste Glücksgefühle empfinden, wir laufen vor unseren Problemen davon und wir laufen, um uns zu vergnügen.
Und wenn die Lebensumstände am schlimmsten sind, laufen wir besonders viel. Der Langstreckenlauf hat in Amerika dreimal starken Zulauf erhalten, jedes Mal während einer großen nationalen Krise. Der erste Boom entwickelte sich während der Weltwirtschaftskrise in den Dreißigerjahren des 20. Jahrhunderts. Mehr als 200 Männer betätigten sich damals als Trendsetter, als sie beim Great American Footrace das ganze Land durchquerten, mit Tagesstrecken von 40 Meilen (rund 65 Kilometern). Die Laufbewegung schlief dann wieder ein, um schließlich Anfang der Siebzigerjahre einen neuen Aufschwung zu erleben, in einer Zeit, in der wir mit den Folgen des Vietnamkriegs zu tun hatten, mit dem Kalten Krieg, Rassenunruhen, einem kriminellen Präsidenten und der Ermordung von drei ungeheuer populären führenden Politikern. Und der dritte Langstreckenboom? Ein Jahr nach dem 11. September 2001 wurde der Querfeldeinlauf plötzlich zum Freiluftsport mit den höchsten Zuwachsraten. Vielleicht war das ein Zufall. Vielleicht gibt es aber auch einen Auslöser in der menschlichen Psyche, eine einkodierte Reaktion, die unsere erste und bedeutendste Überlebensfähigkeit aktiviert, sobald wir spüren, dass die Raubtiere sich nähern. Was nun den Abbau von Stress und sinnliche Vergnügungen anbelangt: Das Laufen gehört zu unserem Leben, noch bevor wir Sex haben. Die Voraussetzungen dafür und das entsprechende Bedürfnis haben wir von Anfang an. Wir müssen nur loslegen und dranbleiben.
Genau darum ging es mir. Nicht um ein teures Stück Plastik, das ich in meinen Schuh stecken konnte, nicht um eine monatliche Zufuhr von Schmerzmitteln, nur um eine Methode, wie ich loslegen konnte, ohne meinen Körper zu ruinieren. Ich liebte das Laufen nicht, aber ich wollte laufen. Was mich in die Praxis von Dr. Nummer drei führte: zu Dr. Irene Davis, einer Expertin für Biomechanik und Leiterin der Running Injury Clinic an der University of Delaware.
Dr. Davis stellte mich auf ein Laufband, zunächst barfuß und anschließend mit drei verschiedenen Laufschuhen. Sie ließ mich gehen, traben und laufen. Sie ließ mich vorwärts und rückwärts über eine Messplatte laufen, um die Kräfte zu ermitteln, die beim Aufsetzen der Füße wirkten. Und dann saß ich da, und das kalte Grausen packte mich, als die Ärztin das Videoband abspielte.
Nach meinem eigenen Empfinden bin ich leichtfüßig und flink wie ein Navajo auf der Jagd. Der Kerl auf dem Bildschirm sah aber aus wie Frankensteins Monster beim Versuch, Tango zu tanzen. Ich bewegte mich so ruckartig auf und ab, dass mein Kopf über den oberen Bildrand hinauswanderte. Ich wedelte mit den Armen wie ein Baseballschiedsrichter, und meine 47er-Schuhe stampften so heftig auf das Band, dass es klang, als liefe das Videoband unrund.
Dr. Davis stellte dann – als ob der erste Anblick nicht schon schlimm genug gewesen wäre – auf Zeitlupe um, sodass wir uns ruhig zurücklehnen und richtig genießen konnten, wie sich mein rechter Fuß nach außen drehte, mein linkes Knie nach innen auswich und mein Rücken sich so heftig sträubte und verkrampfte, dass das Ganze aussah, als müsste mir jemand eine Brieftasche zwischen die Zähne klemmen und um Hilfe rufen. Wie zum Teufel kam ich überhaupt vorwärts mit diesem ganzen Auf und Ab, Hin und Her und Fisch-ander-Angel-Gezappel?
»Okay«, sagte ich. »Wie sieht der richtige Laufstil aus?«
»Das ist die ewige Frage«, lautete die Antwort von Dr. Davis.
Und die ewige Antwort … nun, das war eine knifflige Angelegenheit. Ich könnte meine Schrittlänge umstellen und eine verbesserte Stoßdämpfung erreichen, wenn ich auf dem besser gepolsterten Mittelfuß landete und nicht auf der knochigen Ferse, aaaaber … Vielleicht tauschte ich so nur das eine Problem gegen ein anderes ein. Ferse und Achillessehne können durch Experimente mit einem neuen Laufstil plötzlich ungewohnten Belastungen ausgesetzt werden, was dann zu einer neuen Verletzungsserie führt.
»Laufen ist eine große Belastung für die Beine«, sagte Dr. Davis. Sie war so freundlich und verständnisvoll. Ich konnte mir selbst dazudenken, welchen Gedanken sie nicht aussprach: »Besonders für deine Beine, Großer.«
Ich stand wieder am Anfang. Nach mehreren Monaten, in denen ich den Rat von Fachärzten eingeholt und das Internet nach einschlägigen Studien durchforstet hatte, bestand mein ganzer Fortschritt darin, dass meine Frage herumgereicht und an mich zurückgegeben wurde:
Warum tut mein Fuß weh?
Weil Ihnen das Laufen nicht guttut.
Warum tut mir das Laufen nicht gut?
Weil es die Schmerzen in Ihrem Fuß verursacht.
Aber warum? Antilopen bekommen kein Schienbeinkantensyndrom. Wölfe legen sich keine Eisbeutel aufs Knie. Ich glaube nicht, dass Jahr für Jahr 80 Prozent aller Wildpferde durch die mit dem Laufen verbundenen Belastungen außer Gefecht gesetzt werden. In dieser Situation erinnerte ich mich an einen Ausspruch, der dem britischen Mittelstreckler Roger Bannister zugeschrieben wurde. In einer Zeit, in der er Medizin studierte, in der klinischen Forschung arbeitete und sich einprägsame Gleichnisse ausdachte, wurde er zum ersten Menschen, der die Meile unter vier Minuten lief: »Jeden Morgen wacht in Afrika eine Gazelle auf«, sagte Bannister. »Sie weiß, dass sie schneller als der schnellste Löwe laufen muss, sonst wird sie getötet. Jeden Morgen wacht in Afrika auch ein Löwe auf. Er weiß, dass er schneller laufen muss als die langsamste Gazelle, sonst wird er verhungern. Es spielt keine Rolle, ob du ein Löwe oder eine Gazelle bist: Wenn die Sonne aufgeht, fängst du am besten an zu laufen.«
Warum sollte jedes andere Säugetier auf diesem Planeten sich auf seine Beine verlassen können, wir aber nicht? Wie konnte ein Kerl wie Bannister Tag für Tag aus dem Labor stürmen, auf einer harten Aschenbahn in dünnen Lederschlappen seine Runden drehen und dabei nicht nur schneller werden, sondern auch von Verletzungen verschont bleiben? Wie kann es sein, dass manche von uns jeden Morgen bei Sonnenaufgang wie die Löwen oder die Bannisters in der Gegend herumrennen, während wir anderen erst einmal eine Handvoll Ibuprofen brauchen, bevor wir unsere Füße bewegen können?
Das waren sehr interessante Fragen. Aber bald darauf sollte ich feststellen: Die einzigen Menschen, die sie beantworten konnten – die einzigen, die die Antworten lebten -, redeten nicht darüber.
Vor allem nicht mit jemandem wie mir.
Im Winter 2003 hatte ich beruflich in Mexiko zu tun und blätterte eines Tages in einer spanischsprachigen Reisezeitschrift. Plötzlich weckte ein Foto von Jesus, der eine Geröllhalde hinunterrannte, meine Aufmerksamkeit.
Die genauere Betrachtung ergab, dass der Abgebildete möglicherweise nicht Jesus war, definitiv aber ein Mann, der ein bauschiges Hemd und Sandalen trug und einen von Geröll übersäten Abhang hinunterrannte. Ich versuchte mich an der Übersetzung der Bildunterschrift, kam aber nicht darauf, warum sie im Präsens gehalten war. Es schien sich hier nämlich um eine sehnsuchtsvolle atlantische Legende zu handeln, die von einem untergegangenen Reich erleuchteter Superwesen erzählte. Nach und nach fand ich dann heraus, dass ich mit allem richtig lag, mit Ausnahme der Adjektive »untergegangen« und »sehnsuchtsvoll«.
Ich war in Mexiko, um im Auftrag des New York Times Magazine eine verschwundene Popsängerin und ihren geheimen Gehirnwäsche-Kult aufzuspüren, aber der Artikel, an dem ich gerade arbeitete, kam mir im Vergleich zu dem, was ich in dieser Zeitschrift las, mit einem Mal äußerst langweilig vor. Ausgeflippte untergetauchte Popstars kommen und gehen, aber die Tarahumara schienen ewig zu leben. Dieser kleine, in seinem geheimnisvollen Canyonversteck sehr zurückgezogen lebende Stamm hatte nahezu alle Probleme gelöst, die der Menschheit zusetzten. Man benenne eine Kategorie – Geist, Körper oder Seele -, und die Tarahumara boten prompt eine perfekte Lösung an. Es sah ganz danach aus, als hätten sie ihre Höhlen insgeheim in Brutkästen für Nobelpreisträger verwandelt, die alle daran arbeiteten, Hass, Herzkrankheiten, Schienbeinkantensyndrome und Treibhausgase aus der Welt zu schaffen.
Im Tarahumara-Land gab es weder Verbrechen noch Krieg oder Diebstahl. Es gab keine Korruption, Fettleibigkeit, Drogensucht, Gier, Misshandlung von Ehefrauen und Kindern, auch Herzerkrankungen, Bluthochdruck oder Kohlendioxidemissionen waren unbekannt. Sie bekamen keine Diabetes, keine Depressionen, ja sie alterten nicht einmal: 50-Jährige liefen schneller als Teenager, und 80-jährige Großväter legten Marathondistanzen im Gebirge zurück. Krebserkrankungen waren bei diesem Volk kaum feststellbar. Die Tarahumara-Genies hatten sich sogar mit Ökonomie beschäftigt und ein einzigartiges Finanzsystem geschaffen, das auf Alkoholkonsum und unsystematischen Freundlichkeiten beruhte: Anstelle von Geld tauschten sie Gefälligkeiten und große Behälter mit Maisbier.
Man rechnet wohl damit, dass ein Wirtschaftssystem, das von Alkohol und Gratisleistungen angetrieben wird, in trunkene Raffgier ausartet, mit der alle Beteiligten sich beidhändig selbst bedienen wie bankrotte Glücksspieler an einem Kasinobüfett, aber im Tarahumara-Land funktioniert es. Die Erklärung liegt vielleicht in der Tatsache, dass die Tarahumara fleißig und unglaublich ehrlich sind. Ein Forscher verstieg sich sogar zu der Spekulation, dass die Gehirne der Tarahumara nach so vielen Generationen der Wahrheitsliebe biochemisch gar nicht mehr in der Lage seien, sich Lügen auszudenken.
Und als ob es nicht genügte, das freundlichste, glücklichste Volk auf Erden zu sein: Die Tarahumara waren auch zäher als alle anderen Menschen. Die einzige Konkurrenz für ihre übermenschliche Gelassenheit war, so hatte es den Anschein, ihre übermenschliche Widerstandsfähigkeit gegen Schmerz – und lechuguilla, ein fürchterlicher, selbstgebrannter Schnaps aus Klapperschlangenleibern und Kaktussaft. Laut einem der wenigen außenstehenden Augenzeugen eines richtigen Tarahumara-Festes waren die Feiernden schließlich so enthemmt, dass die Frauen sich gegenseitig die Oberbekleidung vom Leib rissen und zum Oben-Ohne-Ringkampf übergingen, während ein gackernder alter Mann das Getümmel umrundete und die Kämpferinnen mit einem Maiskolben in den Hintern zu pieksen versuchte. Die Ehemänner beobachteten das Geschehen derweil wie gelähmt und mit glasigem Blick. Cancún während des Spring Breaks war gar nichts im Vergleich zu den Barrancas während der Erntezeit.
Die Tarahumara feierten in diesem Stil gewöhnlich die ganze Nacht hindurch, und dann, gleich am nächsten Morgen, brachen sie zu einem Wettlauf auf, der nicht bloß über zwei Meilen ging oder bescheidene zwei Stunden, sondern zwei ganze Tage dauerte. Nach einem Bericht des mexikanischen Historikers Francisco Almada legte ein Tarahumara-Meisterläufer einmal 700 Kilometer ohne Pause zurück, was einer Laufstrecke entspricht, die in New York City beginnt und erst in Detroit zu Ende ist. Andere Berichte erzählen von Tarahumara-Läufern, die 480 Kilometer an einem Stück hinter sich brachten. Das entspricht nahezu zwölf Marathonläufen nacheinander, die der Läufer durchmisst, einen nach dem andern, bis das Dutzend voll ist, während die Sonne aufgeht, hoch am Himmel steht und schließlich wieder untergeht, bevor dann abermals ein neuer Tag beginnt.
Und die Tarahumara bewegten sich keineswegs auf ebenen, asphaltierten Straßen, sondern liefen auf und ab, und das auf Canyonpfaden, die im Lauf der Generationen von ihren eigenen Füßen ausgetreten wurden. Lance Armstrong ist einer der größten Ausdauersportler aller Zeiten, doch seinen ersten Marathonlauf schaffte er nur mit Mühe und Not, obwohl er fast jeden zweiten Kilometer ein Energiegel zu sich nahm. (Nach dem New-York-City-Marathon schrieb Lance seiner Exfrau eine SMS: »Oh. Mein. Gott. Aua. Fürchterlich.«) Und diese Burschen schafften so etwas im Dutzend, nacheinander?
Ein amerikanischer Physiologe wanderte 1971 in die Copper Canyons und war von der körperlichen Leistungsfähigkeit der Tarahumara so beeindruckt, dass er 2800 Jahre zurückgehen musste, um einen passenden Vergleichsmaßstab zu finden: »Seit der Zeit der antiken Spartaner hat vielleicht kein anderes Volk mehr einen solchen Grad der körperlichen Ertüchtigung erreicht«, resümierte Dr. Dale Groom, als er seine Ergebnisse im American Heart Journal veröffentlichte. Im Unterschied zu den Spartanern sind die Tarahumara allerdings so freundlich wie Bodhisattvas. Sie benutzen ihre enormen körperlichen Fähigkeiten nicht dazu, um andere fertigzumachen, sondern um in Frieden zu leben. »Als Gesamtkultur sind sie eines der großen ungelösten Rätsel«, sagt Dr. Daniel Noveck, ein an der University of Chicago lehrender Anthropologe und Tarahumara-Experte.
Die Tarahumara sind ein so rätselhaftes Volk, dass sie sogar unter einem Pseudonym leben. Ihr richtiger Name lautet Rarámuri – Die Fußläufer. Die Bezeichnung »Tarahumara« prägten spanische Eroberer, die die Stammessprache nicht verstanden. Der verballhornte Name hielt sich, weil die Rarámuri ihrem eigenen Namen entsprachen und lieber wegliefen als stehenzubleiben, um über diese Frage zu streiten. Auf Aggression antworteten die Tarahumara stets, indem sie Fersengeld gaben, das war nun einmal ihre Art. So war es gewesen, seit Cortés’ gepanzerte Eroberer in ihre Heimat vorgedrungen waren, und auch bei späteren Invasionen durch Pancho Villas Rebellen und mexikanische Drogenbarone hatten sie sich nicht anders verhalten. Wurden sie angegriffen, rannten die Tarahumara immer weiter und schneller als jeder Verfolger, und dabei zogen sie sich immer tiefer in die Barrancas zurück.
Mein Gott, sie müssen unglaublich diszipliniert sein, dachte ich. Totale Konzentration und Hingabe. Die Shaolin-Mönche unter den Läufern.
Nun, das stimmte nicht ganz. In Sachen Marathonlauf pflegen die Tarahumara eher einen karnevalistischen Stil. Ihre Ernährung, ihre Lebensführung und ihr Temperament sind für einen Lauftrainer ein Albtraum. Sie trinken, als wäre Silvester ein wöchentlich wiederkehrendes Ereignis, und schütten dabei, aufs ganze Jahr gesehen, so viel Maisbier in sich hinein, dass sie jeden dritten Tag ihres Erwachsenenlebens entweder betrunken oder verkatert verbringen. Im Unterschied zu Lance führen die Tarahumara ihrem Körper keine Elektrolytgetränke zu. Sie essen zwischen ihren Trainingseinheiten auch keine Proteinriegel; eigentlich nehmen sie so gut wie gar keine Proteine zu sich, ihre Ernährung besteht im Wesentlichen aus Maismehl, das durch ihre Lieblingsspeise ergänzt wird: gegrillte Maus. Ist die Zeit für das Rennen gekommen, wird weder trainiert noch systematisch auf einen bestimmten Zeitpunkt hingearbeitet. Sie machen keine Dehnübungen und wärmen sich auch nicht auf. Sie spazieren einfach zur Startlinie, lachen und scherzen dabei … und rennen dann los wie die Teufel, um 48 Stunden lang nicht mehr anzuhalten.
Warum sind sie nicht verkrüppelt?, fragte ich mich. Es sah ganz danach aus, als hätte sich ein Schreibfehler in die Statistiken geschlichen: Sollten nicht wir, die Leute mit den nach neuesten Erkenntnissen gestalteten Laufschuhen und den maßgefertigten Einlagen – verletzungsfrei bleiben und dafür die Tarahumara – die viel mehr und auf deutlich felsigerem Untergrund liefen, mit Schuhen, die man kaum als Schuhe bezeichnen konnte – ständig aus dem Rennen sein?
Ihre Beine sind einfach widerstandsfähiger, weil sie ihr ganzes Leben lang gerannt sind, dachte ich, bevor mir aufging, dass das ein Trugschluss war. Aber das bedeutet, dass sie häufiger verletzt sein sollten, nicht weniger; wenn das Laufen schlecht für die Beine ist, sollte besonders häufiges Laufen sehr viel schlechter sein.
Ich schob den Artikel beiseite und war fasziniert und verärgert zugleich. Alles, was wir über die Tarahumara wussten, schien nicht auf der Höhe der Zeit zu sein, eine Verhöhnung, auf irritierende Weise unbegreiflich, wie die Rätsel eines Zenmeisters. Die zähesten Burschen waren zugleich die freundlichsten Menschen; die am stärksten belasteten Beine waren die flinksten; die gesündesten Menschen hatten die schlechteste Ernährung; ein Stamm von Analphabeten war weiser als alle anderen; diejenigen, die am schwersten arbeiteten, hatten am meisten Spaß …
Und was hatte das Laufen mit all dem zu tun? War es ein Zufall, dass das erleuchtetste Volk der Welt auch die erstaunlichsten Läufer stellte? Sinnsucher stiegen auf die Berge des Himalaya, um diese Art von Weisheit zu erlangen – dabei war sie, so wurde mir klar, die ganze Zeit einen Katzensprung hinter der mexikanischen Grenze zu finden.
3
Wo genau hinter der Grenze dieser Ort lag, sollte sich jedoch als schwierige Frage erweisen.
Die Zeitschrift Runner’s World gab mir den Auftrag, in die Barrancas zu gehen, um dort nach den Tarahumara zu suchen. Ich brauchte allerdings erst einen Geisterjäger, bevor ich nach den Geistern suchen konnte. Man sagte mir, Salvador Holguín sei der einzige Mann, der dieser Aufgabe gewachsen sei.
Tagsüber ist Salvador ein 33 Jahre alter Angestellter der Stadtverwaltung von Guachochi, einem Grenzort am Rand der Copper Canyons. Abends ist er ein Mariachi-Sänger, der in Kneipen auftritt, und er sieht auch entsprechend aus. Mit seinem Bierbauch, den schwarzen Augen, dem Rosenkavalierlächeln und dem gewinnenden Äußeren entspricht er genau dem Bild eines Mannes, der sein Leben zwischen Schreibtischstuhl und Barhocker aufteilt. Salvadors Bruder ist dagegen der Indiana Jones des mexikanischen Schulsystems. Jedes Jahr belädt er einen Esel mit Bleistiften und Arbeitsheften und schlägt sich mit dem Tier bis in die Barrancas durch, um die Schulen in den Canyons mit neuem Material zu versorgen. Salvador ist bei Unternehmungen aller Art gern mit von der Partie, deshalb nimmt er sich, wenn eine solche Expedition ansteht, auch mal frei, um seinen Bruder zu begleiten.
»Hombre, kein Problem«, sagte er zu mir, nachdem ich ihn aufgespürt hatte. »Wir gehen einfach zu Arnulfo Quimare …«
Hätte er es dabei belassen, wäre ich begeistert gewesen. Auf meiner Suche nach einem ortskundigen Führer hatte ich erfahren, dass Arnulfo Quimare der beste lebende Tarahumara-Läufer war. Er entstammte einem Klan von Cousins, Brüdern, angeheirateten Verwandten und Neffen, die fast genauso gut waren. Die Aussicht, direkt zu den verborgenen Hütten der Quimare-Dynastie geführt zu werden, war mehr, als ich hätte erwarten können. Das einzige Problem bestand darin, dass Salvador immer noch redete.
»… ich bin mir ziemlich sicher, dass ich den Weg kenne«, fuhr er fort. »Ich war aber noch nie dort. Pues, lo que sea.« Na ja, wie auch immer. »Wir werden schon hinfinden.«
Unter normalen Umständen klänge so etwas ein bisschen zweifelhaft, aber im Vergleich zu allen anderen Leuten, mit denen ich gesprochen hatte, war Salvador ungeheuer optimistisch. Die Tarahumara haben ihre Zeit damit verbracht, die Kunst der Unsichtbarkeit zu perfektionieren, seit sie sich vor 400 Jahren in ein Niemandsland geflüchtet haben. Viele Tarahumara leben heute noch in Felsenhöhlen, die nur über lange Kletterbalken erreichbar sind. Haben sie ihre Wohnstätte erreicht, ziehen sie die Balken hoch und verschwinden im Fels. Andere Stammesmitglieder leben in perfekt getarnten Hütten. Carl Lumholtz, der große norwegische Forschungsreisende, musste einmal verblüfft feststellen, dass er an einem ganzen Tarahumara-Dorf vorbeigegangen war, ohne auch nur eine Spur von Menschen oder ihren Behausungen zu entdecken.
Lumholtz war ein Fachmann für extreme Lebensumstände, der jahrelang unter Kopfjägern in Borneo gelebt hatte, bevor er Ende des 19. Jahrhunderts ins Tarahumara-Land zog. Aber man spürt bei der Lektüre seines Berichts, wie selbst dieser Mann um Fassung ringt, nachdem er sich durch Wüsten geschleppt und lebensgefährliche Klettertouren hinter sich gebracht hat, schließlich ins Herz des Tarahumara-Landes vorgedrungen ist, und dann findet er …
Keine Menschenseele.
»Der Anblick dieser Berge wirkt erhebend auf das Gemüt, aber sie zu überqueren erschöpft die Muskeln und die Geduld«, erinnert sich Lumholtz in seinem 1902 erschienenen Buch Unknown Mexiko: A Record of Five Years’ Exploration Among the Tribes of the Western Sierra Madre. »Nur wer die Berge Mexikos selbst bereist hat, begreift die Schwierigkeiten und Ängste, die mit einem solchen Unternehmen verbunden sind, und zollt dem Reisenden Anerkennung.«
Mit einer solchen Feststellung verbindet sich zunächst einmal die Annahme, dass man diese Berge überhaupt erreicht. »Auf den ersten Blick ist das Land der Tarahumara unzugänglich«, klagte der französische Schriftsteller Antonin Artaud, nachdem er es in den Dreißigerjahren des vergangenen Jahrhunderts mit viel Mühe und Schweiß auf der Suche nach schamanischer Weisheit bis in die Copper Canyons geschafft hatte. »Kaum ein paar unkenntliche Trampelpfade, die alle zwanzig Meter vom Erdboden verschluckt zu werden scheinen.« Artaud und seine Führer entdeckten schließlich einen Pfad, hatten aber schwer zu schlucken, bevor sie ihn begingen: Die Tarahumara lassen sich von dem Grundsatz leiten, dass die beste Methode, Verfolger abzuschütteln, darin besteht, sich an Orte zu begeben, an die ihnen nur ein Verrückter folgen würde, und legen ihre Kletterpfade auf selbstmörderisch steilem Terrain an.
»Ein falscher Schritt«, hielt ein Abenteurer namens Frederick Schwatka bei einer Expedition in die Copper Canyons bereits 1888 in seinem Notizbuch fest, »und der Kletterer stürzt sechzig bis neunzig Meter tief in die Schlucht hinab und wird vielleicht zum verstümmelten Leichnam.«
Schwatka war im Übrigen kein zimperlicher Dichter aus Paris. Er war ein Leutnant der US-Armee, der die Grenzkriege gegen Mexiko überstanden hatte und später dann als Amateuranthropologe unter den Sioux lebte. Der Mann wusste also einiges über verstümmelte Leichname. Außerdem hatte er einige der unwirtlichsten Gegenden seines Zeitalters bereist, unter anderem auch zwei Jahre mit einer höllischen Expedition zum nördlichen Polarkreis verbracht. Als er jedoch in die Copper Canyons gelangte, musste er die Liste seiner Errungenschaften umschreiben. Schwatka empfand angesichts der unendlichen Wildnis, die ihn dort umgab, eine kurze, spontane Bewunderung – »Das Herz der Anden oder die Gipfel des Himalaya bieten keine großartigeren Landschaften als die wilden, unbekannten Schlupfwinkel der Sierra Madre in Mexiko« -, bevor er wieder in düstere Verblüffung verfiel: »Wie man auf diesen Felsen Kinder erziehen kann, ohne sie Jahr für Jahr allesamt wieder zu verlieren, ist für mich eines der größten Rätsel, das mit diesem seltsamen Volk verbunden ist.«
Selbst in der heutigen Zeit, in der das Internet die Welt zu einem globalen Dorf hat zusammenschnurren lassen und uns Google-Satelliten einen Blick in den Hinterhof wildfremder Menschen ermöglichen, die am anderen Ende unseres Heimatlandes leben, sind die nach ihren eigenen Traditionen lebenden Tarahumara genau die geisterhaften Wesen, die sie bereits vor 400 Jahren waren. Vor etwa 15 Jahren drang eine Expeditionsgruppe tief in die Barrancas vor, und plötzlich sahen sich die Wanderer durch das Gefühl, von unsichtbaren Augen beobachtet zu werden, aus der Fassung gebracht:
»Unsere kleine Gruppe war bereits stundenlang durch die Barranca del Cobre in Mexiko gewandert, ohne irgendeine Spur von anderen menschlichen Wesen zu entdecken«, schrieb ein Expeditionsmitglied. »Jetzt, im Herzen einer Schlucht, die sogar tiefer als der Grand Canyon ist, hörten wir das Echo von Tarahumara-Trommeln. Ihre einfachen Rhythmen waren zunächst kaum wahrnehmbar, wurden aber schon bald lauter. Man konnte unmöglich sagen, wie viele es waren und wo sie sich befanden, weil die Felswände die Echos zurückwarfen. Wir sahen unsere Führerin fragend an. ›Quién sabe?‹, sagte sie. ›Wer weiß? Man kann die Tarahumara nur sehen, wenn sie das auch wollen.‹«
Der Mond stand immer noch hoch am Himmel, als wir uns mit Salvadors zuverlässigem Pick-up auf den Weg machten. Bei Sonnenaufgang hatten wir die Asphaltstraße schon längst hinter uns gelassen und rumpelten über eine unbefestigte Piste, die eher einem Flussbett als einer Straße glich. Im ersten Gang holperten und schlingerten wir ganz langsam dahin wie ein Trampschiff bei schwerem Seegang.
Mit Kompass und Karte versuchte ich hartnäckig, unseren Standort zu bestimmen, konnte aber manchmal nicht beurteilen, ob Salvador eine beabsichtigte Richtungsänderung vornahm oder nur einem herabgestürzten Felsblock auswich. Doch schon bald spielte das keine Rolle mehr – wo immer wir auch waren, unser aktueller Aufenthaltsort gehörte nicht mehr zur bekannten Welt. Wir schlängelten uns nach wie vor auf einer schmalen Passage zwischen den Bäumen durch, aber die Karte zeigte nur unberührten Wald an.
»Mucha mota por aquí«, sagte Salvador und wies mit einem kreisenden Finger auf die umgebenden Hügel. Hier gibt es eine Menge Marihuana.
Die Barrancas wurden, weil sie polizeilich so schwer zu kontrollieren sind, zum Stützpunkt zweier rivalisierender Drogenkartelle, man kennt sie als Los Zetas und die New Bloods. Beiden Gruppen gehörten ehemalige Elitesoldaten der Armee an, und beide agierten absolut skrupellos. Die Zetas waren dafür bekannt, dass sie unkooperative Polizisten in Fässer mit brennendem Dieselöl warfen und gefangene Rivalen an das Maskottchen der Bande verfütterten – einen bengalischen Tiger. Sobald die Schreie der Opfer verstummt waren, wurden ihre verkohlten und von Tigerzähnen verstümmelten Köpfe eingesammelt und als Marketingmittel verwendet. Die Kartelle markierten ihr Territorium gern, und in einem Fall stellten sie die aufgespießten Köpfe zweier Polizisten vor einem Regierungsgebäude zur Schau und ergänzten diesen Anblick durch eine auf einem Schild festgehaltene Aufforderung in spanischer Sprache: ZEIGT ETWAS RESPEKT. Noch im selben Monat wurden fünf Köpfe auf die Tanzfläche eines überfüllten Nachtklubs gerollt. Selbst hier draußen, am Rand der Barrancas, wurden im Durchschnitt etwa sechs Leichen pro Woche gefunden.
Aber Salvador schien davon gänzlich unbeeindruckt. Er fuhr weiter durch den Wald und sang lauthals und reichlich unzusammenhängend von einer Frau namens Maria, mit der es nur Ärger gab. Plötzlich erstarb das Lied in seinem Mund. Er schaltete den Kassettenrekorder aus und fixierte einen roten Dodge Pick-up mit dunkel getönten Scheiben, der unmittelbar vor uns aus dem Staubwirbel aufgetaucht war.
»Narcotrafi cantes«, murmelte er.
Drogenkuriere. Salvador fuhr so nah wie nur möglich an die Felskante zu unserer Rechten heran und ging noch weiter vom Gas, wodurch er unsere Geschwindigkeit ehrerbietig von den bisherigen gut 15 Stundenkilometern auf null reduzierte und so dem großen roten Dodge so viel Platz wie nur möglich einräumte.
Hier gibt’s keinen Ärger, lautete die Botschaft, die er auf diese Weise übermitteln wollte. Wir kümmern uns um unseren eigenen Kram, der nichts mit Drogen zu tun hat. Fahrt einfach weiter …, denn was sollten wir sagen, wenn sie uns den Weg verstellten, aus dem Auto stiegen und mit vorgehaltenen Gewehren verlangten, dass wir langsam und deutlich erklärten, was zum Teufel wir hier draußen, mitten im mexikanischen Marihuana-Land, zu suchen hatten?
Wir konnten ihnen nicht einmal die Wahrheit sagen; wenn sie die glaubten, waren wir erledigt. Sänger und Reporter waren zwei Berufsgruppen, die den mexikanischen Drogenbanden genauso verhasst waren wie Polizisten. Hier ist nicht von Verrätern oder Polizeispitzeln die Rede, die im Fachjargon ebenfalls »singen«; nein, diese Leute hassten richtige, auf der Gitarre klimpernde, Liebeslieder vortragende Schnulzensänger. In nur 18 Monaten hatten die Drogenbanden 15 Sänger hingerichtet, darunter auch Zayda Peña Arjona, die 28 Jahre alte, wunderschöne Sängerin von Zayda y Los Culpables, die im Anschluss an ein Konzert niedergeschossen wurde; sie überlebte diesen ersten Anschlag, aber das Killerteam verfolgte sie bis ins Krankenhaus und erschoss die Künstlerin, die sich dort von ihrer Operation erholte. Der Frauenschwarm Valentín Elizalde starb im Kugelhagel einer Kalaschnikow in einem grenznahen Ort auf der mexikanischen Seite, unweit der Stadt McAllen in Texas, und Sergio Gómez wurde ermordet, kurz nachdem er für einen Grammy nominiert worden war. Die Mörder verbrannten seine Genitalien, dann erwürgten sie ihr Opfer und warfen den Leichnam auf die Straße. All diesen Künstlern wurde, soweit das überhaupt jemand erklären konnte, ihr Ruhm, ihr gutes Aussehen und ihr Talent zum Verhängnis. Die Sänger beeinträchtigten das den Drogenbaronen so wichtige Gefühl der eigenen Bedeutsamkeit, und deshalb mussten sie sterben.
Die bizarre Fatwa gegen Balladensänger war eine von Emotionen bestimmte und nicht vorhersagbare Vorgehensweise, aber das Verdikt gegen Reporter war rein geschäftlicher Natur. Amerikanische Blätter griffen mexikanische Zeitungsberichte über die Drogenkartelle auf, was amerikanischen Politikern unangenehm war, die dann ihrerseits Druck auf die Drug Enforcement Administration (DEA), die US-Drogenbehörde, ausübten, gegen die Händler vorzugehen. Die wütenden Zetas warfen Handgranaten in Redaktionsbüros und schickten sogar Mörder über die Grenze, um unliebsame amerikanische Journalisten zur Strecke zu bringen. Innerhalb von sechs Jahren wurden 30 Reporter ermordet, und der Herausgeber der Zeitung von Villahermosa fand eines Tages vor seinem Redaktionsgebäude den abgetrennten Kopf eines untergeordneten Drogenpolizisten und einen Zettel, auf dem zu lesen war: »Du bist der Nächste.« Der Blutzoll war so fürchterlich, dass Mexiko schließlich bei der Zahl der getöteten oder entführten Reporter weltweit nur noch vom Irak übertroffen wurde.
Und wir hatten den Kartellen jetzt eine Menge Arbeit abgenommen. Ein Sänger und ein Journalist waren unaufgefordert bei ihnen vorgefahren. Ich schob mein Notizbuch in meine Hose und prüfte schnell, ob es in der vorderen Wagenhälfte noch mehr zu verstecken gab. Es war aussichtslos. Überall lagen Kassetten von Salvadors Gruppe herum, in meiner Brieftasche steckte ein leuchtendroter Presseausweis, und zwischen meinen Füßen hatte ich einen Rucksack abgestellt, der mit Tonbandgeräten, Schreibwerkzeug und einer Kamera vollgestopft war.
Der rote Dodge kam längsseits. Es war ein herrlicher, sonniger Tag, an dem ein kühler, nach Kiefern riechender Wind wehte, aber die Fenster des Pick-ups waren fest geschlossen, was die Insassen hinter den rauchschwarzen Scheiben für uns unsichtbar machte. Das Gefährt wurde langsamer, kroch polternd dahin.
Fahrt einfach weiter, schoss es mir durch den Kopf. Nicht anhalten, nicht anhalten, nicht nicht nicht …
Der Wagen hielt an. Aus den Augenwinkeln sah ich, dass Salvador stur geradeaus schaute und die Hände auf das Lenkrad gelegt hatte. Auch ich sah wieder geradeaus und rührte mich nicht.
Wir saßen regungslos da.
Sie saßen.
Wir waren still.
Sie waren still.
Sechs Morde pro Woche, dachte ich. Sie verbrannten seine Genitalien. Ich stellte mir vor, wie mein Kopf auf eine Tanzfläche in Chihuahua rollte und Pfennigabsatzträgerinnen darüber in Panik gerieten.
Ein plötzliches Motorengebrumm. Meine Augen wanderten abermals nach links. Der große rote Dodge war wieder zum Leben erwacht und dröhnte vorbei.
Salvador beobachtete im Seitenspiegel, wie das Todesmobil in einer Staubwolke verschwand. Dann klopfte er auf sein Lenkrad und ließ seine Ay-yay-yay-Kassette wieder laufen.
»Bueno!«, rief er. »Andale pues, a más aventuras!« Gut so! Auf zu neuen Abenteuern!
Teile meines Körpers, die sich so fest verkrampft hatten, dass sie Walnüsse hätten knacken können, entspannten sich langsam wieder. Aber nicht lange.
Einige Stunden später trat Salvador hart auf die Bremse. Er setzte ein Stück zurück, bog von dem ausgefahrenen Weg scharf nach rechts ab und fuhr zwischen den Bäumen hindurch. Wir fuhren immer tiefer in den Wald hinein, walzten über Tannennadeln und holperten durch Querrinnen, die so tief waren, dass ich mir den Kopf am Überrollbügel anschlug.
Je finsterer der Wald wurde, desto stiller wurde Salvador. Zum ersten Mal seit unserer Begegnung mit dem Todesmobil stellte er sogar die Musik ab. Ich dachte, er wollte nur die Einsamkeit und die Stille auf sich wirken lassen, also versuchte ich mich zurückzulehnen und seine Wahrnehmungen zu teilen. Als ich schließlich die Stille mit einer Frage beendete, brummte er mir eine übellaunige Antwort entgegen. Allmählich dämmerte mir, was hier los war: Wir hatten uns verfahren, und Salvador wollte es nicht zugeben. Ich beobachtete ihn genauer und sah, dass er jetzt langsamer fuhr, um die Baumstämme genau zu prüfen, als ob es irgendwo in der keilförmigen Rinde einen entzifferbaren Straßenatlas gäbe.
Wir sind aufgeschmissen, dachte ich. Wir hatten eine Eins-zu-vier-Chance, dass diese Sache gut ausging, was noch drei andere Möglichkeiten übrigließ: eine Wiederbegegnung mit den Zetas, ein Sturz mit dem Fahrzeug von den Felsen in der Dunkelheit oder eine ziellose Fahrt in der Wildnis, bis uns der Proviant ausging und einer von uns den anderen aß.
Und dann, genau bei Sonnenuntergang, ging uns der Planet aus.
Wir kamen aus dem Wald, und vor uns tat sich eine unendliche Leere und Weite auf – ein Riss in der Erde, der so breit war, dass die andere Seite in einer anderen Zeitzone hätte liegen können. Weit unten in der Tiefe sah es aus wie nach einer zu Stein erstarrten Weltuntergangsexplosion, als hätte ein zorniger Gott inmitten der Apokalypse seine Meinung geändert und die Zerstörung der Welt beendet. Ich blickte auf eine mehr als 50 000 Quadratkilometer umfassende Wildnis, willkürlich unterteilt in verwinkelte Schluchten, die tiefer und breiter als der Grand Canyon waren.
Ich ging bis zur Felskante vor, und mein Herz begann zu pochen. Ein senkrechter Abfall in … eine unendliche Tiefe. Ganz weit unten wirbelten Vögel durch die Luft. Den mächtigen Fluss in der Talsohle konnte ich gerade noch erkennen. Von hier oben sah er aus wie eine dünne blaue Vene im Arm eines alten Mannes. Mein Magen krampfte sich zusammen. Wie zum Teufel sollten wir da hinunterkommen?
»Wir schaffen das«, versicherte mir Salvador. »Die Rarámuri schaffen es tagtäglich.«
Dieser Hinweis munterte mich offenkundig nicht auf, also wies Salvador auf die positive Seite des Hindernisses hin. »Hey, es ist besser so«, sagte er. »Das ist zu steil für Drogenhändler, die gehen da nicht runter.«
Mir war nicht klar, ob er das auch selbst glaubte oder ob er nur log, um mich aufzumuntern.
So oder so, er hätte es besser wissen müssen.
4
Zwei Tage später stellte Salvador seinen Rucksack ab, wischte sich den Schweiß aus dem Gesicht und sagte: »Wir sind da.«
Ich sah mich um: Außer Felsen und Kakteen gab es hier nichts.
»Wir sind wo?«
»Aquí mismo«, sagte Salvador. »Genau hier. Hier lebt der Quimare-Klan.«
Ich begriff nicht, wovon er redete. So weit das Auge reichte, sah es hier genauso aus wie auf jener Nachtseite eines entlegenen Planeten, die wir in den letzten Tagen durchwandert hatten. Wir hatten den Wagen am Canyonrand abgestellt und uns dann, rutschend und kletternd, auf den Weg hinab in die Schlucht gemacht. Es war eine Erleichterung gewesen, wieder auf ebenem Gelände zu gehen, aber nicht lange. Am nächsten Morgen gingen wir flussaufwärts und sahen uns von den hoch aufragenden Felswänden immer enger umschlossen. Wir zogen weiter und balancierten den Rucksack auf dem Kopf, als wir in brusthohem Wasser wateten. Die Sonne wurde von den hohen Felsen mehr und mehr verdeckt, bis wir uns schließlich durch eine gurgelnde Finsternis kämpften. Es war ein Gefühl, als wanderte man langsam zum Meeresgrund hinab.
Salvador entdeckte schließlich eine Lücke in der glatten Wand, und wir ließen den Fluss hinter uns. Zur Mittagszeit sehnte ich mich in den düsteren Talgrund zurück. Über uns stand eine brütend heiße Sonne, ringsum gab es nur nackte Felswände, und der Aufstieg fühlte sich an wie eine Klettertour auf einer stählernen Rutschbahn. Schließlich hielt Salvador an, und ich ließ mich auf einen Felsen sinken, um auszuruhen.
Der Mann ist verdammt zäh, dachte ich. Salvador lief der Schweiß über das sonnengebräunte Gesicht, aber er blieb auf den Beinen. Er hatte einen seltsamen, erwartungsvollen Gesichtsausdruck.
»¿Que pasa?«, fragte ich. »Was ist los?«
»Sie wohnen hier«, sagte Salvador und zeigte dann auf einen kleinen Hügel.
Ich stand wieder auf, folgte ihm durch einen Riss in den Felsen und stand unvermittelt vor einer dunklen Öffnung. Der Hügel war in Wirklichkeit eine kleine Hütte, die aus Lehmziegeln gefertigt und so in den Hang eingefügt war, dass sie unsichtbar blieb, bis man buchstäblich auf ihr stand.
Ich sah mich nach weiteren versteckten Behausungen um, aber in keiner Himmelsrichtung gab es irgendeinen Hinweis auf andere menschliche Wesen. Die Tarahumara ziehen ein Leben in solcher Isolation vor, was auch für den Umgang untereinander gilt. Bewohner desselben Dorfes mögen es nicht, wenn man so nahe beieinander wohnt, dass man den Rauch des nachbarlichen Herdfeuers sehen kann.
Ich öffnete den Mund, um zu rufen, und schloss ihn gleich wieder. Dort, in der Dunkelheit, stand bereits jemand und beobachtete uns. Dann trat Arnulfo Quimare, der gefürchtetste Tarahumara-Läufer, ins Freie.
»Kuira-bá«, sagte Salvador. Es waren die einzigen Worte der Tarahumara-Sprache, die er kannte. »Wir gehören alle zusammen.«
Arnulfo sah mich an.
»Kuira-bá«, wiederholte ich.
»Kuira«, hauchte Arnulfo mit einer Stimme, die so sanft wie ein Seufzer klang. Er streckte seine Hand zum Tarahumara-Händedruck aus, einem sanften Berühren mit den Fingerspitzen. Dann verschwand er wieder in der Hütte. Wir warteten und … warteten noch ein bisschen länger. War das alles? Aus der Hütte drang nicht einmal ein Flüstern, keinerlei Anzeichen dafür, dass er wieder herauskommen würde. Ich sah um die Ecke, um zu prüfen, ob er sich durch den Hinterausgang davongemacht hatte. Ein weiterer Tarahumara-Mann döste dort im Schatten der Rückwand, aber von Arnulfo war nichts zu sehen.
Ich trat wieder zu Salvador. »Kommt er zurück?«
»No sé«, antwortete Salvador mit einem Schulterzucken. »Ich weiß nicht. Vielleicht haben wir ihn richtig verärgert.«
»Jetzt schon? Wie denn?«
»Wir hätten nicht einfach so daherkommen dürfen.« Salvador ärgerte sich über sich selbst. Er war übereifrig gewesen und hatte eine entscheidende Verhaltensregel im Umgang mit den Tarahumara verletzt. Bevor man sich einer Tarahumara-Behausung nähert, muss man sich in gebührendem Abstand auf den Boden setzen und abwarten. Dann schaut man eine Zeit lang in die entgegengesetzte Richtung, als ob man einfach nur hier vorbeiwandern würde und nichts Besseres zu tun hätte. Wenn dann jemand auftaucht und den Besucher in seine Behausung einlädt, ist das eine feine Sache. Wenn nicht, steht man wieder auf und geht. Man geht nicht einfach hin und baut sich vor dem Eingang auf, wie Salvador und ich das getan hatten. Die Tarahumara entscheiden gern selbst, ob sie sichtbar sein wollen oder nicht. Wer seine Augen auf sie richtet, ohne eingeladen zu sein, verhält sich wie jemand bei uns, der einen anderen Menschen nackt in dessen Badezimmer überrascht.
Arnulfo erwies sich zum Glück als ein Mensch, der verzeiht. Kurze Zeit später kam er mit einem Korb süßer Limetten zurück. Wir seien zu einem ungünstigen Zeitpunkt erschienen, erklärte er uns. Seine ganze Familie sei grippekrank. Der Mann hinter der Hütte sei sein älterer Bruder Pedro, der vom Fieber so geschwächt sei, dass er nicht einmal aufstehen könne. Arnulfo lud uns dennoch ein, hier bei ihm auszuruhen.
»Assag«, sagte er. Setzt euch.
Wir ließen uns nieder, wo wir ein bisschen Schatten fanden, schälten die Früchte und starrten auf das schäumende Wasser des Flusses. Wir kauten einträchtig, spuckten Samenkörner auf den Boden, und Arnulfo schaute schweigend aufs Wasser. Ab und zu wandte er sich zur Seite und taxierte mich. Er fragte nicht, wer wir waren und warum wir überhaupt bei ihm aufgetaucht waren. Es sah ganz danach aus, als wollte er das selbst herausfinden.
Ich bemühte mich, ihn nicht anzustarren, aber es ist schwierig, die Augen von jemandem abzuwenden, der so gut aussieht wie Arnulfo. Er war so braun wie poliertes Leder und hatte lustige dunkle Augen, die in gedankenverlorenem Selbstvertrauen unter den Ponyfransen seines schwarzen Pilzkopfs hervorblitzten. Er erinnerte mich an die frühen Beatles; an alle frühen Beatles, die sich hier zu einer klugen, heiteren, ruhig-schönen Verbindung ungezügelter Stärke zusammengefunden hatten. Er trug die typische Tarahumara-Kleidung, ein knielanges Lendentuch und ein feuerrotes Gewand, das sich wie ein Piratenhemd bauschte. Bei jeder Bewegung sah man auch, wie sich seine Beinmuskeln bewegten und eine neue Form annahmen wie geschmolzenes Metall.
»Wir sind uns schon einmal begegnet«, sagte Salvador auf Spanisch.
Arnulfo nickte.
Drei Jahre nacheinander hatte Arnulfo einen tagelangen Fußmarsch auf sich genommen, um in Guachochi bei einem 100-Kilometer-Rennen durch die Canyons anzutreten. Das ist ein jährlich ausgetragenes, für alle Interessenten offenes Rennen, zu dem Tarahumara von überallher aus den Sierras und die wenigen mexikanischen Läufer, die bereit sind, ihre Beine und ihr Glück im Wettkampf mit den Stammesleuten auf die Probe zu stellen, zusammenkommen. Arnulfo hatte es dreimal in Folge gewonnen. Er übernahm den Titel von seinem Bruder Pedro, und den zweiten und dritten Platz belegten sein Cousin Avelado und sein Schwager Silvino.
Silvino war ein seltsamer Fall, ein Tarahumara, der auf der Grenzlinie zwischen alter und neuer Welt balancierte. Vor Jahren war ein Mitglied der Christian Brothers, ein Mann, der eine Tarahumara-Schule betrieb, mit Silvino zu einem Marathonlauf irgendwo in Kalifornien gezogen. Silvino gewann und brachte so viel Geld nach Hause, dass es für einen alten Pick-up, ein Paar Jeans und einen neuen Anbau für das Schulhaus reichte. Silvino hatte den Pick-up oben, am Rand des Canyons, abgestellt und stieg gelegentlich dort hinauf, um nach Guachochi zu fahren. Er war aber nie wieder in den Rennbetrieb zurückgekehrt, obwohl er damit eine sichere Geldquelle entdeckt hatte.
Im Vergleich zum Rest der Welt sind die Tarahumara ein lebender Widerspruch: Sie grenzen sich von Außenstehenden ab, sind aber zugleich auch fasziniert von der Welt, die sie umgibt. Einerseits leuchtet das auch ein: Wenn man gern außergewöhnlich lange Strecken läuft, muss es sehr verlockend sein, einfach loszulaufen und herauszufinden, wohin (und wie weit) einen die eigenen Beine tragen. Einmal tauchte ein Tarahumara-Mann sogar in Sibirien auf. Irgendwie hatte er sich auf ein Trampschiff verirrt und es bis in die Weiten der russischen Steppe geschafft, wo er schließlich aufgegriffen und per Schiff nach Mexiko zurückgebracht wurde. Im Jahr 1983 wurde eine Tarahumara-Frau mit ihren typischen wirbelnden Röcken in einer Kleinstadt in Kansas entdeckt, wo sie durch die Straßen spazierte. Sie verbrachte die folgenden zwölf Jahre in einer Heilanstalt, bis einer Sozialarbeiterin endlich auffiel, dass sie keineswegs nur wirres Zeug redete, sondern eine unbekannte Sprache sprach.
»Würden Sie jemals in den Vereinigten Staaten zu Rennen antreten?«, fragte ich Arnulfo.
Er kaute nach wie vor Limetten und spuckte Samenkörner aus. Nach einiger Zeit zuckte er mit den Schultern.
»Werden Sie in Guachochi wieder antreten?«
Mampf. Mampf. Schulterzucken.
Jetzt wusste ich, was Carl Lumholtz gemeint hatte, als er schrieb, die Tarahumara-Männer seien so scheu, dass der Stamm ohne Bier bereits ausgestorben wäre. »Es mag zwar unglaublich klingen«, hatte Lumholtz sinniert, »aber ich zögere nicht, hier zu erklären, dass der unzivilisierte Tarahumara im alltäglichen Leben zu scheu und bescheiden ist, um seine ehelichen Rechte und Privilegien durchzusetzen;