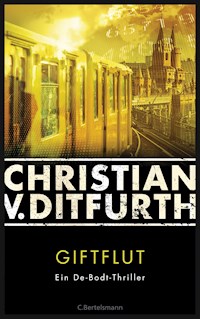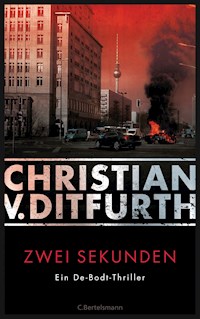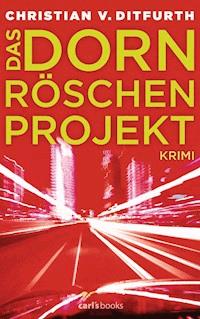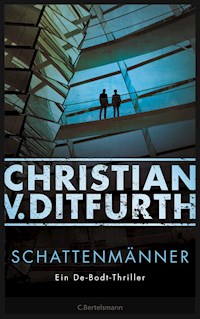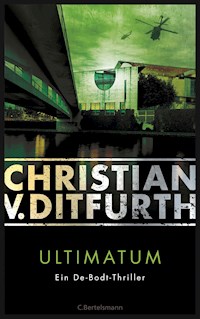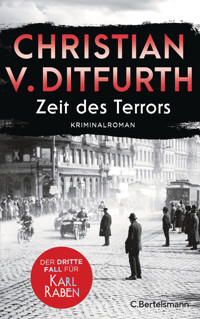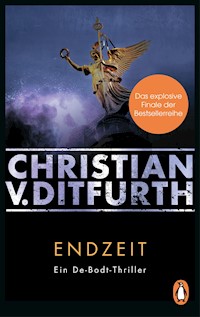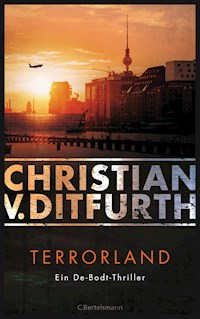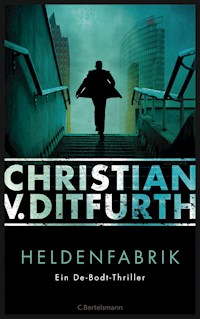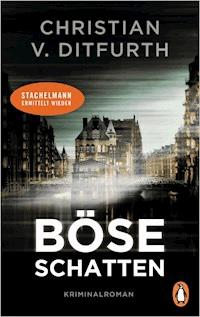
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Penguin Verlag
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Serie: Stachelmann ermittelt
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2018
In Hamburg wird die Leiche eines Mannes gefunden, der 25 Jahre zuvor zu Tode gefoltert wurde. In seinem Mund steckt ein Fetzen Papier, von dem sich die Polizei Rückschlüsse erhofft. Oberkommissarin Rebekka Kranz bittet Josef Maria Stachelmann, den frisch berufenen Uni-Professor mit Privatschnüffler-Vergangenheit, um Hilfe. Eine Autobombe explodiert vor seinem Haus, in seiner Wohnung sind Abhörwanzen, er wird offen beschattet, sein Assistent Georgie wird schwer verletzt. Aber Stachelmann lässt nicht locker und stößt bei seinen Recherchen auf ein finsteres Kapitel der deutsch-deutschen Geschichte.
Christian von Ditfurth erweist sich erneut als Meister allerbester Spannungsliteratur mit politischem Anspruch.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 479
Ähnliche
CHRISTIAN V. DITFURTH, geboren 1953, ist Historiker und lebt als freier Autor in Berlin und in der Bretagne. Neben Sachbüchern und Thrillern hat er Kriminalromane um den Historiker Josef Maria Stachelmann veröffentlicht, die auch international Aufmerksamkeit fanden. Außerdem erschienen Thriller um den Berliner Kommissar Eugen de Bodt. Zwei Sekunden wurde mit dem Stuttgarter Krimipreis für den »besten deutschsprachigen Kriminalroman 2016« ausgezeichnet. Zuletzt erschien Giftflut.
Weitere Informationen zum Autor unter www.cditfurth.de
»Zwei Sekunden ist ein hoch spannender und ziemlich realitätsnaher Thriller.«Welt am Sonntag
Außerdem von Christian v. Ditfurth lieferbar:Das Dornröschen-Projekt, KriminalromanTod in Kreuzberg, KriminalromanEin Mörder kehrt heim, KriminalromanHeldenfabrik, ThrillerZwei Sekunden, ThrillerGiftflut, Thriller
Besuchen Sie uns auf www.penguin-verlag.de und Facebook
CHRISTIAN V. DITFURTH
BÖSE
SCHATTEN
Stachelmanns neue Fälle 1
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen. Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
PENGUIN und das Penguin Logo sind Markenzeichen von Penguin Books Limited und werden hier unter Lizenz benutzt.
Copyright © 2018 by Penguin Verlag, München, in der Verlagsgruppe Random House, Neumarkter Straße 28, 81673 München
Umschlag: Cornelia Niere, München, unter Verwendung eines Motivs von Shutterstock /artworks-photo
Redaktion: Claudia Alt
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-21895-9 V002
www.penguin-verlag.de
Für Chantal
Prolog
Der Junge hielt die Holzkiste vor dem Bauch. Die Hand der Mutter lag auf seiner Schulter. Er hatte Tränen in den Augen und presste die Lippen aufeinander. Der Vater trat den Spaten in die Erde. Das Stahlblatt schleifte im Erdgestein. Er drückte auf den Spatenknauf und stemmte einen Brocken Erde heraus. Ein Regenwurm kringelte unter die Hecke. Es war ein schattiger Platz, an dem sie Tiger begraben wollten. Ein Auto hatte den Kater überfahren. Er war nicht mal drei Jahre alt geworden. Tiger hatte sich nach dem Unfall noch in den Garten zurückgeschleppt. Am Morgen fand ihn die Mutter, da war er schon steif. Sie hatten Tiger vor zwei Jahren aus dem Tierheim geholt. Er war vielleicht zwölf Wochen alt gewesen. Der Kater war anhänglich geworden. Dem Jungen war er fast überallhin gefolgt. Morgens, wenn er zur Schule ging, lenkte die Mutter den Kater ab, damit er dem Jungen nicht nachrannte.
Der Vater wischte sich die Stirn. Er war stämmig und groß. Früher hatte er in einem Verteilzentrum der Post gearbeitet. Bis seine Vorgesetzten merkten, dass er ein Organisator war. Nach ein paar Jahren leitete er das Verteilzentrum, in dem er als Lehrling angefangen hatte. Dort hatte er auch seine Frau kennengelernt. Die hatte lange am Band gestanden, wo Millionen von Paketen vor ihren Augen vorbeigezogen waren. Nachdem sie geheiratet hatten und sie schwanger geworden war, arbeitete sie erst halbtags, dann blieb sie zu Hause. Sie konnten es sich nun leisten. Die beiden waren gute Eltern und liebten sich immer noch. Selten kam es zum Streit.
Der Vater seufzte und grub weiter. Nach ein paar Spatenstichen winkte er dem Jungen, die Kiste ins Grab zu legen. Aber das Loch war zu flach. Der Junge hob die Kiste wieder heraus. Der Vater stieß das Spatenblatt in die Erde. Es knirschte. Er ruckelte am Stiel und brach einen Erdbrocken frei. Den hob er an, dann erstarrte er und ließ den Brocken in die Grube zurückfallen. »Scheiße!«, stammelte er.
Der Junge starrte in die Grube. Sein Mund öffnete sich wie in Zeitlupe, dann schrie er. Der kleine Holzsarg plumpste auf den Boden, der Deckel öffnete sich. Ein schwarz-weißer Katzenkadaver fiel aus der Kiste. Wie tiefgefroren. Die Mutter schlug sich die Hand vor den Mund.
Es zog ihre Blicke an wie ein Magnet. Knochenstücke an Gelenken in der Grube. Dazu ein Finger, am Mittelhandknochen abgetrennt.
1
Er schwitzte, und seine Hände zitterten. Er steckte sie in die Hosentaschen. Dann drehte er sich zum Fenster. Zog ein Schnupftuch hervor und tat so, als putzte er sich die Nase. Hastig wischte er mit dem Tuch die Stirn trocken. Der Rücken war feucht. Er fror. Als er sich umdrehte, sah er die Gesichter. Sah die Erwartung. Erinnerte sich an die Ankündigung. Sein Vortrag mit dem Titel »Gedenken oder Geschichtspolitik?«. Ein Titel, der ihm gleich fremd war, als er ihn zum ersten Mal auf dem Plakat las. Dröge. Obwohl er von ihm stammte. Sie hatten ihn nach einem Titel gefragt, und ihm war gerade nichts Besseres eingefallen. Dann wollte er es nicht mehr ändern. Es hätte den falschen Eindruck gemacht. Weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund. Reißerisch sah es aus, langweilig las es sich. Anmaßend vor allem. Aber nun stand es überall. Und in den Gesichtern sah er, dass er den Anspruch einlösen musste. Das Versprechen, Trauer von Lüge zu trennen, Nachdenklichkeit von Berechnung, Wirklichkeit von Erfindung. Was, verdammt, ist wirklich? Alles Konstruktion? Aber es gibt doch Fakten. Gedanken verwirbelten in seinem Hirn. Warum konnte er sich nicht einen Dutzendstoff aussuchen, wie es die meisten taten? »Das KZ-System des Nationalsozialismus« etwa, um bedeutungsschwanger zu berichten, was schon hundertmal berichtet worden war. Warum zog es ihn immer aufs Glatteis, wo es doch leichter war, feste Wege zu finden? Gewiss, er hatte es immer geschafft. Bisher. Hatte seinen Magister gemeistert. Hatte promoviert. War Dozent am Historischen Seminar der Uni Hamburg geworden. Hatte ein Büro im Philosophenturm gehabt. Bis er Bohming zu Fall brachte. Den Sagenhaften. Den Chef. Professor Bohming hatte alle Historikerschlachten ohne Kratzer überlebt. War nicht im schwarzen Loch gelandet wie Nolte, der Finsterling. Aber Stachelmann hatte ihn erwischt. Den Betrüger. Bohming saß nun Tag für Tag in seinem Wohnzimmer und starrte trüb vor sich hin. So war es jedenfalls bei ihrer letzten Begegnung gewesen. So musste es heute noch sein. Bohming, der nicht wusste, wo er hinsollte mit seinem Hass auf Stachelmann. Ausgerechnet der saß nun auf dem Lehrstuhl. Professor Josef Maria Stachelmann. Es hörte sich so falsch an, als hätten sie ihn zum Kaiser der Salomonen ausgerufen.
Sie saß in der ersten Reihe. Vor dem Rednerpult. Eingerahmt von den Männern. Das war ein Oberbegriff, unter dem wegen ihrer Verwechselbarkeit und Austauschbarkeit die Lehrstuhlmitarbeiter Lehmann und Ostermann zusammengefasst wurden. Die Männer verehrten Anne natürlich und fragten sich, warum ausgerechnet Stachelmann sie abgekriegt hatte. Dinge gibt’s.
Anne hätte nicht kommen dürfen. Wenn er schon versagte, dann nicht vor ihr. Stachelmann hatte ein paarmal versucht, ihr den Besuch bei seiner Antrittsvorlesung zu vermiesen. Aber sie hatte ihn nicht verstanden. Seine Andeutungen verstand sie nie. Wenn jemand einen Anspruch habe, dabei zu sein und sogar in der ersten Reihe zu sitzen, dann doch sie. Sie hatte recht. Wie immer. Das nagte an ihm. Wie immer.
Seine Augen suchten Bohming. Er würde nie wiederkommen. Das musste Stachelmann lernen. Er war jetzt der Chef. Aber ohne Bohming fehlte was. Das merkte er erst, seit er als Privatschnüffler in Geschichtsfragen gescheitert war.
Was kommt jetzt?
In der letzten Reihe entdeckte er Georgie. Der spielte mit seinem Handy. Was wollte Georgie hier? Georgie gehörte zu seinem alten Leben. Hatte sich selbst als Detektivgehilfe eingestellt. War plötzlich da gewesen. Unentbehrlich geworden. Und ein Dauerärgernis. Bei ihm konnte sich Stachelmann nur auf eines verlassen, nämlich auf seine Launen. Er kam und ging, wann es ihm passte. Hing im Notfall bestimmt gerade in einer Schwulenkneipe rum. Anne hatte nicht verstanden, was er an Georgie fand. Sie mochte ihn nicht, auch wenn sie es nicht zugab.
Er erschrak, als er die Stimme hörte. Der Dekan war ans Pult getreten und hatte zu reden begonnen. Professor Huld hüstelte, dann setzte er seine staubtrockene Ansprache fort. Das Hüsteln hielt er bestimmt für einen dramatischen Höhepunkt. Redete von einem Kollegen, dessen wissenschaftlicher Ruf keinesfalls gelitten habe, als er eine Auszeit genommen habe. Hüstel. Der wie kaum ein anderer befähigt sei, einen auch international beachteten Lehrstuhl zu bekleiden. Nun habe der Kollege gewiss nicht so viele wissenschaftliche Arbeiten vorgelegt wie manch anderer. Aber was er veröffentlicht habe, sei von umso beeindruckenderer Qualität und nachhaltigerer Gültigkeit.
Wie kommt einer nur auf solche Wendungen?, dachte Stachelmann. Hohl, hohler, Huld. Stachelmann würde es nie lernen, mit hundert Wörtern nichts zu sagen. Dann noch solche Wörter.
Sein Magen zog sich zusammen. Gleich musste er ans Rednerpult treten. Das Manuskript seines Vortrags wartete im Fach unter der Tischplatte. Ob er etwas vergessen hatte? Er erinnerte sich, als er in einer Vorlesung immer wieder in seinen Papieren blättern musste, weil die Reihenfolge nicht stimmte. Und wenn eine Seite fehlte? Er hatte den Text gar nicht mehr gründlich durchgesehen. In diesem Augenblick wusste er überhaupt nicht, was er vortragen würde. In seinem Hirn herrschte Leere.
Beifall, als Huld sagte: »Ich übergebe nun das Wort dem verehrten Kollegen Stachelmann, der mit dieser Vorlesung sein neues Amt antritt.«
Die Knie zitterten, als er ans Pult trat. Er spürte ein Stechen im Rücken. Es würde sich ausweiten, zuerst in die Beine schießen. Er hatte vergessen, die Diclofenac-Tablette zu schlucken. Sonst tat er es immer auf Verdacht, wenn etwas Wichtiges anstand. Ein Griff in die Jacketttasche genügte. Aber wie sah das aus? Als nähme er ein Aufputschmittel.
Er richtete seinen Blick auf einen Fleck an der Rückwand. Dann schaute er aufs Manuskript. Die Buchstaben verschwammen. Auf dem Kopf wurde es heiß. Gleich würde er unter den Haaren schwitzen. Plötzlich begann sein Mund zu reden. Er blickte ein paarmal beiläufig ins Manuskript und ertappte sich staunend, dass er eher erzählte als vortrug.
Die Tür sprang auf. Eine schmächtige Frau. Kurze braune Haare, große Augen. Als wäre sie über sich selbst erschrocken, stand sie im Raum. Alle Blicke richteten sich auf sie. Sie hob entschuldigend die Hand und schloss die Tür. Etwas zu laut. Sie fand keinen Sitzplatz und hockte sich neben der ersten Reihe auf den Boden.
Stachelmann hatte währenddessen weitergeredet. Als er endete, herrschte Stille. Er stand da und wusste nicht, was jetzt geschehen sollte. Stimmt, ein Imbiss war vorgesehen. Dann hörte er es. Zunächst Räuspern und Husten. Ein paar Fäuste klopften auf die Tischplatten, dann klopften viele. Er blickte irritiert auf die Sitzreihen. Alle klopften. In der Mitte erhoben sich Leute und klatschten. Schließlich standen alle. Am Schluss erhob sich auch Anne. Ihr war unwohl dabei, das konnte Stachelmann nicht übersehen.
Auch die verspätete Hörerin hatte sich hingestellt. Sie klatschte und musterte Stachelmann, ohne es zu verbergen.
Huld kam nach vorn und reichte ihm die Hand. »Ausgezeichnet, Herr Stachelmann, wirklich ausgezeichnet.« Stachelmann blickte ihm in die Augen. In denen musste doch in riesigen Buchstaben Lüge stehen. Aber sie strahlten. Die Männer umarmten ihn kurz. Anne zögerte, dann nahm sie sein Gesicht in ihre Hände und küsste ihn. Warum sagte sie nichts? Sie war die Einzige, die erkannt haben musste, dass die Vorlesung dünn gewesen war. Die Hörer hatten sich doch durch die Umstände beeindrucken lassen.
Der Dekan stand neben ihm und nickte, sobald jemand Anerkennung äußerte. Die meisten Leute, die ihm die Hand gaben und etwas sagten, kannte Stachelmann nicht. Manche Gesichter hatte er schon einmal gesehen, aber ihm fehlten die Namen. Er verstand die Gratulanten nicht richtig. Es waren nur Geräusche. »Vielen Dank!« – »Großartige Vorlesung!« – »Da haben Sie sich aber etwas getraut!« Gruppen plauderten im Raum verteilt. Manche Hörer hatten sich bereits mit Getränken versorgt. Anne drückte ihm ein Glas in die Hand und stieß mit ihm an. »Glückwunsch, Herr Professor«, sagte sie und strahlte ihn an.
Sie war doch nur neidisch. Anne arbeitete auch am Historischen Seminar. Aber niemand schien ihr zuzutrauen, eine Karriere wie Stachelmann hinzulegen. Zumal mit diesem Umweg. Er hatte doch gekündigt, alles hingeworfen. Und jetzt war er wieder da. Und gleich ganz oben. Gewiss, sie hatte ihn bestärkt, sich um die Professur zu bewerben. Aber niemand hatte damit rechnen können, dass er sie auch kriegte. Das war so ein Rat gewesen von der Art, dass die Vernunft ihm gebot, das Gefühl aber den Erfolg fürchtete. Sie verstellte sich, keine Frage. Er war jetzt ihr Chef. Das konnte ihr nicht passen. Für sie gab es nichts zu strahlen.
Er trank einen Schluck. Sekt, schon leicht schal, zu warm. Kopfschmerzwasser.
Die kleine Frau stand plötzlich vor ihm. Sie reichte ihm die Hand. »Hätte ich an der Uni solche Vorlesungen gehört, wäre ich vielleicht nicht Polizistin geworden.« Sie lachte, etwas zu laut.
Er starrte sie an, gleich war es ihm peinlich. Polizistin hatte sie gesagt. Er dachte an Ossi, den Freund, der tot war. Ossi war Polizist gewesen.
»Ich soll Sie von Herrn Taut grüßen.«
Taut, der Kriminalrat, der Ossis Chef gewesen war. LKA irgendwas.
»Danke«, sagte Stachelmann.
Renate Breuer stand neben der Polizistin und blickte ungeduldig. Die Sekretärin des Seminars. Bohmings Sekretärin, die jetzt seine war. Gewiss nahm sie es ihm übel, dass er Bohming abgeschossen hatte. Obwohl der Grund den Begriffsstutzigsten überzeugen musste. Plumper Betrug, viel zu lang unter der Decke gehalten. Dagegen waren die jüngsten Plagiatsaffären Kindergeburtstage.
Breuer trat einen Schritt vor und reichte ihm die Hand. »Ich freue mich sehr«, sagte sie. Ihre Stimme klang gerührt. Stachelmann nahm ihre Hand und blickte auf den Boden. Ihm wurde wieder heiß auf dem Kopf.
»Danke«, sagte er leise.
Die Polizistin blickte ihn an und sagte: »Rebekka Kranz, ich hab mich gar nicht vorgestellt. Oberkommissarin, eine von Tauts Knechten.« Sie formte einen Bauch und lachte.
Stachelmann erschrak.
»Der Kuchen«, sagte Kranz. »Er liebt ihn. Für ihn wird er sterben. Sie werden ein Grab für zwei schaufeln müssen.« Sie hielt sich die Hand vor den Magen, als hätte sie Schmerzen, und gluckste.
»Was kann ich für Sie tun?«
»Wenn Sie mal fünf Minuten hätten …«
»Ist jetzt schlecht. Sie sehen ja.«
Am Abend landete er mit Anne im Tokaja, naham Campus. Hier hatte er vor Jahren mit Ossi geredet. Der Fall Holler. Ein reicher Makler, dessen Frau und Kinder ermordet worden waren. Ossi hatte sich bei ihm gemeldet.
Im Tokaja wurde nicht mehr geraucht. Sie fanden einen Tisch neben der Tür. Gebrabbel hallte im Raum. Einige Tische weiter saß eine Runde von Studenten und feixte. Einer blickte zu Stachelmanns Tisch und nickte. Stachelmann konnte sich nicht an ihn erinnern, nickte aber zurück. Er fühlte sich fremd und allein, obwohl er hier weder fremd noch allein war.
»Du sagst, die sei Polizistin?«
Stachelmann nickte.
»Und was wollte sie?«
Er zuckte mit den Achseln. »Sie kommt morgen Nachmittag.«
2
Der Brief im schmutzig grauen Umschlag enthielt die ganze Wahrheit. 827 Euro betrug seine Rente. Er würde keinen Widerspruch einlegen. Die Ungerechtigkeit war richtig errechnet. Dieser Scheißstaat fand ihn mit einem besseren Taschengeld ab. Kurt würde seine Wohnung verlieren und sich am Stadtrand eine billigere Bleibe suchen müssen. Er schnaubte. Stand auf vom Küchentisch und wackelte mit krummen Beinen ins Wohnzimmer, wo die Zigarettenschachtel lag.
Die andere Drecksnachricht stand in der Bild. Sie hatten ihn gefunden. Es konnte nur er sein. Der Ort, nahe Rahlstedt. Der Zustand der Leiche. Es passte alles. Sie zeigten Fingerknochen, die irgendein Depp gefunden hatte. Wollte eine Katze begraben. Sentimentale Pisser.
Aber er war es gewohnt, eins und eins zusammenzuzählen. Zwei konnte gut sein oder auch schlecht. Aber zwei blieb zwei. Kurt lachte über Leute, die sich die Dinge schönredeten. Es war, wie es war. Und er konnte es sich nicht leisten, die Augen davor zu verschließen.
Sie hatten ihn gefunden. Jetzt, kurz bevor er selbst abtreten würde. Er war Realist. Die Besuche beim Arzt waren nicht erfreulich. Ändern Sie Ihren Lebenswandel. Leck mich am Arsch!
Kurt ging hinaus auf den Balkon und steckte sich eine an. Seit es keine richtigen Zigaretten mehr gab, rauchte er jede mit Verachtung. Die Roth-Händle waren auch nicht mehr die Lungentorpedos, die sie mal waren. Duftkraut wie inzwischen auch der Franzosentabak. Irgendwann würden sie einem Doppelkorn ohne Alkohol vorsetzen. Die Schweine.
Überall Schweine.
Wäre er nicht alt, er würde denen so richtig einheizen. Er hätte Terrorist werden sollen. Nur als Terrorist kann einer ehrlich leben. Ein Zug an der Zigarette. Er sog den Rauch ein, staute ihn ein paar Sekunden in der Lunge und ließ ihn langsam entweichen.
Draußen regnete es. Auch der Frühsommer oder Spätfrühling war scheiße.
Auf dem Bürgersteig schob eine Frau einen Kinderwagen, aus dem es plärrte. Ein Taxi rollte vorbei, langsam, auf der Suche nach einer Hausnummer.
Er rauchte die Zigarette hastig zu Ende, erhob sich, verharrte und setzte sich wieder. Er hatte keinen Grund zur Eile. Bleib ruhig. Sie würden ihn nie finden. Er überlegte, welche Wege von seinem Opfer zu ihm führen könnten. Es fand nur einen einzigen. Aber auf den würde keiner kommen. Die wollten keine Nadel im Heuhaufen finden, sondern ein Nadelatom im Himalaja.
Er lächelte. Eigentlich war es gar nicht übel, dass sie die Leiche gefunden hatten. Unterhaltsam, sehr unterhaltsam. Er würde verfolgen, wie sie im Dunkeln tappten, und sich amüsieren.
Kurt hatte lang nicht an ihn gedacht. Also bewusst. Im Untergrund seines Hirns rumorte es oft, aber er hatte gelernt, die Geräusche zu überhören. Meistens. Ihn erstaunte, dass ihn die Erinnerung nicht plagte. Es fühlte sich eher an wie ein angenehmes Gruseln. Als sähe er einen dieser Fernsehkrimis, wo man am Anfang schon wusste, dass am Ende alles wieder gut sein würde.
Kurt hatte leicht herausgefunden, dass das Opfer gern mit dem Rad spazieren fuhr. Immer denselben Weg. Immer mittags. Wenn er Pause machte. Der Weg teilte eine Siedlung, dann querte er ein Wäldchen, an dessen Ende ein Teich lag.
Eine junge Frau radelte vorbei. Seine Augen folgten ihr.
Es hatte nicht lang gebraucht, um die Sache zu planen. Und es hatte geklappt. Wie am Schnürchen.
Seine miese Laune verflog mit der Erinnerung. Es fehlte nur noch ein Lied.
»Gibt acht! Es kracht!«
Schreit mich ein Spanier an.
Wenig geht über Strauss und nichts über den Zigeunerbaron.
3
»Das Opfer ist ein Mann. Zwischen vierzig und fünfzig. Er wurde gefoltert«, sagte Rebekka Kranz. »Offenbar lang und intensiv.«
Sie saß ihm klein gegenüber. Ihre Augen waren unruhig. Ihre Hände redeten mit. Grazile Finger, keine Ringe. Überhaupt kein Schmuck. Ein zarter Hals. Stachelmann zwang seine Augen, ihn nicht anzustarren. Den Hals.
»Es muss lang gedauert haben. Es waren zwei Täter … also, mindestens zwei haben gefoltert … das ist natürlich nur eine Vermutung.«
»Woher …?«
»Es ist die Art der Verletzungen. Der Rechtsmediziner sagt, sie hätten verschiedene Messer benutzt. Manchmal hat eine Messerspitze den Knochen getroffen.«
Stachelmann schloss die Augen. Er sah zwei Männer, die immer wieder auf einen anderen Mann einstachen. Sie mussten aufpassen, dass sie keine wichtigen Gefäße trafen. Sonst wäre die Folterung bald vorbei gewesen. »Wie kommen Sie darauf, dass es lang gedauert hat?«
»So viele Stiche, deren Spuren wir finden. Da gibt es natürlich mehr Stiche, weil wohl einige keine Spuren am Skelett hinterlassen haben.«
Natürlich.
»Vielleicht haben ihn auch mehr Leute entführt, drei oder vier, was weiß ich? Folterspuren fanden wir allerdings nur von zwei Messern. Könnte aber sein, dass sie sich abgelöst haben …«
Folter mit Schichtwechsel.
Sie rutschte auf ihrem Stuhl hin und her. Als hätte sie die Schmerzen, die sich in Stachelmanns Rücken vom Steißbein bis zum Hals ausbreiteten.
Sie schwiegen.
Im Flur Stimmen. Stachelmann glaubte, Breuer zu hören. Er fragte sich, wann er die Unsicherheit ihr gegenüber verlieren würde. Das schlechte Gewissen, das sich sie als Auslöserin seiner Erinnerung ausgesucht hatte. Damit er bloß nie vergaß, was er angerichtet hatte. Bohmings Sohn, gefangen in der Drahtfalle. Und erschossen. In Notwehr. Notwehr?
Stachelmann kramte in der Schreibtischschublade nach einer Schmerztablette. Sie beobachtete ihn. Als er den Blister gefunden hatte, drückte er in der Schublade einhändig eine Pille heraus und steckte sie in den Mund. Sammelte Speichel und schluckte sie. Sie beobachtete es ausdruckslos.
»Herr Taut sagt, Sie könnten vielleicht helfen.«
»Bei was?«
»Sie hätten uns schon mal blamiert, hat er gesagt.«
Stachelmann blickte ihr in die Augen. Sie erwiderte den Blick, bis ihre Lider flackerten und sie wegsah. Taut, der im Büro saß und seine Leute scheuchte. Mit seinem schnellen Verstand und einer Wampe, die sich vermutlich weiter gebläht hatte. Seit damals.
»Irgendwann platzt er«, hatte Ossi gesagt und prollig geröhrt. Sie werden ein Grab für zwei schaufeln müssen. Der Spruch stammte von ihm, nicht von ihr. Hatte sie Ossi gekannt? Aber vermutlich war es einer dieser Scherze, die seit ewigen Zeiten umgingen.
»Sie sind neu …«
»Geht so.« Sie lachte.
Warum lacht sie so oft und so laut?
»Skelett«, sagte Stachelmann. »Wie lang begraben?«
»Vielleicht zwanzig Jahre.«
»Und was habe ich damit zu tun?« Er legte den Finger an die Lippe. »So meine ich es …«
Sie wehrte mit geöffneten Händen ab. »Schon klar.«
»Und was?«
»Es ist ein Mann«, sagte der Rechtsmediziner. Dann streckte er Stachelmann einen viel zu langen Arm mit viel zu großer Hand entgegen. »Ich hab von Ihnen gehört.«
»Ich habe Herrn Stachelmann die wichtigsten Dinge berichtet. Das ist Dr. Vogel.«
»Schauderhafte Geschichte«, sagte er beiläufig. »Folter, und was für eine. Da muss jemand großen Hass …«
»Oder Wut«, sagte sie.
»Was auch immer.«
Vor ihnen lag das Gerippe. Gut erhalten. An der linken Hand fehlte der Zeigefinger. Der lag am Fußende in der Edelstahlwanne.
»Das Opfer muss entführt worden sein«, sagte Kranz. »An einen Ort, wo man ihn ausgiebig quälen konnte. Was heißt, dass die Täter glaubten, niemand könne das Opfer hören. Ein Raum, der sicher war. Wo die Täter nicht gestört werden konnten.«
»Etwa der Keller eines einsamen Hauses«, ergänzte Vogel.
»Eine Industrieruine, Halle, Garage, Schuppen«, sagte Kranz.
Stachelmann betrachtete die Leiche. Merkwürdig, ihn schauderte nicht. Er hatte einen sachlichen Blick auf die Knochen. Grau, mit Erdkrümeln in den Augenhöhlen. Das Gebiss schien vollständig.
»Was hat ihn getötet?«
Vogel nickte. »Die Qualen. Er ist irgendwann verblutet.«
»Er wurde aber nicht umgebracht, wo er gefunden wurde«, sagte Stachelmann.
»Vielleicht ist der Tatort in der Nähe, vielleicht ganz woanders. Kann sein, der Täter schloss aus, dass ihn jemand fand, wo er ihn begrub. Dann ist der Tatort wohl nicht weit entfernt. Aber das sind Spekulationen.«
Sie lachte nicht ein einziges Mal.
Taut saß hinter seinem Schreibtisch und telefonierte. Er winkte Kranz und Stachelmann an den Besprechungstisch. Sie setzten sich gegenüber. Taut hörte währenddessen zu, was der Anrufer ihm sagte. Er saß unbeweglich wie Buddha. Seine Miene verriet nicht, ob ihm gefiel, was er erfuhr. Hin und wieder sagte er trocken »Ja«, wohl um dem Gesprächspartner zu zeigen, dass er noch am Hörer war. Endlich legte er auf. Mit den Händen stützte er sich auf der Tischplatte ab, als er sich erhob. Er seufzte einmal leise. Dann kam er bedächtigen Schritts zum Besprechungstisch, eine Plastikhülle in der Linken. Taut reichte Stachelmann die Hand. »Gut, Sie wiederzusehen. Obwohl, ich gebe es zu, es mich an Ereignisse erinnert, die ich gern vergessen würde.«
Er setzte sich mit einem Seufzen.
Der Kriminalrat war noch fetter geworden. Stachelmann hatte das Bild vor Augen, wie er mit Taut auf der Feuerleiter auf das Dach eines Universitätsinstituts kletterte. Das wäre inzwischen kaum mehr möglich.
Stachelmann blickte an sich nach unten. Er selber war aber auch nicht schlanker geworden. Anne hatte ihn schon gefoppt und von einem Schmerbauch gesprochen, den sie an ihm entdeckt haben wollte. Und Felix, der gerade mit maximalem Erfolg seine soundsovielte Trotzphase abfeierte, hatte ihn Fettsack genannt. Als ihn die Fopperei zu nerven begann, hatte er sich auf die Waage gestellt. Dreieinhalb Kilo mehr, optimistisch gewogen. »Als Professor darf ich das«, erklärte er und erntete Hohn und Gelächter.
»Herr Stachelmann, erst mal meinen Glückwunsch zur …«
Stachelmann winkte ab.
Taut zeigte keine Reaktion. Er schob die Plastikhülle zu Stachelmann. Kranz beobachtete die beiden Männer. Sie hatte Augen, die einen gefangen nahmen.
Die Hülle schützte einen Papierfetzen. Der Rand war vermodert. Es war nichts zu erkennen als eine Drahtspitze.
Während Stachelmann sich mühte, das Bild zu verstehen, sagte Taut: »Lag beim Toten. Es ist ein Wunder, dass es nicht völlig vergammelt ist. Die KTU sagt, dass das Stück wohl halbwegs luftdicht eingeschlossen gewesen sei. Wie ein Fossil. Das ist es ja auch. Ein Fossil.«
Schweigen.
Stachelmann starrte zum Fenster hinaus. Das Bürohaus eines Versicherungskonzerns. Menschen an Schreibtischen.
»Mehr haben Sie nicht?«
Taut schüttelte den Kopf. »Bisher nicht. Sonst nur Vermutungen. Und das.« Sein Finger zeigte auf den Fetzen.
»Der Täter war sich sicher, dass die Leiche nie gefunden würde«, sagte Stachelmann vor sich hin.
»Er hat sie in einer Gegend vergraben, wo bis vor Kurzem niemand gebaut hätte. Aber jetzt wurde das Gebiet erschlossen. Der Speckgürtel platzt …« Taut zog ein Taschentuch hervor und wischte sich die Lippen ab.
Regen trommelte an die Fensterscheibe. Gerade hatte noch die Sonne geschienen. Es dämmerte in Tauts Büro.
Stachelmann fiel auf, dass Kranz ruhig auf ihrem Stuhl saß. Erstaunlich. Sie konzentrierte sich auf irgendwas. Sie hatte ein Bein übers andere geschlagen und umklammerte mit den Händen ihr Knie. »Das ist Stacheldraht«, sagte sie.
Taut und Stachelmann betrachteten den Papierfetzen. Ein Drahtende konnte es sein. Angespitzt, wie bei Stacheldraht.
»Woher stammt das?«, fragte Stachelmann.
»Zeitungspapier, sagt die KTU«, erwiderte Taut leise. Er war woanders mit seinen Gedanken.
»Stacheldraht in der Zeitung«, sagte Kranz.
»Welche Zeitung?«, fragte Stachelmann.
»Wissen wir nicht. Das wird gerade untersucht. Ob was herauskommt …« Tauts Fingerspitzen klopften leise auf dem Tisch.
»Sonst haben Sie nichts?«
Taut schüttelte kaum merklich den Kopf.
»Und mich haben Sie wegen dem da geholt.« Stachelmann deutete auf den Papierfetzen. Das angespitzte Ende eines Drahts auf halb verrottetem Papier.
»Mehr wird es eher nicht werden«, sagte Taut.
Kranz räusperte sich.
»Wir werden nicht einmal herausfinden, aus welcher Zeitung es stammt. Und sogar wenn, was würde es helfen. Stellen Sie sich vor, das war im Hamburger Abendblatt abgedruckt …«, sagte Stachelmann.
»Dann würden wir die Ausgabe im Archiv finden und wissen, wann der Mord geschah«, sagte Kranz.
»Ja?« Taut lächelte. »Wir würden wissen, dass der Mord vor einem bestimmten Zeitpunkt verübt wurde. Wann, wüssten wir nicht.«
»Das meine ich doch. Wir könnten ihn eingrenzen …«
»Und wenn Sie die Mühe investierten, in allen Zeitungen der Umgebung zu suchen, die vor, sagen wir mal, spätestens fünfzehn Jahren erschienen sind?«, fragte Stachelmann.
Taut nickte. »Machen wir ja. Das Ergebnis hängt auch davon ab, ob die Archivare den Rest des Bildes identifizieren können. Es könnte ja was anderes sein. Aus einer Anzeige für einen Baumarkt stammen. In einer Zeitung für Schrebergärtner erschienen sein. Aus dem Ausland stammen … ein Matrose aus Manila …«
»Außerdem könnte der Ausriss schon im Boden gelegen haben und mit dem Mord nichts zu tun haben«, sagte Kranz.
»Männliche Leiche unbestimmten Alters, irgendwas zwischen vierzig und fünfzig, gefoltert, vor circa fünfzehn bis fünfundzwanzig Jahren verscharrt. Das ist alles, was wir wissen«, sagte Taut. »Der Rest ist Spekulation.«
Stachelmann legte eine Kopie auf den Küchentisch.
Anne zog sie vor ihre Augen. »Das ist ja winzig«, sagte sie. »Hast du das von Taut?«
Stachelmann nickte.
»Und was soll das sein?«
»Stacheldraht. Vielleicht. Eine bessere Erklärung kenn ich auch nicht.«
»Und was solltest du dort?«
Stachelmann überlegte. »Weiß auch nicht. Die kommen nicht voran. Wahrscheinlich wollen Sie sich nicht vorwerfen lassen, dass sie nicht alles versucht haben.«
»Stacheldraht wird doch überall benutzt. Der Typ war Schrebergärtner …«
»Die benutzen anderen Draht. Stacheldraht soll schmerzen, wenn man ihn überwindet. Gefängnisse, Lager, Sicherheitsbereiche …«
»Bonzenvillen«, ergänzte Anne.
Ihr Ton gefiel ihm nicht. Sie musste alles gegen den Strich bürsten. Was er sagte, galt nicht. Wurde bezweifelt, wenigstens ergänzt und so als unvollständig entlarvt. Es schwang ein Vorwurf mit. Da brauche ich keine Fantasie, um zu ahnen, was sie treibt. Eifersucht, Neid gewiss auch. Aber vor allem stank es ihr, dass er nun ihr Chef war. Sie war Historikerin wie er. Aber mit Schwächen, die er auszubügeln geholfen hatte. Stachelmann erinnerte sich. Wie gerührt er war ganz am Anfang ihrer Bekanntschaft, als sie ihm gestand, dass sie keine Ahnung hatte, wie man in Archiven forschte. Sogar Bibliotheken waren ihr Angstorte. Überhaupt fürchtete sie nichts mehr, als dass sie anderen als Versagerin galt. Aber als sie Archive und Bibliotheken nutzen musste, da hatte Stachelmann ihr geholfen und die Angst genommen. Er kannte ihre Schwächen, und das plagte sie. Ausgerechnet er wurde als Historiker gepriesen. Sie fand sich nicht beachtet. Keine Sekunde wollte sie sich herausreden, dass sie viel Zeit mit ihrem Sohn verbrachte. Den ein anderer gezeugt hatte, obwohl für Felix und in gewisser Weise auch für Anne Stachelmann der Vater war. Ein merkwürdiger zwar, aber einen anderen gab es nicht. Ein Vater, den das Kind nervte und den es ebenso nervte, dass ihn das Kind nervte. Und der immer noch nicht herausgefunden hatte, ob er genervt war, weil Felix biologisch nicht sein Sohn war. Oder ob es daran lag, dass er im Grund seines Herzens Kinder für die Verkörperung von Chaos und Lärm im Besonderen hielt und der verhassten Unberechenbarkeit im Allgemeinen.
Die Stimmung beim Abendbrot war gedrückt. Felix übernachtete bei einem Klassenkameraden. Eigentlich hatten Anne und Stachelmann diesen Abend ganz für sich.
Bevor er in der Nacht eindämmerte, überlegte er, was schieflief. Wahrscheinlich lag es allein an ihm. Wie immer. Er kam mit irgendwas nicht klar. Vermutlich gönnte Anne ihm alles, was er erreicht hatte. So sagte sie es ja auch. Doch irgendwas in seinem Hirn rief, dass sie log. Auch sich selbst belog. Er musste mit ihr darüber reden. Seit sie zusammengezogen waren, lief es nicht gut. Es gab keinen Streit, aber das war schon alles. Manchmal blickte sie ihn traurig an. Ob sie ihn so aufforderte, etwas zu sagen? Aber was? Er fand nichts Greifbares. Er wusste nicht, was ihn störte. Außer einem Verdacht, für den er kein Indiz fand außer in seiner Stimmung. Er bildete sich ihren Neid nur ein. Das würde sie ihm sagen. Sie würde sich innerlich an die Stirn tippen. Und sich fragen, wie lange sie es noch aushielt mit einem, der in einer Wahnwelt lebte.
Sie schlief längst. Darum beneidete er sie. Sich hinlegen, einschlafen, fertig.
Ob er ausziehen sollte? Zurück nach Lübeck? Dort hatte er sich wohlgefühlt. Vielleicht wurde es dann wieder wie früher?
Er war vom ersten Blick an in sie verliebt gewesen. Er wusste längst, dass er alles falsch gemacht hatte damals. Dass er sich nicht getraut hatte. Mit Frauen klappte es nie so richtig. Sie war nach Hamburg gekommen. Er wohnte in Lübecks Altstadt und war Dozent gewesen, Bohmings Knecht. Sie waren sich nähergekommen, als Ossi ihn in den Makler-Fall zog. Stachelmann half Ossi, und Anne half auch. Das war irgendwie selbstverständlich gewesen. Ossi hatte sich bei Stachelmann gemeldet, weil er im Abendblatt über einen Vortrag von ihm gelesen hatte. Ossi, der alte Genosse aus Heidelberg. Die Polizei stand auf dem Schlauch. Es war Stachelmann, der den Täter fand, weil er und Anne dessen Motive begriffen. Damals war die Erde noch rund. Stachelmann plagte sich mit seiner Habilitationsschrift, Anne mit Archiven und Bibliotheken und Ossi mit einem Serienmord. Nun war Ossi tot. Und längst hatte der Alltag die Liebe zerfressen. Oder was auch immer er sich vorgestellt hatte.
Wie soll man mit solchen Einsichten gut schlafen?
Anne lag auf der Seite und atmete ruhig. Sie konnte immer schlafen. Kam mit ein paar Stunden aus. Er war immer zerschlagen morgens. Wälzte sich, kämpfte gegen den Schmerz. Gegen die Sorgen. Gegen die Ängste.
Er stand auf und ging ins Wohnzimmer. Zog den ersten Band von C. S. Foresters Hornblower-Abenteuern aus dem Regal, setzte sich in den Sessel und begann zu lesen. Wie ein junger Mann in der Zeit der napoleonischen Kriege eine Marinekarriere begann, obwohl er für alles geeignet schien, nur nicht für die Seefahrt.
4
Der Lichtstrahl färbte den großen Zeh. Langsam kroch er über die Bettdecke zum Gesicht. Als er das Auge traf, blinzelte es. Die Augenbrauen zogen sich zusammen, Fältchen furchten die Stirn. Die Lider flackerten. Dann öffneten sich die Augen. Sie blickten auf ein Poster des Great Barrier Reef. Fische, Korallen, das komplette Klischee.
Darunter ein Korkbrett mit Notizen und Fotos. Eines zeigte sie in einem Neoprenanzug, die Taucherbrille baumelte um den Hals.
Sie gähnte unwirsch. Beugte den Oberkörper nach vorn und fiel zurück aufs Kissen. Der Strahl wanderte zum Haaransatz. Ein Blick zum Wecker. Viel zu früh.
Sie dachte an diesen Kauz. Stachelmann. Irgendwas hatte er in ihr berührt. Jedenfalls sah sie immer wieder sein Gesicht. Wie er da saß und schwieg. Sein Blick hing am Fenster, aber vermutlich dachte er einfach nach. Er wirkte verloren. Als hätte er nichts zu tun mit dieser Welt. Keine Miene verriet, ob er verstand, was Taut ihm erklärte. Den schien das Verhalten nicht zu interessieren. Die beiden kannten sich, das erklärte es. Was sie noch nicht begriffen hatte, war die Sache mit Ossi, dem Kollegen. Ermordet. Eine unglaubliche Geschichte.
Sie hatte keine Lust aufs Büro. Ihre Mordkommission war auf die Leiche angesetzt worden. Aber Taut würde sie machen lassen. Kranz war nun dran. Taut gab seinen Leuten gern Freiraum. Sie konnten jederzeit zu ihm kommen, aber er rief sie nur, wenn er ahnte, dass sie sich verrannten oder etwas Wichtiges übersehen hatten. Kranz würde die Ermittlungen in Tauts Namen leiten. Und er würde sich ansehen, was sie trieb. Es war einfach Pech, dass sie diesen Fall bekam. Taut hielt Wort. »Sie sind als Nächste dran«, hatte er gesagt. Und nun war sie dran. Sie dachte keine Sekunde daran, sich zu beschweren. Ihr Fall. »Der Tote vom Reinbeker Redder«, hatte sie gestern in der Morgenpost gelesen. Knochen aus der späten Steinzeit. Sie wusste nicht, wer den Spruch aufgebracht hatte. Sie hatte noch keinen Kollegen getroffen, der glaubte, dass sie dieses Verbrechen aufklären würden. Knochen, ein winziger Fetzen Papier. Der Fundort nicht der Tatort. Wäre der Mord vor Kurzem geschehen, sie hätten Reifenspuren gesucht, Fingerabdrücke, DNS-Spuren. Ohne Spuren waren sie aufgeschmissen. Vielleicht half die Berichterstattung. Heute würde Taut eine Pressekonferenz abhalten. Er hatte sie dazu gebeten. Es war ihr erster Auftritt vor den Medien. Sie spürte seit gestern Abend ein Kribbeln im Magen. Aber es war ein kleiner Schritt auf der Karriereleiter. Öffentliche Auftritte wirken nach innen. In der Machogesellschaft der Bullen hatten Frauen es immer noch schwer. Auch wenn sie dagegenhielten und was werden wollten. Oberkommissarin in ihrem Alter, das war schon nicht schlecht. Aber es hatte einen Preis. Sie musste doppelt so stark und stabil wirken wie ihre Kollegen. Sie musste einen rauen Ton aushalten und beherrschen. Nicht zimperlich sein. Dumme Sprüche abfedern. Kontern.
Nachher würde sie Vermisstenlisten prüfen. Immerhin: ein Mann von eins dreiundachtzig, Alter vierzig bis fünfzig, Schuhgröße 44, Gewicht vielleicht achtzig Kilo. Der Doc erklärte verwegen, dass der Gelenkverschleiß, vor allem der Knie, solchen Rückschluss zuließ. Kranz war da skeptisch. Nicht jeder hatte die gleichen Knie. Manche hielten mehr Gewicht aus, andere weniger. Fett war er jedenfalls nicht gewesen.
Kranz setzte sich auf die Bettkante. Sie schloss die Augen und versuchte sich den Mann vorzustellen. Vogel hatte versprochen, bald ein Modell zu liefern. Da gab es eine Software, die aus dem Schädelskelett ein Gesicht formte. Damit wollten sie in die Medien. »Wer kennt diesen Mann?« Nur stand es in den Sternen, ob das Modell genau genug war. Doch wenn sie so herausfanden, wer der Mann war, dann würden sie seine Umgebung abklopfen. Wahrscheinlich war der Mörder längst tot und alle Mühe umsonst.
Sie duschte und frühstückte. Was hieß, sie trank heißes Wasser und aß einen Margarinetoast. Über ihre Gewohnheit, heißes Wasser zu trinken, hatten schon manche gegrinst. Aber sie blieb stur. Manchmal erklärte sie knapp, sie habe sich das bei einer Reise nach China angewöhnt. Den Tee habe bestimmt ein Chinese erfunden, dem versehentlich ein Blatt in den Wasserpott gefallen sei. Irgendwann gaben die Leute es auf, sie von ihrem Trip abzubringen. Sie amüsierte sich über die Blicke im Western, einer Barmbeker Blueskneipe, in der sie gern Darts spielte. Für Besuche im Western würde sie kaum mehr Zeit finden. Bis sie den Mörder fanden oder aufgaben.
Es gab nichts, das sie mehr hasste, als aufzugeben.
Taut hatte ihr ein kleines Büro auf seiner Etage zugewiesen. Er wusste, dass sie Ruhe brauchte. Wenn da Kollegen rumwuselten, das Telefon pausenlos klingelte und das Getratsche losging, würde sie wahnsinnig werden. Taut kannte seine Leute.
Am Schreibtisch, das Gesicht in die Hände gestützt. Der Blick auf den Monitor. Als könnte dort des Rätsels Lösung aufploppen. Da war nur die Startseite der BKA-Datenbank. Sie mühte sich, ihre Abfrage anzupassen. Körpergröße, Alter, Gewicht. Ein paar Felder konnte sie nicht ausfüllen. Woher sollte sie etwa wissen, wann und wo der Mann geboren war? Die Voraussetzung für einen Sucherfolg war, dass der Mann als vermisst gemeldet worden war oder auf der Fahndungsliste stand. Sie wusste, dass die Suche nichts bringen würde. Aber es wäre ein schwerer Fehler, sie auszulassen.
Sie ließ den PC arbeiten und stellte sich ans Fenster. Es zeigte zum Parkplatz. Dienstwagen kamen, Dienstwagen fuhren weg. Die meisten Kollegen kannte sie. Zwei, drei hatten schon bei ihr angeklopft. Aber ein Verhältnis mit einem Kollegen kam nicht infrage. Sie war gern Polizistin, aber das bedeutete nicht, dass sie vierundzwanzig Stunden am Tag daran erinnert werden wollte. Bullenschweiß. Der Mief nach einer Nachtschicht.
Sie stellte sich hinter ihren Schreibtisch und sah das Bild auf dem Monitor. Der Erste auf einer Liste von fünf Männern. Ihre Augen untersuchten das Gesicht. Vermisst seit dem 8. August 1992. Die Körpergröße passte, die Schuhgröße auch. Der Vermisste stammte aus Norderstedt. Nicht weit. Warum sollte der Täter auch eine Weltreise machen, bevor er sein Opfer begrub? Beruf Speditionskaufmann. Vielleicht ging es um Schmuggel. Womöglich war der Tote vom Reinbeker Redder Lastwagenfahrer gewesen und hatte sich ein Zubrot verdient. Und war mit seinem Auftraggeber aneinandergeraten. Je länger sie das Gesicht musterte, desto klarer wurde ihr, dass sie den Mann gefunden hatte.
5
Brüderlein, Brüderlein und Schwesterlein
Wollen alle wir sein. Stimmt mit mir ein!
Erst ein Kuss, dann ein Du,
Du, Du, Du immerzu!
Die CD im Küchenradio. Er lehnte sich zurück, verschränkte die Hände hinter dem Nacken. Und wenn sie herausbekamen, wer der Tote war? Er zündete sich eine an. Auf dem Küchentisch die Morgenpost. Die wusste, dass die Polizei ein Phantombild erstellen würde. Es sei möglich, dem Skelett ein Gesicht zu geben. In erstaunlich vielen Fällen sei die Ähnlichkeit groß. Kurt erinnerte sich an Fernsehdokus, in denen Wissenschaftler aus ein paar alten Knochen tausend Jahre alte Tote quasi wiederauferstehen ließen. Dreidimensional.
Er erinnerte sich noch gut an sein Opfer. Eiergesicht, eng beieinanderstehende Augen. Ein kräftiger Kerl. Wäre die Überraschung nicht geglückt, hätte es schiefgehen können. Dann hätten sie vielleicht sein Skelett ausgegraben. Dann wäre er schon lang alle Sorgen los.
In der Nacht hatten ihn Träume geweckt. Seine Verhaftung. Szenen aus dem Keller. Wie der Typ unterm Knebel schrie. Seine Befriedigung darüber. Aber seine Hoffnung trog, durch diesen Gewaltakt und die Erschütterung, die er in ihm auslöste, den Grund allen Übels zu verdrängen. Er hatte sich eingebildet, dass sich seine Tat vor das große Verbrechen schieben könnte. Oder sich darüberlegte. Wie immer das Bewusstsein beschaffen sein mochte.
Gestern hatte er die Nachricht vom Leichenfund fast gleichgültig aufgenommen. In der Nacht aber hatte ihn der Teufel gehetzt. Nach allen Regeln der Kunst.
Wenn die Polizei das Opfer identifizierte, würden sie das Umfeld abgrasen. Vielleicht kam ein besonders findiger Bulle auf den Dreh. Das war, bei Licht betrachtet, unwahrscheinlich, aber nicht ausgeschlossen. Er beruhigte sich. Wo konnten sie Spuren seiner Tat finden? Er musste darüber nachdenken.
Vor dem Aldi fiel es ihm ein. Auf dem Parkplatz. Er bremste und schaltete den Motor aus. Dann bockte er die Vespa auf und ging ein paar Schritte. Abrupt blieb er stehen. »Mensch, Opa!«, schimpfte eine Frau, die mit ihrem Kinderwagen um ihn herumkurvte.
Klar. Es gab eine Spur zu ihm. Der Weg wäre schmal und verwinkelt. Direkt kamen sie ihm nicht drauf. Und nur wenn es einen gab, dessen Hirn beweglich genug war. Dann vielleicht kämen sie zum großen Verbrechen. Und von dort auf einem ebenso winkligen Pfad zu ihm.
Er ging in den Supermarkt und kaufte Spaghetti, ein paar Nudelsoßen, Käse, Wurst und eine Flasche Branntwein.
Er musste Robert anrufen.
Und er musste erfahren, wie es Magda ging. Magda, die in einem Pflegeheim vor sich hin lallte, während sich Speichelfäden aus ihrem Mund zogen.
6
Vor ihm lag die aktuelle Ausgabe der Vierteljahrshefte für Zeitgeschichte. Aber sein Hirn befasste sich nicht mit der Sozialpolitik des italienischen Faschismus, über den sich ein prätentiöser Doktorand ausließ. Er dachte an Anne. An die letzte Nacht. Als sie ihn berührt und er sich wegdreht hatte. Das konnte er nicht. Fix umschalten von Spannung auf Zärtlichkeit. Der Schmerz brannte weiter, lange noch. Er wäre froh, wäre er beweglicher. Könnte gleich vergessen. Als wäre nichts gewesen. Aber da war etwas. Er wusste noch nicht genau, was es war. Eifersucht, Neid. Aber das war nicht alles. Längst nicht.
Es klopfte. Renate Breuer öffnete. »Die Herren von der Sonnenfallstiftung«, sagte sie. Er fand ihren Ton einen Tick zu vorwurfsvoll.
Er hatte nicht nur den Termin vergessen, sondern auch die Namen der Herren. Verdammt.
Es waren zwei. Flanellanzug, Krawatte, modische Frisuren, italienische Schuhe, Dreitagebärte. Managerzwillinge. Als sie näher kamen, roch Stachelmann den dezenten Duft eines Herrenparfüms, das einer von ihnen benutzte, wenn nicht beide das gleiche verwendeten. Stachelmann kam sich ein bisschen klebrig vor. Die Herren stellten sich vor ihn.
»Dobbert. Wir hatten telefoniert. Danke, dass Sie Zeit für uns gefunden haben«, sagte der eine. Er war blond.
Auch der andere reichte ihm die Hand. »Schmalfuß.« Er hatte dunkelbraune Haare, fast schwarz und war eine halbe Handbreit kleiner.
Stachelmann wies zur Sitzecke. Er hastete hin, um den Tisch von Zeitschriften, Büchern und Manuskripten zu befreien, die er dort gestapelt hatte.
»Machen Sie sich bloß keine Umstände«, sagte der Dunkelbraune.
Sie setzten sich. Der Blonde holte eine Pappmappe aus der Aktentasche, schlug sie auf, zog ein Blatt heraus und legte es auf den Tisch. »Wir hatten Ihnen ja geschrieben.«
Stachelmann überlegte. Ihm wurde warm. Es ging um Drittmittel, das Hosianna eines jeden Lehrstuhls. Geld eintreiben bei der Wirtschaft. Das mochte Pharmazeuten und Physikern leichtfallen. Umso triumphaler, wenn es einem Geschichtslehrstuhl gelang. Endlich fiel es ihm ein. Die Stiftung befasste sich mit der Bildung von Kindern und Jugendlichen. Er erinnerte sich des ersten Schreibens der Stiftung. Wo sie auf Studien der Berliner Freien Universität verwiesen, um den Mangel an historischer Bildung bei Jugendlichen zu beklagen. Und eine Zusammenarbeit vorschlugen, um diesen Missstand zu beheben. Ein Skandal sei es doch, dass Schüler heutzutage nicht mehr wüssten, wer Adolf Hitler, Erich Honecker oder Konrad Adenauer gewesen seien. Walter Ulbricht als erster Bundeskanzler, man stelle sich das vor.
Als er daran dachte, musste Stachelmann grinsen. Der Blonde blickte ihn an.
»An was haben Sie denn gedacht?«, fragte Stachelmann.
Der Blonde schien verwirrt ob der Frage. Der Dunkelbraune saß da und guckte Stachelmann freundlich an. Solche Leute sind eben zerstreut, wie der Volksmund sagt.
»Herr Professor, wir haben die Hoffnung, dass wir gemeinsam eine, sagen wir mal, Handreichung für die Bildungspolitiker erarbeiten. Sie hatten dazu ja schon einige Anregungen formuliert, die es uns sehr angetan haben.«
Er hatte es verdrängt. Und wusste nun, warum. Er konnte es sich nicht leisten, einen Drittmittelpartner zu vergrätzen. Auch wenn er dessen Absichten misstraute. Stimmt, er hatte denen eine Mail geschickt und sich ein paar Gedanken abgequetscht, die er für so originell hielt wie die Erfindung der Banane.
»Gewiss, aber das war doch eher rudimentär.«
»Jeder Anfang ist rudimentär, Herr Professor, wenn ich das so sagen darf«, erklärte der Blonde. War der Schmalfuß? Dobbert?
Natürlich, dachte Stachelmann, allem Anfang haftet ein Zauber an. Nur diesem hier nicht.
Stachelmann nickte, um Einverständnis zu zeigen. »Sie wollen mit unserem Lehrstuhl also ein Maßnahmepapier ausarbeiten, damit unsere Schüler lernen, wer Adenauer war.«
»Sie haben es auf den Punkt gebracht«, sagte der Blonde.
»Und dann wollen Sie an die Kultusministerkonferenz herantreten und die davon überzeugen, dass die Schulen bei Ihnen Material kaufen, damit die Schüler künftig nicht mehr Hitler mit Honecker verwechseln.«
»Genau«, sagte der Dunkelbraune. »Die konkreten Maßnahmen haben wir schon mit Ihren Kollegen von der FU ausgearbeitet. Die legen einen besonderen Wert darauf, dass Schüler sich mit der DDR-Geschichte beschäftigen …«
»Der zweiten deutschen Diktatur«, sagte der Blonde pathetisch.
Stachelmann fühlte sich beklemmt. Er hatte nicht die geringste Lust, diesen Gestalten zu erklären, dass es einen Unterschied gab zwischen Wissenschaft und Propaganda.
»Und für diese Zusammenarbeit möchten Sie etwas bezahlen«, sagte Stachelmann.
Diese Bemerkung schien den Blonden zu erstaunen. Er blickte Stachelmann in die Augen, als wollte er prüfen, ob der ihn auf den Arm nahm.
»Natürlich wollen wir dafür bezahlen. Wir kaufen eine Wissensressource …«
»Und einen Namen, der Ihnen nutzen kann.«
»Ja, natürlich.« Es klang so, als hätte er gefragt: Was wollen Sie denn noch?
Es klopfte, die Tür öffnete sich. Breuer steckte ihren Kopf hinein. Dann hielt sie eine Zeitung hoch. »Bitte geben Sie mir Bescheid, wenn Sie Zeit haben«, sagte sie. Kopf und Zeitung verschwanden.
Die beiden Besucher schienen nichts zu bemerken. Der Blonde strich sich durch die Haare und räusperte sich. »Vielleicht könnten wir die praktischen Fragen besprechen, Herr Professor.« Fast hätte sich Stachelmann zu Bohming umgedreht.
»Natürlich«, sagte er. Ihn ärgerte seine Verlegenheit. Und seine Feigheit. Am liebsten hätte er die beiden Wichte rausgeschmissen. »Bestimmt haben Sie auch schon überlegt, wie Sie Hardenberg den Schülern ins Bewusstsein bringen wollen.«
Dobbert und Schmalfuß wechselten einen Blick. Dann sagte der Blonde: »Selbstverständlich, Herr Professor, werden wir Hardenberg in die Liste jener Persönlichkeiten der Nachkriegsgeschichte aufnehmen …«
»Und Willem Zwo?«
Dobbert und Schmalfuß starrten erst sich an, dann Stachelmann. »Herr Professor …«, sagte der Dunkelbraune.
»War ein Witz«, sagte Stachelmann.
Die beiden begannen zu lachen.
»Man muss ja nicht immer bierernst sein«, sagte der Blonde.
Der Dunkelbraune schickte einen Lacher hinterher. »Das war gut, Herr Professor. Ich glaube, wir sind auf einer Wellenlänge.«
Nun hätte Stachelmann fast losgelacht.
»Musste das sein?«, fragte Anne beim Abendbrot, während Felix seinen Teller mit einem Löffel bearbeitete.
Er blickte sie eine Weile an.
»Guck nicht so streng. Ich hätte allen Grund, grimmig zu sein.«
Vermutlich hatte sie recht. »Ich dachte …«
»Du hast wieder für mich gedacht.«
»Dann ändere ich das, und du bist raus.«
Sie schüttelte den Kopf. »Du verstehst mich nicht. Es geht mir nicht darum, ob es sachlich richtig war oder nicht. Du hast über meinen Kopf hinweg entschieden. Darum geht es. Und das würde auch gelten, wenn du mir auf diese Weise eine Gehaltserhöhung hättest zukommen lassen.«
»Manchmal …«
»Aber nicht diesmal. Du hättest den Herren sagen können, dass du das mit deinen Mitarbeitern beraten willst …«
»Du kommst nur nicht damit klar, dass ich dein Chef bin.« Nun war es raus.
Schweigen.
Dann: »Sogar Bohming hat vorher gefragt.«
»Das ist doch Quatsch. Der hat gesagt: Frau Derling, Sie schreiben mir doch den Vortrag Soundso, ja? Und die Frau Derling hat erwidert: Natürlich, Herr Professor.« Er überlegte, dann sagte er: »Hatte ganz vergessen, dass ihr euch gleich geduzt habt. Also hat er gesagt …«
Sie schlug mit der Hand auf den Tisch.
Diesmal schwiegen sie lang. Sogar Felix unterbrach sein Zerstörungswerk.
»Vielleicht ist es besser, ich ziehe aus«, sagte Stachelmann. Er war jetzt in der Stimmung, solche Dinge zu sagen. Gleich bedauerte er es. Am liebsten hätte er noch etwas angefügt. Wie es ihn nervte, dass Felix sich zu Hause immer noch wie ein Kleinkind verhielt, obwohl er längst zur Schule ging.
In ihren Augen glitzerte es.
Er hasste es. Und sie tat ihm leid. Jede, die sich mit ihm einließ, war am Ende gelackmeiert. Ausnahmslos. Er brachte sie alle zum Weinen. Aber was für einen Sinn konnte eine Liebe haben, in der man nichts sagte, um die Harmonie zu retten? Er hielt Harmonie ohnehin für eine Lüge. Der Mantel des Schweigens. Besser durch Nichtreden schweigen als durch Worte.
Anne zog die Zeitung vor sich. Das Hamburger Abendblatt, das Breuer ihm auf den Schreibtisch gelegt hatte, nachdem die beiden Vertreter buckelnd abgetreten waren. »Wir reden bald weiter. Ganz, ganz herzlichen Dank für das gute Gespräch, Herr Professor.« Im Regionalteil die Überschrift: »Hamburger Historiker ermittelt wieder.« Darunter ein kurzer Text:
Wie wir aus Polizeikreisen erfuhren, hat das Landeskriminalamt Professor Josef Maria Stachelmann vom Historischen Seminar der hiesigen Universität erneut mit Ermittlungen beauftragt. Stachelmann hat in den vergangenen Jahren entscheidend dazu beigetragen, Mordfälle aufzuklären. Allerdings hat sich die Hamburger Polizei zu dieser erstaunlichen Personalie bisher nur spärlich geäußert. Genannte Kreise behaupten, dass es um die Leiche vom Reinbeker Redder geht. Wie wir berichtet haben, wurde dort zufällig der stark skelettierte Leichnam eines Mannes gefunden, der vor etwa zwanzig Jahren Opfer eines Verbrechens wurde. Unsere Redaktion fragt sich, was es bedeutet, wenn ein so renommierter Historiker an der Aufklärung dieses Mordfalls mitwirkt. Ist es Ausdruck von Hilflosigkeit? Will sich die Polizei bei einem Misserfolg der Ermittlungen auf den Standpunkt zurückziehen, sie habe doch alles versucht? Oder gibt es ernst zu nehmende historische Motive, für deren Klärung fachmännischer Rat unentbehrlich ist? Das LKA war zu einer Stellungnahme zum jetzigen Zeitpunkt nicht bereit. Ein Dementi ist das nicht.
7
»Können Sie erklären, welche Aufgabe dieser Historiker bei den Ermittlungen hat?« Der Typ hatte gegelte Haare und trug eine Hornbrille. Er streckte ihr sein Mikrofon fast in den Mund.
Kranz saß neben Konrad Ott, dem Pressesprecher, im Konferenzraum des Präsidiums und spürte ihr Herz. Es pochte so schnell und laut, dass sie fürchtete, es sei im Saal zu hören.
Es waren vielleicht fünfzehn Medienleute da. Die Lokalzeitungen, der NDR, Privatsender. Und Werner Albers, ein Lokalredakteur vom Abendblatt, der sie anhimmelte. Manchmal rief er unter einem Vorwand an, nur um mit ihr zu sprechen. Sie hatten sich vor vier Jahren bei einer Mordermittlung zufällig am Absperrband getroffen. Er hatte davor warten müssen und sie angesprochen, als sie zum Tatort kam. Aus irgendeinem bescheuerten Grund hatte sie zwei belanglose Sätze mit ihm gewechselt. Aus dem Mord war ein Totschlag geworden, aber Werner blieb ihr auf den Fersen. Er war aber zu harmlos, um lästig zu werden.
Sie warf einen Blick auf Ott, doch der tat so, als bemerke er es nicht.
»Der Stand der Ermittlungen erlaubt es noch nicht, Ihnen eine ausführliche Antwort zu geben.« Sie wusste schon während sie sprach, dass sie einen Fehler gemacht hatte.
»Ein Hinweis würde genügen. Wenn ich Ihren Wort Glauben schenken kann, gibt es Auskünfte unterhalb der Schwelle der Ausführlichkeit«, drängte der Reporter.
»Haben Sie das geschrieben? ›Dieses Wochenende war arschgeil‹?« Ich rede mich um Kopf und Kragen.
»Nein, das war eine Kollegin«, erwiderte er. »Ich freue mich aber, dass Sie unser Blatt so aufmerksam lesen.«
So eine Scheiße.
»Ich kann Ihnen zu den Aufgaben von Professor Stachelmann nichts sagen. Aus ermittlungstaktischen Gründen.«
Sie sah den Typen grinsen. Er wusste, dass er sie erwischt hatte. Und sie wusste es noch besser.
»Können Sie etwas zum Fundort sagen. Oder ist der auch geheim?« Gelächter.
Die durchgestylte junge Frau hatte eine beneidenswert gute Figur. Ihr Mikrofon trug das Logo eines TV-Krawallsenders. In ihrem Gesicht trug sie die Arroganz junger Leute, die noch nicht ahnen, dass sie dafür keinen Grund haben. Der Kameramann ihrer Anstalt stand an der Wand, das Gesicht hinter seinem Gerät verborgen. Er schwenkte die Kamera von der Kollegin zu Kranz.
Die hätte am liebsten gesagt, dass sie das Opfer womöglich bald identifizieren würde. Aber das verkniff sie sich. Man muss als Bulle oft dümmer dastehen, als man ist. Das gehörte zu den Weisheiten, die der Buddha vom Präsidium gern unters Volk streute. Obwohl Taut sicher war, dass es sich in den meisten Fällen um Bordeaux für Colatrinker handelte.
»Wir wissen nicht mehr, als Sie schon wissen. Wie war bitte Ihr Name?«
»Karin Lobinger von First TV. Und der Tatort …«
»Kennen wir nicht.«
»Warum geben Sie eine Pressekonferenz, wenn Sie keine Auskunft geben können? Oder wollen?«
»Weil Ihre Kolleginnen und Kollegen uns gedrängt haben. Es ist ein Service der Polizei …«
»Auf den wir besser verzichtet hätten«, schnappte die Jungreporterin.
»Das zu beurteilen liegt ganz in Ihrem Ermessen.«
Sie war gerade zurück in ihrem Büro, als es an der Tür klopfte. Lobinger steckte ihren Kopf herein. »Haben Sie vielleicht noch …?«
»Eigentlich nicht«, sagte Kranz.
Lobinger betrat das Büro und stellte sich vor Kranz’ Schreibtisch. »Es könnte sich lohnen. Für Hinweise …«
»Raus!«, sagte Kranz.
»Wir könnten Ihre Rolle bei den Ermittlungen … hervorheben. Und wenn Sie etwas wünschen. Ein Geschenk unter Freunden vielleicht?«
Kranz sprang auf, packte Lobingers Arm und drehte ihn auf den Rücken. Lobinger stöhnte auf. »Halten Sie das Maul!«, befahl Kranz.
Lobinger verstummte schlagartig.
»Wenn Sie noch einmal mein Büro betreten, ohne dass ich Sie ausdrücklich dazu einlade, kriegen Sie eine Anzeige wegen Angriffs auf einen Polizeibeamten im Dienst. Und bevor Sie jetzt sagen, dass ich dafür keine Zeugen hätte, sollten Sie jetzt genau zuhören: Ich habe Zeugen dafür. Verstanden?«
Kranz löste den Griff. Lobinger stöhnte noch einmal, aber mehr aus Protest als wegen des Schmerzes. Dann nickte sie. Drehte sich um und ging. Das Türschloss klickte leise, als es einrastete.
Kranz öffnete den Aktendeckel. Obenauf lag das Foto des vermissten Spediteurs. Ein Porträt, frontal. Lachfältchen an Augen- und Mundwinkeln. Eierförmiges Gesichts. Eng beieinanderstehende Augen fand sie eigentlich unsympathisch. In diesem Fall aber nicht. Der Mann hatte etwas Väterliches. Irgendwie. Aber vielleicht fand Kranz das nur, weil sie ihren Vater nicht kannte.
Wieder öffnete sich die Tür. Springbein blieb im Rahmen stehen. »Der Chef ist sauer«, sagte er.
»Ja, und?«
»›Sie werden uns jetzt von allen Seiten beschießen‹, hat er gesagt.«
»Bis sie was Neues haben«, erwiderte Kranz. »Immer mit der Ruhe, Springbein.«
Ihr ging das Dauergejammer des Kollegen auf die Nerven. Springbein war nicht dumm, aber ängstlicher als ein Hase im Fuchsbau. Sie betrachtete die knochige Gestalt mit den weißblonden Haaren und dem Bartstrich über der Lippe. Irgendwie war er, wie er aussah. Weglaufen, sich ducken. Jede Mahnung des Chefs raubte ihm den Schlaf. Aber sie verachtete ihn nicht. Sie zwang sich immer wieder zur Geduld, wenn sie mit ihm zu tun hatte. Er war ein guter Polizist, im gleichen Rang wie sie. Viel weiter würde er es aber kaum bringen. In seinem Fall war der Name wirklich Schicksal. Springbeins Ehrgeiz richtete sich auf seine Marathonzeit, sein sonstiges Augenmerk galt dem Untergang des HSV. Sein Stolz war ein Bild im Abendblatt, das ihn beim letzten Stadtlauf zeigte mit einem verzerrten Gesicht wie Emil Zátopek. Ihre Großmutter in Trittau hatte Bilder der »tschechischen Lokomotive« gesammelt. Springbein hatte bestimmt keine Ahnung, wer Zátopek war. Und ohne Oma wüsste sie es auch nicht.
»Die Blut-und-Titten-Journaille tut wieder aufgeregt. Das ist alles. Guck dir lieber den mal an.«
Springbein trat neben sie. Er roch auch noch am Abend so, als wäre er gerade der Badewanne entstiegen. »Ist das unser …?«
»Sieht fast so aus. Es passt alles. Der einzige Vermisste, bei dem alle Merkmale, die wir kennen, zutreffen. Wenn unsere Leiche als vermisst gemeldet wurde, dann muss es der sein. Ich habe einen Zeitraum von zehn Jahren und ganz Norddeutschland durchsucht. Und es bleibt nur der. Zeit und Ort stimmen. Körperbau, Alter stimmen. Kein Grund, was rauszuposaunen. Aber wenn wir nachbohren, finden wir heraus, dass es unser Mann ist.«
»Günter Andert«, las Springbein leise vom Bildschirm ab. »Norderstedt.«
»Seine Frau hat ihn vermisst gemeldet. Vielleicht gibt es die noch unter dieser Nummer.« Sie wählte, es hob jemand ab.
»Ja?«
»Sprech ich mit Frau Andert?«
»Wer ist denn da?«
»Ach so, Entschuldigung. Landeskriminalamt Hamburg, Kranz. Frau Andert?«
»Ja.« Eine traurige Stimme. »Sie rufen wegen der … vom Reinbeker Redder …«
»Ja, Frau Andert. Ich würde gern gleich zu Ihnen kommen. Geht das?«
Pause, dann: »Ja, kommen Sie.« Ein Kessel pfiff im Hintergrund.
Gisela Andert war anders, als Kranz sie sich vorgestellt hatte. Nicht hager und schwach, sondern fast eins fünfundsiebzig und kräftig gebaut, wie man sich eine Bilderbuchbäuerin vorstellte. Aber sie war Näherin von Beruf gewesen und längst in Rente. Sie hatte gerötete Augen hinter der Brille. Sie bat Kranz und Springbein in die Wohnstube, wie sie die nannte.
Die Polizisten lehnten Kaffee und sonstige Getränke höflich ab.
Andert saß auf dem Sofa und blickte Kranz ängstlich an. »Sie haben ihn gefunden, nicht wahr?«, fragte sie leise. In Anderts Stimme glaubte Kranz den Widerklang dessen zu hören, was die arme Frau in den vergangenen zwanzig Jahren erdulden musste. Die Angst, dass ihr Mann einfach abgehauen war. Dass er eine verborgene Existenz geführt hatte. Vielleicht eine zweite Familie, für die er sich entschied. Dass es an ihr gelegen haben könnte. Eine Furcht, die sich in manchen Nächten zu finsterster Gewissheit verdichtete.
»Wir sind uns noch nicht sicher. Die Rechtsmedizin erarbeitet gerade ein Modell. Sie versucht das Aussehen des Toten nachzubilden.«
»Ja, warum …?«
»Wir sind gekommen, weil so viele Indizien auf Ihren Mann hindeuten und wir keine Zeit verlieren wollen.«
»Sie glauben also …«
»Wie gesagt, wir sind nicht sicher. Aber es gibt Hinweise … es passt alles … bisher.«
Andert nickte. »Gewissheit wäre natürlich …«
Kranz verstand sie sofort. Würde Anderts Mann lebendig auftauchen, wäre es die furchtbarste Enttäuschung. Aber natürlich wollte die Frau nicht sagen, dass sie froh wäre, wenn ihr die erspart bliebe.
»Falls es Ihr Mann ist … ich hoffe natürlich …, dann müssen wir den Mörder finden …«
»Wenn er noch lebt«, warf Springbein ein.
Andert blickte ihn an, als sähe sie ihn zum ersten Mal.
»Ist ja eine Weile her«, sagte Springbein, als wollte er sich entschuldigen.
»Was wissen Sie über das Verschwinden Ihres Mannes? Was waren die Umstände?«
»Das habe ich doch damals alles schon gesagt, Frau …«
»Kranz«, sagte die Oberkommissarin. »Ich habe Ihre Aussagen gelesen. Nur ist es so, dass einem später oft noch was einfällt. Sie haben ja doch weiter nachgedacht …«
In Anderts Blick sah Kranz den Widerschein des Leids. Sie nickte. »Ja«, sagte sie nur. In dem kurzen Wort steckten Wut, Verzweiflung, Misstrauen, Trauer. Der Mangel an Gewissheit traf sie härter als der Verlust. Sie begriff auch: Da gab es mehr, als in den Akten stand.