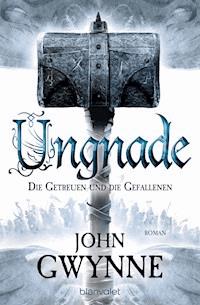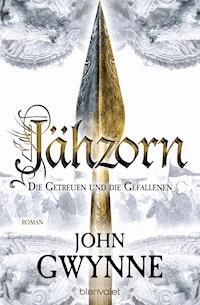12,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Blanvalet Taschenbuch Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Getreuen und die Gefallenen
- Sprache: Deutsch
Düster, episch, mitreißend: Diese Saga stellt alles in den Schatten!
Der Krieg ist ausgebrochen und hat die Verfemten Lande in Chaos gestürzt. Der Krieger Corban, der einst treu für König Brenin kämpfte, ist auf der Flucht – bis dem Feind ein wertvolles Pfand in die Hände fällt: Die junge Cywen ist Corbans Schwester, und um sie zu retten, würde er jeden Preis zahlen. Gleichzeitig ringt Corban mit der Bürde, ein Held zu sein. Doch während er vor seinem Schicksal flieht, formieren sich dunkle Mächte, um die Verfechter der Gerechtigkeit für immer zu zerschlagen ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1216
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Das Buch
Der Krieg ist ausgebrochen und hat die Verfemten Lande in Chaos gestürzt. Der Krieger Corban, der einst treu für König Brenin kämpfte, ist auf der Flucht – bis dem Feind ein wertvolles Pfand in die Hände fällt: Die junge Cywen ist Corbans Schwester, und um sie zu retten, würde er jeden Preis zahlen. Gleichzeitig ringt Corban mit der Bürde, ein Held zu sein. Doch während er vor seinem Schicksal flieht, formieren sich dunkle Mächte, um die Verfechter der Gerechtigkeit für immer zu zerschlagen …
Der Autor
John Gwynne studierte an der Brighton University, wo er später auch unterrichtete. Er spielte Bass in einer Rock-and-Roll-Band, bereiste die USA und lebte in Kanada. Heute ist er verheiratet, hat vier Kinder und führt in England ein kleines Unternehmen, das alte Möbel restauriert.
Weitere Informationen unter: http://www.john-gwynne.com/
Von John Gwynne bereits erschienenMacht · Bosheit
Besuchen Sie uns auch auf www.facebook.com/blanvaletund www.twitter.com/BlanvaletVerlag
JOHN GWYNNE
Bosheit
Die Getreuen und die Gefallenen 2
Aus dem Englischenvon Wolfgang Thon
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Die Originalausgabe erschien 2014 unter dem Titel »Valour – The Faithful and the Fallen 2« bei Pan Macmillan, London.
Copyright der Originalausgabe © 2014 by John Gwynne
Copyright der deutschsprachigen Ausgabe © 2017 by Blanvalet in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Urban Hofstetter
Umschlaggestaltung: Isabelle Hirtz, Inkcraft, nach einer OriginalvorlageUmschlagillustration: Paul Young represented by Artist Partners
Karte: © Fred van Deelen
BL · Herstellung: sam
Satz: Uhl + Massopust, Aalen
ISBN 978-3-641-17581-8V005www.blanvalet.de
Für Harriet, die tapferste Seele, die ich kenne.Für meine Eltern. Ich wünschte, ihr hättet das erleben können. Ich vermisse euch. Und natürlich für Caroline, einfach weil sie so ist, wie sie ist.
Ewiger Kampf zwischen den Getreuen und den Gefallenen,
unendlicher Zorn überkommt die Welt der Menschen.
Lichtträger sucht Fleisch zu werden aus dem Kessel,
um seine Ketten zu zerbrechen und den Krieg aufs Neue zu beginnen.
Zwei, geboren aus Blut, Staub und Asche sind die Paladine
der Entscheidung zwischen
der Dunkelheit und dem Licht.
Die Schwarze Sonne wird die Erde in Blut ertränken,
der Strahlende Stern muss sich mit den Kostbarkeiten vereinen.
An ihren Namen werdet ihr sie erkennen –
Verwandtenmörder, Verwandtenrächer, Gigantenfreunde, Draakenreiter,
Dunkle Macht gegen Lichtbringer.
Einer wird die Flut sein, einer der Fels in der kochenden See.
Vor einem werden Sturm und Schild stehen,
vor dem anderen Treuherz und Schwarzherz.
Neben dem einen reitet die Geliebte, neben dem anderen die Rächende Hand.
Hinter einem versammeln sich die Söhne des Mächtigen, die strahlenden Ben-Elim, unter dem Großen Baum.
Hinter dem anderen die Unheiligen, die fürchterlichen
Kadoshim, die versuchen, die Brücke zu überqueren
und die Welt in die Knie zu zwingen.
Sucht nach ihnen, wenn der Hochkönig ruft, wenn die Schattenkrieger aus dem Dunkel reiten,
wenn die weißen Mauern von Telassar verlassen sind, wenn das Buch im Norden gefunden wird.
Wenn die Weißwyrmer aus ihren Nestern kriechen,
wenn der Erstgeborene zurückholt, was verloren war,
und die Kostbarkeiten sich aus ihrer Ruhe erheben.
Erde und Himmel werden warnend schreien, werden diesen Krieg der Leiden ankündigen.
Blutige Tränen werden aus den Knochen der Erde sickern,
und am Höhepunkt des Mittwinters wird aus helllichtem Tag
finsterste Nacht.
1. KAPITEL
UTHAS
Im Jahr 1142 des Zeitalters der Verbannten, Geburtsmond
Der Kessel aus schwarzem Eisen war riesig. Groß und rund thronte er auf einem Podest in der Mitte der höhlenartigen Kammer. Fackeln mit blauen Flammen an den Wänden warfen kleine Lichtkreise in die Dunkelheit. Am Rand der Schatten schlichen, nur schwach erkennbar, lange, sehnige Gestalten umher.
Uthas vom Gigantenclan der Benothi trat zu dem Kessel. Seine dunkle Silhouette glitt über die Wand. Er erklomm die Stufen und blieb davor stehen. Der Kessel war vollkommen schwarz und zeigte keinerlei Spiegelungen, schien sogar das Licht der Fackeln zu verschlucken. Einen Moment lang sah er jedoch so aus, als würde er sich schütteln, sanft pulsieren wie ein krankes Herz.
Am Eingang der Kammer gab jemand mit einem gedämpften Murmeln dem Giganten eine Anweisung, aber der rührte sich nicht, sondern starrte den Kessel einfach nur an.
»Was ist denn?«, erwiderte er schließlich.
»Nemain schickt nach dir, Uthas. Sie sagt, der Träumer erwacht.«
Der Angesprochene seufzte und schickte sich an, die Kammer zu verlassen. Dabei strich er mit den Fingerspitzen über die kalte Wölbung des Kessels und blieb dann wie erstarrt stehen.
»Was hast du?«, fragte ihn seine Schildwache Salach vom Eingang der Kammer.
Uthas neigte den Kopf zur Seite und schloss die Augen. Stimmen, Stimmen, die mich rufen. »Nichts.« Er wusste nicht genau, ob er das Flüstern aus dem Kessel gehört oder nur gespürt hatte. »Bald«, wisperte er, als er seine Finger von dem kalten Eisen löste.
Ein Umriss tauchte aus den Schatten auf, als er zum Eingang ging. Er versperrte ihm den Weg, glitt um ihn herum. Ein Wyrm. Seine weißen Schuppen glänzten, als er den flachen Kopf hob und Uthas mit kalten, seelenlosen Augen musterte. Uthas blieb regungslos und stumm stehen, bis die Kreatur seine Witterung aufgenommen hatte. Er kämpfte gegen sein Unbehagen an, doch dann glitt die Schlange davon. Ihre Segmente zogen sich zusammen und dehnten sich aus, als sie wieder in den Schatten zu ihrer Brut kroch. Uthas atmete vernehmlich aus.
»Dann komm«, sagte er, als er an Salach vorbeiging. »Wir sollten Nemain nicht warten lassen.«
Er warf einen Blick auf die mürrischen Gesichter der Wächter am Eingang der Kammer. Sie alle trugen Pelze und Eisen. Schweigend gingen sie durch die unterirdischen Gewölbe von Murias, dem letzten Stützpunkt der Benothi-Giganten. Er lag versteckt im Hochland von Benoth, tief eingegraben in das graue, von Nebel überzogene Land.
Bald erreichten sie eine breite Treppe, die sich in einer Spirale in die Dunkelheit hinaufschraubte. Schon bald fluchte Uthas leise, als der vertraute Schmerz in seinem Knie ihm zu schaffen machte, während er höher und höher stieg.
»Bitseach!«, fluchte er laut. Miststück! Er dachte an Nemain, die ganz oben in diesem hohen Turm auf ihn wartete. Hinter ihm lachte Salach leise.
Schließlich erreichten sie eine Tür. Salach nickte der Kriegerin zu, die dort Wache stand. Es war Sreng, Nemains Schildmaid. Sie machte den beiden auf.
Der Raum war nur spärlich eingerichtet und bis auf ein großes mit Fellen bedecktes Bett in der Mitte nur spärlich möbliert. Auf dem Bett lag eine Frau, eine schlanke Frau. Sie war schweißnass, und ihre Arme und Beine schienen unwillkürlich zu zucken. Neben ihr saß ein weißhaariger Mann und hielt ihre Hand. Seine massige Gestalt passte kaum in den Stuhl. Er sah zur Tür, als Uthas und Salach den Raum betraten, und starrte die beiden an. Ein von Narben überzogenes Loch klaffte an der Stelle, wo eines seiner Augen hätte sein sollen.
»Ein-Auge.« Uthas nickte. »Wie geht es ihr?«
Balur Ein-Auge zuckte mit den Schultern.
»Wo ist Nemain?«
»Ich bin hier.« Die Stimme zog Uthas’ Blick zum anderen Ende des Gemachs. Dort stand eine Gestalt in einem Türbogen, umrahmt vom fahlen Licht des Tages in ihrem Rücken.
Nemain, Königin der Benothi. Auf dem Balkon hinter ihr hockten Raben auf der Brüstung. Einer flatterte auf ihre Schulter.
»Meine Königin.« Uthas senkte den Kopf.
»Willkommen daheim.« Ihr Haar war schwarz wie die Nacht und umrahmte ihr milchig weißes kantiges Gesicht. »Welche Neuigkeiten bringst du mir?«
»Im Süden herrscht Unruhe. Narvon führt Krieg mit Ardan, und die Krieger von Cambren marschieren nach Osten.« Er machte eine Pause und atmete tief durch. Die nächsten Worte schienen auf seinen Lippen gefroren zu sein. Er fürchtete die Antwort, die ihn erwartete. »Unsere Feinde führen Krieg untereinander. Es wäre ein guter Zeitpunkt, zuzuschlagen und sich zurückzuholen, was einst uns gehörte.« Bitte, Nemain, gib mir den Befehl. Erspare mir, das zu tun, was ich tun muss, falls du dich weigerst.
»Wir sollen nach Süden ziehen? Wir sind ein gebrochenes Volk, Uthas – das weißt du. Wir sind zu wenige, um auch nur diese Festung zu bemannen, ganz zu schweigen davon, den Süden zu erobern, der einst uns gehörte. Außerdem haben wir jetzt eine andere Aufgabe vor uns.« Sie trat auf den Balkon hinaus.
Er seufzte und folgte ihr bis zur Balustrade, wo ihm die kalte Luft auf der Haut brannte. Vor ihnen fiel eine Felswand steil ab, bis sie in großer Tiefe im Nebel verschwand. Ein Meer aus dunklem Granit, Schnee und Heidekraut erstreckte sich bis zum Horizont. Raben umkreisten den Balkon, ließen sich von den Aufwinden tragen. Einer kreischte und schwenkte ab, um neben Nemain zu landen. Sie streckte die Hand aus und kraulte seinen Kopf. Der Vogel klapperte mit dem Schnabel.
»Und der Westen?«, fragte sie. »Was ist mit Domhain?«
Uthas zuckte mit den Schultern. »Von dort wissen wir nur wenig. Ich vermute, dass Eremon alt geworden ist und sich in seiner Senilität damit zufriedengibt, nichts zu tun. Dieser Bandraoi Rath jedoch hält uns auf Trab!«, spie er hervor. »Er gibt keine Ruhe. Er jagt unsere Kundschafter und überfällt unsere Ländereien, er und seine Gigantenjäger. Es hat etliche Verluste gegeben.«
Nemain zischte, und ihre Augen glühten rot. »Ich würde nichts lieber tun, als loszumarschieren und zurückzuholen, was wir verloren haben, Rath daran erinnern, warum er uns hasst.«
»Dann lass es uns tun!«, drängte Uthas sie. Das Blut rauschte in seinen Ohren, als Hoffnung in ihm aufkeimte.
»Das können wir nicht«, gab Nemain zurück. »Der Kessel muss bewacht werden. Er darf nie wieder benutzt werden. Er darf auf keinen Fall in die falschen Hände fallen.«
Diese Worte wirkten wie Hammerschläge auf Uthas.
»Aber wir müssen wissen, was jenseits unserer Grenzen vor sich geht. Domhain darf uns nicht verschlossen bleiben. Du wirst eine Abteilung nach Süden führen und so viel wie möglich über Eremons Pläne in Erfahrung bringen.«
»Wie du befiehlst, meine Königin«, antwortete Uthas.
»Wähle aus, wen du willst, aber nimm nicht zu viele mit. Schnelligkeit wird dir eher von Nutzen sein als eine große Zahl. Und versuche, Raths Aufmerksamkeit zu entgehen.«
»Ich werde tun, was du befiehlst.«
Ein schriller Schrei ertönte in der Kammer hinter ihnen. Die Frau auf dem Bett hatte sich aufgesetzt. Das schweißnasse Haar klebte ihr im Gesicht, und sie hatte die Augen so weit aufgerissen, dass sie aus den Höhlen zu treten schienen. Balur packte ihre Hand und murmelte beruhigend auf sie ein.
»Ethlinn, was hast du gesehen?«, fragte Nemain.
Die bleiche Frau holte bebend Luft. »Sie kommen«, flüsterte sie. »Die Kadoshim kommen immer näher. Sie können den Kessel spüren. Die Schwarze Sonne kommt, um sie Fleisch werden zu lassen. Sie kommt, um den Kessel zu holen.«
2. KAPITEL
CYWEN
Cywen erwachte genauso langsam wie die hereinkriechende Flut.
Als Erstes kehrte ihr Gefühl zurück. Ein dumpfes Pochen in ihrem Kopf, ihrer Schulter, ihrer Hüfte. Ihr ganzer Körper war wie zerschlagen, aber einige Stellen schmerzten besonders. Dann hörte sie es. Ein Stöhnen, gedämpfte Stimmen, Schritte, ein schabendes Kratzen, als würde etwas über den Boden gezogen. Dann das Kreischen von Möwen und das ferne Rauschen des Meeres. Sie versuchte, die Augen zu öffnen. Eines war verkrustet und geschwollen. Das Tageslicht drang ihr wie ein Stich ins Hirn. Wo bin ich? Sie sah sich um. Krieger in roten Mänteln zerrten Leichen über den gepflasterten Hof und hinterließen blutige Spuren auf den Steinen. Sie warfen die Toten auf einen Haufen mit Leichnamen.
Plötzlich strömte alles auf sie ein, kamen all die Erinnerungen zurück, das Gespräch mit Marrock auf den Zinnen, Evnis im Burghof, die schwarz gekleideten Krieger innerhalb der Mauern, die Tore, die sich öffneten, und Conall …
Irgendetwas Weiches befand sich unter ihr. Sie lag auf einer Toten, einer Frau, die mit leblosen Augen zu ihr hinaufstarrte. Taumelnd rappelte sich Cywen auf, und alles drehte sich um sie, bevor die Welt wieder zur Ruhe kam.
Das Steintor stand weit offen. Ein gleichförmiger Strom von Menschen ging durch die Tore hinein und hinaus. Die meisten trugen die roten Mäntel von Narvon. Schwarze Rauchsäulen stiegen in den blassen Himmel empor, wo ein leichter Wind vom Meer her an ihnen zupfte und sie zu einem Schleier formte.
Die Schlacht ist also verloren. Dun Carreg ist gefallen.
Dann drang ein anderer Gedanke durch ihren benebelten Verstand. Meine Familie.
Sie betrachtete die Leichen um sich herum und erinnerte sich daran, wie sie mit Conall hinabgestürzt war. Aber sie konnte ihn nirgends unter den Toten entdecken. Die Gesichter ihrer Mam und ihres Pas zuckten ihr durch den Kopf, außerdem die von Corban und Ghar. Wo waren sie nur alle?
Cywen entfernte sich unbehelligt aus dem Burghof und ließ sich langsam durch die Straßen treiben, folgte der Spur der Toten. Sie lagen überall herum, manchmal in kleinen Haufen, wo die Kämpfe heftiger getobt hatten, und einige Leichen waren immer noch in makabrer Umarmung ineinander verschlungen. Der Geruch von Rauch und Feuer verstärkte sich, je weiter sie in die Festung hineinging. Unwillkürlich lenkte sie ihre Schritte zu den Stallungen. Dort waren noch mehr Krieger, rot gewandete Männer, die sich um die panischen Pferde kümmerten. Sie sah Corbans Hengst Schild in der kleinen Koppel. Dann war er verschwunden, zwischen den anderen Pferden der Herde, die dort zusammengetrieben worden war.
Wo ist Ghar?
Wie in einem Traum ging sie weiter und musterte die Gesichter der Toten. Sie suchte nach ihrer Familie. Jedes Mal war sie erleichtert, wenn sie in ein lebloses Gesicht blickte und es nicht einem von ihnen gehörte. Sie suchte weiter und wurde hektischer, bis sie sich schließlich in dem Hof vor der Großen Halle wiederfand.
Hier war ebenfalls ein Leichenhaufen aufgeschichtet, der noch größer war als der vor dem Steintor. Überall waren Krieger, Verletzte, die mit Asche und Blut bedeckt waren. In einer Ecke sah Cywen die grauen Uniformröcke von Ardan. Die besiegten Krieger scharten sich zusammen, viele von ihnen waren verletzt. Sie wurden von einer Abteilung von Owains Männern bewacht.
Dann ertönte lautes Wehklagen aus der Halle. Ein Brett oder vielleicht auch eine Tischplatte wurde aus dem Eingang hinausgetragen und mit einem dumpfen Schlag gegen eine der Säulen neben dem Eingang gelehnt. Cywen sah, dass eine Leiche darauf befestigt war. Sie war blutüberströmt, aber trotzdem deutlich zu erkennen. Cywen drehte sich fast der Magen um.
Es war Brenin. Sein Kopf schwang schlaff hin und her, die Arme waren verdreht, und man hatte seine Handgelenke und Knöchel auf die Platte genagelt. Blut säumte die tiefe Wunde in seiner Brust. Cywen spuckte Galle auf die blutbefleckten Pflastersteine, während Ascheflocken wie schwarzer Schnee um sie herum zu Boden fielen.
Dann wischte sie sich über den Mund und näherte sich stolpernd den Türen der Halle. Den Blick hielt sie auf Brenins Leichnam gerichtet.
»Bitte, Elyon, Allvater«, betete sie leise, »lass meine Verwandten noch am Leben sein.« Sie blieb vor Brenin stehen und starrte ihn an, bis ein Krieger sie anstieß und ihr befahl, aus dem Weg zu gehen. Sie warf ihm einen finsteren Blick zu.
Aus der Festhalle drang Lärm in den Hof hinaus. Es entstand Unruhe, Männer schrien, und jemand gab ein tiefes Knurren von sich. Sturm?
Im nächsten Moment stürmte sie durch die offenen Türen in die Halle und blinzelte, während sich ihre Augen an das gedämpfte Licht gewöhnten. Im Inneren herrschte vollkommenes Durcheinander. Tische und Stühle waren umgestoßen worden, die Dachbalken waren rußgeschwärzt vom Feuer, und dort, wo die Flammen gerade erst gelöscht worden waren, hingen immer noch Rauchwolken unter dem Dach. Hier waren viele Menschen. Sie sah Owain, im Gespräch mit Nathair, der von einer Gruppe der schwarz gekleideten Krieger umringt war, die die Tore erstürmt hatten. Evnis war bei ihnen, und auch Conall. Wut packte sie, und instinktiv griff sie zu ihrem Messergurt. Dann runzelte sie die Stirn, als ihr wieder einfiel, dass sie all ihre Wurfmesser letzte Nacht auf der Mauer verbraucht hatte.
Schließlich glitt ihr Blick in Richtung des Lärms, der ihre Aufmerksamkeit erregt hatte. Eine Gruppe von Kriegern stand im Halbkreis um ein schnappendes, knurrendes Etwas herum.
»Bring ihn einfach um«, sagte einer der Krieger. Cywen sah scharfe weiße Zähne blitzen, eine stumpfe Schnauze und scheckiges Fell.
»Buddai«, flüsterte sie und rannte los, drängte sich mit den Ellbogen durch die Reihe der Krieger.
Der massige Hund stand mit gesenktem Kopf da und fletschte die Zähne.
Cywen kam stolpernd zum Stehen, und Buddais großer Schädel schwang zu ihr herum. Er schnappte nach ihr, doch dann erkannte er sie plötzlich. Er winselte und wedelte zögernd mit dem Schwanz, als er jemand Vertrautes an diesem Ort des Todes sah, jemand, der zu seinem Rudel gehörte. Sie stürzte sich auf ihn, schlang ihm die Arme um den Hals und grub das Gesicht in sein Fell. So verharrte sie lange, während ihre Tränen in Buddais Fell versickerten. Schließlich lehnte sie sich zurück, spürte die Zunge des Hundes auf ihrem Gesicht und blickte zu Boden.
»Deshalb bist du also hier«, murmelte sie. Ihr Pa lag ausgestreckt da, die Augen glasig und blicklos. Sein ganzer Körper war von Wunden übersät und mit schwarzem Blut verkrustet. Sie schluchzte erstickt, kniete sich neben Thannons Leiche und fuhr ihm sanft mit den Fingerspitzen über die Wange. Sind sie etwa alle ermordet worden? Sie legte den Kopf auf die Brust ihres Vaters. Buddai schmiegte sich an sie und drückte seine Schnauze in Thannons Hand. Sie sackte schlaff zu Boden.
»Mädchen.« Ein Speerschaft bohrte sich ihr in den Rücken.
»Was denn?«
»Geh da weg.« Der Mann war ein älterer Krieger. Sein roter Bart war von silbernen Strähnen durchzogen.
»Nein.« Sie umklammerte ihren Pa fester.
»Wir müssen die Halle säubern, Mädchen, und dieser Köter lässt uns nicht in seine Nähe.« Er stieß mit dem stumpfen Ende seines Speers gegen Thannons Stiefel. Buddai knurrte. »Wenn du diesen Hund mitnehmen kannst, umso besser, sonst bleibt uns nichts anderes übrig, als ihn zu töten.«
Buddai töten? Bitte keine Toten mehr.
»Ich … ja.« Cywen wischte sich über Augen und Nase. Dann kniete sie sich vor Buddai hin und streichelte ihn. Das Fell über seinen Vorderläufen war blutverkrustet, und er winselte leise, als sie die Wunde untersuchte. »Komm mit mir, Buddai«, flüsterte sie. »Sonst töten sie dich auch noch.« Er legte nur den Kopf schief und blickte sie verständnislos an.
Cywen stand auf, trat ein paar Schritte von dem Hund weg und rief ihn. Er näherte sich ihr zögernd, blickte dann zu seinem toten Herrn zurück und jaulte erbärmlich.
»Komm schon, Buddai, komm mit.« Cywen schlug mit der Hand gegen ihr Bein, und diesmal gehorchte er. Der rotbärtige Krieger nickte und fuhr mit seiner schaurigen Arbeit fort.
Niemand nahm Notiz von Cywen. Sie war nur eine weitere blutverschmierte Überlebende dieser schrecklichen Nacht. Die Krieger in der Halle schienen vor allem damit beschäftigt zu sein, den Boden von Leichen frei zu räumen oder sich um verletzte Kameraden zu kümmern. Owain und Nathair waren immer noch in ihr Gespräch vertieft, aber Cywen bemerkte, dass der Schildmann des Königs von Tenebral, der schwarz gekleidete Krieger namens Sumur, zu ihr hersah.
»Komm schon, Buddai«, sagte Cywen. »Machen wir lieber, dass wir hier wegkommen.« Sie drehte sich zur Tür der Halle herum und stieß mit jemandem zusammen.
»Esel!« Der Mann grunzte vor Schmerz. »Pass doch auf, wohin du – du!«
Cywen stand wie erstarrt da und erkannte, mit wem sie zusammengestoßen war. Es war Rafe.
Der Sohn des Jägers erwiderte finster ihren Blick. Buddai knurrte, und Rafe trat einen Schritt zurück.
Sein blondes Haar war stumpf und voller Asche, und seine Augen waren gerötet und blutunterlaufen. Er hatte geweint. In einem Hosenbein war ein tiefer Schnitt, kurz über dem Knie, und eine Spur von getrocknetem Blut lief hinab bis zu seinen Stiefeln. Die Wunde war mit einem Fetzen Tuch verbunden.
»Das hat dein Bruder mir angetan«, erklärte er, als er ihrem Blick auf sein Bein folgte. »Noch etwas, wofür ich ihm Vergeltung schulde.«
»Ban«, keuchte Cywen. Ihr Herz schmerzte bei dem Gedanken an ihren Bruder. »Er lebt also noch?« Sie hatte fast zu viel Angst, den Gedanken laut auszusprechen.
»Mag sein, aber bestimmt nicht mehr lange. Wir werden ihn erwischen, wir werden sie alle erwischen.«
»Sie alle? Wen denn noch? Meine Mam und Ghar?«
Rafe sah sie einen Moment an, dann grinste er. »Bist wohl ganz allein auf dich gestellt, kleines Mädchen? Besser, du gewöhnst dich gleich daran.«
Wut stieg in ihr auf, und sie hasste Rafe in diesem Moment so sehr, wie sie noch nie jemanden gehasst hatte. Sie griff nach ihren Messern und fluchte leise, weil sie immer wieder vergaß, dass sie schon alle geworfen hatte. »Verräter!«, zischte sie.
»Das kommt darauf an, von welcher Seite aus du es betrachtest«, erwiderte Rafe, aber seine Miene verfinsterte sich. »So wie ich das sehe, ist Evnis mein Herr. Und ich tue, was er mir befiehlt. Außerdem sieht es im Moment so aus, als wäre er auf der Seite der Gewinner.«
»Noch«, murmelte Cywen.
»Hier hat sich einiges geändert.« Rafe drohte ihr mit dem Finger. »Und wenn du das nicht ganz schnell kapierst, wird es dir leidtun. Du solltest von jetzt an mehr auf deine Manieren achten. Denn deine Beschützer haben dich alle im Stich gelassen. Du bist wohl doch nicht so besonders, was? Warum sonst hätten sie dich zurückgelassen?« Er grinste. »Denk mal darüber nach.«
Cywen hätte ihn am liebsten geschlagen. Seine Worte waren scharf und schnitten tief so wie ihre Messer. Sie ballte die Fäuste, wusste aber, dass es keine gute Idee war, ausgerechnet jetzt irgendjemanden anzugreifen.
Rafe blickte über ihre Schulter, und sie folgte seinem Blick. Evnis winkte dem Sohn des Jägers. Conall stand immer noch neben ihm. »Wir sehen uns wieder«, versprach Rafe. »Und mach dir keine Sorgen, wir werden deine Familie schon finden.« Er grinste höhnisch und zog langsam einen Finger über seine Kehle, von einem Ohr zum anderen. Ohne nachzudenken, trat Cywen vor und rammte Rafe ihr Knie in die Lenden.
Er sank zu Boden und rollte sich zu einer wimmernden Kugel zusammen.
»Und für dich ist es besser, wenn du dich von mir und meiner Familie fernhältst!«, zischte sie. Dann hörte sie ein leises Lachen hinter sich. Der rotbärtige Krieger hatte sie beobachtet, zusammen mit einer Handvoll anderer Männer.
»Du und dieser Hund passt gut zusammen«, erklärte er. Er grinste, und sie errötete. Aber sie verkniff sich eine wütende Antwort. Sie hielt es für besser zu verschwinden.
Cywen senkte den Blick und ging, gefolgt von Buddai, zu dem offenen Portal der Festhalle. Als sie ins Tageslicht hinaustrat, warf sie noch mal einen Blick zurück. Rafe stemmte sich langsam vom Boden hoch. Und Sumur starrte sie immer noch an.
Der Drang, nach Hause zurückzukehren, war übermächtig. Sie rannte durch die Straßen, und Buddai lief humpelnd neben ihr her.
Als sie die Tür öffnete und in die Küche trat, erwartete sie fast, ihre Mam am Ofen stehen zu sehen, während ihr Pa am Tisch saß und etwas aß. Sie rief sogar laut ihre Namen und hoffte, irgendjemanden antworten zu hören. Dann durchsuchte sie alle Zimmer, bis sie wieder in der Küche landete. Ihr Haus war leer, genauso kalt und leblos wie der Blick ihres Pas.
Wo sind sie?
»Verschwunden«, flüsterte sie. Sie schluchzte, schwankte und hielt sich am Küchentisch fest.
Alle sind weg. Und sie haben mich einfach zurückgelassen. Rafes Worte hallten laut in ihrem Kopf. Wie konnten sie das nur tun? Sie sah auf Buddai hinunter. Der Hund erwiderte ihren Blick treuherzig. Wieder tauchte die Erinnerung an ihren Pa auf, an all das verkrustete Blut auf seinem Körper, an die schrecklich leblosen Augen. Sie wünschte sich, ihre Mam wäre hier, um sie festzuhalten und zu trösten. Und Ban, ihr Bruder und bester Freund. Warum hatten sie sie einfach im Stich gelassen? Wieder schluchzte sie, sank zu Boden, schlang ihre Arme um Buddai und weinte mit krampfhaften, schmerzhaften Schluchzern. Der fleckige Hund leckte Cywens tränenüberströmte Wange und schmiegte sich schützend an sie.
3. KAPITEL
VERADIS
Veradis trank einen Schluck aus seinem Wasserschlauch und goss sich die Flüssigkeit dann über Kopf und Hals. Er und seine Männer hatten sich in einem Halbkreis vor den großen Toren von Haldis verteilt, der letzten Bastion des Gigantenclans der Hunen. Kurz zuvor waren Calidus und Alcyon im Innern der Festung verschwunden, gefolgt von mehr als zweihundert Kriegern.
Überlebende des Kampfes gegen die Giganten tauchten in kleinen Grüppchen auf der Lichtung auf. Veradis schickte ein halbes Dutzend Kundschafter aus, um den Nachzüglern den Weg zu weisen.
»Diese Arbeit macht durstig, was?« Boos, sein Waffenbruder, grinste. »Dieses Töten von Giganten, meine ich.«
Der hünenhafte Krieger blutete aus einer Wunde an seinem Ohr. Das Blut hatte seine Haare verfilzt. Als Veradis genauer hinsah, bemerkte er, dass es nicht nur eine oberflächliche Wunde war. Seinem Freund fehlte ein großes Stück vom Ohr.
»Wo ist dein Helm?«, fragte Veradis.
»Hab ihn verloren.« Boos zuckte mit den Schultern. Dann berührte er sein Ohr und betrachtete seine blutigen Fingerspitzen. »Besser, als meinen Kopf zu verlieren.«
»Das ist noch die Frage.« Veradis reichte seinem Freund den Wasserschlauch.
Boos trank in gierigen Schlucken. »Wir können Rauca eine schöne Geschichte erzählen, stimmt’s?«
»Wohl wahr«, erwiderte Veradis. »Wenn wir das hier überleben.« Er ließ den Blick über die Steinhaufen um sie herum gleiten, von denen jeder mindestens zweimal so groß war wie ein Mann. In jedem dieser Gräber ruhte ein Gigant. Immer noch drang Schlachtenlärm zu ihnen, herangetragen von einem kalten Wind, schwach und hallend. Jenseits der Grabhügel sah er die Gipfel der Bäume des Fornswaldes. Hinter Veradis erhob sich eine blanke Felswand hoch in den Himmel, die von riesigen Reliefs bedeckt war. Ein offener Durchgang am Fuß der Wand führte in die Dunkelheit.
Der Blutrausch der Schlacht ebbte langsam ab, wich dem Gefühl von schmerzenden Muskeln, Müdigkeit und einem pulsierenden Schmerz im Gesicht. Veradis hob die Hand und zog einen Splitter aus seiner Wange. Die Axt eines Giganten hatte sich in seinen Schild gegraben, den eisernen Rand zertrümmert und Holzsplitter in sein Gesicht geschleudert.
Viele von seinen fünfhundert Männern waren in der Schlacht zwischen den Grabhügeln gefallen, aber die Überlebenden standen voller Stolz da. Sie wussten, dass sie diese Schlacht entschieden hatten, dass sie irgendwie mit ihrem Schildwall eine drohende Niederlage in einen Sieg verwandelt hatten.
Die Kriegerhorden von Braster und Romar waren erheblich dezimiert worden, von der Magie und dem Eisen der Giganten. Braster selbst war verletzt und bewusstlos vom Schlachtfeld geschleppt worden. Romar, der König von Isiltir, hatte eine Streitmacht durch diesen schwarzen Eingang geführt, um die flüchtenden Hunen zu verfolgen. Obwohl Calidus ihn als einen Dorn in ihrem Fleisch betrachtete, da er sich Nathair und seinen Dienern bei fast jeder Gelegenheit widersetzte, beneidete Veradis Romar nicht um diesen Kampf auf engstem Raum, der ihn in den dunklen Tunneln erwartete.
Vor allem, da Calidus angedeutet hatte, dass es Zeit wäre, drastische Maßnahmen gegen den aufsässigen König zu ergreifen. Aber das war Calidus’ Angelegenheit. Nathair hatte Veradis klargemacht, dass er keine Befehlsgewalt über Calidus besaß und der Mann tun konnte, was er wollte. Zudem hatte Calidus die Jehar, um seine Wünsche durchzusetzen.
Was immer geschieht, geschieht, dachte er. Romar war ihm gleichgültig, aber in dem Berg, in diesen Tunneln waren Freunde von ihm. Kastell und Maquin. Sie gehörten zu den Gadrai, Romars Elitekämpfern. Es würde ihm nicht gefallen, wenn sie zu Schaden kämen. Aber er hatte sie gewarnt, oder zumindest hatte er das versucht. Was hätte er auch sonst tun können?
Als Veradis in die Tunnel spähte, drang Lärm aus der Dunkelheit – das Klirren von Eisen und gedämpfte Schreie.
Boos tippte ihm auf die Schulter und deutete mit einem Nicken auf die Grabhügel. Einer der Kundschafter war zurückgekehrt.
»Ich habe etwas gefunden«, keuchte der Mann schwer atmend.
»Was denn?«
»Eine versteckte Tür. Ich habe Stimmen gehört und noch etwas, etwas Sonderbares.«
Veradis sammelte ein Dutzend Männer um sich, übertrug Boos den Befehl über die anderen und folgte dann dem Kundschafter. Der führte ihn zwischen den Grabmälern hindurch. Alles war gespenstisch still.
Schließlich endeten die Hünengräber, und eine Ansammlung von Steingebäuden tauchte vor ihnen auf. Sie waren leer und dunkel. Jetzt kamen sie nur noch langsam voran, da Veradis und seine Männer überprüften, ob tatsächlich keine Giganten in der Finsternis lauerten.
»Dort.« Der Kundschafter zeigte auf die Felswand.
Schlingpflanzen überzogen das Gestein. Veradis betrachtete die Stelle, konnte jedoch nichts Ungewöhnliches entdecken.
»Nein, hier.« Der Kundschafter trat vor. Vor der Felswand blieb er stehen und scharrte mit einem Stiefel im Boden vor sich. Ein Griff kam zum Vorschein. Er war an einer Falltür befestigt.
Veradis kniete sich hin und legte ein Ohr an die Tür. Zuerst hörte er nichts, aber dann vernahm er ein ersticktes Weinen wie von einem Kind.
Er deutete auf den Griff und flüsterte Befehle. Zwei Krieger packten den Eisenring, und der Rest versammelte sich mit gezückten Waffen um die Falltür.
»Jetzt!«, befahl Veradis, und die Männer rissen die Tür auf.
Breite Steinstufen führten in die Tiefe hinab, und das Sonnenlicht fiel auf Gesichter, die zu ihnen heraufblickten. Viele Gesichter. Es waren Gigantengesichter, aber irgendetwas an ihnen wirkte auf Veradis schon auf den ersten Blick sonderbar. Anders.
Bevor er etwas tun konnte, brüllte jemand, und eine Gestalt stürmte die Stufen hinauf, einen Streithammer schwingend. Hinter ihr erhoben sich Stimmen in der Dunkelheit. Veradis sprang zur Seite. Der Hammer verfehlte ihn und traf krachend einen anderen Krieger, zermalmte seine Knochen. Der Mann brach am Boden zusammen, und der Gigant griff weiter an. Andere Männer flogen durch die Luft.
Veradis und seine Leute umkreisten ihren Feind, der ihnen Flüche entgegenschleuderte und sich trotzig um seine eigene Achse drehte. Veradis sprang vor, stach zu und wich rasch wieder zurück. Der Gigant brüllte auf und fuhr zu Veradis herum, aber dessen Männer griffen ebenfalls an und stachen auf den Hünen ein. Der Gigant brüllte seine Wut heraus, griff den Kreis aus Kriegern an und schmetterte einen Mann zu Boden. Schwerter blitzten auf. Der Gigant taumelte ein paar Schritte, brach dann zusammen, und sein Blut sickerte ins Gras.
Veradis blieb einen Moment regungslos stehen und atmete schwer. Dann trat er vor und stieß den am Boden liegenden Giganten mit dem Fuß an. Ihr Feind würde nicht mehr aufstehen.
»Kommt heraus!«, befahl Veradis und beugte sich über die Falltür. Schweigen antwortete ihm. Er spähte in das Dämmerlicht und erkannte dort, wo die Sonne nicht hinschien, schemenhafte Gestalten. »Ich bin nicht so dumm, zu euch hinabzusteigen. Aber wenn ihr dort unten bleibt, werdet ihr alle brennen«, sagte er und hob die Stimme. Immer noch kam keine Antwort. Er zuckte mit den Schultern und wandte sich ab.
»Es sind noch Kinder«, ertönte eine barsche Stimme aus der Dunkelheit. »Wir kommen hoch. Bitte, tötet sie nicht.«
Giganten-Kinder. Was für ein Tag! »Kommt hoch. Wenn es stimmt, was du sagst, werden wir euch nichts tun, außer ihr greift uns an.« Veradis trat zurück und warnte seine Männer mit erhobener Hand.
Eine Gestalt tauchte aus dem Loch im Boden auf. Ein Gigant, groß und breitschultrig. Es war eine Frau, wie das Fehlen des Schnauzbartes verriet, aber sie war ebenso muskulös wie die männlichen Exemplare ihrer Art. Schwarze Lederstreifen bedeckten ihre Brüste, und in den Händen hielt sie locker einen Streitkolben. Ihr Blick zuckte von Veradis zu dem Giganten, der bäuchlings im Gras lag. Ein Ausdruck von Trauer huschte über ihr Gesicht.
Veradis bedeutete ihr weiterzugehen. Sie gehorchte zögernd und sagte irgendetwas Unverständliches. Hinter ihr tauchten andere Gestalten aus dem Erdloch auf.
Veradis blinzelte. Es waren ungefähr dreißig. Etliche von ihnen waren kleiner oder genauso groß wie er, andere dagegen größer. Sie waren muskulös, aber zierlicher als die Erwachsenen. Ihre Glieder waren länger und wirkten ein wenig ungelenk, wie bei Fohlen. Auf einigen Gesichtern zeigte sich bereits der erste Bartwuchs, die meisten jedoch waren unbehaart. Außerdem waren ihre Gesichtszüge nicht so kantig wie die der erwachsenen Giganten, die Veradis gesehen hatte. Einige waren bewaffnet mit Langmessern, die in etwa die Länge von Veradis’ Schwert hatten. Und einige wenige von ihnen, die größeren, schwangen Streithämmer oder Äxte. Sie alle sahen ängstlich aus, und schienen nicht zu wissen, ob sie kämpfen oder flüchten sollten. Veradis spürte ihre Anspannung und wusste, dass diese Situation beim kleinsten Fehler in einem Blutbad enden konnte. Die Hüterin sagte etwas, und die jugendlichen Giganten mit den Streithämmern und Äxten ließen ihre Waffen sinken.
Sie spürt es auch.
»Es sind nur Kinder«, wiederholte die Gigantin. Stolz und Flehen mischten sich in ihrer Stimme.
Kinder. »Die meisten von ihnen sind größer als ich«, gab Veradis zurück. Er fuhr sich mit der Hand durchs Haar. »Ich werde ihnen nichts antun, ebenso wenig wie dir. Solange du nicht als Erste angreifst.«
Der Blick der Gigantenfrau zuckte zwischen ihm und seinen Männern hin und her. »Also ist die Schlacht verloren.« Das war keine Frage, sondern eine Feststellung.
»So ist es. Ihr müsst eure Waffen niederlegen. Alle.« Und dann kann ich mir überlegen, was ich mit euch anfangen werde. Veradis betrachtete die kleine Gruppe hinter ihr und stellte zu seinem Unbehagen fest, dass sie ihm und seinen Männern zahlenmäßig überlegen waren.
Die Frau gab einen barschen Befehl über die Schulter zurück, und Eisen fiel klirrend auf den Boden. Einige zögerten, und sie wiederholte ihren Befehl, lauter diesmal. Gleichzeitig ließ sie ihren eigenen Streithammer fallen. Dann erregte etwas hinter Veradis ihre Aufmerksamkeit, und ihre dichten Brauen zogen sich finster zusammen.
Alcyon kam auf sie zu. Calidus und die Jehar folgten ihm. Sie schienen sich wie ein dunkler Umhang über das Land zu breiten.
»Was haben wir denn hier?«, erkundigte sich Calidus.
»Sie hatten sich versteckt«, erwiderte Veradis. »Und sie haben sich uns ergeben.« Der harte Blick in Calidus’ Augen gefiel ihm ebenso wenig wie die Art und Weise, wie der Mann die Hand auf den Griff seines Schwertes legte.
»Dia duit.« Alcyon trat vor. Er legte eine Hand auf die Stirn.
Die Gigantenfrau musterte ihn argwöhnisch, erwiderte aber die Geste. Dann hob sie den Kopf und witterte wie ein Jagdhund, der den Geruch seiner Beute wahrnimmt. Ihre Augen verengten sich zu schmalen Schlitzen, als sie ihren Blick auf Calidus richtete. »Cen fath coisir tu racan ar dubh aingeal.«
Alcyon zuckte mit den Schultern. »Ich habe meine Wahl getroffen«, brummte er. Aber ein sonderbarer Ausdruck zeigte sich auf seinem harten Gesicht.
Ist das Scham?, dachte Veradis.
»Sie können nicht am Leben bleiben.« Calidus war hinter Alcyon getreten.
Der Gigant hob eine Hand, und seine Miene verfinsterte sich. »Es sind nur Kinder.«
»Sie werden nicht immer Kinder bleiben. Sie werden ihre Familien rächen wollen. Und sie werden zurückholen wollen, was du ihnen genommen hast.«
»Was genommen?« Die Gigantin sprach die Worte langsam aus und verzog dabei das Gesicht, als hätte sie einen widerlichen Geschmack im Mund.
»Die Sternenstein-Axt«, gab Calidus zurück.
Der Blick der Gigantin zuckte zu Alcyon, und jetzt sah Veradis die Axt, die er in einer Schlinge auf dem Rücken trug. Sie war von der Klinge bis zum Griff von einem matten Schwarz. Als Veradis sie anstarrte, ertönte ein Geräusch in seinem Kopf, ein schwacher Windhauch, das Flüstern von Stimmen – es dauerte nur einen Herzschlag lang, dann war es verschwunden. Er blinzelte.
Die Gigantin ächzte, riss ihren Streithammer vom Boden hoch und stürzte sich auf Alcyon. Der sprang hastig zurück, zog mit einer fließenden Bewegung die Axt vom Rücken und parierte einen Schlag, der ihm zweifellos den Kopf von den Schultern getrennt hätte.
Hinter ihr hoben eine Handvoll Gigantenkinder ihre Waffen auf und folgten dem Beispiel ihrer Hüterin. Mit einem Geräusch, als würde sich eine Welle am Strand brechen, zückten die Jehar ihre Schwerter.
Veradis stolperte zurück, Schwert und Schild bereit, aber etwas hielt ihn davon ab, in die Schlacht einzugreifen. Er wollte das Blut dieser Giganten nicht vergießen. Es waren nur Kinder. Sie sind dein Feind, sagte eine Stimme in seinem Kopf.
Und was ist mit Gnade, auch einem Feind gegenüber?, dachte er.
Alcyon blockte den Angriff der Gigantin und benutzte seine neue Axt wie einen Stock. Immer wieder schlug sie auf ihn ein, und Alcyon wich vor ihren Angriffen zurück. Er schien ebenfalls davor zurückzuschrecken, Blut zu vergießen. Um ihn herum kämpften die Jehar gegen die Jugendlichen, die sich mit mehr Leidenschaft als Geschick auf die schwarz gekleideten Krieger gestürzt hatten. Viele von ihnen waren bereits tot.
Schließlich hämmerte Alcyon der Gigantin den Schaft der Axt auf den Kopf. Sie taumelte zurück und sank auf ein Knie. Um sie herum kam die Schlacht zum Erliegen, als die jungen Giganten die Szene beobachteten.
»Lass deine Waffe fallen!«, knurrte Alcyon.
Calidus tauchte zwischen ihnen auf. Alcyon schrie den silberhaarigen Mann an, doch Calidus ignorierte ihn. Er holte mit dem Schwert aus und schlug der Gigantin in einer einzigen, geschmeidigen Bewegung den Kopf von den Schultern.
Ihre Mündel schrien vor Entsetzen und Wut auf, und einige verstärkten ihre Angriffe. Andere dagegen wandten sich um und flüchteten zwischen die Steinhaufen.
Alcyon senkte den Kopf.
Die Jehar machten kurzen Prozess mit den restlichen Giganten, und nach wenigen Augenblicken war der Kampf vorbei.
»Willkommen, Veradis!« Calidus grinste, als er zu ihm trat. Mit seinem Umhang wischte er das Blut von seinem Schwert. Akar, der mürrische Anführer der Jehar, ging hinter ihm.
Veradis nickte, während er den Kopf der Gigantin und die Leichen der Kinder um sie herum betrachtete. »Ist es gut gegangen? In den Tunneln?« Er versuchte, den Blick von den Toten loszureißen.
»Das kann man so sagen. Die Hunen sind jetzt endgültig besiegt. Und wir haben eine großartige Trophäe für Nathair gefunden.«
»Eine Trophäe? Was denn?«
»Das hier.« Alcyon hob die Axt. »Eine derSieben Kostbarkeiten.« Seine Miene war immer noch düster.
Aus der Nähe sah Veradis jetzt, dass der Schaft der Axt aus dunklem gemasertem Holz bestand. Es war glatt und glänzend von Alter und Gebrauch und über die gesamte Länge mit eisernen Ringen verstärkt. Das doppelschneidige Blatt war von einem matten Schwarz, das sämtliches Licht zu verschlucken schien, statt es zu reflektieren.
Er sah an ihnen vorbei zu den Jehar und bemerkte eine Handvoll anderer Krieger. Er erkannte Jael unter ihnen.
»Wo sind die anderen?« Ein ungutes Gefühl beschlich ihn, als er wieder an Kastell und Maquin dachte.
»Es gab Verluste.« Calidus zuckte mit den Schultern. »Das ist ein Schlachtfeld, Veradis. Hier sterben Männer.«
»Männer? Welche Männer?«
»Viele!«, fuhr Calidus ihn an, sichtlich gereizt. »Romar ist gefallen, zusammen mit einigen seiner Männer.«
»Mit allen«, verbesserte ihn Alcyon.
»Mit allen«, bestätigte Calidus ungerührt. »Eine Tragödie, gewiss, aber solche Dinge kommen eben vor.«
Veradis starrte ihn an. Die Gesichter von Kastell und Maquin tauchten vor seinem inneren Auge auf. Ich habe versucht, sie zu warnen.
»Komm, Alcyon.« Calidus wandte sich ab. »Beseitige die Leichen, Veradis. Wir treffen uns später und besprechen, wie es weitergeht.«
Alcyon folgte Calidus, die schwarze Axt über der Schulter balancierend. Akar blieb bei Veradis. Der Anführer der Jehar wirkte mürrisch und sah aus, als wolle er etwas sagen. Dann jedoch drehte er sich ebenfalls um und folgte Calidus. Seine schwarz gekleideten Krieger schlossen sich ihm an.
Veradis beobachtete, wie das flackernde Feuer Licht und Schatten über Calidus’ Gesicht warf. Er saß ihm gegenüber und war in ein Gespräch mit Lothar vertieft, dem Heerführer von König Braster von Helveth.
Hinter dem Ratgeber, halb verborgen im Schatten, hob sich dunkel Alcyons massige Gestalt ab. Seit dem Gemetzel an den Gigantenkindern war er in eine brütende Stimmung verfallen. Die schwarze Axt lag quer über seinem Schoß. In der Hand hielt er eine lange, dünne Nadel, von deren Spitze schwarze Tinte tropfte. Veradis sah fasziniert zu, wie Alcyon sich in einem regelmäßigen Rhythmus in den Unterarm stach und weitere Dornen zu der Tätowierung der Schlingpflanze hinzufügte. Sie markierten die Leben, die der Gigant in der Schlacht ausgelöscht hatte. Veradis runzelte die Stirn. Ob Kastell und Maquin wohl ebenfalls mit einem solchen Dorn gekennzeichnet werden?
Akar saß mit einer Kriegerin der Jehar am Feuer. Sie war dunkelhaarig und hatte ein hageres Gesicht. Sie schien noch jung zu sein, soweit Veradis das erkennen konnte, nicht viel älter als er. Seine Miene verdüsterte sich. Er konnte sich immer noch nicht an die Vorstellung von Kriegerinnen gewöhnen, schon gar nicht an solche, die so geschickt waren wie die der Jehar.
Lothar verabschiedete sich und verschwand in der Dunkelheit. Niemand hatte zwischen den stummen Gräbern von Haldis sein Lager aufschlagen wollen, also hatten sie sich auf den Hang vor der Bestattungsstätte zurückgezogen. Nicht weit von der Stelle entfernt, von der aus Veradis am Morgen die Schlacht beobachtet hatte. Das schien schon sehr lange zurückzuliegen.
Überall auf dem Kamm und dem Hang flackerten Lagerfeuer, an denen sich die Überlebenden dieser Schlacht wärmten. Etwa viertausend Krieger waren nach Haldis marschiert. Weniger als eintausend hatten überlebt, und die Hälfte davon gehörte zu Veradis’ Kriegerhorde und den Jehar. Romars Kriegerhorde war fast vollständig vernichtet worden. Nur Jael und eine Handvoll anderer hatten überlebt. Brasters Kriegerhorde war es nicht viel besser ergangen. Nur die paar Hundert Männer, die ihren verwundeten König vom Schlachtfeld eskortiert hatten, waren dem Tod entkommen.
»Und?«, fragte Veradis von der anderen Seite des Lagerfeuers her. »Wie geht es König Braster?«
»Seine Verletzung war nicht tödlich«, erwiderte Calidus. »Ein Schlag mit einem Streithammer hat ihm die Schulter zerschmettert. Lothar sagte, die Heiler gäben sich damit zufrieden, seine Knochen wieder zusammenzufügen, also …« Er zuckte mit den Achseln. »Er wird vielleicht nie wieder ein Schwert führen können, aber er wird es überleben.«
»Gut.« Veradis mochte Braster. Der König von Helveth hatte eine grobe, aber direkte und ehrliche Art. »Und wie sieht unser neuer Plan aus?«
»Jetzt wird es Zeit, Nathair zu suchen. Wir waren lange genug von ihm getrennt.«
»Hervorragend.« Veradis war immer noch sehr stolz darauf, dass ihm der Oberbefehl über diesen Feldzug anvertraut worden war, vor allem, nachdem er seine Kriegerhorde erfolgreich durch die Schlacht geführt hatte. Auch wenn er wusste, dass Calidus und Alcyon eine sehr große Rolle dabei gespielt hatten, weil es ihnen gelungen war, bei den Hunen die Magie ihrer Elementare wirkungslos zu machen. Aber während des ganzen Feldzuges hatte er an Nathair gedacht. Er war besorgt, weil sein Freund und König auf der Suche nach dem Kessel ins Ungewisse segelte. Er war Nathairs Erstes Schwert. Er sollte an seiner Seite sein.
»Wie wollen wir ihn finden?«, fragte er. »Er wollte nach Ardan segeln, als wir uns getrennt haben, aber wer weiß, wo er jetzt ist?«
»Ich habe erfahren, wo er ist.« Calidus tippte sich an den Kopf. »Vergiss nicht, ich war viele Jahre lang oberster Spion der Vin Thalun. Nathair befindet sich in Dun Carreg in Ardan. Dorthin werden wir jetzt reiten. Nathair braucht uns, braucht seine Berater um sich. Ich werde dafür sorgen, dass Lykos uns dort abholt.«
Veradis gab ein unverbindliches Brummen von sich. Er wusste nicht genau, ob er wirklich erfahren wollte, wie Calidus das bewerkstelligen würde. Ihm gefiel die Vorstellung, diesen Wald endlich verlassen zu dürfen, aber die Erwähnung der Vin Thalun erregte immer noch seinen Argwohn. Manchmal saß Misstrauen eben sehr tief.
»Wir brechen also morgen früh auf?«
»Beim ersten Licht. Wir werden erst nach Osten ziehen und Jael nach Isiltir begleiten. Von dort aus reisen wir nach Ardan weiter.«
»Jael?« Veradis war Kastells Cousin vom ersten Moment an unsympathisch gewesen. Er war ein ganz anderer Mensch als Kastell oder Maquin. Die beiden hatte Veradis als Freunde betrachtet, und nun lagen sie tot in den Tunneln unter Haldis. Veradis wusste nicht, durch wessen Hand sie gefallen waren, und irgendwie war es ihm auch lieber so. Ein anderer Teil von ihm jedoch konnte an nichts anderes denken. Lass es auf sich beruhen, flüsterte eine Stimme in seinem Kopf.
»Ja, Jael«, bestätigte Calidus. »Hast du damit ein Problem?«
»Nein«, antwortete Veradis. Er wollte noch mehr sagen, verkniff es sich aber.
»Gut. Jael hat jetzt, wo Romar gefallen ist, Anspruch auf den Thron von Isiltir. Und Nathair wird ihn in seinem Anspruch unterstützen.«
»Sonderbar.« Die Worte kamen über Veradis’ Lippen, bevor er es verhindern konnte. »Romar und seine Schildwachen sind in den Tunneln gefallen, und nur Jael hat überlebt.« Er hob den Kopf und starrte Calidus scharf an.
Der Berater lächelte ihn humorlos an. »Das ist Krieg. So etwas geschieht eben.«
Calidus hatte natürlich recht, in einer Schlacht fielen Männer. Veradis hatte mehr Schildbrüder im Kampf verloren, als er zählen mochte, und viele von ihnen waren Freunde gewesen. Er wusste, dass im Leben die Dinge nicht immer nach Wunsch verliefen. Aber das hier? Was in diesen Tunneln geschehen war, fühlte sich an wie Verrat. »Hast du gesehen, wie Romar starb?«, hakte Veradis nach. »Und hast du gesehen, wer ihn tötete?«
»Aber ja.« Calidus’ Gesicht war so ausdruckslos wie ein Stein. »Ein Gigant hat Romar getötet. Denk lieber an die Lebenden als an die Toten, Veradis. Wir alle dienen Nathair. Was wir hier tun, dient einem guten Zweck. Es ist gut für Nathair.« Er kniff die Augen zusammen. »Ich hoffe, dass du genug Überzeugung besitzt, um deinem König vorbehaltlos zu dienen.«
»Natürlich!«, gab Veradis zurück. »Zweifle niemals an meiner Loyalität zu Nathair.«
»Gut.« Calidus lächelte schwach. »Ich werde mich jetzt schlafen legen. Wir müssen früh aufbrechen und haben eine lange Reise vor uns.«
Alcyon erhob sich und verschwand hinter Calidus in der Dunkelheit. Akar machte Anstalten, ihnen zu folgen.
»Akar«, hielt Veradis den Jehar auf. »Hast du Romar fallen sehen?«
»Hab ich.«
»Und …?«
»Calidus hat die Wahrheit gesagt«, erwiderte Akar. »Ein Gigant hat Romar getötet.«
»Oh.« Veradis war sowohl überrascht als auch erleichtert. Er war vollkommen sicher gewesen, dass Calidus beim Tod des Königs von Isiltir die Hand im Spiel gehabt hatte.
»Ein Gigant«, fuhr Akar nach einem Herzschlag fort, »und getötet hat er ihn mit einer schwarzen Streitaxt.« Dann drehte sich der Jehar um und verschwand in der Dunkelheit.
4. KAPITEL
MAQUIN
»Ich lass dich jetzt los. Mach keine Dummheiten.«
Die Worte drangen wie aus weiter Ferne in Maquins Bewusstsein.
Wo bin ich?
Er öffnete die Augen, aber zunächst schien das keinen großen Unterschied zu machen. Es blieb pechschwarz, sein Gesicht war gegen kalten Stein gepresst, und seine Schulter schmerzte höllisch.
»Vorsichtig. Sie sind zwar schon eine Weile weg, aber in diesen Tunneln tragen Geräusche weit«, fuhr dieselbe Stimme fort.
Tunneln? Dann kehrte die Erinnerung zurück, wie eine Lawine aus Bildern. Haldis, die Schlacht in den Tunneln. Romar, der mit Calidus wegen dieser Axt stritt. Der Verrat. Tod. Kastell …
»Kas…« flüsterte er kaum vernehmlich.
»Er ist tot«, antwortete die Stimme nach langem Schweigen. »Sie sind alle tot.«
Kastell.
Er hatte gesehen, wie Jael ihn mit dem Schwert durchbohrt hatte, und sofort gewusst, dass die Verletzung tödlich war. Er hatte versucht, zu seinem Freund zu eilen, aber Orgull, der Hauptmann der Gadrai, hatte ihn gepackt und in die Dunkelheit gezerrt, während die Schlacht noch um sie herum tobte. Es hatte keinen Zweifel gegeben, wie sie enden würde. Romar, der König von Isiltir, war von Calidus von Tenebral verraten worden. Und von Jael.
Und Kastell war getötet worden.
Zuerst hatte Maquin sich gewehrt, versucht, sich aus Orgulls Griff zu befreien, aber der Mann war ungeheuer stark. Dann … nichts.
»Ich kann mich nicht mehr an alles erinnern. Was ist passiert?« Seine Stimme krächzte.
»Du hast gekämpft wie ein Draake, um loszulaufen und dich umbringen zu lassen. Ich musste dir eins über den Schädel ziehen.« Orgulls Stimme drang zu ihm herab. Er spürte, wie der Hüne die Achseln zuckte, was einen sonderbaren Schmerz in seinem Rücken auslöste. »Entschuldige.«
Jetzt spürte Maquin ein Gewicht auf sich, das ihn zu Boden drückte. »Sitzt du etwa auf mir?«
»Ich musste sichergehen, dass du nicht aufspringst und losrennst, sobald du aufwachst.«
»Daran kann ich nicht mal denken.« Maquin grunzte. »Steh auf.«
Er fühlte, wie Orgulls Gewicht von seinem Rücken verschwand. Dann rollte er sich zur Seite, stemmte sich auf ein Knie und richtete sich stöhnend auf. Er griff instinktiv nach seinem Schwert.
Orgull runzelte die Stirn. »Bist du klar im Kopf?«
»Ja.« Maquins Miene verdüsterte sich. Er lockerte die Schultern und dehnte die verkrampften Muskeln. Dabei spürte er einen stärkeren Schmerz, der seine Aufmerksamkeit beanspruchte. Er erinnerte sich daran, dass er vom Streithammer eines Giganten getroffen worden war. Seine Schulter brannte höllisch. Er biss die Zähne zusammen und sah sich in der Kammer um.
Die Fackeln flackerten immer noch, und in den eisernen Schüsseln brannte Öl mit blauen Flammen. Sie bildeten eine Gasse, die auf den toten Gigantenkönig zuführte. Sein Leichnam hockte nach wie vor auf dem steinernen Thron auf dem Podest. Davor häuften sich die Leichen.
Maquin und Orgull sahen sich an und gingen wortlos zurück zum Schauplatz des Kampfes. Sie achteten darauf, nicht auf die Leichen zu treten.
Wir sind die Letzten, die von den Gadrai übrig geblieben sind, flüsterte eine Stimme in Maquins Kopf. Der Rest ist tot. Sie sind alle tot. Er machte die Augen zu und sah erneut, wie Jael sein Schwert in Kastells Bauch rammte.
Orgull kniete sich neben Vandil, ihren toten Anführer, und schloss ihm die Augen. In seiner Brust klaffte eine riesige Wunde, wo der Gigant Alcyon ihn mit der schwarzen Axt getroffen hatte.
Maquin ging zu der Stelle, wo er Kastell hatte fallen sehen.
Der junge Mann lag mit dem Gesicht nach unten auf dem Boden, und unter seiner Taille hatte sich eine Blutlache gebildet. Maquin kniete sich neben ihn und drehte ihn auf den Rücken. Dann nahm er ihn in die Arme.
»Ach, Kas«, flüsterte er. Tränen traten ihm in die Augen, und die Trauer erstickte seine Worte. So viele Erinnerungen. Er dachte an den Tag von Kastells Geburt zurück. Er selbst war ein Krieger im Haus von Kastells Pa gewesen. Maquin wusste noch, wie stolz es ihn gemacht hatte, als er zu Kastells Schildwache auserkoren worden war. Er erinnerte sich daran, wie er den Jungen nach dem Angriff der Hunen aus den Flammen und den Trümmern des Anwesens geschleppt hatte, und wusste noch jedes Wort seines feierlichen Gelübdes, ihn bis zum Tod zu beschützen.
Die Tränen tropften ihm von der Nase und fielen auf Kastells Gesicht, wo sie schmierige Spuren hinterließen.
Ich habe versagt. Er hatte Kastell geliebt wie den Sohn, den er selbst nie gehabt hatte. Und dann hatte er zugelassen, dass er durch Jaels Hand starb. Kalte Wut breitete sich in seinem Bauch aus.
Maquin wischte Kastell ganz sanft den Schmutz aus dem Gesicht und legte ihn auf die Erde. Er suchte Kastells Schwert, legte es ihm auf den Körper und faltete die steifen Finger um den Griff. Dann kniete er sich hin, flüsterte ein Gebet, bat ihn um Verzeihung und legte ein neues Gelübde ab. Und dieses werde ich unbeirrbar erfüllen, es sei denn, mich ereilt zuvor der Tod. Jael wird durch meine Hand sterben. Er zog einen Dolch aus seinem Gürtel, ritzte sich mit der Klinge die Handfläche und ließ das Blut auf Kastell tropfen.
Orgull trat neben ihn und senkte den Kopf.
»Jael hat ihn ermordet«, murmelte Maquin.
Orgull nickte. Das Licht aus den Schalen schimmerte blau in seinen Augen. »Jael schien diesem Calidus außerordentlich nahezustehen. Ich hätte es vorhersehen müssen. Die beiden haben sich für vieles zu verantworten.« Er strich nachdenklich über den Kriegerzopf, den er in sein blondes Haar geflochten hatte. »Das war mehr als nur eine Blutfehde zwischen Onkel und Neffe. Ich glaube, Jael hat es auf den Thron von Isiltir abgesehen.«
»Auf den Thron?«
»So ist es. Wie alt ist Romars Sohn, vielleicht zehn Sommer?« Orgull zuckte die Achseln. »Jael ist mit Romar blutsverwandt, wenn auch nur entfernt. Er hat Anspruch auf den Thron, sobald all jene beseitigt sind, die in der Erbfolge vor ihm stehen.«
»Wie zum Beispiel Romar«, sagte Maquin.
»Und er.« Orgull blickte nachdrücklich auf Kastell.
Maquin fuhr sich mit den Handballen über die Augen. »Dafür wird Jael bezahlen.«
Orgull musterte ihn. »Wenn ich recht habe, wäre die beste Rache, Jael den Thron von Isiltir zu versagen.«
»Ich ramme ihm lieber eine Klinge ins Herz«, erklärte Maquin.
»Und wenn du scheiterst? Wir wissen nicht, wie die Lage da oben ist, aber Jael hat ganz sicher Schildwachen um sich herum, und außerdem Calidus mit seinem Giganten und den Jehar. Sehr wahrscheinlich würdest du nicht einmal in seine Nähe kommen. Und Jael würde dann trotzdem den Thron besteigen. Das wäre dann keine besonders befriedigende Rache, oder?«
Maquin starrte Orgull böse an. Ihm war klar, dass der Mann recht hatte, aber er wollte die Wahrheit einfach nicht hören.
»Die Nachricht von Jaels Verrat muss nach Isiltir gelangen«, fuhr der Leutnant der Gadrai fort. »Ich werde nicht zulassen, dass unsere Schwertbrüder umsonst gefallen sind.« Orgull bückte sich neben Romar, hob das Schwert des toten Königs auf und wickelte es in einen Umhang. »Und ich habe dich nicht gerettet, um zuzusehen, wie du dein Leben wegwirfst, sobald wir oben rauskommen.«
»Du hast nicht über mein Leben zu bestimmen«, gab Maquin zurück. »Ich werde Jael töten.«
Orgull bückte sich ein wenig, um Maquin in die Augen zu sehen. »Ich brauche deine Hilfe. Hier steht mehr auf dem Spiel als nur die Rache für einen Mann. Bitte hilf mir, die Kunde von diesem Gemetzel nach Isiltir zu bringen.« Er hielt inne und sah Maquin an, dann schüttelte er den Kopf. »Ich schlage dir einen Pakt vor. Hilf du mir dabei, dann helfe ich dir ebenfalls. Wir werden zusammen dafür sorgen, dass Jael für seinen Verrat mit dem Leben bezahlt, oder aber wir werden bei dem Versuch gemeinsam sterben. Das schwöre ich bei unseren gefallenen Brüdern.«
Maquin holte tief Luft, während er über Orgulls Worte nachdachte. Der Vorschlag war klug. Wenn er jetzt versuchte, Jael anzugreifen, würde er wahrscheinlich bloß sterben, ohne irgendetwas zu erreichen. »Einverstanden«, flüsterte er und warf einen Blick auf Kastells Leichnam.
Sie umfassten sich an den Unterarmen, um den Pakt zu besiegeln.
»Natürlich müssen wir zuerst einmal lebend hier herauskommen«, meinte Maquin dann.
»Das stimmt. Bist du verletzt?«
»Es ging mir schon mal besser.« Sein linker Arm hing schlaff an der Seite herunter, das Gesicht war bleich und schweißgebadet. »Ich habe einen Schlag mit einem Streitkolben auf die Schulter bekommen.«
Orgull stellte sich hinter Maquin und tastete die Schulter und den Arm des Kriegers ab. »Sie ist nur ausgerenkt, nicht gebrochen. Hier, beiß da drauf.« Er reichte Maquin einen Lederriemen. Dann packte er die Schulter des Kriegers mit seiner großen Faust, legte die andere Hand zwischen Schulterblatt und Rückgrat und stieß dann einmal mit aller Kraft zu.
Es knackte laut, Maquin zischte und sackte zusammen.
»Benutz das nächste Mal statt der Schulter lieber deinen Schild, um so einen Schlag abzufangen«, riet ihm Orgull.
»Ich werde versuchen, daran zu denken.« Maquin spie den Lederriemen aus. Dann sank er auf ein Knie.
»Nimm dir, was du brauchst.« Orgull bückte sich und nahm einem gefallenen Krieger den Schild ab. »Wir müssen uns einen Weg hier heraus suchen.«
Es kostete Maquin einige Mühe, von Kastells Leichnam wegzugehen. Er sah sich suchend um. Dann trank er gierig aus seinem Wasserschlauch und füllte ihn aus den Schläuchen der Gefallenen wieder auf. Kurz danach fand er einen einfachen Holzschild mit eisenbeschlagenem Rand und einem Schildbuckel. Er wies Spuren der Schlacht auf, aber es waren nur Kratzer. Maquin hob ihn hoch, überprüfte die Riemen und schlang ihn sich auf den Rücken. Dazu wählte er noch einen Speer mit einem breiten Blatt aus.
Orgull hielt eine Axt in Händen. Sie hatte einem der Knochenkrieger der Giganten gehört, die man einst zurückgelassen hatte, um ihren König zu bewachen. Als Maquin ihn erstaunt ansah, schlug Orgull mit der Axt auf den Steinboden. Funken flogen auf, als die Klinge ein Stück aus dem Fels hackte. Rost rieselte von dem Blatt. Orgull fuhr mit dem Daumen über die Schneide und nickte zufrieden.
»Hast du vor, dir den Weg nach draußen frei zu hacken?«, wollte Maquin wissen.
»Wenn es sein muss, ja. Scharf genug ist sie dafür jedenfalls.« Orgull lächelte freudlos. »Allerdings habe ich nicht vor, den Vorderausgang zu benutzen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Calidus ihn unbewacht und offen gelassen hat. Wenn ich anfange, mit der Axt dagegen zu hämmern, wecke ich damit alle zwischen hier und dem Wald.«
»Richtig«, räumte Maquin ein.
»Siehst du diese Flammen?«
Maquin warf einen Blick auf die blauen Lichter. Einige flackerten und knisterten, als ein Windstoß hindurchfuhr.
»Suchen wir die Stelle, wo die Luft herkommt, und hoffen wir, dass es nicht nur eine Ritze in der Wand ist.«
Sie hörten ein ersticktes Stöhnen, das unter einer der zahlreichen Leichen hervorkam. Als Maquin den Körper eines Jehar-Kriegers beiseitezog, sahen sie zuerst zuckende Finger und dann einen Arm, der sich bewegte.
Er gehörte Tahir, einem ihrer Schwertbrüder von den Gadrai, einem jungen Mann, nicht viel älter als Kastell. Sie waren Freunde.
Sie befreiten ihn, untersuchten ihn auf Verletzungen, fanden jedoch nur eine große eiförmige Beule an seiner Schläfe. Der untersetzte Krieger hob einen seiner langen Arme und berührte die Schwellung mit den Fingern. Er zuckte zusammen.
»Was ist passiert?« Seine Augen schienen Schwierigkeiten zu haben, sich scharf zu stellen.
Orgull berichtete ihm von Jaels Verrat.
»Vandil?« Tahir erhob sich unsicher und blickte auf die Leichen um ihn herum.
»Tot. Abgeschlachtet von Calidus’ dressierten Giganten«, antwortete Orgull.
Tahir stieß einen Pfiff aus, schüttelte den Kopf und sah im selben Moment so aus, als würde er es bereuen. »Und was jetzt?«
»Wir suchen uns einen Weg aus diesem Rattenloch. Dann sehen wir weiter.«
Maquin improvisierte Fackeln aus den Schäften von Äxten und Speeren, umwickelte ihre Spitzen mit Tuchstreifen aus Umhängen und tauchte sie in die mit Öl gefüllten Schalen, die den Gang der toten Krieger säumten. Sofort flackerten sie in demselben blauen Licht.
Zusammen marschierten sie zum Rand der Kammer und suchten die Wände nach einem Durchgang ab. Es dauerte nicht lange, bis sie eine Öffnung fanden. Sie war von dichten Spinnweben verdeckt, die sich im Wind sacht hin- und herbewegten. Maquin hielt seine Fackel an das Netz. Blaue Funken knisterten und fraßen sich in einem immer größer werdenden Kreis hindurch, bis von dem Netz nichts mehr übrig war. Orgull warf den beiden einen Blick zu und trat dann in die Dunkelheit. Tahir folgte ihm.
Maquin zögerte und blickte in die Felsenkammer zurück. »Gehab dich wohl, Kastell.« Nach einem kurzen Moment biss er die Zähne zusammen und trat ebenfalls in den Gang.
Sie gingen schweigend voran, wobei das bläuliche Licht ihrer improvisierten Fackeln von den Wänden und der hohen Decke des Tunnels reflektiert wurde. Andere Gänge zweigten ab, und Maquin warf misstrauische Blicke in die undurchdringlichen Schatten. Immerhin befanden sie sich hier im Fornswald oder, besser gesagt, darunter, und der Forn war das finstere Herz derVerfemten Lande. Seine Bewohner waren im Allgemeinen recht unfreundlich. Und so wild wie Raubtiere.
Seine Gedanken kehrten wieder zu jenen zurück, die sie in der Kammer gelassen hatten, zu Vandil, zu seinen Schwertbrüdern der Gadrai, zu Romar und vor allem zu Kastell. Immer wieder sah er, wie Jael vor Kastell trat und ihn mit dem Schwert durchbohrte. Er hätte dichter bei ihm bleiben müssen. Tränen verschleierten ihm den Blick, und er wischte sich mit geballten Fäusten die Augen.
Dann erregte ein Geräusch seine Aufmerksamkeit. Es war ein Kratzen, das aus der Dunkelheit eines Seitengangs kam. Er starrte in die Finsternis und glaubte, unmittelbar außerhalb des Lichtkreises seiner Fackel eine Bewegung zu erkennen. Es war etwas Großes, das das Licht schwach reflektierte. Maquin zischte eine Warnung und zog sein Schwert.
»Was ist los?«, erkundigte sich Tahir, als Orgull zu ihnen trat.
»Irgendetwas ist da unten«, murmelte Maquin.
»Was ist es?«
»Ich weiß es nicht. Irgendetwas eben.«
Maquin ging in den Seitentunnel und hielt seine Fackel hoch. Die Dunkelheit wich vor dem Licht zurück, aber sie enthüllte nur blanken Fels.
»Jetzt ist jedenfalls nichts mehr da«, stellte Tahir fest.
»Kommt weiter«, befahl Orgull. »Tahir, du bildest die Nachhut.«
»Jawohl, Häuptling.«
Sie gingen weiter, etwas schneller als zuvor, und der Gang stieg steil an. Ein gutes Zeichen, dachte Maquin, dem der Schweiß den Rücken hinunterlief. Rauf ist erheblich besser als runter. Der Tunnel wurde außerdem schmaler, und die Decke senkte sich allmählich. Das ist allerdings kein gutes Zeichen. Wird der Gang einfach aufhören? Und was machen wir dann? Kurz danach blieb Orgull stehen. Er griff an die Decke des Gangs und fuhr mit den Fingern über eine Baumwurzel, die knotig und verdreht aus dem Felsen herausragte.
»Wir müssen dicht unter der Oberfläche sein«, meinte Maquin.
»Mittlerweile sind wir mehr als eine Wegstunde gegangen, schätze ich«, bemerkte Tahir.
»Allerdings. Ich vermute, dass wir Haldis hinter uns gelassen haben, aber viel weiter dürften wir noch nicht gekommen sein«, erklärte Maquin.