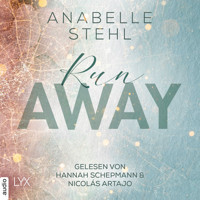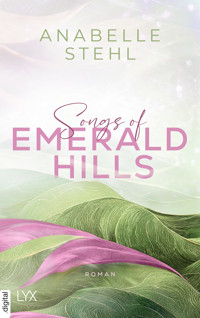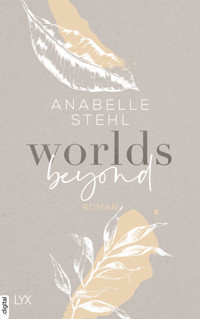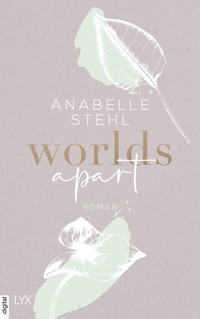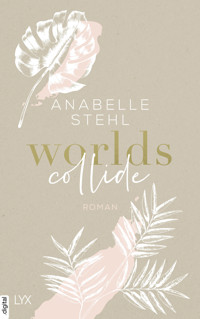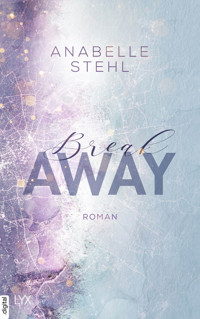
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Away-Reihe
- Sprache: Deutsch
Nur bei dir fühle ich mich frei ...
Für Lia bricht eine Welt zusammen, als ihr eine einzige Nacht zum Verhängnis wird. Nicht nur folgen ihr seitdem die Blicke und das Getuschel ihrer Kommilitonen überall auf dem Campus - selbst ihre Freundinnen wenden sich von ihr ab. Als sie es nicht länger erträgt, packt Lia kurzerhand ihre wichtigsten Sachen und setzt sich in einen Bus nach Berlin. Sie hofft, in dem anonymen Trubel der Hauptstadt einen klaren Kopf zu bekommen und wieder zu sich selbst zu finden. Doch dann trifft sie auf Noah, der ihre Welt von einem Moment auf den anderen ein weiteres Mal auf den Kopf stellt ...
"Erfrischend, gefühlvoll und wunderschön. Anabelle Stehl holt New Adult nach Deutschland!" Bianca Iosivoni
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 572
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leserhinweis
Widmung
Playlist
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
42. Kapitel
Epilog
Danksagung
Triggerwarnung
Leseprobe
Die Autorin
Die Romane von Anabelle Stehl bei LYX
Impressum
ANABELLE STEHL
Breakaway
ROMAN
ZU DIESEM BUCH
Endlich wieder durchatmen können – das ist alles, was Lia sich wünscht, als sie völlig überstürzt ihre Sachen packt und in den nächstbesten Bus nach Berlin steigt. Sie hat kein Ziel in der Stadt und auch keinen Plan. Aber sie erträgt das Getuschel und die Blicke nicht mehr, die ihr überall auf dem kleinen Campus ihrer Uni folgen, seit sie eines Nachts eine folgenreiche Entscheidung traf. Lia hofft, dass sie in dem anonymen Trubel der Hauptstadt wieder zu sich selbst findet und dass damit auch ihre größte Leidenschaft – das Filmen – zu ihr zurückkehrt. Doch schon bei ihrem ersten Stopp in Berlin – einem gemütlichen Café in der Nähe vom Alexanderplatz – trifft Lia auf Noah, der mit seiner offenen Art und seinem attraktiven Lächeln ihren Plan, sich erst einmal nur auf sich selbst zu konzentrieren, augenblicklich auf den Kopf stellt. Dabei hat Noah seine ganz eigenen Probleme: Nachdem sein Bruder in eine Schlägerei verwickelt war und daraufhin seinen Posten im Familienunternehmen aufgeben musste, setzt Noah nun alles daran, zu verhindern, dass seine Familie endgültig auseinanderbricht. Dennoch nimmt er sich die Zeit, Lia an seine Lieblingsplätze in Berlin zu führen und ihr die Stadt durch seine Augen zu zeigen. Und je näher sie sich kommen, desto schlechter fühlt sie sich, weil sie Noah nicht die ganze Wahrheit über das, was an ihrer alten Uni geschehen ist, erzählen kann …
Liebe Leser*innen,
dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Deshalb findet ihr hier eine Triggerwarnung.
ACHTUNG: Diese enthält Spoiler für das gesamte Buch.
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Anabelle und euer LYX-Verlag
Für meine Eltern.
Danke, dass ihr meine Familie seid.
Und für die PJS. Danke, dass ihr meine Familie wurdet.
PLAYLIST
Lennon Stella – Breakaway
Florence + The Machine – Hunger
Woodkid – Run Boy Run
Jessie Reyez – FIGURES
Bea Miller – feel something
Hozier – Movement
Arcade Fire – My Body Is a Cage
Shawn Mendes – A Little Too Much
Tom Walker – Leave a Light On
Gabrielle Aplin – Please Don’t Say You Love Me
Ava Max – So Am I
Passenger – Hell or High Water
Foo Fighters – The Pretender
Pitbull, Kesha – Timber
Backstreet Boys – Everybody
Taylor Swift – You Need To Calm Down
Athlete – Wild Wolves
Walking on Cars – Speeding Cars
Gary Go – Berlin
Dermot Kennedy – An Evening I Will Not Forget
Kesha – Praying
dodie – Burned Out
Billy Raffoul – You Be Love
Christina Aguilera – The Voice Within
Selena Gomez – Look At Her Now
Rachel Platten – Fight Song
1. KAPITEL
Lia
»Noch jemand nach Berlin? Nach Berlin bitte einsteigen!«, hörte ich von Weitem.
Ich sprintete an einer Gruppe von Schülern vorbei, stolperte fast über die Reisetasche einer jungen Mutter und kam schließlich schwer atmend vor dem roten Bus zum Stehen. Ich hätte gedacht, einmal die Woche Yoga wäre genug, um mich fit zu halten, aber mein Schnaufen und die Schmerzen in den Beinen teilten mir etwas anderes mit. Mit leicht zitternden Fingern öffnete ich den Reißverschluss meines Rucksacks und kramte in dem Chaos darin nach meinem Handy.
»Magst du mit?«, fragte mich der Mann, der eben noch über den Busbahnhof gerufen hatte und dessen Shirt vom gleichen Rot war wie der Bus.
Ich nickte, unfähig, eine klare Antwort zu formulieren, da mein Atem immer noch zu schnell ging und meine Zunge trocken am Gaumen klebte.
»Dann pack deinen Koffer da rein.« Er deutete auf die geöffnete Klappe an der Seite des Busses. »Flughafen auf die andere Seite, Alex gleich hier vorne rein.«
Ich schob meinen kleinen Koffer zu den anderen ins Innere des Busses und streckte dem Mann dann mein Smartphone entgegen, auf dem ich vor wenigen Minuten das Ticket gekauft hatte.
Er scannte den QR-Code, nickte mir knapp zu und schloss dann die Türen an der Seite des Busses, sodass mein Koffer außer Sichtweite verschwand.
Ich machte das hier wirklich. Wow. Mein Herz schlug kräftig weiter in meiner Brust, nur dass es jetzt nicht alleine an dem Sprint durch die morgendliche Sommerhitze lag, sondern ganz eindeutig an Aufregung. Und Angst. Denn die, so wurde mir gerade bewusst, hatte ich. Ich merkte erst, dass ich mich keinen Zentimeter gerührt hatte und nach wie vor auf die Kofferraumtür starrte, als sich ein roter Farbklecks in mein Sichtfeld bewegte und meine Aufmerksamkeit verlangte.
»Na, Fräulein, wenn du mitfahren magst, musst du auch einsteigen.«
»Entschuldigung«, murmelte ich, verbiss mir meinen Kommentar auf das »Fräulein« und schob die Daumen unter die Riemen meines Rucksacks. Ich konnte das hier. Nicht weil ich besonders mutig oder abenteuerlustig war, sondern schlicht und ergreifend, weil es keine Alternative gab. Ich musste das hier können.
Ich setzte den rechten Fuß auf die kleine Treppe, die ins Innere des Busses führte und blickte mich noch ein letztes Mal um. Alles, was ich sah, war der etwas heruntergekommene Busbahnhof dieser Kleinstadt, den ich so oft auf dem Weg zur Hochschule passiert hatte. Keine Ahnung, was ich erwartete. Vielleicht, dass sich dieser Moment besonders anfühlte, dass ich Wehmut spüren würde oder einen Abschluss. Erleichterung oder das aufregende Kribbeln eines Neuanfangs. Aber alles, was ich fühlte, war Gleichgültigkeit. Und so drehte ich mich wieder herum und setzte auch den linken Fuß auf die Stufe.
Ich war an Bord. Immerhin.
Der Bus war von ein paar Plätzen abgesehen ziemlich leer, sodass ich zwei Sitze für mich beanspruchen konnte. Eigentlich keine große Überraschung, schließlich war es ein Dienstagmorgen. Ich schob mich in eine Reihe im hinteren Teil des Busses und streifte mir den Rucksack von den Schultern. Mein T-Shirt klebte unangenehm am Sitz, obwohl es hier drinnen erfrischend kühl im Vergleich zu draußen war. Ich zog einen der Haargummis von meinem Handgelenk und drehte mir die langen kupferroten Haare zu einem unordentlichen Dutt auf den Kopf. Kühle Luft traf angenehm auf den feinen Schweiß in meinem Nacken.
Ich atmete tief durch. Ich schaffe das.
Nach Berlin waren es über vier Stunden mit dem Bus. Zum Glück. Je mehr Zeit ich hier drin verbrachte, desto mehr Distanz schaffte ich zwischen mir und diesem Ort. Der Bus gab ein tiefes Brummen von sich, als der Fahrer den Motor startete. Ich öffnete meinen Rucksack und kontrollierte noch ein letztes Mal, dass ich auch alles Wichtige dabeihatte: Portemonnaie, Ladekabel, Handy. Meine Hand fand wie automatisch ihren Weg an meinen Hals. Kamera. Ich atmete erleichtert aus und strich mit dem Daumen leicht über den Rand des Objektivs, als würde ich das Gerät beruhigen wollen. Dabei war in Wahrheit ich diejenige, die Beruhigung gebrauchen konnte. Sonst funktionierte das auch und das kalte Metall unter meinen Fingern erdete mich für gewöhnlich. In letzter Zeit jedoch trug es viel eher zu meiner Unruhe bei. So sehr sogar, dass ich die Kamera fast zu Hause gelassen hätte. In letzter Sekunde hatte ich mich aber doch noch umentschieden. Ob aus Hoffnung oder in dem naiven Versuch, Normalität zu wahren, wusste ich nicht. Mein Zeigefinger verharrte in der Bewegung und ich blickte nach unten auf die Kamera. Auf mein kreatives Ventil. Auf die Erinnerung an alles, was in letzter Zeit schiefgelaufen war. Ich umklammerte das Gerät, hob es an, befreite meinen Kopf aus dem Lederband und stopfte es in den unteren Teil meines Rucksacks unter ein kleines Handtuch. Sofort fühlte ich mich etwas leichter, was mich gleichzeitig traurig stimmte. Ich schloss den Rucksack und hoffte einfach, dass ich die wichtigsten Dinge dabeihatte oder würde nachkaufen können. Zum Überlegen war keine Zeit gewesen. Ich hatte alles an Kleidung, was noch einigermaßen tragbar aussah, in meinen Koffer gestopft, Make-up und Zahnbürste aus dem WG-Bad genommen und dann das Haus verlassen, bevor ich meiner Mitbewohnerin Lisa oder irgendjemandem aus dem Wohnheim in die Arme laufen konnte. Ich hatte keine Lust auf die Blicke gehabt. Oder noch schlimmer, auf die Frage von Lisa, wieso ich nicht an der Uni war und meine Klausur in Medienrecht schrieb.
Mit dem Blick aus dem Fenster zwang ich mich, an etwas anderes zu denken. Nicht daran, wie ich im Seminarraum auf das leere Blatt gestarrt hatte und einfach alles Gelernte weg gewesen war. Wie mein Stift in der Hand gezittert hatte, weil die geflüsterten Worte auf dem Gang viel zu laut in meinen Ohren widerhallten. In Dauerschleife. Bei dem Gedanken an die Blicke und das Tuscheln, als ich aufgesprungen und aus dem Seminarraum gelaufen war, zog sich mein Bauch schmerzhaft zusammen und mir wurde flau im Magen. Ich atmete tief ein und wieder aus und versuchte, mich zu beruhigen. Ich war jetzt hier, in diesem Bus. Und mit jeder Sekunde bewegte er sich weiter von der Hochschule weg. Von meinen Kommilitonen. Von den Blicken und dem Gerede. Alles, was ich wollte, war eine Auszeit. Ein paar Wochen Ruhe in einer Stadt, in der mich niemand kannte. Ich schob mir die Kopfhörer in die Ohren und startete meine Playlist. Zu Florence + The Machine konzentrierte ich mich mit all meinen Gedanken auf Berlin und das, was vor mir lag. Denn genau darum ging es bei diesem Trip doch: alles hinter mir zu lassen und endlich, endlich wieder nach vorne zu schauen.
»Flughafen Schönefeld«, riss mich die tiefe Stimme des Busfahrers aus dem Schlaf. Ich wischte mir die Strähnen aus dem Gesicht, die sich aus dem Dutt gelöst hatten, und streckte mich, so gut es in der engen Sitzreihe ging. Meine Schulter knackte und mein Hals fühlte sich unangenehm steif an. Ich hatte keine Ahnung, wann genau ich eingeschlafen war, aber offensichtlich hatte ich mein Ziel fast erreicht. Durch das Fenster konnte ich die vielen Menschen beobachten, die in den Flughafen eilten oder den überdachten Weg vom Terminal zur S-Bahn liefen. Wie gern ich ebenfalls einfach in ein Flugzeug gestiegen und ans andere Ende der Welt geflogen wäre. Aber sowohl mein Kontostand als auch das schlechte Gewissen meiner Mutter gegenüber hatten mir einen Strich durch die Rechnung gemacht. Na ja, und die Tatsache, dass ich bis heute Morgen gar nicht vorgehabt hatte, mein Zuhause zu verlassen. Da ich zwei Wochen lang das Haus gar nicht verlassen hatte, war eine Fahrt quer durchs Land für mich ein Meilenstein.
»Nächster Halt: Alexanderplatz. Wir kommen um etwa 15:30 Uhr an. Nehmen Sie bitte wieder Platz und schnallen Sie sich an.«
Ich reckte ein letztes Mal die Arme in die Höhe und befreite dann das Kabel meiner Kopfhörer aus der Lücke zwischen den beiden Sitzen. Irgendwann im Schlaf hatten sie sich wohl verabschiedet. Ich entsperrte mein Smartphone und wollte gerade wieder meine Musik starten, als mein Blick über die anderen Apps schweifte. Facebook. Instagram. Twitter. In der oberen rechten Ecke prangten Zahlen in kleinen roten Kreisen, die neue Nachrichten ankündigten. Etliche neue Nachrichten. Die bunten Logos der Apps brannten sich in meine Augen, mein Finger schwebte regungslos über dem Display. Dann senkte ich meinen Daumen auf das pink-lilafarbene Viereck, das einer Kamera ähnelte und so lange mein kreatives Ventil gewesen war. Ich widerstand dem Drang, mir die neuen Benachrichtigungen anzeigen zu lassen – Direct Messages, Kommentare, ich ignorierte alles. Stattdessen tippte ich auf mein Profilbild, scrollte durch die Einstellungen und klickte durch den Hilfebereich der App, bis ich endlich das fand, wonach ich suchte. Ohne zu zögern, landete mein Finger auf dem Link, unter dem ich mein Konto dauerhaft löschen konnte. Ich spürte ein kleines aufgeregtes Kribbeln in der Magengegend, das sich überraschend angenehm anfühlte. Angespornt von dem Gefühl wiederholte ich den Vorgang für meine anderen sozialen Kanäle. Es waren nur wenige Klicks und es hatte sich nicht wirklich etwas verändert, aber ich spürte dennoch, wie eine unsichtbare Last von meinen Schultern genommen wurde. Dann fiel mein Blick auf WhatsApp. Nur wenige Leute hatten meine Handynummer, es gab keine neuen Nachrichten. Dennoch öffnete ich die App, scrollte etwas nach unten und klickte auf den Chat mit Alexander. Alexander, dem ich fälschlicherweise vertraut hatte. Ich merkte, wie sich das Kribbeln in meinem Bauch in Wut verwandelte, die nur noch verstärkt wurde, als ich seine letzte Nachricht las.
Wir müssen reden. Bitte.
Beinahe hätte ich laut aufgelacht. Ich wollte nicht reden. Er war schuld, dass ich überhaupt hier war. Ich hatte die Nachricht unbeantwortet gelassen. So wie die Nachrichten davor. Mir wurde schon schlecht, wenn ich nur seinen Namen las. Jetzt jedoch tippten meine Finger eine Antwort.
Lass mich in Ruhe. Lösch meine Nummer.
Ich drückte auf Senden. Dann klickte ich auf seinen Namen über dem Chatverlauf, scrollte nach unten und blockierte Alexander. Geräuschvoll atmete ich aus und hoffte, dass all das reichen würde. Ich startete meine Musik, lehnte den Kopf an die Scheibe und beobachtete die vorbeiziehende Landschaft draußen. Die Felder waren gelblich verfärbt, als könnten sie dringend etwas Regen vertragen. Während ich der vorbeiziehenden Landschaft zusah, beruhigte sich mein Herzschlag langsam wieder. Und obwohl man das Umland Berlins wohl kaum als idyllisch oder pittoresk bezeichnen konnte, war der Anblick für mich traumhaft schön. Weil er bedeutete, dass ich es geschafft hatte. Ich war weg. Und konnte zumindest für eine Weile atmen, alles hinter mir lassen und so tun, als wäre nichts geschehen.
Die vorbeirauschenden Bäume und Häuser wirkten so hypnotisierend auf mich, dass meine Augen ohne mein Zutun wieder zufielen – bis ich eine Sekunde später jäh zusammenzuckte, als ein lautes Hupen ertönte, das sogar durch meine Kopfhörer den Weg in mein Trommelfell fand. Ich sah, wie der Busfahrer in einer rüden Geste eine Hand durchs Fenster streckte. Dann wechselte der Bus auf die rechte Spur. Beim Blick über die Schulter konnte ich gerade noch erkennen, wie sich ein dunkelroter Opel mit ungesund klingendem Motor und fetter Delle in der rechten Hintertür links am Bus vorbeischob. Der Mann auf der Beifahrerseite trug eine Sonnenbrille und schüttelte sichtlich genervt den Kopf, als der Wagen den Bus überholte. Auf Höhe des Busfahrers hupte er erneut, dann raste er, vermutlich ohne die Geschwindigkeitsbegrenzung zu beachten, davon.
»Idiot«, murmelte ich stumm, lehnte mich zurück und beobachtete, wie die Umgebung immer städtischer wurde, bis sich schließlich Hotels mit kleineren Geschäften abwechselten. Menschen liefen geschäftig an ihnen vorbei, ohne ihr Glück zu begreifen, in einer so großen, pulsierenden und vor allem anonymen Stadt zu leben. Gleich würde ich endlich mein Ziel erreichen und, zumindest für eine Weile, zu ihnen gehören. Zum ersten Mal seit Wochen hatte ich das Gefühl, dass ich mich wieder vorwärtsbewegte, anstatt wie ein Hamster im Rad zu strampeln und trotz der körperlichen Anstrengung kein Stück voranzukommen.
Ich zog meinen Koffer aus dem seitlichen Gepäckfach und verabschiedete mich vom Busfahrer, der allerdings schon umgekehrt war, um einen Kollegen zu grüßen. Mit der freien Hand schützte ich meine Augen vor der Sonne, während ich mich umsah, die andere hielt meinen Koffer fest umklammert. Ich legte den Kopf in den Nacken und ließ meine zusammengekniffenen Augen den Fernsehturm hinaufwandern. Dann schweifte mein Blick weiter über den Alexanderplatz, den ich bisher nur aus dem Fernsehen kannte. Wir waren nie viel gereist und obwohl ich das immer vorgehabt hatte, hatten sich diese Pläne nach der Trennung meiner Eltern geändert. Ich konnte und wollte meine Mutter nicht auch noch alleine lassen. Also fiel die Wahl ganz automatisch auf eine Hochschule in ihrer Nähe. Ich unterdrückte das schlechte Gewissen, das mich bei diesen Gedanken sofort heimsuchte. Zumindest ihr hätte ich Bescheid geben sollen. Aber dann hätte sie eine Erklärung verlangt und die konnte ich ihr nicht geben.
Ich schüttelte die lästigen Gedanken ab und betrachtete die Szenerie vor mir. Menschentrauben standen an der Ampel zu meiner Linken, gelbe Straßenbahnen fuhren ratternd an ihnen vorbei, kleine Buden rahmten den Platz und die Sonne ließ die Hitze vom Boden aufsteigen. Es roch nach frittiertem Essen, Abgasen und Sommer. Es war laut. Und alle gingen einfach ihres Weges, ohne mir Beachtung zu schenken. Ich liebte es.
Meine Hände glitten wie automatisch an die Stelle unter meiner Brust, an der normalerweise meine Kamera an ihrem Lederband baumelte. Erst als meine Finger den Stoff meines Shirts berührten, fiel mir auf, dass das Gewicht in meinem Nacken fehlte. Kurz verspürte ich Wehmut. Normalerweise würde die Linse die Szene, die sich vor meinen Augen abspielte, für immer festhalten. Immer, wenn ich filmte, betrachtete ich meine Umgebung mit anderen Augen. Nahm sie in all ihren Facetten wahr. Meine Kamera war nicht nur mein Ventil, sie half mir auch, mehr im Jetzt zu leben. Innezuhalten in einer schnellen Welt, diese Geschwindigkeit einzufangen und mit jedem erneuten Zuschauen etwas zu entdecken, was mir sonst entgangen wäre. Unsere Augen mochten die besten Linsen sein, aber unser Gehirn filterte notwendigerweise alles und sortierte aus, was es für unnötig erachtete. Eine Kamera hingegen war in der Lage, jedes noch so kleine Detail für alle Ewigkeit auf einer Speicherkarte festzuhalten – Bild, Ton, Bewegungen und Emotionen. Sie fing Erinnerungen nicht nur ein, sie schaffte neue, indem sie auch zeigte, was wir sonst nicht wahrgenommen hätten.
Ich ließ meinen Blick über die nun ungefilmten Szenen wandern, wie es sonst die Linse meiner Kamera getan hätte. Jetzt erst sah ich, dass die Kugel des Fernsehturms die Sonne in einem kreuzförmigen Muster reflektierte. Jetzt erst bemerkte ich die drei Kinder, die auf dem Parkplatz auf der gegenüberliegenden Straßenseite Hüpfkästchen spielten.
Es fühlte sich sonderbar an, diese Szenen nicht festhalten zu können, als würde mir die Erfahrung wie Sand durch meine Finger rinnen. Aber es war schön, Momente wie diesen wieder wahrzunehmen. Wieder zur Kamera greifen zu wollen. Vielleicht würde ich genau das in meiner Zeit hier ja wieder tun. Meine Mundwinkel schoben sich leicht nach oben. Es mochte noch nicht für ein Lächeln reichen, aber es war ein Anfang.
Ich atmete die warme Luft ein und stieß sie hörbar wieder aus.
Und jetzt?
Unschlüssig stand ich mit meinem Rucksack und dem kleinen Koffer vor der Grünfläche, an der mich der Bus rausgeworfen hatte. Ich mochte wenig Gepäck haben, aber was ich noch viel weniger hatte, war ein Plan.
2. KAPITEL
Noah
Er sah richtig scheiße aus. Die Leute sagten immer, Elias wäre eine etwas zu groß geratene, ältere Version von mir, aber meine Fresse: Er sah nach wie vor groß und muskulös aus, die eingefallenen Wangen jedoch waren neu. Seine Augen waren noch genauso hellbraun wie meine, doch unter ihnen lagen dunkle Schatten. Wo er sonst nur wenige Stoppeln erlaubte, bevor er zum Rasierer griff, war ihm ein Bart gewachsen, etwas heller als sein braunes Haar. Es sah nicht einmal schlecht aus, doch alles an meinem Bruder wirkte plötzlich stumpf und glanzlos. Als läge ein Filter über ihm, der allem ein wenig Farbe entzog.
Elias unterbrach meine Musterung, indem er sich mit beiden Händen über das Gesicht fuhr und mir somit den Blick auf die so offensichtlichen Veränderungen nahm.
»Sieh mich nicht so an. Ich weiß«, seufzte er, rieb sich noch einmal die Stelle zwischen den Augen und sah dann wieder zu mir.
»Sorry«, murmelte ich. »Hat dir Mama noch nicht damit in den Ohren gelegen, dass du dich mal rasieren solltest?«
Elias lachte kurz auf und schüttelte leicht den Kopf.
»Was?«, fragte ich irritiert.
»Ich dachte, sie hat dir erzählt, was passiert ist. Oder wieso bist du hier? Glaubst du wirklich, unsere Eltern lassen sich grad hier blicken?« Er verschränkte die Arme vor der Brust und sah mich mit hochgezogenen Augenbrauen an.
Ich stutzte. Das konnte er doch nicht ernst meinen. »Sie hat erzählt, dass ihr Streit hattet. Nicht, dass ihr nicht mehr miteinander redet.«
»So kann man es auch nennen«, murmelte er. »Und was genau führt dich hierher? Solltest du nicht gerade in Bolivien oder Argentinien oder so sein?«
Ich schnaubte. »Als ob ich unter diesen Umständen dortbleiben könnte. Ich wäre schon früher gekommen, aber ich habe erst am Freitag erfahren, was passiert ist.«
Ich hatte immer noch nicht verdaut, dass unsere Eltern nicht nur Elias aus der Firma geworfen, sondern auch den Kontakt zu ihm abgebrochen haben sollten. Und mir tagelang verschwiegen hatten, was vorgefallen war. Ich hätte für Elias da sein müssen. Stattdessen hatte ich nichts ahnend Tausende Kilometer entfernt mein Leben gelebt und Elias’ Antworten auf meine Nachrichten klangen, als wäre alles in Ordnung.
Wenn ich mir das Chaos, das in seiner Küche herrschte, so betrachtete, seine glanzlosen Augen, war ganz und gar nichts in Ordnung. Ich nahm einen Schluck Wasser und schluckte meine Frustration gleich mit hinunter. Hätte meine Mutter sich nicht am Telefon verraten, würde ich wohl immer noch unwissend am anderen Ende der Welt sitzen. Sie hatte es klingen lassen, als wäre das Ganze nur halb so wild, und mich davon abbringen wollen, zurück nach Deutschland zu fliegen. Als ob ich mich noch auf etwas anderes hätte konzentrieren können.
»Du hättest deine Reise nicht abbrechen sollen. Es ist nicht so, als könntest du hier etwas ändern«, sagte nun auch Elias. »So habe ich nur eine Sache mehr, die ich auf die lange Liste meines schlechten Gewissens schreiben kann.«
Elias’ breite Schultern sackten noch ein wenig weiter nach unten, was ich kaum für möglich gehalten hätte. So kannte ich ihn nicht. Lebensbejahend, positiv, rebellisch und über alle Maßen loyal, das war mein Bruder. Nicht dieses personifizierte Häufchen Elend, das scheinbar jegliche Hoffnung aufgegeben hatte.
»Das ist doch scheiße, Mann«, stieß ich frustriert aus.
»Spar dir den Atem«, sagte Elias deutlich gefasster. »Wut hat mich auch nicht weitergebracht.«
»Und du nimmst das einfach so hin? Wie lange soll das bitte so weitergehen? Mama und Papa können doch nicht ewig sauer auf dich sein.«
Elias hob die Schultern. »Schätze, das hängt ganz davon ab, ob Rothe junior wieder der Alte wird.« Er stieß ein verächtliches Schnauben aus. »Wobei ich nicht weiß, ob ich darauf hoffen sollte.«
Nein, so kannte ich meinen Bruder ganz und gar nicht.
»Was ist in der Nacht genau passiert? Wieso hast du Christopher angegriffen?«, wiederholte ich die Worte, die ich bereits am Telefon an ihn gerichtet hatte und die mich seit dem Anruf meiner Mutter Tag und Nacht beschäftigten.
Jetzt konnte ich beobachten, was ich zuvor nur Elias’ Stimme am Telefon entnehmen konnte: Er machte dicht. Die Arme erneut vor der Brust verschränkt, blickte er mir direkt in die Augen.
»Ich war betrunken, wir hatten Streit, es gab eine Schlägerei. Ende der Geschichte.«
»Die du begonnen hast?« Denn das konnte ich mir kaum vorstellen.
»Offensichtlich. Wie gesagt, ich war betrunken. Ich erinnere mich nicht mehr an Details.«
Frustriert rieb ich mir über das Gesicht.
»Elias, wenn du nicht mit mir redest, kann ich dir nicht helfen.«
»Richtig, du kannst mir nicht helfen.« Seine Züge wurden sanfter und die Wärme kehrte in seine braunen Augen zurück. »Noah, du bist mein kleiner Bruder. Wenn überhaupt, sollte ich dir helfen.«
»Ich bin nur ein Jahr jünger«, murmelte ich genervt.
Elias streckte einen Arm über den Küchentisch und legte mir seine Hand auf die Schulter. »Mama und Papa haben deutlich gemacht, dass ich mich bei ihnen gerade nicht blicken lassen brauche. Es liegt nicht an dir, das hier zu fixen. Du warst ja nicht einmal dabei.«
»Es tut mir leid«, begann ich, aber Elias hob die Hand.
»Das war nicht als Vorwurf gemeint.«
»Und was machst du jetzt? Suchst du dir einen neuen Job? Studierst du einfach nur?« Ich hielt inne. »Das Geld haben sie dir nicht gestrichen, oder?«
Elias schwieg.
»Was?«, fragte ich.
»Ich werd erst mal nicht zur Uni gehen.«
»Wie bitte? Aber du hast deinen Bachelor fast.«
Elias lächelte grimmig. »Ist ja nicht so, als bräuchte ich ihn, wenn ich jetzt eh nicht in der Firma anfangen kann.«
»Dann fängst du woanders an. Außerdem kriegen wir Mama und Papa mit Sicherheit überzeugt. Du kannst doch nicht einfach die Uni abbrechen.« Das konnte Elias nicht ernst meinen. Er liebte sein Studium und hatte genauso hart für seine Noten geackert wie ich. Wenn nicht härter.
»Ich hab ja nichts von Abbrechen gesagt. Vielleicht nehme ich ein Urlaubssemester.«
»Aber wieso?«, fragte ich.
Elias seufzte und rieb sich erneut über das Gesicht und massierte mit den Fingern seine Nasenwurzel, als bereitete ihm unser Gespräch Kopfschmerzen.
»Weil ich jetzt erst einmal rausfinden muss, wie es weitergehen soll. Das wäre mein Praxissemester in der Firma gewesen. Auf die Schnelle finde ich keinen anderen Betrieb, der mich nimmt. Und der Deal ist, dass ich erst mal nicht in die Firma zurückkomme«, sagte er nun leiser.
»Der Deal?«
Ich wartete darauf, dass Elias weitersprach, aber in der Küche war nichts zu hören außer dem leisen Summen des Kühlschranks und dem Rauschen des Verkehrs, das durch das geöffnete Fenster drang.
»Was für ein Deal?«, fragte ich erneut.
Elias gab ein genervtes Geräusch von sich. »Der Deal, dass die Geschäfte zwischen Rothe und uns weitergehen, wenn ich mich von Christopher und seiner Familie fernhalte und von allen Projekten abgezogen werde. Also, so richtig fernhalte. Nicht nur ein bis zwei Wochen, sondern langfristig. Dass ich dort dieses Semester für meine Credits arbeiten kann, kann ich also vergessen. Aber wen kümmert’s, ich hab ja nur jahrelang darauf hingearbeitet«, endete Elias mit sarkastischem Ton.
»Das willst du einfach so hinnehmen?« Ich konnte und wollte es nicht glauben. Dass Elias das getan haben sollte und noch viel weniger, dass er und meine Eltern einem solchen Deal zugestimmt hatten. Denn leider machte diese Tatsache die erste realer: Wieso sollten sie bei so etwas Absurdem zustimmen, wenn Elias nicht wirklich auf Christopher losgegangen wäre?
»Ich finde etwas Neues. Und je nachdem, was mit Christopher ist, kann ich mit etwas Zeit zurück in den Betrieb kommen. Uns bleibt einfach nichts anderes übrig, als abzuwarten, okay?« Elias drückte meine Schulter und lächelte mir zu, aber es erreichte seine Augen nicht.
Ich schaltete durch die einzelnen Radiosender und drehte die Musik auf, bis sie lauter als meine kreisenden Gedanken war. Dann kurbelte ich das Fenster herunter, damit wenigstens etwas frische Luft in den aufgeheizten Wagen drang.
»Sicher, dass du nicht reden magst?« Daniel, mein bester Freund, Mitbewohner und nun auch Chauffeur, musterte mich mit kritischem Blick. »Du warst ganz schön schnell fertig da drinnen.«
»Ich wünschte, dein Auto hätte Bluetooth«, murmelte ich und ignorierte Daniels Frage. Ich drückte ein paar weitere Knöpfe und blieb letztendlich bei irgendeinem Chartsender hängen.
»Hey, nichts gegen Betty«, sagte Daniel und streichelte das Lenkrad seines in die Jahre gekommenen Opel Corsa. »Sonst setz ich dich aus und du kannst die S-Bahn nach Frohnau nehmen.«
Als ich nicht reagierte, warf Daniel mir erneut einen kurzen Blick zu. »Also …?«, fragte er gedehnt.
Ich senkte den Kopf gegen das Sitzpolster und seufzte. »Ich hab nichts zu erzählen, was ich dir nicht auch schon am Telefon gesagt hab. Der Besuch bei Elias hat rein gar nichts gebracht.«
»Tut mir leid«, sagte Daniel. »Aber um der Situation was Gutes abzugewinnen: Ich bin echt froh, dass du zurück bist.«
Ich lächelte leicht. Daniel war mein bester Freund seit Kindertagen, und wir teilten uns in Berlin eine Wohnung. Es wäre der erste Sommer seit Jahren gewesen, den wir nicht zusammen verbracht hätten. Insofern war das tatsächlich ein kleiner Trost.
»Viel wichtiger«, begann ich und drehte das Radio schlagartig leiser. »Shit, ich hab es echt fast vergessen: Wie war dein Casting?«
Daniel atmete laut aus und antwortete nicht. Stattdessen schaltete er endlich den Motor des Wagens ein und blinkte links, um sich in den Verkehr einzufädeln. Noch wenige Minuten vor dem Boarding meines Rückflugs hatte er mir von dem Casting erzählt, an dem er teilnehmen würde. Irgendeine Band suchte einen neuen Drummer. Sie hatten sogar schon in einigen namhaften Clubs gespielt. Seit wir uns kannten, wollte Daniel nichts anderes als Musik machen, und so aufgekratzt, wie er am Telefon gewesen war, wunderte es mich, dass er eben nicht sofort damit rausgeplatzt war.
»Es war … okay?«, sagte er.
»War das eine Frage?«
»Sicher, dass wir darüber reden wollen?«, fragte Daniel. »Du warst zwar nur zwanzig Minuten bei deinem Bruder in der Wohnung, aber ihr habt euch doch sicher unterhalten?«
»Glaub mir, ich kann mir gerade nichts Schöneres vorstellen, als nicht daran denken zu müssen.« Ich drehte mich leicht im Beifahrersitz, um Daniel besser ansehen zu können.
»Wie war das Casting? Hast du die anderen Bandmitglieder schon alle kennengelernt?«
Und mit diesen zwei Fragen schien der Damm gebrochen. »Es war so gut«, begann Daniel. »Also nicht ich, keine Ahnung, ob ich gut war. Aber die anderen sind alle so nett! Und Felix, der Sänger, schreibt die Lieder bisher alle selbst. Als ich gesagt hab, dass ich auch manchmal schreibe, wollte er direkt was sehen. Es wäre so, so cool, wenn das klappt, Noah.«
Ich ließ den Kopf wieder nach hinten an die Kopfstütze fallen, hörte lächelnd Daniels Erzählungen zu und beobachtete, wie der schleichende Verkehr Kreuzbergs am Fenster vorbeizog. Es war gut, dass Daniel mich nach seinem Casting am Flughafen abgeholt hatte. Seine Anwesenheit vertrieb die lästigen Gedanken zwar nicht, sorgte aber dafür, dass ich mich zusammenriss. Durch den Besuch bei Elias war ich noch völlig durch den Wind und hatte es nicht gerade eilig, heim zu meinen Eltern zu fahren. Ich war angefressen. Mein Bruder vertraute mir anscheinend nicht genug, um mir die ganze Wahrheit zu erzählen. Denn ich war mir sicher, dass in der Nacht seiner Verhaftung mehr geschehen war als eine durch Alkohol ausgelöste Partyschlägerei. Noch wütender war ich, dass meine Eltern es nicht für nötig gehalten hatten, mir direkt Bescheid zu sagen. Am Telefon hatte meine Mutter erklärt, sie hätte mir meine Zeit im Ausland nicht verderben wollen. Das hielt ich allerdings für eine lahme Ausrede, schließlich waren meine Eltern von Anfang an nicht begeistert von meinen Reiseplänen gewesen. Ihrer Meinung nach hätte ich das Praxissemester, genau wie mein Bruder, gleich in unserer Firma machen können – oder aber, wenn ich schon reisen musste, in Europa, um nebenbei zahlende Kundschaft akquirieren zu können. Aber Südamerika? Fehlanzeige. Trotzdem hatten sie mich letzten Endes finanziell unterstützt.
Aber Kyra – wieso hatte Kyra nicht wenigstens etwas gesagt? Meine Schwester stand mir vielleicht nicht so nahe wie Elias, aber wir hatten dennoch ein gutes Verhältnis. Und gerade, wenn es um unsere Eltern ging, hielten wir Geschwister zusammen. Immer. Zumindest hatte ich das geglaubt. Denn bisher hatte sie auf keine meiner Nachrichten geantwortet.
Ich wurde jäh aus meinen Gedanken gerissen, als Daniel auf die Bremse trat. Der Gurt schnitt in meine Schulter, als mein Oberkörper durch den abrupten Tempowechsel nach vorne fiel. Der rote Bus vor uns war, ohne zu blinken, auf die linke Spur gewechselt und versuchte nun im Schneckentempo, einen Rollerfahrer zu überholen.
»Idiot«, zischte Daniel neben mir und drückte entnervt auf die Hupe. »Deshalb fahr ich nie in der Stadt.«
Wie aus Protest wurde der Bus noch langsamer, um sich dann schleichend wieder rechts einzuordnen und uns endlich überholen zu lassen. Jedoch nicht ohne einen uns durchs Fenster entgegengestreckten Mittelfinger des Busfahrers.
Daniel klopfte im Vorbeifahren kurz auf die Hupe und ich zog nickend meine Sonnenbrille wie zum Gruß, was der Busfahrer mit einem Kopfschütteln quittierte. Dann drückte mein bester Freund das Gaspedal durch und brachte mich, so schnell es sein Auto erlaubte, näher zum Haus meiner Eltern – und zu der Konfrontation, die dort auf mich wartete.
3. KAPITEL
Lia
Und jetzt?
Da war ich also. Zum ersten Mal kamen mir Zweifel an meinem Plan. Wobei Plan die falsche Bezeichnung war, denn er bestand nur aus einem Wort: Berlin. Das war’s. Aber auch wenn es ungeplant und unfreiwillig geschehen war, hatte ich es immerhin aus meiner Komfortzone herausgeschafft. Wie meine Mitbewohnerin Lisa es mir seit Tagen gepredigt hatte. Am Ende hatte sie sogar gedroht, meine Mutter anzurufen, wenn ich nicht endlich wieder das Haus verließ. Nur hatte sie vermutlich nicht gemeint, dass ich gleich die Stadt verlassen und ans andere Ende Deutschlands fahren sollte. Der Bus war mittlerweile abgefahren, und ich stand immer noch mehr oder weniger an der gleichen Stelle. Durch meine Kurzschlussreaktion heute Morgen war mir nicht einmal Zeit geblieben, mir ein Hotel oder Airbnb zu suchen. Ich hatte nichts.
»Ups, sorry!«, rief eine Stimme hinter mir im gleichen Moment, als jemand an meine Schulter stieß. Der Kerl, der mich angerempelt hatte, hielt in der einen Hand ein Longboard und in der anderen einen Kaffeebecher. Er warf mir ein entschuldigendes Lächeln zu, wodurch sich ein Grübchen in seiner rechten Wange abzeichnete. Eilig winkte er mir nur noch einmal entschuldigend zu, bevor er auf sein Longboard sprang und kurz darauf um die Ecke bog. Der Geruch seines Kaffees blieb. Ich beschloss, es als Wink des Schicksals zu sehen – außerdem war Kaffee immer eine gute Idee – und wandte mich in die Richtung, aus der er gekommen war. Während ich der Straße folgte, beobachtete ich die Menschen, die hier alle ihr Leben lebten: Familien mit Kindern, Berufstätige in ihrer Mittagspause, Schulkinder auf dem Heimweg, Studenten an Laptops in Bistros. Sicher hatten auch sie mit ihren eigenen Problemen zu kämpfen, aber von außen betrachtet wirkte alles wie ein friedliches, lebendiges Zusammenspiel. Vielleicht war diese spontane Reise ja genau das, was ich brauchte. Vielleicht konnte ich zumindest für die nächsten paar Wochen mitspielen, meine Probleme zurücklassen und einfach nur leben.
Es brauchte noch weitere fünfzehn Minuten, bis meine Augen auf eine Klapptafel fielen, die am Rand des Bürgersteigs aufgestellt war. Aus der Tür strömte der verlockende Duft von Kaffee und im Gegensatz zu den anderen Cafés, die ich auf dem Weg gesehen hatte, war drinnen sogar noch Platz. Die langen Bänke mit Sitzkissen draußen vor dem Fenster waren unbesetzt. Kein Wunder bei der prallen Hitze. In der Hoffnung auf WLAN und Koffein betrat ich den Laden. Eine kleine Glocke ertönte und kündigte mich an.
»Hey!«, begrüßte mich eine fröhliche Stimme, »bin sofort da.«
Die Stühle und Sessel im Café passten alle nicht zusammen. In der hinteren Ecke standen zwei Schaukelstühle neben einem breiten Bücherregal, das von oben bis unten gefüllt war. Die rechte Wand aus roten Backsteinen passte so gar nicht zur weißen Außenfassade des Gebäudes und überall standen und hingen Pflanzen. Auf einem der runden Tische stand ein großer, kupferfarbener Globus. Diesmal registrierte ich das Zucken meiner Finger und stoppte sie in der Bewegung, bevor sie zu der leeren Stelle vor meiner Brust greifen konnten. Ich verdrängte den Gedanken und betrachtete stattdessen die Auswahl in der Kuchentheke. Neben einfachen Scones gab es Muffins, Käsekuchen und einige Torten, die mir das Wasser im Mund zusammenlaufen ließen. Ich war verliebt.
»Du guckst wie ich, als ich das erste Mal hier reingekommen bin.«
Ich blickte auf und sah in ein freundlich lächelndes Gesicht, in dem sich strahlend weiße Zähne und ein goldenes Nasenpiercing von gebräunter Haut abhoben.
»Ich würde am liebsten alle nehmen«, erwiderte ich. »Kannst du einen davon empfehlen?«
Die junge Frau lachte. »Tatsächlich alle«, sagte sie. Dann zeigte sie auf einen roten Kuchen mit weißem Frosting. Die Ringe an ihren schlanken Fingern reflektierten das durchs Fenster hereinfallende Licht. »Aber der Red Velvet Cake ist mein liebster. Die meisten Kuchen werden morgens geliefert, aber den hier macht Karl, der Besitzer, jeden Tag selbst.«
»Dann nehm ich einen davon und einen Flat White.«
Das Lächeln der Frau verstärkte sich noch und brachte ihre dunklen Augen zum Strahlen. »Cool. Setz dich schon mal, ich bring’s dir an den Tisch.«
Ich hatte gerade den Rucksack unter meinem Sessel verstaut, als sie auch schon das Stück Kuchen vor mir auf den Tisch stellte. Jetzt erst sah ich die pinkfarbenen Spitzen ihres dunklen Haars, das in einem Pferdeschwanz bis zu ihren Schultern reichte. Abgesehen davon, dass sie mir mit ihrer herzlichen Art sowieso gleich sympathisch war, konnte ich nicht anders, als ihren Stil zu bewundern. Sie trug kurze, zerfranste Hotpants, in denen ein lockeres weißes Shirt steckte, und um die Hüften hing ein rot kariertes Hemd. Das Ganze hatte sie trotz der Hitze mit klobigen schwarzen Boots mit Nieten kombiniert. Sie sah aus, als wäre sie einem Fashion Board auf Pinterest entsprungen.
»Dein Flat White kommt sofort.« Sie bemerkte meinen Blick und sah mich mit erhobenen Augenbrauen an. »Alles okay?«
»Ja, entschuldige.« Ich lächelte. »Ich habe nur gerade beschlossen, dass du meine neue Stilikone bist.«
Zum dritten Mal in der kurzen Zeit schenkte sie mir ein strahlendes Lächeln, und ich fragte mich, ob es irgendjemanden gab, der diese Frau nicht auf Anhieb mochte.
»Oh, danke. Alles secondhand von einem Laden hier in der Stadt. Ich kann dir gern die Adresse aufschreiben.« Sie hielt mir die Hand hin. »Ich bin übrigens Phuong.«
Ich ergriff ihre ausgestreckte Rechte und schüttelte sie.
»Freut mich. Ich bin …«, ich zögerte kurz. »Lia.«
Phuong schmunzelte. »Dann herzlich willkommen, Lia.« Sie nickte in Richtung meines Rucksacks. »Ich vermute, du bist zu Besuch hier? Oder auf der Durchreise?«
»Das weiß ich ehrlich gesagt noch nicht.«
»Das klingt nach einer längeren und vor allem interessanten Geschichte.« Phuong musterte mich kurz und sah sich dann im Café um. »Ich mach schnell deinen Kaffee. Hier ist gerade eh nichts los, also wenn es dir nichts ausmacht …« Sie zuckte mit den Schultern. »Ich liebe Reisegeschichten.«
Ich stutzte. »Viel zu erzählen gibt es nicht, ich bin gerade erst angekommen.« Und wenn ich eines in diesem Moment nicht wollte, dann war es, über mich zu reden. Phuongs Lächeln geriet kurz ins Wanken und ich gab mir einen Ruck. »Ich bin eher auf dich und dein WLAN angewiesen. Noch habe ich nämlich gar keine Ahnung, wie es weitergehen soll«, sagte ich. »Also … falls du mir helfen magst.« Ich deutete auf den dunkelgrünen Sessel mir gegenüber. »Hier ist mehr als genug Platz für zwei.«
»Und dann bist du einfach los? Verrückt.« Phuong sah mich mit großen Augen an. Nachdem sie sich versichert hatte, dass die anderen zwei Kunden versorgt waren, hatte sie sich mit einem Americano für sich und dem Flat White für mich an den Tisch gesetzt. Es hatte nicht lang gedauert, bis sie mich doch zum Reden gebracht hatte. Auch wenn ich eine sehr abgespeckte Version des heutigen Tages wiedergegeben hatte. Um nicht zu sagen, eine völlig andere. Denn ich hatte ihr gesagt, dass ich leidenschaftlich gern filmte, Inspiration suchte und glaubte, der Tapetenwechsel würde mir dabei helfen, diese zu finden.
»Wow, du bist echt mutig.«
Ich stutzte und hätte fast laut aufgelacht. »Glaub mir, das denkst du nur, weil dieser kleine Ausschnitt das Erste ist, was ich dir von mir und meinem Leben erzählt habe.« Und weil ich dir verschwiegen habe, dass ich mitten in der Prüfung weggerannt bin. Und wovor ich weggerannt bin.
Obwohl ich ihre Worte abtat, merkte ich, wie meine Wangen warm wurden. Nach den letzten Wochen fühlte es sich seltsam an, ungezwungen in einem Café zu sitzen und sich zu unterhalten. Noch seltsamer war es aber, dass Phuong mir gegenüber so aufgeschlossen und nett reagierte. In ihren Fragen lag ehrliches Interesse. Und hinter ihren Worten schien sich keinerlei Verurteilung zu verstecken. Um die Verlegenheit zu überspielen, nahm ich schnell einen Schluck von meinem Kaffee. Er schmeckte himmlisch.
»Und wenn der nächste Bus nicht nach Berlin, sondern nach München oder Paris gefahren wäre, dann wärst du jetzt dort?«, fragte Phuong.
Ich hatte tatsächlich einfach die App geöffnet und den nächstbesten Bus gewählt, der mich einigermaßen weit wegbrachte. Berlin hatte an oberster Stelle gestanden. Irgendetwas daran hatte sich sofort richtig angefühlt.
»Paris vermutlich nicht, ich kann kein Wort Französisch«, gab ich zu bedenken. »Aber ja, vom Prinzip her schon. Alles, was meine Ersparnisse zugelassen hätten.«
»Das ist so cool. Und von deinen Freunden wolltest du niemanden dabeihaben?«
Ich schüttelte den Kopf und ignorierte den Stich, den ihre Worte bei mir auslösten. Meine Freunde …
»Ich habe niemandem gesagt, dass ich gehe«, ergänzte ich, als Phuong mich fragend ansah. »Nur meiner Mitbewohnerin hab ich einen Zettel auf den Tisch gelegt, dass ich im Urlaub bin.« Ich lächelte schief. »Und selbst sie wird mir vermutlich erst glauben, wenn ich ihr ein Selfie vorm Bundestag schicke. Ich bin sonst nicht besonders abenteuerlustig. Also … so viel zum Mutigsein.« Ich schluckte. Die Worte waren mir einfach herausgerutscht, ohne dass ich bedacht hatte, wie sie auf Phuong wirken mochten.
Zu meiner Überraschung schüttelte sie vehement den Kopf, sodass sich einzelne Strähnen aus ihrem Zopf lösten.
»Nein, Lia, du siehst das falsch. Wer ist mutiger: Derjenige, der ständig ein Abenteuer nach dem anderen erlebt, immer auf Achse ist? Oder die Person, die ihre gewohnte Umgebung und Routine liebt und es dann plötzlich wagt, aus ihr auszubrechen? Ich glaube, wir Menschen sind alle Gewohnheitstiere. Es kommt einfach nur darauf an, was deine Gewohnheit ist. Die zu durchbrechen, das ist mutig.«
»Vielleicht hast du recht.« Nur dass das auf mich nicht zutraf. Denn ich brach nicht mit meinen Gewohnheiten. Ich lief einfach nur davon.
Phuong betrachtete den Globus am Tisch nebenan. »Vielleicht sollte ich das auch mal machen. Den Globus drehen, drauftippen und sehen, wo er mich hinschickt.« Sie seufzte. »Aber die Miete will ja bezahlt werden und ein Urlaubssemester ist echt nicht drin.«
Ich seufzte mit. »Das kenne ich zu gut. Was studierst du denn?«, fragte ich und schob mir mit dem kleinen Löffel einen Rest Milchschaum in den Mund.
»Jura«, meinte Phuong. Man musste mir meine Verwunderung ansehen, denn als sie meinen Blick erwiderte, lachte sie auf. »Keine Sorge, du bist nicht die Erste, die so guckt. Überraschung: Wir leben im 21. Jahrhundert. Man kann auch mit bunten Haaren, Piercings und Tattoos Jura studieren.«
»Nein, das ist es gar nicht«, beeilte ich mich zu sagen, »nur klingt Jura so trocken. Und du wirkst wie das genaue Gegenteil. Ich hatte einfach was Künstlerisches erwartet.«
Phuong grinste. »Ich habe leider keine Ahnung von Kunst. Ich seh sie mir gern an, aber ich kann nicht einmal einen anständigen Kreis zeichnen, geschweige denn singen oder so was.«
»Und warum Jura?«
»Weil ich Menschen helfen will, aber kein Blut sehen kann.« Sie schmunzelte. »Na ja, und dass ich damit ziemlich sicher einen Job finde, ist auch nicht gerade schlecht.«
Ich verzog den Mund, was Phuong nicht entging. Im nächsten Moment lächelte sie schmal.
»Mist. Ich bin grad in ein Fettnäpfchen getreten, oder?«, fragte sie. »Du studierst was Geisteswissenschaftliches?«
Ich zögerte. Dann winkte ich ab, bevor sie weitere Fragen zu meinem Studium stellen konnte. »Ich studiere noch nicht.« Die Lüge kam mir erstaunlich leicht über die Lippen.
»Hast du überlegt, was Künstlerisches zu machen?«, wollte Phuong wissen. »Wo du so gern filmst«, fügte sie hinzu, als ich nicht direkt antwortete.
»Mal sehen«, sagte ich ausweichend. »Aber selbst wenn, du hast ja recht. Es ist überhaupt nichts verkehrt daran, bei der Studienwahl ein bisschen aufs Geld zu gucken.« Wie oft hatte ich mich während meines ersten Semesters gefragt, ob ich das nicht auch besser hätte tun sollen.
Phuong stützte den Kopf auf ihrer Handfläche auf. »Ja. Zumal ich bisher die Einzige in der Familie bin, die studiert. Irgendwie erwarten dadurch alle, dass ich in spätestens fünf Jahren reich bin. Völlig realistisch natürlich.«
Ich zuckte mit den Schultern. »Aber auch nicht völlig unrealistisch.«
»Ich mag deinen Optimismus. Gib mir gern was davon ab. Aktuell sieht es eher so aus, dass ich ständig arbeite und die Semesterferien über bei meiner Mom wohne, damit ich mein Wohnheimzimmer in der Zeit untervermieten kann.« Sie stutzte und sah mich eindringlich an. »Behalt das bitte für dich, sonst flieg ich mit Sicherheit raus.«
Ich schmunzelte. »Okay. Meine Verschwiegenheit gegen euer WLAN-Passwort.«
»Oh, ups. Voll vergessen.« Phuong sprang auf und lief zur Theke. Sie holte einen kleinen Rucksack hervor und kam mit ihrem Laptop zurück zum Tisch. Er war über und über mit Stickern beklebt – von feministischen Sprüchen bis hin zu Aufklebern, bei denen der aktuelle Präsident der Vereinigten Staaten nicht gerade gut wegkam. Das machte sie mir gleich noch sympathischer. Phuong tippte auf ihrem Laptop und drehte ihn dann zu mir herum.
»Hier, such dir gern ein Hostel oder so raus. Das ist einfacher als am Handy.«
»Danke«, sagte ich. »In welchem Stadtteil sind wir gerade?«
Phuong lachte. »Du bist süß. Mitte. Aber wenn du sparen willst, schau vielleicht besser im Umfeld.«
Phuong stand auf und ging zur Theke, bevor sie sich wieder zu mir an den Tisch setzte. Sie legte etwas neben den Laptop. »Bisschen altmodisch, aber hier hast du eine Karte.« Sie grinste. »Das klang nämlich, als könntest du eine gebrauchen. Und hier«, sie tippte auf den Flyer, der auf der Karte lag, »ist mein erster Veranstaltungstipp für dich. Eine Freundin von mir gibt morgen Abend ein Konzert, falls du auch kommen magst. Der Eintritt ist frei.«
Ich nahm den Flyer in die Hand. Zuerst sprang mir die blonde Frau darauf ins Auge. Sie strahlte pures Selbstbewusstsein aus und stand, eine Gitarre vorm Körper, auf der Bühne. Zu ihrer Linken war ein Mann mit weißblonden Haaren am Mikrofon auszumachen und schräg hinter ihr ein Schlagzeuger, dessen Gesicht jedoch im Schatten lag. In der Mitte stand diagonal in geschwungener goldener Schrift »Gone Gone Gone«. Vermutlich der Bandname. Ich kniff die Augen zusammen. Nicht, weil das Foto so schlecht geschossen war, sondern weil die restliche Schrift winzig und leicht verschwommen war. Ich hoffte, sie spielten besser, als sie Flyer entwarfen, denn den hätte meine kleine Cousine mit Paint vermutlich ähnlich gut hinbekommen. Und die war sieben.
Phuong schien meinen Blick bemerkt zu haben, denn sie lachte. »Ich weiß, sag nichts. Mach dir einfach selbst ein Bild.«
Ich nickte, auch wenn ich genau wusste, dass ich es nicht tun würde, so nett diese Einladung auch war. Ich wollte mich nicht aufdrängen.
Hinter mir am Eingang ertönte die Glocke und unterbrach unser Gespräch. Phuongs Augen wanderten an mir vorbei Richtung Tür.
»Hey«, rief sie, wobei sich ihr Gruß wie eine Frage anhörte.
»Na, sieh mal einer an …«, sagte sie, zu leise, als dass es der Hereinkommende hören konnte.
»Kundschaft?«, fragte ich, schob den Flyer in die zusammengefaltete Karte und drehte mich um, um zu sehen, wer da das Café betrat.
Der Kunde war maximal ein paar Jahre älter als ich. Als die Tür hinter ihm ins Schloss fiel, schob er sich die dunkle Sonnenbrille auf den Kopf, wodurch einzelne Strähnen seines braunen Haars nach oben abstanden. Er griff sich an den V-Ausschnitt seines grauen Shirts und schüttelte ihn, vermutlich, um sich abzukühlen. In der anderen Hand hielt er einen übergroßen Rucksack, der beinahe den Boden berührte. Ich kniff die Augen zusammen und versuchte, ihn gegen das hereinfallende Licht besser sehen zu können. Der Kerl kam mir vage bekannt vor.
»Warte kurz«, sagte Phuong und stand auf. Allerdings ging sie nicht hinter die Theke, um die Bestellung aufzunehmen, sondern lief auf den Mann zu.
»Was machst du denn hier?«, fragte sie. Zwei Meter vor ihm blieb sie stehen und knetete die Finger vor ihrem Körper, als wäre sie unsicher, was sie mit ihren Händen anfangen sollte. Dann verschränkte sie die Arme vor der Brust und blickte zu ihm auf. Phuong wirkte plötzlich gar nicht mehr so selbstsicher wie noch zuvor. Ob zwischen den beiden mal was gelaufen war?
Zu gerne hätte ich ihr Gesicht gesehen. Gleichzeitig verfluchte ich meine blöde Neugier.
»Lange Geschichte«, erwiderte der Neuankömmling und ließ von seinem T-Shirt ab. Er sah sich im Café um, wobei sein Blick meinen gefangen hielt, bevor er weiterwanderte. »Hier hat sich ja nicht viel verändert.«
Phuong lachte kurz. »Du warst nur zwei Monate weg. Was hast du erwartet?«
Er zuckte mit den Schultern. »Fühlt sich anders an als vorher.«
Eine Weile sagten beide nichts und selbst von hier hinten konnte ich spüren, dass es keine angenehme Stille war.
Phuong räusperte sich. »Kaffee?«, fragte sie.
Er schien erleichtert und nickte lächelnd. »Ja, to go. Danke dir.« Phuong verschwand hinter der Theke und füllte die Bohnen in der Maschine nach.
Als ich in Richtung Tür blickte, sah ich, wie der Mann mich musterte. Ich hob die Augenbrauen. Anstatt ertappt wegzusehen, wie es die meisten getan hätten, kam er auf meinen Tisch zu. Dabei gab er den Blick durch die Tür auf die Straße frei. Plötzlich wusste ich, warum er mir – mitsamt der Sonnenbrille – so bekannt vorkam.
»Du bist neu hier.« Er zog sich einen Stuhl vom Nachbartisch heran und blieb mit etwas Abstand im Gang sitzen. Seinen Reiserucksack lehnte er gegen das Tischbein.
»Du kennst jeden in Berlin?« Ich musterte ihn mit hochgezogenen Augenbrauen. Seine Stimme war angenehm tief und ruhig, aber unter seinen Augen lagen dunkle Schatten, als hätte er seit Tagen nicht richtig geschlafen. Das kannte ich zu gut.
Er nickte zu meinem sperrigen Rucksack. »Nein, aber du hast Gepäck dabei. Und siehst nicht aus, als ob du in Berlin wohnst.«
Bitte was?
»Gerade angekommen?«
Ich lächelte ihm zu. »Ja. Zum Glück. Es war ganz schön knapp, denn beinahe wäre ein ziemlich aufdringlicher roter Opel meinem Bus hinten aufgefahren. Der Fahrer war sicher betrunken.« Ich blickte durchs Fenster nach draußen zu dem roten Auto mit der tiefen Delle, das vor seiner Ankunft noch nicht dort gestanden hatte, und hielt mir gespielt erschrocken die Hand vor den Mund. »Oh, das tut mir leid!«
Wider Erwarten lachte er. »Okay, okay, schon verstanden.« Er strich sich kurz durchs dunkle Haar, wodurch es noch ein wenig mehr abstand. »Nicht gerade der beste erste Eindruck, was? Zu meiner Verteidigung: Ich hatte einen echt miesen Tag.«
»Es sah zwar nicht so aus, als hättest du eine besucht, aber in der Fahrschule lernt man eigentlich, nicht wütend Auto zu fahren.« Obwohl ich versuchte, es nicht zu tun, zuckten meine Mundwinkel.
»Ich bin nicht selbst gefahren. Mein Freund saß am Steuer.«
»Wo ist Daniel überhaupt?«, fragte Phuong über den Lärm der Kaffeemaschine hinweg.
»Der muss weiter, seine Drums wegbringen.«
»Er hätte ja wenigstens kurz Hallo sagen können«, sagte Phuong. »Er hat sich, seit du weg warst, genau ein einziges Mal hier blicken lassen.«
»Er hat einfach viel zu tun, glaub ich.«
Durch die großen Fenster des Cafés beobachtete ich, wie der rote Wagen losfuhr.
Phuong kam neben dem Dunkelhaarigen zum Stehen und drückte ihm einen Pappbecher in die Hand. »Geht aufs Haus. Willkommen zurück.«
»Danke.« Er prostete mir mit dem Becher zu. »Ich glaube, ich trinke ihn doch hier. Ich muss meine Ehre verteidigen.« Seine Augen blitzten auf, als er mich angrinste. Mir verschlug es die Sprache, sodass ich stumm zurückprostete.
Phuong zog die Augenbrauen in die Höhe. »Na, dann viel Erfolg. Lass auf keinen Fall die Geschichte aus, wie du dich vor Daniels Party an dem Baileys für unseren Latte macchiato betrunken hast.« Ihr Blick wanderte zu mir. »Dreimal darfst du raten, wer die leeren Baileys-Flaschen erklären musste und ein verwüstetes Café aufzuräumen hatte.«
Grinsend schüttelte er den Kopf. »Nicht hilfreich, Phuong. Außerdem war das nicht meine Idee, sondern die meines Bruders.«
Sein Grinsen verschwand schlagartig und Phuong biss sich auf die Unterlippe. »Wie geht’s Elias?«
»Gut«, antwortete er knapp, wobei sich seine Miene noch weiter verdunkelte.
»Ich hab von Kyra gehört, was passiert ist«, murmelte Phuong. »Ich weiß, wie wichtig dir das war. Wenn du …«
»Ich will nicht drüber reden. Ich muss das Ganze gleich schon mit meinen Eltern durchkauen.« Er seufzte und drehte den Kaffeebecher in seinen Händen.
Phuong nickte knapp, schwieg und schien plötzlich sehr interessiert an ihren dunkel lackierten Fingernägeln.
Ich wurde nicht wirklich schlau aus diesem Wortwechsel. Aber ich hätte schon sehr schwer von Begriff sein müssen, um nicht zu merken, dass irgendetwas zwischen den beiden stand. Ich schluckte meine Neugier hinunter. Die Stille, die sich über uns legte, war sogar mir als Außenstehende unangenehm. Um die Stimmung wieder zu lockern, räusperte ich mich und schlug ein neues Thema an.
»Also … ich weiß, dass du Freunde mit fragwürdigem Fahrstil hast und dass du gerne Baileys trinkst. Aber wie heißt du überhaupt?«
»Oh, verdammt. Du erwischst mich wirklich an einem extrem schlechten Tag. Normalerweise sind meine Manieren besser.« Er stellte den Kaffeebecher auf dem Tisch ab und hielt mir seine Hand entgegen. »Noah.«
»Freut mich.« Ich ergriff seine Hand, die warm war und rauer, als ich gedacht hätte. »Ich bin Lia.«
Er drückte leicht zu und sah mir dabei tief in die Augen. »Ist das eine Abkürzung?«, fragte Noah.
»Ja, kurz für Emilia. Aber du kannst mich ruhig Lia nennen, das reicht.«
»Okay. Und was bringt dich nach Berlin, Lia?«
An die Art, wie er meinen Namen aussprach, könnte ich mich gewöhnen. Noch dazu sah er ehrlich interessiert aus. Seine braunen Augen musterten mich eingehend.
»Ehrlich gesagt, ein Zufall.«
Er legte den Kopf schief, eine stumme Aufforderung, weiterzusprechen.
»Ich hab es Phuong gerade schon erzählt. Ich wollte einfach verreisen und das Zufallsprinzip entschied sich für Berlin.« Ich zuckte mit den Schultern. »Und jetzt bin ich hier.«
»Also einfach ein Tapetenwechsel?«, hakte Noah nach.
»Sozusagen.«
»Sie filmt«, sprang Phuong ein. »Das ist quasi ihre Recherchereise. Oder sagt man dann Inspirationsreise?«
»Wenn du das sagst, klingt es wesentlich cooler, als es eigentlich ist«, sagte ich und bemühte mich um ein Lächeln, auch wenn mir das schlechte Gewissen aufgrund meiner Lüge schwer im Magen lag. Phuong war mir gegenüber von der ersten Sekunde an offen gewesen und wie ich mich verhielt, war das genaue Gegenteil von offen.
»Hast du jetzt eigentlich einen Schlafplatz gefunden?«, fragte Phuong und deutete zu ihrem Laptop.
Ich schüttelte den Kopf. »Nein, sorry. Ich wurde da von jemandem abgelenkt.« Ich warf Noah einen Blick zu, bevor ich mich wieder dem Display zuwandte. »Ich weiß auch noch gar nicht, wie lange ich bleibe und ob ich noch weiterreisen soll.« Beim Scrollen durch die verschiedenen Angebote überschlug ich grob, was ich mir leisten konnte. In den letzten Wochen war ich nicht auf der Arbeit erschienen, das hatte meinem Kontostand nicht wirklich gutgetan. Phuong hatte recht, die Hostels und Pensionen, die bezahlbar waren und einigermaßen gut aussahen, lagen alle außerhalb. Ich klickte auf eines der Angebote und seufzte.
»Hm?«, fragte Phuong und schob sich neben mich, um mit mir auf den Bildschirm schauen zu können.
»Hier sind nur noch gemischte Zimmer frei«, sagte ich und klickte mich zurück zu den Suchergebnissen.
Phuong zuckte mit den Schultern. »Ist doch nicht so schlimm. Du bist ja eh nur zum Schlafen da. Ich mache das auf Reisen auch immer, ist echt halb so wild.«
Ich lächelte verkrampft und scrollte weiter. Phuongs Zeigefinger tippte auf den Bildschirm.
»Hier, das ist in Friedrichshain und nicht zu teuer.« Ich klickte auf das Angebot. Es war eines der wenigen Zimmer, das mich unter vierzig Euro die Nacht kosten würde. Allerdings war es trotzdem über meinem Budget.
Meinem nicht vorhandenen Budget.
»Ein paar Blocks von dort ist eine Pension«, meinte Noah. »Sie gehört der Großmutter meines besten Freundes. Daniel, von dem ich eben erzählt habe. Da ist sicher auch noch was frei und wenn ich sage, dass du eine Freundin von mir bist, bekommst du sicher einen Rabatt. Außerdem ist das Frühstück der Wahnsinn. Wenn du magst, bringe ich dich hin. Es liegt sowieso auf dem Weg zur S-Bahn.«
Überrascht blickte ich ihn an. Wieso waren hier alle so nett? Oder war das normale Höflichkeit und ich war sie einfach nicht mehr gewohnt? Möglich, aber ich war keine Freundin von Noah. Und auch wenn er es nur vorgab, um mir zu helfen – wer tat so etwas schon, ohne eine Gegenleistung dafür zu erwarten?
Noahs Blick ruhte abwartend auf meinem Gesicht, während ich mich so ruhig und neutral wie möglich gab. Trotzdem konnte ich nicht verhindern, dass sich mein Herzschlag beschleunigte. Und im Gegensatz zu eben, als ich meinen Namen zum ersten Mal aus seinem Mund gehört hatte, war es diesmal kein angenehmes Gefühl. Ich schluckte und fühlte, wie trocken mein Hals war. Schnell trank ich den letzten Schluck meines nun lauwarmen Kaffees – mehr um Zeit zu schinden, als um meinen Rachen zu befeuchten.
»Das ist wirklich lieb«, begann ich und wich Noahs Blick aus. Stattdessen betrachtete ich wieder das Angebot für das Hostelzimmer. Meine Hand bewegte sich schneller als meine Gedanken und berührte das Trackpad des Laptops. Ich klickte auf Buchen, bevor ich es mir anders überlegen konnte. »Aber ich will gar keine Umstände machen. Das Hostel ist echt bezahlbar und vielleicht lerne ich so auch noch ein paar andere Reisende kennen. Das ist bestimmt besser, als Berlin auf eigene Faust zu erkunden.« Ich lächelte Noah an und hoffte, dass es überzeugend wirkte. »Aber danke dir trotzdem.«
Noah zuckte mit den Schultern. »Klar, wie es dir lieber ist.«
Die Muskeln in meinen Schultern entspannten sich und ich atmete erleichtert aus. Kurzerhand gab ich die Zahlungsinformationen auf der Website ein, schloss den Vorgang ab und schob Phuong dann ihren Laptop zu.
Sie klappte ihn zu, ließ sich wieder auf den Stuhl mir gegenüber fallen und zog die Beine zum Schneidersitz hoch.
»Also bist du nach den Semesterferien wieder an der Uni?«, fragte sie an Noah gewandt.
Noah nickte. »Jap, sieht so aus. Etwas früher, als geplant, aber eigentlich freu ich mich sogar.«
»Studiert ihr an der gleichen Uni?« Ich sah von Noah zu Phuong.
»Nein«, sagte Phuong. »Ich bin an der Humboldt und er an der HTW. Wir kennen uns über seine Schwester.«
»HTW?«, fragte ich.
»Hochschule für Technik und Wirtschaft. Ich mach Environmental Engineering«, meinte Noah.
»Wow. Also du rettest die Umwelt und Phuong Menschen.« Meine Finger spielten mit dem Griff der nun leeren Tasse.
»Noch rette ich gar keine Menschen, sondern spiele Quizduell in den Vorlesungen.«
Noah lachte auf. »Immer noch? Ist das nicht ein bisschen 2014?«
»Aus dir spricht nur der blanke Neid, weil du mich nie besiegt hast.«
»Sie lügt«, sagte Noah an mich gewandt. »Studierst du auch?«
Ich schüttelte den Kopf, da ich die Lüge nicht schon wieder aussprechen wollte. Ich hasste Lügen eigentlich. Und wenn ich so weitermachte, würde ich mich garantiert in einem Lügennetz verstricken. Also entschied ich mich für Halbwahrheiten.
»Ich würde gern was mit Film studieren«, erwiderte ich auf Noahs Frage. »Die Ferien wollte ich zum Filmen nutzen. Bei den Bewerbungen muss man in der Regel ein Portfolio mit einreichen. Also dachte ich, ich sammle hier Material für einen Kurzfilm.« Okay, das war keine komplette Lüge. Ich hatte letztes Jahr nach dem Abitur tatsächlich ein Portfolio an meiner Hochschule einreichen müssen. Anscheinend war ich in Halbwahrheiten mittlerweile ein richtiger Profi. ›Es geht mir gut‹, war eine weitere, die ich fast täglich äußerte.
»Das klingt so cool!«, sagte Phuong. »An welche Uni willst du denn?«
»Ähm«, sagte ich wenig eloquent. Shit. »Ich weiß noch nicht genau. Ich …« Ich räusperte mich und spürte das Herz in meiner Brust hämmern. Eigentlich war ich hier, um das hinter mir zu lassen. Die Uni, das Studium, die Leute. Einfach alles. Ich wollte nicht daran denken, geschweige denn darüber sprechen.
Halt einfach die Klappe, Lia. Verhalt dich wie ein normaler Mensch.
Als ich Noahs und Phuongs abwartende, irritierte Blicke sah, räusperte ich mich erneut. Wahrscheinlich hielten sie mich für komplett bescheuert. »Vielleicht sollten wir nicht über die Uni reden, schließlich sind gerade Semesterferien«, sagte ich in einem lahmen Versuch, mein seltsames Verhalten zu rechtfertigen.
Phuong stützte den Kopf auf ihrer Hand ab und hob die Schultern. »Okay, fair enough.«
»Hast du irgendwo was hochgeladen?«, fragte Noah.
Ich schüttelte den Kopf und wünschte, die beiden ließen mich das Gespräch wieder von mir auf sie lenken. »Nein. Ich hab einige Videos und Konzepte für Kurzfilme herumliegen, aber irgendwie bin ich mit nichts zu einhundert Prozent zufrieden.« Ich zögerte, doch Noahs interessierter Blick brachte mich wider Erwarten zum Weiterreden. »Ich will keine bloßen Landschaftsaufnahmen machen, aber wenn man diejenige mit der Kamera ist, führt das zwangsläufig dazu, dass man wenig Foto- und Filmmaterial von sich selbst hat.«
»Dann helfen dir die Kurse an der Uni sicher«, sagte Noah. »Da habt ihr dann Gruppenarbeiten und du lernst Leute kennen, die genauso dafür brennen und dir beim Dreh helfen können.«
Ich hätte am liebsten laut aufgelacht, biss mir aber auf die Zunge. Noahs Vorstellung war auch einmal meine gewesen. Und die hatte ganz toll funktioniert.
»Vielleicht bist du auch einfach zu kritisch mit dir selbst«, warf Phuong ein.
In dem Moment klingelte ein Handy und rettete mich vor weiteren Fragen. Noah zog sein Smartphone aus der Tasche.
»Sorry, eine Sekunde.« Mit zusammengepressten Lippen blickte er auf das Display. Er stand auf und ging einige Schritte in Richtung Tür, bevor er abhob.