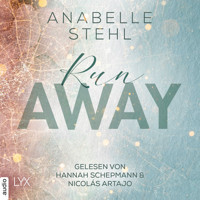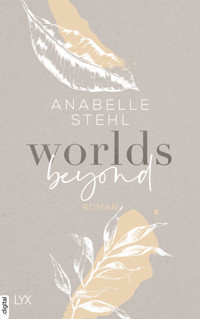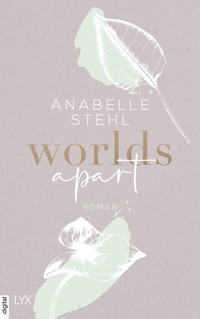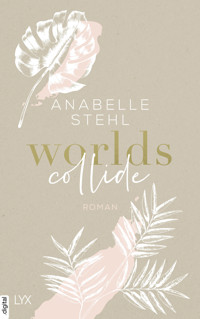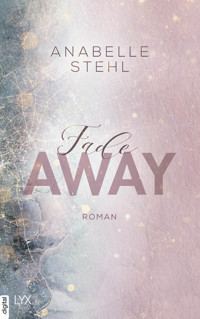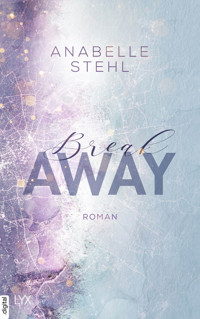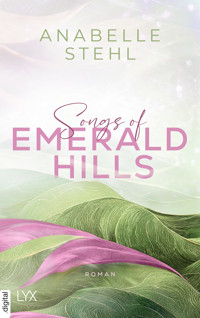
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Irland-Reihe
- Sprache: Deutsch
Ein Neuanfang auf der grünen Insel ...
Eine Weile Abstand von allem - insbesondere den schmerzhaften Erinnerungen an ihre beste Freundin -, das erhofft Caroline sich von ihrem Aufenthalt in Irland. Idealerweise findet sie auf der grünen Insel endlich heraus, was sie eigentlich will vom Leben. Wen sie will, merkt sie früher, als ihr lieb ist: Conor, der Nachbar ihrer etwas schrulligen Gastgeberin, verdreht ihr nämlich vom ersten Tag an den Kopf. Als sie zusammen ein Gälisch- Festival auf die Beine stellen, um Conors Sprachschule zu retten, kann auch dieser nicht länger leugnen, dass er sich zu Caro hingezogen fühlt. Doch sie wird bald nach Deutschland zurückkehren, und so wehrt er sich mit aller Macht gegen die aufkommenden Gefühle, denn Verluste hatte er in seinem Leben bereits genug ...
Romantisch, warm und voller Herz - ein Buch, das sich wie Heimkommen anfühlt
Auftakt der neuen Reihe von SPIEGEL-Bestseller-Autorin Anabelle Stehl
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 535
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Widmung
Playlist
Leser:innenhinweis
Ausspracheguide
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
35. Kapitel
36. Kapitel
37. Kapitel
38. Kapitel
39. Kapitel
40. Kapitel
41. Kapitel
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Anabelle Stehl bei LYX
Impressum
ANABELLE STEHL
Songs of Emerald Hills
Roman
ZU DIESEM BUCH
Carolines Leben steckt in einer Sackgasse. Sie ist unglücklich mit ihrem Studium, hat sich von ihrem Freund getrennt und ist noch immer nicht über den Verlust ihrer besten Freundin hinweg, die vor einem Jahr gestorben ist. Als sie im Internet auf eine Anzeige stößt, in der jemand eine Betreuerin für seine Mutter in der Nähe von Galway in Irland sucht, ist das für Caro ein Wink des Schicksals. Kurz entschlossen nimmt sie den Job an und steigt in das nächste Flugzeug. Doch der Start auf der grünen Insel ist mehr als holprig: Roisin Connolly, die alte Dame, die sie nach einer Knieoperation betreuen soll, will sie eigentlich nicht im Haus haben. Hinzu kommt, dass Caro die Sprache nicht versteht, denn Baile na Mara liegt im gälischsprachigen Teil Irlands, Englisch wird im Alltag so gut wie gar nicht verwendet. Aber trotz aller Schwierigkeiten gibt Caro nicht auf. Sie verliebt sich in das Land, die Natur – und in Conor. Conor lebt im Nachbarhaus, und schon bei ihrer ersten Begegnung kribbelt es gewaltig. Und beim Bogenschießen, Schafestreicheln und dem Organisieren eines Gälisch-Festivals, um Conors Sprachschule zu retten, kommt sie dem charmanten Iren zwangsläufig näher. Doch Conor wehrt sich mit aller Macht gegen seine aufkeimenden Gefühle, denn er weiß genau, dass er Caro verlieren wird. Und Verluste hatte er in seinem Leben schon genug …
Für Herrn Orth
Go raibh maith agat.
PLAYLIST
You’re On Your Own, Kid – Taylor Swift
Magnetised – Tom Odell
We Were Wild – Esmé Patterson
Wildest Dreams – Duomo
Alice Hyatt – Damien Jurado
Brid Og Ni Mhaille – The Corrs
The Galway Girl – Fiddler‘s Green
Whiskey in the Jar – The Dubliners
Give Me Love – Ed Sheeran
Outnumbered – Dermot Kennedy
I Contain Multitudes – Bob Dylan
Smoke Slow – Joshua Bassett
Dancing Queen – Stacey Ryan
I GUESS I’M IN LOVE – Clinton Kane
Might Be Toxic – Faith Richards
Bigger Than The Whole Sky – Taylor Swift
Irish Goodbye – Sammy Copley
Ireland – Ellie Banke
Liebe Leser:innen,
bitte beachtet, dass Songs of Emerald Hills Elemente enthält, die triggern können. Dies betrifft: Verlust, Tod, Trauerbewältigung.
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Anabelle und euer LYX-Verlag
AUSSPRACHEGUIDE
Songs of Emerald Hills spielt in der Gaeltacht – einem nach wie vor gälischen Gebiet Irlands. Dadurch sind einige Namen und Orte für uns ungewohnt. So sprecht ihr diese aus (ich habe mich der Einfachheit halber für eine Transkription mithilfe unseres Alphabets entschieden, die korrekte phonetische könnt ihr online nachschlagen):
Orte
Baile na Mara – bajlle na mara
Gaeltacht – Gäiltacht
Tigh Mholly – Tie Wollie
Namen
Aisling – Äschlin
Aoife – Iefa
Cian – Kieänn
Cormac – Kormäk
Declan – Decklänn
Eoin – Ouin (wie »Owen«)
Feargal – Föhrgäll
Pádraig – Pahdrig
Roisin – Roschien
Siobhán – Schiwahn
Außerdem gibt es in dem Buch einige irische Phrasen. Das bedeuten sie:
Irische Phrasen
A Bhreandáin, a Chiara, cad atá ar siúl agaíbh anseo? – Brendan, Kiera, was macht ihr hier?
Agus tá tú? – Und du bist?
Ar mhaith leat seaicéad? – Willst du eine Jacke?
Cén chaoi a bhfuil tú / sibh? oder Conas atá tú / sibh? – Wie geht es dir / euch?
Dia duit! / Dia dhuit! – Hallo!
Dia is Muire duit / dhuit. – Hallo (als Erwiderung).
Fág é! – Lass es! / Aus!
Go raibh maith agat. – Danke.
Le do thoil ná téigh. – Bitte geh nicht.
Maidin mhaith. – Guten Morgen.
Maith an cailín. – Gutes Mädchen.
Mo chailín. Beidh gach rud ceart go leor. – Mein Mädchen. Alles wird gut.
Póg mo thóin. – Leck mich am Arsch.
Sláinte (mhaith)! – Prost!, wörtl.: »(gute) Gesundheit«
Slán! – Auf Wiedersehen!
Spraoi a bheith agat! – Viel Spaß!
Tá an ghrian ag taitneamh. – Die Sonne scheint.
Tá mé beo. – Ich bin am Leben.
Táim ag súil leis sin. – Ich freu mich drauf.
Táim caillte. – Ich bin verloren.
Táim go maith. – Mir geht’s gut.
Tóg go bog é! – Nimm’s locker! (als Abschiedsfloskel verwendet)
PROLOG
Caroline
München, ein Jahr zuvor
Ich starrte auf den Sarg und wünschte, dass ich es wäre, die darin liegt. Stattdessen stand ich davor, inmitten all dieser Menschen, von denen sich die Hälfte sicher auch fragte, wieso es nicht mich statt Nadine erwischt hatte. Ich wünschte, ich könnte ihnen diese unausgesprochene Frage beantworten. Am liebsten hätte ich mich umgedreht und hinausgeschrien, dass ich doch auch keinen blassen Schimmer hatte.
Dass das Leben nun einmal scheißunfair war und der Tod ein schlechter Witz. Dass ich selbst wusste, dass sie es mehr verdient hätte zu leben als ich.
Ich biss die Zähne so fest zusammen, dass mein Kiefer protestierend knackte. Am Rande bekam ich mit, wie Manuel den Druck seiner Finger an meinem Arm verstärkte, als könnte er die Teile zusammenhalten, in die ich zerbrochen war. Seit drei Jahren war er meine Stütze, mein Fels in der Brandung. Doch jetzt war es zwecklos. Man konnte mich nicht mehr fixen. Ich brauchte keinen Felsen, wenn ich doch längst ertrunken war. Mit Nadine war auch ein Teil von mir gestorben. Und die restlichen Teile bereuten, noch da zu sein. Ich wusste, dass ich dankbar sein sollte für seine Liebe und Unterstützung, sein Verständnis. Doch in mir war nur Leere.
Der Priester faselte etwas davon, dass Nadine jetzt an einem besseren Ort war, und es kostete mich alles an Selbstbeherrschung, nicht laut aufzulachen. Was für ein Ort sollte das sein? Nadine hatte dieses Leben geliebt. Im Gegensatz zu mir hatte sie Pläne gehabt. Eine Zukunft.
Was sie jedoch auch gehabt hatte, war Myokarditis. Eine Herzmuskelentzündung. Mit nur zwanzig Jahren. Und als ob das nicht schlimm genug war, hatte sie sich diese durch eine Lebensmittelvergiftung zugezogen. Beim Essen mit mir. Während es mich nur einige Tage ausgeknockt hatte, hatte Nadine sich nicht erholt. Die Entzündung war zu spät entdeckt worden, und obwohl wir anfangs noch gescherzt hatten, war die Lage schnell aus dem Ruder gelaufen. Ich würde die Stimme ihrer Mutter am Telefon nie wieder vergessen, sie jagte mich in meinen Träumen und würde es wohl tun, bis ich irgendwann auch unter der Erde landete.
Mein Blick wanderte zu Bernd und Annika, Nadines Eltern, die ich seit dem Kindergarten kannte. Beide weinten, hielten sich aneinander fest, schienen nur Sekunden davon entfernt, auf dem Friedhof zusammenzubrechen. Ob sie mich genauso sehr dafür hassten wie ich?
Die Worte des Pfarrers spülten über mich hinweg, und tief in meinem Inneren wünschte ich, dass ich noch an das glauben könnte, was er sagte. An ein Leben nach dem Tod, an Vergebung für all unsere Sünden, an bessere Orte. Doch welchen Trost würde mir das schon spenden? Meine beste Freundin war tot. Und ich war allein. Wir würden unseren Dreißigsten nicht in Vegas feiern, wie wir es geplant hatten. Sie würde aus ihren Songs auf Spotify kein richtiges Album mehr machen. Sie würde nicht auf meiner Hochzeit singen.
Stattdessen trat der Pfarrer nun zur Seite, und irgendjemand startete ihren Song, während die ersten Trauernden vortraten, um sich zu verabschieden.
Softly, carefully, I tread on new paths, stimmte Nadines sanfte Stimme das Lied an. Sie nur zu hören sorgte dafür, dass sich alles in mir zusammenzog. Mein Herz schmerzte, mein Magen krampfte, und meine Beine gaben nach. Es dauerte eine Weile, bis ich verstand, dass der Schrei, der durch das Rauschen in meinen Ohren in mein Bewusstsein drang, mein eigener war. Manuel versuchte noch, mich zu stützen, doch es war zu spät. Ich fiel und fiel und fiel und erwischte mich bei dem Gedanken, nie wieder aufstehen zu wollen.
Conor
Baile na Mara, ein Jahr zuvor
Hätte ich gewusst, dass der Tag nichts als schlimme Nachrichten bereithalten würde, wäre ich mit unserem Kater Gaiman einfach auf der Couch geblieben. Stattdessen verließ ich im grünen Trikot das Haus, um Connacht Rugby, das einzig wahre Team, anzufeuern und ein paar Bier mit den Jungs zu kippen.
»Dia dhuit, Conobhar!«
Mrs Connolly, der einst die Bäckerei gehört hatte, schaute aus dem Küchenfenster zur Straße hinaus, so, wie sie es die meiste Zeit tat, und winkte mir zu.
»Dia is Muire dhuit!«, grüßte ich zurück und kam auf dem Fußweg, der an ihrem Haus vorbeiführte, zum Stehen. Ich wusste nie so recht, was ich von der alten Dame halten sollte. Sie plauderte ab und an mit einem, blieb jedoch meist für sich und hatte in der Regel immer etwas zu beklagen. Außerdem hatte sie es nie leiden können, wenn wir laut waren, und sich regelmäßig bei meinen Eltern über mich beschwert. Jetzt, da ich älter war, schien ich zu einem würdigen Gesprächspartner aufgestiegen zu sein, auch wenn ich nach wie vor nicht sicher war, ob sie mich wirklich mochte.
»Cén chaoi a bhfuil tú?«
»Gut, immerhin ziehen wir Tipperary gleich ab«, erwiderte ich mit einem Grinsen und deutete auf mein Jersey-Shirt. »Und Ihnen? Und den beiden Kleinen?«
Mrs Connolly drehte sich um, als müsste sie nachschauen, um meine Frage beantworten zu können.
»Gut, gut«, sagte sie dann, als sie den Blick ihrer graublauen Augen wieder auf mich richtete. »Die beiden schlafen gerade. Letzte Ferienwoche, richtig? Deinen Bruder hab ich gestern schon getroffen, als ich auf dem Weg zum Friseur war. Die Uni läuft? Wann geht es zurück in die Stadt?«
Ich nickte und vermied es, die Uhrzeit am Handy zu checken. Ich war spät dran und wollte auf keinen Fall den Anpfiff verpassen. Mir war klar, dass die erste Runde dann auf mich gehen würde. »Alles bestens. In ein paar Tagen fahr ich wieder, auch wenn ich am liebsten noch bleiben würde.«
»Studieren ist ein Privileg«, grummelte sie mehr zu sich als zu mir. »In Galway ist’s doch sicher aufregender als hier?«
Ich zuckte mit den Schultern. »Ich mag die Ruhe hier lieber.«
Jetzt flog mein Blick doch zur Uhr, und natürlich bemerkte es Mrs Connolly. Sie richtete sich auf und strich die geblümte Bluse glatt. Trotz ihrer oft zurückhaltenden Art trug sie stets bunte, auffällige Muster. »Na dann. Grüß Molly und Siobhán von mir.«
»Mach ich«, rief ich, während ich mich schon zum Gehen wandte.
Baile na Mara war – zu meinem Vorteil – winzig. Um zum Pub zu gelangen, der das Spiel übertrug, musste ich bloß die Hauptstraße entlanglaufen, bis kurz vor dem kleinen Shop, der die einzige Einkaufsmöglichkeit in unserem Dorf bot. Pubs hingegen hatten wir drei, und jedes behauptete von sich, das älteste in Baile na Mara zu sein. Unabhängig vom Gründungsjahr war das Tigh Mholly zu unserer Stammkneipe mutiert, was nicht zuletzt daran lag, dass der Laden Pádraigs Mam Molly gehörte.
Während ich die grünen Felder entlanglief, begann es leicht zu nieseln. Nicht ungewöhnlich für Irland, erst recht nicht im Oktober. Vermutlich würde in wenigen Minuten schon wieder die Sonne zwischen den Wolken hervorbrechen und die ganze Szenerie in warmes Licht tauchen. Ich liebte diese schnellen Stimmungswechsel, und ich liebte diesen Ort. Das Meer zu meiner Rechten, dessen sanftes Rauschen bis zu mir vordrang, die Kühe und Schafe, die sich auf den Feldern abwechselten, die Weitläufigkeit, die so anders als in meiner Unistadt Galway war. Und ebenso liebte ich die Tatsache, dass ich hier endlich wieder Gaeilge sprechen konnte – Gälisch, also Irisch, was mir in der Stadt außerhalb des Unterrichts nicht möglich war. So sehr ich mein Studium in Irish and Celtic Studies auch liebte, konnte ich es doch kaum erwarten, heimzukehren. Zurück in die Gaeltacht, eines der wenigen und immer kleiner werdenden Gebiete Irlands, in denen noch Irisch gesprochen wurde. Nirgends fühlte ich mich wohler und mehr wie ich selbst als hier. Englisch war, wie bei vielen im Ort, nur meine Zweitsprache, und auch wenn ich diese fließend und akzentfrei sprach, war es nicht genauso natürlich, wie Irisch zu sprechen. Das Englische kam mir manchmal vor wie ein zu enges Kostüm, das an einigen Stellen spannte und nie so ganz passen wollte.
Der Regen wurde stärker, als das dunkelgrüne Gebäude, das seit Jahren der Dreh- und Angelpunkt unserer Treffen war, endlich in Sichtweite kam. Die pinken Verbenen bildeten einen starken Kontrast zum Anstrich und zogen gemeinsam mit der Schiefertafel, die die verschiedenen Biere und das Menü feilbot, die Blicke der Passanten auf sich. Mollys rostige Karre davor war mir ebenso vertraut wie die schwarze, geschwungene Schrift über dem Eingang: Ceol agus craic – Musik und Spaß – war zwar der typische Slogan, der fast alle Irish Pubs zierte, doch hier war das Motto Programm. Kaum, dass ich die Tür aufgestoßen hatte, wurde ich von Gelächter, lauten Gesprächen und einem enthusiastischen »Na endlich!« begrüßt. Kurz darauf traf Eoins Pranke mich an der Schulter, und er drückte mir ein Guinness in die Hand. Wie es aussah, würde ich wohl doch nicht die erste Runde schmeißen müssen.
»Go raibh maith agat«, bedankte ich mich mit einem Lachen bei meinem Freund und nickte ein paar der anderen Anwesenden zu. Wie immer, wenn ein Spiel lief, hatte sich der halbe Ort hier versammelt.
»Gern. Wobei ich es fast selbst getrunken hätte. Du bist grad noch pünktlich, Anpfiff war vor einer Minute.«
»Sorry, Mam wollte noch Hilfe bei was und Mrs Connolly …«
»Okay, die Ausrede gilt«, unterbrach Eoin mich grinsend und fuhr sich über das kurz rasierte Haar, an dessen Stelle vor wenigen Tagen noch lange, dunkle Strähnen gewesen waren. »Die Frau hat mich letztens beim Einkaufen ganze zehn Minuten festgequatscht und sich in einer Tour über das Wetter beschwert. Wie kann sie so miesepetrig und so gesprächig zugleich sein?«
Ich hob die Schultern und trank einen Schluck des Biers ab, bevor ich antwortete. »Gute Frage. Warst du beim Friseur?«
»Nope, das ist Olivias Werk.« Er streckte eine Hand aus und zog an meinem braunen, lockigen Haar, das mir mittlerweile fast in die Augen fiel. »Sag Bescheid, wenn sie sich dich als Nächstes vornehmen soll.«
»Sarah würde mich umbringen«, gab ich zurück, und Eoin verdrehte seine blauen Augen, wie immer, wenn ich meine Freundin erwähnte. Die beiden waren nie richtig miteinander warm geworden, dabei waren wir mittlerweile seit zwei Jahren zusammen.
»Declan hast du nicht aus dem Haus bekommen?«
»Er hasst Rugby nach wie vor.«
»Ich werde nie verstehen, wie ihr euch so sehr unterscheiden könnt.«
»Zweieiig«, gab ich mit einem Schulterzucken zurück. Dabei waren sich Declan und ich – abgesehen vom Äußeren – gar nicht so unähnlich. Wir hatten dieselben Ziele und Ideale, und ich konnte es schon jetzt kaum erwarten, gemeinsam mit ihm die alte Schule unseres Grandpas wiederzueröffnen. Leider standen zwischen uns und der Eröffnung noch ein Semester Büffeln und eine Abschlussarbeit.
Ich folgte Eoin zu den anderen an unseren Tisch, wo ich von lautem Gegröle begrüßt wurde, weil irgendjemand auf dem Bildschirm gerade einen unserer Spieler gefoult hatte. Pádraig, mein bester Freund seit Sandkastenzeiten, rutschte zur Seite, damit ich neben ihm Platz nehmen konnte. Der Tisch klebte leicht, als ich mein Glas darauf abstellte, doch das gehörte genauso dazu wie das Bild an der gegenüberliegenden Wand, das Pádraig, Eoin, Cormac, Cian, mich und meinen Zwillingsbruder Declan als Teenies am Strand zeigte. Wir standen in gelben Warnwesten in Reih und Glied vor einem weißen Boot und grinsten in die Kamera. Wir sechs waren unzertrennlich – oder zumindest waren wir es gewesen, denn Cian war mittlerweile nach Kanada ausgewandert.
Das Foto war knapp zehn Jahre alt und leicht vergilbt, doch trotz Renovierungsarbeiten hatte Molly es an dieser Stelle hängen lassen. Vermutlich, weil wir ebenso zum Inventar des Pubs gehörten wie die wackligen Stühle und der urige, holzige Geruch. Es markierte unseren Stammtisch – nicht, dass jemand uns diesen streitig gemacht hätte. Die Gäste hier funktionierten zuverlässig wie ein Uhrwerk: Sie saßen seit Jahren an denselben Tischen, bestellten die gleichen Getränke und führten mehr oder weniger die gleichen Gespräche. Genau wie ich trugen die meisten gerade grüne Mannschaftsjerseys. Es war brechend voll, und ich entdeckte auch ein paar Leute aus den Nachbarorten, die wohl extra hergefahren waren. Molly, Pádraigs Mam, winkte mir von hinter der Theke aus, und auch ihre Frau Siobhán, die mit meinem Dad an einer Schule arbeitete, nickte mir zu und hob das Glas zum Gruß. Ich tat es ihr gleich.
»Was grinst du denn so?«, fragte Cormac und hob die rotblonden, buschigen Brauen. »Noch haben wir nicht gewonnen.«
»Bin einfach froh, wieder hier zu sein. Ich hab’s vermisst.«
»Immerhin einer, der Heimweh hat«, meinte Cormac und gab Pádraig einen so kräftigen Hieb gegen den Oberarm, dass dieser gegen mich stieß. Er rollte mit den Augen.
»Ja«, pflichtete Eoin ihm bei. »Der Junge ist vorhin sogar ins Englische gewechselt. Pass auf, sonst hält man dich noch für einen von Conors Touris.«
»Haha«, machte Pádraig trocken, und obwohl wir einander ständig aufzogen, hatte ich das Gefühl, dass es ihn diesmal wirklich nervte, denn seine grauen Augen funkelten – jedoch nicht vor Belustigung.
»Wenn ich mich recht erinnere, hast du letztes Mal mit einer dieser Touristinnen rumgemacht«, gab ich zurück, in der Hoffnung, die Aufmerksamkeit von Pádraig wegzulenken.
»Sie hat angefangen«, nuschelte Eoin in sein Bier. Wer auch immer es gestartet haben mochte, mein Dad war nicht gerade begeistert gewesen.
Jedes Semester kamen Studierende nach Baile na Mara, die über Erasmus, CIEE oder eines der anderen Programme ein Auslandssemester in Irland absolvierten. Sie checkten bei Molly ein und nahmen Unterricht in der alten Schule meines Dads. Einst hatte die meinem Grandpa gehört und war eine ganz normale irische Schule für Kinder im Ort und Umland gewesen. Mittlerweile war sie die meiste Zeit geschlossen, und mein Dad arbeitete als Lehrer an einer englischsprachigen Einrichtung. Wir öffneten die Türen des alten Gebäudes nur noch zu besonderen Anlässen und wenn mein Dad und ich Studierenden ein paar Grundkenntnisse in Gälisch vermittelten. Leider waren einige mehr an der Abendkultur und einem meiner besten Freunde interessiert gewesen als an Vokabeln.
»Alles in Ordnung bei dir?«, fragte ich leise, als Eoin und Cormac sich in ein Gespräch über besagte Gruppe aus Studentinnen vertieften. Pádraig hob die Schultern und pustete sich eine Strähne seines blonden Haars aus der Stirn.
»Keine Ahnung. Findest du es nicht ein bisschen komisch, wieder hier zu sein?«
Ich runzelte die Stirn. »Was meinst du?«
Das halbvolle Pint-Glas in der Hand deutete er durch den Raum. »Dieselben Gesichter …« Er schwenkte das Glas zu unseren beiden Freunden. »… die gleichen Gespräche. Heute Abend die gleiche Musik, das gleiche Essen und das gleiche Rugbyspiel.«
»Na, ich hoffe nicht. Letztes Mal hat Connacht verloren«, erwiderte ich grinsend. Meine Mundwinkel senkten sich jedoch ganz von selbst, als ich sah, dass mein bester und ältester Freund die Geste nicht erwiderte. Nicht zum ersten Mal hatte ich das Gefühl, dass das Band unserer Freundschaft immer poröser wurde. Im Gegensatz zu mir studierte er nicht in Galway, sondern in der Hauptstadt. Zwar sahen wir uns immer noch regelmäßig, doch irgendetwas zwischen uns hatte sich mit Beginn der College-Zeit verändert, und ich konnte nicht benennen, was es war.
Klar, seit uns nicht länger fünf Minuten Fußweg, sondern Kilometer voneinander trennten, sprachen wir seltener miteinander, doch das konnte kaum das Problem sein, immerhin war mit Eoin und Cormac weiterhin alles okay. Pádraig hingegen wurde von Mal zu Mal unzufriedener und wortkarger, kam immer seltener nach Hause. Wir vertrauten uns nach wie vor Dinge an, doch wir taten es nicht mehr mit Leichtigkeit, sondern aus Gewohnheit.
»Es tut sich einfach nichts«, sprach er weiter. »In Dublin ist kein Tag wie der andere.«
»Aber Routinen haben doch auch ihre Vorteile. In Dublin juckt es keinen, wenn du krank bist. Hier stehen gleich fünf Leute mit Hühnersuppe oder Medikamenten auf der Matte.«
»Ja, weil alle ihre Nase überall reinstecken.«
Ich hob die Brauen. Es war natürlich nicht das erste Mal, dass Pádraig sich über unsere kleine Gemeinde ausließ. Doch meist tat er es im Scherz. Jetzt jedoch klang er bierernst, hatte die grauen Augen frustriert zu Schlitzen verengt. Ein ungutes Gefühl machte sich in mir breit, denn so sehr ich den Gedanken beiseitedrängen wollte: Er erinnerte mich immer mehr an Cian.
»Ist was passiert? Oder woher kommt das alles?«
»Nein, es ist vielmehr all das, was hier nicht passiert.« Pádraig schwenkte sein Glas in der Hand, sodass ein kleiner Strudel in der dunklen Flüssigkeit entstand. Eine Weile beobachtete er ihn stumm, dann hob er den Blick und sah mich an. »Ich werde nach Australien ziehen. Ich mach das Physikstudium in Sydney fertig.«
»Was?«, fragte ich so laut, dass Cormac und Eoin die Köpfe zu uns herumschnellen ließen.
»Ich kann fast all meine Credits mitnehmen, muss nur einen Kurs nachholen, aber das wird kein Thema. Das akademische Jahr ist da anders getaktet als hier, also hab ich noch etwas Zeit. Aber zum nächsten Semester bin ich weg. Meine Mams wissen es natürlich schon, Grandma auch. Ich wollte es euch eigentlich schon früher sagen, aber ich wusste nicht wie …« Er hob die Schultern. Die roten Flecken auf seinen Wangen waren das einzige Indiz dafür, wie nervös er war. Ansonsten wirkte er ruhig, seine Stimme beinahe gleichgültig.
In mir jedoch war alles taub. Pádraig durfte nicht gehen. Nicht auch noch er.
»Warum?«, fragte ich, und hätte ich mich nicht so sehr aufs Ein- und Ausatmen konzentriert, die Tonlosigkeit meiner Stimme hätte mich mit Sicherheit erschreckt.
»Hab ich doch grad gesagt … Ich will einfach mehr. Mehr vom Leben, Chancen in der Karriere, ich …«
»Und das kannst du nicht in Irland haben, oder was?«
Cormac und Eoin sagten nichts, sahen nur von Pádraig zu mir und wieder zurück, als wären wir die eigentliche Attraktion des Abends, nicht das Spiel, das mit Rufen kommentiert wurde, die kaum an mein Ohr drangen.
»Wo denn? Soll ich nach dem Studium zurück nach Baile na Mara? Soll ich in meiner ranzigen Mietwohnung in Dublin bleiben? Später bei Google oder Facebook einsteigen? Ganz ehrlich, was haben wir denn sonst?«
»Ryanair!«, warf Eoin nun doch ein, hörte aber schlagartig auf zu lachen, als ich ihm einen bitteren Blick zuwarf.
»Also lässt du all das einfach zurück? Deine Heimat? Genauso wie Cian?«
»Cian wirkt recht glücklich in Kanada.«
Ich stieß ein ungläubiges Lachen aus. Cian hatte sich bereits nach der Schule aus dem Staub gemacht. Dass Pádraig es ihm nun gleichtun wollte … Mein Blick schoss zu dem alten Foto von uns sechs. Somit waren wir nur noch vier. »Ich fass es nicht.«
»Conor, wir haben hier keine Perspektive.«
»Ach ja? Und wer bist du, dass du so allwissend bist?«
»Das hat nichts damit zu tun, dass ich allwissend bin, schau dir doch die Zahlen an. Es gibt kaum Jobs, wenn, dann sind es beschissene Arbeitsplätze, und bezahlbare Wohnungen kannst du sowieso knicken. Du klammerst dich an ein sinkendes Schiff und kippst eimerweise Wasser über Bord, obwohl das Loch immer größer wird. Das ist naiv.«
»Pádraig …«, warf Cormac ein, doch ich schüttelte bloß den Kopf, leerte mein Bier in wenigen Zügen, wischte mir über den Mund und stand auf. Ich hatte das nicht nötig. Schon als ich mich für mein Studium entschieden hatte, war Pádraig der Meinung gewesen, ich sollte lieber etwas Sinnvolles tun, als mich an eine sterbende Sprache zu klammern.
»Dann bin ich eben naiv, aber wenigstens trete ich unsere Kultur und Freundschaft nicht mit Füßen. Viel Spaß in Australien.«
»Hey, Conor, jetzt warte doch«, rief Eoin mir hinterher, als ich mich zum Gehen wandte. Doch in meinen Ohren rauschte das Blut, und hinter meinen Augen brannten kindische Tränen. Ich fühlte mich verraten. Von Pádraig, Cian, der Tatsache, dass sich mein Freundeskreis mehr und mehr ausdünnte und ich nichts dagegen tun konnte. Es war mein größter Traum, all das am Leben zu erhalten: unsere Sprache, unsere Kultur, Baile na Mara. Meine Heimat. Und nun verlor ich immer weitere Stücke davon und konnte nichts tun, als hilflos zuzusehen. Vielleicht hatte Pádraig recht, und ich war naiv. Vielleicht war alles längst verloren.
Als ich die Tür unseres Hauses aufstieß, raste mein Puls immer noch, und in meinem Kopf pochte es. Ich wollte nichts sehnlicher, als mich einfach auf das Bett meines alten Kinderzimmers zu werfen. Meine Eltern waren unterwegs, ebenfalls das Spiel schauen, allerdings bei Freunden. Gaiman begrüßte mich maunzend und strich ein Mal um meine Beine, bevor er sich wieder auf seinen Kratzbaum vor der Heizung verzog. Mein Zwillingsbruder Declan saß mit Sicherheit in seinem Zimmer und schrieb Bewerbungen oder schaute Netflix. Er hatte Sport noch nie viel abgewinnen können. Kurz überlegte ich, ihm die Neuigkeiten mitzuteilen, immerhin war Pádraig genauso sein Freund wie meiner – doch ich wollte mich nicht damit beschäftigen. Wollte vielmehr Ablenkung von all dem.
Ich nahm mein Handy hervor und überlegte, Sarah zu schreiben. Sie schaffte es immer, mich zu erden, ganz gleich, was mich bedrückte. Ich hatte gerade den Haustürschlüssel in die Schale auf der Kommode geworfen und mein Handy aus der Jeanstasche genommen, als ich einen Laut von oben vernahm. Irritiert hob ich den Kopf und starrte zur Treppe, die vom Flur aus einen Stock höher führte. Es klang nach Declan.
Ich schüttelte den Kopf. Vielleicht zockte er auch und verlor mal wieder bei Counter Strike. Ich öffnete den Chat mit Sarah und lief langsam nach oben, doch noch bevor ich die Nachricht abgeschickt oder das Ende der Treppe erreicht hatte, hörte ich wieder ein Geräusch. Diesmal fuhr es mir durch Mark und Bein. Meine Finger stoppten in der Bewegung, schwebten über den Tasten auf meinem Display.
»Ja!«
Nein.
Mir wurde heiß und kalt zugleich. Ich ließ meine Hand mit dem Smartphone sinken. Denn die Stimme, die nun in ein Stöhnen überging, kannte ich. Ich kannte sie so gut. Es war dieselbe Stimme, die mir noch gestern Nacht zärtliche Worte ins Ohr geflüstert hatte. Die sich vor knapp drei Stunden von mir verabschiedet hatte. Die vor zwei Jahren das allererste Ich liebe dich, das ich je ausgesprochen hatte, erwidert hatte. Die Stimme, die ich den Rest meines Lebens an meiner Seite wissen wollte.
Wie betäubt erklomm ich die restlichen Stufen, packte mein Handy weg, ohne die Nachricht abzuschicken, und kam vor Declans Tür zum Stehen, die Hand bereits an der Klinke.
Ich kniff die Augen zusammen. Wollte meine Finger nicht nach unten bewegen, nicht sehen, was sich vor meinem inneren Auge ohnehin schon abspielte. Doch bei dem nächsten Laut – einem tiefen Stöhnen meines Bruders – stieß ich die Tür dennoch auf.
Wenn mein Blut eben durch meinen Körper gerast war, dann war ich mir sicher, dass es jetzt stehen blieb. Mein Herz zumindest tat es bei dem Anblick, der sich mir bot. Es war, als liefe alles um mich herum in Zeitlupe ab, grausam langsam, damit ich jedes Detail genau aufnehmen und abspeichern konnte.
Declan rappelte sich auf und fuhr herum, die Augen geweitet, das dunkelblonde Haar verwuschelt. Als er sich vom Bett in den Stand rollte, bestand keinerlei Zweifel mehr, wer bis eben unter ihm gelegen hatte. Mit einem überraschten Keuchen zog Sarah sich die Decke vor die Brust, als ob ich derjenige war, vor dem sie ihren Körper verstecken musste. Auf ihrer Miene wechselten sich die Emotionen ab – Überraschung, Entsetzen, Reue –, während in mir alle erkalteten.
»Conor!« Mein Bruder schnappte sich sein Shirt vom Schreibtischstuhl und hielt es sich vor den Schritt, die andere Hand streckte er nach mir aus. »Ich kann das …«
»Was, erklären?« Ich schluckte gegen den Kloß in meinem Hals an und sah zu meiner Freundin, die nach wie vor regungslos auf dem Bett saß. Ihre dunkelbraunen, glänzenden Haare fielen ihr in unordentlichen Strähnen über die Schulter. Sie machte keine Anstalten, sich zu rühren oder etwas zu sagen. »Ich hab im Sexualkundeunterricht aufgepasst, Erklärungen sind nicht nötig.«
Keine Ahnung, was mehr wehtat: Sarahs Betrug, Declans Verrat oder die Tatsache, dass es schon das zweite Mal heute war, dass ich das Gefühl hatte, jemand würde mir das Herz mit der Faust zusammendrücken. Vermutlich hätte ich sauer sein müssen. Dinge durch die Gegend werfen sollen. Doch das Gegenteil war der Fall. Alles hatte sich verlangsamt, schien stillzustehen, und ich war nur taub. Da waren keine Emotionen mehr in mir, nur Kälte, ganz so, als hätte dieser Tag mir alles an Gefühlen gestohlen.
Endlich rührte Sarah sich, machte Anstalten, sich zu erheben, doch es war zu spät. Ich wollte keine Erklärungen, keine falschen Entschuldigungen oder Ausflüchte hören. Also drehte ich mich um, trat aus dem Zimmer und ließ den Anblick hinter mir, der sich unwiderruflich in mein Gedächtnis gebrannt hatte.
Vielleicht hatte Pádraig recht, und ich war naiv. Vielleicht waren meine Träume und das Leben, das ich mir ausmalte, nicht möglich, die Hoffnung vergebens. Vielleicht waren die Enttäuschungen heute nur der Anfang von allem.
1. KAPITEL
Caroline
Ob meine Mutter endlich aufhören würde zu reden, wenn ich die Gabel statt ins überteuerte Steak in meinen Handrücken ramme? Für einen kurzen Augenblick spiele ich mit dem Gedanken, entscheide mich dann jedoch, das Besteck einfach sinken zu lassen. Die Gabel hinterlässt ein klirrendes Geräusch, als sie den Teller trifft, doch selbst das stoppt meine Mutter nicht.
»Ich weiß noch genau, wie ich mich damals gefühlt hab.« Sie sieht mit verklärtem Blick zu meinem Vater. »Noch einmal jung sein und studieren, das wär’s.«
Ich befehle meinen Mundwinkeln, sich zu heben. So wie vor drei Minuten noch, als sie von der Kanzlei schwärmte, die sie mit meinem Dad gegründet hat und in die ich nach meinem Studium eintreten muss. Nein, darf. Denn das Schlimmste an all dem? Ich habe diesen Weg selbst gewählt. Mir meine persönliche Straße direkt in die Hölle gepflastert.
»Na, komm schon. Wir haben uns auch oft genug über das Lernpensum beschwert«, gibt mein Vater mit einem Zwinkern in meine Richtung zurück. Seine vollen Lippen, die meine Schwester und ich von ihm geerbt haben, verziehen sich belustigt.
Ob sie überhaupt merken, dass ich nicht mehr esse? Vermutlich nicht. Für meine Familie ist alles wieder okay. Zwar bemühen sie sich immer noch, regelmäßig zu betonen, wie schön das Leben ist, doch ich schauspielere mittlerweile gut genug, um sie glauben zu machen, dass auch ich es wieder liebe. Das Jahr Therapie hat zwar dafür gesorgt, dass zumindest nicht mehr alles furchtbar ist, doch an den meisten Tagen ist nun alles gleichgültig – und ich bin mir noch nicht im Klaren darüber, ob das wirklich eine Verbesserung darstellt.
Wenn man meine Eltern fragt, ist das wohl so, denn für sie tue ich endlich das Richtige. Schludere nicht mehr rum. Sorge nicht länger für Lücken im Lebenslauf, die ihrer Meinung nach so schlimm sind wie meiner nach die Monotonie, die mich nun tagtäglich erwartet, nur unterbrochen von den gelegentlichen Partys am Wochenende. Alleinig die Trennung von Manuel finden sie nach wie vor ebenso unerfreulich wie unverständlich. Ich weiß, dass sie darauf hoffen, dass ich wieder zur Vernunft komme. Dass wir uns einvernehmlich getrennt haben, dass es daran liegt, dass ich kaum noch etwas fühle, innerlich leer bin, das können sie nicht wissen. Sollen sie auch nicht. In ihren Augen werde ich erwachsen. In ihren Augen ist meine Trauer ein Teil der Vergangenheit und nicht der ständige Begleiter, der einfach nicht von meiner Seite weicht. Letzte Woche Mittwoch bin ich mit Samthandschuhen angefasst worden. Einen Tag lang. Nadines Todestag. Jetzt wiederum habe ich zu funktionieren, immerhin ist es nun über eine Woche später, ein gewöhnlicher Freitag. Doch Trauer ist nichts, was man verpacken, fest verschnüren und außer Sichtweite legen kann. Man kann sie nicht gezielt auspacken und sich ihr zu besonderen Anlässen stellen. Vielmehr überrollt sie einen wie eine Lawine, hinterrücks, losgetreten von den kleinsten Dingen, und begräbt einen unter sich, ohne Luft zum Atmen zu lassen.
»Dann warte mal das Staatsexamen ab«, sagt meine Schwester Lena mit einem Lachen. »Da dachte ich wirklich, ich sterbe.«
Das macht natürlich Hoffnung. Ich fühle mich jetzt schon wie tot.
»Da hab ich bei Caroline keine Bedenken. Sie hat schon immer hervorragende Noten gehabt, das wird an der Universität nicht anders sein.«
Ja, genau das ist auch meine Befürchtung. Wenn ich wenigstens schlecht wäre in dem, was ich tue, würden meine Eltern sicher von dem Gedanken ablassen, dass ich in die Kanzlei einsteige. Doch Lernen lag mir schon immer, und ich habe das ungute Gefühl, dass sich das auch mit Studienbeginn nicht ändern wird. Bei meiner Ausbildung zur Grafikdesignerin beispielsweise war es genauso. Doch Freude empfand ich nicht dabei, und das hat schließlich dazu geführt, dass ich im zweiten Lehrjahr abgebrochen habe. Diesmal jedoch, so betonen meine Eltern bei jeder sich bietenden Gelegenheit, würde ich es durchziehen.
Das, was meine Mutter sich zurückwünscht, die glücklichen Erinnerungen ans Studieren – an die glaube ich nicht. Ich habe jetzt schon keine Lust auf das Studium, und wenn ich an das große, unbekannte Danach denke, graut mir davor noch mehr. Denn was erwartet mich dann? Ein Leben in der Kanzlei meiner Eltern. Bis zur Rente. Der bloße Gedanke sorgt dafür, dass das teure Essen plötzlich bleischwer in meinem Magen liegt und sich das große, schicke Restaurant mitsamt seinen funkelnden Kronleuchtern dunkel und beengend anfühlt. Nadine war die Einzige, die meine »Findungsphase«, wie meine Eltern es betiteln, nicht für verschwendet gehalten hat. Die Praktika nach dem Abi – von der Tierarztpraxis bis hin zur Zeitungsredaktion –, die abgebrochenen Ausbildungen zur Erzieherin und Grafikdesignerin, das angefangene Modestudium und das Praktikum in einer Marketingagentur danach. Sie hat mich ermutigt, alles auszuprobieren. Sie hat mir sogar vom Jurastudium abgeraten, doch mit ihr ist auch jegliche Kraft aus meinem Leben verschwunden, mich noch für Dinge einzusetzen. Ich nehme das Sektglas und trinke ein, zwei Schlucke der perlenden Flüssigkeit, aber es hilft nichts.
»Alles in Ordnung?«, fragt meine Mutter nun doch und zieht die perfekt gezupften Brauen zusammen. »Schmeckt es dir nicht?«
»Alles bestens«, erwidere ich und lächle ihr zu. »Hab einfach nicht so viel Hunger.«
Sorge blitzt in ihrem Gesicht auf, und ich zwinge mich, das Lächeln meine Augen erreichen zu lassen. Ich will meine Eltern nicht beunruhigen. Sie tun ihr Bestes und wollen auch für mich nur das Beste. Ich kann ihnen nicht einmal vorwerfen, mich gedrängt zu haben. Sie haben mir Zeit und Raum gegeben, um mich auszuprobieren, mir Ausbildungen und Praktika finanziert. Doch nichts davon fruchtete, ich bin von Berufswunsch zu Berufswunsch gesprungen, ohne dass mich etwas begeistert hat. Als ich nach Nadines Tod gar keinen Antrieb mehr hatte, haben sie interveniert und mir ein Ultimatum gestellt. Ihrer Meinung nach ist Struktur das, was mich wieder auf die rechte Bahn lenkt. Ein Ziel, ein klar gegliederter Alltag, dem ich folgen kann, ohne auf dumme Gedanken zu kommen. Ich kann es ihnen nicht verübeln. Zum einen ist ihre erfolgreiche Kanzlei der beste Beweis, dass ihr Weg funktioniert, zum anderen weiß ich ja selbst nicht, was mit mir nicht stimmt. Allen in der Gruppentherapie ist es irgendwann besser gegangen. Sie haben gelernt, diesen neuen Weg im Leben zu gehen, haben sich durch ihre Trauer gekämpft, Hobbys und Aufgaben gefunden. Nur ich bin auf der Stelle getreten. Während um mich herum laufend wechselnde Menschen auf den Stühlen gesessen haben, war es, als wäre ich mit meinem verwachsen. Bis ich irgendwann angefangen habe, zu simulieren. Mir Geschichten auszudenken. Eine Maske aufzusetzen. Das mag unehrlich sein, doch es funktioniert und ist zu einem Schutzschild geworden, den ich nicht mehr ablege.
»Du brauchst die Stärkung«, sagt mein Vater und deutet mit seinem Messer auf das nicht aufgegessene Stück Fleisch. »Erzähl mir nicht, dass du seit deinem Einzug ins Wohnheim vor zwei Wochen etwas anderes als Spaghetti gegessen hast, ich kenn dich.«
»Jetzt lasst sie doch«, erwidert Lena und wirft mir einen verschwörerischen Blick zu. So schwer es manchmal auch ist, ihre Schwester zu sein, setzt sie sich doch stets für mich ein. Genau wie Nadine es immer getan hat. Womöglich haben sich die beiden deshalb so gut verstanden.
»Ich hatte nicht nur Spaghetti«, verteidige ich mich. Und das ist nicht gelogen – an manchen Tagen waren es Farfalle, an anderen gab es Fusilli. Auch wenn das sicher nicht die Art abwechslungsreicher Ernährung ist, die meinem Vater vorschwebt.
»Auf jeden Fall sind wir sehr stolz auf dich«, sagt meine Mutter und hebt zum wiederholten Mal an diesem Abend ihr Glas. Mein Vater tut es ihr gleich.
»Ja, schön, dass du endlich etwas gefunden hast. Manchmal liegt das Glück näher, als man glaubt.« Mein Vater stößt ein leises Lachen aus, bevor er das Glas an seine Lippen führt.
»Ja«, bestätige ich und zwinge mir ein Lächeln aufs Gesicht. Ich trage es immer, wenn ich über das am Montag startende Studium rede, kein Wunder, dass meine Eltern denken, dass ich mich wirklich darauf freue. Ebenso wenig wundert es mich, dass sie glücklich darüber sind, dass ich endlich in ihre Fußstapfen trete. Meine bisherige berufliche Laufbahn ist nicht gerade eine, die dem Namen Schulte Ehre macht. Zum wiederholten Male wünsche ich mir, ich wäre mehr wie Lena. So ähnlich wir uns mit unseren blonden, welligen Haaren und den grünen Augen optisch sind, so unterschiedlich sind wir in unserem Inneren. Sie ist eine gerade Linie, die Zielstrebigkeit in Person, ich bin ein verworrenes Labyrinth und finde wieder und wieder den Weg nicht.
Aber ist es denn so schlimm, Dinge austesten zu wollen? Schon als Kind habe ich die Berufswünsche gewechselt wie Unterwäsche. Doch woher soll ich auch wissen, was ich den Rest meines Lebens tun möchte? Woher weiß es irgendjemand? Wir Menschen ändern uns doch. Dem Jurastudium habe ich in erster Linie deshalb zugestimmt, weil es mir Zeit erkauft, bis ich mich den Mühlen des Berufslebens stellen muss.
»Wo wir schon bei Glück sind: Gibt es da was Neues?«, wirft meine Mutter ein und wackelt mit den Augenbrauen, als wäre Glück immer gleichbedeutend mit Liebesglück.
»Nein«, erwidere ich knapp.
»Und wie geht es Manuel so? Wir haben ihn viel zu lang nicht mehr zu Gesicht bekommen.«
Wow, sehr subtil, Mama. Ich hätte wissen müssen, dass sie darauf hinauswill. Tatsächlich hat sich Manuel gemeldet. Letzte Woche, natürlich hat er Nadines Todestag nicht vergessen. Uns hat es nur im Doppelpack gegeben, und so ist sie mit der Zeit auch eine seiner Freundinnen geworden. Doch mehr als gemeinsame Erinnerungen – an Nadine und unsere Beziehung – verbindet Manuel und mich nicht länger. Er war meine erste Liebe, mein erster Freund, und auch wenn es von außen wirken muss, als hätte Nadines Tod für unsere Trennung gesorgt, so war das Feuer, das uns einst verbunden hat, eigentlich längst erloschen. Nadines Tod hat nur den Willen in mir erstickt, für die Beziehung zu kämpfen. Wie hätte ich auch für uns kämpfen sollen, wenn mir sogar die Kraft fehlt, es für mich selbst zu tun?
Ich merke voll schlechtem Gewissen, dass mich das nicht groß stört. Selbst nach unserer Trennung habe ich nicht getrauert. Er ist bloß ein weiterer Mensch, den ich verloren habe, und ehrlich gesagt ist es eine Erleichterung. Denn wären wir noch zusammen, wäre er hier, und somit säße eine Person mehr am Tisch, die ich belügen müsste.
»Gut, denke ich«, antworte ich schließlich nach einer zu langen Pause. Anstatt mein Steak weiterzuessen, greife ich zu meinem Glas und trinke drei große Schlucke, was mir einen skeptischen Blick von Lena einbringt.
»Alles okay?«, murmelt sie hinter vorgehaltener Serviette, mit der sie sich gerade den Mund abtupft. »Wenn dir das heute alles zu viel ist, sag Bescheid. Dann lass ich mir was einfallen.«
Ich spiele gerade mit dem Gedanken, das Angebot in Anspruch zu nehmen, als meine Mutter einen überraschten Laut ausstößt.
»Rosaline? Dirk?«, erklingt eine fremde Stimme.
Ich drehe mich zu der Frau um, die gerade freudestrahlend auf unseren Tisch zuläuft. Sie trägt einen schicken dunkelroten Hosenanzug und hat die schwarzen Haare mit einer Spange hochgesteckt. Noch jemand, der sein Leben absolut im Griff zu haben scheint.
»Was für ein Zufall, euch hab ich ja ewig nicht gesehen!«
Meine Mutter steht auf und umarmt die Frau. Ich kenne sie, bin jedoch nicht sicher, woher.
»Annalena, wie schön, dich mal wiederzusehen. Ich hab auf Facebook gelesen, dass ihr zurück nach München gezogen seid. Ist dein Mann auch da?«, fragt meine Mutter und sieht sich um.
»Nein, nein. Der ist für einen geschäftlichen Termin unterwegs, ich bin allein hier. Du mit der Familie, wie ich sehe?« Sie dreht den Kopf zu uns, und ich setze das Lächeln auf, das ich mir für Situationen wie diese antrainiert habe.
»Hallo, Lena. Oh, und du musst Caroline sein. Dich hab ich zuletzt gesehen, da gingst du mir noch bis hier.« Sie deutet mit der Hand zu ihrer Hüfte. Das erklärt dann wohl, wieso ich sie nicht zuordnen kann. »Schön, dich mal wiederzusehen.«
»Ebenso«, erwidere ich.
»Caroline beginnt jetzt zum Wintersemester auch ihr Studium.«
»Ach, toll. Ebenfalls Rechtswissenschaften?«
Ich nicke, was jedoch nicht nötig gewesen wäre, da meine Mutter sofort das Wort ergreift. »Ja, jetzt haben wir bald eine richtige Familienkanzlei, genau wie ihr«, meint sie lachend.
»Das ist schön! Ihr müsst so stolz sein. Lasst uns doch bald mal zusammen essen gehen, ja? Es gibt bestimmt etliche neue Lokale in München, die Stadt hat mir wirklich gefehlt.«
»Sehr gern. Mit der ganzen Familie?« Meine Mutter dreht sich kurz zu uns um, ihr Blick liegt auf mir. »Wer weiß, vielleicht wäre eure Kanzlei sogar was für ein Praktikum.«
Ich beiße mir so fest auf die Innenseiten meiner Wangen, dass es wehtut.
»Sie können sich die drei Monate Praktikum aufteilen, damit es in die vorlesungsfreie Zeit passt. Also beispielsweise dreimal vier Wochen. Das ist, denke ich, am sinnvollsten. Es sei denn, Caroline möchte für eine der Praxisphasen länger ins Ausland. Aber bei euch kann sie sicher sehr viel lernen.«
»Na klar, das denke ich auch!«, sagt Annalena und wirkt aufrichtig erfreut, als sie zu mir blickt. »Du kannst gerne jederzeit vorbeikommen und dir die Kanzlei mal anschauen, Caroline. Wir sitzen in Maxvorstadt, gar nicht so weit von der Uni entfernt. Melde dich einfach. Warte, ich gebe dir noch schnell meine neue Nummer, Rosaline.«
Ich beobachte meine Mutter und Annalena dabei, wie sie Nummern austauschen, und schenke mir von dem Sekt nach. Ich sollte dankbar sein. Ich bin mir sicher, andere träumen von den Chancen und der Unterstützung, die mir so ohne Weiteres zuteilwird. Doch ich fühle mich nicht dankbar, ich fühle mich einfach nur leer.
Zwei Stunden später lasse ich die Tür unserer Wohnheim-WG mit einem lauten Knall ins Schloss fallen. Mit der freien Hand stütze ich mich an der grau gestrichenen Wand im Flur ab, mit der anderen umklammere ich die Tasche, als wäre sie das Letzte, was mich aufrecht hält. Ich habe definitiv zu viel Sekt getrunken. Ich lasse die Tasche fallen, ziehe Mantel und Schal aus und hänge sie an die Garderobe zu meiner Rechten, neben der noch immer ein paar Umzugskartons stehen, dabei sind wir seit fast drei Wochen hier drin. Ich mache mich gerade an den Reißverschlüssen meiner Stiefel zu schaffen, als Veronika aus ihrem Zimmer kommt.
»Hey! Na, wie war das Essen?«
Ich kicke die Stiefel in die Ecke zum Schuhregal und lehne mich seufzend gegen die Wand.
»So schlimm?« Vero lacht, was ihre langen, goldenen Ohrringe zum Wackeln bringt. Sie trägt ein kurzes dunkelgrünes Kleid, und ihre schulterlangen braunen Haare sind zu sanften Locken gedreht. »Willst du doch noch mit ausgehen? Heute ist ein Ersti-Treffen. Eigentlich von den Medizinern, aber ich hab vorgestern einen von ihnen kennengelernt.«
Sie wackelt mit den Brauen, und mein schlechtes Gewissen macht sich bemerkbar – die Uni hat uns diese WG im Wohnheim zugeteilt, weil wir beide im ersten Semester Rechtswissenschaften studieren. Doch im Gegensatz zu mir hat Vero Lust auf das alles: das Studium, die Partys, die durchgemachten Nächte mit irgendwelchen Jungs. Sie wäre wohl mit jeder anderen Mitbewohnerin besser dran.
»Ich hab heute schon mehr als genug getrunken«, sage ich und fahre mir durch die langen, welligen Haare, die noch nasskalt vom Oktoberwetter sind. Ich kann kaum erwarten, dass es wieder wärmer wird. »Ich glaub, ich bleib heute Abend ausnahmsweise mal daheim. Nächstes Mal wieder, ja?«
»War es so schlimm mit deinen Eltern?«
Veronika weiß, dass Jura nicht mein Traumstudium ist. Das habe ich ihr beim ersten Umtrunk in der neuen WG offenbart. Doch wie sehr ich es hasse, habe ich sowohl bei unserem Einzug als auch bei den Partys danach wohlwissend für mich behalten. Ich will mich nicht unbeliebt machen, immerhin wohne ich erst knapp drei Wochen im Wohnheim, und dass meine Eltern beide Anwälte sind, verschafft mir auch so schon einen unfairen Vorteil, wie das Aufeinandertreffen mit Annalena eben zu gut gezeigt hat. Wenn ich dann noch zugebe, das alles nur aus Alternativlosigkeit zu tun …
»Ne, nicht schlimm. War nur etwas anstrengend, und ich bin echt müde.«
Veronika hebt die Schultern. »Na gut. Wenn du es dir anders überlegst, schreib einfach, ja?«
»Mach ich, danke. Dir einen schönen Abend.«
»Dir auch«, erwidert Vero, nimmt ihre High Heels aus dem Schuhschrank und zieht eine Lederjacke von der Garderobe, in der sie bei dem Wetter sicher erfrieren wird. Vero ist super, und in einem anderen Leben würden wir sicher Freundinnen werden. Sie bemüht sich stets, mich bei allem einzuschließen – egal ob Kaffee mit den anderen im Wohnheim oder Partys –, und wir haben bereits bei unserem Einzug einen Pakt geschlossen, dass wir die Mitschriften miteinander tauschen und zusammen lernen – der perfekte Start ins Unileben. Doch wie soll irgendjemand eine Chance haben, wenn ich alle Menschen, die ich kennenlerne, direkt mit Nadine vergleiche? Mir ist klar, dass das unfair ist, dass niemand sie ersetzen kann, aber sobald eine neue Bekanntschaft nicht über die gleichen flachen Witze lacht, meine Leidenschaft für französische Arthouse-Filme nicht teilt oder sich sonst irgendwie von Nadine unterscheidet, hat sie bereits verloren. Ich habe die beste Freundin gehabt, die ich mir hätte wünschen können. Wenn überhaupt zeigen die neuen Bekanntschaften mir, wie glücklich ich mich schätzen kann, so eine Freundschaft erlebt zu haben. Der Verlust mag umso schwerer wiegen, aber unsere Erinnerungen tun es auch.
Ich biege nach links in mein kleines, aber gemütliches Zimmer ab. Viel mehr als ein Kleiderschrank, mein Arbeitsplatz und mein Bett passen nicht hinein, aber ich habe mir mit Lichterketten, Grünpflanzen, Bildern und einigen Büchern einen Rückzugsort geschaffen. Ich knipse die Stehlampe neben meinem Schreibtisch an, die den Raum in warmes, gemütliches Licht taucht, dann werfe ich mich aufs Bett und entsperre mein Handy. Wie von selbst finden meine Finger den Chatverlauf und beginnen zu tippen.
Caroline, 19.43 Uhr:
Ich hatte recht. Der Tag war ein Desaster. Das Schlimmste ist, wie stolz meine Eltern sind. Nein, gar nicht. Das Schlimmste ist, wie wenig stolz du wärst. Schätze, ich hab jetzt ein Praktikum in einer angesehenen Kanzlei, noch bevor das Studium überhaupt losgeht. Klasse, oder?
Caroline Schulte, Rechtsanwältin. Ich kann das goldene Namensschildchen schon vor mir sehen.
Wenn ich an die nächsten Jahre denke, wird mir schlecht. Ich wünschte, du wärst hier. Ich wünschte, du würdest mir sagen, dass alles okay wird. Dass das nicht für immer ist, es nie zu spät ist, eine neue Richtung einzuschlagen. Ich wünschte, du würdest mir meine Jacke zuwerfen und mich in eine deiner Münchner Karaokebars ziehen und so lang auf mich einreden, bis wir auf die Bühne gehen.
Ich vermisse das. Die spontanen Aktionen. Dieses Gefühl von Leben. Das Lachen. Dich.
Ich drücke auf Senden, und wie jedes Mal starre ich so lang auf den einzelnen, einsamen Haken, bis mein Display dunkel wird. Dann erst lege ich das Smartphone zur Seite und schließe die Augen. Die Nachrichten an Nadine sind mein tägliches Ritual geworden. Wie ein Tagebuch, nur dass sie mir erlauben, mich einen Moment lang der Illusion hinzugeben, dass sie antworten könnte. Noch beim Schreiben male ich mir ihre Antworten aus, fühle mich ihr zumindest einige Minuten lang näher. Ein Blick auf ihr Profilbild genügt, und schon höre ich ihre Stimme, den Klang ihres Lachens. Sehe die kleine Zahnlücke zwischen ihren Schneidezähnen, die sie sich nie hat korrigieren lassen, einfach weil sie zu ihr gehört. Weil Nadine noch nie etwas anderes als sie selbst war.
Leider wird das Gefühl, dass sie mir nicht einfühlsam zurückschreiben, sondern mir in Großbuchstaben antworten und mich anbrüllen würde, mit jedem verstreichenden Tag größer. Sie würde meine Apathie hassen. Nadine war der kreativste Mensch, den ich jemals kennenlernen durfte. Ihre YouTube- und TikTok-Videos begeistern selbst jetzt noch Tausende Menschen. Ich checke ihre Social-Media-Accounts jede Woche, auch wenn ich die Videos rechtzeitig pausiere, bevor Nadine mit ihren Songs beginnt. Ich verkrafte es, sie zu sehen, immerhin habe ich etliche Fotos von uns an den Wänden. Auch alte Sprachnachrichten höre ich ab und an. Doch ihr Gesang ist zu viel. Ihre Stimme hat einen anderen Klang, wenn sie singt. Verletzlich und doch so deutlich, als ob sie alle Wahrheiten der Welt beinhaltet. Es ist unfair, dass sie nicht mehr Zeit bekommen hat, denn ich bin mir sicher, dass sie in spätestens drei Jahren auf den großen Bühnen der Welt gestanden hätte.
Ich öffne die Augen wieder und sehe zu der Wand neben meinem Bett, die eine Lichterkette und etliche Polaroids zieren. Nadine und ich beim Karaoke, Nadine und ich beim Zelten, Nadine und ich beim Mottotag kurz vor unserem Abitur. Beim Anblick der Fotos zieht sich mein Herz schmerzhaft zusammen. Nicht nur, weil ich sie so sehr vermisse, sondern auch, weil ich mich so sehr vermisse. Mein Lachen, meine Begeisterung für Dinge, meine Neugier, alles auszuprobieren, meine Vorfreude auf die Welt und all das, was sie bereithält. Ich schlucke, und die vier Wände meines kleinen Zimmers sind mir plötzlich zu eng. Ich brauche Ablenkung.
Mit den Dutzenden Kissen auf meinem Bett baue ich mir eine Art Rückenlehne, hole meinen Laptop und decke mich dann, an die Wand gelehnt, wieder zu. Ich scrolle erst durch Netflix, dann Amazon und lande schließlich auf YouTube, unschlüssig, was ich gucken soll. So richtig Lust habe ich auf nichts, doch an Schlaf ist noch nicht zu denken.
Einige Minuten später entscheide ich mich schließlich für den Vlog einer YouTuberin, die durch die Staaten reist. Ich starte das Video und will gerade die Werbung wegklicken, als ich aus Versehen darauf tippe, anstatt diese zu skippen. Genervt rolle ich mit den Augen und bin schon im Begriff, den Tab zu schließen, der aufgesprungen ist, als mein Blick an etwas hängen bleibt.
Du möchtest raus aus deinem Alltag? Dich für einen guten Zweck engagieren? Neues erleben? Lernen und wachsen?
Mein Blick schweift von den einladenden Worten hin zu den farbenfrohen Bildern, die darunter auftauchen. Ein blaues Meer, ein sehr glücklich wirkender Mann auf einem Pferd, eine Frau umringt von Hunden, eine andere mit einem Kind an der Hand in der Stadt – dazwischen immer wieder Natur. Ohne darüber nachzudenken, klicke ich auf das nächstbeste Bild.
»Freiwilligenprojekte in 56 Ländern«, lese ich leise vor, was nun auf der Seite auftaucht. »Aufenthalt von zwei Wochen bis ein Jahr.«
Mein Herz klopft schneller, und das Gefühl ist so ungewohnt in meiner Brust, dass ich mich beinahe davor erschrecke. Ich schließe YouTube, als im Hintergrund der Vlog startet, den ich bis eben noch sehen wollte, und scrolle weiter über die Seite. Firmen, Organisationen, aber auch Privatleute können hier Inserate einstellen, auf die sich Freiwillige dann bewerben. Gezahlt wird, wie es den Anschein hat, nichts, dafür gibt es eine gratis Unterkunft und eine Verpflegungspauschale.
Mein Blick huscht von links nach rechts, scannt die zahlreichen Angebote, und zu dem Herzklopfen gesellt sich ein leichtes Kribbeln. Kein aufregendes wie beim Achterbahnfahren, kein heftiges Prickeln wie beim Verliebtsein, vielmehr ein sanftes, das sich anfühlt wie der erste Schneefall – aber es ist da. Und es ist mehr, als ich seit Ewigkeiten gespürt habe. Mir ist klar, dass ich nicht schon wieder ein Studium schmeißen kann. Aber wenn bereits wenige Wochen möglich sind …
Ich schüttle den Kopf und verwerfe den Gedanken wieder. Ich bin nicht wie diese YouTuberin mit ihrem Trip durch die Vereinigten Staaten. Ich werde die Vorlesungen besuchen und die restliche Zeit vor Netflix oder Social Media verbringen, so wie es die letzten Wochen auch der Fall war. Ich bin drauf und dran, den Laptop zuzuklappen, doch irgendetwas hält mich zurück. Erneut greife ich zum Handy und öffne den Chat mit Nadine.
Caroline, 19.59 Uhr:
Was würdest du sagen, wenn ich etwas richtig Verrücktes tue?
Ich drücke auf Senden und sehe zu dem Foto an der Wand rechts von mir, das uns beide am Marienplatz zeigt – Nadine am Mikrofon, ich strahlend daneben. Es war das erste Mal, dass sie in der Öffentlichkeit gesungen hat. Etliche Menschen sind stehen geblieben, und ein älteres Paar hat Nadine einen Zwanziger in die Hand gedrückt, obwohl sie extra keinen Hut oder Ähnliches vor sich gelegt hat. Bis heute erfüllt mich der Gedanke mit Stolz. Auf Nadine, weil sie sich getraut hat, aber auch auf mich, weil es mich all meine Überredungskünste gekostet hat, dass sie sich endlich in die Öffentlichkeit wagt. Es war der Beginn von allem: ihrem YouTube-Kanal, den Songs auf Spotify und etlichen weiteren Auftritten quer durch München.
Behutsam streiche ich über das Foto, und Gewissheit setzt sich in meiner Brust fest, da, wo die Erinnerung mein Inneres wärmt. Nadine würde mich genauso bestärken wie ich sie damals.
Ich ziehe den Laptop zurück auf meinen Schoß. Was hindert mich daran, die nächsten Wochen im Ausland zu verbringen? Mich noch heute zu bewerben, meine Sachen zu packen und loszufahren? Bis der wichtige Stoff an der Uni beginnt, bin ich längst zurück. Eine kurze Auszeit, bevor der restliche Ernst meines Lebens mich einholt. Meinen Eltern müsste ich nicht einmal Bescheid sagen. Mein Herz pocht nun so heftig, dass es beinahe aus meiner Brust springt. Zum ersten Mal seit Nadines Tod spüre ich, wie Adrenalin von meinem Körper Besitz ergreift. Nur so kann ich mir erklären, dass meine Finger die Seite mit den Angeboten aus Europa öffnen. Frankreich und Norwegen fallen aufgrund der Sprachbarriere flach. Ich klicke mich weiter, angetrieben von dem Flattern in meinem Herz, meinem Bauch und meiner Brust, bis ich schließlich bei den Angeboten für Irland lande. Ich bin noch nie dort gewesen, doch schon bei den Bildern der grünen Hügel, Schafherden und Klippen steigt meine Reiselust. Irland sieht nach Freiheit aus.
Ich stoße auf die Anzeige für eine irische Farm in West Cork, bevor ich entdecke, dass ich leider mindestens sechs Monate bleiben müsste. Das passt vorn und hinten nicht mit meinem Studium zusammen. Ich filtere die Ergebnisse nach Länge und bemerke frustriert, wie die Anzahl der Inserate von 143 auf 17 schrumpft. Für das erste Ausschreiben muss man einen gültigen Führerschein besitzen – tue ich – und sich zutrauen, Pferdeanhänger durch die Gegend zu fahren – tue ich nicht, erst recht nicht im Linksverkehr.
»Hilfe in irischem Cottage direkt am Meer.« Ich hebe die Augenbrauen. »Meine Mutter braucht für wenige Wochen Hilfe im Haushalt, da sie sich von einer Operation am Knie erholt. Sie ist mobil, soll sich jedoch noch schonen und benötigt daher Unterstützung beim Einkaufen und Putzen und jemanden, der sie regelmäßig zur Physiotherapie bringt. Dafür wohnst du in erstklassiger Lage direkt am Meer, hast ein eigenes Zimmer zur Verfügung und die herzlichsten Menschen in der Nachbarschaft, die man sich wünschen kann. Das Gesuch ist kurzfristig, dein Aufenthalt würde ab sofort beginnen. Wenn du Lust hast, melde dich einfach per Mail bei uns, und wir klären alles Weitere!«
Ich überfliege die restlichen Zeilen. Ich würde zwar keinen Lohn, aber etwas Haushaltsgeld für eigene Einkäufe erhalten und könnte kostenlos in dem Cottage wohnen. Wenn ich der Anzeige glauben darf, wäre mein Tagesablauf recht entspannt und ließe sehr viel mehr Freizeit zu als die anderen Hilfsgesuche. Ich kaue auf meiner Unterlippe und lese mir das Inserat ein zweites Mal durch. Laut der Zusammenfassung in der Infobox sind es nur ein paar Wochen, sechs bis acht, um genau zu sein. Nicht ideal, da ich einiges an Stoff verpassen würde, aber wenn ich dem Pakt mit Vero Glauben schenken darf, schickt sie mir die Mitschriften sicher zu. Bis zu den Prüfungen arbeite ich alles nach.
Ein weiteres Mal gleitet mein Blick über die Website. Auf der rechten Seite sind Kontaktdaten vermerkt. Der Name der Frau, um die es geht, lautet Roisin Connolly. Kurz stolpere ich über den Vornamen, aber als jemand, der manchmal mit K, manchmal ohne E geschrieben und genauso häufig falsch ausgesprochen wird, sollte ich mich womöglich nicht wundern. Die E-Mail-Adresse gehört einem Brendan Connolly, vermutlich der Sohn, der die Anzeige eingestellt hat.
Erneut fliegt mein Blick über den Text und zu den drei Bildern, die sich darüber befinden. Ein gemütlich aussehendes violettes Häuschen mit großem Garten, ein kleines Zimmer mit Bett, Tisch, Stuhl und einer Kommode, das vermutlich meines sein würde, und ein Bild vom Meer, wie es an die Klippen peitscht, Gischt versprüht und einen Kontrast mit dem satten Grün bildet. Bevor ich es mir anders überlegen kann oder die Stimme der Vernunft mich eines Besseren belehrt, habe ich die E-Mail-Adresse kopiert und mein Postfach geöffnet.
»Dear Mr Connolly«, beginne ich, und mit jedem Wort, das ich tippe, schießt weiteres Adrenalin durch meinen Körper. Vielleicht ist es unbedacht, vielleicht lenkt mehr Sekt als Verstand meine Finger, doch in diesem Moment fühlt sich alles genau richtig an.
2. KAPITEL
Conor
Ich kann das Nein in seinen Augen schon lesen, bevor er es ausspricht.
»Leider ergab die Bonitätsprüfung, dass Sie nicht kreditwürdig sind. Ich kann Ihnen gern Angebote für kleinere Kredite zeigen, sollte das von Interesse für Ihr Vorhaben sein. Sollten Sie einen Masterabschluss anstreben, könnten Sie auch einen Studienkredit bei uns aufnehmen und von den geringen Zinsen profitieren, die …«
Ich schalte auf Durchzug. Ich will keinen verdammten Studienkredit, ich will Geld, mit dem ich auch etwas anfangen kann. Keine läppischen tausend Euro oder Ähnliches, sondern genug, um einen Unterschied zu bewirken. Wie soll mir ein Studienkredit dabei helfen, die Räume neu auszustatten, Lehrpersonal zu bezahlen oder zu renovieren?
Obwohl ich mit der Absage gerechnet habe, immerhin ist es bei Weitem nicht die erste, sinkt meine Laune noch ein Stück tiefer. Wer hätte gedacht, dass das noch möglich wäre? Der Anzugträger – Sean Carroll laut seinem Namensschild – sieht mich mit erhobenen Brauen an. Vermutlich hat er etwas gefragt.
»Danke für Ihre Zeit«, sage ich und erhebe mich. Irritiert blickt er zu mir hoch, also hat er ganz bestimmt etwas gefragt. Mit Sicherheit hat er mir gerade ein Angebot gemacht, das ich in seinen Augen nicht ausschlagen kann. Tja, falsch gedacht, Sean Carroll. Ich kann, so wie du mich mal kannst. »Slán.«
»Auf Wiedersehen«, antwortet er auf Englisch. War klar. Kein Wunder also, dass er mein Projekt nicht für kreditwürdig erachtet.
»Nicht, wenn es sich vermeiden lässt«, murmle ich, denn auch diese Bank muss ich wohl oder übel von meiner Liste streichen. Das Problem dabei? Ich habe so ziemlich alle Banken in Galway und Umgebung durch. Natürlich könnte ich es in anderen Städten probieren, doch wenn ich in unserer Region schon keine Chance habe, wieso sollte es in Cork oder Limerick anders aussehen?
Als ich Mr Carrolls Büro verlasse, lächelt die Dame am Empfang mir freundlich zu, aber ihre fröhliche Miene gerät ins Wanken, als sie meine erblickt. Ich sollte ein schlechtes Gewissen haben, doch in mir brennt nur Wut. Nicht auf Mr Carroll, sondern auf alles und jeden. Auf diese Leute, die ihrem Alltag nachgehen und überhaupt nicht sehen, wie das, was uns ausmacht, jeden Tag weiter schwindet. Auf die etlichen Filialen, an denen ich gerade vorbeilaufe. Sie hatten sicherlich keinerlei Probleme dabei, Startkapital zu bekommen. Auf den Schmuckladen, der die Claddagh-Ringe verkauft – traditionelle irische Ringe, die überwiegend von Touristen erworben werden. Irisch sein und leben ist nur noch ein Trend. Etwas, was man niedlich findet, für einige wenige Wochen im Urlaub austestet und allen daheim dann von der lustigen Kultur erzählt. Der Kultur, die so tot und zu Kitsch verkommen ist, dass mir überhaupt nicht nach Lachen zumute ist.