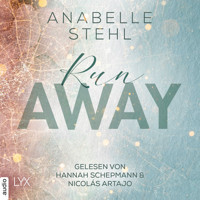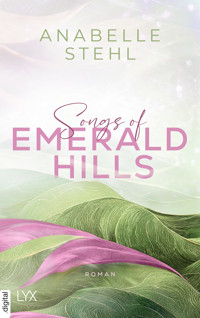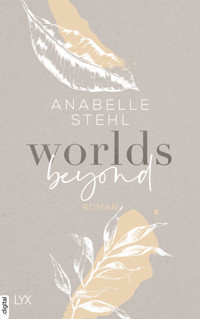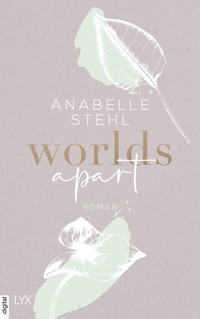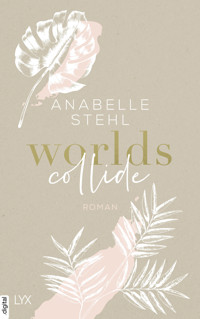9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Lyx.digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Away-Reihe
- Sprache: Deutsch
Die Menschen, die wir am meisten lieben, haben auch die Macht, uns am meisten zu verletzen
Von einem Tag auf den anderen ist in Miriams Leben nichts mehr, wie es war: Als ihre Familie von ihrem Schwangerschaftsabbruch vor einigen Jahren erfährt, wenden sich ihre Eltern und auch ihre Schwester von ihr ab. Miriam ist verletzt und weiß nicht, wie sie das wieder hinbiegen soll. Zum Glück erhält sie Unterstützung von ihren Freundinnen - und von Elias. Dem Mann, in den sie schon lange heimlich verliebt ist - der in ihr aber niemals mehr als die beste Freundin seiner kleinen Schwester sehen wird. Oder doch?
"Tiefe Gefühle, reale Schicksale und wichtige Messages -das alles habe ich an RUNAWAY geliebt." ROXYSPODCAST
Die AWAY-Reihe:
1. Breakaway
2. Fadeaway
3. Runaway
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 533
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
INHALT
Titel
Zu diesem Buch
Leserhinweis
Widmung
Playlist
Prolog
1. Kapitel
2. Kapitel
3. Kapitel
4. Kapitel
5. Kapitel
6. Kapitel
7. Kapitel
8. Kapitel
9. Kapitel
10. Kapitel
11. Kapitel
12. Kapitel
13. Kapitel
14. Kapitel
15. Kapitel
16. Kapitel
17. Kapitel
18. Kapitel
19. Kapitel
20. Kapitel
21. Kapitel
22. Kapitel
23. Kapitel
24. Kapitel
25. Kapitel
26. Kapitel
27. Kapitel
28. Kapitel
29. Kapitel
30. Kapitel
31. Kapitel
32. Kapitel
33. Kapitel
34. Kapitel
Epilog
Danksagung
Die Autorin
Die Romane von Anabelle Stehl bei LYX
Impressum
ANABELLE STEHL
Runaway
ROMAN
ZU DIESEM BUCH
Kurz vor dem Abitur wird Miriam schwanger. Zusammen mit ihrem Freund entschließt sie sich zu einer Abtreibung, über die sie Jahre später in einem Podcast berichtet. Als ihre Familie diesen entdeckt, bricht sie den Kontakt ab – enttäuscht nicht nur von Miriams Entscheidung, sondern auch davon, dass sie sich ihnen nicht anvertraut hat. Miriam ist verletzt, besonders vom Verhalten ihrer Schwester Louisa, die sich einfach nicht mehr bei ihr meldet. Unterstützung erhält Miri dagegen von ihren Freundinnen – und von Elias, dem Mann, in den sie schon lange verliebt ist, der in ihr allerdings nie etwas anderes als die beste Freundin seiner kleinen Schwester sehen wird. Oder doch? Denn bei ihren Treffen sendet er ihr verwirrende Signale, wirft ihr lange Blicke zu und vertraut ihr Dinge an, von denen sonst niemand weiß. Als Miriam sich ihm öffnet und ihm ihre Gefühle gesteht, blockt er jedoch ab und lässt sie enttäuscht zurück. Nach dem Chaos der letzten Monate und seiner ausweglosen privaten Situation wehrt Elias sich mit aller Macht dagegen, die eine Sache zu gefährden, die ihm in seinem Leben Stabilität gibt: die Freundschaft zu Miriam – auch wenn das, was er für sie empfindet, schon lange über freundschaftliche Gefühle hinausgeht …
Liebe Leser:innen,
bitte beachtet, dass Runaway Elemente enthält, die triggern können. Diese sind: Abtreibung und unerfüllter Kinderwunsch sowie Krankheit in der Familie.
Wir wünschen uns für euch alle das bestmögliche Leseerlebnis.
Eure Anabelle und euer LYX-Verlag
Für Saskia.
Du bist mein Safe Space.
PLAYLIST
Ziggy Alberts – Runaway
Conan Gray – Generation Why
Taylor Swift, The Chicks – Soon You’ll Get Better
dodie – Would You Be So Kind
Mandy Moore – When Will My Life Begin?
AJR – Pretender (Acoustic)
Tessa Violet – Crush
Maroon 5 – Denim Jacket
Third Eye Blind – Motorcycle Drive By
Lauren Aquilina – Swap Places
Olivia O’Brien – Love Myself
Selena Gomez – Rare
Dua Lipa – Blow Your Mind (Mwah)
Alessia Cara – Here
FINNEAS – I Lost a Friend
Dermot Kennedy – Outnumbered
Kafka Tamura – Berlin
salem ilese – Mad at Disney
Emily King – Georgia
Stu Larsen – The Loudest Voice
Bruno Major – Nothing
Zara Larsson – WOW
Ella Henderson – Friends
PROLOG
Podcast: Your Story is My Story
»Hallo, danke, dass ihr zuhört. Ich … ich bin heute hier, weil … Ich hatte vor zwei Jahren eine Abtreibung. Ich weiß, dass das Thema unglaublich viel Konfliktpotenzial bietet, deshalb gleich vorweg: Es ist vollkommen in Ordnung, wenn ihr nichts von Abtreibungen haltet und euch niemals für eine entscheiden würdet. Das müsst ihr nicht. Was ihr jedoch müsst, ist zu respektieren, dass jede Person das Recht hat, für sich selbst zu entscheiden. Ich habe sehr lange über meine Abtreibung geschwiegen. Genauer gesagt wussten es bis eben nur zwei Personen. Aber ich schäme mich nicht dafür, und so wie Kyra in den vergangenen Podcast-Folgen versucht hat, anderen Mut zu machen und Scham zu nehmen, möchte ich heute das Gleiche tun.«
»Danke für deinen Mut! Wie hast du damals reagiert? Wie war der Weg bis zur finalen Entscheidung?«
»Sowohl für mich als auch für den potenziellen Vater war sofort klar, dass wir noch keine Kinder möchten und dass es nicht der richtige Zeitpunkt ist. Trotzdem haben wir natürlich die Alternativen durchgespielt: Wie sähe unser Leben mit diesem Baby aus? Welche Möglichkeiten haben wir? Ich möchte irgendwann Kinder, also bin ich im Kopf alle Szenarien durchgegangen. Letztendlich hat sich aber jedes ausgemalte Szenario völlig falsch angefühlt. Ich würde sagen, dass es zwar eine leichte, aber keine leichtfertige Entscheidung war. Was schwer war, war alles, was auf die Entscheidung hin folgte. Der Gang zur Gynäkologin und all die Hürden – denn obwohl wir in Deutschland zum Glück frei entscheiden können, ob wir ein Kind bekommen möchten oder nicht, wurde mir stellenweise ein anderes Gefühl vermittelt. Ich war gerade einmal in der fünften Woche, ein medikamentöser Abbruch war also noch möglich. Das geht nur bis zur neunten Woche. Meine Frauenärztin konnte mir nicht weiterhelfen, da sie selbst keine Abbrüche vornahm. Aufgrund des Paragrafen 219a, der Werbung für Schwangerschaftsabbrüche verbietet, durfte sie mich jedoch auch an keine Klinik überweisen.«
»Hat sie negativ reagiert?«
»Nein, sie war total verständnisvoll. Aus Foren, in denen ich mich mit anderen ausgetauscht habe, weiß ich, dass das leider nicht selbstverständlich ist. Mit der Hürde meinte ich eher das Gefühl, das mir bei all dem vermittelt wurde. Obwohl alles, was ich getan habe, völlig legal war, fühlte es sich durch das komplizierte Prozedere an, als täte ich etwas Illegales.«
»Korrigier mich, wenn ich falsch liege, aber der Paragraf verbietet es Ärzten und Ärztinnen, auf ihrer Praxis-Website darauf hinzuweisen, dass sie Schwangerschaftsabbrüche durchführen, richtig? Wie hast du letztendlich jemanden gefunden?«
»Genau. Ich habe großes Glück, dass ich in Berlin lebe und es hier so gute Beratungsstellen gibt, die mir sehr geholfen haben. Aber nicht alle Schwangeren haben diese Chance. Gerade in ländlicheren Regionen muss man oft mehr als hundert Kilometer weit fahren, um einen solchen Arzt zu finden, und viele Krankenhäuser sind in kirchlicher Hand und lehnen Abbrüche komplett ab. Religiöse Gebote werden sowieso häufig als Grund verwendet, deshalb sind Abtreibungen in einigen Ländern nach wie vor illegal. Verbote von Schwangerschaftsabbrüchen führen aber nicht dazu, dass nicht abgetrieben wird. Es werden also keine Abtreibungen verhindert, es werden sichere Abtreibungen verhindert.«
»Bist du selbst religiös?«
»Nein, aber ich glaube, auch als religiöser Mensch hätte ich ähnlich entschieden – gut, das lässt sich jetzt natürlich leicht sagen. Ich lese in Kommentarspalten ständig, dass Kinder gottgewollt sind, aber was bringt es einem Kind, wenn es von Gott gewollt ist, nicht aber von den eigenen Eltern?«
»Dass so wenige Praxen Abbrüche anbieten, hat aber vermutlich nichts mit Religion zu tun – abgesehen von den eben erwähnten Krankenhäusern. Denkst du, das hängt mit dem Paragrafen zusammen?«
»Kann sein. Ich hab danach in ein paar Artikeln gelesen, dass die Anzahl der Praxen, die in Deutschland Schwangerschaftsabbrüche anbieten, zurückgegangen ist. Ich kenne die genauen Zahlen nicht auswendig, aber ich glaube, es waren knapp 40 Prozent in weniger als zwanzig Jahren.«
»Was glaubst du, woran das liegt?«
»Dort stand, dass es an Unis viel seltener gelehrt wird und es natürlich auch auf Ärzteseite mit sehr viel mehr Stress verbunden ist, sich den ganzen Hürden zu stellen. Aber ich weiß es nicht genau. Ich hoffe nur, dass ich mit dem Reden darüber dem Stigma entgegenwirken kann. Denn mir geht es gut, und ich habe meine Entscheidung bis heute kein einziges Mal bereut. Gleichzeitig bin ich mir, wie eben erwähnt, ziemlich sicher, dass ich einmal Kinder will. Ich glaube, das ist auch etwas, was viele nicht verstehen: dass hinter einem Schwangerschaftsabbruch keine tragische Geschichte stecken muss. Ich weiß, dass meine Eltern mich unterstützt hätten – dennoch war es für mich die einzig richtige Wahl. Falls ihr also ebenfalls vor einer solchen Entscheidung steht, macht euch bitte bewusst, dass sie nur euch und euren Partner oder eure Partnerin etwas angeht.«
»Da du gerade deine Eltern angesprochen hast, hast du ihnen von alldem erzählt?«
»Nein, habe ich nicht. Die Entscheidung haben wir damals allein getroffen und …«
Kommentare:
FstehtfürFreunde:
Und gemeinsam mit 219a auch gleich noch 218 abschaffen. Gute Folge!
BarcelonaLover:
Wie egoistisch kann man sein? Sie hätte es auch einfach zur Adoption geben können
BerlinCityGirlxx:
Danke für den Podcast. My Body my Choice
Limone7:
Wenn sie doch sogar meint, dass ihre Eltern sie unterstützt hätten, verstehe ich das Problem überhaupt nicht? Vielleicht mal Verantwortung für das eigene Handeln übernehmen.
Jedi98:
Falsches Timing ist ein legitimer Grund. Hättest du zugehört, hättest du das vielleicht verstanden.
R0bert0:
»Es werden sichere Abtreibungen verhindert«? Dass ich nicht lache. Was ist daran sicher, wenn ein Kind stirbt?
PeterPanda:
Howaboutno:
Danke dafür. Kyra, kannst du vielleicht noch was zu der Situation in Polen machen?
1. KAPITEL
Miriam
Es gab viel, was ich an Berlin liebte oder besser gesagt zu lieben gelernt hatte. Denn früher war mir die Stadt zu laut, zu groß, zu grau und zu dreckig gewesen. Diese Skepsis war innerhalb des ersten Semesters, das ich hier verbracht hatte, in das komplette Gegenteil umgeschlagen: Ich liebte die heruntergekommenen Ecken genauso sehr wie die für den Tourismus herausgeputzten. Ich liebte die teils ruppige Art der Menschen, gepaart mit ihrer Offenheit, die lauen Sommerabende in Parks und an der Spree, die kleinen Läden, die vielen noch unentdeckten Ecken, das Künstlerische und die Abwechslung, die einen rund um die Uhr erwartete. Ich liebte, dass hier jeder seinen Platz fand. Aber nichts liebte ich so sehr wie all die Cafés, Restaurants und Bistros. Egal ob Burger, Veganes für unterwegs oder ausgiebiges Frühstück – Berlin bot alles in tausendfacher Ausführung.
Als ich letztes Jahr aus dem Umland in die Stadt gezogen war, hatten meine Schwester Louisa und ich es uns zum Ziel gemacht, all das auszuprobieren und uns einmal quer durch Berlin zu futtern. Mal morgens, bevor Louisa ins Büro musste, mal mittags, wenn ich eine Lücke zwischen zwei Vorlesungen hatte, und manchmal auch abends. Jeden Montag, zum Beginn einer neuen Woche, trafen wir uns – wo, bestimmten wir in abwechselnder Reihenfolge. Knapp fünfundzwanzig Orte hatten wir mittlerweile besucht, und so gern wir in manche auch ein zweites oder drittes Mal gegangen wären, wir hielten uns an unsere selbst auferlegten Regeln.
»Guten Morgen!«, begrüßte mich eine Frau mit kurzen braunen Haaren und tätowierten Armen.
»Hallo, ich hab eine Reservierung auf den Namen Voigt.«
»Für ein Tattoo oder einen Tisch?«
»Ähm … einen Tisch?«
Die Frau ließ ihren Zeigefinger über die Seiten eines vergilbten Notizbuchs gleiten. »Yep, hier steht’s. Ich habe für euch den da hinten mit den beiden hohen Sesseln ausgewählt.« Sie deutete links an mir vorbei. »Aber um die Uhrzeit ist so wenig los, sucht euch gern was aus. Kann ich dir schon was zu trinken bringen? Kaffee?«
»Alles klar, danke dir! Ich nehm einen schwarzen Tee.«
»English Breakfast?«
Ich nickte.
»Kommt sofort.«
Kurz beäugte ich die Kuchenauswahl, da es nie zu früh für Kuchen war, dann setzte ich mich auf einen der braunen Sessel. Das heutige Café hatte Louisa ausgewählt. Es lag im Wedding zwischen dem englischen und afrikanischen Viertel und war, wenn ich das Schild über der Tür neben der Theke genauer betrachtete, eine Mischung aus Coffeeshop und Tattoostudio. Unter dem Frühstücksmenü, das vor mir auf dem Tisch lag, befand sich eine eingeschweißte Karte mit Samples und Wanna-Dos der beiden Tätowiererinnen des Ladens. Mein Blick huschte über die filigranen Skizzen, bevor ich ihn weiter über die floralen Muster der Tapete und den dunklen Dielenboden wandern ließ. Tattoos waren nicht mein Fall, aber die Einrichtung des Ladens sorgte dafür, dass ich mich direkt wohlfühlte.
Ich schielte auf mein Handy, das bereits kurz nach neun anzeigte. Die U6 nach Rehberge hatte länger gebraucht als vermutet, wodurch ich mich etwas verspätet hatte. Umso ungewöhnlicher, dass Louisa noch nicht hier war – normalerweise war sie stets die Erste.
»Hier, dein English Breakfast und etwas Milch, falls benötigt. Magst du was frühstücken oder wartest du noch?«
»Ich würde noch auf meine Schwester warten, wenn das okay ist«, erwiderte ich.
»Klar, lass dir Zeit.«
Die Frau platzierte den Tee, der auf einer mit weißen Blüten verzierten Untertasse stand, vor mir auf dem Tisch. Ob sie sich die zahlreichen Tattoos, die ihren Arm bedeckten, hier hatte stechen lassen? Eine Weile beobachtete ich sie beim Arbeiten, dann holte ich, um die Wartezeit zu überbrücken, mein Buch aus der Tasche. Heute begann bereits das zweite Semester, und ich hatte keine Ahnung, wie die Zeit so schnell verflogen war. Auch wenn ich mir von Kyra, meiner besten Freundin und Mitbewohnerin, die gesamte letzte Woche blöde Sprüche hatte anhören müssen, hatte ich bereits mit den ersten Büchern begonnen, die ich für die Literaturmodule lesen musste. Ich war in ein Seminar zu den Brontë-Schwestern gekommen und hatte Jane Eyre vorletzte Nacht verschlungen, sodass ich heute Wuthering Heights beginnen konnte.
Eine halbe Tasse Tee und ein Kapitel später saß ich immer noch allein an meinem Tisch. Erneut warf ich einen Blick aufs Handy, auf dessen Display ein Bild von meiner Schwester und mir in London zu sehen war. Es war ein typisches Touristenfoto vor einer roten Telefonzelle, und man konnte die Ähnlichkeit zwischen uns nicht leugnen. Louisa war ein Stück größer, hatte im Gegensatz zu mir blaue Augen, und ihre Haare waren von etwas dunklerem Blond, doch sonst sah man auf den ersten Blick, dass wir Schwestern waren. Sie hatte die gleichen runden Wangen wie ich und eine beinahe identisch aussehende Stupsnase. Von unseren grinsenden Gesichtern wanderte mein Blick ein Stück nach oben auf die Zeitanzeige. Es war beinahe halb zehn. Ich gab den PIN meines Smartphones ein – 1905, Prinz Harrys und Meghan Markles Hochzeitstag – und tippte eine Nachricht an meine Schwester.
Hey, alles okay bei dir?
Louisa war nicht online, und meine Worte an sie blieben ungelesen, allerdings hatte sie die letzte Nachricht, in der ich mich fürs Zuspätkommen entschuldigte, gesehen. Es war absolut untypisch, dass sie unpünktlich war, noch mehr jedoch, dass sie sich nicht meldete. Was, wenn ihr etwas zugestoßen war? Da sie außerhalb wohnte, nahm sie an den meisten Tagen das Auto, das sie mit ihrem Verlobten teilte. Was, wenn sie einen Unfall gebaut hatte?
Ich klickte auf das Anruf-Symbol und hielt mir das Handy mit leicht klopfendem Herzen ans Ohr. Das Freizeichen ertönte mehrmals, doch niemand hob ab. Wahrscheinlich war alles in Ordnung, doch selbst die kleine Möglichkeit, ihr könnte etwas zugestoßen sein, machte mich unfassbar nervös. Ich scrollte durch meine Kontakte, bis ich bei ihrem Verlobten angelangt war. Er hob bereits nach dem dritten Klingeln ab.
»Hey, Miri! Alles okay?« Sorge lag in seiner Stimme, was mich nicht überraschte. Wir kamen super miteinander aus, aber die Male, die ich ihn angerufen hatte, konnte ich an einer Hand abzählen.
»Hi, Kerim. Keine Ahnung, deshalb ruf ich an. Ist mit Louisa alles in Ordnung? Wir sind eigentlich zum Frühstücken verabredet, aber sie ist nicht aufgetaucht.«
»Oh, wirklich?« Kerim stieß einen brummenden Laut aus. »Davon hat sie nichts gesagt. Sie ist direkt zur Arbeit gefahren, glaub ich. Klang zumindest so. Vielleicht hat sie es vergessen? Sie war gestern noch ziemlich lang bei euren Eltern und hatte nicht so viel Schlaf. Generell ist sie momentan ein bisschen geplättet.«
»Hm. Vielleicht. Danke dir.« Die Sorge verstärkte sich nur noch, denn ich glaubte kaum, dass Louisa unser Treffen vergessen hatte. Doch ich wollte Kerim nicht beunruhigen, falls wirklich alles okay war.
»Kein Thema. Oh, hey! Hast du schon ein Geschenk für deinen Vater?«
»Ne, bis auf das Fotoalbum, das ich angefangen hab.«
»Wollen wir was Größeres zusammen schenken? Eine kleine Reise oder ein Wellnesswochenende oder so was?«
»Du hast meinen Papa getroffen, oder? Viel Erfolg, wenn du ihn zu Massagen und Gesichtsmasken überreden magst. Aber ein Wochenendtrip klingt gut. Wir können die Tage ja noch mal reden, ich bin dabei.«
»Cool!«, sagte Kerim. »Ich hoffe, du hast nicht so lange warten müssen. Vielleicht dachte sie, ihr trefft euch mittags.«
»Schon okay«, antwortete ich, verabschiedete mich von Kerim und versuchte es direkt im Anschluss noch einmal bei Louisa, allerdings wieder ohne Erfolg. Sollte sie es wirklich vergessen haben und nun in die Arbeit vertieft sein? Ich konnte es mir kaum vorstellen. Zumal sie ihren Job als Grafikerin in einer Agentur nicht gerade liebte.
Als Louisa fünfzehn Minuten später immer noch nicht da war, packte ich meine Sachen zusammen, bezahlte den Tee und verließ das Café. Allein frühstücken wollte ich nicht, lieber holte ich mir etwas im Bistro der Uni.
Auf dem Weg zur Humboldt schrieb ich meiner Schwester zwei weitere Nachrichten, doch auch diese blieben ungelesen. Mit ungutem Gefühl im Bauch machte ich mich auf den Weg zu meiner ersten Vorlesung. Das war nicht der Start, den ich mir für diesen Tag erhofft hatte. Immerhin war ich nun, im zweiten Semester, wesentlich weniger aufgeregt als zu Beginn des Studiums letztes Jahr im Oktober. Ein wenig freute ich mich sogar.
Mit einem erschöpften Seufzen ließ ich mich aufs Bett fallen. Meine Freundin Phuong hatte mich vorgewarnt, dass die Schonfrist des ersten Semesters nun vorbei wäre und das zweite wesentlich härter starten würde. Leider hatte sie recht behalten. Nicht nur hatte ich heute direkt drei Veranstaltungen in Folge gehabt, meine To-do-Liste war auch schon wesentlich voller als zu Beginn des ersten Semesters. Erneut checkte ich mein Smartphone und sah, dass Louisa alle Nachrichten gelesen und dennoch nicht geantwortet hatte. Ich tippte wieder einmal auf das grüne Symbol, hörte das Freizeichen, doch sie hob nicht ab.
»Ich übertreibe bestimmt vollkommen«, murmelte ich, dennoch ging ich in die Favoritenliste und wählte die Nummer meiner Mutter.
»Miriam, hallo«, erklang ihre Stimme. So schnell, als hätte sie meinen Anruf erwartet.
»Hi, Mama. Wie geht es dir?«
»Kann nicht klagen«, antwortete sie knapp. »Was gibt es?«
Okay, irgendetwas war eindeutig im Busch. So kurz angebunden kannte ich meine Mutter überhaupt nicht. Vielleicht hatte Louisa irgendwelche Probleme, von denen Kerim nichts wusste? Das würde erklären, wieso sie gestern bei meinen Eltern gewesen war – vielleicht war es etwas, womit sie sich nicht an ihren Verlobten wenden konnte.
»Ich kann Louisa nicht erreichen. Wir waren heute verabredet, und sie kam nicht. Kerim meinte, sie war gestern bei euch?«
»Ja«, erwiderte meine Mutter, und ich wartete darauf, dass sie das Ganze weiter ausführte, doch das tat sie nicht. Stattdessen füllte Schweigen den Hörer.
»Ist alles in Ordnung bei ihr?«
»Och, ich weiß nicht, Miri«, gab meine Mutter zurück, und ihr sarkastischer Tonfall ließ mich die Stirn runzeln. Was zur Hölle war bitte los?
»Ähm, ist alles okay? Ist was mit Louisa passiert?«
Ein Rauschen drang in mein Ohr, als meine Mutter hörbar ausatmete. Bei ihren nächsten Worten klang ihre Stimme gepresst. »Wieso sagst du mir nicht, ob alles okay ist?«
Ich seufzte innerlich und ging im Kopf die letzten Unterhaltungen mit meiner Schwester durch. Hatte ich irgendetwas gesagt oder getan? Wir hatten einen Streit gehabt, der sich um Louisas und Kerims Hochzeitsvorbereitungen gedreht hatte, aber das war geklärt und die Wogen geglättet. Selbst wenn nicht, wie alt waren wir, wenn sie mich deswegen verpetzte? Nein, irgendetwas anderes musste im Busch sein.
Bevor ich weiter nachfragen konnte, unterbrach meine Mutter das Schweigen.
»Wie konntest du nur?«
Wie konnte ich was nur?
Ich war in den Semesterferien gerade erst zwei Wochen zu Hause gewesen. Krampfhaft durchforstete ich meine Erinnerungen nach etwas, das meine Eltern und Louisa so aufgebracht haben könnte.
»Wir haben Kyras Podcast gehört. Besser gesagt, deine Schwester hört ihn und hat uns gestern von deinem Gastauftritt berichtet.« Meine Mutter schwieg erneut, und ich vernahm nur ihr Atmen, als müsste sie sich sammeln, bevor sie weitersprach. »Wie konntest du nur? Unter unserem Dach? Hattest du vor, uns das irgendwann zu erzählen?« Ihre Worte wurden schneller, so aufgebracht war sie nun. »Weiß Finn davon? Ich nehme mal an, er wäre der Vater gewesen? Oder hast du es vor ihm auch geheim gehalten und eine komplette Egonummer durchgezogen?«
Beinahe hätte ich aufgelacht, so makaber war ihre Wortwahl.
»Egonummer? Haben wir denselben Podcast gehört?«, fragte ich zurück und merkte, wie mein Herz heftig in meiner Brust pochte. Ich hatte mit vielem gerechnet, aber nicht hiermit. Die Aufnahme mit Kyra lag knapp fünf Monate zurück. Kurz davor und auch noch danach hatte ich mit dem Gedanken gespielt, es meinen Eltern zu sagen, mich aber dagegen entschieden. Vor allem, als die ersten negativen Kommentare unter der Folge aufkamen – Kyra hatte mich vor ihnen gewarnt, und die positiven waren wesentlich zahlreicher gewesen, aber sie hatten mich dennoch in meiner Entscheidung bestärkt, meiner Familie nichts zu sagen. Denn ich kannte ihre Einstellung zu dem Thema. Ich hatte es am Tisch oder auch vor dem Fernseher oft genug miterlebt, als ich noch zu Hause gewohnt hatte.
»Miriam, du hast abgetrieben«, sprach meine Mutter nun das Offensichtliche noch einmal aus, und allein die Anklage und der Vorwurf in ihrer Stimme sorgten dafür, dass etwas in mir kalt wurde, dass ich in Sekundenschnelle Mauern um mich herum errichtete. Ein Streit mit meiner Mutter war das Letzte, was ich wollte, aber in dieser Sache ließ ich mich nicht beirren. Ich stand hinter meiner Entscheidung. Damals wie heute.
Als ich von der ungewollten Schwangerschaft erfahren hatte, war für meinen damaligen Freund Finn und mich sofort klar gewesen, dass wir kein Kind wollten. Nicht, weil ich nie Kinder wollte – denn das tat ich –, sondern weil wir selbst noch Kinder gewesen waren. Wir waren nicht bereit gewesen. Ich war nicht bereit gewesen. Was meine Mutter wüsste, hätte sie den Podcast wirklich aufmerksam gehört, denn in diesem hatte ich genau das gesagt.
Die Stimme meiner Mutter brach, ob aus Traurigkeit oder unterdrückter Wut, konnte ich nicht deuten. »Du warst nicht einmal volljährig und hast diese Entscheidung komplett ohne uns getroffen.«
»Ja, das habe ich«, sagte ich betont ruhig. »Weil ich genau wusste, wie ihr reagiert hättet. Außerdem stand ich kurz vor meinem 18. Geburtstag. Nicht dass das irgendeine Rolle spielt.«
»Und dann sagst du einfach gar nichts?«, fragte meine Mutter, und ich hielt das Handy ein Stück vom Ohr weg, so laut war ihre Stimme geworden.
»Weil es nicht eure Entscheidung war, sondern meine«, erwiderte ich. Am liebsten hätte ich die Worte zurückgebrüllt. »Ich weiß, dass du das nicht verstehst, aber …«
»Wir alle verstehen dich nicht! Was hast du dir dabei gedacht? Nichts vermutlich. Du bist noch zur Schule gegangen. Glaubst du wirklich, du warst da reif genug, eine Entscheidung mit solcher Tragweite allein zu treffen? Miriam, ich bitte dich!«
Genau das war der Grund, weshalb ich, als ich herausgefunden hatte, dass ich schwanger geworden war – ungeplant und viel zu früh für meinen Geschmack –, nicht zu ihnen gegangen war. Ich liebte meine Eltern, aber zum einen trauten sie mir damals wie heute zu selten zu, meine eigenen Entscheidungen treffen zu können. Zum anderen hatten sie ihre Meinung zu der Debatte oft genug kundgetan, dass ich wusste, es hätte mindestens einen Streit, sehr viel wahrscheinlicher aber eine komplette Katastrophe hervorgerufen. Und dafür hatte ich in der Situation keine Nerven gehabt. In der Podcast-Folge hatte Kyra mich gefragt, wie es für mich gewesen war, das ohne meine Familie durchzuziehen. Sie hatte gefragt, ob ich aus Scham geschwiegen hatte. Meine einfache Antwort hatte »Nein« gelautet. Seit der Folge hatte ich weiter darüber nachgedacht, und mittlerweile glaubte ich, dass eine gewisse Scham doch Bestandteil meines Schweigens gewesen war – wenngleich ich wusste, dass ich mich für nichts zu schämen brauchte. Ich hatte Angst vor der Reaktion meiner Eltern gehabt, und mein Kopf war auch ohne die Meinung Dritter viel zu voll gewesen. Was ich damals gebraucht hatte, waren keine Ratschläge und Standpunkte, sondern Zeit, darüber nachzudenken, was ich wirklich wollte. Doch Zeit war die eine Sache, die bei einem Schwangerschaftsabbruch Mangelware war, denn je mehr davon ich hätte verstreichen lassen, desto weniger Optionen wären mir geblieben. Also hatte ich nur Finn von der Schwangerschaft erzählt, da er der Einzige war, den es ebenfalls etwas anging. Wir waren uns einig, dass wir das Kind nicht behalten wollten, und als die Entscheidung gefallen war, hatte ich nichts als Erleichterung verspürt. Da waren keine Reue, kein »Was wäre wenn«, keine Trauer, keine Zweifel. Diese Gefühle hatten sich bis heute nicht geändert.
Ich schloss kurz die Augen und sammelte mich, bevor ich weitersprach. »Falls du eine Entschuldigung erwartest, kann ich sie dir nicht geben«, sagte ich, immer noch um eine ruhige Stimme bemüht. Ich hasste es, wie klein ich mich gerade wieder fühlte. Als lebte ich noch im Haus meiner Eltern. »Ihr hättet mich nicht davon abbringen können, weil es für mich die richtige Entscheidung war.« Ich schluckte gegen die Trockenheit an, die plötzlich meinen Hals befallen hatte. Ich durfte jetzt auf keinen Fall weinen, denn dann würde ich meiner Mutter nur bestätigen, was sie bereits vermutete: dass ich zu jung war, um solche Dinge allein zu entscheiden. Dabei hatte ich mir das Gespräch so oft ausgemalt. Doch in meiner Vorstellung war es vollkommen anders abgelaufen. An einem Tisch. Bei Tee. Mit Verständnis in den Gesichtern meiner Eltern. Idealerweise mit meiner Großmutter am Tisch, die als Einzige von alldem wusste. Doch mir war klar, dass das genau das war: eine Wunschvorstellung. Nicht nur, weil meine Großmutter seit einem halben Jahr nicht mehr lebte, sondern weil es naiv war zu glauben, dass dieses Gespräch jemals hätte ruhig verlaufen können. Ich griff zu dem Ring an meiner rechten Hand, den sie mir vor ein paar Jahren geschenkt hatte und der mich immer wieder erdete.
»Deine Großmutter wusste davon, nicht wahr?«, fragte meine Mutter im selben Moment, als hätte sie meine Gedanken gelesen.
»Ja«, sagte ich. Sie hatte davon gewusst. Nicht vorab, so gern ich auch direkt zu ihr gelaufen wäre. Doch dann hätte sie es vor ihrer eigenen Tochter geheim halten müssen, und das hatte ich nicht gewollt. Ich hatte es ihr erst danach erzählt, weil ich mit jemandem hatte reden wollen. Nicht, um mein Gewissen zu erleichtern oder etwas Derartiges. Denn alles, was ich nach der Tablette gefühlt hatte, war Erleichterung gewesen. Ein Abebben der beklemmenden Angst, die mich die Tage, nachdem ich es herausgefunden hatte, in ihren Klauen gehalten hatte. Ich hatte es ihr erzählt, weil ich kein Geheimnis darum machen wollte – zumindest nicht mehr, als ich musste. Weil ich mich nicht dafür schämen wollte und weil ich wusste, dass ich bei meiner Großmutter auf Verständnis treffen würde, ob sie nun derselben Meinung war oder nicht. Sie hatte mir beigebracht, andere Perspektiven einzunehmen und anderen Menschen Verständnis entgegenzubringen, egal welchen Lebensweg sie wählten und wie sich dieser von meinen eigenen Vorstellungen unterschied. Eine Eigenschaft, die sie meiner Mutter anscheinend nicht hatte vermitteln können, denn von dieser drang ein empörtes Schnauben durch den Hörer.
»Unglaublich. Also hält nicht nur meine eigene Tochter es vor mir geheim, sondern auch meine Mutter. Nur dass die es nicht stolz der ganzen Welt erzählt, anstatt erst einmal mit der Familie zu reden.«
»Stolz?«, fragte ich fassungslos. »Wo hast du da bitte Stolz rausgehört? Ich habe über Artikel 219a gesprochen und darüber, wie es mir nach allem ging. Weißt du warum? Weil ich genau das, was wir hier machen, nicht für andere will. Dass sich andere Frauen schuldig fühlen. Ich wusste ganz genau, dass du mir Schuldgefühle einreden würdest.«
»Dann überleg mal, warum«, erwiderte meine Mutter. »Du warst keine dreizehn mehr, du hättest dein Abi trotzdem machen können, du kommst aus einem finanziell sicheren Haushalt. Du hattest keinen Grund. Wir hätten uns um das Kind kümmern können. Wir hätten …«
»Es war aber nicht eure Entscheidung!«, sagte ich und wurde nun doch lauter als beabsichtigt. Mein Herz hämmerte in meiner Brust, und meine Augen brannten. »Und Louisas genauso wenig. Ich kann nicht glauben, dass sie es euch erzählt hat, ohne mit mir darüber zu sprechen.«
»Jetzt mach deiner Schwester keinen Vorwurf! Immerhin war sie ehrlich zu uns.«
»Mama, ich kann verstehen, wenn ihr Zeit braucht, aber ihr könnt mir nicht allen Ernstes böse sein. Und Louisa hat ja wohl noch weniger Anlass dazu. Das ändert doch überhaupt nichts!«
»Das ändert nichts? Du hast eben gesagt, dass du unsere Einstellung kennst. Du wusstest also ganz genau, was du tust. Dennoch hast du es getan, hast es nicht einmal für nötig gehalten, mit uns zu sprechen? Wo ändert das bitte nichts?« Meine Mutter atmete zitternd aus, und ich konnte nichts dagegen tun, dass meine Augen nun doch feucht wurden. Mit der freien Hand fuhr ich mir nervös übers Gesicht und wischte die aufkommenden Tränen weg. Mit der anderen hielt ich das Smartphone so fest umklammert, dass meine Finger schmerzten.
»Ich weiß nicht, was ich dir noch sagen soll.« Ich schluckte. »Ich bereue es nicht, und du wirst mich auch nicht dazu bekommen, es zu tun. Gerade bin ich wirklich heilfroh, dass ich es euch damals nicht erzählt habe.«
Einige Sekunden lang hörte ich nichts bis auf das leise Rauschen der Leitung, das jedoch genauso gut von dem Blut in meinen Ohren kommen konnte, denn mein Puls ging nach wie vor viel zu schnell.
»Dann habe ich dir auch nichts mehr zu sagen.« Die Stimme meiner Mutter klang so kühl und tonlos, dass es mir einen unangenehmen Schauer den Rücken hinabjagte. So hatte ich sie noch nie gehört. Ich wollte gerade etwas erwidern, da knackte es in der Leitung. Sie hatte aufgelegt. Mit offenem Mund starrte ich auf mein Handy. Ich drückte auf die Wahlwiederholung, doch sie nahm nicht noch einmal ab. Das konnte nicht ihr Ernst sein, oder? Noch nie hatte meine Mutter mich einfach abgewürgt. Sie war es doch immer, die Wert auf Kommunikation und klärende Gespräche legte. Als ich es bei meinem Vater probierte, erklang ebenfalls nur das Freizeichen. Kopfschüttelnd ließ ich die angehaltene Luft entweichen und fuhr mir durch die langen Haare.
Das durfte nicht wahr sein. Ich wählte zum bestimmt zehnten Mal an diesem Tag die Nummer meiner Schwester, doch auch sie hob nicht ab. War sie allen Ernstes sauer auf mich? Und hatte sie im Gegensatz zu meiner Mutter nicht einmal den Nerv, mir das auch zu sagen? Bei meinen Eltern hatte ich mit einer solchen Reaktion gerechnet, aber bei Louisa? Nie und nimmer.
Ich schluchzte auf, und meine Hand flog zu meinem Mund, als könnte ich das Geräusch somit zurückholen und meine Trauer in mir verschließen. Ich wusste nicht einmal, ob es wirklich Trauer war oder ob ich nicht vielmehr vor unterdrückter Wut weinen musste.
Bevor ich es erneut bei Louisa versuchen konnte, wurde die Tür zu meinem Zimmer geöffnet, und meine Mitbewohnerin steckte ihren Kopf herein.
»Ich würd was kochen, magst du auch …« Kyra stoppte mitten im Satz und kam langsam in mein Zimmer. »Hey, alles okay?«
Ich schüttelte nur weiter den Kopf und schaffte es nun nicht länger, die Tränen zurückzuhalten, die in meinen Augen brannten.
»Nichts ist okay.«
2. KAPITEL
Elias
»Sehr gut, Marlon!«
Meine Stimme hallte durch den Saal des Boxstudios und vermischte sich mit dem Quietschen von Turnschuhen und den dumpfen Geräuschen, wenn Füße oder Hände auf die Pratzen trafen. Ich kam hinter dem dunkelhaarigen Jungen, dessen Boxtechnik ich gerade gelobt hatte, zum Stehen und beobachtete ihn eine Weile beim Ausführen der Schläge. Es war erstaunlich, welche Fortschritte er in so kurzer Zeit gemacht hatte.
»Du hast geübt, oder?«, fragte ich. »Zu Hause, meine ich.«
Marlon nickte, ohne jedoch den Blick von seinem Gegenüber abzuwenden, der bei jedem Schlag gegen die Handpratze leicht mit den Beinen federte.
»Das merkt man. Deine Technik ist viel sauberer geworden. Weiter so.«
Ein Lächeln formte sich auf dem Gesicht des Jungen, was wiederum mich zum Lächeln brachte. Ich kannte Marlon erst seit wenigen Monaten und hatte ihn als anstrengendes, lautes und vor allem freches Kind kennengelernt – davon war nur noch selten etwas zu erkennen. Gut, laut war er nach wie vor, aber das war ich in dem Alter auch gewesen. Dafür kam er pünktlich, gab keine Widerworte mehr und hatte, wenn mich nicht alles täuschte, mittlerweile sogar Freunde in dem Kurs gefunden. Wenn ich Marc Glauben schenken durfte, war diese Entwicklung erst eingetreten, als ich den Kurs übernommen hatte. Marc hatte mir diesen im Winter überlassen, was an ein Wunder grenzte, da er den Laden bis dahin fast im Alleingang geschmissen hatte. Zwar hatten wir Aushilfen, aber die Kurse lagen alle in seiner Hand. Bis auf die beiden, die ich nun unterrichtete.
Ich drehte eine weitere Runde in dem Raum, korrigierte hier und da eine Haltung und achtete auf die Beinarbeit der Gruppe. Etwa zehn Minuten später pfiff ich einmal in die grüne Trillerpfeife, die um meinen Hals hing. Die Geräusche von Schritten und Schlägen verstummten, bis nur noch angestrengtes Keuchen zu hören war. Ich grinste innerlich. Auch das war etwas, das vor Kurzem noch undenkbar gewesen wäre: Ruhe auf Befehl.
»Das habt ihr gut gemacht, Leute!« Ich nickte in die Runde, und mein Blick fiel auf verschwitzte Gesichter, von denen mir einige jedoch entgegengrinsten. »Dann sehen wir uns am Donnerstag.« Als die Ersten sich ihre Sachen schnappten und auf den Ausgang zuliefen, stieß ich erneut einen Pfiff aus, diesmal jedoch mit dem Mund. Abrupt blieb der Junge, der schon die Tür erreicht hatte, stehen und sah mir ertappt, aber mit zuckenden Mundwinkeln entgegen.
»Hast du nicht was vergessen?«
»Was denn?« Julius blickte zu mir auf und presste die Lippen zusammen, so sehr musste er sich das Grinsen verkneifen.
Wie konnten Kinder so unschuldig aussehen und es dennoch so faustdick hinter den Ohren haben? Ich verschränkte die Arme vor der Brust und sah ihn abwartend an, ohne ein Wort zu sagen. Er hielt meinem Blick exakt sieben Sekunden lang stand, bevor er losprustete und in die andere Ecke zu dem schmalen, hohen Schrank lief. Mit einem Eimer und Wischmopp bewaffnet schob er sich an mir vorbei aus dem Raum.
»Wer hilft Julius?«
»Ich mach das«, sagte Marlon, der sich gerade seine Sweatjacke überzog.
»Du warst letztes Mal schon dran, du musst nicht …«
»Macht mir nichts«, rief er und rannte im nächsten Moment aus dem Raum.
»Ihr macht das echt immer nur, um mich zu ärgern, oder?«, fragte ich. »Wenn bei euch in ein, zwei Jahren die Pubertät losgeht, bin ich hier raus. Ich sag’s euch. Habt ein schönes Wochenende!«
»Du auch!«
»Schönes Wochenende.«
Ich klatschte die Jungs und Mädchen ab, als sie an mir vorbeiliefen. Hätte man mir vor einem Jahr gesagt, dass ich, anstatt wie geplant in der Firma meiner Eltern zu sitzen, das Boxtraining einer Gruppe Zehn- bis Fünfzehnjähriger leiten würde, hätte ich die Person definitiv ausgelacht. Dennoch stand ich jetzt hier und war … glücklich. Denn das Gefühl in meinem Bauch war eindeutig Stolz. Ich wusste, wie es sich anfühlte, Stolz auf die eigene Arbeit zu empfinden. Gute Noten in meinem Studium der Umwelttechnik hatten mich mit Stolz erfüllt, und jeder einzelne Vertragsabschluss und jedes Kundenlob in unserem Familienbetrieb hatten dieses Gefühl hervorgerufen. Doch jetzt fühlte es sich anders an – nach mehr. Wärmer. Es hatte meinen Rauswurf aus der Firma im letzten Jahr gebraucht, um dieses Gefühl, dieses Mehr kennenzulernen. Damals hatte ich geglaubt, dass der Streit mit meinen Eltern und der Rauswurf das Schlimmste waren, was mir hätte passieren können. Ich war auf Christopher Rothe, den Sohn unseres längsten Geschäftspartners, losgegangen – nicht grundlos, wie meine Eltern mittlerweile wussten – und hatte daraufhin das Unternehmen verlassen müssen. Ein Umstand, der mir damals komplett den Boden unter den Füßen weggerissen hatte. Jetzt jedoch war ich beinahe dankbar dafür, denn es war die Veränderung gewesen, die ich gebraucht hatte, um zu merken, dass etwas Essenzielles in meinem Leben gefehlt hatte: Begeisterung und Leidenschaft für das, was ich tat.
Die Tür hinter mir schwang wieder auf, und Julius und Marlon rannten mit einem viel zu vollen Eimer Wasser und einem tropfenden Mopp bewaffnet herein, wobei sie eine nasse Spur hinterließen.
»Lasst mich raten: Das halbe Studio ist nass?«
»Gar nicht wahr!«
»Marlon hat gesagt, wir brauchen noch mehr Wasser.«
»Hä, du hast den Eimer unterm Hahn stehen lassen.«
»Jungs«, sagte ich und nickte in Richtung Boden. »Um halb beginnt der nächste Kurs. Go.«
Die beiden wischten den blauen Hallenboden, wobei sie wesentlich mehr Spaß hatten, als man beim Putzen vermutlich haben sollte.
»Ich hab übrigens eine Zwei in dem Diktat bekommen!«, platzte Marlon auf einmal heraus und blickte kurz zu mir, wie um meine Reaktion zu sehen. »Ich hab gemacht, was du gesagt hast, und mir den Text von Google vorlesen lassen und dann mitgeschrieben und korrigiert und all das. Ich hab sogar Petroleum richtig, weil ich das durch Zufall geübt hab, und dafür gab es einen extra Punkt.«
Marlons Strahlen war ansteckend. Vor knapp zwei Wochen hatte er erzählt, dass es ziemliche Probleme in der Schule gab, von denen zu Hause ganz zu schweigen. Ich wusste, dass der Junge weder auf den Kopf gefallen noch faul war, denn im Training war er mehr als bereit zu lernen. Wie sein Fortschritt in Deutsch zeigte, lag ich mit dieser Annahme richtig. Ihm fehlten nur etwas Hilfe und ein Anreiz.
»Ich bin stolz auf dich«, sagte ich. »Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich das Wort selbst in der zehnten Klasse noch falsch geschrieben hätte.«
Marlon sah mich nicht noch einmal an, aber ich erkannte das Lächeln, das sich über beide Wangen zog, während er sich auf den Wischmopp konzentrierte.
Ja, dieser Stolz fühlte sich definitiv ganz anders an als der, den ich durch das Büro gewohnt war. Auch wenn ich seit Kurzem wieder in der Firma arbeitete, war es die Arbeit hier, die mich abends mit einem Lächeln einschlafen ließ.
»Oh, Elias beehrt uns doch noch! Ich bin hocherfreut!«
»Klappe, Ky«, sagte ich und gab meiner kleinen Schwester einen Knuff. Kyra umarmte mich zur Begrüßung.
»Wir sind einfach nur verwundert, dass Mr Pünktlich mal zu spät ist«, kommentierte Noah, bevor auch er mich kurz an sich drückte.
»Ja ja«, wiegelte ich ab. »Wenn ich einen Euro bekäme für jedes Mal, das ihr schon zu spät gekommen seid.«
»Dann wärst du jetzt reich, wissen wir«, gab Kyra zurück und ließ sich wieder auf den gepolsterten tannengrünen Sessel fallen. »Wäre vielleicht gar nicht so schlecht, dann könntest du mal zum Friseur.«
Ich fuhr mir durch die braunen Haare, die tatsächlich lang geworden waren und nun beinahe Noahs ähnelten, bis hinunter zu dem kurzen Bart, der an meiner Handfläche kratzte.
»Ich mag’s, lass dich nicht verunsichern«, gab Noah mit einem Seitenblick auf unsere Schwester zurück.
»Wollt ihr noch was trinken?«, fragte ich, als ich den beinahe leeren Latte Macchiato meiner Schwester bemerkte. Anscheinend hatte ich die beiden doch länger warten lassen als gedacht.
»Ich nehm noch einen Caramel Macchiato«, antwortete sie, wie aus der Pistole geschossen.
»Ich hab noch, danke.«
Ich hängte meine Lederjacke, die ich an dem warmen Apriltag nicht gebraucht hätte, über den freien Sessel und ging zur Theke, um bei Larissa den Caramel Macchiato und einen Cappuccino für mich zu bestellen. Eine Sekunde später trat Phuong aus dem kleinen Raum zur Rechten der Theke, in der Hand trug sie zwei große Packungen Kekse. Ich hatte sie eine Weile nicht gesehen, lange genug zumindest, dass mich die schwarz-türkisen Haare überraschten.
»Hi Elias!« Sie stellte die Packungen auf dem Tresen ab und blickte kurz zu Larissa hinter ihr. »Du hast schon bestellt?«
Ich nickte. »Alles gut bei dir?«
»Jap, bis auf den üblichen Unistress kann ich mich nicht beklagen. Kat und ich überlegen, eine WG zu gründen. Das Wohnheim macht mich langsam fertig.«
Phuong war eine von Kyras besten Freundinnen und arbeitete seit knapp zwei Jahren im Poet’s Corner, das zu unserem Stammcafé geworden war. Zugegeben, ich war – im Gegensatz zu meinen Geschwistern – nicht der Typ für Cafés oder Stillsitzen, deshalb traf ich sie eher selten hier an.
»Schön, dich mal wieder zu sehen«, kommentierte sie im selben Augenblick, als hätte sie meine Gedanken gelesen.
»Ja, ist eine Weile her. Aber du siehst mich jetzt sicher häufiger. Kyra ist der Meinung, dass wir uns regelmäßiger treffen müssen, also haben wir ab heute alle zwei Wochen Coffee Dates. Und damit es keinen Streit gibt, wer zu wem fährt, haben wir beschlossen, uns auf halber Strecke zu treffen und veranstalten sie hier.«
»Das ist aber nicht die Mitte von Schöneberg und Kreuzberg.«
»Okay, vielleicht hatte auch keiner Lust darauf, die Wohnung auf Vordermann zu bringen«, gab ich grinsend zurück.
»Ist mir recht, sonst bekomme ich dich und Noah ja gar nicht mehr zu Gesicht.«
Ich plauderte noch mit Phuong, bis Larissa die Getränke gemacht hatte, und trug diese dann selbst zum Tisch. Kyra schnappte sich ihren Caramel Macchiato sofort und stieß ein wohliges Seufzen aus.
»Sag bitte nicht, dass du wieder so wenig geschlafen hast.« Der Sessel gab ein Knarzen von sich, als ich mich darauf fallen ließ. »Kyra?«, fragte ich, als einige Sekunden verstrichen.
»Du hast gesagt, ich soll es nicht sagen, also hab ich die Klappe gehalten.«
»Milan oder Podcast?«, erkundigte sich Noah mit einem Grinsen.
»Beides«, murmelte sie.
»Übernimm dich bitte nicht«, meinte ich.
»Sagst gerade du mit deinen zig Jobs, der Uni und allem.«
»Milan lenkt sie schon ab.« Noah warf Kyra einen Blick von der Seite zu.
»Klappe!«
»Seit wann bist du Milan-Fan?«, fragte ich meinen Bruder, der direkt mit den Händen abwiegelte.
»Fan würde ich jetzt nicht gerade sagen. Es ist mehr so eine gegenseitige Akzeptanz.«
»Ja, ja. Akzeptanz. Deshalb haben du, Daniel und er letzte Woche auch selig Mario Kart zusammen gezockt. Du hast ihn eingeladen.« Sie warf mir einen wissenden Blick zu, der mich zum Schmunzeln brachte. Noah war zu Beginn nämlich alles andere als begeistert von Milan gewesen.
»Woher weißt du das?«
»Daniels Insta-Story.«
»Wieso postet der Junge alles auf Instagram? Seit ich wieder da wohne, muss ich wirklich aufpassen, keine Unterwäsche irgendwo rumfliegen zu lassen, die dann für alle sichtbar online landet.«
»Die gehört sowieso in den Wäschekorb.«
Noah rollte mit den Augen. »Jedenfalls wollte ich nur gucken, ob er überhaupt was für dich ist.«
Kyra stieß ein Schnauben aus, das die Kerze auf dem Tisch zum Flackern brachte. »Dafür ist es etwas spät. Als ob du das außerdem zu entscheiden hättest.« Sie pikte ihn in den Oberarm. »Pass auf, sonst pack ich dich doch noch in den Podcast.«
»Du kannst das nicht immer als Drohung nehmen.«
»Funktioniert bisher aber gut.«
Ich folgte dem Schlagabtausch der beiden mit einem Grinsen. »Vielleicht sind die regelmäßigen Treffen doch keine so gute Idee, wenn ihr euch wieder so benehmt wie damals, als ihr noch bei Mama und Papa gewohnt habt.«
»Klappe«, erwiderten beide gleichzeitig, was uns alle zum Lachen brachte.
»Also seid Milan und du jetzt richtig offiziell zusammen?«, fragte ich meine kleine Schwester.
»Ich … glaub schon, ja.«
»Du glaubst? Ihr seht euch doch seit Monaten.«
»Generation Z, Elias. Ich bin mir nicht mal mehr sicher, ob man sich so was sagt oder ob ›wir sind jetzt exclusive‹ die neuen magischen Worte sind. Dating ist kompliziert, alter Mann.«
Ich trat unter dem Tisch nach ihrem Fuß, was sie zum Lachen brachte.
»Aber ja, doch, kann man schon so sagen.«
»Ich freu mich für dich«, sagte ich, und mein Lächeln verstärkte sich, als ich ihres sah. Kyra hatte etwas Glück in der Liebe wohl mehr verdient als wir alle zusammen.
»Papa meinte, du kannst Freitag nicht mit zum Kundentermin?«, fragte Noah.
Ich schüttelte den Kopf. »Ne, aber ich mach ihm morgen noch die Auswertung fertig. Mit dem Fahren und allem wär’s zu knapp mit dem Kurs. Gehst du stattdessen mit?«
»Nope, ich hab Uni, und Papa ist der Meinung, ich sollte da besser hin.«
Noah grinste zwar, aber ich hätte zu gern seine Gedanken gelesen, denn ich war mir nicht sicher, wie mein Bruder wirklich über meinen Job bei Marc dachte – oder besser gesagt über die Tatsache, dass sich in letzter Zeit immer häufiger dessen Termine mit denen des Betriebs schnitten. Mein Rauswurf hatte ihn mehr mitgenommen als mich, was der erste Hinweis für mich hätte sein sollen, dass es sich bei der Sache mehr um Noahs als um meinen Lebenstraum handelte. Es hatte nie infrage gestanden, dass Noah und ich Seger Solar, den Laden, den unser Großvater gegründet hatte und der mittlerweile mehr als bloße Solarpanels herstellte, irgendwann übernahmen. Wir hatten unser Studium danach ausgewählt, Schulpraktika in dem Betrieb gemacht und waren mit Beginn der Uni beide als Werkstudenten dort eingestiegen. Mit meiner Suspendierung wurden Noah meine Aufgaben zugeteilt, und er hatte mehr Verantwortung übernommen. An sich nichts, was Noah störte, denn er brannte für die Firma, doch seine Freude, als sich alle Missverständnisse letzten Winter geklärt hatten und ich zurück auf meinen Posten durfte, war umso größer gewesen. Nicht groß genug jedoch, dass sie sich vollständig auf mich übertrug. Dabei sollte ich Freude fühlen, oder nicht? Ich musterte meinen Bruder und fragte mich nicht zum ersten Mal, wie ich es schaffen konnte, mich meiner Aufgabe wieder mit der gleichen Hingabe wie früher zu widmen.
»Oh, hi!«, rief Kyra plötzlich und winkte in Richtung Tür. Ich folgte ihrem Blick. Miriam, Kyras zweite beste Freundin, betrat gerade den Laden. Sie trug eine dunkelblaue Jeansjacke über dem Arm und kam, dem Rucksack nach zu urteilen, wohl gerade von der Uni. Ihre hellen Haare fielen ihr in sanften Wellen bis über die Brust. Miriams Blick huschte kurz suchend zur Theke, dann erst kam sie an unseren Tisch.
»Hey«, sagte Miriam, wobei der Blick aus ihren hellbraunen Augen mich nur kurz streifte. Ich war mir nie ganz sicher, ob sie mich mochte. Manchmal kam es mir so vor, dann wiederum schien sie mir auszuweichen – oder hatte es getan, als Kyra noch bei unseren Eltern gewohnt hatte und wir gleichzeitig zu Besuch gewesen waren. Wann immer wir zu zweit in einem Raum waren, hatte sie eine Ausrede gefunden, diesen zu verlassen. Vielleicht war es ihr einfach unangenehm, mit dem großen Bruder ihrer besten Freundin Small Talk betreiben zu müssen. Wer konnte es ihr verübeln? Generell war Miriam eher still, doch in den Momenten, in denen sie etwas sagte, zogen mich ihre Worte stets in den Bann.
»Wie geht es dir?«, fragte Kyra, und in ihrem Blick lag Sorge, wenn mich nicht alles täuschte. Ich folgte ihm und konnte es nachvollziehen. Miriams Augen waren leicht gerötet, nicht als hätte sie geweint, sondern vielmehr, als hätte sie die Nacht nicht geschlafen. Ich biss mir auf die Zunge, um die Fragen, die darauf lagen, zurückzuhalten. Sie war Kyras Freundin, und was immer sie bedrückte, ging mich nichts an. Ich mochte Miriam und fand sie eindeutig attraktiv, aber ich wusste es besser, als diese Gedanken ihren Lauf nehmen zu lassen. Kyra hatte zu Schulzeiten schwer Anschluss gefunden und nur eine Handvoll enger Freundinnen. Diese gingen ihr über alles, und um nichts in der Welt würde ich etwas tun, was diese Freundschaften sabotierte.
»Ganz in Ordnung«, erwiderte Miriam. »Ist Phuong zufällig da?«
»Ja«, antwortete ich, während mein Blick die Theke entlangschweifte. »Entweder auf Toilette oder in der Küche, aber eben war sie noch hier.«
»Danke«, sagte Miriam. Sie sah von uns zurück zur Theke, als wäre sie nicht sicher, was sie jetzt tun sollte.
»Du kannst gern hier warten«, meinte ich und zog ihr einen der Sessel des benachbarten Tischs heran. Ein zaghaftes Lächeln erschien auf ihrem Gesicht, aber es wirkte vorsichtig und erreichte ihre Augen nicht.
»Danke, ich will euer Date aber gar nicht stören.«
»Du störst doch nicht«, widersprach Kyra direkt, woraufhin sich Miriam auf den Sessel neben mir setzte. Ohne dass ich es wollte, nahm ich den beinahe schon vertrauten Duft ihres Shampoos wahr. Es war der Geruch nach Zitrus, der sie seit Jahren umgab.
»Anstrengender Tag?«, fragte ich.
Miriam lachte auf. »Kann man so sagen, ja.«
»Magst du reden?«
Verblüfft blickte Miriam mich an. Ich war selbst überrascht, dass mir diese Frage herausgerutscht war – und noch mehr über die leichte Enttäuschung, die sich in mir bemerkbar machte, als sie langsam den Kopf schüttelte. »Nein, aber danke. Ich wollte kurz Phuongs Meinung zu was und bin auch gleich wieder weg. Außerdem kennst du anstrengende Tage sicher besser als ich … Du bist zurück in der Firma?«
Ich nickte. »Ja, seit drei Wochen.«
»Endlich«, warf Noah ein.
»Ach, du hast doch auch ohne mich erstaunlich wenig Mist gebaut.«
»Bin trotzdem froh, dass du bei dem Termin nachher dabei bist.«
»Du willst heute noch arbeiten?«, fragte Kyra und warf einen Blick auf ihre Uhr. »Aber du warst doch gerade erst im Studio. Und du hattest heute Morgen schon Uni.«
»Ja, aber ich hab auch den hier«, erwiderte ich und deutete auf die Kaffeetasse vor mir. »Außerdem war das an der Uni nur eine Infoveranstaltung zur Bachelorarbeit.«
»Ich weiß nicht. Meinst du nicht, das ist ein bisschen viel?«
»Ich hab ihm auch schon gesagt, dass Marc es sicher versteht, wenn er nicht mehr im Studio aushilft.«
»Ich helf nicht nur aus, ich hab eigene Kurse.«
Noah hob beschwichtigend die Hände. Wir hatten dieses Gespräch bereits letzte Woche geführt, und es war nicht gerade auf einer positiven Note geendet. Noah war der Meinung, ich arbeitete zu viel und könnte mich so nicht auf meinen Posten in unserem Familienbetrieb konzentrieren – etwas, das Noah wichtiger als alles andere war. Und mir bis vor Kurzem auch. Weil ich nie eine Alternative gekannt hatte … Doch so sehr ich in die Firma zurückgewollt hatte, so sehr missfiel mir nun die Vorstellung, im Studio zu kündigen. Denn es war nicht nur die Arbeit, die ich liebte. Es war das Gefühl, etwas Positives zu bewirken, so wie heute mit Marlon. Das Gefühl, gebraucht zu werden.
»Du hast vor allem bald deine Bachelorarbeit«, meinte Kyra und musste lachen, als ich mein Gesicht verzog.
»Erinnere mich doch nicht daran. Nein, aber ernsthaft: Ich schaff das schon.«
Kyra und Noah nickten, auch wenn beide nicht völlig überzeugt von meinen Worten wirkten. Miriam neben mir lächelte abwesend, und ich war mir sicher, dass sie mit ihren Gedanken gerade überall war, nur nicht bei diesem Gespräch.
»Sicher, dass du nicht reden magst?«, fragte ich leise, während Noah und Kyra weitersprachen. Miriam richtete den Blick aus ihren warmen braunen Augen auf mich, bevor sie ihren Kopf leicht von links nach rechts bewegte. »Ist eine etwas längere Geschichte, und ich hab euer Treffen sowieso schon gestört.« Hinter ihr öffnete sich die Tür zu den Toiletten, und Phuong trat heraus. »Als hätte sie mich gehört«, fuhr Miriam fort und stand auf. »Danke dir, Elias«, sagte sie und schenkte mir ein Lächeln, das wesentlich echter wirkte als zuvor und dafür sorgte, dass ich für einen kurzen Augenblick alles um mich herum vergaß.
Am liebsten hätte ich mich selbst geschüttelt. Die Freundin meiner kleinen Schwester war tabu.
Miriam nahm ihren Rucksack vom Boden. »Ich quatsch mal kurz mit Phuong. War schön, euch beide mal wieder gesehen zu haben. Sorry, dass ich einfach so reingeplatzt bin.«
»Alles gut«, meinte Noah. »Hey«, rief er dann, als Miriam gerade im Begriff war, wegzugehen.
»Ja?«
»Was machst du denn am 7. Mai?«
Sie hob die Schultern und sah ihn perplex an. »Noch keine Pläne, denke ich. Wieso?«
»Ich weiß, es ist mega früh, aber ich würd gern meinen Geburtstag feiern und dachte, ich frag lieber alle jetzt schon, bevor sie den Tag verplanen. Also falls du Zeit hast … Ich will nichts Großartiges machen, einfach die alte Truppe bei mir und Daniel.«
»Total gern!«, sagte Miriam, und erneut erschien ein Lächeln auf ihrem Gesicht. Es brachte ihre Augen zum Strahlen und sorgte dafür, dass auch meine Mundwinkel sich wie von selbst hoben. Kurz trafen sich unsere Blicke, dann schulterte sie ihren Rucksack, winkte uns noch einmal zum Abschied und ging in Richtung Theke. Ich sah ihr hinterher und blieb mit einem Gefühl zurück, das mich verdächtig an Enttäuschung erinnerte. Doch worüber? Dass sie sich mir nicht anvertraute? Wieso sollte sie auch?
»Ist alles okay bei ihr?«, fragte ich dennoch leise.
Kyra seufzte. »Lange Geschichte.« Ihr Blick ruhte weiter auf Miriam. »Sorry, aber ich schau mal nach ihr, ja? Ihr könnt euch in der Zwischenzeit mal das hier ansehen. Nächste Woche kommt ein Film, den Lia und ich unbedingt gucken wollten, und ich dachte, ihr wollt vielleicht mit …«
Kyra entsperrte ihr Handy und legte es auf den Tisch. Dann lächelte sie mir entschuldigend zu und lief Miriam hinterher zur Theke.
Noah schnappte sich das Smartphone und begann, den Inhalt des Films vorzulesen, doch ich hörte nur mit einem Ohr zu, denn mein Blick wanderte immer wieder zu Miriam. Diese war nun in ein Gespräch mit Phuong und Kyra verwickelt. Was auch immer die drei besprachen, Miriam sah alles andere als glücklich aus, und ich hätte zu gern gewusst, was hinter der Geschichte steckte, die Kyra gerade erwähnt hatte.
3. KAPITEL
Miriam
»Oh Mann, aber wie kam deine Schwester überhaupt auf den Podcast?«, fragte Phuong. Ich hatte ihr von dem gestrigen Telefonat erzählt, obwohl mir klar war, dass sie nicht helfen konnte. Doch auch wenn ich meinte, was ich meiner Mutter gesagt hatte, und nichts bereute – mit irgendjemandem musste ich reden. Und bei Phuong und Kyra konnte ich mir sicher sein, dass sie mir den Rücken stärkten.
»Ich war einfach doof«, erwiderte ich. »Meine Schwester und ihr Verlobter waren an Ostern auch bei meinen Eltern, und ich hab Kyras Podcast erwähnt. Schätze, Louisa hat ihn danach gehört und ist wohl gestern bei der Folge mit mir angelangt.«
»Und sie ist da so konservativ wie deine Eltern?«
»Scheint so. War mir auch nicht klar.«
Kyra, die neben mir an der Theke lehnte, den Kopf auf die Hände gestützt, schenkte mir ein mitleidiges Lächeln, mit dem sie mich gestern schon mehrmals bedacht hatte. Sie hatte mich bereits nach der Aufnahme des Podcasts gewarnt, dass meine Familie ihn hören könnte, dass online Kommentare kommen könnten, und ich hatte ihn trotzdem hochladen wollen. Die Kommentare kamen, wie von Kyra vorhergesagt, direkt. Während ich anfangs noch überlegt hatte, nach der Aufnahme zu meinen Eltern zu fahren, hatten mich die zahlreichen Meinungen zu der Folge davon abgehalten. Mit den Kommentaren war ich erstaunlich gut klargekommen, vielleicht, weil ich sie alle fast schon im selben Wortlaut erwartet hatte. Man fand sie unter jeglichen Instagram-Posts zum Thema. Doch sie hatten mir auch mögliche Reaktionen meiner Familie aufgezeigt, und das wiederum hatte mir Angst eingejagt. Genug, um das Geschehene weiterhin vor meinen Eltern und meiner Schwester geheim zu halten.
»Hast du Louisa mittlerweile erreicht?«, fragte Kyra, woraufhin ich den Kopf schüttelte.
»Okay, also weißt du noch gar nicht, ob sie wirklich auf der Seite deiner Eltern ist«, gab sie zu bedenken.
»Aber wieso sonst sollte sie mir nicht antworten?«
»Bereust du den Podcast?« Kyra kaute auf ihrer Unterlippe.
»Nein, das hab ich dir doch gestern schon gesagt.«
»Ich weiß, aber …«
»Nichts aber. Ich steh nach wie vor dahinter.«
»Was können wir tun?« Phuong legte ihre Hand auf meine und drückte sie kurz. Ich erwiderte ihren Blick und ließ geräuschvoll einen Schwall Luft entweichen. Tja, was konnten sie tun?
Langsam hob ich die Schultern. »Ich weiß es nicht. Denkt ihr …«
»Denken wir was?«, hakte Kyra nach, als ich nicht weitersprach.
Mit den Fingerspitzen rieb ich mir über die Stirn, hinter der sich ein Ziehen bemerkbar machte.
»Denkt ihr, ich hab einen Fehler gemacht?«
»Mit der Abtreibung?«, fragte Phuong. »Das ist ganz allein deine Entscheidung, das sagtest du doch selbst.«
»Damit, dass ich ihnen damals nichts gesagt hab. Ich bin mir sicher, dass es das Richtige war, aber ihr hättet meine Mutter hören sollen.« Ich schüttelte den Kopf.
»War sie wirklich wütend wegen der Sache an sich? Oder eher, weil sie es auf diese Weise erfahren hat?«
Ich hob die Schultern. »Ich weiß es nicht genau, ein bisschen von beidem, denke ich. Du kennst sie ja nicht, aber sie sind nicht gerade die liberalsten. Frag Kyra.«
»Mag sein«, stimmte diese mir zu, »aber ich weiß auch, dass sie dich lieben. Vielleicht brauchen sie einfach ein bisschen Zeit, für sie ist das Ganze ja noch recht frisch.«
»Du hast nichts falsch gemacht«, meinte Phuong ruhig, aber bestimmt. »Wenn überhaupt bewundere ich dich. Meine Periode war einmal fast eine Woche zu spät, und ich hatte schon totale Panik. Dass du das damals alles allein geschafft hast … Wirklich, Miri, ich hab Respekt.«
Ich lächelte schwach. »Danke dir. Ich wünschte nur, meine Familie würde das genauso sehen.«
»Ruf Louisa noch mal an«, sagte Kyra. »Vielleicht kann sie zwischen euch vermitteln. Ich kann mir kaum vorstellen, dass sie auch sauer auf dich ist, sie ist quasi in unserem Alter.«
»Genau«, stimmte Phuong zu. »Du kannst in der Küche telefonieren, wenn du magst.«
»Du kannst auch mein Handy nutzen«, bot Kyra an. »Falls sie wirklich sauer ist, geht sie da vielleicht eher ran.«
»Was nicht besser wäre, weil ich dann weiß, dass sie nicht mit mir sprechen möchte.« Ich lächelte schief. »Ich probier es noch mal so. Ihr seid die Besten, wisst ihr das?«
»Yep«, sagte Phuong mit einem Grinsen. »Deshalb mach ich gleich auch ganz laut die Beatles an und bringe dir die beste heiße Schokolade in ganz Berlin zum Trost.«
»Hast du nicht gesagt, die gibt es in der Kaffeerösterei neben Lias Galerie?«, fragte Kyra.
»Jetzt mach es mir doch nicht kaputt«, protestierte Phuong. »Aber ja, da müssen wir mal hin.«
Das Gespräch der beiden versetzte mir einen kleinen Stich, denn die Rösterei wäre mein Vorschlag für eines der nächsten Treffen mit meiner Schwester gewesen, nachdem Phuong und Lia so davon geschwärmt hatten. Die nagende Unruhe, die Phuongs Worte in mir hervorgerufen hatten, war aber immerhin Anlass genug, dass ich mein Handy entsperrte und mich in die kleine Küche des Poet’s Corners verzog. Ich schloss die Tür hinter mir und hoffte, dass Phuong Larissa daran hindern würde, hereinzuplatzen. Wenn Louisa überhaupt dranging.
Nervös drückte ich auf den Hörer und hielt mir das Handy ans Ohr. Eins, zwei, drei, vier. Im Kopf zählte ich die Male mit, die das Freizeichen ertönte. Dann knackte es in der Leitung. Louisa war endlich rangegangen.
»Was willst du, Miriam?«
Die Stimme meiner Schwester klang so abweisend, dass es mich direkt an das gestrige Telefonat mit meiner Mutter erinnerte. Doch was mich noch viel mehr irritierte, war, dass sie mich mit meinem vollen Namen ansprach – das tat sie sonst nie. Innerlich wappnete ich mich für das folgende Gespräch, denn ich wusste bereits, dass es nie und nimmer gut laufen konnte. Dabei wollte ich nichts weniger, als noch einmal die gleiche Ablehnung erfahren, die mir meine Mutter gestern entgegengebracht hatte.
»Hi, Lou«, sagte ich und räusperte mich. Ich wünschte, ich hätte mit ihr sprechen können, bevor sie und Mama über alles geredet hatten. Ich liebte meine Mutter, aber sie hatte zu Louisa stets ein engeres Verhältnis gehabt als zu mir, und ich konnte mir gut vorstellen, dass sich die Lage immer und immer weiter hochgeschaukelt hatte, während ich nichtsahnend kein Wort dazu sagen konnte.
Was mein Vater wohl über all das dachte? War er auch so wütend? Schon als kleines Mädchen war ich mehr nach ihm gekommen und hatte auch heute noch einen engeren Draht zu ihm.
»Was gibt’s?«, riss mich Louisas Stimme aus den Gedanken.
»Wie geht es dir?«
»Gut«, antwortete Louisa knapp und schwieg. Sie erkundigte sich weder, wie es mir ging, noch hielt sie das Gespräch sonst am Laufen.
»Ich hab gestern Morgen auf dich gewartet«, sagte ich. Wieder erwartete mich nur Schweigen auf der anderen Seite, dennoch schaffte sie es, mir ein schlechtes Gefühl zu geben.
»Bist du wütend auf mich?«, fragte ich also, obwohl ich die Antwort längst kannte.
Am anderen Ende der Leitung war ein leises Lachen zu hören, das jedoch so empört klang, dass es einem Schnauben glich. »Das fragst du wirklich?«
»Gut, dann lass es mich umformulieren: Warum bist du wütend auf mich?«
»Warum ich wütend auf dich bin? Jetzt im Moment gerade, weil du diese Frage überhaupt stellst. Was glaubst du denn?«
»Weil Mama und du den Podcast gehört habt. Und keiner von euch kam auf die Idee, mal mit mir zu reden?«
Erneut lachte Louisa auf, diesmal jedoch etwas lauter. »Du bist ja lustig, uns Vorwürfe zu machen. Inszenier dich jetzt bloß nicht als das Opfer in diesem Szenario. Wir sollen mit dir reden, nachdem du uns verschweigst, dass du … nachdem du uns so etwas verschweigst?«
»Ich hätte vielleicht mit euch reden sollen, ja«, antwortete ich und bemühte mich, meine Stimme ruhig zu halten, schon allein, weil ich nicht wollte, dass Phuong, Kyra und Larissa draußen alles mithören konnten. Ich hasste Streit. Ich wusste ganz genau, wie sehr meine Stimme zu zittern anfangen würde, wenn ich die Wut und Traurigkeit, die ich fühlte, jetzt nach außen dringen ließ. »Aber ich hatte in diesem Moment genug im Kopf und wollte nicht …«
»Hättest du, ja. Dann hätten wir dir diese Dummheit nämlich ausreden können.«
Perplex hielt ich inne und vergaß, was ich noch hatte sagen wollen.