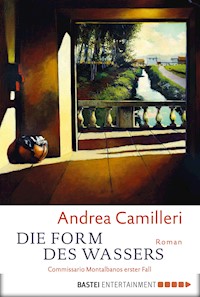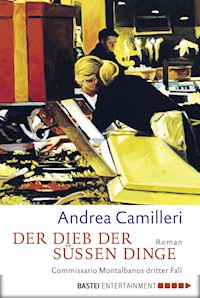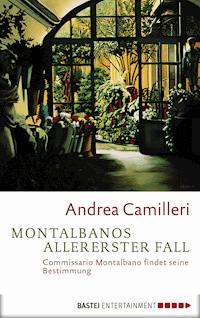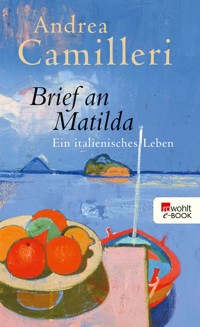
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
"Liebe Matilda, ich habe wenig im Leben gelernt, und davon erzähle ich Dir jetzt." Andrea Camilleri ist über neunzig Jahre alt, seine jüngste Urenkelin fast vier. Während er schreibt, wuselt die kleine Matilda unter seinem Schreibtisch herum und spielt vor sich hin. Da beschließt er, ihr einen langen Brief zu schreiben. Sie soll ihn lesen, wenn sie groß ist. Auf Seiten, die voller Gefühl, Humor und Aufrichtigkeit sind, durchlebt Camilleri noch einmal die Etappen seines Lebens, von Kindheitserinnerungen an die Mussolini-Ära über die bleiernen Jahre und Berlusconi bis hin zu einem Mafia-Blutbad in seiner Heimatstadt. Und er erzählt von der ersten Begegnung mit Rosetta, der Liebe seines Lebens. Er schreibt über seine sizilianischen Wurzeln, über Liebe, Freundschaft, Politik, Literatur. Dabei hat Camilleri durchaus den Mut, Fehler zuzugeben. Es gibt keine Sicherheiten, die er Matilda mitgeben kann. Dafür aber die wertvolle Kunst des Zweifels. Mit Leichtigkeit erzählt, pointiert, humorvoll: ein Geschenk fürs Leben.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 100
Veröffentlichungsjahr: 2019
Ähnliche
Andrea Camilleri
Brief an Matilda
Ein italienisches Leben
Über dieses Buch
«Liebe Matilda, ich habe wenig im Leben gelernt, und davon erzähle ich dir jetzt.»
Andrea Camilleri ist über neunzig Jahre alt, seine jüngste Urenkelin fast vier. Während er schreibt, wuselt die kleine Matilda unter seinem Schreibtisch herum und spielt vor sich hin. Da beschließt er, ihr einen langen Brief zu schreiben. Sie soll ihn lesen, wenn sie groß ist.
Auf Seiten, die voller Gefühl, Humor und Aufrichtigkeit sind, durchlebt Camilleri noch einmal die Etappen seines Lebens, von Kindheitserinnerungen an die Mussolini-Ära über die bleiernen Jahre und Berlusconi bis hin zu einem Mafia-Blutbad in seiner Heimatstadt. Und er erzählt von der ersten Begegnung mit Rosetta, der Liebe seines Lebens.
Er schreibt über seine sizilianischen Wurzeln, über Liebe, Freundschaft, Politik, Literatur. Dabei hat Camilleri durchaus den Mut, Fehler zuzugeben. Es gibt keine Sicherheiten, die er Matilda mitgeben kann. Dafür aber die wertvolle Kunst des Zweifels.
Mit Leichtigkeit erzählt, pointiert, humorvoll: ein Geschenk fürs Leben.
Vita
Andrea Camilleri wurde 1925 in Porto Empedocle, Sizilien, geboren. Er ist Schriftsteller, Drehbuchautor und Regisseur und lehrte über zwanzig Jahre an der Accademia d’Arte Drammatica Silvio D’Amico. Im Kindler Verlag sind etliche seiner Werke erschienen, zuletzt «Gewisse Momente» (2019). Andrea Camilleri ist verheiratet, hat drei Töchter, vier Enkel und lebt in Rom.
Impressum
Die Originalausgabe erschien 2018 unter dem Titel «Ora Dimmi Di Te, Lettera a Matilda» bei Giunti Editore S.p.A./Bompiani.
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Dezember 2019
Copyright © 2019 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
«Ora Dimmi Di Te, Lettera a Matilda » Copyright © 2018 by Giunti Editore S.p.A./Bompiani
Covergestaltung any.way, Barbara Hanke/Cordula Schmidt
Coverabbildung Stillleben mit Blick auf Stromboli und Panarea (Öl auf Leinwand), Morrocco, Leon (b.1942)/Bridgeman Images
ISBN 978-3-644-00312-5
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Meine liebe Matilda,
diesen langen Brief schreibe ich dir wenige Tage vor meinem zweiundneunzigsten Geburtstag. Du bist jetzt fast vier Jahre alt. Noch kennst du das Alphabet nicht, doch als junges Mädchen wirst du diesen Brief lesen, hoffe ich.
Ich schreibe dir blindlings im buchstäblichen wie im übertragenen Sinn. Im buchstäblichen Sinn, weil die Sehkraft mich in den letzten Jahren allmählich verlassen hat. Mittlerweile kann ich nicht mehr lesen und schreiben, nur noch diktieren. Im übertragenen Sinn, weil ich mir nicht vorstellen kann, wie die Welt in zwanzig Jahren aussehen wird, die Welt, in der du leben musst.
Denn auch in den letzten zwanzig Jahren hat es sehr viele und manchmal völlig unerwartete Veränderungen gegeben. Die Welt sieht nicht mehr so aus wie in meiner Jugend und meiner frühen Erwachsenenzeit. Politische, wirtschaftliche, kulturelle und gesellschaftliche Umbrüche haben sie gewandelt, aber auch wissenschaftliche Entdeckungen, der Einsatz modernster Technologien, die Auswanderungsströme von einem Kontinent zum anderen und das fast endgültige Scheitern unseres Traums von der Europäischen Gemeinschaft.
Doch warum verspüre ich das dringende Bedürfnis, dir zu schreiben?
Auf diese Frage kann ich nur mit einer gewissen Bitterkeit antworten: Mir ist sehr wohl bewusst, dass das Alter Grenzen setzt und ich daher nicht in den Genuss kommen werde, dich Tag für Tag aufwachsen zu sehen, deine ersten Gedanken zu erfahren, die Entwicklung deines Geistes zu verfolgen. Kurz, ich werde keine Gespräche mit dir führen können. Dieser Brief soll ein kleiner Ersatz für den Dialog sein, der niemals zwischen uns stattfinden wird. Darum muss ich dir, glaube ich, zuallererst von mir erzählen. Vielleicht wird deine Mutter Alessandra über mich sprechen, aber es ist mir lieber, wenn ich dir mit eigenen Worten von mir und meinem Leben berichten kann. Und ich wünsche mir von ganzem Herzen, dass einiges davon, zum Beispiel die Zeit des Nationalsozialismus und Faschismus, Rassismus, Vernichtungslager, Krieg und Diktatur dir sehr weit entfernt und veraltet vorkommen werden.
Ich bin 1925 in Porto Empedocle geboren, einem kleinen Ort im Süden Siziliens. Die Menschen dort waren zum größten Teil Fischer, Hafenarbeiter, Fuhrleute und Bauern. Es gab nur wenige Angestellte und noch weniger Geschäftsleute. In der ersten Klasse war ich von Mitschülern umgeben, die fast alle in ärmlichen Verhältnissen lebten. Stell dir vor, die Kinder der Bauern trugen ihre Schuhe auf dem Schulweg um den Hals gebunden, um sie nicht abzunutzen, und zogen sie erst an, wenn sie das Klassenzimmer betraten. Das Pausenbrot, das Mama mir jeden Morgen in den Ranzen steckte, konnte ich, wenn ich mich recht erinnere, nie allein aufessen. Fast immer habe ich es mit anderen geteilt, weil ich die neidischen, hungrigen Blicke meiner Klassenkameraden nicht ertragen konnte.
Als ich geboren wurde, war Benito Mussolini seit drei Jahren italienischer Regierungschef und hatte seinen Plan, das Land einer faschistischen Diktatur zu unterwerfen, schon weitgehend umgesetzt. Ich vermute, du wirst mit dem Begriff «faschistisch» nicht viel verbinden können, darum versuche ich dir zu erklären, was in jenen Jahren geschehen ist.
Das für Italien siegreiche Ende des Ersten Weltkriegs im Jahr 1918 hätte dem Land theoretisch eine Zeit wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Stabilität bringen können. Aber es kam anders. Die Soldaten, die von der Front zurückkehrten, fanden kaum Arbeit, denn das, was viele Jahre eine Kriegsindustrie gewesen war, konnte nicht schnell genug in eine Industrie des Friedens umgewandelt werden. Auch gab es viele Konflikte zwischen Arbeitgebern und Arbeitern, und sie wurden offen ausgetragen. Von all den Versprechen, die man den Soldaten während des Kriegs gemacht hatte, war nicht eines eingelöst worden. Straßenkämpfe zwischen Polizisten und Kriegsheimkehrern oder Arbeitern waren sehr häufig. In dieser Situation erschien den Großgrundbesitzern in Mittel- und Norditalien und einigen wichtigen Industriellen eine Rückkehr zur Ordnung dringend geboten. Doch dafür brauchte es einen Mann mit dem nötigen Charisma und mit unbedingter Loyalität gegenüber dem Auftrag, den sie ihm erteilen würden. Ihre Wahl fiel auf einen ehemaligen Sozialistenführer und einstigen Chefredakteur des «Avanti!», der Tageszeitung der Sozialistischen Partei: Benito Mussolini war ein glühender Verfechter des Kriegseintritts und dann Kämpfer in vorderster Front gewesen. Innerhalb kurzer Zeit konnte er alle ehemaligen Kampfgenossen um sich versammeln und den Teil des Bürgertums gewinnen, der in der Unzufriedenheit der Arbeiterschaft eine reale Gefahr sah. In Anlehnung an die Symbolik des antiken Roms gründete er die Fasci di combattimento, eine faschistische Miliz, deren Mitglieder schwarze Hemden trugen, mit Knüppeln bewaffnet und äußerst gewalttätig waren. Sie nannten sich «Squadristen». Schon bald nach Gründung der Fasci brannten viele Büros sozialistischer Organisationen, und es gab schwere Kämpfe mit Toten auf beiden Seiten. Als die Sozialisten sich 1921 spalteten, entstand die Kommunistische Partei Italiens, deren erster Generalsekretär Antonio Gramsci war. Die Kommunisten wurden zum bevorzugten Angriffsziel der Faschisten.
1922 erkannte Mussolini, dass er auf die Unterstützung der großen Mehrheit des italienischen Volkes zählen konnte. Am 28. Oktober desselben Jahres, beim sogenannten «Marsch auf Rom», marschierte er mit Tausenden Mitgliedern seiner Partei nach Rom. Die Lage war ernst. An den Toren der Hauptstadt trafen die Faschisten auf Truppen der italienischen Armee. Ein Bürgerkrieg schien unvermeidlich. Premierminister Facta bat den König, den Notstand auszurufen, was bedeutete, dass die Truppen auf die Faschisten hätten schießen dürfen. Aus diesem Kampf wäre der Faschismus klar als Verlierer hervorgegangen, doch der König entschied überraschenderweise anders. Er weigerte sich nicht nur, den Notstandsbeschluss zu unterschreiben, er empfing Mussolini sogar im Quirinale, dem Präsidentenpalast, und beauftragte ihn mit der Bildung einer neuen Regierung. Hier bewies Mussolini eine gewisse politische Gewieftheit, denn zu seiner ersten Regierung gehörten auch Liberale, Demokraten und Sozialisten. Doch das nur für sehr kurze Zeit, denn schon bald wurde klar, dass Mussolini nach Alleinherrschaft strebte. Die Situation spitzte sich zu, als 1924 der sozialistische Abgeordnete Giacomo Matteotti, einer der hellsichtigsten und mutigsten Gegner Mussolinis, umgebracht wurde. Ein großer Teil der Bevölkerung reagierte mit Empörung auf diesen politischen Mord, und Mussolini sah seine Machtposition gefährdet. Doch mit Hilfe seiner brutalsten Squadristen konnte er seine Autorität innerhalb kurzer Zeit wieder festigen.
Von dem Moment an wurde der Faschismus in Italien zu einer wirklichen Diktatur. Mussolini löste das Parlament und den Senat auf, sie wurden ersetzt durch die Camera dei fasci e delle corporazioni. Dieses legislative Organ aus Mussolini treu ergebenen Männern verbot die Zeitungen des linken Spektrums, ließ Antonio Gramsci verhaften (und praktisch im Gefängnis zugrunde gehen) und jede Missfallenskundgebung mit Gewalt niederschlagen. Für seine Expansionspläne brauchte Mussolini junge Männer, also begann er mit einer wahnwitzigen Bevölkerungspolitik: Kinderreiche Familien erhielten Prämien. Frisch verheiratete Paare, die innerhalb eines Jahres, wie es damals hieß, «dem Vaterland einen Sohn schenkten», wurden von der Steuer befreit, Unverheirateten dagegen die Steuern erhöht. Abgesehen von den wenigen Politikern, die ins Ausland flohen, erlebte das Land ein merkwürdiges Phänomen, nämlich dass der Faschismus bei fast allen Italienern schnell Zustimmung fand. Von nun an griff Mussolini noch stärker ins Privatleben der Menschen ein, alle Staatsangestellten mussten dem Regime Treue schwören und in die faschistische Partei eintreten. Und alle, wirklich alle Staatsdiener, vom Grundschullehrer bis zum Universitätsprofessor, vom Richter bis zum Gerichtsdiener, gehorchten diesem Befehl. Nur vierundzwanzig Universitätsprofessoren verweigerten den Treueschwur – was ihnen auf immer zur Ehre gereicht – und verloren ihren Lehrstuhl.
1925, als ich geboren wurde, war der Faschismus bereits eine stabile Diktatur. Seinen Nachwuchs, von Kleinkindern bis zu jungen Menschen, organisierte er in paramilitärischen Verbänden. Samstags trugen wir die faschistische Uniform und gingen zum Exerzieren. Ich war Mitglied der Balilla, der Jugendorganisation der Partei, unser Motto lautete: «Libro e moschetto, fascista perfetto» («Buch und Karabiner machen den perfekten Faschisten»). In Wirklichkeit lasen meine Kameraden kaum oder gar keine Bücher.
Ich war eine Ausnahme. Mit fünf hatte ich unter Anleitung meiner Mutter und meiner Großmutter Elvira lesen gelernt, mit sechs bediente ich mich schon in der Bibliothek meines Vaters, die sehr gut bestückt war. Also las ich anfangs keine Kinder- oder Jugendbücher, sondern Literatur für Erwachsene, richtige Romane. Meine ersten Autoren waren Conrad, Melville und Simenon. Seitdem habe ich nie mehr aufgehört zu lesen. Und grenzenlos war mein Staunen über das Geheimnis, wie die geschriebenen Wörter in meinen Kopf gelangten – als wären sie mir diktiert worden.
In der Schule ließen die Lehrer uns jeden Tag die drei Parolen Mussolinis aufsagen: «Glauben, gehorchen, kämpfen», und erzählten uns dann begeistert, dass der Duce, wie Mussolini sich nennen ließ, sehr intelligent sei und Italien groß machen wolle. Jeden Samstag ging es nach dem Exerzieren in die Kirche, wo der Pfarrer uns den Katechismus erklärte und uns unermüdlich daran erinnerte, dass der Papst Mussolini als «von der göttlichen Vorsehung Gesandten» bezeichnet hatte, man ihm also blind gehorchen müsse. Und so war ich zwangsläufig mit zehn ein glühender Faschist; ja, als Mussolini 1935 Abessinien den Krieg erklärte, schrieb ich ihm sogar einen Brief mit der Bitte, als Freiwilliger in die Schlacht ziehen zu dürfen. Zu meiner Freude und Verwunderung erhielt ich einen Antwortbrief, in dem er mir erklärte, dafür sei ich noch zu jung.
Im folgenden Jahr, 1936, brach ein zweiter Krieg aus, der spanische Bürgerkrieg, der zu einer Art Wasserscheide zwischen Faschisten und Antifaschisten wurde. Du musst wissen, dass es in Europa damals mehr Diktaturen als demokratische Regierungen gab: in Russland herrschte Stalin, in Italien Mussolini, in Deutschland Hitler, in Portugal Salazar. Der Krieg in Spanien brachte einen neuen Diktator an die Macht: Francisco Franco. Die einzigen verbleibenden,