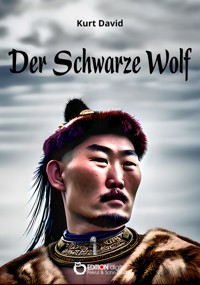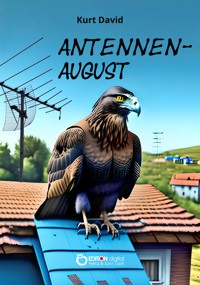7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 7,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: EDITION digital
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Zeichen und Wunder geschehen in Piepenbach, in einer Zeit, in der MTS-Traktoren durchs Dorf knattern und die Bauern Genossenschaften gründen. Aber der alte Joseph, der Totenbettmeister des Dorfes, weiß zu schweigen, und so ahnen die Piepenbacher nichts von der Gnade, die einem ihrer Mitbürger widerfahren ist. Hätten sie übrigens Einsicht in den Briefwechsel zwischen Josef und dem lieben Gott gehabt, sie hätten sich sehr gewundert. Denn der liebe Gott denkt ganz anders über unsere Zeit, über die mangelhafte Versorgung des Konsums mit Stumpen und über freiwillige Aufbaueinsätze, als man sich das so vorstellt, anders als der Herr Pfarrer sich das wünscht. Aber, wie gesagt, das alles weiß nur Josef. Und Evi, die Nachbarstochter, die weiß es auch. Aber sie erzählt es bestimmt niemandem, weil sie Angst hat, dass der Josef es herausfindet. Sie hat nämlich einen noch besseren Draht zum lieben Gott als Joseph, und das würde ihn beleidigen, wenn er es wüsste. Das 1959 in der DDR erschienene Buch durfte wegen kirchlicher Proteste nicht neu aufgelegt werden.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 146
Veröffentlichungsjahr: 2023
Ähnliche
Impressum
Kurt David
Briefe an den lieben Gott
ISBN alibri",sans-serif'>978-3-96521-848-2 (E-Book)
Das Buch erschien erstmals 1959 im Verlag Neues Leben Berlin.
© 2023 EDITION digitalPekrul & Sohn GbR Godern Alte Dorfstraße 2 b 19065 Pinnow Tel.: 03860 505788 E-Mail: [email protected] Internet: http://www.edition-digital.de
Wohl dem Menschen, der Weisheit findet,
und dem Menschen, der Verstand bekommt.
SPRÜCHE 3, 13
ERSTES KAPITEL
Joseph aber war fromm.
MATTH. 1, 19
Städter, die nach einer heiteren Omnibusfahrt draußen am Ortseingang von Piepenbach aussteigen, tun oft so, als müssten sie den Hut in die Luft werfen und jubeln: Hurra! Land! Piepenbach – du meine Perle! Ich höre schon die „Glocken im Tale“.
Aber mit den Glocken täuschen sich die Leute meist, und es sind nur ein paar Milchkannen, die auf einem Gehöft klappern.
Nein, Piepenbach ist keine Perle. Piepenbach ist einfach Piepenbach, ein Dorf wie viele andere Dörfer. Durch das ganze Dorf, durch die Salatgärten und Kohlrabipflanzungen schlängelt sich ein Bach, nämlich die Pieper, die – wenn es lange nicht geregnet hat – zu riechen anfängt. Im Bach feiern Gänse und Enten Hochzeit, verleben auf ihm die Flitterwochen und machen an seinen verstrauchten Ufern mit den Jungen die ersten Ausflüge, zeigen ihnen die tiefsten Stellen und warnen ihre gefiederten Kinder vor Scherben und Blech, das da am Ufer gefährlich in der Sonne blitzt.
Die Menschen in den kleinen Fachwerkhäusern längs der Straße, von denen viele in der Stadt arbeiten, lieben diesen Bach, sie lieben den schiefgewachsenen Apfelbaum und die Ziegen und Schafe, die hinter dem Hause angepflockt sind und kahle Flecke in die Wiese fressen. Oh, Piepenbach ist doch schön!
Geht man die Dorfstraße hinauf, am Konsum vorbei, so kommt man zur Kirche, die auf einem Hügel steht. Kirchen stehen ja oft auf Hügeln. Das ist deshalb so, damit die Leute draußen auf dem Feld immer sehen, wie spät es ist. In Piepenbach allerdings können sie das nicht mehr sehen: erstens, weil das Zifferblatt eine ganze Reihe von Sommersprossen aufweist, und zweitens, weil sich die Uhr mit ihren großen Zeigern manchmal ein bisschen ausruht.
Am Kirchberg lehnt ein Haus, ein Häuschen mit Strohdach, das gerade so hoch ist, dass man die Sperlingsnester mühelos aus der Dachrinne klauben kann.
In diesem Hause wohnt Joseph. Das ist der Totenbettmeister von Piepenbach. Dieser Joseph hat keine Brüder. Er ist ganz allein. Seine Frau hat vor kurzem das Zeitliche gesegnet, und er hat ihr das Grab selber geschaufelt. Dass er es fünfzig Zentimeter tiefer machte, als sonst üblich ist, nahm keiner übel. Joseph sagte zu den Trauergästen, die verwundert guckten: „Die, was die Verkäuferinnen im Konsum sind, die nehmen sich auch von den knappen Sachen zuerst.“
Das Häuschen steht direkt an der Pieper, bei Hochwasser in der Pieper. Rechts vom Gewölbe – so heißt hier der Hausflur – wohnt Joseph. Er hat eine niedrige Stube, darüber eine Dachkammer. Und weil er Totenbettmeister ist und das Haus der Kirche gehört, ist er der Hausverwalter. Ohne Hausverwalter geht es nicht, weil gegenüber, in der größeren Wohnung, noch andere Leute mit einer Tochter und einem Jungen wohnen, die auch richtig verwaltet sein wollen. Joseph macht seine Sache als Hausverwalter so gut, dass die Gespräche zwischen den zwei Hausparteien häufig für Tage verstummen. Oft muss Joseph eingreifen, weil der kleine Fritz von drüben über eines seiner Gurkenbeete gesprungen ist – schließlich kann es leicht geschehen, dass sich die Gurken durch den Luftzug beim Sprung eine Erkältung zuziehen. Was die siebzehnjährige Tochter Evi betrifft, so stört es Joseph, dass sie immer die allerneuesten Schlager singt. „Du hast nun so einen biblischen Namen“, hatte er ihr einmal gesagt, „aber ich glaube, das ist die einzige Verbindung, die du zur Bibel hast!“
Geht man zur Hintertür hinaus, sieht man den Garten mit Blumenbeeten und Gemüsebeeten und Holzstapeln. Und blicken wir zum strohgedeckten Dach hoch, glotzt uns ein großes Loch an, durch das man Einblick in den Bodenraum der Familie Blumenroth erhält, eben der Familie, die unter Josephs Verwaltung steht. Herr Bruno Blumenroth hat sich schon oft bei Joseph über das Loch beklagt. Joseph sagte aber nur: „So lange du und einige andere im Dorf die Kirchensteuer nicht zahlen, so lange kannst du auch nicht erwarten, dass wir von der Kirche dir das Loch zustopfen!“
So verhalten sich also die Dinge. Und nun wird es wohl Zeit, dass wir sehen, wo Joseph steckt, damit wir ihn – wie es sich gehört – zum Mittelpunkt dieser Geschichte machen können.
*
Joseph stand weit draußen auf Punzelmanns Waldwiese in einem patschnassen Drainagegraben und stach Lehm. Er trug Gummistiefel, die bis zu den Oberschenkeln reichten. Unter seinen Füßen schwappte und gurgelte das lehmige Wasser. Joseph hatte einen dicken Eichenast aus dem nahen Walde geholt, ihn in den Rasen getrieben und seine Jacke daraufgehängt. Der Graben war so tief, dass Joseph, auch wenn er sich aufrichtete, nicht zu sehen war. Trotzdem konnte man erkennen, wo er grub; denn an dieser Stelle stiegen dicke Tabakswolken aus dem Graben auf und kringelten sich in der Luft. Beim Lehmstechen baumelte seine lange Hängepfeife hin und her. Er rauchte ununterbrochen, schon wegen der vielen Mücken, die über der sumpfigen Wiese ihren Frühjahrstanz drehten.
Joseph schaute nach der Sonne. Es musste bald Feierabend sein. Er griff wieder mit der Hand in die Lehmjauche und brachte einige alte, zerbrochene Dränrohre ans Licht. In hohem Bogen warf er sie hinaus.
Gerade in diesem Moment ging auf der Waldwiese der pensionierte Pfeifferlehrer vorbei. Er musste einen für sein Alter unerhörten Seitensprung machen, um nicht so ein lehmbeschmiertes Rohr vor den Bauch geknallt zu bekommen.
„Joseph!“, schrie er und fuchtelte mit seinem Spazierstock in der Luft herum. „Kannst nicht ein bisschen aufpassen, wenn ich so ahnungslos hier dahermarschiere, um frische Luft zu schnappen?“
Joseph stach erst noch einige Male in den Lehm, bevor er in das Gesicht des alten Lehrers sah.
„Ich bitt’ auch schön um Verzeihung, Herr Lehrer, ’s war ja gar nicht ernst gemeint!“ In Wirklichkeit dachte Joseph aber: Wenn ich gewusst hätte, dass du dahier herumstolzierst – ich hätte schon getroffen. Immer wenn er den Pfeifferlehrer sah, musste er an seine Schulzeit denken und an die Haselnussstecken aus dem Schreiberbusch.
Pfeiffer stand mit durchgedrückten Knien da und streckte sich – das tat er immer, weil er so klein war –, und er sagte: „Was treibst du dich hier draußen rum und arbeitest für den Punzelbauer. – Ich denke, ein Totengräber hat bloß auf dem Friedhof zu tun, hä?“
Joseph war sehr ärgerlich über die Unkenntnis des Lehrers und sagte, die Pfeife aus dem Mund nehmend: „Siiie! Ham Siiie eine Ahnung! Meinen Sie, ich kann von einer einzigen Leiche im Monat leben?“ Mit der langen Pfeife herumfuchtelnd, unterstrich Joseph die Bedeutung seiner Worte.
Pfeiffer stutzte, dann brüllte er ein gellendes Lachen heraus und ging schnurstracks weiter. Dabei schüttelte er seinen weißhaarigen Kopf. Er lachte noch, als er schon drüben in den Wald hineinging.
Joseph war aus dem Loch geklettert und sah dem Lehrer erbost nach. Trottel der! Lacht, wo es sich um so eine ernste Angelegenheit handelt. Der denkt wohl wirklich, ich kann von dem bisschen Glockengeläut und den paar Hochzeiten und Taufen existieren, wo die Leute hier alle so alt werden. Der ist auch schon zweiundachtzig.
Zweiundachtzig! Da heißt es immer, im Frühjahr sterben viele Leute. Gar nichts. Die Piepenbacher sind zähe.
Er zog seine Jacke über, rückte die Nickelbrille zurecht, schulterte Spaten und Spitzhacke und lief los. Auch jetzt baumelte seine Pfeife vom Munde herab. Auf der Straße schlug sich Joseph die Lehmpatzen von den Gummistiefeln. Er wollte noch in den Konsum, und um achtzehn Uhr musste er Feierabend läuten.
Wie er so die Dorfstraße hinunterging, sah er, dass der Gemeindebote Karl von Haus zu Haus lief. Joseph spuckte wütend in den Straßengraben; denn er wusste: Geht Karl in die Häuser, hat er Einladungen in der Tasche.
Im Konsum fragte Joseph: „Gibt’s Stumpen?“
„Nein.“
„Käse?“
„Heute nicht.“
„Quark?“
„Morgen, Joseph, morgen früh.“
„So!“ Er nahm die Pfeife aus dem Mund und fuhr mit dem Handrücken über die feuchten Lippen.
„Apfelsinen haben wir, Seph“, sagte die Verkäuferin freundlich.
Joseph winkte ab. Er dachte: Apfelsinen! Solche Malariakugeln. Die sollen mir damit gestohlen bleiben. Hab’ ich in meinem Leben schon mal eine Apfelsine gegessen? Aber im Konsum gibt es ja nie was. Keine Stumpen, keinen Käse, keinen Quark. Bin bloß gespannt, wie das so weitergehen wird. Da soll man auch noch politisch werden, wie es in der Zeitung steht. So lange es keine Stumpen gibt, bleibe ich unpolitisch.
Er stieg die vierundsiebzig Stufen des Kirchturmes hinauf und begann zu läuten.
Joseph war ein sehr frommer Mensch. Oben im Kirchturm hielt er Einkehr. Und die mittlere Glocke, die er jeden Mittag, jeden Abend zu läuten hatte, brummte: Bet schön – bet schön. –
Als Joseph fertig war, zündete er sich wieder eine Pfeife an, lehnte sich zum Turmfenster hinaus und blickte auf Piepenbach hinab. Einige Dohlen flogen zu den Luken herein und flatterten auf den Glockenstuhl. Von hier sah Joseph natürlich auch sein Strohdachhäuschen, und er entdeckte Bruno Blumenroth, der im Garten Beete umgrub. Das macht sich gut, dachte Joseph, da kann ich gleich noch mit ihm reden. Eilig stieg er vom Turm. Unten auf dem Friedhof traf er die alte Müllern, die ihm wichtigtuerisch zuflüsterte: „Denk nur, Seph, die Pfalz-Meta liegt im Sterben!“
„Du meine Güte!“ Joseph seufzte. „Wen’s aber heutzutage auch alles erwischt!“ Meta Pfalz war einundneunzig Jahre alt.
Als er den Kirchberg hinunterging, dachte er an die Meta und an den Pfeifferlehrer.
Im Garten traf er Bruno. Er sagte hastig: „Keine Stumpen, keinen Käse, keinen Quark gibt es im Konsum!“ Und schon huschte er durch die Hintertür, so dass Bruno Blumenroth keine Möglichkeit hatte, ihm zu antworten. Das ging fast jeden Abend so. Blumenroths wussten das. Sie wussten auch, weshalb Joseph gerade zu ihnen kam. Bruno war im Gemeinderat. Und Frau Blumenroth kassierte die Deutsch-Sowjetischen-Freundschafts-Beiträge im Dorf. Sie waren also „Politische“. Zudem hielten Blumenroths nichts vom Jenseits, weil sie zu denen gehörten, die zunächst einmal das Diesseits verschönen wollten. Streit gab es deshalb kaum. Blumenroths ließen sich von Josephs Mucken nicht beeindrucken.
Sie nahmen ihn, wie er war. Und oft saß Bruno bei Joseph und Joseph bei Bruno in der Stube.
Kam Joseph nun abends nach Hause und sagte nichts, dann wussten Blumenroths sofort: Aha, heut gibt es alles im Konsum.
Im Gewölbe zog der Totengräber seine Gummistiefel aus und lief auf Strümpfen über den Ziegelgrund in die Stube. Er wusch sich, dann setzte er Wasser auf den Herd, putzte Messer und Löffel, spülte Tassen und Teller, fegte die Stube. Als er beim Einquirlen seiner Suppe war, klopfte es.
In der Tür stand der Gemeindebote Karl.
„Guten Tag!“
„Tag!“ Joseph quirlte weiter und guckte in den Topf. Er wusste, wer vorn an der Tür stand – ohne hingesehen zu haben, versteht sich. „Und?“
Karl machte die Aktentasche auf – sie hatte so einen langen Riemen, den man über die Schulter hängen kann – und brachte eine Liste zum Vorschein.
„Die Sache ist so, Seph, wir brauchen Leute, viel Leute, weißt du.“
„Ihr braucht immer Leute, viel Leute!“ Joseph ließ den Quirl los und stellte sich breitbeinig auf die Diele.
„Ja“, sagte Karl, er kannte Joseph sehr genau. „Das ist nämlich so, zugegeben, wir wollen Gäblers Scheune runterreißen. Die ist doch so verfallen, weißt du. Und dann wollen wir ein neues Spritzenhaus dort bauen. Ein Spritzenhaus für die Feuerwehr im Dorf, zugegeben. Wir brauchen ja, zugegeben, ein neues Spritzenhaus im Dorf!“
„Und ob“, sagte Joseph, „das brauchen wir.“
„Siehst du“, meinte Karl und hielt die Liste wie einen Steuerbescheid in der Hand. „Hier auf dem Papier sollen sich nun die eintragen, die da mitmachen, Seph!“
„Ohne Bezahlung?“
„Ohne, Seph, freiwillig!“
„Rheuma!“, bemerkte Joseph und stemmte die eine Hand in die Hüfte.
„Aha“, sagte Karl. Auch das kannte er, aber er tat so, als sei es ihm ganz neu. „Wenn du hier am Spritzenhaus nicht willst, Seph, wie wär’ es dann mit der neuen Wartehalle für den Bus?“
„Ohne Bezahlung?“
„Ohne!“
Joseph schüttelte den Kopf und legte die andere Hand ebenfalls in die Hüfte.
„Wir wollen auch noch oben auf dem alten Schweinemarkt Grünanlagen schaffen, zugegeben, Grünanlagen zum Schönaussehen, machst da mit?“
„Ohne?“
„Ohne!“
„Gras wächst von alleine, Karl. Übrigens, ihr habt ja Auswahl – mehr als im Konsum! – Macht der Klempner mit?“
„Nein!“
„Der Herr Pfarrer?“
„Nein!“
„Der Herr Kantor?“
„Auch nicht!“
„Genügt!“
„Viele andere machen schon mit, und ich war erst im halben Dorf“, sagte Karl.
„Da reicht’s ja, Karle!“ Joseph schubste die Töpfe auf dem Herd zurecht. „Ja, ja, Karle, ich hab’ auch furchtbares Rheuma, schrecklich!“
„Blumenroths machen mit! Der Bruno und die Evi!“, sagte Karl.
„Das gehört sich von selbst!“, meinte Joseph und hob eine Stürze vom Topf. Brodem stieg an die Decke, dampfte in die kleine Stube und verhüllte die zwei.
„Und der Pietsch Karl, der aus dem Niederdorf, der drin in der Autofabrik Schlosser ist, der hat sich mit der Frau hier eingeschrieben und macht mit!“, meinte Karl und tippte mit dem Finger auf die Liste.
Joseph warf eine Handvoll Salz in den Topf und wusste sofort: Das war zu viel! Wegen dem habe ich mir jetzt die Suppe verdorben.
„Und die LPG-Bauern stellen die Fahrzeuge zur Verfügung, am Abend, versteht sich, also nach der Feldarbeit, Seph!“
„Depp, denkst, sie könnten sie am Tage hergeben, wo sie die selber brauchen? – Na, und macht nicht der Steinbergbauer auch mit?“
„Der auch, Joseph!“
„Möcht auch sein, der trägt doch immer die Fahne, wenn ein Feiertag ist!“, meinte Joseph.
Karl überhörte die Stichelei und sagte: „Sogar der Pichler-Lehrer kommt sonnabends mit der achten Klasse und macht mit!“
„Pappapp“, machte Joseph, „Parteimensch, möchte sein! Keine Kunst!“ Joseph kicherte.
„Und der Gräber Eduard, der in der Seifenfabrik ist, der Flake Emil aus der 91 und die …“
„Hör auf, Karl! Wozu drangsalierst mich noch, wenn ihr so einen Haufen Begeisterter habt, hä?“
Karl meinte: „Wenn der Pfarrer mitmachen täte, wärst auch dabei, was?“
„Natürlich!“, sagte Joseph, und das klang geradezu herausfordernd.
Als Karl über den Ziegelflur ging, um mit Bruno über Joseph zu sprechen, brummelte er: „Wie so ein Hammel ist der. Stur läuft er hinter seinem Leitmähmäh her!“
Joseph war zufrieden. Dass der Klempner nicht mitmacht, ist mir ganz verständlich, dachte er. Der kriegt immer so schwer Blech von diesem Staat. Wie’s im Leben halt ist: Dem einen fehlen die Bleche, dem anderen die Leichen. Es hat eben jeder seinen Ärger.
Drüben bei Blumenroths lachte Evi laut auf. „Dummes Ding!“, knurrte Joseph.
ZWEITES KAPITEL
Eigene Weissagung und Deutung und Träume sind nichts und machen doch einen schweren Gedanken, und wo es nicht kommt durch Eingebung des Höchsten, so halte nichts davon.
SIRACH 34, 5/6
Saß Joseph abends allein in seiner Stube, dann las er meist in der Bibel. Der Wind heulte im Schornstein, ein Birnbaumast schabte drohend an der blechernen Dachrinne. Oft sprang auch noch die schwarze Katze von der Ofenbank oder vom Fenstersims und schlich leise über die Dielen. Joseph fühlte dann, dass nur Gottes Wort ihn vor den Mächten der Finsternis schützen konnte.
So war es auch an diesem Abend.
Joseph feuchtete die Fingerspitzen an und schlug die Bibel auf. Er kannte sie gut. Sie war das einzige Buch, das er je gelesen hatte. Dafür hatte er aber eine ganze Reihe Kalender studiert, alte Kalender, mit wundersamen Geschichten, und zwar katholische wie evangelische; Joseph setzte sich hierbei über alle Unterschiede im Glauben hinweg. Die katholischen Geschichten, die über Heilige und Wunder berichteten, imponierten ihm sogar mehr als die evangelischen. Übrigens muss noch erwähnt werden, dass Joseph selber schriftstellerisch tätig war. Er stand mit der „Wochenpost“ in Verbindung und war dort korrespondierendes Mitglied. Oft schrieb er Artikel für die Leserbriefseite, in denen er mitteilte, dass es im Konsum wieder einmal keine Stumpen gegeben hatte. –
Nun las er also in der Bibel. Am liebsten studierte er jene Stellen, in denen von den Wundern des Herrn die Rede war. Zu jener Zeit hatte es genügt, wenn Kranke den Saum von Jesu Kleid berührten, und schon waren Blinde sehend, Verrückte normal und Tote lebendig geworden. An solchen Geschichten konnte sich Joseph gar nicht satt lesen. Da hörte er nicht mehr das Schaben des Birnbaumastes an der Dachrinne. Besonders beeindruckte ihn, dass der Herr manchmal unter seinen Jüngern gesessen hatte, und die ihn nicht sehen konnten. Gerade jetzt hatte er wieder so eine Stelle gefunden. Joseph schaute sich in der Stube um. Vielleicht ist er jetzt bei mir! dachte er. Er blickte hinüber zum Glasschrank, aber da sah er nur sich selbst, die Ellenbogen aufgestützt, die Fäuste unterm Kinn, die Pfeife im Mund und die Nickelbrille auf der Nase. Vor ihm lag die Hausbibel, aufgeschlagen und dick. Den Herrn konnte er im Glasschrank nicht entdecken. Nur die hohen Tassen mit den Silberrändern und Jahreszahlen und Abziehbildern Kaiser Wilhelms standen dort.
Die Katze miaute. Sie wollte raus und blinzelte zur Türklinke hoch. Und auch Joseph litt es nicht mehr in der Stube, weil eben der Herr doch nicht da war. Er zog seine Jacke über, setzte die Mütze auf und ging.
Draußen schien der Mond, gelb und rund. Und viele Sterne standen am Himmel. Joseph guckte in die Pieper. Dort spiegelte sich der Himmel. Gelb und verschroben war der Mond. Er wackelte und zitterte, und es sah aus, als bade er. Drüben auf dem Friedhof heulte ein Käuzchen. Die Turmuhr schlug.
Joseph stieg feierlich den Kirchberg hoch. Er wollte einen Rundgang über den Friedhof machen. Unter seinen Füßen knirschte der Kies. Vor den Toten fürchtete er sich nicht. Er kannte sie ja fast alle persönlich.
Trotzdem erschrak er ganz schön, als er sah, wie zwei Leute über die Friedhofsmauer kletterten und nach draußen sprangen. Joseph erschrak, weil er sofort wusste: In diesem Augenblick sind zwei gestorben. Es war eine alte Weisheit. So viele, wie in der Nacht über die Friedhofsmauer nach draußen springen, so viele sterben in der gleichen Nacht.
Joseph dachte an die Pfalz-Meta und wünschte ihr einen guten Heimgang in die Regionen des Herrn.
Er schritt, den Mond im Rücken, durch die Grabreihen, und das weiße Licht fiel auf die Marmorsteine, Holzkreuze und Eisenzäune. Ich werde sie hinten bei der Weide hinpacken. Das ist ein schönes Plätzchen für die Meta.
Hinter der Friedhofsmauer kicherte es. Ja, ja, die Jugend von heute, nicht einmal Achtung vor den Toten hat sie, dachte Joseph.
Er ging hinüber zur Dorfstraße. Hier traf er Frau Fischer, die immer Neuigkeiten zu erzählen wusste. „Die Meta ist tot, denk nur, die Meta!“