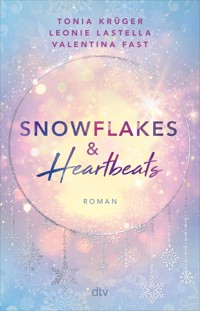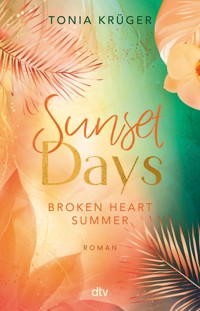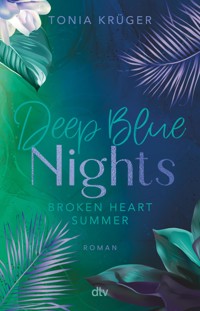
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Broken-Heart-Summer-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte über alte Gefühle und neue Anfänge Found Family, Secret Crush & Unrequited Love – Band 2 der ›Broken Heart Summer‹-Reihe! Ein Jahr ist vergangen, seit Rea sich entschieden hat, auf Hawaii – und bei Cam – zu bleiben. Eine Zeit intensiver Gefühle, mit romantischen Abenden am Strand, aber auch leisem Zweifel. Passen sie und Cam wirklich zusammen? Genügt es ihr, immer nur in den Tag hineinzuleben, wo sie doch so zielstrebig auf ihr Studium hingearbeitet hat? Dann steht plötzlich Maya vor ihr. Alles ist wieder da: die Freundschaft, die sie verbindet, ebenso wie die Liebe, die sie trennt. Aber vielleicht ist Maya genau die Freundin, die Rea jetzt braucht, um eine Entscheidung zu treffen: für ihre Liebe zu Cam oder ihr berufliches Weiterkommen … - Liebe oder Karriere, Freundschaft oder Partnerschaft? Tonia Krüger erzählt tiefgründig und mitreißend, wie Rea und Maya ihren Weg gehen. - Emotionen pur: verletzte Gefühle, tiefgreifende EntscheidungenAlle Bände der ›Broken Heart Summer‹-Reihe: Band 1: Sunset Days Band 2: Deep Blue Nights Die Bände sind nicht unabhängig voneinander lesbar. Von Tonia Krüger außerdem erschienen bei dtv: ›Love Songs in London‹-Reihe & Kisses in the Snow
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 555
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Wenn dein Herz etwas ganz anderes will als dein Verstand – worauf wirst du hören?
Rea hat das Gefühl, mit Cam ihr Glück gefunden zu haben. Doch nach einem Jahr fragt sie sich immer häufiger, ob ihr neues entspanntes Inselleben auf Kauai wirklich das ist, was sie will – vor allem, als sie Zane kennenlernt. Er arbeitet hart für sein Studium, ist zielstrebig und zeigt eindeutig Interesse an ihr. Rea stellt ihr Leben – und ihre Liebe – mehr und mehr infrage. Würde Zane nicht viel besser zu ihr passen als Cam, der bloß in den Tag hineinlebt? Wie viel kann sie für ihre große Liebe aufgeben, ohne sich selbst zu verlieren?
Als endlich das lang ersehnte Wiedersehen mit ihrer besten Freundin Maya bevorsteht, hofft Rea, dass Maya ihr in ihrem Gefühlschaos beistehen wird. Doch als Maya auftaucht, ist alles anders als erwartet …
Der fesselnde Abschluss der gefühlvollen »Broken Heart Summer«-Reihe
Von Tonia Krüger sind bei dtv außerdem lieferbar:
Love Songs in London – All I (don’t) want for Christmas (Band 1)
Love Songs in London – Here comes my Sun (Band 2)
Love Songs in London – Dancing on Sunshine (Band 3)
Love Songs in London – It’s raining Love (Band 4)
Kisses in the Snow (zusammen mit Leonie Lastella und Valentina Fast)
Broken Heart Summer – Sunset Days (Band 1)
Tonia Krüger
Broken Heart Summer
Deep Blue Nights
Band 2
Roman
Rea
Ke‘e Beach, Kaua‘i
Die Sandkörner tanzen. Die Wellen lassen sie aufsteigen, sich umeinanderdrehen und wieder hinabsinken – nur um sie im nächsten Moment neu aufzuwirbeln. Sonnenlicht fällt durchs glasklare Wasser, der Untergrund schimmert wie Elfenbein. Ich lasse mich treiben, beobachte einfach nur, liebe die Ruhe.
Und dann gerät Cam in mein Blickfeld. Nach ein paar Flossenschlägen ist er bei mir und umfängt meine Taille. Wir tauchen auf, nehmen die Masken ab. Sonne glitzert in den Tropfen auf unserer Haut, in unseren Haaren.
»Hast du die Schildkröten gesehen?« Cam deutet zum Riff. »Zwei Stück. Die eine so groß.« Mit den Händen zeigt er eine Länge von mindestens anderthalb Metern an. »Die muss uralt sein.«
Ich liebe die Begeisterung in seinen blitzenden Augen, sein Lächeln und dass er hier ist – bei mir. Denn ich weiß, dass er das nur für mich tut. Ginge es nach ihm, wäre er garantiert jenseits des Riffes beim Surfen. Aber da das nach wie vor nichts für mich ist, geht er eben mit mir schnorcheln.
»Ja, ich habe sie eine ganze Weile beobachtet«, erwidere ich. »Bis sie mich angestarrt hat, als würde ich sie extrem nerven. Da bin ich lieber auf Abstand gegangen.«
Cam lacht leise. »Rücksichtsvoll wie immer.«
Ich spüre seine Hände wieder an meiner Taille. Ich liebe es, wie er meinen Körper umfasst, wie selbstverständlich und schön sich das anfühlt. Ich liebe, dass es ein wie immer zwischen uns gibt. Dass wir uns mittlerweile seit fast einem Jahr kennen und einander vertraut geworden sind.
Cam zieht mich dichter zu sich, bis aus der Berührung seiner Hände eine Ganzkörperberührung wird. Dann sind seine Lippen auf meinen. Und mir stockt der Atem. Weil sich das wahrscheinlich nie selbstverständlich anfühlen wird. Von Cam geküsst zu werden beschleunigt alles in mir von null auf hundert in unter einer Sekunde – treibt mir den Puls in die Höhe, lässt mein Blut rauschen, Sterne in meinem Bauch funkeln. Ich, Rea, die immer nur gearbeitet hat, die immer nur Schulden und Karriere im Kopf hatte, die Angst vorm Meer hatte, immer nur gedacht und nie gefühlt hat. Die jetzt aber auf einer Insel im Pazifik lebt, sich den Nachmittag freinimmt, um mit Cam und seiner Familie Zeit am Strand zu verbringen. Die im Meer schwimmt – mitten in dieser glitzernden, türkisfarbenen Lagune voller tropisch bunter Meereslebewesen – und von ihrem unfassbar gut aussehenden, überwältigenden Freund geküsst wird.
Ich schlinge meine Beine um seine Hüfte. Im ersten Moment habe ich nur Salz geschmeckt, aber dann schmecke ich auch Cam – seine leichte Süße, die herbe Note, nach der ich süchtig bin, und die Erregung, die seine Lippen auf meinen, das Reiben seiner Zunge und ganz besonders sein Drängen sofort in mir wecken. Ich ringe nach Atem und dann lässt Cam uns einfach untergehen.
Das Meer rauscht und gluckert um uns herum, während wir ganz tief in das helle Blau sinken. Auf der Oberfläche schimmert glänzend das Sonnenlicht. Unter uns erstrecken sich die bunten ineinander verschlungenen Korallen. Scharen von Fischen stieben auseinander, als ich mich an Cams Nacken festhalte. Er presst sich an mich. Unterwasserküsse. Die gehören definitiv zu den Dingen, die schöner aussehen, als sie sich anfühlen, und die trotzdem perfekt sind. Weil ich mich nie in meinem Leben so gesehen habe. Weil ich nie damit gerechnet habe, dass Kaua‘i, Schwimmen im Meer und Küsse mit Cam mal Teil meines Lebens sein könnten.
Wir drehen uns einmal um unsere Achse. Und die glitzernden Sonnenstrahlen, bunten Korallen und umherschwirrenden gelben Doktorfische drehen sich mit. Mir wird schwindelig – weil mein Gehirn überfordert ist, aber auch, weil ich so glücklich bin.
Wir treiben langsam wieder nach oben, durchbrechen die Oberfläche. Ohne Cam loszulassen, wische ich mir die Nässe aus den Augen und streiche meine Haare zurück. Der Ke‘e Beach im Norden von Kaua‘i ist jetzt im Sommer mein Lieblingsstrand. Dunkler Regenwald, heller Sand, türkisfarbene Lagune und juwelenblaues Meer weiter draußen. Cam und ich schweben im Wasser, als wären wir Teil dieser Welt.
»Perfekter Tag, oder?«, fragt Cam mich leise. »Perfekter Moment.«
»Ja«, antworte ich nur. Das Ende vom fucking Regenbogen gibt es gar nicht, hat Maya letztes Jahr gesagt. Aber ich spüre deutlich, dass ich ihm gerade ganz nah bin.
Der Gedanke an Maya lässt mich innerlich zusammenzucken. Vor fast einem Jahr haben wir uns am Flughafen in Honolulu voneinander verabschiedet. In wenigen Tagen wollen wir uns wiedersehen, aber bisher habe ich nichts von ihr gehört. Ich weiß nicht, ob sie wirklich kommt, ob sie unseren Happiness-Check durchziehen will.
»Woran denkst du?«, unterbricht Cam mein Schweigen.
»An Maya.«
»Hat sie sich noch nicht gemeldet?«
Ich schüttle nur den Kopf, halte mich an Cam fest und genieße den Kontrast zwischen seiner Körperwärme und dem kühlen Wasser.
»Ruf sie doch an.«
»Sie wollte diese Auszeit«, erinnere ich ihn. »Irgendwie fühlt es sich nicht richtig an, diejenige zu sein, die sie beendet.«
»Sie meldet sich bestimmt. Ihr wart wie Schwestern. So viel wird sich nach einem Jahr nicht verändert haben.«
»Bei mir hat sich mein ganzes Leben geändert«, sage ich leise.
Er löst sich von mir, um mich forschend anzusehen. »Zum Guten, hoffe ich?«
Die Besorgnis in seinen dunklen Augen bringt mich zum Schmunzeln. Wie kann er irgendwas anderes glauben? Mit beiden Händen umfasse ich sein Gesicht und küsse ihn. »Zum Besten«, flüstere ich mit meinen Lippen an seinen und verdränge die Fragezeichen in meinem Kopf.
Denn Maya … Es ist mir so unfassbar schwergefallen, mich an ein Leben ohne sie zu gewöhnen. Habe ich mich überhaupt daran gewöhnt? Oder nur daran, weniger überrascht zu sein, dass sie nicht mehr da ist, dass ich keine Nachrichten mehr auf meinem Handy von ihr habe, sie nicht nachhakt, wie es mir geht, mir von verrückten Erlebnissen erzählt, mich mit absurden Ideen zum Lachen bringt? Klar, ich habe ein neues Leben. Ich habe manchmal sogar selbst verrückte Erlebnisse – mehr als früher jedenfalls, als ich von morgens bis abends in der Bibliothek und im Labor hockte. Aber Maya … Sie fehlt mir einfach. Und ich weiß schon jetzt, dass sie sich mit keiner oberflächlichen Antwort abspeisen lassen wird, wenn sie mich fragt, ob das Leben, das ich gerade führe, genau das Leben ist, das ich will. Falls sie mich fragt … Womöglich ist es ihr ja viel leichter gefallen, mich aus ihrem Leben zu streichen.
»Niemand bewacht die Picknickkörbe«, bemerkt Cam in diesem Moment. »Wollen wir was essen, bevor die Monster uns das Beste wegfuttern?«
Ich sehe mich zum Strand um, an dem Familien und Paare sitzen. Viele sind bereits im Aufbruch begriffen, denn bald wird die Sonne untergehen. Weiter draußen hinterm Riff sind noch einige Surfer unterwegs, die den für die Sommermonate gar nicht so schlechten Swell ausnutzen. Darunter Cams Geschwister Debora und Braydon. Braydons Frau Jill beaufsichtigt ihre Kinder, die in Ufernähe im Wasser spielen. Die beiden hat Cam mit Monstern gemeint. Und tatsächlich haben insbesondere Luna und Leo mir im vergangenen Jahr so etwas wie Futterneid beigebracht.
Also folge ich Cam ans Ufer und dann zu den Picknickdecken und Kühltaschen, die wir im Schatten unter den Bäumen zurückgelassen haben. Ich schüttle mir das Wasser aus den Haaren und lasse mich dann auf mein Handtuch fallen. Cam reicht mir als Erstes eine Handvoll Datteln – sein Geheimtipp zum Neutralisieren des intensiven Meersalzgeschmackes. Während ich die schwere Süße der Frucht genieße, wühlt sich Cam durch die Kühltruhe und zählt Sandwiches auf, die zur Auswahl stehen.
»Oh, hier ist eins mit Honigschinken, Provolone und Braydons Gewürzöl«, bemerkt Cam und hält es hoch.
»Das nehme ich!«
Das Blitzen seiner dunklen Augen trifft mich bis ins Herz. »Das werde ich aber nicht kampflos aufgeben.«
Grinsend richte ich mich auf, küsse Cam, lasse meine Zunge mit seiner spielen, bis ich spüre, wie er in diesen Kuss hineinschmilzt. Dann winde ich ihm das Sandwich aus der Hand.
»Dieser Kampf war keine wirkliche Herausforderung«, stelle ich fest, will schon in meine Beute beißen und lache, als Cam sich unerwartet auf mich wirft und ich rückwärts in den Sand falle.
Ich rechne mit einer Kitzelattacke, damit, dass Cam sein Sandwich zurückfordert. Stattdessen sind da wieder seine Lippen auf meinen. Ganz unwillkürlich schlingen sich meine Arme um seine Taille, ganz tief nehme ich das Kribbeln in mir wahr, das Beben, das von meinem Körper auf seinen übergeht, als er seine Finger in meine nassen, sandigen Haare flicht. Dann verharrt er über mir. Heiß trifft sein Atem mein Gesicht. Seine Augen sind fast schwarz. Und ich wünschte, wir wären allein. Nur er und ich. So müsste das Leben immer sein, habe ich letztes Jahr gedacht. Es müsste immer Sommer sein. Und mit Cam ist es das.
»Oh fuck!«, flüstert er mit seinen Lippen an meinen. »Warum muss dieser Strand so überfüllt sein?« Er lässt sich neben mich auf den Rücken rollen und ich muss lachen. Weil der Strand alles andere als überfüllt ist, ich aber genau weiß, was er meint: dass gerade jeder Mensch abgesehen von uns beiden zu viel ist. Atemlos blicken wir durch das dunkle Grün der Baumwipfel in den blauen Himmel über uns.
»Hier.« Diplomatisch teile ich mein Sandwich mit ihm und richte mich erst halb auf, als ich den Nachrichtenton meines Smartphones höre. Ich finde es nach einigem Suchen in einem der Körbe. Meine Mom. Mein Herz zieht sich zusammen, als ich ihre Nachricht lese: Hey, mein Schatz. Was machst du gerade? Ich vermisse dich.Das Schlimme ist, dass diese Nachrichten von meiner Mom häufiger werden. Fast täglich sagt sie mir, wie sehr ich ihr fehle. Und ich … Natürlich würde ich sie gerne öfter sehen und all meine Erlebnisse mit ihr teilen. Aber mir fällt es mit jedem Mal schwerer, ihr Fotos von den Traumstränden zu schicken, an denen ich meine Nachmittage verbringe, während ich weiß, dass sie nach ihrer Arbeit in der Schule zu ihrem Zweitjob aufbricht, statt es sich auf dem Sofa gemütlich zu machen. Ich wünschte, sie würde sich endlich mal wieder Zeit nehmen, um zum Sport zu gehen. Oder ins Kino. Freundinnen zu finden, statt immer nur mir nachzutrauern.
»Was ist los?« Cam richtet sich ebenfalls auf und sieht mich fragend an.
»Meine Mom.« Seufzend werfe ich mein Handy zurück in den Korb. »Sie vermisst mich.«
»Tut mir leid, dass ihr euch so selten sehen könnt.«
Das ist eine Untertreibung. Seit fast einem Jahr haben meine Mom und ich uns nicht getroffen. Doch das ist nicht Cams Schuld, auch wenn er gerade genauso wirkt.
Ehe ich ihm das allerdings sagen kann, fällt seine Familie über uns her – seine laute, wunderbare, verrückte Familie.
»Hey!« Debora wirft sich neben mich in den Sand. »Sag mir nicht, dass ihr Braydons Gewürzöl-Sandwiches gefuttert habt.«
Luna und Leo haben sich bereits auf die Kühltasche gestürzt. Sie sind fünf und sieben, beide dickköpfig und immer kampfbereit. Braydon und Jill versorgen sie rasch mit Essen, bevor die ersten Sandwiches in den Sand geschleudert werden können.
»Und? Wie sind die Wellen?«, will Cam von seiner Schwester wissen.
»Für einen Sommertag in Ke‘e nicht schlecht«, meint sie. »Klein, aber lang.«
»Onkel Cam, gehst du gleich mit mir surfen?« Leo hält ein diplomatisch in der Mitte geteiltes Frischkäse-Gurken-Brot in der Hand und sieht Cam hoffnungsvoll an.
»Warum wolltest du gerade nicht mit mir surfen?«, fragt Debora empört.
Leo schneidet eine Grimasse in ihre Richtung. »Mit Onkel Cam ist es lustiger. Der kennt alle Tricks.«
Debora ist sich nicht zu schade, Leo die Zunge rauszustrecken.
»Ich will auch mit Onkel Cam surfen«, verlangt Luna.
»Aber nacheinander«, bestimmt Braydon. »Erst Leo und dann Luna. Solange kann ich mit dir Beachball spielen, Luna.«
»Du bist gemein.« Luna beißt sichtlich schlecht gelaunt in ihr Sandwich.
»Ach, und ich dachte, ich wäre besonders opferbereit.« Braydon grinst in die Runde. »Luna mit einem Schläger auszustatten ist quasi selbstmörderisch. Das hat sie von ihrer Tante.«
»Das stimmt gar nicht«, protestiert Debora sofort.
»Doch, klar«, hält Cam dagegen. »Ich musste mit drei Stichen genäht werden, weil du mir deinen Tischtennisschläger auf den Kopf gehauen hast, nachdem ich gewonnen hatte. Hier.« Grinsend deutet er auf eine kaum sichtbare Linie unter seinem Haaransatz.
»Da waren wir Kinder«, verteidigt Debora sich.
»Dass Jay wochenlang mit einem blauen Auge rumgelaufen ist, weil du ihn beim Minigolf erwischt hast, ist nicht so lange her«, beharrt Cam.
»Das war keine Absicht«, ruft Debora und deutet auf Cam. »Da wollte ich dich treffen, weil du meine ganze Tüte Sour Patches vertilgt hast.«
»Ha!« Braydon lacht auf. »Das hätte ich niemals gewagt.«
»Jay hat heute noch Angst vor ihr.«
»Ich wollte ihn wirklich nicht treffen.« Debora wirkt jetzt ehrlich zerknirscht. Sie wirft ihre langen dunklen Haare über die Schulter und öffnet eine Flasche Wasser. Beim Trinken laufen ihr ein paar Tropfen übers Kinn, aber sie wischt sie ungerührt weg. Dann beißt sie in ihr Sandwich und rückt näher zu mir.
»Die Jungs sind immer so dramatisch«, meint sie. »Dabei waren wir Kinder, als die Golfballgeschichte passierte. Also … zumindest waren wir jünger.«
Ich hebe die Augenbrauen. »Wie viel jünger?«
»So anderthalb Jahre …?« Sie klingt kleinlaut und ich lache ungläubig auf.
»Kein Wunder, dass Jay Angst vor dir hat.«
»Er stand superungünstig«, verteidigt Debora sich und beißt nachdenklich in ihr Baguette. Dann lehnt sie sich mit einem Seufzen gegen meine Schulter. »Womöglich sollte ich ihm noch mal sagen, dass es mir leidtut, wenn es ihm so nachhängt.«
Ich lege ihr einen Arm um die Schultern. »Ach, ich glaube, Cam ärgert dich nur.«
Debora schießt ihrem Bruder einen Blick zu, der lachend sein Sandwich gegen Leo und Luna verteidigt. »Zuzutrauen ist es ihm.«
Schmunzelnd sichere ich mir einen von Jills selbst gebackenen Cookies zum Nachtisch. Nach einem Jahr in Cams Familie fühlt sich Debora wie meine Freundin an. Wir gucken Serien zusammen, gehen ins Kino, treffen uns in der Stadt zu Milchshakes und Malasadas und manchmal überredet Debora mich, dass sie mir die Nägel lackieren darf. Spätestens am nächsten Tag rückt sie mir dann jedes Mal mit Acetonlösung zu Leibe, weil alles schon wieder abblättert, aber trotzdem fühlt sich das ein bisschen nach all dem an, was ich mit Maya verloren habe. Ein bisschen. Nicht so vertraut. Nicht so tief. Nicht so selbstverständlich. Aber ein bisschen.
»Gehen wir jetzt surfen, Onkel Cam?«, fragt Leo lauthals.
»Bin dabei.« Cam greift nach seinem Surfbrett, das er mit der Nase zuerst nur wenige Meter von uns entfernt in den Sand gesteckt hat.
»Leo!« Jill erhebt sich ebenfalls. »Du tust da draußen exakt, was Cam dir sagt, verstanden?«
»Ja, Mom.« Leo verdreht die Augen, als sei es meilenweit unter seiner Würde, Sicherheitsanweisungen entgegenzunehmen.
»Kommst du auch mit?« Cam streicht mir mit einer Hand über den Rücken und ich sehe zu ihm auf. Ich liebe es, wenn das Sonnenlicht in diesem speziellen Winkel in seine Augen fällt, sodass es das helle Braun seiner Iris goldfarben blitzen lässt. Überhaupt liebe ich ihn genau so, wie er gerade ist – mit seinen dunklen Haaren von Wind, Wasser und Salz zerzaust, mit Sand an seinen bloßen Füßen und diesem übermütigen Lächeln.
»Klar.«
»Lass das Fish ruhig hier«, ruft Cam Leo nach, als er zu seinem Brett laufen will, das neben Lunas Bodyboard im Schatten unter den Bäumen liegt. »Wir probieren ein Tandem.«
Begeistert rast Leo Richtung Ufer – gefolgt von Jill, die ihm befiehlt, auf Cam zu warten.
»Spielen wir jetzt Beachball, Daddy?«, will Luna wissen.
»Na, sicher. Gleich.« Braydon lässt sich nach hinten auf sein Handtuch sinken. »Gib mir fünf Minuten für ein Verdauungsschläfchen, okay?«
Luna sieht nicht begeistert aus. Bedrohlich wirbelt sie den Schläger in der Hand. Schließlich kennen wir alle die Nickerchen von ihrem Dad. Braydon arbeitet als Rettungsassistent und hat einen anstrengenden Nachtdienst hinter sich. Mich würde wundern, wenn es bei den fünf Minuten bleibt. Wahrscheinlich muss Debora gleich als Spielpartnerin einspringen.
Wenig später stehen Jill und ich am äußeren Rand der Landzunge, von der die Lagune eingefasst ist. Ich genieße es, dass die Regenwaldbäume bereits ihren Schatten auf uns werfen. Weiter draußen lässt die Sonne das Meer glitzern. Cam pflügt kraftvoll durch die über dem Riff auslaufenden Wellen, während Leo auf seinem Rücken liegt und sich wie ein Äffchen mit beiden Armen an seinen Schultern festklammert.
»Spätestens daran merke ich immer, dass ich nicht in Hawai‘i geboren und aufgewachsen bin«, bemerkt Jill. »Zwischen Fahrrad fahren und surfen lernen besteht hier einfach kein Unterschied.«
Um durch die Brandung zu gelangen, stützt Cam sich auf seinem Bord hoch, als fühle er Leos zusätzliches Gewicht auf seinem Rücken gar nicht. Hinter der Brechungslinie bleibt er kurz auf dem Surfbrett liegen, dann paddelt er auch schon an. Er stimmt seine Geschwindigkeit auf die der heranrollenden Welle ab. Sein Board gleitet Richtung Tal und Cam kommt auf die Füße. Leo hält sich weiter mit beiden Armen um seinen Hals fest. Er hüpft auf Cams Rücken auf und ab, während Cam mit schnellen pumpenden Bewegungen Tempo aufnimmt.
»Wow! Das meinte Leo wohl mit Tricks.« Jill lacht leise, als Cam Leos Hände packt, ihn von seinem Rücken zieht und neben sich auf sein Surfboard stellt. Mit einem Arm um seinen Oberkörper hält er ihn fest.
Leo passt sich seinen Bewegungen an, geht jeden Schwung mit.
»Rea?« Debora kommt durch den Sand auf uns zugelaufen und bringt mir mein Handy. »Du hattest einen Anruf.«
Maya! Ihr Name schießt mir schlagartig durch den Kopf. Hat sie endlich angerufen? Ich reiße Debora fast mein Telefon aus der Hand, aber statt Mayas Namen leuchtet mir der von meinem Chef entgegen.
»Danke«, murmle ich in Deboras Richtung. »Da muss ich kurz zurückrufen.«
»Ha!«, kommentiert Debora den Tandem-Wellenritt von Cam und Leo, während ich mich schon von Jill und ihr entferne. »So was hätte früher jemand mal mit mir machen sollen.«
Ich folge dem Ufer um die Lagune, während ich darauf warte, dass mein Chef rangeht. Meine Sohlen drücken sich in den nassen Sand. Die Wellen umspülen angenehm kühl meine Füße. Manchmal überrascht es mich, wie sehr ich das mittlerweile genießen kann, obwohl ich noch vor einem Jahr so viel Angst vor dem Meer hatte. Cam sagt, der Ozean sei immer beides: die Schöne und das Biest. Heute trägt die Lagune ein strahlend blaues, märchenhaft schönes Kleid und macht sich bereit für den Ball zum Sonnenuntergang.
Mein Chef hat nur zwei kurze Rückfragen zu dem Report, den ich ihm heute Mittag geschickt habe. Ich kann ihm beide aus dem Stegreif beantworten. Danach entschuldigt er sich für die Störung, was ihn jedoch nicht davon abhalten wird, mich jederzeit wieder nach Feierabend anzurufen. Meistens überflüssigerweise, weil er meine Reports nur gründlicher lesen müsste. Aber gut … ich werde mich jetzt nicht darüber aufregen. Stattdessen lasse ich mich auf der gegenüberliegenden bewaldeten Landzunge in den Sand sinken. Die Sonne wird bald hinter den Ausläufern der Nā Pali Coast versinken. Sie wird die Palmen auf den Hängen in scharfe Scherenschnitte verwandeln und die Lagune in tiefe Schatten tauchen.
Ich denke an Maya, starre auf das Telefon in meiner Hand, als könnte ich es mental zwingen, einen Anruf von Maya anzuzeigen. Es fühlt sich so merkwürdig an, dass ihr Leben eine so gigantische Leerstelle für mich geworden ist. Ich weiß nichts darüber, was sie im letzten Jahr gemacht hat. Anfangs hat meine Mom mir hin und wieder von ihren Besuchen erzählt. Sie ist die Einzige, die abgesehen von Cam Bescheid weiß – darüber, warum Maya auf Abstand zu mir gegangen ist, eine Auszeit wollte. Weil sie sich in mich verliebt hat. Noch immer fühlt sich das nach etwas an, das nicht wahr ist. Ich habe Maya seit einem Jahr nicht gesehen. In meinem Kopf sind sie und ich irgendwo bei diesem Schockmoment hängen geblieben, in dem ich begriff, dass es ihr ernst ist mit ihren Gefühlen für mich.
Schließlich habe ich meine Mom gebeten, mir nichts mehr von Maya zu erzählen. Denn wenn wir miteinander sprachen und Mayas Name fiel, trat jedes Mal diese kurze betretene Stille ein, als wäre Maya gestorben. Beinahe so unverständlich und schmerzhaft haben sich die ersten Wochen ohne sie tatsächlich für mich angefühlt. Aber jetzt ist das Jahr fast vorbei. Zeit für Mayas Auferstehung. Zeit, sich wieder an mich zu erinnern. Doch noch schweigt sie hartnäckig.
Mit einem Seufzen blicke ich über die Lagune. Ich kann Maya nicht einfach schreiben. Sie wollte die Auszeit. Sie muss das Schweigen brechen.
Jill und Debora stehen noch an der anderen Seite und schirmen ihre Augen mit der Hand ab, um Cam und Leo zu beobachten. Braydon liegt auf seinem Handtuch am Strand und beweist, dass seine Fünf-Minuten-Angaben für eine x-beliebige Zeitspanne stehen. Abgesehen von uns ist die Bucht fast verlassen. Weiter draußen sind noch zwei Surfer unterwegs. Eine letzte Familie am Strand packt gerade zusammen. Die für Kaua‘i obligatorische Hühnerfamilie stakst durch den Sand und sucht pickend die verlassenen Picknickplätze ab.
Ich frage mich, wo Luna ist. Suchend wandert mein Blick umher – nur eine Sekunde etwa, bevor eine dünne Stimme an mein Ohr dringt. »Mommy!«
Mein Blick fliegt übers Wasser und mein Herz setzt aus. Luna muss sich aus Langeweile ihr Bodyboard geschnappt und allein am Wasser damit gespielt haben. Jetzt ist sie viel zu weit draußen. »Daddy!« Sie klammert sich ans Board, schafft es aber nicht, sich nach oben zu ziehen. Im selben Augenblick habe ich mein Telefon am Ohr. Ich lasse Braydons Handy klingeln, weil er sich als Einziger bei unseren Sachen befindet, werfe gleichzeitig den freien Arm in die Luft und rufe lautstark über den Strand nach Hilfe. Doch ich spüre nahezu, wie der dichte Wald hinter mir meine Stimme schluckt. Niemand dreht sich um – nicht mal Braydon zuckt.
»Mom!« Lunas Stimme klingt panisch. Sie hat wieder versucht, auf ihr Board zu kommen, aber dabei hat sie es verloren. Luna geht unter. Prustend und wild strampelnd kommt sie wieder hoch. Sofort habe ich im Kopf, was Cam mir mal erklärt hat: Wenn sie zum ersten Mal untergehen, hat man schon fast verloren. Denn beim zweiten Mal bleiben sie länger unten. Die Abstände zum Auftauchen werden größer. Und dann tauchen sie gar nicht mehr auf.
Luna kommt prustend hoch, ihre Stimme ist noch dünner, aber diesmal, glaube ich, ruft sie meinen Namen.
»Cam!«, brülle ich erneut über den Strand, höre jetzt in meiner Stimme die gleiche Panik wie in Lunas.
Ich lasse mein Handy einfach in den Sand fallen und renne los. Nach nur wenigen Schritten spritzt Wasser um mich auf. Dann falle ich nach vorne und schwimme. Meine Arme ziehen schnell durchs Wasser, meine Beine schlagen kraftvoll. Trotzdem habe ich das Gefühl, Luna nicht näher zu kommen.
Atemlos halte ich inne, kneife die Augen zusammen, scanne die Brechungslinie und mir wird eiskalt. Shit! Hinter Luna ist das Wasser ruhig.
Trügerisch führt ein dunkler Streifen zwischen den weiß schäumenden Wellen hinaus aufs Meer. Das kann ein Zeichen für einen Rippstrom sein – eine Art Kanal, durch den das anbrandende Wasser zurück in die offene See läuft.
»Fucking shit!«, fluche ich. Denn Lunas Kopf verschwindet erneut unter Wasser und es dauert zu lange, bis sie wieder hochkommt. Ich weiß, so ein Strom kann eine tödliche Falle sein, aber mir bleibt keine Wahl. Ich schwimme schräg, bis ich auf die senkrechte Linie zwischen Luna und dem Strand einbiege. Jetzt komme ich rasch voran. Und das bedeutet vor allem eins: Der Strom hat mich ebenfalls gepackt.
Zuerst bekomme ich Lunas Bodyboard zu fassen. Das Ding nutzt mir jedoch nichts. Es ist für ein Kind geeignet und sinkt unter meinem Gewicht tief ein. Also schiebe ich es vor mir durchs Wasser, bis ich Luna erreiche.
»Hey!«, rufe ich ihr zu. Sie sinkt mit dem Kopf unter Wasser und ich ergreife sie, ziehe sie hoch. »Alles gut, ich hab dich.«
Mein Brustkorb zieht sich zusammen. Es ist überhaupt nichts gut. Luna klammert sich so fest an mich, dass ich fast nicht mehr atmen kann. Sie tritt mich schmerzhaft unter Wasser. Die Panik in ihren Augen springt direkt auf mich über. Denn so kann ich nicht schwimmen. Ich kann uns nicht mal richtig über Wasser halten, während ich mich mit einer Hand am Bodyboard festhalte und der Strom uns weiter nach draußen zieht, aufs Ende des Riffes zu.
»Komm, Luna, ich helf dir aufs Board, okay?«, rede ich ihr gut zu. »Dir kann jetzt nichts mehr passieren.«
Wer’s glaubt! Gegen einen Rippstrom kommen nicht mal ausgebildete Rettungsschwimmer an. Ich werde Luna unmöglich zurück an den Strand schieben können. Holy fucking shit! Mir wird schwindelig vor Angst. Ich merke, wie ich die Kontrolle verliere. Mit einer Hand am Bodyboard sehe ich mich hektisch um – nach irgendetwas, das uns helfen kann. Als ich Cam entdecke, verleiht mir die Erleichterung schlagartig Auftrieb. Er muss mich doch gehört haben. Mit kraftvollen Paddelbewegungen hält er auf seinem Surfboard liegend direkt auf uns zu, ist uns schon ganz nah.
»Cam!«, rufe ich ihm entgegen, höre selbst, wie meine Stimme entgleist. »Luna, sie …« Ich verschlucke mich am Salzwasser. »Sie ist abgetrieben.«
»Rea.« Er ergreift meinen Arm, sobald er bei uns ist, zieht mich halb auf sein Surfbrett. Obwohl es auf diese Weise gefährlich tief sinkt, lässt mich das aufatmen.
»Hey, Luna.« Cams Stimme klingt ruhig – so wie er es für Krisensituationen wahrscheinlich gelernt hat. »Alles gut. Wir legen dich wieder auf dein Board, okay? Dann hältst du dich an meiner Leash fest wie immer.« Doch Luna schluchzt nur nach ihren Eltern und klammert sich mit angstverzerrtem Gesicht an mich.
»Ich muss Luna zu mir aufs Board nehmen.« Cam streckt die Arme nach ihr aus. Ich versuche sie ihm zu übergeben, aber sie tritt und schlägt wild um sich.
»Luna.« Cam muss sie mir nahezu entreißen, klopft ihr mit der flachen Hand ins Gesicht. »Luna, ich bin jetzt da und bringe dich ans Ufer. Du musst nur ein bisschen mithelfen. Du legst dich jetzt auf mein Board und dann bist du gleich wieder bei Mom und Dad.«
Endlich reagiert sie auf seine Worte und tut weinend, was er sagt. Cam hilft ihr, sich flach hinzulegen, und schiebt sie ganz nach vorn zur Nase seines Brettes. Dann dreht er sich zu mir um.
»Kannst du dich auf dem Bodyboard halten?«
»Schon.« Ich brauche ein paar Versuche, um mich daraufzuziehen, und spüre die Erschöpfung in meinen verkrampften Muskeln. »Aber das hält mich nur so halb.«
Um Cams Augen bilden sich besorgte Fältchen. »Wir probieren es«, beschließt er, wahrscheinlich weil es keine Alternative gibt. »Halt dich an meiner Leash fest.«
Ich bekomme die dünne blaue Kordel zu fassen, die sowohl an Cams Board als auch an seinem Knöchel befestigt ist, spüre jedoch schnell, dass ich zu viel Widerstand biete. Mittlerweile haben wir das Ende des Riffes erreicht. Cam muss uns seitlich aus dem Rippstrom paddeln. Ohne mich kann er danach den Schwung der brechenden Wellen nutzen, um Luna Richtung Strand zu bringen. Mit mir auf einem halb versunkenen Bodyboard funktioniert das jedoch nicht.
»Das geht so nicht, Cam.« Ich ringe nach Luft – einfach weil da so scheißviel Wasser unter mir ist. Aber ich bin nicht mehr die Rea von vor einem Jahr, die nie im Meer gebadet hat, für die ein Strand eine unüberwindbare Grenze darstellte, die allein im Wasser Panik bekam. All das war vor allem, was meine Mom mir beigebracht hatte. Weil sie meinen Dad auf See verloren hatte und dieser Schock zu tief saß. Doch nach einem Jahr an den Stränden Kaua‘is kann ich aufs Meer blicken und die Schöne sehen. Ich muss das Biest nicht mitdenken. Ich kann trennen, was meine eigenen Unsicherheiten sind und was die Angst meiner Mom ist. Und das hier … das kann ich schaffen. »Du musst Luna zuerst zum Strand bringen.«
»Ich lasse dich nicht allein hier draußen.«
»So kommen wir aber nicht vorwärts«, beharre ich.
Cam schüttelt den Kopf. »Du wirst weiter raustreiben, wenn du nicht selbst aus dem Strom schwimmen kannst.«
»Ich weiß. Du holst mich zurück, okay?« Die Aussicht, weiter abzutreiben, macht mir Angst. Verdammt große Angst. Aber die Panik habe ich im Griff.
Einen Moment lang mustert Cam mich zweifelnd. Dann richtet er sich halb auf seinem Board auf und sieht sich um, schiebt schließlich zwei Finger in den Mund und stößt einen schrillen Pfiff aus. »Hey!« Winkend hebt er einen Arm und ich sehe, dass er die Aufmerksamkeit der beiden Surfer zu erregen versucht, die ich schon vom Strand aus gesehen habe. »Ich glaube, sie haben uns bemerkt. Die kommen bestimmt her und helfen dir.« Cam wendet sich wieder mir zu. »Ich kehre um, sobald ich Luna an Braydon oder Jill übergeben habe.«
»Okay.« Die Angst lässt meine Muskeln zittern. Ich schließe meine Hände unter Wasser um die Ränder des Boards, damit Cam es nicht sieht, und erwidere entschlossen seinen Blick.
Er küsst mich auf die Stirn. »Ich bin gleich wieder da.«
Ich nicke – weil ich weiß, dass wir anders nicht aus dieser Situation herauskommen werden. Dann sehe ich zu, wie Cam sich abwendet und mich zurücklässt. Er entfernt sich jetzt rasch von mir. Sein Board wird von einer Welle ergriffen, die Luna und ihn aufs Ufer zutreibt, das für mich gerade unerreichbar ist. Ich befinde mich schon außerhalb des Riffes. Keine Ahnung, wie tief das Wasser unter mir ist. Keine Ahnung, was für Viecher unter mir herannahen. Ich denke an meine Mom. Vor genau solchen Situationen hat sie mich mein Leben lang gewarnt.
»Hey, brauchst du Hilfe?«
Obwohl die Wellen nicht hoch sind, merke ich erst jetzt, dass die beiden Surfer mir mittlerweile ganz nah sind. Hoffnung durchströmt mich. »Ja!« Erleichtert richte ich mich auf dem Bodyboard auf. »Bitte.«
Der Erste, der mich erreicht, hat kurze hellbraune Haare und ein ebenmäßiges Gesicht mit ungewöhnlich hellblauen Augen. »Hi, ich bin Zane. Du bist ganz schön weit abgetrieben.«
»Ich weiß. Ein Kind ist fast ertrunken und ich wollte helfen.«
»Wo ist das Kind?« Alarmiert sieht er sich um.
»Mein Freund bringt es ans Ufer«, sage ich rasch.
Diese Information scheint Zane keineswegs zu beruhigen. Er setzt sich auf seinem Surfbrett auf und runzelt die Stirn. »Und dich hat er einfach hier draußen gelassen?«
Ich mag es nicht, wie er die Situation beurteilt, obwohl er gar nicht dabei war, aber ich bin nicht in der Verfassung, eine Diskussion darüber anzufangen. Also erwidere ich bloß: »Vorher hat er euch zu Hilfe gerufen.«
»Er hätte auf uns warten müssen«, meint Zane, winkt mich dann aber einladend zu sich. »Komm am besten zu mir rüber.« Er dreht sich zu seinem Kumpel um. »Reid, kannst du das Bodyboard nehmen?«
»Klar.« Reid lächelt mich an. Er hat blonde Haare, die ihm fast bis zu den Schultern reichen. Dass die beiden so entspannt wirken, lässt mich aufatmen. Das hier ist eine Entfernung vom Strand, die für Surferinnen und Surfer vollkommen normal ist, mache ich mir bewusst. Trotzdem klammere ich mich weiter ans Bodyboard und schaffe es irgendwie nicht, loszulassen.
»Soll ich dir helfen?« Zane lässt sich ins Wasser gleiten und hält sein Surfbrett an der mir abgewandten Seite fest, schiebt es dichter an mich ran. »Versuch einfach rüberzurutschen.«
Tief hole ich Luft, als hätte ich vor zu tauchen. Dann lasse ich mich ins Wasser gleiten, habe einen endlosen Moment lang das Gefühl zu fallen. Dann kriege ich das feste, kühle Material von Zanes Surfboard zu fassen. Über das Brett hinweg fange ich seinen Blick auf. Das irritierende Hellblau seiner Augen nimmt mich für einen Moment gefangen. Anscheinend sieht er mir meine Angst an, denn er legt eine Hand auf meine. »Du bist gleich wieder am Strand.«
Ich nicke, ziehe mich mühsam an seinem Board hoch.
»Rutsch ganz nach vorne und erschrick nicht. Ich lege mich direkt hinter dich, okay?«
Ich nicke. Kurz habe ich Sorge, wieder ins Wasser zu fallen, als Zane sich hinter mir hochstemmt, und ich klammere mich noch fester.
»Keine Sorge. Mein Board hat jede Menge Auftrieb«, erklingt seine Stimme direkt in meinem Nacken. »Das trägt uns beide.«
»Okay.«
Zane liegt halb auf mir. Ich spüre seinen Atem in meinem Rücken. Aber das darf mich jetzt nicht stören. Immerhin rettet er mich gerade.
»Alles gut?«, erkundigt er sich und wartet auf mein Nicken. »Dann geht’s los.« Er beginnt zu paddeln. Seine Arme streifen über meine Schenkel. Die Wellen heben das Board mit uns darauf an, lassen es wieder sinken und heben es erneut an.
Dann paddelt Zane ein paar Züge schneller. Im nächsten Augenblick schießt das Board vorwärts. Scharf atme ich ein. Denn obwohl ich auf einem verdammten Surfbrett auf dem Wasser liege – mit einem Kerl ziemlich schwer auf meinem Unterleib –, habe ich einen winzigen Moment lang das Gefühl zu fliegen.
»Alles in Ordnung bei dir?«, erkundigt sich Zane.
Mit einer angespannten Bewegung wische ich mir Spritzwasser aus den Augen. »Ja, alles okay.«
»Dein Freund hätte dich echt nicht da draußen lassen dürfen, wenn du dich nicht auskennst«, brummt Zane in meinem Rücken. Unwillkürlich verkrampfen sich meine Hände um die Ränder des Surfbrettes. Denn Cam kommt uns bereits entgegen. Am liebsten würde ich direkt zu ihm rüberwechseln, aber gleichzeitig will ich auch einfach auf dem direktesten Weg zurück ans Ufer.
»Rea! Bist du okay?«, ruft er mir zu.
»Ja!«
»Danke, Leute.« Auch Cam macht keine Anstalten, mich auf sein Board zu holen. Stattdessen paddelt er zwischen Zane und Reid zurück Richtung Ufer. »Das war gerade eine Scheißsituation. Gut, dass ihr noch draußen wart.«
»Klar, Mann, kein Problem!« Reid übergibt Cam das Bodyboard, sobald wir in flaches Gewässer gelangen.
Zane ist allerdings weniger entspannt. »Was wäre denn gewesen, wenn wir nicht mehr draußen gewesen wären? Hättest du deine Freundin dann einfach zurückgelassen?«
Oh nein! Ich verstehe ja, dass Zanes Beschützerinstinkt geweckt ist. Immerhin bin ich gerade hilflos wie ein Robbenbaby auf einer zu kleinen Eisscholle aufs offene Meer getrieben. Aber ich will trotzdem nicht, dass er Cam Schuldgefühle einredet.
»Dann wäre die Situation noch beschissener gewesen«, gibt Cam ehrlich zu und presst die Lippen zusammen, sichtlich bemüht, sich nicht provozieren zu lassen. »Ich war froh, euch zu Hilfe rufen zu können. Also, danke noch mal.«
Im seichten Uferbereich lässt Zane sich von seinem Brett rutschen und kommt auf die Füße. Ich platsche deutlich unbeholfener ins Wasser. Zane bemerkt offenbar, dass ich Probleme habe. Meine Muskeln zittern vor Erschöpfung. Ich finde kaum mein Gleichgewicht. Zane stützt mich am Unterarm, bis ich sicher stehe. »Geht’s dir gut? Das muss ein ziemlicher Schock für dich gewesen sein.«
»Ich bin okay.« Rasch blicke ich zu Reid. »Danke für eure Hilfe. Ich bin echt froh, dass ihr da wart. Wenn ihr wollt …« Mir fällt ein, dass ich mein Handy vorhin einfach in den Sand geworfen habe, und ich lächle verlegen. »Sorry, mein Telefon liegt irgendwo dahinten am Strand. Ich versuche gleich es wiederzufinden. Dann könnt ihr mir eure Nummer geben. Wenn ihr wollt, laden wir euch mal auf ein Bier ein oder so.«
»Gute Idee.« Cam legt seinen Arm um meine Taille und ich lehne mich Halt suchend gegen ihn.
»Klar.« Zane lächelt, wobei sich charmante Grübchen in seinen Wangen bilden. »Wir sind noch ein paar Tage auf Kaua‘i, also können wir uns gern treffen.«
»Rea!« Jill kommt ins Wasser gestürmt, drängt Cam zur Seite und fällt mir um den Hals, presst mich an sich und schluchzt hemmungslos an meiner Schulter. »Sie wäre ertrunken ohne dich. Oh Gott, sie wäre ertrunken.«
Braydon schlingt seine Arme gleichzeitig um Jill und mich. »Wie können wir das jemals wiedergutmachen?«
»Ihr habt nichts wiedergutzumachen«, protestiere ich. Mittlerweile zittere ich am ganzen Körper – keine Ahnung, ob vor Kälte, Anspannung oder vom Abebben des Adrenalins in meinen Adern. Jills und Braydons Verzweiflung ist mir gerade zu viel.
»Lasst sie erst mal aus dem Wasser kommen«, schaltet Cam sich ein, als spüre er mein Unwohlsein. »Sie braucht trockene Klamotten und was zu trinken.« Er zieht mich zwischen den beiden hervor und ich folge ihm an den Strand. Nur wenig später hat Debora mir mein Badetuch gebracht und Cam hält es um mich fest, damit ich mich umziehen kann.
»Rea?« Ich habe gerade erst meine Shorts und mein flaschengrünes Top angezogen und Cam lässt das Handtuch los, als Zane wieder neben uns auftaucht. Mit einem Lächeln hält er mir mein Telefon hin.
»Du hast es gefunden?« Überrascht sehe ich ihn an. »Danke! Das wäre nicht nötig gewesen! Ihr habt schon so viel geholfen.«
Grinsend zuckt er mit den Schultern. »Wenn ich dich anrufen soll, musst du es haben, oder?«
»Da ist was dran«, erwidere ich. »Gib mir deine Nummer, okay? Ich melde mich bei dir.« Ich öffne meine Kontaktliste und sehe fragend zu ihm auf. Kurz bleibt mein Blick an seiner Kette hängen – Kokosperlen und ein flacher runder Silberanhänger, in dem sich eine stilisierte Welle bricht. Typisches Surferaccessoire. Dann tippe ich, während Zane mir seine Nummer diktiert.
»Erhol dich gut vom Schreck«, sagt er schließlich. Wieder verwirrt mich das helle Eisblau seiner Augen. »Du warst verdammt mutig da draußen. Es ist nicht leicht, in so einer Situation die Nerven zu behalten.«
Ich nicke nur und verabschiede mich von ihm und Reid.
Als die beiden gehen, lasse ich mich in Cams Arm ziehen und lege meinen Kopf an seine Schulter, spüre sein Herz gegen meinen Brustkorb schlagen. Ich fühle ihn atmen und atme im gleichen Rhythmus mit, bis die Luft wieder ganz tief in meine Lunge strömt.
»Was denkst du?«, murmelt er in meinen Haaransatz, während mein Blick über die Lagune schweift. Aber diesmal antworte ich ihm nicht.
Ich bin gefangen vom Anblick der grauen Schatten, die aus den umliegenden Wäldern aufs Wasser kriechen. Sie schlucken das türkisfarbene Leuchten der Lagune, färben sie in dunkles Violett. Selbst an einem ruhigen Tag wie heute kann der Ozean tödlich sein. Am Meer gibt es nichts schönzureden. Es ist immer auch ein Biest.
»Ich bin stolz auf dich.« Cam streicht mir die Haare zurück. »Du warst mutig, Rea. Und du hast alles richtig gemacht.«
Ich sehe ihn an und muss ganz unverhofft lächeln. Weil er recht hat. Weil ich gerade ein bisschen über mich hinausgewachsen bin, über das, was ich mir je zugetraut hätte. Und als ich diesmal wieder über die Lagune blicke, denke ich an Maya. Ich will ihr von meiner Baywatch-Aktion erzählen, wie sie das bestimmt nennen würde. In ihrer Vorstellung bin ich noch die Rea von vor einem Jahr, die da draußen komplett in Panik geraten wäre. Ich will ihr mein neues Leben hier auf der Insel zeigen. Und ich kann es kaum erwarten, dass sie endlich anruft.
Maya
San Francisco International Airport
Tief atme ich den Zuckerwatteduft ein, setze mich auf meinen Rollkoffer und beobachte die Leute: Vielflieger, die mit handlichem Gepäck und einem Tablet unterm Arm auf die Schalter zusteuern, Backpacker, die sich an den überdimensionierten Anzeigetafeln orientieren, Familien, die versuchen, gleichzeitig die Kofferabgabe zu finden und ihre umherstürmenden Kinder im Auge zu behalten.
Und ich. Zu früh, obwohl das gar nicht meine Art ist. Mit ungeduldigem Blick auf meinen Flug nach Honolulu, der nur ganz langsam auf der Anzeigetafel nach oben kriecht. Vor gut einem Jahr stand ich mit Rea hier und sah ihr zu, wie sie mit ihren vielen Büchern hantierte. Schließlich musste sie die Tasche doch als Sperrgepäck aufgeben.
Und da sind sie wieder: meine Gedanken an Rea. Hallo, ich hatte euch schon vermisst. Ich schmunzle über mich selbst. Und ich genieße das Kribbeln, das mittlerweile meinen ganzen Körper erfasst hat – meinen Bauch, mein Herz, irgendwie sogar meinen Kopf. Ich freue mich auf diese Reise. Auf meinen Dad, das Blue Water Bliss, Kaua‘i. Und auf Rea.
Allein der Zuckerwatteduft, der dem bauchigen Gerät eines mobilen Standes mitten in der Abflughalle entströmt, weckt Hunderte Erinnerungen an unsere Kindheit. Ich muss an den Zuckerwattemann am Fisherman’s Wharf denken, an Rea und ihr Faible für die Süßigkeit. Es ist eine ganz und gar harmlose Rückblende, die sich in meinem Kopf gerade abspielt. Es gibt auch jede Menge gefährliche, aber ich schaffe es immer besser, sie zu unterdrücken. Die ersten Wochen ohne Rea waren die Hölle für mich. Ich weiß, wir brauchten das. Ich, um meinen Liebeskummer zu verarbeiten. Sie, um zu vergessen, dass ich ihretwegen welchen hatte. Trotzdem habe ich mich gefühlt, als sei ein Teil von mir amputiert worden.
Aber dann traf ich …
Jäh werde ich aus meinen Gedanken gerissen, als mir jemand von hinten die Augen zuhält. Ich muss lachen, weil ich nur eine Person kenne, die das macht.
»Lilly.« Ich ziehe ihre Hände von meinen Augen und drehe mich zu ihr um.
Sie nimmt mein Gesicht in beide Hände und gibt mir einen stürmischen Kuss auf die Lippen. »Hi.«
Alles an Lilly leuchtet – vor allem ihre blonden Haare, auf denen das Licht glänzt wie die Sonne auf dem Meer. Sie hat ein herzförmiges Gesicht mit einem verschmitzten Lächeln, bei dem sie einen Mundwinkel ein bisschen höher zieht als den anderen – was schon reicht, um mich schmelzen zu lassen wie Zuckerwatte auf der Zunge. In ihren braunen Augen leuchtet ein grünlicher Kranz rund um die Pupillen und auf ihren Fingernägeln immer irgendein neuer Nagellack.
»Sorry, dass du warten musstest. Bin ich zu spät?«
»Nein, ich war zu früh.«
Lilly hebt die Augenbrauen. »Echt? Du bist nie zu früh.«
Lächelnd stehe ich von meinem Koffer auf. Es fühlt sich erstaunlich gut an, dass sie das über mich weiß. Und das ist anders als früher. Die Typen, mit denen ich es länger als für ein paar Dates ausgehalten habe, wurden mir meistens in dem Moment langweilig, in dem sie anfingen, mich und meine Eigenheiten besser zu kennen. Mit Lilly ist genau das aufregend. »Ich kann es einfach nicht erwarten, bis es endlich losgeht«, sage ich.
»Ich auch nicht. Ich habe nur Angst, dass die Airline nicht gut zu meinen Babys ist.« Lilly löst sich von mir und deutet auf ihr Gepäck. Neben ihrem Koffer stehen zu ihren Füßen eine Umhängetasche und ein riesiger Rucksack in Mittelblau mit Retro-Applikationen aus Leder, von dem ich annehme, dass er Lillys Kameraausrüstung enthält.
»Solltest du nicht vielleicht draufschreiben, dass Kameras drin sind, damit sie den Rucksack nicht werfen?«
»Werfen?« Beim Anblick von Lillys panischem Gesichtsausdruck muss ich lachen. »Ich gebe den doch nicht auf. Der kommt ins Handgepäck.«
»Aber das Ding ist riesig«, wende ich ein. »Hast du alle Kameras dabei, die du besitzt?«
»Fast. Ich will schließlich vorbereitet sein. Wenn ich in Hawai‘i nicht mit meinem gesamten Equipment experimentieren kann, wo sonst? Das Hochzeitspaar, das gestern ein Shooting bei mir hatte, war jedenfalls null experimentierfreudig. Da hätte ich mich auch einfach mit meiner Kompaktkamera hinstellen können.«
»Mit null experimentierfreudig meinst du, dass sie nicht auf dem Geländer der Golden Gate Bridge balancieren oder mit Skateboards die Lombard Street runterfahren wollten? Das kann ich ja gar nicht verstehen.«
»Genau deshalb liebe ich dich.« Lilly küsst mich wieder – diesmal richtig. Ich genieße die Hitze und Weichheit ihrer Lippen auf meinen, finde immer wieder schön, wie gut wir zusammenpassen. Keine von uns muss sich verrenken. Da sind einfach nur ihr leuchtendes Gesicht, ihre braunen Augen, die zu hellem Bernstein verschmelzen, wenn sie mir näher kommt, und dann ihre immer ein bisschen gierige Art, mit der sie mich küsst. »Wollen wir los?« Sie löst sich von mir und sieht sich zur digitalen Uhr an der Anzeigetafel um. »Bis ich mit meinem ganzen Zeug durch die Sicherheitskontrolle bin, dauert es bestimmt wieder ewig. Außerdem habe ich riesigen Hunger.«
»Was hältst du von einer Portion Zuckerwatte als Vorspeise? Ich lade dich ein.«
Lillys Augen fliegen zum Zuckerwattestand, vor dem eine ganze Reihe aufgeregt herumhüpfender Kinder Schlange steht. Mit immer gleichen Bewegungen zieht der Zuckerwattemann die Wolken auf lange Holzstäbe, kassiert zwei Dollar dafür und reicht sie nach vorne. Ein unbeirrbarer, gemächlicher Ablauf im hektischen Treiben des Flughafens.
»Klar, gerne.«
Sobald wir unser Gepäck aufgegeben haben und die Zuckerwatte in Händen halten, lassen sich meine Gedanken an Rea gar nicht mehr aufhalten. Das Verrückte ist, dass ich mich vor allem an sie und mich als Kinder erinnere. Ein Jahr ist gar nicht so lang, habe ich zum Abschied zu ihr gesagt. Jetzt erscheint es mir wie ein ganzes Leben. Und vielleicht ist das gut so. Es bedeutet, dass meine Verliebtheit in sie nur eine Episode war und wir jetzt wieder Freundinnen sein können. Ich vermisse sie immer noch. Aber nicht mehr auf diese verzweifelte, sehnsuchtsvolle, extrem schmerzhafte Weise wie anfangs. Eher ungeduldig, weil ich endlich meine beste Freundin zurückwill, der ich ungefiltert alles erzählen kann, was mich beschäftigt.
»Hast du eigentlich noch mal mit deiner Mom gesprochen?«, fragt Lilly, während wir auf die Sicherheitskontrolle zuschlendern – ich nur mit meinem City-Rucksack in leuchtendem Bordeauxrot, Lilly mit ihrem riesigen Foto-Backpack und ihrer Umhängetasche. Sie wirkt zierlich unter dem Gewicht, bewegt sich aber, als würde sie es gar nicht spüren.
»Worüber?«
Sie hebt die Augenbrauen, während sie die letzten Reste ihrer Zuckerwatte vom Holzstab knabbert. »Deinen Dad lerne ich immerhin endlich kennen, aber deine Mom möchte ich auch gerne treffen. Immerhin wohnt sie hier in San Francisco und wir müssen nicht stundenlang fliegen, um sie zu sehen.«
Sofort spüre ich die unangenehme Spannung über meine Haut flirren, die ich meistens wahrnehme, wenn ich mich unter Druck gesetzt fühle. Lilly hat sich schon vor ein paar Wochen in den Kopf gesetzt, Miranda kennenlernen zu wollen. Und klar, wir sind jetzt in einer richtigen Beziehung. Lilly hat Fächer in meinem Schrank, Zahnbürste, Cremes und Shampoo in meinem Bad und vergisst ständig ihr Ladekabel bei mir. Aber Miranda hat sich noch nie für irgendetwas interessiert, das mir wichtig war. Sie wird Lilly mit derselben Gleichgültigkeit strafen wie meinen Wunsch, mein eigenes Café zu eröffnen. Mein Bachelorabschluss entspricht nicht ihren Erwartungen und meine Wut darüber, dass sie mir über zwanzig Jahre lang meinen Vater vorenthalten hat, erkennt sie nur halbherzig an. Gerade bin ich froh, dass Miranda und ich angesichts unserer Differenzen überhaupt miteinander reden. Unser Friede ist brüchig. Auch weil Miranda meine sexuelle Orientierung lediglich für eine weitere Taktik von mir hält, ihre Aufmerksamkeit zu erregen. Und sie glaubt, es sei ein Riesenzugeständnis, mich nicht in jedem Gespräch darauf hinzuweisen, dass sie in Lilly ein Mittel sieht, um aufzufallen und mich besonders zu fühlen.
Ich wünschte, ich könnte ihr Lilly vorstellen – mit ihrem spritzigen Temperament, ihrem Humor und ihrem Unternehmungsgeist. Aber all das würde vollkommen wirkungslos an Mirandas Bollwerk abprallen. Miranda würde abfällig schnaufen und hin und wieder einen schneidenden Seitenhieb einbringen. Sie würde Lilly das Gefühl geben, sowieso nicht auf Dauer in meinem Leben zu sein.
Aus diesem Grund werde ich ein Treffen zwischen den beiden so lange wie möglich hinauszögern.
Ich werfe meinen Holzstab in einen der mit leeren Plastikflaschen überfüllten Mülleimer. »Weißt du, Lil, es gibt Leute, die schaffen es, die ganze Welt mit Licht und Leben zu füllen – so wie du. Und dann gibt es Leute wie Miranda, die jedem das Gefühl geben, ihren Ansprüchen nicht zu genügen. Neben ihr komme ich mir immer unzulänglich vor – weil sie in die Oper geht und ich ins Taylor-Swift-Konzert, weil ich beim Italiener Wein bestelle und sie die Weinkarte, weil sie eine verdammte Chefärztin ist und ich kaum meinen Abschluss in Englischer Literatur geschafft habe. Und weil ich ein Café eröffnen will und das in ihren Augen nur Leute tun, die sonst nichts können.«
Lilly verdreht die Augen. »Das sind Vorurteile. Ein eigenes Geschäft zum Laufen zu bringen ist unfassbar komplex – vor allem hier in San Francisco, wo es schon mehr als genug Läden gibt. Aber du bist mutig genug, es zu versuchen. Allein dafür kannst du verdammt stolz auf dich sein, Maya.«
»Danke.« Ich drücke ihre Hand. »Aber Miranda nennt das dumm, nicht mutig.«
»Dann beweis ihr das Gegenteil«, sagt Lilly einfach.
Als Antwort seufze ich nur. Allein der kurze Austausch über Miranda reicht bereits, meine Stimmung zu drücken.
»Ich frag mich einfach …« Lilly mustert mich nachdenklich. »Du lässt deine Mom ziemlich hart und kalt klingen. Und trotzdem scheint dir echt viel an ihr zu liegen – so oft, wie du sie erwähnst. Warum?«
»Weil sie meine Mom ist.« Die Worte sind wie ein Reflex. Mein Leben lang habe ich mich danach gesehnt, von Miranda geliebt zu werden – so wie Rea von Carly geliebt wird. Und ich eigentlich auch, muss ich zugeben. Ich weiß, ich brauche Miranda nicht. Falls ich Alex für meine Pläne gewinne, werde ich bald nicht mal mehr finanziell von ihr abhängig sein. Trotzdem wünsche ich mir ihre Anerkennung, als wäre ich erst dann wirklich etwas wert, wenn sie mich damit auszeichnet. Meine Sehnsucht nach ihrer Bestätigung begleitet mich schon zu lange, um sie einfach abzuschütteln. Mittlerweile hat sie sich wahrscheinlich epigenetisch in mein Erbgut eingeschrieben. Rea hat das immer verstanden. Sie hat zwischen Miranda und mir vermittelt. Lilly hingegen blickt mit ganz anderen Voraussetzungen auf Miranda. Und wer weiß … vielleicht werde ich das durch Lilly auch irgendwann tun.
»Wenn es dir als Grund reicht, dass sie deine Mom ist, reicht mir das auch«, verkündet Lilly allerdings.
»Lass uns jetzt erst mal nach Kaua‘i fliegen und meinen Dad treffen, okay?«, versuche ich sie abzulenken.
Lilly hebt unbestimmt die Schultern und rückt ihren schweren Fotorucksack zurecht. »Deine Mom weiß aber von uns, oder? Also, dass wir zusammen sind, meine ich.«
»Klar weiß sie von uns.« Ich kann mich gerade so beherrschen, nicht auszusprechen, was Miranda darüber denkt, weil Lilly schnell genervt ist, wenn sie irgendwo Vorurteile oder Ablehnung wittert. Ich kann es ihr nicht verdenken. Sie hatte am Ende der Highschool ein ziemlich verunglücktes Coming-out und seitdem sehr viel mehr dumme Sprüche zu ertragen als ich.
»Und sie hat kein Problem damit, dass du auf Frauen stehst?«, hakt Lilly nach.
»Nicht direkt, aber …« Hilflos hebe ich die Schultern.
»Was aber?«
»Um die Wahrheit zu sagen: Ich will einfach nicht, dass du sie triffst.« Wow! Es tut gut, das auszusprechen. Als hätte ich zu lange unter Wasser die Luft angehalten und wäre nun endlich an die Oberfläche gekommen. Dann jedoch fällt mir auf, wie Lilly mich anstarrt. Diese Information muss sie offenbar erst mal verarbeiten.
»Können Sie weitergehen oder dauert das bei Ihnen länger?« Ein ungeduldiger Mann im Anzug macht uns mit wedelnder Hand darauf aufmerksam, dass sich vor uns in der Schlange eine ziemliche Lücke aufgetan hat. Ich ziehe Lilly mit mir, um aufzuschließen.
»Was ist denn das Problem?«, will Lilly wissen. Ihre Gefühle sind ihr wie immer deutlich ins Gesicht geschrieben. Eigentlich mag ich ihre unverstellte Art. Gerade stresst sie mich allerdings eher. »Meine Familie hast du doch auch kennengelernt und mitgekriegt, dass bei uns nicht alles einfach ist.«
Ich widersetze mich dem Impuls, die Augen zu verdrehen. In Lillys Familie wird viel gestritten, ja. Aber auf diese liebevolle Weise, bei der man weiß, dass sich alle nur furchtbar aufregen, weil sie sich gegenseitig so wichtig sind. Miranda spielt in einer vollkommen anderen Liga. Doch unseren Sommer auf Kaua‘i will ich mir auf keinen Fall davon verderben lassen, dass ich zu viel über die schwierige Beziehung zu meiner Mutter nachdenke. Ich ignoriere das genervte Schnaufen des Mannes hinter uns, weil wir schon wieder zu viel Abstand zu den Reisenden vor uns lassen, streiche Lilly die schimmernden blonden Haare zurück und sehe ihr in die Augen, konzentriere mich genau auf den dünnen grünen Kreis um ihre Iris.
»Ich bin froh, dass du mitkommst«, sage ich fest. »Ich bin froh, dass ich dich Alex vorstellen kann. Aber Miranda ist ein anderes Kapitel in meinem Leben. Über sie können wir nach der Reise reden, okay?«
Diesmal zögert Lilly nur einen winzigen Moment, ehe sie nickt. »Okay. Sorry, wahrscheinlich hätte ich dich nicht gerade jetzt damit unter Druck setzen sollen.«
»Schon gut.« Ich küsse sie – kurz nur, es genügt allerdings, damit sich der Mann hinter uns mit einem gequälten Laut vorbeidrängt.
»Auch das noch«, glaube ich ihn brummen zu hören, ignoriere ihn aber.
»Ich weiß es zu schätzen, dass du dich für meine Familie interessierst. Es gibt nur einfach nicht viel Familie da, wo ich herkomme.«
»Das tut mir ehrlich leid, Maya.«
Ich nicke erleichtert über ihr Verständnis. Mein Herzschlag hat sich jedoch nicht wieder beruhigt, als wir endlich an die Reihe kommen und Lilly hektisch anfängt, ihr gesamtes Gepäck in die Plastikbehältnisse auf den Rollbändern zu sortieren und mit dem Sicherheitsbeamten über die richtige Behandlung ihrer Kameras zu diskutieren.
Denn mich plagt ein Problem, das viel gravierender ist, als Lilly von Miranda fernzuhalten. Irgendwann in den nächsten zwei Tagen werde ich Lilly davon erzählen müssen – von Rea, meiner besten Freundin, die ich kenne, seit ich denken kann, mit der ich ein Jahr lang kein Wort gewechselt habe, an die ich täglich denke, die der Hauptgrund ist, warum ich mich so auf meine Rückkehr nach Kaua‘i freue. Und die ich Lilly gegenüber nie auch nur erwähnt habe.
Rea
Kapa‘a, Kaua‘i
Ich mag die Nacht – immer schon. Zu Hause in San Francisco wird die trubelige Stadt ruhiger und weniger grell in der Dunkelheit. Und auf der Farm meiner Großeltern in der Nähe von Bodega wird es komplett finster. Manchmal saß ich am Ende des Sommers draußen am Feldrand, die Nacht so tiefschwarz, dass sie auf ihre ganz eigene Weise glänzt, die Luft erfüllt vom Duft der zweiten Lavendelblüte und der würzigen Erde, und lauschte der Stille.
Auf Kaua‘i gibt es diese Art von Finsternis ebenfalls, aber es gibt auch Nächte wie heute – mit einem Himmel voller Sterne, die ihm Tiefe verleihen, den Eindruck von Endlosigkeit. Diese Nächte mag ich am liebsten.
Ich stehe im dunklen Zimmer am Fenster und blicke nach draußen auf das stille Schimmern der nächtlichen Farben. Hinter mir höre ich Cam die Holzstiege vom Zwischenboden herunterkommen, wo wir vor ein paar Monaten unser neues Futonbett aufgebaut haben. Ich liebe die rauen Holzbalken, mit denen der Dachgiebel darüber abgestützt ist, die gemütliche Atmosphäre, die durch die zahllosen darunter angebrachten Lichterketten erzeugt wird. In San Francisco hat meine Mom sie großzügig in unserer Wohnung verteilt. Sie meint, sie können aus einem hässlichen Raum einen schönen zaubern und einen schönen Raum in einen Herzensort verwandeln. Unsere Wohnung in San Francisco war immer ein gemütliches Zuhause für mich. Aber meinen Herzensort habe ich hier gefunden. Bei Cam.
Nach dem Tag heute habe ich es trotzdem nicht geschafft, zur Ruhe zu kommen. Ich dachte, Cam würde schon schlafen, als ich vor ungefähr einer Viertelstunde unter seinem Arm herausgekrochen bin und mich hierher ans Fenster gestellt habe.
»Bist du okay?« Er schlingt von hinten seine Arme um mich und ich lehne mich gegen ihn.
»Ich kann nur nicht schlafen.«
»Es tut mir leid«, murmelt er in meine Haare.
»Was?«
»Dass ich euch nicht beide retten konnte. Dass wir nicht alle besser auf Luna geachtet haben. Dass du in diese Situation geraten bist.«
»Cam.« Ich drehe mich in seinem Arm um und ziehe seinen Kopf zu mir, küsse ihn auf die Stirn. »Übernimm nicht die Verantwortung für Dinge, für die du nichts kannst.« Das hat er schon früher getan. Aber die Situation heute war nicht seine Schuld – auch wenn Zanes Kommentare ihn vielleicht etwas anderes glauben lassen.
Cam zieht mich fester an sich und wir halten uns gegenseitig umschlungen. Im letzten Jahr ist mir immer klarer geworden, dass er – sosehr er das Meer liebt und sowenig er ohne das Surfen er selbst wäre – trotzdem manchmal Angst hat. Weil er als Lifeguard die Gefahren kennt. Weil er sie selbst erfahren hat. Das Meer hat ihn gezeichnet. Ich kenne seine Narben.
Cam lässt seine Fingerkuppe hauchzart über meine Stirn streichen – senkrecht vom Haaransatz abwärts bis zu meinen Brauen, wie er das oft tut. »Was denkst du?«
Ich seufze unwillkürlich. Als Leo und Luna im Bett waren, saß der Schock noch immer mit uns anderen im Wohnzimmer. Keiner schaffte es, zu den üblichen Abendaktivitäten überzugehen. Niemand stritt ums Fernsehprogramm, niemand diskutierte, wer am nächsten Tag die Kinder von der Schule abholen soll, wer den Küchendienst macht und wer vergessen hat zu saugen oder das Bad zu putzen.
»Dass sich viel verändert hat«, sage ich endlich. »Vor einem Jahr wäre ich da draußen gestorben vor Panik. Aber jetzt … Ich fühle mich gut. Trotzdem habe ich Angst vor Albträumen.«
Cams Hand fährt in einer Ellipse über meinen Rücken. Ich liebe dieses Gefühl, diesen beruhigenden Druck seiner Finger, die Vorhersehbarkeit der Route, die er nimmt, die Wärme seines Körpers durch mein dünnes Schlafshirt.
»Rea?« Er löst sich von mir. In der Dunkelheit ist sein Gesicht nur eine Silhouette. Über unseren Köpfen dreht sich gemächlich ein Ventilator. Cams Atem trifft warm mein Gesicht. »Hast du Lust auf einen Nachtspaziergang?«
Wieder richte ich den Blick durchs Moskitogitter in die Schatten im Garten. »Ja.«
Wir brauchen nur etwa fünf Minuten, um angezogen auf der sporadisch von Laternen erleuchteten Wohnstraße zu stehen. Ohne uns abzustimmen, schlagen wir die Richtung zum West Trailhead des Sleeping Giant ein. Den Berg zu erklimmen, der tatsächlich wie der gigantische Kopf eines auf dem Rücken liegenden Riesen aussieht, war eins der ersten Dinge, die ich mit Cam unternommen habe, nachdem ich mich entschieden hatte, auf Kaua‘i zu bleiben. Seitdem war ich mehrmals oben – mit Debora, mit Cam und manchmal allein. Ich habe den Sonnenaufgang von dort oben beobachtet und den Sonnenuntergang. Und wenn ich von der South Shore Richtung Kapa‘a fahre und die Silhouette des Berges ausmache, komme ich dem Gefühl, hier zu Hause zu sein, ganz nah.
Cam beleuchtet den Weg mit einer Taschenlampe, während wir dem Pfad ins Unterholz folgen. Der Lichtstrahl geistert über matschige rötliche Erde und knöchelhohes Gras. Nach nur wenigen Schritten hüpft eine faustgroße gelbe Kröte irritiert aus dem Weg. Dann verschluckt uns ein Dickicht ineinander verwobener Äste. Hin und wieder atme ich den blumig-pudrigen Duft von Hibiskus ein. Durch die Sohlen meiner Schuhe spüre ich die markanten Wurzeln der Bäume, die sich fest in den Boden krallen.
Der Strahl der Taschenlampe fliegt über die Äste von Sträuchern und Buschwerk, die den Weg wie einen Tunnel einfassen. Ich halte mich dicht hinter Cam, bis wir atemlos am Ende eines besonders steilen Abschnittes angekommen sind. Wäre es nicht mitten in der Nacht, würde sich die Aussicht hier weit über die Insel öffnen, über die Gebirgszüge in der Ferne und bis zum Horizont über den Ozean. Stattdessen verliert sich der Lichtstrahl in der Dunkelheit, bis Cam ihn löscht.
Im ersten Augenblick umschließt uns die Finsternis undurchdringlich. Nur an der Küste sind die glitzernden Leuchtpunkte von Straßenlaternen und erhellten Gebäuden zu erkennen. Ich höre, wie es im Unterholz raschelt. Aus der Ferne weht der Ruf einer Eule zu uns. Ich lausche dem Rauschen des Windes, dem leisen Geklapper der Hölzer. Und langsam gewinnt die Welt auch für meine Augen an Tiefe, langsam fange ich an zu sehen, was ich sehe. Aus den nachtschwarzen Schatten wird silbriges Grau, dunkles Violett und hier und dort geisterhaftes Blau. Der Mond steht nahezu voll über uns. Er gießt sein Silberlicht über die Insel, löst die Konturen von Bergformationen aus der Nacht, glänzt matt auf einem Flusslauf. Der Wind riecht nach dieser speziellen Kaua‘i-Mischung aus Tannennadeln, Farn und Regen. Und manchmal duftet er sogar nach wilden Blüten.
Ich mag die Nacht. Ich mag die Farben der Schatten. Ich mag das Gefühl, zusammen mit Cam ganz allein zu sein, weil dann alles in mir zur Ruhe kommt.
Ich lasse meine Hand in die von Cam gleiten und seine Finger schließen sich um meine.