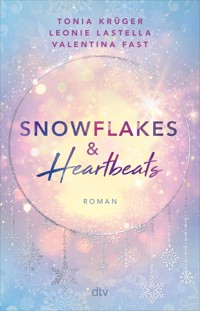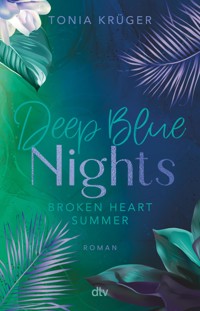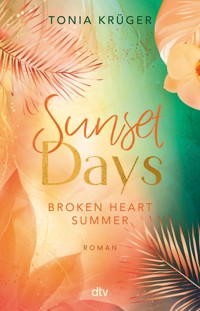
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: dtv
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Broken-Heart-Summer-Reihe
- Sprache: Deutsch
Eine Geschichte über die Suche nach der Liebe und sich selbst Opposites Attract & Slow Burn – Der Auftakt der neuen Reihe der Autorin, für alle Fans von mitreißenden Liebesromanen Sonne, Strand, Meer! Rea und Maya verbringen den Sommer auf Hawaii. Eigentlich will Rea ihrer Freundin dabei helfen, deren Dad zu finden. Als sie jedoch Cam begegnet, ist plötzlich alles anders: Rea blüht auf und genießt ihre neu entdeckten Gefühle. Doch ist eine Beziehung mit Cam überhaupt möglich? Und wird ihre Liebe die Distanz zwischen Hawaii und San Francisco überstehen? Da macht Maya ihr auch noch ein unerwartetes Geständnis und plötzlich scheint es, als drohe Rea am Ende dieses Urlaubs nicht nur ihre große Liebe Cam zu verlieren … - Der perfekte Mix aus sommerlich-leichtem Erzählton, vielschichtigen Charakteren und emotionaler Tiefe - Topsetting Hawaii: Die exotische Kulisse lädt zum Träumen einAlle Bände der ›Broken Heart Summer‹-Reihe: Band 1: Sunset Days Band 2: Deep Blue Nights Die Bände sind nicht unabhängig voneinander lesbar. Von Tonia Krüger außerdem erschienen bei dtv: ›Love Songs in London‹-Reihe & Kisses in the Snow
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 551
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über das Buch
Wenn du dein Herz am anderen Ende der Welt verlierst – wirst du ihm folgen?
Als Cam Rea bei ihrer ersten Begegnung von den Füßen reißt, bringt er damit nicht nur ihr Gleichgewicht, sondern auch ihr Gefühlsleben gehörig ins Wanken. Mit jedem Treffen, an denen er sie an atemberaubende Strände und romantische Buchten führt, verliebt Rea sich ein wenig mehr in den lässigen Surfer. Und das, obwohl sie doch eigentlich Kopfmensch ist und ein klares Ziel hat: Medizinstudium, eine Karriere als Ärztin – ein geregeltes Leben eben. Jetzt regen sich jedoch Zweifel in ihr, ob sie das wirklich glücklich macht. Aber will sie ihre Pläne tatsächlich für eine Sommerliebe aufgeben? Als wäre das nicht kompliziert genug, verhält sich auch Maya immer seltsamer. Bis sie Rea eines Tages etwas offenbart, das ihre Freundschaft auf eine harte Probe stellt. Und das ausgerechnet jetzt, wo mit dem Ende des Ur laubs auch die Trennung von Cam naht …
Eine bewegende Liebesgeschichte vor der romantischen Kulisse Hawaiis
Von Tonia Krüger sind bei dtv außerdem lieferbar:
Love Songs in London – All I (don’t) want for Christmas (Band 1)
Love Songs in London – Here comes my Sun (Band 2)
Love Songs in London – Dancing on Sunshine (Band 3)
Love Songs in London – It’s raining Love (Band 4)
Kisses in the Snow (zusammen mit Leonie Lastella und Valentina Fast)
Tonia Krüger
Broken Heart Summer
Sunset Days
Band 1
Roman
Rea
San Francisco International Airport
Orange und weiß gestreifter Stoff wirbelt um Mayas Beine, während sie sich ausgelassen im Kreis dreht. Obwohl wir uns noch mitten in einer Boutique am Flughafen von San Francisco befinden, kann ich sie mir jetzt schon vorstellen, wie sie mit diesem Kleid an einer hawaiianischen Promenade entlangspaziert und bewundernde Blicke auf sich zieht.
Ich hingegen sitze mit mulmigem Gefühl auf einem Hocker zwischen dem Ganzkörperspiegel und dem Schuhregal, das mit sommerlichen Sandaletten bestückt ist. Nervös halte ich mein Telefon umklammert und kontrolliere alle paar Sekunden die Uhrzeit. Die fast vier Stunden Aufenthalt bis zum Boarding sind mittlerweile auf dreißig Minuten zusammengeschmolzen und während sich meine beste Freundin in Seelenruhe um die eigene Achse dreht, würde ich lieber flugbereit am Gate sitzen. Die erste Tablette gegen meine Reiseübelkeit habe ich sicherheitshalber schon vor einer Weile geschluckt und das Dimenhydrinat hat seine Wirkung in Form bleierner Müdigkeit entfaltet.
»Du siehst aus, als wärst du mein mürrischer Ehemann.« Mayas Augen blitzen. Ihr intensives Ozeanblau passt genau zu den sommerlichen Farben des Kleides. »Probier doch auch mal was an.«
»Wozu? Ich habe einen ganzen Koffer voller Klamotten dabei.«
»Einen halben.« Maya stemmt die Hände in die Hüften, wo ein schmaler Gürtel ihre Taille betont. »Unser Zelt und dein Survival-Kit nehmen doch den meisten Platz ein. Nicht zu vergessen die Büchertasche, die du als Sperrgepäck aufgeben musstest.«
»Das stimmt gar nicht.« Maya zieht mich schon den ganzen Morgen mit meiner Ausrüstung auf. Das Erste-Hilfe-Set hat sie erspäht, als ich bei der Gepäckabgabe versuchte, meine Büchertasche in den Koffer zu stopfen. Eigentlich hatte ich die als Handgepäck mitnehmen wollen, aber die Frau am Schalter hat nur den Kopf geschüttelt und auf das Maximalgewicht verwiesen. Also musste ich umräumen. War es offensichtlich, dass dies meine erste längere Reise ist? Oh, ja! War die Warteschlange furchtbar genervt von mir? Doppel-Ja. Aber was soll ich machen? Nach meinem College-Abschluss und mit dem Aufnahmebescheid der San Francisco Medical School muss ich jede Gelegenheit nutzen, mich auf mein Studium vorzubereiten.
»Wir verpassen den Flug schon nicht.« Maya entgeht offensichtlich nicht, wie ich schon wieder auf mein Handy schaue. Sie zupft den Kragen des Kleides zurecht und öffnet schließlich einen weiteren Knopf. Der Ausschnitt gibt nun den Ansatz ihrer Brüste frei, was dem eigentlich eleganten Outfit eine sexy Note verleiht. »Perfekt.« Maya knickt die Hüfte ein und blickt mich herausfordernd an. »Findest du nicht?«
Ich reiße mich zusammen und mustere sie. Ihre in einem wunderbar warmen Erdton schimmernden Haare fallen ihr locker um die Schultern. Sie hat feine Gesichtszüge, unfassbar lange dunkle Wimpern und dank ihrer zahlreichen Dance-Work-outs einen umwerfenden Körper. Ich kann nicht leugnen, dass ich mir früher neben ihr oft unscheinbar vorkam. Manchmal fragte ich mich, wie es wäre, so schön zu sein wie Maya. Aber irgendwie fühlte ich mich gleichzeitig in ihrem Schatten viel zu wohl, um ihn wirklich verlassen zu wollen.
»Wenn es heißt, dass du es endlich kaufst, finde ich das Kleid perfekt«, sage ich schließlich.
Maya verdreht die Augen. »Da spricht wieder mein mürrischer Ehemann aus dir. Deinetwegen musste ich heute so früh aufstehen. Lass mich wenigstens so viel Spaß wie möglich aus diesem Flughafenaufenthalt herausholen.«
Als Antwort seufze ich nur. Mittlerweile verschwimmt alles in der Peripherie meiner Wahrnehmung. Wahrscheinlich habe ich zu viele von den Reisetabletten geschluckt. Ich wollte einfach sichergehen, dass es reicht. Jetzt löst sich meine Nervosität langsam in Schläfrigkeit auf.
Es stimmt allerdings, dass wir meinetwegen so früh am Flughafen waren, weil ich unbedingt ausreichend Puffer bis zum Abflug einplanen wollte. Am Ende mussten wir uns stundenlang die Zeit zwischen überteuerten Shops und klimatisierten Restaurants vertreiben. Wahrscheinlich sollte ich Maya wirklich ein bisschen Spaß gönnen.
Das Problem ist, dass Maya und ich grundlegend verschiedene Vorstellungen davon haben, wie man an einem Flughafen Spaß hat. Auf Kaffee und Bagels konnten wir uns einigen. Aber danach hat Maya mich durch sämtliche Boutiquen geschleppt, um sich in immer neue Outfits zu werfen, die ich mir nicht mal im Traum leisten könnte. Allein um den Flug zu finanzieren, habe ich wochenlang Nachhilfe gegeben und Hausarbeiten korrigiert, statt für mein Studium zu lernen.
Ich fände es schöner, mich mit meinem im Handgepäck verbliebenen Lehrbuch in eine ruhige Ecke zu setzen und die Atmosphäre in mich aufzusaugen: die geschäftige Zielstrebigkeit der Reisenden, das stete Rollen der Handgepäckkoffer und die latente Rastlosigkeit der Wartenden. Ich habe mich der weiten Welt nie so nah gefühlt.
Aber Maya geht nun mal gerne shoppen. Ihre Mom Miranda hat sie schon zu Schulzeiten in Sommercamps in aller Welt geschickt und Maya kam jedes Mal mit ausgefallenen Schmuckstücken und schicken Klamotten zurück. Sie hat mal gesagt, sie wäre an einem Ort erst dann richtig angekommen, wenn sie dort etwas Hübsches gekauft habe. Ich glaube, es ist ihre Art, eine Verbindung zu fremden Umgebungen aufzubauen.
Während Maya endlich wieder in der Umkleide verschwindet, um das Kleid gegen ihre bequemen Reiseklamotten zu tauschen, verlasse ich die Boutique und warte draußen auf sie. Die klimatisierte Luft kribbelt in meinen Atemwegen. Ein Brummen hat sich in meinem Kopf festgesetzt und schluckt fast die Durchsage der Mitarbeiterin von Hawaiian Airlines, die unseren Flug aufruft.
Alarmiert sehe ich mich zu Maya um, die an der Kasse steht und mit zurückgelegtem Kopf über irgendetwas lacht, das die Verkäuferin gesagt hat. Verdammt! Ich überlege, noch mal in den Laden zu gehen und Maya anzutreiben. Wäre ich nicht so benebelt, hätte ich das wahrscheinlich längst getan, aber so beobachte ich nur, wie sie bezahlt, gleichzeitig redet und lächelt. Das ist etwas, worum ich Maya wirklich beneide: ihre einnehmende Art. Ich finde, sie ist ein bisschen wie Zitronenlimonade – frisch, spritzig und genau das, was alle wollen.
Ich hingegen finde es schwierig, andere Menschen einzuschätzen, und bin in Gesprächen selten so entspannt wie Maya. Insbesondere jetzt, da die Informationen in meinem Kopf deutlich langsamer weitergegeben werden als sonst.
Endlich kommt Maya ihre Papiertüte schwenkend aus der Boutique. Sie trägt ihre Jogginghose und ein locker fallendes weißes T-Shirt, das sie in ihrer Taille zusammengeknotet hat.
»Du bist ganz blass, Rea.« Sie hakt sich bei mir unter und zieht mich Richtung Gate. »Meinst du, es war klug, diese Tabletten zu schlucken? Du siehst nicht so aus, als ginge es dir wesentlich besser. Eher, als würdest du die nächsten fünfeinhalb Stunden durchschlafen.«
»Hoffentlich. Dann kriege ich wenigstens nicht mit, dass sich ein paar Tausend Kilometer Luft zwischen mir und dem Boden befinden.« Bei dem Gedanken wird mir flau – trotz der Tabletten.
»Aber mit wem soll ich mir dann die Zeit vertreiben?«
Ich werfe Maya einen schiefen Blick zu. »Ich wette, bis wir ankommen, hast du dich mit dem halben Flugzeug bekannt gemacht.«
»Kommt drauf an, wer unsere Sitznachbarn sind.«
Wir reihen uns in die Schlange fürs Boarding ein. Ich öffne schon mal das Ticket auf meinem Smartphone. Maya hingegen setzt ihre Wasserflasche an und trinkt mit zurückgelegtem Kopf. Mir fällt eine Gruppe junger Typen auf, die unbekümmert etwas abseits bei den Sitzbänken stehen, statt sich anzustellen. Sie lachen laut über irgendetwas, zwei rangeln miteinander. Alle drei sind braun gebrannt und wirken in ihren Shorts, T-Shirts und Flipflops, als wären sie auf dem Weg zum Strand. Wahrscheinlich sind sie das auch. Ich frage mich, ob sie Urlauber sind, die sich direkt nach der Landung auf den Weg nach Waikīkī machen werden. Einer von ihnen beobachtet Maya beim Trinken.
Maya bemerkt es auch und grinst ihn an. Er schenkt ihr ein Lächeln. Ich schätze, damit ist Mayas Board-Entertainment gesichert.
»Worauf wartest du?« Maya wirft mir einen auffordernden Blick zu und deutet mit ihrer Trinkflasche in der Hand nach vorne. »Ich dachte, du kannst es gar nicht abwarten einzusteigen. Oder bist du im Stehen eingeschlafen?«
Ertappt bemerke ich, dass sich eine Lücke zwischen mir und der Person vor mir aufgetan hat. Hastig will ich sie schließen, doch im selben Moment macht einer der jungen Männer lachend mehrere Schritte rückwärts, weil sich einer der anderen offenbar auf ihn stürzen will. Ich sehe ihn auf mich zukommen, kann aber nicht ausweichen. Meine Reflexe sind völlig außer Gefecht gesetzt. Er prallt gegen mich und bringt mich so aus dem Gleichgewicht, dass ich zu Boden getaumelt wäre, hätte Maya mich nicht aufgefangen.
»Oh, fuck! Das tut mir leid.« Er dreht sich um – sein Blick irgendwie überrascht. So leicht, wie ich weggeknickt bin, hat er wahrscheinlich ein Kind oder eine Greisin hinter sich vermutet – nicht eine zweiundzwanzigjährige angehende Medizinstudentin, die es mit dem Reisemedikament übertrieben hat. »Geht’s dir gut?«, will er wissen. Mittlerweile sieht er besorgt aus. Vermutlich, weil ich ihn so reglos anstarre. Noch immer befinde ich mich nur deshalb in aufrechter Position, weil Maya mich von hinten stützt.
»Du bist mir auf den Fuß getreten«, bringe ich hervor.
Ein amüsierter Funke blitzt in seinen braunen Augen auf. Habe ich gerade zu sehr wie ein Kleinkind geklungen? Ich lausche meinen eigenen Worten nach und versuche gleichzeitig, mich auf ihn zu konzentrieren. Er ist nicht ganz einen Kopf größer als ich, aber irgendwie fühle ich mich durch die Tabletten gar nicht richtig da und er ist im Vergleich so präsent, dass ich ein bisschen eingeschüchtert bin. Unter seinem hellgrauen T-Shirt sind kräftige Schultern und muskulöse Arme zu erkennen. Er trägt nur Shorts und mein Blick gleitet über seine gebräunten Beine abwärts. Erst bei seinen Füßen, die in ausgetretenen Bast-Flipflops stecken, wird mir bewusst, dass ich ihn anstarre. Rasch blicke ich ihm wieder ins Gesicht, wo sich mittlerweile ein ausgewachsenes Grinsen breitgemacht hat. Im Kontrast zu seinen dunklen, leicht verstrubbelten Haaren und seiner sonnengebräunten Haut blitzt in seinen Augen irgendein heller Funke. Er mustert mich erwartungsvoll. Hat er etwas zu mir gesagt?
»Äh … was?«, frage ich probehalber.
Sein belustigter Blick fliegt zu Maya. Dann sieht er wieder mich an. »Ich wollte wissen, ob dir abgesehen von deinem Fuß noch was wehtut. Du wirkst so weggetreten.«
Maya lacht auf, stellt sicher, dass ich wieder alleine stehen kann, und lässt mich los. »Keine Sorge. Sie hat ein paar Pillen eingeworfen, die sie schläfrig machen. Sonst ist alles in Ordnung.«
»Was für Pillen?« Neugierig gesellt sich der junge Mann zu uns, vor dem sein Kumpel eben zurückgewichen ist. Er ist dunkler vom Typ, hat schwarze Haare, fast schwarze Augen und wirkt nicht weniger trainiert. Wahrscheinlich alles Surfer.
»Dimenhydrinat«, erkläre ich ihm. »Das blockiert die Rezeptoren für Histamin im Gehirn und hemmt den Brechreflex. Habe ich genommen, um gleich im Flugzeug nicht alles vollzukotzen.«
Der junge Mann verzieht das Gesicht.
Mein Blick wandert unwillkürlich zu seinem Kumpel mit den braunen Augen zurück. Er wirkt noch immer amüsiert. »Dann danke, schätze ich.«
Ich nicke ihm zu, als hätte ich ihm einen persönlichen Gefallen getan. Shit, ich bin echt nicht ganz bei Sinnen. Ich habe nicht die geringste Ahnung, ob ich noch eine normale Unterhaltung führe oder schon völlig out of order wirke.
»Tut mir jedenfalls leid, dass ich dich umgerannt habe«, entschuldigt er sich nochmals. »Jay sind die Argumente ausgegangen und da musste er zu den Fäusten greifen.« Er schlägt seinem Kumpel auf die Schulter.
Jay schiebt ihn von sich. »Ist nicht so, als hättest du es nicht verdient«, brummt er, sieht dann aber mich an. »Mir tut es auch leid. Dass außer Cam jemand zu Schaden kommt, war nicht mein Plan.«
»Schon gut«, sage ich und er lächelt mir zu. Sehr gut! Ich sollte mich auf knappe Antworten konzentrieren und es ansonsten vermeiden zu sprechen. Kommunikation ist schließlich selbst im Vollbesitz meiner geistigen Kräfte nicht meine Stärke. Zumal ja ohnehin alles gesagt ist und wir endlich an Bord gehen sollten. Neben uns passieren jede Menge Leute die Ticketschranke.
Maya hat jedoch andere Pläne. Offenbar wittert sie ihre Chance, Kontakte für die Dauer des Flugs zu knüpfen. »Warum genau sollte Cam denn Schaden nehmen?«, hakt sie nach.
»Tut nichts zur Sache.« Jay winkt ab.
Cam grinst jedoch schon wieder und ich fühle mich aus irgendeinem Grund fast versucht zurückzulächeln. Dabei … Der Typ ist gut aussehend, trainiert und auf einen Flug nach Honolulu gebucht. In Gedanken ist er garantiert schon am Strand. Leute wie er blicken auf dem Weg zu Maya meistens direkt an mir vorbei. Oder rempeln mich an. Oh, sorry, hab dich gar nicht gesehen. Mit Sicherheit meint dieser Cam mit seinem Lächeln also nicht mich. »Du bist doch sonst so eine Plaudertasche«, zieht er seinen Freund auf.
»Cam hat behauptet, Jay sei Freediver geworden, weil er als Surfer mehr Zeit unter als über den Wellen verbringt.« Der blonde Typ, der Maya zuvor beobachtet hat, kommt dazu. Er hält ihr eine Hand hin. »Jared.«
»Maya. Und das ist Rea.« Sie gibt ihm die Hand, sieht aber Jay an. »Freediver? Das ist krass! Ich hab das mal im Fernsehen gesehen. Wie lange kannst du die Luft anhalten?«
»Das kommt ganz auf die Disziplin an. Meine Bestzeit liegt bei knapp zehn Minuten.«
»Echt?« Mayas Augen weiten sich beeindruckt.
»Das hat er beim Surfen gelernt.« Cam lacht, als Jay versucht, ihn in den Schwitzkasten zu nehmen.
»Falls ihr mal auf Kaua‘i seid und tauchen lernen wollt, meldet euch bei uns«, mischt Jared sich ein. »Ich kenne jede Menge Leute, die euch eine Einweisung geben können. Wenn ihr allerdings lieber Spaß haben wollt, statt unter Wasser rumzuhängen, wäre ich genau euer Mann.«
Maya wirft ihm unter erhobenen Augenbrauen einen Blick zu. »Inwiefern?«
»Ich habe eine Surfschule in Kōloa.« Er blinzelt ihr zu. »Was dachtest du denn?«
»Dass du mich zu einem Kurs im Korbflechten überreden wolltest.«
Jared lacht auf. »Korbflechten gehört nicht zu meinem ansonsten recht beachtlichen Skill-Set.«
»Angeben anscheinend schon.« Maya grinst ihn an.
Ich verdrehe die Augen. Ich kenne dieses Spiel. Diesmal stört es mich jedoch nicht, dass Maya sich in den erstbesten Flirt stürzt, der sich ihr bietet. Ich habe wirklich nicht das Gefühl, noch lange die Augen offen halten zu können.
»Wollen Sie auch an Bord?« Die Flugbegleiterin am Zugang zur Passagierbrücke lächelt uns unverbindlich zu.
»Äh … ja.« Ich stelle meinen Rucksack ab und krame hektisch darin herum, bis mir auffällt, dass ich mein Telefon mit dem Ticket schon in der Hand halte.
»Kannst du noch einen Fuß vor den anderen setzen oder soll ich helfen?« Cam schultert meinen Rucksack und reißt mich im nächsten Moment ohne Vorwarnung von den Füßen. Er hält mich mit einem Arm unter meinen Knien und einem unter meinen Achseln und trägt mich scheinbar mühelos in Richtung der Ticketschranke. Ich bin so überrascht, dass ich Sekunden brauche, um zu reagieren. Moment, das hier hätte nicht passieren sollen! Trotz meiner trägen Wahrnehmung begreife ich das langsam.
»Spinnst du?« Ärgerlich strample ich mit den Beinen. »Du kannst mich doch nicht einfach hochheben, ohne zu fragen.«
Er setzt mich zurück auf den Boden. »Ich dachte, dein Fuß tut weh.«
»Ja, aber er muss deshalb nicht gleich amputiert werden. Ich kann selbst laufen.«
»Alles in Ordnung?«, erkundigt sich die Flugbegleiterin, als ich endlich vor ihr stehe und ihr mein Smartphone präsentiere.
»Alles bestens«, gebe ich zurück, sehe mich zu Maya um, die ins Gespräch mit Jay vertieft ist, und laufe dann etwas wackelig mit einer Hand an der Reling den Tunnel zur Flugzeugtür hinunter. Es kribbelt in meinem Bauch. Und irgendwie sogar in meinem Kopf. Keine Ahnung, ob das auch am Reisemedikament liegt oder an dem verwirrenden Duft, der mir gerade in Cams Armen in die Nase gestiegen ist. Ganz leicht blumig, aber vor allem sehr frisch und ein bisschen herb. Einen Moment lang wird mein Brustkorb weit. Verdammt. Ich versuche tief zu atmen und das merkwürdige Gefühl zu ignorieren.
Ich hoffe, Cam und seine Freunde sitzen am anderen Ende der Kabine. Für Maya und mich habe ich Plätze ganz hinten gebucht, weil meinen Recherchen zufolge die Überlebenschancen dort auch bei einem Absturz am größten sind. Aber das wussten die drei wahrscheinlich nicht. Sie wirken mit ihrer lässigen Art nicht wie Leute, die sich über so was Gedanken machen.
»Warum fliegst du überhaupt, wenn dir davon so schlecht wird?« Cam holt mich nach wenigen Schritten ein.
Ich werfe ihm einen schiefen Blick zu. »Keine Sorge. Ich fliege nicht. Ich fliege nur mit.«
Er lacht auf. »Dann bin ich ja beruhigt. In deinem Zustand hätte ich sonst das Flugzeug evakuiert.«
Fast gegen meinen Willen spüre ich mich schmunzeln. »Sorry, aber ich stehe ziemlich neben mir. Das liegt an den Tabletten.«
Wie zum Beweis stoßen wir in der ovalen Öffnung zur Flugzeugkabine fast zusammen und bleiben dicht nebeneinander stehen. Da ist wieder dieser Duft! Cams Geruch ist mir definitiv zu Kopf gestiegen und ergibt zusammen mit meinen Pillen keine gute Kombi. Denn normalerweise haben Typen keinen Effekt auf mich, einfach nur, weil sie gut aussehen. Schon gar nicht, wenn alles an ihnen auch ohne Board unterm Arm Surferboy schreit.
»Kein Problem.« Er zuckt mit den Schultern und aus seinem Grinsen wird ein echtes Lächeln – seine Mundwinkel heben sich, seine Augen werden heller. »Ich finde das ehrlich gesagt ganz süß.«
Klar. Reflexartig verdrehe ich die Augen. Mich hat noch nie ein Mann als süß bezeichnet, aber kaum bin ich nicht richtig bei mir, triggere ich irgendwelche Beschützerinstinkte. Ich brauche allerdings selbst mit einer Überdosis Reisemedikament im Blut niemanden, der mich zu meinem Platz trägt.
»Willkommen an Bord. Kann ich Ihnen helfen, Ihre Plätze zu finden?« Ein höflicher Hinweis des Flugbegleiters, dass wir endlich den Durchgang für die letzten Passagiere freigeben sollen – nämlich Maya und Jay, die hinter uns drängeln.
»Wir sitzen nicht zusammen«, informiere ich ihn überflüssigerweise und betrete den Gang. Immerhin weiß ich genau, wo sich mein Platz befindet, während Cam auf seinem Ticket nachsehen muss. Insofern bekomme ich einen kleinen Vorsprung.
»Hey, warte mal. Rea, oder?« Genervt drehe ich mich um, als Cam schon wieder zu mir aufschließt. Mir ist es unangenehm genug, dass wir die Letzten sind. Dabei müsste ich mich wahrscheinlich nicht beeilen. Die meisten Reisenden sind eh noch damit beschäftigt, ihr Handgepäck zu verstauen oder ihre Zeitschriften und Tablets auszupacken.
»Brauchst du den noch oder kann der weg?« Cam deutet auf den Rucksack über seiner Schulter. Meinen Rucksack. Verdammt! Er hat mir die ganze Zeit meine Tasche getragen? Ist noch irgendwas von meinem Gehirn übrig außer Dimenhydrinat-Brei?
»Äh, ja. Den hätte ich gerne wieder.« Ich spüre, dass ich rot werde, versuche aber, es zu ignorieren. Stattdessen strecke ich die Hand aus und lasse mir von Cam meinen Rucksack geben.
»Sag mir Bescheid, falls du nach der Landung doch einen Lift brauchst.«
»Danke, aber das wird nicht nötig sein.«
»Na dann … Guten Flug. Ich hoffe, diese Pillen wirken wenigstens.« Er grinst mich noch ein letztes Mal an, ehe er sich umdreht, um zu seinem Platz weiter vorne zu gehen. Wahrscheinlich in Jays Nähe, der sich gerade in einen Sitz fallen lässt. Dabei muss Cam sich an Maya vorbeidrängen, die ihm im Gang entgegenkommt. Die beiden lächeln sich ungezwungen an.
»Treffer«, sagt sie, als sie mich erreicht. »Die Jungs sind nett. Also wird der Flug hoffentlich nicht so langweilig wie befürchtet. Was hat Cam noch gesagt?«
Ich gebe nur ein Brummen von mir und gehe weiter zu unserer Sitzreihe. »Nichts.«
»Du hast dich mit ihm unterhalten. Da wird er doch was gesagt haben.«
»Wir sind eher zufällig nebeneinanderher gegangen.« Ich quetsche mich auf meinen beengten Sitzplatz und meinen Rucksack mit einiger Mühe unter den Vordersitz. Dann schließe ich meinen Gurt, umfasse mit beiden Händen die Armstützen und lehne den Kopf zurück. Jetzt kann ich nur noch eins tun: nicht in Panik geraten, weil ein Pilot, dessen Qualifikation ich nicht kenne, für die nächsten fünfeinhalb Stunden die volle Kontrolle über mein Leben hat.
Maya beobachtet mich mit leicht schief gelegtem Kopf. »Immerhin hat er dir den Rucksack getragen.«
»Das war ein Versehen.«
»Also mir hat noch nie jemand aus Versehen meine Tasche getragen.«
»Nein, ich meinte …« Seufzend breche ich ab. »Ach, egal.«
Als sich das Flugzeug langsam rollend in Bewegung setzt, schließe ich die Augen. Maya legt sacht ihre Hand auf meine. Ihr Daumen streicht beruhigend über meine Haut.
»Keine Sorge, Rea. Du wirst eh das meiste verschlafen. Und ich passe auf dich auf.«
Träge öffne ich noch einmal die Augen und lächle ihr zu. »Okay.«
Irgendwie tut es gut, dass Maya zumindest ahnt, wie es mir gerade geht. Denn das hier tue ich nur für sie. Im Grunde kann ich mir für meine erste richtige Reise kaum etwas Gruseligeres vorstellen, als auf einem winzigen Stück Land mitten im offenen Pazifik zu landen. Die einzige Ambition, die ich je in Bezug aufs Reisen hatte, war, einmal in meinem Leben auf einen wirklich hohen Berg zu steigen – den Half Dome im Yosemite Park zum Beispiel. Mein Grandpa hat genau das getan, als er ein junger Mann und der Berg noch nicht so überlaufen war. Damals hat er fast alle großen Gipfel in den Nationalparks Kaliforniens bestiegen. Und er sagt immer: Wenn du da ganz oben stehst, alles unter dir zurücklässt und die Welt um dich vollkommen still ist, dann glaubst du zwar dem Himmel näher zu sein, aber in Wirklichkeit bist du dir selbst näher. Hawai‘i dürfte also genau der falsche Flecken Erde für mich sein.
Trotzdem sitze ich jetzt hier. Und während das Flugzeug sich mit mir in den Himmel erhebt, fängt es in meinem Bauch wieder an zu kribbeln. Doch obwohl das garantiert nur daran liegt, dass die Erde unter mir immer kleiner wird, erinnert es mich an das Gefühl, als Cam mich von den Füßen gerissen hat. Es ist, als hätte mein vernebeltes Gehirn diesen Moment in all meinen Zellen gespeichert. Wenn die Wirkung des Reisemedikaments nachlässt, wird dieser Fehler hoffentlich behoben.
Maya
Flight HA 393
Mehrfach tippe ich mit dem Finger auf das Display meines Tablets, bis es reagiert und der Film pausiert. Dann nehme ich der Flugbegleiterin zwei belegte Baguettes ab. Sie deutet auf Rea. »Während des Essens sollte sie bitte ihren Sitz hochstellen.«
»Ich kümmere mich darum.«
Ich klappe Reas Tisch runter und lege ihre Mahlzeit darauf. Dann stupse ich sie an. Rea rührt sich nicht. Was genau hat sie da bloß geschluckt? Nach dem Start vor etwa zwei Stunden ist sie in einen komatösen Schlaf gefallen. Davor hatte sie versucht, in ihrem Lehrbuch zu lesen. Es liegt noch immer aufgeschlagen auf ihrem Bauch. Ihr Kopf ist zur Seite gefallen. Ich stupse sie fester und ihr Nasenrücken kräuselt sich auf diese irgendwie anbetungswürdige Weise, mit der sie zum Ausdruck bringt, wenn ihr etwas nicht gefällt. Einen Moment lang lasse ich meinen Blick über die Konturen ihres Gesichts gleiten – den sanften Schwung ihrer Lippen, ihre hohen Wangenknochen und die über ihrer Nase verstreuten Sommersprossen. Rea hasst sie, aber ich finde, sie verleihen ihrer normalerweise so entschlossenen Miene ein bisschen Weichheit. Jetzt, da sie nach ihrer Überdosis Reisetabletten vollkommen weggetreten ist, liegt sie in den engen Sitz gekuschelt, als ginge das ganze Leben sie nichts an. Es ist ungewohnt, sie so hilflos zu sehen. In ihrem bordeauxfarbenen Hoodie versinkt sie fast. Da sie nur Shorts trägt, hat sich eine Gänsehaut auf ihren Beinen gebildet. Ihre Haare trägt sie in ihrem üblichen unordentlichen Knoten auf dem Kopf. Wie immer haben sich einige Strähnen daraus gelöst und umrahmen ihr Gesicht – leicht gewellt und in der Farbe von Honig. Reas Anblick weckt alte Erinnerungen in mir: an nie endende Sommertage, duftende Lavendelfelder, Reas Grandpa zwischen seinen Bienenstöcken, umschwärmt von den Insekten – er die Ruhe selbst, Rea und ich in sicherer Entfernung.
Rea durfte die Sommer oft bei ihren Großeltern verbringen, weil ihre Mom Carly nie Geld für Urlaube hatte. Und ich folgte ihr jedes Jahr nach Bodega, sobald ich aus den Sommercamps zurück war, zu denen Miranda mich immer schickte. Bei dem Gedanken an die kleine Farm habe ich den Geschmack des Lavendelhonigs auf der Zunge – frisch, fruchtig-süß und ein bisschen herb. Wie Rea.
Irgendwie tut es mir leid, sie wecken zu müssen. Trotzdem schüttle ich sie vorsichtig an der Schulter – dann mit mehr Nachdruck. Wieder kräuselt sich ihr Nasenrücken und sie schlägt endlich die Augen auf. Ihr Grün wirkt dunkler als sonst.
»Sind wir da?«
Ich lächle sie an. »Nein, aber es gibt Essen.«
Blinzelnd richtet Rea sich auf. Einen Moment lang mustere ich ihr blasses Gesicht von der Seite. Sie greift nach dem Baguette und zieht die Brauen leicht zusammen, während sie – wie immer, bevor sie in irgendetwas hineinbeißt – die Brötchenhälften aufklappt, um die Zutaten kritisch zu überprüfen.
»Wie viele Tabletten hast du genau geschluckt?«, erkundige ich mich schließlich.
»Zu viele«, gibt Rea seufzend zurück. »Aber immer noch besser als kotzen.« Sie beißt in ihr Sandwich.
»Ausdruck, Rea, Ausdruck.« Grinsend ahme ich Mirandas Stimme nach. Sie hat Rea oft zurechtgewiesen, als wir noch Kinder waren. Außer ihr hat nie jemand Rea davon abgehalten zu fluchen. Ihre Mom Carly kann schließlich auch ziemlich an die Decke gehen, wenn sie sich über jemanden aufregt. Doch Miranda hatte Angst, ich würde mir das irgendwann abschauen. Manchmal habe ich geflucht, nur um sie zu ärgern. Aber dann gab sie Rea die Schuld daran und verdarb mir den Spaß.
Ich packe mein Sandwich aus, nehme einen großen Bissen, ziehe meine Trinkflasche aus dem Rucksack und erstarre, als dabei auch der Brief herausfällt. Hastig bücke ich mich danach und blicke auf das dünne Papier mit dem krakeligen Schriftzug: Dr. Miranda Laurence.
»Bist du sehr nervös?« Rea sieht mich fragend an und ich schiebe den Brief rasch zurück in den Rucksack.
»Ich stelle mir lieber vor, einfach mit dir in den Urlaub zu fliegen, damit die Enttäuschung nicht zu groß wird. Es ist schließlich nicht allzu wahrscheinlich, dass seine Adresse noch dieselbe ist.«
»Immerhin haben wir einen Namen und einen Anhaltspunkt, wo wir nach ihm fragen können«, beharrt Rea. »Das ist mehr, als du jemals zu hoffen gewagt hast – angesichts der Tatsache, dass Miranda so ein Geheimnis um deinen Vater macht.«
»Wer weiß, welche Gründe sie dafür hat.« Ich trinke ein paar Schlucke und stelle die Flasche auf dem Tisch vor mir ab. »Vielleicht ist er ein Krimineller.«
Rea zieht die Augenbrauen zusammen. »Du hast dir dein Leben lang einen Helden vorgestellt, aber ausgerechnet jetzt glaubst du, er ist ein Krimineller?«
Seufzend schüttle ich den Kopf. »Nein, natürlich nicht. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Ich hoffe einfach, es wird mein Ende vom Regenbogen sein.«
Rea wirft mir einen forschenden Blick zu – wie immer, wenn sie sich fragt, ob ich etwas ernst meine. Diesmal bin ich mir selbst nicht sicher. Ich denke an mein absolutes Lieblingskinderbuch, das Carly uns bestimmt einige Tausend Mal vorlesen musste – über die kleine Ella, die gesagt bekommt, am Ende vom Regenbogen liege ein Schatz verborgen. Daraufhin zieht sie los, ihn zu finden. Immer wieder habe ich Carly gefragt, ob es stimme, ob es am Ende des Regenbogens wirklich einen Schatz gebe. Und sie sagte: Am Ende des Regenbogens findest du das, was du dir am meisten wünschst.
Von da an hoffte ich bei jedem Regenbogen, den ich sah, an seinem Ende würde mein Dad warten. Irgendwie denke ich das noch heute. Bisher habe ich das Ende vom Regenbogen nur nicht erreicht.
»Diesmal jagen wir nicht das Ende vom Regenbogen, Maya«, dringt Reas Stimme durch meine Gedanken. Sie hat ihr Brötchen nur halb gegessen und legt es zur Seite. »Diesmal haben wir eine echte Spur.«
Das klingt noch immer unvorstellbar. In den nächsten Tagen könnte ich zum ersten Mal in meinem Leben vor meinem Vater stehen. Dem Mann, über den meine Mutter nie sprechen wollte. Und ich frage mich vor allem eins: Werde ich ihm ähnlich sein?
Mit Miranda habe ich nichts gemeinsam – nichts, was uns verbinden könnte, weder optisch noch in anderer Hinsicht. Mit sechzehn war ich so überzeugt davon, dass Rea und ich von unseren Müttern vertauscht worden sind, dass ich heimlich DNA-Proben eingereicht habe. Selbst als das Ergebnis da war, habe ich mich gefragt, ob es vielleicht einen Laborfehler gegeben hat. Aber jetzt habe ich es schriftlich: Miranda Laurence ist meine Mutter. Dabei würde Rea viel besser zu ihr passen – abgesehen vom Fluchen natürlich. Sie ist genauso entschlossen, genauso zielstrebig, genauso schnell im Kopf, genauso arbeitsam. Warmherziger natürlich, einfühlsamer, sensibel und manchmal sogar verletzlich. Aber dass Rea sich entschieden hat, wie meine Mutter Ärztin zu werden, hat mich in eine echte Krise gestürzt. Irgendwie machte es die Differenzen zwischen Miranda und mir noch sichtbarer. Machte noch deutlicher, wie ich eigentlich hätte sein müssen, um Mirandas Erwartungen zu erfüllen – um von ihr geliebt zu werden.
Mittlerweile hat Rea ihren Bachelor in Biologie gemacht. Ab Herbst wird sie zur Med School gehen. Meine Mutter hat sie unterstützt, ihr bei den Bewerbungen geholfen. Mein Literaturstudium hält sie für Zeitvertreib. Ich ehrlich gesagt auch. Offiziell bin ich zwar eingeschrieben, aber die meiste Zeit jobbe ich in Cafés, träume von meiner eigenen Bar am Strand und bin eine Enttäuschung für Miranda. Die Wahrheit ist: Ich bin nicht wie Rea. Ich weiß einfach nicht, was ich will. Oder wer ich überhaupt bin. Wie auch, wenn ich gar nicht weiß, woher ich komme.
Miranda hat natürlich kein Verständnis für meine Orientierungslosigkeit. In ihrer Vorstellung weigere ich mich bloß, das College mit so guten Noten wie Rea abzuschließen, um sie zu erpressen. Nach dem Motto: Ich versaue aus Prinzip mein Leben, wenn du mir nicht sagst, wer mein Vater ist.
Ich spüre, wie sich meine Hände zu Fäusten ballen. Wie immer, wenn ich an Miranda denke, sehe ich nicht nur sie, sondern auch eine gewaltige Leerstelle. Wie immer macht ihr Schweigen mich wütend. Wie immer macht ihr Mangel an Interesse mich traurig. Und wie immer will ich nichts davon sein. Vor allem jetzt nicht. Dennoch spüre ich das Brennen auf meiner Haut – wie meistens, wenn ich angespannt bin.
Dass ich mittlerweile eine Spur von meinem Dad habe, ahnt Miranda nicht. Sie weiß nicht mal, dass ich im Flugzeug nach Honolulu sitze.
Immerhin ist Rea da. Und sie bemerkt offenbar, wie es mir geht. Tröstend legt sie die Arme um mich und ihren Kopf an meine Schulter. »Ich kann dir nicht versprechen, dass wir Alex finden. Oder dass er wirklich dein Dad ist. Aber irgendetwas werden wir über ihn herausfinden.«
Bewusst entkrampfe ich meine Hände und bringe ein Lächeln in ihre Richtung zustande. Was ich jetzt brauche, um mich besser zu fühlen, ist Ablenkung. Positive Gefühle als Blitzableiter für meine innere Anspannung. Hier im Flugzeug sind die Möglichkeiten allerdings begrenzt, sodass meine Gedanken doch wieder zu dem Moment abschweifen, in dem ich den Brief in Mirandas Unterlagen fand. Auf rätselhafte Weise habe ich sofort gespürt, dass er mein Leben verändern wird. Er hat sich in meinen Händen viel zu schwer für das dünne Papier angefühlt. Außerdem lag er in Mirandas abgeschlossener Schreibtischschublade ganz unten. Sie hat mir nur verraten, wo ich den Schlüssel finde, weil ich meinen verlorenen Reisepass neu beantragen musste, dringend meine Geburtsurkunde brauchte und Miranda nicht zu Hause war. Dem Poststempel nach ist der Brief schon fünfzehn Jahre alt. Bestimmt hat sie ihn längst vergessen.
LiebeMira. Ich kenne niemanden, der Miranda so nennt. Obwohl es über sieben Jahre her ist, dass wir zusammen waren, kann ich die Monate mit dir nicht vergessen. Ich denke immer noch oft an dich. Außerdem fällt es mir schwer, mir jemanden vorzustellen, der so liebevolle Worte an meine Mutter richtet. Aber sie hat den Brief aufbewahrt. Er muss ihr etwas bedeutet haben. Erst später, als ich das Haus verlassen wollte, fing ich im Kopf an zu rechnen. Fünfzehn Jahre. Und dieser Alex hat geschrieben, dass ihre Beziehung über sieben Jahre her war. Ich habe dich gegoogelt und anscheinend bist du als Ärztin richtig erfolgreich geworden. Mich wundert das nicht. Du warst schon damals brillant!
Minutenlang stand ich wie erstarrt auf den Treppenstufen vor der Villa. Mir wurde erst heiß, dann kalt. Schließlich ging ich zurück ins Arbeitszimmer und nahm den Brief mit. Ich habe Rea in der Bibliothek gefunden, in der sie meistens sitzt und lernt, und ihr den Brief gezeigt. Ich bin mir nicht sicher, ob ich dir so viel bedeutet habe wie du mir. Aber ich glaube, ich habe hier einen Ort gefunden, an dem ich mich zu Hause fühle. Ich glaube, ich werde hierbleiben. Und du sollst wissen, wie und wo du mich erreichen kannst, falls du das jemals willst.
»Denkst du, Miranda hat ihm geantwortet?«, habe ich Rea gefragt.
Sie hat lange gezögert. Ich glaube, sie hat den Brief genauso oft gelesen wie ich. »Das kann ich mir nicht vorstellen«, hat sie irgendwann gemeint. »Falls er dein Dad ist und Miranda nicht will, dass ihr voneinander wisst, wird sie ihn nicht kontaktiert haben.«
Rea begriff natürlich sofort, dass ich in Alex meinen Vater vermutete. Ich musste gar nichts sagen. Sie klappte ihren Laptop auf und recherchierte, bis sie einsah, dass der Name Alex Atwood einfach zu geläufig ist. »Wenn du mehr über ihn rausfinden willst, musst du zu der Adresse fahren.«
Neben mir schlägt Rea ihr Lehrbuch auf und reißt mich damit aus meinen Gedanken. Sie starrt eine Weile auf eine komplexe Abbildung und blättert schließlich um. Ich bezweifle, dass sie diesmal länger durchhält als vorhin.
Die Flugbegleiterin kommt erneut vorbei, um unseren Müll einzusammeln. Jared geht schon wieder Richtung Toilette. Der Typ hat entweder eine schwache Blase oder er will mich in ein weiteres Gespräch verwickeln. Vorhin hat er mich zu überreden versucht, mit ihm und seinen Kumpels Karten zu spielen. Ehrlich gesagt wäre das genau das, was ich jetzt brauche. Aber Rea dämmert bereits mit ihrem Buch in der Hand weg, also werde ich sie nicht allein hier sitzen lassen. In ihrem Zustand würde sie ja nicht mal mitkriegen, wenn sie ausgeraubt oder begrapscht wird.
Außerdem ist ihr Kopf an meine Schulter gesunken und ich schätze, dort wird sie ihren Pillenrausch nun ausschlafen. Ich lächle Jared also unverbindlich zu, stecke mir die In-Ears in die Ohren und lasse den Film auf meinem Tablet weiterlaufen. Tief atme ich ein. Reas Duft nach dem leichten Lavendelaroma ihres Shampoos steigt mir in die Nase. Das stellen ihre Großeltern auf der Farm selbst her. Schlagartig entfaltet der Geruch seine Wirkung auf mich. Wann immer ich die Tür zu Reas und Carlys Wohnung öffne, empfängt er mich. Er ist mein Zuhausegefühl.
»Hi.«
Ich blicke auf und bin überrascht, dass nicht Jared, sondern Cam vor mir steht.
»Hey.« Sofort ziehe ich mir die In-Ears aus den Ohren. »Willst du mich auch überreden, mit euch Karten zu spielen?«
»Nein, keine Sorge.« Er lehnt sich mit der Hüfte gegen den freien Sitz vor mir, verschränkt die Arme vor der Brust und macht mit dem Kinn eine Bewegung in Reas Richtung. »Ich wollte nur mal sehen, ob die Tabletten wirken. Ist mit ihr alles in Ordnung? Sie scheint sich ernsthaft abgeschossen zu haben.«
»Hast du das vorhin noch nicht gemerkt?« Ich drehe den Kopf, um Rea anzusehen. Sie regt sich kurz, schläft aber weiter. Der Lavendelduft ihrer honigfarbenen Haare wird intensiver.
»Schläft sie immer mit Buch?«
Plötzlich habe ich das Gefühl, Rea in ihrer verletzlichen Situation vor Cams Neugier schützen zu müssen. Ich werfe ihm einen langen Blick zu. »Ich halte es für unwahrscheinlich, dass du das jemals herausfinden wirst.«
Ein Lächeln fliegt über sein Gesicht. »Jemand, der sein Brechzentrum mit Pillen deaktiviert und den Wirkstoff kennt, schläft bestimmt mit Büchern unterm Kopfkissen.«
»Und du?«, gebe ich zurück. »Schläfst du mit einem Surfbrett unterm Kopfkissen?«
Er grinst. »Ohne das Kopfkissen.«
»Verstehe. Bist du Surfer aus Hawai‘i? Oder bist du auf dem Weg nach Hawai‘i, um zu surfen?«
Er verschränkt seine Arme vor der Brust. »Wir waren bei den US Open of Surfing in Huntington Beach.«
»Bist du angetreten?«
Sacht schüttelt er den Kopf. »Wettkampf ist nicht so mein Ding.«
Irgendwie macht ihn das sympathisch. In der Welt, in der ich aufgewachsen bin, gilt Ehrgeiz als eine Tugend, mit der ich noch nie etwas anfangen konnte.
Er zuckt mit den Schultern. »Es war ganz cool, aber ich freue mich auf zu Hause.«
»Und wo genau ist das?«
»Kaua‘i. Aber auf dem Weg machen wir einen Zwischenstopp und holen jemanden ab. Und was führt euch nach Honolulu?«
Ich hebe die Schultern. »Urlaub, Strandbars, Cocktails.«
Er runzelt die Stirn. »Wenn ihr glaubt, exotische Cocktails, Blütenkränze und Hula-Musik seien alles, was Hawai‘i zu bieten hat, täuscht ihr euch. Das ist das Geringste, was ihr dort finden werdet.«
»Tatsächlich?« Rea regt sich an meiner Seite, doch ich blicke weiter zu Cam. »Vielleicht willst du uns die weniger offensichtlichen Highlights zeigen?«
»Kein Problem. Manchmal jobbe ich bei Kaua‘i Local Guides.«
Grinsend hebe ich die Augenbrauen. »Wir können dich also buchen?«
Er lacht leise auf. »Ihr könnt es zumindest versuchen. In erster Linie bin ich Rettungsschwimmer. Mit den geführten Touren verdiene ich mir nur hin und wieder was dazu.«
»Rettungsschwimmer?« Ich werfe ihm einen nun doch beeindruckten Blick zu und wette, den erntet er öfter. »Wie in ›Baywatch‹?«
»Ohne die Zeitlupen natürlich. Wir sind deutlich schneller.«
Bestimmt hat er diesen Satz nicht zum ersten Mal gesagt. »Dann kannst du uns sicher die schönsten Strände zeigen, oder?«
»Wenn ihr nach Kaua‘i kommt, klar.« Sein Blick fliegt zu Rea, als ihr Buch zu Boden rutscht und sie sich schlagartig aufrichtet. »Oh, es lebt«, zieht er sie auf.
Rea gibt nur ein Brummen von sich und taucht im Fußraum ab, um ihr Buch aufzuheben.
»Cam hat angeboten, uns die schönsten Strände von Kaua‘i zu zeigen«, fasse ich unser Gespräch für sie zusammen.
Rea zieht ihre Füße an, dreht uns den Rücken zu und lehnt ihren Kopf gegen die Kabinenwand. »Wir haben doch gar keine Zeit für den Strand.«
Cam hebt die Augenbrauen und blickt in meine Richtung. »Urlaub, Bars und Cocktails, aber keine Zeit für den Strand?«
Mit einem Lächeln setze ich mir die In-Ears wieder ein. »Du musst ja nicht alles wissen.«
Rea
Daniel K. Inouye International Airport, O‘ahu
Ich bin immer noch benommen. Und froh, dass ich kurz vor der Ankunft keine weitere Tablette geschluckt habe, obwohl ich plötzlich Angst hatte, dass die Wirkung nachlässt. Aber Maya hat mir das Pillenröhrchen förmlich aus der Hand gerissen.
Mittlerweile stehen wir stumm mit den Mitreisenden um das knarzende Gepäckband und warten auf das Eintreffen der Koffer. Der Flughafen wirkt zunächst schmucklos – niedrige Decken, endlose geflieste Flure, klimatisierte Luft. Doch nach und nach entdecke ich erste Details, die verraten, dass wir auf einer hawaiianischen Insel gelandet sind – Blumen und andere Pflanzen in langen Rabatten, Fotografien von traumhaften Stränden und Küstenlinien und auf nahezu jedem Werbeplakat ein Aloha.
Dazu passt auch Mayas mit Palmenmotiven bedruckter Trolley, den sie wahrscheinlich extra für diese Reise gekauft hat und der gerade über das Band rollt.
Ich dagegen bin mit meiner alten Reisetasche unterwegs. Ich liebe das Teil mit den bunten Streifen, weil es mich an die Sommer bei meinen Großeltern erinnert. Abgesehen davon, dass die Rollen mittlerweile ziemlich in Mitleidenschaft gezogen sind, ist sie noch in gutem Zustand. Meine Mom hat schon immer Dinge gekauft, die lange Haltbarkeit versprechen.
Glücklicherweise entdecke ich meine Tasche bald und wuchte sie vom Band. Meine Bücher folgen kurz darauf. Als ich mich suchend nach Maya umdrehe, steht sie schon beim Durchgang zur Ankunftshalle und unterhält sich mit Jared. Seine Kumpels sind nicht zu sehen.
Ich frage mich, wann wir uns endlich von ihnen verabschieden können. Die Jungs sind ja ganz nett, aber zum Schnorcheln oder Flirten sind wir nun mal nicht hergekommen.
Ich folge Maya und Jared in die Ankunftshalle, wo wir uns durch eine dicht gedrängte Masse Wartender schlängeln. Doch ich ignoriere die ungewohnte Umgebung und richte meinen Fokus stattdessen auf die vor mir liegende Aufgabe: Maya nicht verlieren, den Flughafen verlassen, den Mietwagen abholen. Rasch schließe ich zu ihr auf.
»Wir müssen rüber zur Autovermietung. Ich habe angegeben, dass unser Flug um vierzehn Uhr landet.«
»Nur keine Eile.« Jared lacht. »Hawai‘i, Baby. Island Time.«
»Island Time?«
Er zuckt mit den Schultern. »Eine halbe Stunde hat man immer.«
Maya lacht. »Ich fühle mich jetzt schon wohl.«
Das kann ich mir vorstellen. Dennoch strebe ich mit meinem Gepäck Richtung Ausgang und hoffe, dass sie mir folgt.
Vor dem Flughafen empfangen mich feuchte Hitze und grelles Licht. Dass ich mit meinem warmen Hoodie viel zu dick angezogen bin, kann ich endgültig nicht mehr ignorieren. Wahrscheinlich bin ich die letzte verbliebene Person an diesem Flughafen, die mehr als ein luftiges Kleid oder ein Top zu kurzer Hose trägt.
Ich schiebe die Reisetasche an die Seite, stelle meine Büchertasche daneben und setze meinen Rucksack ab. Dann befreie ich mich aus dem Pullover und binde ihn mir um die Hüften. Anschließend ziehe ich meine Fliegersonnenbrille aus dem Rucksack und versuche Luft zu holen. Mein Brustkorb fühlt sich zu eng an. Wie immer, wenn ich gestresst bin. Ich atme tiefer, aber der Widerstand bleibt. Nach dem langen Flug müsste ich dringend laufen – wenigstens eine kurze Runde, um die Luft tief in meine verkrampfte Lunge zu zwingen. Aber das ist keine Option. Island Time hin oder her. Entschlossen zücke ich mein Smartphone, um mich zu orientieren.
Über uns dröhnt der Verkehr eines Highways. Darunter liegen die Haltebuchten für Taxis, Shuttles und Busse im Schatten.
Ich schaue mich nach der Ausschilderung zur Mietwagenfirma um, als mir Cam ins Auge fällt. Er steht mit seinem Rucksack einige Meter entfernt bei Jay. Jared und Maya gesellen sich gerade zu ihnen. Auch Cam lässt seinen Blick suchend schweifen und einen winzigen Moment lang frage ich mich, ob er zwischen den Reisenden nach mir Ausschau hält. Sofort setzt dieses Kribbeln in meinem Bauch wieder ein, versetzt meinen ganzen Körper in Alarmbereitschaft, als müsste ich gleich eine wichtige Prüfung schreiben. Dann läuft Cam jedoch los und schlingt seine Arme um eine junge Frau, die sich seiner Gruppe von der anderen Seite mit zwei Gehhilfen nähert. Das Kribbeln hört so schlagartig auf, dass alles in mir synchron ins Stocken gerät. Einen Moment lang kann ich den Blick nicht von den beiden abwenden. Ich höre die Frau lachen, weil Cam sie von den Füßen hebt und herumwirbelt – anscheinend ist das so ein Ding von ihm. Eine Krücke fällt zu Boden, aber als er die junge Frau wieder absetzt, hält sie sich an ihm fest, statt sich danach zu bücken.
Ich versuche wirklich, nicht zu starren. Schließlich gehen sie mich nichts an. Aber da keiner von ihnen Anstalten macht, die Krücke wieder aufzuheben, sehe ich doch immer wieder hin. Die Gehhilfe liegt mitten im Weg. Am liebsten würde ich sie wegräumen, damit niemand darüberstürzt.
Cam redet ungeachtet des Hindernisses auf die junge Frau ein, bis sie ihm lachend die Haare verwuschelt. Eine vertraut wirkende Geste. Dennoch bin ich mir nicht sicher, was zwischen den beiden läuft. Geküsst haben sie sich jedenfalls nicht.
Verdammt! Ich sollte überhaupt nicht darüber nachdenken. Und trotzdem gleitet mein Blick prüfend an der Frau abwärts. Sie ist hübsch, mit ihrem runden, ebenmäßigen Gesicht und ihren glatten, schwarzen Haaren, die ihr fast bis zur Taille reichen. Da sie nur mit einem blumenbedruckten, bauchfreien Top sowie Shorts zu weißen Sneakern bekleidet ist, sehe ich auf einen Blick, dass sie keine Bandagen, Gelenkstützen oder Schienen trägt. Worin wohl ihre Verletzung besteht?
Dankenswerterweise kommt Maya endlich zu mir und reißt mich aus meinen Gedanken. »Jared fragt, ob wir noch mit nach Waikīkī kommen. Was hältst du von einem kleinen Umweg?«
»Muss das sein? Ich bin todmüde, wir müssen den Mietwagen holen, quer über die Insel zum Campingplatz fahren, das Zelt aufbauen und was zu essen auftreiben. Das alles schaffen wir doch so schon kaum, bis die Sonne untergeht.«
Maya verdreht die Augen. »Es wäre aber schön, mit ein paar Mai Tais darauf anzustoßen, dass wir hier sind. Und ich bin gespannt, wie die Jungs versuchen werden, uns zu überzeugen, dass Hawai‘i mehr als nur Cocktails am Strand zu bieten hat.«
»Das können wir auch selbst rausfinden.«
»Na gut.« Maya seufzt tief. »Du scheinst heute noch einen straffen Zeitplan zu haben.«
»Wir sollten uns einfach beeilen, bevor unsere Reservierung verfällt. Ich habe ewig auf so ein günstiges Mietwagenangebot gewartet.« Ich greife nach meiner Tasche, sehe mich um und entdecke endlich den Pfeil in Richtung der Autovermietung. »Wir müssen da lang.«
Maya bleibt einfach stehen. »Wir können doch nicht abhauen, ohne uns zu verabschieden.«
Ich hebe die Augenbrauen. »Wir kennen diese Typen nicht mal. Nur mein Fuß weiß, wie viel Cam ungefähr wiegt.«
»Ach, Rea! Wir haben uns nett unterhalten und sie haben uns eingeladen. Jetzt werden wir uns nicht einfach davonschleichen.« Sie ergreift meinen Arm und zieht mich mit sich zurück zu den drei jungen Männern und der Frau, die mittlerweile zwischen den anderen steht.
»Hey.« Maya schiebt sich zwischen Jared und Jay. »Wir haben für Waikīkī leider keine Zeit.«
»Wo müsst ihr denn so dringend hin?« Jared wirft mir einen ärgerlichen Blick zu, weil er wohl richtig vermutet, dass ich diejenige bin, die den Ausflug verhindert hat.
»Bis ganz an die Westspitze«, antworte ich.
»Das ist am anderen Ende der Insel.« Die junge Frau sieht mich neugierig an. Auch Cam mustert mich, aber ich erwidere seinen Blick bewusst nicht. Er hat mich heute schon genug aus dem Konzept gebracht. »Touristinnen verirren sich da nicht so oft hin. Was wollt ihr da?«
»Campen«, erkläre ich. Dass ich uns vor allem einen Zeltplatz reserviert habe, weil ich mir die anderen Unterkünfte hier niemals leisten könnte, erwähne ich nicht.
Die schwarzhaarige Frau nickt sofort. »Es ist wahnsinnig schön da draußen. Vielleicht seht ihr sogar Albatrosse. Was mich betrifft, ist Waikīkī sehr weit unten auf der Liste meiner Lieblingsstrände.«
»Aber auf meiner ist Waikīkī weit oben«, protestiert Jared.
»Zugebaut, touristisch und meistens überfüllt«, zählt sie auf.
Jared grinst. »Eben.«
Sie verdreht nur die Augen und wendet sich wieder an uns. »Zelten am Strand ist traumhaft. Ich tue das viel zu selten, seit ich in Honolulu wohne. Ich bin übrigens Iris.« Sie reicht uns ihre freie Hand.
Maya ergreift sie. »Ich bin Maya. Und das ist Rea.« Sie deutet auf mich, ehe sie fragt: »Kommst du auch ursprünglich von Kaua‘i?«
Iris nickt. »Ich studiere hier. Aber mein letzter Kurs endet morgen und dann fliege ich mit den anderen rüber nach Hause. Wollt ihr auch noch nach Kaua‘i?«
Ich schüttle den Kopf. »Wahrscheinlich nicht.«
»Vielleicht«, sagt Maya gleichzeitig.
»Solltet ihr«, wirft Cam ein. »Wie gesagt, Hawai‘i hat einiges mehr zu bieten als Cocktails am Strand – besonders Kaua‘i.«
»Stimmt, das wolltest du uns ja noch zeigen.« Maya wirft ihm ein Lächeln zu, aber sein Blick gleitet zu mir.
Das ist so ungewöhnlich, dass ich nicht anders kann, als es zu bemerken. Er grinst mich an und ich bin froh, mich hinter meiner Sonnenbrille verstecken zu können. Angesichts der Hitze dürfte ich außerdem sowieso schon rot im Gesicht sein. Also muss ich keine Angst haben, dass er merkt, wie verlegen er mich macht. Insbesondere, weil Iris neben ihm steht und ich keine Ahnung habe, ob die beiden ein Paar sind.
»Wir müssen jetzt erst mal unser Auto abholen«, sage ich – vor allem, um Maya daran zu erinnern.
»Meldet euch bei mir, wenn ihr surfen wollt«, fordert Jared uns auf. »Oder schnorcheln. Ich kenne die besten Plätze.«
Jay verpasst ihm eine Kopfnuss. »Jeder von uns kennt die besten Plätze.«
Jared reibt sich den Kopf. »Gibst du mir trotzdem deine Nummer?«, fragt er Maya. Ich bin immer wieder überrascht, wie direkt manche Menschen sind.
Maya schiebt sich mit einem unbeeindruckten Lächeln ihre Oversize-Sonnenbrille auf die Nase. »Keine Sorge. Falls ich nach Kaua‘i komme und dich finden will, werde ich das auch.« Sie grüßt in die Runde, als verabschiedete sie sich von alten Bekannten. Iris und Jay wünschen uns einen schönen Urlaub. Ich blicke zu Cam. Durch die Gläser meiner Sonnenbrille wirken seine Augen dunkler. Es macht mich nervös, als er mich anlächelt. »Ich hoffe, deinem Fuß geht’s besser.«
»Alles gut.« Ich greife nach meinen Taschen.
»Und deinem Kopf?« Cam tippt sich kurz an die Stirn.
»Mittelmäßig. Die Wirkung lässt langsam nach.« Irgendwie bin ich froh, dass ich ihn und die anderen nie wiedersehen werde. Es ist mir unendlich peinlich, dass alle mitbekommen haben, wie sehr mich dieses Medikament ausgeknockt hat. Rasch wende ich mich ab, ehe Cam noch etwas sagen kann.
Maya legt mir vergnügt ihren freien Arm um die Schultern, als wir uns endlich unter der Unterführung hindurch auf den Weg in Richtung Autovermietung machen. »Wir sind in Hawai‘i! Ist das nicht unglaublich?«
Ich werfe einen Blick über die Schulter. Es ist keine bewusste Entscheidung. Mein Körper tut es einfach. Und … Shit! Cam sieht immer noch in unsere Richtung. Iris stößt ihn gerade mit dem Ellenbogen an, aber er ignoriert sie. Sein Lächeln wird breiter und er hebt eine Hand in meine Richtung. Hastig wende ich mich wieder ab.
»Was ist?«, will Maya wissen. »Hast du Angst, dass sie uns folgen?«
»Quatsch! Ich habe nur … Ich habe mich nur umgesehen, weil wir in Hawai‘i sind und das so unglaublich ist.«
Maya lacht. »Als ob! Aber ich bin froh, dass wir es geschafft haben.«
Über uns dröhnt der Verkehr. Schweißtropfen bilden sich an meinen Schläfen und zwischen meinen Brüsten. Die Luft fühlt sich so heiß und feucht an, dass ich sie kaum atmen kann. Aber in dem schmalen Streifen zwischen der Hochstraße und dem Gebäude der Autovermietung blitzt blauer Himmel hervor. Und in einem der Sträucher neben dem Eingang hüpfen graue Finken mit rosafarbenen Schnäbeln herum.
Ich lächle Maya an und ihre Augen blitzen ungefähr so blau wie der Himmel über uns. »Ich bin auch froh«, sage ich.
Wolkenkratzer ragen mit ihren im Sonnenlicht blinkenden Fassaden in den strahlend blauen Himmel. Niedrige Bäume mit üppigen Kronen säumen die Straßen. Während ich Maya durch den Verkehr leite, wünschte ich, ich hätte etwas mehr Zeit, meine Umgebung genauer zu betrachten: die breiten Straßen, die Passanten in Flipflops, die grelle Sonne. Maya steuert den Wagen auf den Highway und dann weiter Richtung Nordwesten. Aus den glänzenden Wolkenkratzern werden eintönige Hochhäuser. Fasziniert stelle ich fest, dass die überall wachsenden Palmen die Gebäude mit ihren fleckigen Fassaden und winzigen vollgekramten Balkonen weniger trist aussehen lassen, als sie normalerweise gewirkt hätten.
Der Highway windet sich als gewaltiges zehnspuriges Ungetüm durch dicht bewachsene Täler und über buckelige Hügel. Hier fließt der Verkehr ruhiger, sodass ich mehr Gelegenheit habe, die Landschaft vor den Fenstern unseres Jeeps zu betrachten. Bald werden die letzten Wohnkomplexe vom üppigen Grün verdrängt, das sich über steil aufragende Berge bis in den tiefblauen Himmel zieht – gewaltige Gipfel mit faltigen Hängen. Bestimmt gibt es Wanderwege hinauf. Ich weiß, wir sind nicht meinetwegen hier. Trotzdem hoffe ich, wir werden die Chance haben, wenigstens einmal einen der Berge zu besteigen.
Während der Highway immer schmaler wird und bald als zweispurige Straße kleine Ortschaften durchschneidet, stemme ich meine nackten Füße gegen das Armaturenbrett und sehe zu, wie die Sträucher am Straßenrand zurückweichen und den Blick auf Felder mit Ananas und Zuckerrohr freigeben.
»Cam hat zwar behauptet, Hawai‘i habe viel mehr zu bieten als exotische Cocktails, Blütenketten und Hula, aber so ganz kann ich das nicht glauben«, sagt Maya irgendwann. »Hier sind bloß Wiesen und Hügel. Wo sind denn die Strandbars?«
»Am Waikīkī Beach?«
»Warum sind wir dann nicht dort?« Wehmütig blickt Maya nach draußen. Wilde grüne Hecken ziehen vorbei. »Wie weit ist es vom Campingplatz bis zum nächsten Stra–?«
»Stopp!«, rufe ich im selben Moment und Maya tritt schlagartig auf die Bremse. »Hier musst du rein.«
»Himmel! Hättest du mich nicht etwas früher warnen können?« Maya lenkt den Jeep in eine sandige Einfahrt und hält vor einem Gitter. Dahinter öffnet sich der Blick auf eine Wiese mit vereinzelten Bäumen und etwas Buschwerk. Einige runde Canvaszelte auf Holzpodesten gruppieren sich davor. Weiter hinten blitzt hell das Sonnenlicht auf dem Meer.
»Vom Zeltplatz bis zum Strand?« Ich wiege den Kopf. »Zwanzig Meter?«
Camp Mokulē‘ia, O‘ahu
Sie schmeckt anders als zu Hause – die Luft hier. Eine Mischung aus weicher Süße und dem herben Salz des Meeres breitet sich auf meiner Zunge aus. Ich habe den Pazifik nie gemocht und gehe nicht gerne an den Strand. Im Ozean gebadet habe ich, glaube ich, noch nie. Hätte ich mir etwas anderes als diesen Campingplatz direkt am Ufer leisten können, hätte ich nicht mal Maya zuliebe hier gebucht. Aber jetzt … jetzt verändert diese ganz besondere Mischung irgendetwas in mir. Der Widerstand in meinem Brustkorb, gegen den ich fast immer anatmen muss, fühlt sich nachgiebiger an.
Maya sitzt neben mir und wir graben beide unsere nackten Zehen in den heißen Sand. Nur wenige Schritte vor uns rollt der Pazifik heran – in einem kraftvollen, aber trotzdem irgendwie gemächlichen Rhythmus. Das Meer ist geflutet vom schweren rotgoldenen Licht der untergehenden Sonne. Die Dunkelheit breitet sich bereits im Buschwerk aus – den Fächerblumen, die als einzige zwischen unserem Zelt und dem Ozean wachsen. Zwar habe ich eins meiner Lehrbücher auf den Knien, aber zum ersten Mal seit – Keine Ahnung! Monaten? Jahren? – verspüre ich nicht das Bedürfnis hineinzusehen. Die Fremdheit der Insel fühlt sich gerade viel bedeutsamer an.
Maya legt ihren Kopf an meine Schulter. »Das ist also die Antwort.«
»Welche Antwort?«
»Warum wir hier sind und nicht am Waikīkī Beach. Es ist unfassbar schön.«
Maya hat recht. Der Strand zieht sich in einem weiten Halbkreis um die Bucht und wir sind die Einzigen hier, die beobachten, wie sich der Himmel in immer dunklere Garderoben wirft – von kräftigem Orange bis hin zu dunklem Violett. Das Meer leuchtet im Kontrast dazu silberhell, als hätte es sich vollgesogen mit dem Licht des Tages.
Meine Mom hasst die See. Sie geht nie auch nur in die Nähe eines Strandes und hat mir Hunderte Male eingeredet, vorsichtig zu sein, dem Meer nicht zu trauen. Aber jetzt frage ich mich, ob sie es jemals so gesehen hat – so ruhig und weich und schimmernd. Das Rollen der Wellen ans Ufer ist wie der starke, stetige Schlag eines Herzens.
Ich sauge die seidig warme Luft noch tiefer ein. Denke an die bunten Vögel, die am Abend in den Kronen der Bäume flatterten und uns frech vom Picknicktisch neben unserem Zelt beobachteten. An den leicht ätherischen Duft des Holzes und die Wärme der Sonne auf meiner Haut. Ich weiß nicht, ob ich meine Umgebung jemals so intensiv wahrgenommen habe.
Maya schlingt die Arme um ihre angezogenen Knie. »Unglaublich. Das sind höchstens zehn Meter von unserem Zelt bis zum Strand. Und wir haben ihn auch noch ganz für uns allein. Selbst wenn wir keine Spur von Alex finden und einfach wieder nach Hause fahren müssen, hat sich die Reise hierfür schon gelohnt.«
Sie sieht mich an, während die Sonne über dem Horizont zu einem glühenden Kegel wird, auf einen Punkt zusammengeschmolzen aufleuchtet und dann untergeht. Maya holt tief Luft. »Lass uns schwimmen gehen.«
Unbehaglich setze ich mich zurecht. »Du weißt doch, ich gehe nicht ins Meer. Und du solltest das auch nicht tun. Hier kann es tückische Strömungen geben.«
»Na gut, es muss ja nicht sofort sein. Aber ich habe mir etwas überlegt. Du bist mit mir hergekommen, aber warum soll nur ich etwas davon haben? Das Wasser hier ist garantiert warm und wunderbar und voller tropischer Fische. Das ist die perfekte Gelegenheit für dich, endlich deine Angst zu überwinden.«
»Mal sehen.«
»Überleg es dir. Du willst doch nicht ewig nur in Bibliotheken hocken, oder? Das Leben hat so viel mehr zu bieten. Wenn du das Meer immer meidest, verpasst du was, glaub mir.«
Damit hat Maya vielleicht recht. Aber ehrlich gesagt gehe ich davon aus, dass ich in meinem zukünftigen Leben den Großteil meiner Zeit in der Bibliothek, der Uni und später der Klinik verbringen werde. Wozu sollte ich mich also überwinden, mich mit dem Meer anzufreunden? Ich werde gar keine Zeit haben, mich irgendwo an einen Strand zu setzen.
Maya lässt sich rückwärts in den feinen Sand fallen. Ich lege mich neben sie. Während der nächsten halben Stunde wird mein Atem ruhiger und tiefer. Ich spüre ihn fast bis in meinen Bauch. Immer mehr Sterne erstrahlen über uns – das funkelnde Gewand der Nacht.
»So nah war ich den Sternen noch nie.« Mayas Stimme ist nur ein Flüstern – kaum hörbar über der schläfrigen Brandung. Und ich glaube, ich weiß, was sie meint. Ich habe den Eindruck, ich könne den Arm heben und den Himmel berühren. Wie es sich wohl anfühlt, bei Nacht auf einem Berg zu stehen? Würde man die Höhe noch spüren, wenn man sie nicht mehr sieht?
»Zumindest wirkt es so«, sage ich leise, »als wären wir den Sternen näher.«
»Vertrau mir, Rea«, wispert Maya. »Wir sind es.« Ich spüre ihre tastende Hand an meiner und erwidere ihren Händedruck. »Danke, dass du mit mir hergekommen bist.«
»Klar.«
»Das ist nicht selbstverständlich und ich weiß das. Du hast bisher jeden Cent in dein Studium gesteckt. Und du hast Angst vorm Meer. Aber jetzt investierst du all dein Geld in Flüge und Campingplätze und reist mit mir auf eine Insel, damit ich das hier nicht allein tun muss.«
»Und damit ich den Sternen näher bin.« Ich lächle, als ich spüre, dass Maya mich von der Seite ansieht.
»Ja«, sagt sie schließlich.
Wieder atme ich tief ein. Irgendetwas an diesem Duft von Meer und Nacht gibt mir das Gefühl, das erste Mal in meinem Leben genug Luft zu bekommen. Es fühlt sich an wie heute Vormittag mit Cam, als ich seinen Geruch eingeatmet habe und meine Lunge einen Moment lang ganz weit und durchlässig wurde. Shit!
Schlagartig setze ich mich auf. Wieso muss ich jetzt an Cam denken? Ich meine, selbst wenn sein Lächeln und seine neugierigen Fragen so eine Art Flirten sein sollten, müsste mich das kaltlassen. Ich kenne doch diese unbekümmerten Ich-nehm-das-Leben-locker-Typen von den Partys, auf die Maya mich schleppt. Jungs, die immer ein Grinsen im Gesicht und einen Spruch auf den Lippen haben. Die sind normalerweise gar nicht mein Fall, weil ich nun mal ganz anders bin.
Aber gut. Ich war heute wirklich nicht zurechnungsfähig. Das Dimenhydrinat muss bewirkt haben, dass irgendetwas in mir falsch programmiert wurde. Solche Flashbacks hatte ich nämlich bislang bei noch keinem Mann. Ich bin Kopfmensch. Ich konzentriere mich auf meine Fachbücher und spüre meinen Körper eigentlich nur, wenn ich abends über die Golden Gate Bridge renne, bis mein Herz hämmert und meine Muskeln schmerzen. Und das ist gut so.
Aber als ich jetzt auf der Suche nach einer Ausflucht aus meinen Gedanken in den Himmel blicke, wird alles in mir zu einem verrückten Mix aus Sternen und Bauchkribbeln. Und auf mir unbegreifliche Weise fühlt sich das plötzlich sogar schön an. Ich bekomme Lust, die Arme auszubreiten und über den Strand zu rennen – so wie früher über die Lavendelfelder meiner Großeltern. Einfach so zum Spaß.
»Was ist?«, fragt Maya mich.
»Nichts«, sage ich. Denn ganz ehrlich: Ich habe keine Ahnung, wie ich meine Empfindungen gerade in Worte fassen sollte. Mit klopfendem Herzen lasse ich mich zurücksinken – als wäre ich tatsächlich gerannt und hätte es mir nicht nur vorgestellt.
Pearl Harbor, O‘ahu
Es ist bereits kurz nach Mittag, als wir am nächsten Tag an einem Kai in Pearl Harbor stehen. Obwohl die Hitze mit der ganzen Kraft der äquatorialen Sonne auf meiner Haut brennt, läuft mir ein Schauer über den Körper. Der tiefblaue Himmel, das glitzernde türkisfarbene Wasser, die Palmen und weißen Gebäude stehen in scharfem Kontrast zu den gewaltigen grauen Kriegsschiffen, die in der Battleship Row