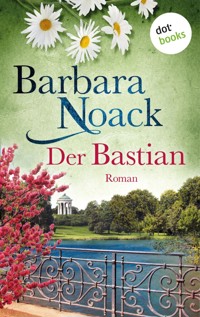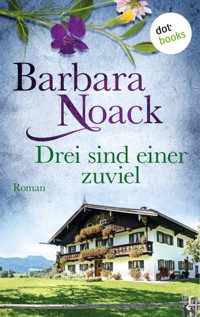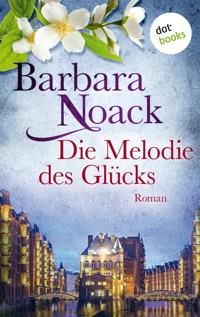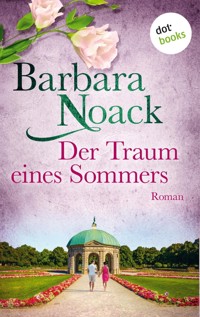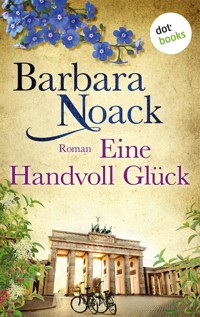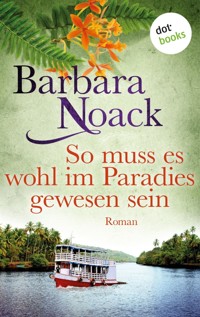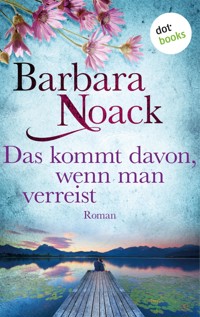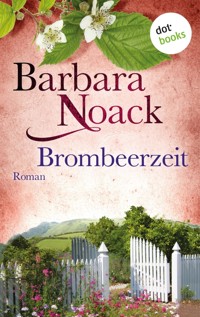
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: dotbooks Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Eine Frau, die das Leben ganz neu entdeckt: "Brombeerzeit" von Barbara Noack jetzt als eBook bei dotbooks. "Man wünscht sich immer das, was man nicht hat. Und wenn man's dann hat, ist es längst nicht so reizvoll, wie man es sich vorgestellt hat." Ihr Leben als Unternehmerin hat Viktoria voll und ganz ausgefüllt – doch nun möchte sie etwas Neues erleben: Sie verkauft ihr Lebenswerk, um endlich ihre Freizeit zu genießen! Doch das ist leichter gesagt als getan, denn statt Meetings wartet nur langweiliges Vormittagsprogramm, die Freunde sind mit sich selbst beschäftigt und neue männliche Bekanntschaften sind auch nicht immer so erquicklich wie erhofft. Doch die neugewonnene Freiheit hält so einige Überraschungen für Viktoria bereit – und auch für die Liebe braucht man manchmal nur ein wenig Geduld … Jetzt als eBook kaufen und genießen: "Brombeerzeit" von Barbara Noack. Wer liest, hat mehr vom Leben: dotbooks – der eBook-Verlag.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 258
Veröffentlichungsjahr: 2016
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Über dieses Buch:
»Man wünscht sich immer das, was man nicht hat. Und wenn man’s dann hat, ist es längst nicht so reizvoll, wie man es sich vorgestellt hat.« Ihr Leben als Unternehmerin hat Viktoria voll und ganz ausgefüllt – doch nun möchte sie etwas Neues erleben: Sie verkauft ihr Lebenswerk, um endlich ihre Freizeit zu genießen! Doch das ist leichter gesagt als getan, denn statt Meetings wartet nur langweiliges Vormittagsprogramm, die Freunde sind mit sich selbst beschäftigt und neue männliche Bekanntschaften sind auch nicht immer so erquicklich wie erhofft. Doch die neugewonnene Freiheit hält so einige Überraschungen für Viktoria bereit – und auch für die Liebe braucht man manchmal nur ein wenig Geduld …
Über die Autorin:
Barbara Noack, geboren 1924, hat mit ihren fröhlichen und humorvollen Bestsellern deutsche Unterhaltungsgeschichte geschrieben. In einer Zeit, in der die Männer meist die Alleinverdiener waren, beschritt sie bereits ihren eigenen Weg als berufstätige und alleinerziehende Mutter. Diese Erfahrungen wie auch die Erlebnisse mit ihrem Sohn und dessen Freunden inspirierten sie zu vieler ihrer Geschichten. Ihr erster Roman »Die Zürcher Verlobung« wurde zweimal verfilmt und besitzt noch heute Kultstatus. Auch die TV-Serien »Der Bastian« und »Drei sind einer zu viel«, deren Drehbücher die Autorin verfasste, brachen in Deutschland alle Rekorde und verhalfen Horst Janson und Jutta Speidel zu großer Popularität.
Barbara Noack veröffentlichte bei dotbooks bereits ihre Romane »Der Bastian«, »Danziger Liebesgeschichte«, »Drei sind einer zuviel«, »Brombeerzeit«, »Das Leuchten heller Sommernächte«, »Die Melodie des Glücks«, »So muss es wohl im Paradies gewesen sein«, »Jennys Geschichte«, »Der Duft von Sommer und Oliven«, »Der Zwillingsbruder«, »Das kommt davon, wenn man verreist«, »Auf einmal sind sie keine Kinder mehr«, »Was halten Sie vom Mondschein?«, »Valentine heißt man nicht«, »Der Traum eines Sommers« und »Eine Handvoll Glück« sowie »Ein Stück vom Leben«, die auch im Doppelband »Schwestern der Hoffnung« erhältlich sind. Auch bei dotbooks erschienen ihre Erzählbände »Flöhe hüten ist leichter«, »Eines Knaben Phantasie hat meistens schwarze Knie« und »Ferien sind schöner« sowie der Sammelband »Valentine heißt man nicht & Der Duft von Sommer und Oliven«.
***
eBook-Neuausgabe Juni 2016
Copyright © der Originalausgabe 1992 Langen Müller in der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München
Copyright © der Neuausgabe 2016 dotbooks GmbH, München
Alle Rechte vorbehalten. Das Werk darf – auch teilweise – nur mit Genehmigung des Verlages wiedergegeben werden.
Titelbildgestaltung: Nele Schütz Design unter Verwendung von shutterstock/Jill Lang
eBook-Herstellung: Open Publishing GmbH
ISBN 978-3-95824-511-2
***
Liebe Leserin, lieber Leser, wir freuen uns, dass Sie sich für dieses eBook entschieden haben. Bitte beachten Sie, dass Sie damit ausschließlich ein Leserecht erworben haben: Sie dürfen dieses eBook – anders als ein gedrucktes Buch – nicht verleihen, verkaufen, in anderer Form weitergeben oder Dritten zugänglich machen. Die unerlaubte Verbreitung von eBooks ist – wie der illegale Download von Musikdateien und Videos – untersagt und kein Freundschaftsdienst oder Bagatelldelikt, sondern Diebstahl geistigen Eigentums, mit dem Sie sich strafbar machen und der Autorin oder dem Autor finanziellen Schaden zufügen. Bei Fragen können Sie sich jederzeit direkt an uns wenden: [email protected]. Mit herzlichem Gruß: das Team des dotbooks-Verlags
***
Wenn Ihnen dieser Roman gefallen hat, empfehlen wir Ihnen gerne weitere Bücher aus unserem Programm. Schicken Sie einfach eine eMail mit dem Stichwort »Brombeerzeit« an: [email protected] (Wir nutzen Ihre an uns übermittelten Daten nur, um Ihre Anfrage beantworten zu können – danach werden sie ohne Auswertung, Weitergabe an Dritte oder zeitliche Verzögerung gelöscht.)
***
Besuchen Sie uns im Internet:
www.dotbooks.de
www.facebook.com/dotbooks
blog.dotbooks.de/
Barbara Noack
Brombeerzeit
Roman
dotbooks.
Kapitel 1
Der Karikaturist Hans Karlow hatte seinen sechzigsten Geburtstag in einem Kreuzberger Lokal gefeiert und dazu all seine Freunde und Bekannten eingeladen. Ein rauschendes Fest bis in den nächsten Morgen, fast wie in den frühen fünfziger Jahren, als unsere Freundschaft begann.
Ich war solche Orgien nicht mehr gewöhnt und auch nicht daran, am nächsten Tag mit einem solchen Schädel herumzulaufen. Ach Gott, es ging mir ja so schlecht. Aber schadete mir gar nichts, warum bin ich so lange geblieben.
Es war auch ein Wiedersehen mit den Kumpanen unserer verräucherten, durchdiskutierten Nächte. Wie oft hatte ich damals den letzten Bus verpaßt und in Karlows ausgekühltem Atelier übernachten müssen, in einem alten, angesengten Ledersessel, der nie aufhörte, wie Bombenangriff zu riechen. Auf der einzigen Matratze schlief Karlow selber mit Elfriede Grün.
Gestern Abend hatte ich manchmal Mühe gehabt, mich an die Jugendgesichter der ehemaligen Freunde zu erinnern. Kneipenleben und Enttäuschungen hatten zu viele Spuren in ihnen hinterlassen.
Die wenigsten hatten die große Karriere geschafft, von der wir damals gemeinsam träumten. Bei einigen spürte ich, sie wollten aus Selbstschutz nicht wissen, wie es mir inzwischen ergangen war, und vor allem wollten sie nicht nach ihrem eigenen Lebenslauf gefragt werden.
Während der Nacht wechselte ich mehrmals die Tische, an denen man zusammenrückte, damit ich mich dazusetzen konnte. Auf einmal saß ich Egon Wohlfahrt gegenüber. Er rückte an seiner Brille mit den verschmierten, dioptrienreichen Gläsern. Während er mich beobachtete, deklamierte er mittelalterlich:
»Owê, war sint verswunten alliu mîniu jâr?
Ist mir mîn leben getroumet od ist ez wâr?«
Professor Egon Wohlfahrt. Er war fünfundzwanzig Jahre älter als ich und ein beeindruckender Mann gewesen. Was habe ich seinetwegen für Liebeskummer durchgemacht. Meinen jungen Körper hatte er sehr genossen, seinem Intellekt jedoch war ich auf die Dauer zu unreif und unergiebig gewesen, weshalb er sich einer Dramatikerin zugewandt hatte, die seine geistigen Ansprüche zu befriedigen verstand. Wohlfahrt war Junggeselle geblieben. Er war noch immer fünfundzwanzig Jahre älter als ich und somit inzwischen ein sehr alter Mann.
Erst gegen sechs Uhr früh hatte ich mein Hotelzimmer betreten, das ich zwei Stunden später schon wieder verlassen mußte, um der Urnenbeisetzung meiner Cousine Annemarie auf dem Steglitzer Friedhof beizuwohnen. Außer mir war nur Annemaries Lebensgefährte erschienen, mit dem ich anschließend in ein Café gegangen war. Ich hatte ihn trösten müssen, weil er nun niemand mehr hatte, der ihn bekochte, seine Hemden bügelte und die halbe Miete bezahlte. Die ganze war ihm zu teuer. Entweder mußte er sich was Kleineres suchen oder untervermieten. Aber dann fiel ihm ein, daß ihm Annemarie einmal Fotos von meinem Nymphenburger Häuschen gezeigt hatte, das war doch viel zu groß für mich allein, seit die Kinder nicht mehr bei mir wohnten. Es würde ihm nichts ausmachen, von Berlin nach München umzusiedeln, nein, wirklich nicht, ich sei ihm sympathisch, er könne ja erst mal auf Besuch zu mir kommen, ich müsse ihm nur rechtzeitig genug mitteilen, wann es mir paßt, damit er einen Flug zum Super-flieg-und-Spartarif bestellen konnte. Als Herr Matzke – so hieß er – auch noch auf seine sexuelle Rüstigkeit zu sprechen kam, rief ich: »Zahlen, bitte«, und ließ ihn vor einem halbgegessenen Nußhörnchen sitzen.
So ein Mistkerl, dachte ich im Taxi zum Hotel. Annemarie hat sich in ihrer Urne unter der Erde noch nicht mal eingelebt, da versucht ihr langjähriger Lebensgefährte bereits, seine Pantoffeln bei der nächsten Dame unterzustellen.
***
Kurz vor zwölf kehrte ich in mein Hotelzimmer zurück, packte die Reisetasche und warf einen sehnsüchtigen Blick auf das Bett, in dem ich in den zwei Morgenstunden höchstens siebenundvierzig Mark achtzig vom Zimmerpreis abgeschlafen hatte.
Im selben Augenblick, als ich aus dem Lift in die Hotelhalle trat, kam Hans Karlow von der Straße herein. Trotz seines Trenchcoats, der so aussah, als ob er ihn auf einer Parkbank gefunden hätte, wo ihn ein Penner hatte liegen lassen, weil er ihm zu schäbig geworden war, musterten ihn zwei weibliche Hotelgäste mit kurz aufflackerndem Interesse.
Ich sah ihn zuerst und hob die Hand. Er kam auf mich zu. Bei seinem Anblick fiel mir ein, daß Elfriede Grün, die Maskenbildnerin, vor sechsunddreißig Jahren bei seinem Anblick ausgerufen hatte: »Was für ein muskulöser Mann!« Drei Monate später war sie von ihm schwanger gewesen.
»Viktörchen«, seine Begrüßungswange war kühl und glattrasiert, »das ist das Erstaunliche an uns beiden. Selbst wenn wir uns nicht verabreden, sind wir auf die Minute pünktlich.«
»Schön, daß du noch gekommen bist«, freute ich mich.
»Schön, daß du gestern Abend da warst«, sagte er. »Ich hatte viel zu wenig Zeit für dich.«
»Wie solltest du auch bei so vielen Gästen.«
»Eben. Da habe ich mir gedacht, fahr mal zu ihrem Hotel. Vielleicht ist sie noch da.« Er sah mich prüfend an. »Geht’s dir schlecht?«
»Warum?«
»Wegen der Sonnenbrille.«
»Wenn du wüßtest, wie es dahinter aussieht! Seit Jahren habe ich nicht so gesumpft wie heute Nacht, und dann der Qualm und bloß zwei Stunden Schlaf!«
»Mach dir nichts draus. Ich sehe auch ramponiert aus«, lachte er.
»Wenigstens bist du frisch rasiert. Dazu bin ich heute Morgen leider nicht gekommen.«
»Dein Bart hat mich noch nie gestört«, versicherte er und fletschte die Zähne. »Sitzt mein Gebiß richtig?«
»Das schon, aber dein Toupet ist verrutscht.«
Neben uns wartete ein Ehepaar auf den Lift. Ihre Blicke waren dem Dialog gefolgt – zuerst auf mein Kinn, dann auf seine Zähne und endlich auf sein schütteres, graues Haar. Es war ein altes Spiel aus Jugendtagen: mit ernsthaft vorgetragenen Blödeleien fremde Leute zu irritieren. Es paßte nur nicht mehr so ganz zu unserem jetzigen Alter.
»Aber laß mal, für deine siebzig siehst du noch immer ganz proper aus«, versicherte ich, ihn unterhakend. »Ißt du ein Süppchen mit mir?« Und als er auf dem Weg zum angrenzenden Restaurant verstimmt vor sich hin schwieg, ahnte ich: »Mit den Siebzig bin ich zu weit gegangen.«
»Oh ja. Ich habe schon Schwierigkeiten genug, mich mit der Sechzig abzufinden.«
Wir fanden einen freien Tisch mit Blick auf den verregneten Kurfürstendamm, setzten uns einander gegenüber, sahen uns aus übernächtigten Augen an. Kannten uns sechsunddreißig Jahre, vergaßen uns manchmal monatelang, aber sobald wir uns begegneten, setzte die starke Sympathie füreinander wieder ein.
Zusammen jung gewesen zu sein, empfanden wir als ein Privileg. Die Bindung aneinander war intensiver als die bei später geschlossenen Freundschaften. Die gemeinsame Armut damals, der heftige Spaß am Leben nach den Kriegs- und Hungerjahren danach, die Spannung auf dieser politisch brisanten Insel Berlin inmitten der Sowjetzone, die uns geistig nicht bequem werden ließ – und vor allem, wir zwei hatten das erreicht, was wir uns einmal vorgenommen hatten: beruflich Karriere zu machen. Wir hatten eine ungetrübte Nostalgie miteinander.
Ich bestellte eine Bouillon mit Ei und Karlow ein Bier für seinen Nachdurst.
»Jetzt sag, wie hat dir mein Fest gefallen. Hast du dich gut amüsiert?«
»Wie Bolle«, versicherte ich ihm. »Der Mann am Klavier und der Drehorgelspieler, die alten Bekannten und überhaupt, interessante Leute. Du bist zu beneiden um deine vielen Freunde.«
»Es waren sogar solche da, denen ich seit Jahren Geld schulde oder die Frau ausgespannt habe. Oder beides.«
»Wie machst du das? Wieso verzeiht man dir immer wieder?«
Er grinste achselzuckend, während er sich über das Brot und die Näpfchen mit Butter und Schmalz hermachte, die der Ober auf den Tisch gestellt hatte. »Man verzeiht mir eben lieber, als daß man auf meine Gesellschaft verzichtet. Ich bin ja auch ein irre netter Kerl.« Er bestrich eine Scheibe Zwiebelbrot dick mit Schmalz, streute Salz darauf und reichte sie über den Tisch: »Komm, iß, Kind. Nach einer durchsumpften Nacht braucht der Magen was Deftiges.« »Schmeckt köstlich«, kaute ich, »aber nun erzähl mal. Du hast eine neue Freundin.«
»Hat sie dir gefallen?«
»Wir haben uns nur kurz unterhalten. Eine gescheite Person. Und so herzlich. Wie alt?«
»Naja«, er grinste ebenso verlegen wie geschmeichelt. »Sie ist drei Jahre jünger als meine Tochter Anna mit Elfriede Grün.« »Oh!«, entfuhr es mir, und dann fragte ich nach Anna. »Ich habe sie gestern Abend vermißt.«
»Sie war auch nur kurz da. Ihr Baby hatte Durchfall.« »Das heißt, du bist inzwischen Opa geworden.«
Das Wort Opa behagte ihm nicht. »Mit Anna ist es nicht so einfach«, sagte er dann. »Sie hat immer Pech mit Männern. Irgendwann hat sie Torschlußpanik gekriegt. Sie wollte unbedingt ein Kind, um einen Lebensinhalt zu haben. Dazu hat ihr ein Philosophiestudent verholfen.« Karlow schmierte sich nun auch ein Brot. »Noch bevor das Baby da war, hat er sein Studium abgebrochen und ist in die Lüneburger Heide gezogen, um Schäfer zu werden. Wir haben seitdem nichts mehr von ihm gehört.«
»Arme Anna«, sagte ich.
Und er: »Wieso arm? Sie hat ihr Baby. Mehr wollte sie nicht von ihm.« Er legte das Messer aus der Hand. »Ihr ist die Wohnung gekündigt worden. Jetzt wohnt sie mit dem Schreihals bei uns. Wir haben kein Privatleben mehr.«
Der Ober brachte meine Bouillon und Karlows Bier. Und als er gegangen war, sagte ich: »Deine Freundin muß dich sehr lieben, wenn sie das alles mitmacht.« Karlow lachte: »Ja, das muß sie wohl, denn auf mein Minuskonto bei der Berliner Bank hat sie es bestimmt nicht abgesehen.« Er löschte seinen Nachdurst mit einem großen Schluck, setzte das Glas ab und sah mich an. »Ich weiß, was du jetzt denkst, Viktörchen. Der riesengroße Altersunterschied zwischen uns. Aber vergiß nicht, auch du hast mal einen viel älteren Mann geliebt.«
»Du meinst den Wohlfahrt. Ich hätte mich am liebsten umgebracht, als er mich damals verlassen hat – ich wußte nur nicht, wie. Und dann habe ich ihn gestern Abend zum ersten Mal wiedergesehen. Stell dir vor, er hätte mich damals geheiratet, und wir wären zusammengeblieben. Dann hätte ich jetzt einen Greis als Mann! Aber so weit denkt man nicht, wenn man jung ist.«
»Komm, trink deine Bouillon, sonst wird sie kalt«, sagte er gereizt.
Und da begriff ich und versicherte ihm, daß ich wirklich nur Professor Wohlfahrt und mich gemeint hatte, nicht ihn und seine dreiunddreißig Jahre junge Geliebte. »Ich schwör’s dir!«
Er war nun sehr nachdenklich. »Mir wär’s auch lieber, sie wäre Mitte Vierzig.«
»Also nur fünfzehn Jahre jünger als du.«
»Warum lachst du?«
»Ach, ich habe mir gerade vorgestellt, ich hätte heute einen fünfzehn Jahre jüngeren Geliebten.«
»Na und? Warum hast du nicht?«
»Weil ich in jeder Frau, die jünger und knackiger ist als ich, eine Rivalin befürchten würde. Weißt du, was eine Frau alt macht? Wenn ihr junger Lover sie wegen einer Jüngeren sitzen läßt.«
Karlow sagte: »Auch Menschen, die im Alter zueinander passen, trennen sich eines Tages.«
»Das ist ein anderer Schmerz.«
»Nein. Das tut genauso weh, wenn man der Verlierer ist.«
»Ich freu mich für dich. Du hast dir durch dieses Mädchen deine Jugend zurückgeholt. Gibt es was Schöneres?«
Er nahm meine Hand und legte sie kurz an seine Wange. »Manchmal glaube ich, wir zwei – du und ich – sind nur aus Versehen alt geworden.« Und gab mir meine Hand zurück. »Was ist mit dir? Lebst du allein?«
»Nach Peter – du kennst ihn ja – ist mir keiner mehr begegnet, der mir gefallen hätte. Man wird auch irgendwann so mißtrauisch. Wenn sich jemand an mich herangemacht hat, war’s meistens einer, der seine eigenen Schwierigkeiten bei mir unterbringen wollte. Und Probleme hatte ich selber genug. Oder er wollte durch mich eine Rolle kriegen. Oder in die Firma einsteigen. Nein, Hänschen. So allein war ich nie, um einen großen Fehler zu machen … « Ich brach ab, irritiert durch den langen, zärtlichen Blick, mit dem er mich betrachtete. »Ist was?«
»Du hast noch immer dein Mädchengesicht«, sagte Karlow.
Das machte mich verlegen und ein bißchen glücklich. Beinahe hätte ich »danke« gesagt.
Und dann fiel ihm ein, daß ich ihm gestern Abend, beim Anstehen am Büfett und Warten auf Bouletten mit Kartoffelsalat, vom Verkauf meiner TV-Firma erzählt hatte. »Sag mal, ist das wirklich wahr?«
»Ja. Vorgestern, bevor ich nach Berlin geflogen bin, habe ich meinen Schreibtisch geräumt und tränenreichen Abschied gefeiert.«
Das konnte er nicht verstehen. »Es lief doch alles gut bei dir. Die Firma war dein Lebensinhalt.«
»Sie war auf dem besten Wege, mich umzubringen. Was glaubst du, wie schwierig es für uns kleinere Produzenten geworden ist. Und dann kam auch noch ein Tiefschlag nach dem andern – ach, ich mag jetzt nicht drüber reden. Ich bin so froh, den ganzen Streß los zu sein.«
Karlow sah mich überlegend an. »Und glaubst du, daß du ohne leben kannst? Die Arbeit hat dir doch auch Spaß gemacht. Du hattest Erfolge.«
»Sogar Preise. Aber man muß im richtigen Moment aufhören können.« Ich sah ihn warnend an. »Mach mir bitte jetzt keine Vorwürfe! Ich habe schon genug gehört. Anscheinend gönnt mir keiner ein Privatleben.«
»Und was willst du damit anfangen?«, erkundigte er sich interessiert.
»Endlich mal das tun, wozu ich nie gekommen bin.« »Tu’ste ja doch nicht«, versicherte er mir. »Je mehr man Zeit hat, umso mehr läßt die Aktivität nach. Alte Tatsache.« Er lehnte sich steif zurück – ich sah seiner Miene die schmerzende Bandscheibe an. Die Schäden hatte er sich wohl bei seiner einzigen sportlichen Betätigung geholt: Wein- und Wasserkisten fünf Stockwerke hoch in sein Atelier zu stemmen, denn in dem hundert Jahre alten Kreuzberger Mietshaus, das er von einem Onkel geerbt hatte, gab es keinen Aufzug.
»Es geht dir nicht gut mit deinem Rücken«, sagte ich. Und er: »Manchmal bleibe ich unten in der Kneipe sitzen aus Furcht vor den fünf Treppen hoch zum Atelier.«
»Du hast immer einen Grund gefunden, in der Kneipe sitzen zu bleiben«, fiel mir ein.
»Vielleicht tausche ich jetzt mein Atelier gegen eine Wohnung im ersten Stock. Ein steiler Absturz. Statt Himmel und Dächern habe ich dann parkende Autos vorm Fenster. Ach, Viktörchen«, er seufzte laut, »hast du dir damals vorstellen können, daß wir zwei auch mal alt und lahm werden?«
»Nein, nie! Ich habe immer geglaubt, so was passiert nur andern.«
»Wie alt war Heinz, als er gestorben ist?« »Achtundvierzig. Ich habe jetzt viel an ihn denken müssen«, sagte ich, meine Bouillon auslöffelnd. »Ich habe mir oft vorgestellt: Wenn du so weitermachst, fällst du eines Tages auch tot um. Und dazu habe ich wirklich noch keine Lust. Naja, mal sehen, wie es weitergeht. Jetzt bin ich erst einmal unendlich froh, die Firma los zu sein. Zu denen, die immer schuften müssen, um sich glücklich zu fühlen, habe ich sowieso nie gehört.«
Dann wurde es für mich Zeit aufzubrechen, und Karlow winkte dem Ober.
Beim Verlassen des Restaurants brachte er seine Hand auf meiner Schulter unter. Es sah so aus, als ob wir zusammengehörten, und es war mir sehr angenehm. Hans Karlow – er war ein Lebenskünstler mit abenteuerlicher Biographie, aber er strahlte Schutz aus. Von einigen Tischen sah man uns nach. Wir waren ein attraktives älteres Paar.
»Bringst du mich noch zum Bus? Ich muß nach Zehlendorf.«
»Wieso nimmst du kein Taxi mit der schweren Tasche?«, die er noch trug.
»Weil ich mir angewöhnen muß, daß ich von jetzt an Taxiquittungen nicht mehr steuerlich absetzen kann. Hab ja keine Firma mehr.«
An der Haltestelle warteten mehrere Rentnerinnen, im Regenwind mit ihren Schirmen kämpfend.
Nach zwei Bussen kam endlich der richtige.
»Am Roseneck mußt du umsteigen«, sagte Karlow und zog einen schwarzen Seidenschal aus seiner Manteltasche.
»Den hätte ich beinah vergessen«, freute ich mich. »Ich hab ihn noch gar nicht vermißt!«
»Er hing über dem Stuhl, auf dem du zuletzt gesessen hast.« Karlow legte ihn mir um den Hals und zog mich mit beiden Enden nah an sich heran. »Mach’s gut, Viktörchen, bis zum nächsten Mal.«
»Du auch. Mach’s gut.« Und ließ mich von ihm auf beide Wangen küssen. Keine der üblichen Bussi-Umarmungen, sondern der Abschied von zwei Freunden, zwischen denen eine tiefe Sympathie füreinander nie ihren amourösen Zauber verloren hat.
Karlow stand noch da und regnete ein, als ich hinter den Rentnerinnen mit ihren zugeklappten Schirmen aufs Einsteigen wartete. »Flieg vorsichtig, hörst du?«, sagte er hinter mir her. »Und laß dich unterwegs von keinem Kerl ansprechen. Du weißt, man kann heute niemandem mehr trauen.«
»Blödmann«, lachte ich zurück.
***
Der Mann rechts neben mir hatte schon ein paar Bierchen getrunken, bevor er zum Flughafen gefahren war, und erzählte nun Geschichten von seinen Schlittenhunden. Nicht alle Passagiere, die bereits seit zwanzig Minuten über die planmäßige Abflugzeit hinaus aufs Einsteigen in die letzte Maschine nach München warteten, freuten sich über sein lautes Mitteilungsbedürfnis, vor allem diejenigen nicht, die lesen oder ihre Akten durcharbeiten wollten wie mein linker Sitznachbar. Er war in einen Ordner mit Grundbuchauszügen und Anwaltsbriefen vertieft. Es ging um ein Haus in Potsdam, und es ging da hoch her zwischen Alt- und Neubesitzern, wie ich feststellen konnte, indem ich ein bißchen mitlas.
Einige dösten vor sich hin. Nur der Hundebesitzer dröhnte munter. Er fuhr gerade mit seinen sieben Huskies zu einem Schlittenrennen über Land. Er hatte sie hinten in seinem Lieferwagen untergebracht. Als er am Zielort ankam, war keiner mehr drin. Er hatte vergessen, die hintere Autotür richtig zuzusperren – da war er vielleicht erschrocken. Es brauchte Tage, um die sieben wieder einzufangen. Nach ihren über mehrere Vorstädte verteilten Fundorten zu schließen, waren sie an jedem längeren Ampelrot nacheinander ausgestiegen. Den letzten fand er per Annonce eine Woche später auf dem Sofa eines älteren Ehepaares wieder.
Endlich wurde die Maschine zum Einsteigen freigegeben. Ich richtete mich auf meinem Fensterplatz ein und freute mich auf Schlaf. Endlich schlafen dürfen – und schloß gleich die Augen, um ja keine Minute zu verlieren. Es tat mir leid, Berlin bereits nach anderthalb Tagen zu verlassen. Aber ich konnte ja nun wiederkommen, wann immer ich wollte. Es gab keine Pflichten und Termine mehr, die mich am privaten Reisen hinderten.
»He, junge Frau, Verzeihung, wenn ich störe, aber könn’ Se vielleicht Ihre Tasche runternehmen? Det is mein Platz.«
Es handelte sich um einen jungen Mann mit Zweitagebart und einem Ringelchen im Ohr. Er beanspruchte den Mittelsitz, den Gang- und Fensterpassagiere gerne als Ablage benutzen.
Ich räumte meine Tasche zwischen meine Beine. Kaum saß der Mensch, begann zwischen unseren Ellbogen der Kampf um die schmale Lehne. Gleichzeitig wurde auf dem Mittelsitz hinter mir die wohlbekannte Stimme des Schlittenhundbesitzers laut. Er stellte sich seiner Platznachbarin, einer alten Dame, als Obermayr vor, Mayer ohne e mit y. Darauf sie, durch seine in einem Flieger ungewohnt joviale Begrüßung irritiert: »Aha.«
Aber das hielt ihn nicht davon ab, eine Unterhaltung zu beginnen. Ob sie auch Bekannte in Berlin besucht habe. Nein, sie wohne in Berlin. Ost oder West? Kurzes: West. Dann besuche sie vielleicht Bekannte in Bayern? Nein. Sie führe zur Kur nach Bad Wörishofen. Wörishofen! Das kannte er. Da war seine Cousine Masseurin. »Aber warum fliegen S’ dann bei der Nacht, wo doch kein Zug nicht mehr nach Wörishofen fahrt?« Und die Dame, schon sehr belästigt durch seine Fragerei: »Ich übernachte bei meiner Tochter in München.«
Im selben Augenblick kam die erste Durchsage aus der Pilotenkanzel. Eine Entschuldigung für den verspäteten Abflug. Ein Steward hatte Rauch in der Kabine entdeckt, weshalb ein gründlicher Durchcheck vorgenommen werden mußte – aber nun war alles in Ordnung. Die Stimme wünschte einen guten Flug.
Das mit dem Rauch – also so genau hatte das eigentlich kein Passagier wissen wollen. Es folgte das übliche Aufsagen und Darstellen der Sicherheitsvorkehrungen, denen niemand zuhörte. Wir rollten zur Startbahn, die Maschinen dröhnten full power auf, der Flieger donnerte los – aus den Belüftungsschlitzen der Klimaanlage fiel dunkler, beißender Rauch auf uns nieder.
Ich guckte meinen Nachbarn an, und der guckte ebenso verdutzt zurück bei angehaltenem Atem. Ein besorgter Blick aus dem Fenster auf immer tieferes Gelichter – wir hatten bereits abgehoben.
Hinter mir rief die aufgeregte Stimme der alten Dame: »Wir fliegen ja! Wieso fliegen wir, wenn’s qualmt? Warum hat der Pilot nicht am Boden gebremst?«
Dazu mein Nachbar: »Au ja! Bremse mal. Mit der Schubkraft, die wir druffhaben, wären wir glatt bis Stadtmitte durchjerutscht.«
Wir mußten in die Luft, egal was passierte. Stewardessen liefen mit nervösem Blick auf die Luftschlitze Richtung Cockpit.
Der Rauch ließ nach, hörte ganz auf, die nervöse Spannung der Passagiere nicht.
Mein Nachbar hatte plötzlich das Bedürfnis sich mitzuteilen. Er sagte: »Da könnte vielleicht eins der zig Kabel hinter der inneren Kabinenfassade kokeln.« Und dann sagte er dasselbe noch mal zu dem Passagier auf dem Gangplatz, der die Hände über seinem Gurt gefaltet hatte, als ob er bete.
»Ist das gefährlich?«, fragte ich.
»Naja«, sagte er. »Aber es kann auch was anderes sein.« »Sind Sie Flieger?«
»Nee.«
Es folgte eine Ansage aus dem Cockpit, die nach wenigen Worten abbrach. Das trug nicht eben zur Beruhigung bei. Und dann endlich eine Mitteilung in einem Stück. Die Maschine kehrt nach Tegel zurück. Aber das ließ sich bei so einem großen Vogel ja nicht im Sturzflug bewältigen, das brauchte eben seine Zeit. Eine Viertelstunde? Zwanzig Minuten? Auf alle Fälle eine Endlosigkeit, in der jeder von uns genügend Zeit zum Nachdenken hatte, zur inneren Einkehr, zur Möglichkeit, sich eine Katastrophe in allen Einzelheiten auszumalen.
Ich kannte Flugzeugabstürze aus den Nachrichten. Aber da waren sie eben schon passiert.
Passiert schon nichts im Linienverkehr über Deutschland.
Aber wenn doch? Und man kann gar nichts dagegen tun, bloß angeschnallt dasitzen mit hochgeklappter Lehne im Kreuz… wie auf dem elektrischen Stuhl. Mein Nachbar zog einen Flachmann aus dem Reisesack zwischen seinen Füßen, schraubte ihn auf und tat einen langen Schluck, wollte ihn wieder zu schrauben, überlegte es sich anders und hielt ihn mir hin. »Sie auch? Die Bordbar wird ja wohl kaum vorbeikommen.«
»Nein danke, bloß keinen Alkohol. Ich hatte letzte Nacht genug auf einem Abschiedsfest.«
Hatte ich wirklich Abschiedsfest gesagt? Sollte ich kurz vor meinem Tod noch einmal die alten Freunde Wiedersehen? Sollte es aus sein, gerade jetzt, wo ich anfangen wollte, mein Leben zu genießen? Ein neuer Rauchausstoß.
Seit dem ersten war kein Sterbenswörtchen mehr aus dem von Natur aus so leutseligen Herrn Obermayr gefallen. Es war überhaupt sehr still in der Kabine. Jeder schien den eisernen Deckel der Disziplin über sein aufgewühltes Innenleben gestülpt zu haben. Ich war ganz sicher: Sobald die Maschine zur Landung aufsetzt, explodiert sie.
Ich schaute auf das spitznasige Profil meines Sitznachbarn. Das war vielleicht der letzte Mensch, den ich in meinem Leben sehen würde. Seine Finger spielten nervös mit dem Ring im Ohrläppchen.
Aber wenn es denn jetzt soweit ist, dann laß es schnell gehen, lieber Gott, und bitte, nicht wehtun. Vorm Wehtun hatte ich Angst.
Mein Nachbar schimpfte vor sich hin.
»Was haben Sie gesagt?«
»Dafür hab ick mir nu mühsam det Rauchen abjewöhnt. Weil et det Leben vakürzen soll. Haha. Lebste gesund, kommt ebend wat andres. Wenn de dran bist, biste dran.«
Ich warf einen Blick zwischen den Sitzlehnen hindurch auf Herrn Obermayr. Er hielt sich an der alten Dame fest. Sie sagte: »Wir sind alle in Gottes Hand«, und er sagte, aus tiefbesorgten Gedanken heraus: »Nachad bringt sie mei Tochter ins Tierheim. Oarme Waisenhunderln …«
Morgen früh steht es als dicke Balkenüberschrift auf den Titelseiten aller Gazetten: »Bei Landung explodiert.« Karlow wird denken: Das ist doch nicht etwa die Maschine, mit der Viktörchen nach München geflogen ist? Die Liste mit den toten Passagieren ist bestimmt noch nicht in der Frühausgabe abgedruckt.
Wieso kamen keine Durchsagen mehr? Warum beruhigte man uns nicht? Wo waren die Stewardessen geblieben? Warum ließ man uns so allein?
Man wird mich an meinen Ringen identifizieren, an meinem Gebiß. Karen hat die Fotos davon und die Röntgenaufnahmen in ihrer Kartei.
Ich möchte nicht sterben.
Mein Nachbar hielt seinen unverschraubten Flachmann mit den Händen umklammert wie ein Rettungsanker.
Wie lange noch? Wie kurz, bis es passiert?
Plötzlich durchfuhr mich ein Gedanke wie ein Schock, der alle Todesüberlegungen beiseite drängte: Du lieber Gott, ich habe nicht aufgeräumt! Die armen Kinder! Wenn sie mein vollgestopftes Haus entrümpeln müssen!
Anstatt um mich zu trauern, werden sie meine Unordnung verfluchen. Frau Engelmann hat immer wieder gesagt: Frau Hornschuh, wir müssen dringend mal auf den Speicher, da findet keine Maus ihren Schwanz nicht mehr. Aber wann je habe ich Zeit gehabt zum Ausmisten? Und wenn ich Zeit hatte, dann wußte ich etwas Schöneres mit ihr anzufangen. Jetzt ist es vielleicht zu spät. Zu spät auch, um die Briefe von meinen Liebhabern, von denen die Kinder nichts wußten, und ihre Fotos zu vernichten. Wozu habe ich die überhaupt aufgehoben? Ich habe sie ja nie wieder angeschaut.
Sie fielen mir erst jetzt wieder ein.
Auch meine Mutter fiel mir ein. Sie räumte gründlich auf, bevor sie starb. Aber sie hatte mir ihre Notizbücher hinterlassen, als postumen Vorwurf. In ihnen war aufgezeichnet, wann ich ungeduldig mit ihr gewesen bin, wann ich sie gekränkt hatte, wann sie sich von mir vernachlässigt fühlte, wie unzufrieden sie mit meinem Lebensstil gewesen ist – in jeder Notiz ein Vorwurf und kein Verständnis für mein stressiges Berufsleben. Dazu die Enttäuschung über ihre Enkel, die sich nicht genügend daran erinnerten, was sie alles, als sie noch klein waren, für sie getan hatte.
Meine Mutter hatte nachträgliche Reue beim Lesen ihrer Notizbücher von mir erwartet. Aber was hatte sie wirklich damit erreicht? Meine herzliche Trauer um sie ernüchtert. Man darf keine Vorwürfe hinterlassen.
Stehen in meinen Terminkalendern Vorwürfe gegen meine Kinder? Höchstens: »Krach mit Frederik« oder: »Karen mal wieder zum Kotzen überheblich.« Aber die beiden lesen bestimmt nicht meine Terminkalender.
Ach, meine Kinder. Ich möchte so gern, daß sie mich in guter Erinnerung behalten.
Endlich eine Durchsage: »Die Maschine setzt zur Landung an.« Wenigstens verzichtete man auf den Zusatz: Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Rundflug.
Auf einmal waren auch wieder die Stewardessen da. Versicherten den Passagieren auf den Gangsitzen, die sie am Rock festzuhalten versuchten: »Alles in Ordnung. Keine Panik«, und eilten zu ihren Plätzen, um sich anzuschnallen.
Nun war es so weit. Ich schaute meinen Nachbarn an.
Er zog den Kopf ein. Ich gab das Durchatmen auf vor Spannung, während die Räder die Piste berührten. Das laute Bremsen, das uns in die Sitzlehne drückte – die Erschütterung im Rumpf – dunkler Rauch schoss auf uns nieder, nebelte die Kabine ein.
Keine Explosion.
Die Maschine rollte langsam aus. Stand nun still. Wir durften nicht etwa erleichtert aufspringen. Man verdonnerte uns dazu, auf unseren Plätzen auszuharren. Man befürchtete wohl einen panikartigen Ansturm auf den Ausgang.
Alle blieben sitzen mit Fluchtgefühlen im Hintern. Wir sind schon ein diszipliniertes Volk.
Ein einziger Mann Mitte Dreißig – in einem Jackett, das wie aufgeblasen wirkte durch die Muskeln darunter – hielt die Spannung nicht länger aus und stürmte durch den Gang nach vorne mit dem Schrei: »Ich will hier raus, verdammt noch mal!«
Ich kenne solche Typen aus dem Fitneß-Studio. Da zieht er sechzig Kilo hoch bei gleichzeitigem Ausstoßen von Stöhnen wie in der Brunft. Hätte er mal lieber seine Nerven trainiert!
»So ein Schisser«, sagte mein Nebenmann verächtlich, obgleich er ihm am liebsten gefolgt wäre. Ich auch.
Die Erlösung von der zwanzigminütigen Todesangst, das Begreifen des Glücks, noch einmal davongekommen zu sein, die Freude am neugeschenkten Leben setzten erst so richtig ein, als wir auf das Eintreffen der Ersatzmaschine warteten. Von zweihundert Passagieren waren etwa achtzig übriggeblieben. Die anderen hatten es vorgezogen, in Berlin zu übernachten.
Herr Obermayr – nun wieder sprachgewaltig – trank auf dem Heimflug drei Dosen Bier und zwei Fläschchen Kognak und erzählte, wie ihm die Hosen geschlottert hatten vor Angst und wie ihm die Tränen gekommen waren bei dem Gedanken an das ungewisse Schicksal seiner Hunde. Und ein Weltumsegler erzählte, wie er einmal im Sturm vor Kap Hoorn gekentert war. Aber damals hatte er seine Rettung selbst in der Hand gehabt, er konnte etwas dafür tun – in einem Flieger nicht. Dieses Hilflos-ausgeliefert-Sein war für ihn das Schlimmste gewesen.
Die Stimmung an Bord war geradezu übermütig. Hoch die Plastikbecher mit Whisky oder Champagner!
Kurz vor der Landung trat plötzlich betretenes Schweigen ein bei dem Gedanken, daß die Heimreise mit dem Flug ja noch nicht beendet war.
Im Parkhaus und auf den -plätzen warteten unsere abgestellten Autos, die leider nicht die Ortskundigkeit ehemaliger Kutschpferde besaßen, die ihre betrunkenen Besitzer auch ohne Zügelführung sicher nach Hause zu bringen vermochten.