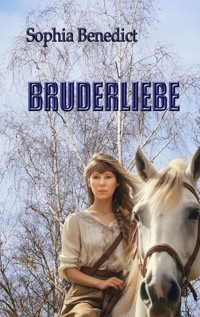
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: BoD - Books on Demand
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Bruderliebe, der neue Roman von Sofia Benedict, ist die Geschichte eines Waisenkindes, einem Mädchen, das sehr früh lernen muss, auf seinen eigenen Beinen zu stehen, um für seine Geschwister und sich selbst zu sorgen. Es ist auch die Geschichte zweier Brüder, die sich beide in dieselbe Frau verlieben, und von Bruderliebe bei dem einen bis zum besessenen Hass reicht. Der Roman schildert die Geschichte zweier Familien mit ausdrucksstarken Worten, die beim Leser Bilder erscheinen lassen, bei denen er mit den Charakteren das Geschehen miterlebt, als ob er selbst dabei wäre. Es ist eine Geschichte, bei der man einerseits sich richtig freut und andererseits feuchte Augen bekommt und ein paar Mal schlucken muss. Dieser Roman bringt dem Leser wieder eine Zeit vor Augen, die jeder - egal ob jung oder alt - sehr gut kennt, die man aber nie vergessen soll und deren Auffrischung und Miterleben jeden bereichert. Die Autorin betrachtet die Zwischenkriegszeit und die Zeit des zweiten Weltkrieg mit den Augen einer Frau, die erbittert ums Überleben für sich selbst und für ihre drei kleinen Geschwister kämpft.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 385
Veröffentlichungsjahr: 2024
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
INHALTSVERZEICHNIS
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 1
„Weg mit den Pfoten, du Schwein!“
Ich stieß ihn mit meinem Ellbogen mit aller Kraft in den Bauch, dass er vor Schmerz aufschrie und zur Seite sprang. Minuten später flüsterte er hasserfüllt:
„Du Verrückte! Du – Pest!“, aber, als der Schmerz anscheinend weg war, brummte er wieder versöhnlich, „du Närrin! Du weißt nicht, worauf du verzichtest …“
„Geh weg, betrunkenes Schwein! Sonst werde ich mich bei Mutter beklagen!“
„Wie schrecklich! Geh, beklag dich! Warum hab‘ ich diese Kranke nur geheiratet?“
„Du hast eine Gesunde geheiratet, krank hast du sie gemacht!“, schrie ich, kochend vor Wut.
Ich hob die Pfanne, die ich gerade auf den Herd stellen wollte und war kurz davor, sie ihm über den Schädel zu schlagen. Wenn ich mich ärgere, weiß ich nicht, woher ich so viel Kraft bekomme. Mein Stiefvater erschrickt, wenn ich mich ärgere. Er floh zur Tür. Betrunken fürchtete er weder Tod noch Teufel. Er griff andere an, wenn er betrunken war, aber vor mir machte er Halt. Betrunken war er öfter als nüchtern und seine Hand war schwer.
Einmal bekam ich sie zu spüren, als er mich ohrfeigte. Ich konnte kaum mehr auf den Beinen stehen. Dann ergriff ich den Schürhaken und schrie: „Mich wirst du nicht schlagen!“ Hätte er den Schürhaken nicht gefangen, hätte ich ihm den Schädel gespalten. Die Haut auf seiner Handfläche war geplatzt. Er blutete, und ich spürte, wie mir das Blut zu Kopf stieg. Ich zitterte vor Zorn.
„Tollwütige“, schrie der Stiefvater und stürzte zur Tür hinaus.
Ich hatte den Schürhaken nun endlich weggelegt. Da sah ich drei Paar erschrockene Kinderaugen vor mir, die mich aus einer dunklen Ecke anschauten. Ich trocknete die Hände an der Schürze und ging zu den Kleinen hin, hockte mich hin und wischte mit immer noch zitternder Hand dem dreijährigen Thomas die Nase ab. Karl war ein Jahr älter als Thomas und Katrin ein Jahr jünger. Ich drückte die Kleinen an mich und flüsterte: „Fürchtet euch nicht, es war nur Spaß. Alles wird gut, er wird niemanden mehr angreifen. Auch euch wird er nicht mehr schlagen!“
Karl weinte:
„Aber Papa kommt doch zurück?! Er ist doch nicht für immer weg?“
„Nein, nein, natürlich, nicht für immer“, flüsterte ich, dachte aber, es wäre schön, wenn es doch für immer wäre.
Es geschah vor ein paar Monaten.
Jetzt sagte ich zu den Kindern:
„Setzt euch zum Tisch, ich gebe euch etwas zum Essen!“
Ich schüttete die Reste des Pflanzenöls in die Pfanne, wartete bis der letzte Tropfen aus der Flasche getropft war, zerbröselte die Reste des Brotes vom Vortag und schlug drei Eier hinein, es war alles, was ich anbieten konnte. Wir hatten keine Vorräte mehr. Ich teilte die Eierspeise in drei Portionen, Karl, dem Ältesten gab ich ein bisschen mehr, wischte die Pfanne mit dem restlichen Stück Brot aus und steckte es in meinen Mund. Die Kleinen aßen schnell, dann schleckten sie ihre Teller ab wie Kätzchen. Sie hatten nicht um mehr gebeten, nur ihre Augen waren voller Flehen.
„Gehen wir in die Sonne, ich erzähle euch ein Märchen“, sagte ich, versuchend, ein unverständliches Schuldgefühl in mir zu unterdrücken. Woran war ich denn schuld? Wir setzten uns auf einen Baumstamm, und ich musste mich tief beugen, damit der Druck auf meinen Magen größer wurde, so war es leichter, den Hunger zu ertragen. Dann begann ich zu erzählen:
„Es war einmal ein kleiner Junge. Er war so klein, dass alle ihn Däumling nannten. Seine Mutter war gestorben, und der Vater hatte wieder geheiratet …“
Vom Hunger kamen plötzlich stechende Schmerzen im Magen, aber ich musste ja nur noch ein bisschen Geduld haben. In einer Stunde würde ich zu Linde gehen, um ihr Nachhilfestunden zu geben. Sie ist zehn Jahre alt, also zwei Jahre jünger als ich; ihre Eltern sind Großbauern, aber sie leben wie vornehme Herrschaften. Gewöhnlich bewirtet mich ihre Mutter zuerst, sie gibt mir ein großes Stück Schmalzbrot oder sogar ein Stück Fleisch mit Brot. Ich bekam auch Apfelsaft. Davon kann ich so viel trinken, wie ich will. Die Familie ist sehr stolz auf ihren Apfelsaft, sie erzeugt ihn selbst und handelt damit. Wenn der Magen leer ist, belebt der erste Schluck dieses süßen Getränks sofort Gehirn und Körper. So bekomme ich neue Kraft.
Linde ist das jüngste von vier Kindern in der Familie, sie ist ein nettes Dickerchen mit Hausverstand, aber mit ihren Hausaufgaben kommt sie nicht wirklich zurecht, so helfe ich ihr dabei. Ihr Vater meint, dass seine Tochter keine Gelehrte werden muss. Er selbst hat auch nur kurz die Schule besucht, ist aber aus eigener Kraft reich geworden. Ich weiß aber, dass er durch den Krieg reich geworden ist, als die Existenz von anderen zerstört wurde. Lindas Mutter sieht dies aber anders. Ihre Eltern waren Lehrer, und sie selbst wollte auch Lehrerin werden. Sie hatte sich aber in einen schönen Bauernburschen verliebt, der ihr ein gutes Leben versprochen und sein Versprechen auch gehalten hat. So war die Familie sehr wohlhabend. Die Mutter leistete auch Schwerstarbeit in der riesigen Wirtschaft. Sie war stark, es belastete sie nicht zu sehr, aber für ihre Kinder wünschte sie sich ein anderes Leben. So bekam ich mit zwölf Jahren mein erstes Gehalt. Ich lernte gut und konnte auch anderen beim Lernen helfen.
Die Schule besuchte ich sehr gern. Ich mochte es, Neues zu erfahren, auch einfach ein Buch zu lesen, dies brachte mir Freude, auch wenn es ein scheinbar langweiliges Lehrbuch war. Es war wie eine Reise in eine andere Welt. Da zog sich sogar die Trauer zurück, und ich dachte nicht mehr daran, wie bitter mein Leben war.
„Der Däumling hat sein Stückchen Brot aufgespart und warf unterwegs Brösel hinter sich, damit er später den Weg zurück nach Hause finden könnte, aber die Vögel …“, setzte ich mit der Märchenerzählung fort.
Katrin lauschte nur meiner Stimme, sie war noch zu klein, um die Bedeutung der Worte wirklich zu verstehen. Karl schaute mürrisch zur Seite, er dachte immer noch an seinen Vater. Nur Thomas hörte mir zu, seine Augen hatten sich mit Tränen gefüllt: „Und er blieb weiter hungrig …“ “Warte ab!“, versuchte ich ihn zu trösten, „es wird alles gut werden …“
*** Seit ich den Schürhaken ergriffen hatte, wagte der Stiefvater nicht mehr, mich oder die Kinder zu schlagen. Aber er trank weiter und verbrachte seine Zeit in den Beisel. Wenn er nach Hause kam, hatte er nicht selten blaue Flecken im Gesicht, denn er mischte sich in jede Schlägerei ein. Heimlich hoffte ich, dass jemand ihn einmal zu Tode prügeln würde. Es freute mich, seine Wunden zu sehen, und es schien so, als ob ein anderer ihn für uns bestrafen würde.
Vielleicht sollte ich doch erzählen, wie es dazu kam, dass meine Mutter dieses Schwein Otto, meinen Stiefvater, geheiratet hat.
Meinen Vater liebte ich mehr als mein Leben. Abends setzte er mich auf seinen Schoß, und wir schnitten zusammen Fotografien aus alten Zeitschriften aus. Wir klebten sie auf Pappe, und es entstanden dann wunderbare Bilder mit den Porträts von Fürsten, Präsidenten, Ministern, mit Kaiser Franz Joseph und Kaiserin Elisabeth, die eine wahre Schönheit war. Ich erinnere mich, dass ich sogar weinte, als Vater sagte, dass es sie nicht mehr gäbe, da sie von einem Mörder getötet worden war. Er sagte auch, dass solche Schurken Terroristen heißen, weil sie unschuldige Menschen töten, die niemandem etwas Schlechtes angetan haben. So sagte mein Vater. Diese Bilder hängen in meinem Zimmerchen immer noch. Mein Vater bastelte ständig etwas, und ich blieb bei ihm, stellte ihm tausende Fragen, und er beantwortete sie geduldig.
Vater arbeitete beim Gipsbetrieb in Mödling, er hatte eine gute Arbeit und verdiente auch gut. Als der Krieg angefangen hatte, musste er nicht zum Wehrdienst, weil Gips auch während des Krieges sehr wichtig war. Oder sogar noch wichtiger als vorher, weil man damit handeln konnte, um für das erworbene Geld Waffen zu kaufen.
Sonntags gingen wir in die Kirche. Mutter zog ihr schönstes Kleid an und legte auf ihre Schultern das persische Umhängetuch; es war ein Geschenk meines Vaters, als sie noch ein Brautpaar waren. Dieses Umhängetuch gefiel auch mir, ich streichelte die seidige, feine Wolle mit der Hand. Mutter sagte, sie würde es mir schenken, wenn ich erwachsen werde. Wird sie nicht mehr, ich musste es verkaufen, um Medikamente für sie zu kaufen.
Nach der Messe aßen wir zu Hause. Dann am Nachmittag gingen wir spazieren, und das sogar bei schlechtem Wetter. Vater kaufte uns Regenschirme, auch für mich einen kleinen mit Spitzen. Ich war sehr stolz darauf, weil ich damit wie eine echte Dame aussah, eine wie auf jenen Bildern, die ich und Vater aus den Zeitschriften ausschnitten. Der Spaziergang endete mit einem Besuch im Kaffeehaus. Die Eltern tranken Kaffee und für mich bestellten sie heiße Schokolade. Ich bekam auch ein großes Stück Torte und die Eltern dazu kleine Gläschen Likör, der ganz nach süßen Marillen roch. Die Wände im Café waren rosafarbig, genau wie die Creme auf meiner Torte. Im großen Spiegel gegenüber sah ich die Spiegelung unserer Familie, sie gefiel mir. Vater und Mutter waren schön gekleidet, und der Raum war auch sehr schön. Bei uns zu Hause war alles sehr bescheiden, wir gaben unsere Feiertagskleider sofort in den Schrank, aber es war bei uns immer warm und gemütlich.
Mir scheint, wir hatten damals ein Leben wie ein König. Mutter war immer fröhlich. Vater auch. Sie lachten oft. Vater sagte, er müsse sich davor fürchten, ob uns ihm nicht jemand stehlen würde, weil wir beide viel zu schön seien, und es sei niemand in der Welt, der schöner sei als wir, und dass er uns sehr liebt. Mutter machte sich aber Sorgen, ob Vater nicht doch zum Krieg einberufen würde. Jetzt denke ich, vielleicht wäre es sogar besser gewesen, wenn das passiert wäre. Vom Krieg kamen viele Männer zurück, auch wenn sie eine Hand oder ein Bein verloren hatten. Mein Vater aber … In der Grube gab es einen Einsturz. Er wurde tot geborgen.
***
Ich weinte nicht. Ich hatte keine Tränen. Ich hatte Angst. Und noch ein Gefühl spürte ich in mir, es war wie Zorn. Ich war zornig auf meinen Vater, ich ärgerte mich, weil er so unvorsichtig gewesen war. Er sagte doch so oft, dass er mich und Mutter mehr als alles in der Welt liebte, und er würde es nicht überleben, wenn es uns nicht mehr gäbe, und er selbst … Er hätte sich selbst zehnfach schützen sollen, weil ohne ihn auch unser Leben zugrunde ging. Warum hat er sich nicht geschont? Warum hat ihn der liebe Gott nicht beschützt, nicht gelehrt, vorsichtig zu sein? Wenn ich Mutter das sagte, weinte sie nur:
„Man darf nicht so sprechen, Isabell …“
Mein Vater nannte mich Isabell, und nach ihm auch alle anderen; an sich heiße ich Elisabeth, so wie die arme Kaiserin. Ich weinte nicht. Ich war zornig. Ich weiß nicht auf wen, wahrscheinlich auf alle, sogar auf meinen Vater. Auch heute noch. Meine Angst hat sich in Zorn verwandelt. Der sitzt tief in mir drinnen. Mein Vater war der beste Mensch auf Erden, warum musste er sterben? Und dieses Schwein Otto lebt! Wir alle schlafen, wir essen, wir atmen, wir laufen … und mein Vater liegt allein unter der Erde.
„Alles ist in Gottes Händen“, sagte Mutter.
Sie ist auch sehr gut, meine Mutter, nur … Sie war immer schon irgendwie unbeholfen. Ohne Vater war sie wie ein Kind. Mutter ärgerte sich niemals darüber, dass ich meinen Vater mehr liebte als sie, sie sagte sogar, dass es so sein sollte, sie hat ihren Vater auch sehr geliebt. Nach Vaters Tod zündete sie jeden Sonntag eine Kerze an, stellte sie auf das Fensterbrett und sagte: „Damit Papas Seele sich freut, weil er dann weiß, wir werden ihn nie vergessen und immer lieben.“ Wir saßen, umarmten uns fest, Mutter weinte, und ich wischte ihr die Tränen ab. Meine Mutter war nie so stark wie ich. Mein Vater war stark, aber die Mutter …
***
Die Rente war gar nicht großzügig, es reichte kaum für das Notwendigste. Mutter verdiente ein bisschen mit ihrer Tagesarbeit dazu, und ich half ihr zu Hause. Unser Haus war nicht groß, aber gemütlich, Mutter hatte es geerbt. Vater hatte es renoviert und den Schuppen dazu gebaut. Im Schuppen hatten wir Hühner. Manchmal kauften wir ein kleines Schwein, das bei uns aufwuchs. Zu Weihnachten hatten wir dann reichlich Wurst und Schinken. Hinter dem Schuppen war ein kleiner Gemüsegarten. Als Vater nicht mehr da war, war alles ziemlich verwüstet und ausgewachsen. Meine Mutter war nicht fähig, eine schwere Arbeit zu leisten, obwohl sie sich bemühte. Ihr Körperbau war viel zu zart. Ich habe Mamas Körperbau, aber die Kraft meines Vaters. So sehe ich zwar schmächtig aus, in Wahrheit kann ich aber Berge versetzen. Das glaube ich zumindest.
Man sagt doch, Unglück kommt selten allein und begegnet einem meist in Gesellschaft. Ottos Erscheinen in unserem Leben war das neue Unglück.
***
Damals, an einem Maitag, saß ich im Garten in der Sonne und studierte ein Lehrbuch, das ich ohnehin bereits auswendig kannte. Das Gras im Garten war hoch gewachsen, lange nicht gemäht, und die Hühner suchten im Gras nach Würmern. Es summten die Bienen, und Schmetterlinge flatterten von einer Blume zur anderen. Warme Sonne streifte meinen Körper und erwärmte sogar die Seele. Es roch nach Lavendel und Honig. Ein wunderbarer Vorsommergeruch. Solche Tage sind geschaffen, damit der Mensch sein Leben genießen und die Kräfte für schwierige Tage sammeln kann.
Ich ließ das Buch ins Gras fallen, pflückte Margeriten und versuchte, daraus einen Kranz zu flechten. Genau in diesem Moment öffnete sich die Pforte und Mutter kam herein. Sie war nicht allein. Sie kam in Begleitung eines großen, nicht schlecht aussehenden, jedoch merklich älteren Mannes. Beide lächelten mich an.
„Komm, ich will dich bekannt machen“, sagte Mutter, „mein Töchterchen Isabell!“
„Und ich bin Otto“, sagte der Mann, hockte sich hin, sah mir ins Gesicht und fragte, „Was machst du da ganz allein?“
„Ich lebe hier“, sagte ich nicht besonders freundlich.
Der Mann lachte auf:
„Kluges Kindchen!“
Er hob mich hoch und fing an, sich mit mir zu drehen. Ich wehrte mich, es gefiel mir gar nicht, dass ein Fremder sich so ungezogen benahm, aber er ließ mich nicht aus seiner Umarmung.
Bald heirateten die beiden. Mutter meinte, ins Haus gehöre ein Wirt, ein Mann müsse da sein, um seine Frau zu beschützen. Beschützen! Dass ich nicht lache! Übrigens, zunächst war Otto gar nicht so schlecht, er hat das Loch im Zaun zugemacht, hat ein Ferkel gekauft und sogar den Brunnen im Hof fertig gebaut, den mein Vater angefangen hatte, aber nicht zu Ende bauen konnte. So mussten wir das Wasser nicht mehr von weit her schleppen. Auch Mutter wurde wieder fröhlich, fast so wie früher. Sie musste auch nicht mehr am Tag arbeiten gehen. Samstags buk sie Kuchen, und am Sonntag gingen wir alle zur Messe. So war alles wieder wie früher. Scheinbar … Ich vermisste meinen Vater nach wie vor. Doch tat es gut, die Mutter wieder froh zu sehen, auch wenn ich eifersüchtig war. Einmal habe ich sie sogar gefragt, ob sie meinen Vater bereits vergessen hätte. Daraufhin wurde sie traurig und sagte:
„Niemals. Er war meine erste Liebe. Die vergisst man nie. Dein Vater bleibt die größte Liebe meines Lebens. Solche Menschen wie ihn gibt es nicht mehr. Aber wenn Otto uns das geben kann, was dein Vater für uns gewünscht hatte, so soll es gut sein. Dein Vater wollte, dass du ein gutes Leben hast.“
“Hatten wir ohne Otto ein schlechtes Leben?“, empörte ich mich.
„Nein, nicht schlecht, aber schwierig … Du bist ein Kind, du verstehst noch nicht alles. Das kommt erst, wenn du erwachsen sein wirst … Ein Kind ist glücklich, wenn es satt ist und es warm hat, Erwachsene brauchen noch einiges mehr …“
Liebe brauchen Kinder auch, wollte ich sagen, aber ich schwieg.
***
Otto hatte gut verdient, sogar besser als mein Vater. Er war bei der Eisenbahn angestellt, damals die erste im Land, einen nationalen, österreichischen Stolz, nannte man sie. So genossen auch alle Mitarbeiter großes Ansehen. Er verwöhnte Mutter und mich, brachte oft kleine Geschenke mit und bemühte sich, nicht nur Mutter, sondern auch mir zu gefallen. Manchmal schien es, er bemühte sich sogar viel zu sehr, irgendwie war es unnatürlich. Das nervte mich.
Ein Jahr später wurde Karl geboren. Ich kann nicht sagen, dass ich mich gefreut hätte. Ganz im Gegenteil. Dieses Würmchen mit krummen Händchen und Beinchen rief bei mir kein glückliches Gefühl hervor … Aber was soll man machen, sagte ich zu mir, Menschen heiraten, damit sie Kinder kriegen können. Das Geheimnis Kinderkriegen war für mich, die in einer ländlichen Gegend aufgewachsen war, nie ein Geheimnis, aber ich wollte nicht darüber sprechen oder sogar nachdenken. Mutter stillte das Baby, sie stand nachts auf, war immer besorgt, also mochte sie dieses Würmchen mehr als mich. Wenn ich ihr das sagte, lächelte sie nur:
„Schau, wie klein und hilflos es ist, und du, du bist ein großes Mädchen, auf dich bin ich stolz. Wenn er so groß und stark wird wie du …“, weiter sprach sie nicht, sondern schien schweigend über etwas nachzudenken.
Was wollte sie sagen? Sollen die Größeren selbst für sich sorgen?
Dann, ein Jahr später, als Thomas geboren wurde, begann ich plötzlich, Karl zu bemitleiden. Er war immer noch so klein und schutzlos und musste auf Mutters Aufmerksamkeit zum Großteil verzichten. In dieser Zeit war er ziemlich lustig geworden, und ich hatte ihn sogar lieb gewonnen. Oder hatte sich das Mitleid in Liebe verwandelt? Ich spielte mit ihm oder band ihn mit einem Kopftuch an meine Brust, lernte stundenlang oder erledigte Hausarbeit. Karl lächelte, es gefiel ihm offensichtlich, die Wärme eines anderen menschlichen Körpers zu spüren.
Nach der Geburt von Thomas war Otto endgültig wie ausgewechselt. Für seine Kinder zeigte er kaum Interesse, manchmal schien es sogar, ich interessierte ihn viel mehr als seine Sprösslinge. Immer öfter kam er betrunken nach Hause, ärgerte sich ohne Grund über Mutter, schrie sie an, als ob er selbst ein Kind wäre:
„Du liebst mich nicht mehr, dich interessieren nur deine Kinder!“
„Was sagst du da!“, weinte Mutter, „du weißt genau, dass es nicht so ist. Das sind doch auch deine Kinder! Was ist so schlecht daran, dass ich sie liebe? Dich liebe ich doch auch …“
Es war ekelhaft zu hören, wie sie sich rechtfertigte, aber ich schwieg, um nicht Öl ins Feuer zu gießen. Meine Seele brannte. Otto wurde immer zorniger, und Mutter wurde ganz unglücklich, wie damals, nach dem Tod meines Vaters. Man muss schon das Letzte auf Erden sein, um seine eigenen Kinder nicht zu lieben.
Manchmal hatte er jedoch seltsame Liebesanfälle:
„Meine lieben Kinder, ihr seid so wunderbar! Ihr wisst nicht, wie sehr ich euch mag! Für euch würde ich mir sogar meine linke Hand abschneiden lassen. Oder die rechte …“
Mich haben seine betrunkenen Liebestränen angeekelt.
„Elisabeth!“, schrie er, „Elisabeth, komm hierher!“
„Was willst du?“
„Du weißt doch, ich habe auch dich sehr gern, so habe ich eine große Bitte an dich: Wenn mir etwas zustoßen sollte, vergiss bitte meine Kinder nicht, versprich mir, dass du dich um sie kümmern wirst!“
Ich wollte einfach brüllen, dass er tot für seine Kinder mehr von Nutzen wäre als lebendig. Sie würden wenigstens eine Rente bekommen, während er nun sein ganzes Gehalt vertrank. Ich konnte es aber nicht sagen, um Mutter nicht noch mehr zu verwirren.
***
Die nächtlichen Scherereien im Elternschlafzimmer hinter der dünnen Wand wurden immer mehr einem Kampf ähnlich, mir schien, als hörte ich Mamas Weinen. Dann sah ich einmal einen blauen Fleck auf Mamas Gesicht ...
„Wirf ihn hinaus“, schrie ich Mutter wütend an, „er liebt weder dich noch die Kinder. Das Geld vertrinkt er auch, wozu brauchst du ihn?“
Mutter schaute mich so an, als ob sie mich in diesem Moment hassen würde. Ich wollte, dass sie auf etwas ganz Teures verzichtet. Erst später verstand ich, dass meine Mutter gar nicht fähig war, sich ohne einen Mann lebendig zu fühlen. Sie brauchte diesen Mann, auch wenn er betrunken und hemmungslos war. Nur er konnte sie auf seine eigene Art glücklich machen. Deshalb ertrug sie alles. Wenn der Stiefvater in den Beisel verschwand, saß sie da, sich nicht bewegend und starrte vor sich hin. Ich fühlte mich schrecklich, wenn ich diesen toten Blick sah. Wo war sie in dieser Zeit? In ihrer inneren Welt war Platz nur für Otto. So wurde ich in dieser kalten Welt allein gelassen. Sogar nach Vaters Tod hatte ich mich nicht so einsam gefühlt, damals hatte ich Mutter, nun aber war ich ganz allein.
Dann wurde Katrin geboren. Die Geburt war schwer, Mutter litt an Blutarmut, sie war – wie wir alle – unterernährt. Sie war so schwach, dass ich mich auch um das Neugeborene kümmern musste.
Dann kam der Arzt. Er war ein bejahrter Herr mit goldenem Kneifer auf der Nase. Er betrachtete das verwahrloste Haus bedrückt, wusch seine Hände und ging ins Schlafzimmer. Lange hörte er mit seinem Gerät Mamas Brust ab, klopfte darauf und hörte sie wieder ab. Er schüttelte den Kopf. Dann stellte er ein Fläschchen Medizin auf den Tisch und sagte, dass Mutter Ruhe und gute Ernährung brauche, worauf Otto nur die Schultern hochzog. Für den Besuch nahm der Arzt kein Geld. Als er wegging, ergriff Otto das Geld vom Tisch, das für den Arzt vorgesehen gewesen war, und verschwand.
***
Er kam betrunken und sehr spät zurück. Ich war gerade aufgestanden, um nach der Kleinen zu sehen. Als ich zurückkam, lag er in meinem Bett und hatte nichts an. Er stürzte sich auf mich, zerrte mich ins Bett, versuchte mich zu küssen. Ich spürte ekligen Schnapsgeruch aus seinem Mund.
„Geh weg von mir!“, zischte ich zornig und versuchte mich zu befreien.
Er war aber viel zu stark. Dann zog ich meine Knie bis zum Kinn und streckte sie abrupt wieder aus. Der Stoß traf die richtige Stelle. Otto krümmte sich lautlos vor Schmerz.
„Geh weg, sonst werde ich jetzt so laut schreien, dass alle Nachbarn kommen!“, zischte ich und stieß meine Nägel in sein Gesicht. Ich hatte wirklich vor, ihm die Augen auszukratzen.
Katrin weinte. Ich wollte sie beruhigen, aber ich war nicht imstande, sie in die Arme zu nehmen. Mein Körper zitterte vor Angst und Zorn. Die Angst erzeugte meinen Zorn. Ich gehöre nicht zu den Menschen, die schweigend alle Beleidigungen einstecken … ich bin nicht so wie meine Mutter!
Dann verlor Otto seine Arbeit, was eigentlich zu erwarten gewesen war. Er wurde wegen seiner Trunksucht entlassen und verdiente nur noch ab und zu einen Tageslohn, und auch dieser blieb in dem Beisel. Wir darbten so sehr, dass unsere frühere Not uns schon als Wohlergehen erschien. Ich konnte keine Milch für die Kleinen kaufen. So überwand ich meinen Stolz und ging zu den Nachbarn betteln, sie hatten Mitleid mit uns.
An Tagen, an denen es meiner Mutter besser ging, stand sie vom Bett auf, erledigte kleine Hausarbeiten, versuchte sogar, Wäsche zu waschen, aber sie hatte wenig Kraft und musste sich bald wieder hinlegen.
Die Jungen wuchsen als Raufbolde auf. Das freute mich, man muss in diesem Leben kämpfen können. Katrin dagegen war unserer Mutter ähnlich. Auch äußerlich. Helles, lockiges Haar umwand ihr rundes Gesichtchen, mit breit geöffneten blauen Augen war sie hübsch wie ein Engel. Wenn ich den Haushalt erledigte, folgten alle drei mir nach wie die Küken der Henne. Manchmal brachte es mich zum Lachen, manchmal aber ärgerte es mich. Müdigkeit machte mich böse. Wenn ich verärgert war, schaute Katrin mich zutraulich mit ihren runden Augen an, in denen Tränen standen, sodass ich nur noch Mitleid haben konnte.
„Bleib doch zu Hause, wenigstens wenn ich in der Schule bin!“, schrie ich Otto an, „pass auf deine Kinder auf, die du so sehr liebst!“
„Wozu brauchst du diese verdammte Schule?“, schrie er zurück, „du bist ohnehin schon viel zu klug!“
Mein Vater sagte immer wieder, er würde alles tun, damit ich Bildung bekomme. Er mochte gebildete Frauen. Er brachte mir sogar das Lesen bei. Mit fünf kannte ich alle Buchstaben und konnte Worte buchstabieren. Er sagte, wenn ich klug und gebildet werde, so würde ich auch einen klugen und gebildeten Mann heiraten können, und wir würden kluge und gebildete Kinder bekommen. Ob ich wirklich verstanden hatte, was das alles bedeuten sollte, weiß ich nicht; ich liebte damals doch nur einen Mann – meinen Vater. Erst später begriff ich, dass Bildung doch eine glückliche und gesicherte Existenz ermöglicht. Mein armer Vater, wenn er nur wüsste, was für ein Leben ich nun hatte! Warum, warum hat der liebe Gott uns meinen geliebten Vater weggenommen und anstelle dessen uns dieses Schwein Otto zugeschoben?! Niemanden werde ich so sehr lieben können, wie ich meinen Vater geliebt habe. Er wollte, dass ich fleißig lerne, so werde ich lernen, was es auch koste. Ich werde seinen Traum verwirklichen!
„Das geht dich nichts an, du Schwein!“, schrie ich Otto an, „über mein Leben wirst du nicht bestimmen!“
Genau in diesem Moment bekam ich die bereits erwähnte Ohrfeige. Er schlug zu mit aller Kraft, ich wäre fast umgefallen und machte einen Schritt nach hinten. Für einen Augenblick erstarrte ich vor Schmerz und Angst, dann aber verwandelte sich dieses ekelhafte Gefühl in Zorn. Ich stand mit dem Rücken zum Ofen. So griff ich nach dem Schürhaken und war bereit, dem Schwein den Schädel zu zersplittern.
„Mich wirst du nicht schlagen!“
Ich weiß nicht, wie ich in diesem Moment aussah. Wahrscheinlich wie eine Hexe. Allerdings sah ich, dass Otto echte Angst hatte. Er lief aus dem Haus. Seitdem fürchtete er sich anscheinend vor mir. Er hatte Angst und hasste mich. Es war auch gut so. Manchmal versuchte er es doch mit Zärtlichkeit, was mich noch zorniger machte. Aber er wusste, sollte ich wieder den Schürhaken ergreifen, würde er im Grab landen. Wie ich bereits sagte, ich war nur äußerlich so schmächtig, in Wirklichkeit hatte ich viel Kraft, besonders wenn mich der Zorn packte. Zorn verlieh mir Kräfte. Sogar wenn ich wenig geschlafen hatte, verließen mich meine Kräfte nicht. Ich lasse nicht zu, dass man aus mir ein Opfer macht, wie meine Mutter eines ist. Ich hasse Opfer!
***
Meine Hausaufgaben machte ich gewöhnlich nachts, wenn alle schliefen. In der Schule war ich wie unsichtbar. Niemand nahm Notiz von mir. Ich dachte, wenn du äußerlich unscheinbar bist, wirst du niemals ein Klassenstern. Die Schönen und Reichen, sie haben es leicht im Leben, aber solche, wie du, müssen für ihr Glück hart kämpfen. Ich lernte gut, es fiel mir auch leicht zu lernen. Wenn ich nur ein bisschen mehr Zeit hätte! Ich gab auch Nachhilfestunden, so konnte ich wenigstens Milch für die Kleinen kaufen. Wie ich das schaffte, kann ich mir nicht erklären, aber meine Noten waren so gut, dass der Schulleiter für mich ein Stipendium besorgt hatte. Er sagte, es wäre ein großer Fehler, wenn ich nicht weiter machen würde. Danach könne ich in ein Gymnasium mit einem Internat gehen. Ach, wenn ich nur allein wäre und mich nicht um die kranke Mutter und um die Kleinen sorgen müsste! Bald bin ich vierzehn, wie es weiter geht, werde ich sehen, es ergibt keinen Sinn, in die ferne Zukunft hineinzuschauen – seinen Weg bewältigt der Gehende, wie man so schön sagt.
Als ich zuletzt in der Kirche war, sagte der Priester in seiner Predigt, dass Zorn eine große Sünde wäre, dass man alle Menschen mögen müsse, man dürfe sich niemals ärgern lassen.
Einfach leicht gesagt! Dieser Priester sollte mein Leben leben. Erst dann könnten wir darüber reden. In die Kirche gehe ich seit langem nicht mehr. Mutter ist krank, und Otto glaubt nicht an Gott. Wir hätten uns auch nicht anständig anziehen können, wenn wir doch einmal in die Kirche hätten gehen wollen.
Was aber meine Bosheit betrifft, so hatte der Priester vielleicht recht. Vielleicht wäre es wirklich sehr gut, wenn man, ohne böse zu sein, ohne Ärger durchs Leben gehen könnte. Dafür aber muss man entweder in einer von Gott behüteten Familie geboren oder eine Heilige sein. Wäre ich gerne eine Heilige? Nein, mein ganzer Ehrgeiz reicht für so eine hohe Aufgabe nicht. Es würde auch bedeuten, aus dem wirklichen Leben weggehen zu müssen und sich nur dem Gebet widmen, sich nicht ärgern, nicht kämpfen. Wer würde aber dann die Mutter und die Kleinen versorgen?
Was erzeugt in mir Zorn, worüber ärgere ich mich? Vor allem über dieses Schwein Otto. Aber wenn ich ehrlich sein soll, ärgerte ich mich über die ganze Welt, über all die Ungerechtigkeit und sogar über mich selbst. Wenn Zorn eine Sünde ist, dann ist es so! Meinem Vater gefiel es sogar manchmal, wenn ich mich ärgerte; er sagte, man muss in diesem Leben stark sein, es ist wichtig. Zorn hilft einem Menschen stark zu sein. Mutter lachte nur, sie sagte, du ziehst sie groß, als ob sie ein Junge wäre, worauf Vater antwortete, dass einer Frau ein starker Charakter auch nicht schaden würde. Er sagte auch, die Bösen erreichten oft viel mehr Respekt als die Guten, wenn es solche überhaupt gibt.
Nach dem Vorfall mit dem Schürhaken fürchtete Otto sich vor mir. Nur wenn er betrunken war … Später kam er doch wieder an mich heran, als ich Kartoffeln schälte. Er legte seine schmutzigen Pfoten auf meine Brüste. Sie sind bei mir im letzten Jahr so gewachsen, dass meine Kleider sich über sie spannten. Ich bin sehr schlank, sogar mager, aber meine Brüste wuchsen wie verrückt. Da habe ich ihm mit ganzer Kraft den Ellbogen ins Sonnengeflecht gestoßen:
„Geh weg, betrunkenes Schwein!“
„Was erlaubst du dir?“, schrie er dann, worauf ich mich zu ihm wendete, und er sah das Messer in meiner Hand.
„Sag Dankeschön, dass du noch so gut davon gekommen bist!“, sagte ich ganz ruhig.
Er stürzte aus der Tür hinaus, und ich fragte mich, ob ich einen Menschen mit dem Messer erstechen könnte. Ich weiß es nicht. Nein, einen Menschen sicher nicht, aber Otto war kein Mensch. Otto war ein Schwein. Das schmutzige, betrunkene Schwein, das nur Kinder zeugen konnte, aber sich um sie sorgen sollten andere. Er hat meine Mutter krank gemacht. Er hat Not in unser Haus gebracht. Ohne ihn wäre unser Leben viel besser gewesen.
Mutter kam in ihrem abgetragenen Morgenmantel aus dem Schlafzimmer und setzte sich zum Tisch.
„Kann ich dir, meine Kleine, helfen?“
„Danke, Mutti, ich komme schon zurecht. Mittagessen ist fast fertig, bald sind die Erdäpfel gar, dann können wir essen.“
Ich habe sie mit der Gabel probiert. Sie waren noch hart. Als ich mich wieder zur Mutter wandte, sah ich, dass sie weinte.
„Mutti, was ist mit dir? Geht es dir schlecht?“
„Nein, es geht dir schlecht, mein Töchterchen! Du meine Arme …“
„Ach nein, Mutti, bei mir ist alles in Ordnung. Ich komme schon zurecht. Du weißt doch, ich bin stark. Schau, Karl hilft mir auch, siehst du, er kehrt den Fußboden“, sagte ich und nickte zu Brüderchen hinüber, der auf einem Besen durchs Zimmer ritt.
So war es.
Ich habe das Märchen zu Ende erzählt, brachte die Kinder ins Haus und ging dann zur Nachhilfestunde. Unterwegs dachte ich an unser Leben, an die Kleinen, und mit Angst daran, was uns in Zukunft erwartete.
***
Mutter starb als ich vierzehn war. An dem Tag habe ich mein Zeugnis bekommen, sie schaute meine Noten an, lächelte fast glücklich und sagte:
„Dein Vater wäre stolz auf dich …“
Am nächsten Morgen lag sie bereits kalt im Bett. Sie starb genauso leise, wie sie lebte. Otto weinte wie ein Kind, dann ging er und kam erst spät betrunken zurück. Was sonst!
Ich erinnere mich kaum an die Beerdigung. Es kamen irgendwelche Menschen zu uns und brachten Lebensmittel. Die Nachbarn haben alle Formalitäten erledigt. Ich allein hätte das nie geschafft.
Sofort nach der Beerdigung verschwand Otto. Ich blieb allein mit den Kindern. Es war sogar gut so, da von Otto sowieso keine Hilfe zu erwarten war.
Ein Tag später erfasste mich Angst. Echte Angst. So stark, dass vor meinen Augen schwarze Schmetterlinge flatterten. Eine innere Leere überfiel mich, die ich bisher kaum gekannt hatte. Angst hatte ich auch früher, es war aber eine reale Angst, die mich zu kämpfen zwang, mich veranlasste, etwas zu unternehmen, dadurch wurde ich auch zornig, und Zorn half mir, neue Kräfte zu bekommen. Diese neue Angst war anders, es war die Angst eines Menschen, der plötzlich in voller Dunkelheit am Rande eines Abgrunds steht. Ich war leer, wie erloschen, und es schien, als wären mir meine Innereien herausgerissen worden und nur eine Hülle zurückgeblieben. Diese Angst blieb für immer irgendwo tief in mir drinnen. Vor diesem Gefühl fürchte ich mich seitdem ständig.
Die Kinder drückten sich an mich, aber ich hatte keine Kraft, sie zu trösten.
In diesem Zustand lebte ich wochenlang. Als meine Angst sich ein wenig abgeschwächt hatte, fing ich an nachzudenken, wie es weitergehen sollte. Ich musste irgendwo in der Nähe eine Arbeit finden, damit ich mich auch um die Kleinen sorgen konnte. Das war aber kaum möglich. Es kamen wieder schwierige Zeiten der Nachkriegskrise. Unsere Nachbarn lebten auch von der Hand in den Mund und konnten sich Helfer in der Wirtschaft kaum leisten. Es war Sommer, wir ernährten uns von unserem ärmlichen Gemüsegarten und von dem, was uns die Nachbarn aus Mitleid brachten.
***
An einem frühen Septembermorgen kamen zwei Herren mit Melonenhüten zu uns. Ohne zu fragen, fingen sie an, den Bau zu betrachten und abzumessen. Sie unterhielten sich mit leisen Stimmen.
„Was ist los?“, fragte ich nicht allzu freundlich, „was machen sie hier?“
Worauf einer der Männer mich ungeniert mit der Hand beiseiteschob, als ob ich ein Gegenstand gewesen wäre. Ohne Einladung kamen die beiden ins Haus und machten ihre Sache weiter. Sie reagierten nicht auf meine empörte Forderung, das Haus zu verlassen. Ich ging nach draußen, um die Nachbarn und die Polizei zu rufen. Da sah ich Otto. Mit einer Zigarette in der Hand stand er auf der anderen Seite der Straße, eines seiner Beine zuckte nervös. Da habe ich alles verstanden. Otto hatte unser Haus verpfändet. Offensichtlich geschah das, als Mutter noch lebte. Mamas Haus! Er hat es versoffen, unser Haus, es gehörte doch uns!
So hatten wir kein Dach mehr über dem Kopf.
Meine Kräfte hatten mich nun endgültig verlassen. Mit wem, wogegen sollte ich nur kämpfen? Ein schreckliches Gefühl hatte sich in meinem Bauch festgesetzt, dort hatte sich ein riesiger Wurm angesiedelt, der Tropfen um Tropfen Leben aus mir heraussaugte. Und doch schien es noch gestern, als wäre das Schlimmste bereits geschehen, dass es noch schlimmer gar nicht werden könnte. Wir hatten unsere Eltern verloren, wir wurden Waisen, es gab niemanden in der Welt, der sich um uns kümmern konnte, welche Not würde noch größer sein? Aber das hier war viel entsetzlicher. Gestern hatten wir wenigstens ein Zuhause, nun wurden wir obdachlos.
In einer Woche mussten wir das Haus verlassen.
Für ein paar Groschen verkaufte ich den häuslichen Kram und kaufte den Kindern ein paar Süßigkeiten und feste Schuhe. Wohin dann?
Diese Frage erledigte sich unerwartet von selbst. Jemand sorgte dafür, dass am Tag meiner größten Verzweiflung an unserer Schwelle drei Damen vom „Roten Kreuz“ standen, sie würden uns in ein Heim für Waisenkinder bringen. Ich zerfloss in Tränen. Zum ersten Mal nach Mutters Tod weinte ich! Es waren Tränen der Erniedrigung und der Dankbarkeit. Wenigstens hatten die Kinder ein Obdach und etwas zu essen. Aber dann kam eine neue böse Überraschung. Die Kleinen würden in verschiedene Kinderheime kommen – die Jungen und das Mädchen wurden getrennt, und ich wurde in einer geschlossenen Karmeliter-Klosterschule für junge Mädchen untergebracht. Karl und Thomas verabschiedeten sich schweigend, ohne zu lächeln, und Katrin schluchzte. Meine kleine Schwester wollte mich nicht aus ihrer Umarmung lassen. Als sie mir mit Gewalt entrissen wurde, griff sie immer noch mit ihren kleinen Händchen nach mir.
Kapitel 2
Es war später Abend, als ich ins große Backsteinhaus mit den breiten Korridoren kam. Die Wände waren bis zur Hälfte mit grauer Ölfarbe angestrichen. Es roch nach Desinfektionsmittel und nach etwas Ekligem, so riecht bitterste Armut. Zwei Nonnen, nicht mehr ganz junge Frauen mit finsteren Gesichtern, holten mich vom Eingang ab. Eine von ihnen brachte mich dann in ein Zimmer mit vergitterten Fenstern. Zehn Betten standen entlang der grauen Wände.
„Hier wirst du schlafen“, sagte endlich die Nonne und zeigte mir das Bett bei der Tür.
Auf der Decke lag ein zusammengelegtes graues Kleid mit weißem Hemdkragen. Ich musste mich umkleiden, davor aber in die Dusche. Der Duschraum befand sich am Ende des langen Korridors. Das trübe Lämpchen im Metallnetz gab nur wenig Licht, damit man sich nicht zufällig die Augen ausstechen konnte. Ausgezogen drehte ich den Griff des Wasserhahns, aus dem Duschkopf kam ein schwacher Strahl lauwarmen Wassers. In der an der Wand befestigten Seifenschale lag ein Stück dünner, verbrauchter Seife. Alles sah irgendwie schmutzig aus. Zitternd vor Kälte und Abneigung, fing ich an, mir Brust und Beine einzuseifen, dann auch den Bauch, unter den Armen und zwischen den Beinen.
„Du solltest mehr Scham besitzen“, sagte die mich aus dem Augenwinkel beobachtende Nonne, sie blieb an der Tür stehen, als ob sie mir nicht vertraute.
„Ich mache es, wie ich es kann“, antwortete ich ziemlich bissig, aber im Flüsterton.
Wie gut wäre es, wenn man mit Wasser alle seine Befürchtungen abwaschen könnte! Ich fühlte mich miserabel. Aber das Wasserbad, obwohl es kalt war, tat mir doch gut; es gab meinem ermüdeten Körper neue Kraft. Meine Seele wurde ruhiger, auch wenn es von kurzer Dauer war, es war viel wert.
Ich hatte das neue Kleid angezogen, das alte fürsorglich zusammengefaltet und wollte es ins Zimmer mitnehmen, aber die Nonne hielt mich an:
„Das schmeiß in den Korb, es kommt in den Ofen!“
„Warum?“, empörte ich mich, „es ist mein Kleid!“
„Aus hygienischen Gründen“, sagte die Nonne abgewendet und fügte im Flüsterton hinzu, so, als ob es ihr peinlich wäre, „da könnten Läuse drinnen sein …“
„Es gibt bei mir keine Läuse!“, empörte ich mich wieder.
„Niemand kann das wissen“, sagte die Nonne mit derselben leisen Stimme, in der doch ein metallischer Ton durchdrang. Dann fügte sie hinzu: „Und merke dir, Kind, bei uns hier spricht man nicht so laut!“
„Und doch“, erwiderte ich nochmals, „es sind meine Sachen. Ich habe keine Läuse. Ich bin überhaupt sehr sauber.“
„Sehr lobenswert, aber man darf sich selbst nicht loben, es ist unbescheiden.“
Es war sinnlos, weiter zu streiten.
Bald kamen wir wieder ins Schlafzimmer. Ich stand neben dem Bett, die Hände willenlos sinken lassend, und ahnungslos, was ich weiter machen sollte. Zum ersten Mal in meinem Leben war ich anscheinend ohne lebensnotwendige Aufgabe. Dieser erzwungene Müßiggang war für mich unfassbar. Ich verspürte wieder eine entsetzliche Leere in mir.
Bevor sie das Zimmer verließ, sagte die Nonne:
„Zum Abendessen hast du dich heute verspätet, ich bitte dich pünktlich zum abendlichen Gebet zu erscheinen!“
Ich blieb allein in diesem schrecklichen Zimmer, das mein neues Zuhause werden sollte. Die großen Fenster befanden sich so hoch oben, dass mein Kopf nur bis zum Fensterbrett reichte. Es kam tiefe Dämmerung, ich sah im Haus gegenüber bereits Licht in den Fenstern, es war nur das letzte Stockwerk und noch ein Stückchen des immer noch rosigen Himmels zu sehen. Schwaches Licht drang durch das staubige Glas ins Zimmer. Der Schalter war bei der Tür, aber so hoch, dass ich ihn kaum erreichen konnte. Das Lämpchen war genauso trüb wie im Duschraum. Auf den Betten lagen ausgewaschene Decken, deren Farbe schwer zu erraten war. Die Deckenecken waren nach oben gefaltet, so konnte man die gräulichen Laken sehen. Mein Nachttischchen hatte kein Schloss, aber wozu würde man es brauchen, wenn ohnedies keine persönlichen Sachen erlaubt waren? Mein Kleid wurde mir weggenommen und meinen mageren Handkoffer musste ich im Aufbewahrungsraum für das Gepäck lassen. Es herrschte hier eine Ordnung, der ich mich unterwerfen musste. Es war nicht mehr mein Leben.
Auf dem Korridor hörte ich gedämpften Lärm, bald kamen die Mädchen ordentlich und paarweise ins Zimmer. Alle ungefähr in meinem Alter, und alle hatten die gleichen grauen Kleider an mit weißen Hemdkragen. Mein Erscheinen hatte sie neugierig gemacht, die Mädchen betrachteten mich unverschämt. Um die Unschicklichkeit des Moments zu bewältigen, stellte ich mich selbst vor.
„Ich bin Elisabeth“, sagte ich, ohne zu lächeln.
Die Mädchen stellten sich auch eine nach der anderen vor, ich konnte alle Namen nicht sofort behalten, aber bereits am nächsten Tag wusste ich schon, wie sie hießen.
***
Zum Gebet ging es in die kalte Kapelle. Den Blick gesenkt, wiederholte ich seit Kindheit bekannte Worte, dachte aber an etwas anderes. In meinem Kopf liefen die Bilder des heutigen Tages ab und auch Bilder der vergangenen Jahre, wie in einem Film, der zufällig zurück gedreht wird. Die Beerdigung, Mamas Krankheit, die Kinder, der betrunkene Otto. Erst als die Glocke erklang, blickte ich nach oben. Aus dem Altar schauten mich traurige Augen der Gottesmutter an. Für einen Augenblick schien mir, sie schauten mir in die Seele. Lange konnte ich meine Augen von ihrem Gesicht nicht abwenden, so nah schien es mir zu sein. Man muss an das Gute glauben. Nur tiefer Glaube konnte mein Schiff vom endgültigen Niedergang retten. Seitdem meine Mutter erkrankte, hatte ich keinen Menschen, auf den ich mich stützen konnte, ich war selbst meine einzige Stütze in dieser Familie. Was würde nun auf mich zukommen? Ich war ganz allein.
Als wir ins Schlafzimmer zurückgekehrt waren, zitterte ich am ganzen Körper. Es war innere Kälte, die aus den Tiefen meiner Seele herauf kroch. Ich kannte sie bereits, es war die Kälte der Angst.
Die Mädchen hatten sich sofort hingelegt.
Unter meinem Kissen fand ich ein langes Nachthemd aus grobem Leinenstoff. Ich zog es an und legte mich ins harte Bett. Die Nonne blickte uns alle streng an.
„Elisabeth, Hände auf die Decke“, gab sie mir einen Befehl.
Obwohl es im Zimmer gar nicht warm war, lagen die Hände aller Mädchen auf den Decken.
„Aber mir ist kalt“, widersprach ich.
Die Schwester sagte nichts, stattdessen stand sie neben mir so lange, bis ich verstanden hatte, dass mein Widerstand vergeblich war. Erst dann schaltete sie das Licht aus und verließ das Zimmer. Nach einer Minute hatte ich die Decke bis zum Kinn hinaufgezogen, aber mir wurde davon kaum wärmer. Die Mädchen tuschelten ganz kurz und leise, dann hörte ich sie nur noch friedlich und tief atmen.
***
Niemals habe ich über den Sinn des Lebens nachgedacht. Meine Existenz bestand aus tausenden Sorgen, und es blieb mir zum Nachdenken keine Zeit. Für mich war es so, als ob es so sein musste, ein anderes Leben kannte ich nicht. Ich hatte auch keine Zeit, zur Seite zu schauen, um mein Leben mit dem anderer Menschen zu vergleichen oder in sie hineinzuschauen. Dafür hatte ich viel zu viel zu tun. Wenn mein Blick irgendwohin gerichtet war, war es in meine Zukunft. Ich konnte nicht genau sagen, wie ich mir diese vorstellte, aber ich wusste, ich würde alles tun, nur um unabhängig zu werden. Mein Leben wird nie so sein, wie das meiner Mutter! Als sie mir sagte, dass eine Frau unbedingt einen Mann braucht als einen Beschützer, war ich klein und glaubte ihr. Unser „Beschützer“ stützte jedoch niemanden, diese Rolle wurde stattdessen mir zugeteilt.
Mein Vater hatte recht, als er sagte, dass Bildung am Wichtigsten sei, auch eine Frau heutzutage müsse einen Beruf erlernen. Egal, was andere meinen, und viele meinten, dass es für eine Frau reichen würde, wenn sie sich um Haushalt und die Kinder kümmerte. Natürlich wäre es schön gewesen, wenn meine Mutter sich allein zu Hause um uns Kinder hätte sorgen können, aber es war leider anders. Sogar, wenn sie gesund geblieben wäre, wäre sie um ihr Leben mit Otto nicht zu beneiden gewesen.
Der Gedanke an meinen Vater ließ in mir wieder eine Welle des Zornes hochkommen. Im nächsten Moment war es mir aber peinlich. Und doch, warum, warum hatte er sich nicht geschont? Kann sich eine Frau auf einen Mann verlassen? Selbst wenn ein Mann edelmütig und gut ist, selbst wenn er seine Familie liebt, ist er ein ewig Reisender. Seine Interessen sind dennoch weit außerhalb der Familie. Sie wollen alle Eroberer, Forscher, Helden sein. Und so beginnen Kriege. Wenn jener Einsturz nicht geschehen wäre und mein Vater nicht durch einen Unfall ums Leben gekommen wäre, wenn er sich nicht bemüht hätte, seine Kameraden zu retten, wäre er vielleicht doch zum Frontdienst einberufen worden und im Krieg gefallen. Er wurde zusammen mit anderen verschüttet, als er ihnen helfen wollte. Mir wurde gesagt, mein Vater wäre ein Held, und ich solle auf ihn stolz sein. Ich bin auch stolz. Und ich weiß, auch wenn mein Vater gewusst hätte, dass mein Leben und das meiner Mutter jenem Einsturz auch zum Opfer gefallen wären, hätte sich nichts geändert. Nein, daran darf ich nicht denken. Man würde mich auch nicht verstehen.
Ich hatte immer das gemacht, was ich machen musste und erledigte das, was keine außer mir erledigt hätte. Ich war in ständiger Bewegung, die gewisse „zentrifugale“ Kraft hielt mich und meine Welt im Gleichgewicht. Auf einmal war wieder alles zusammengebrochen. Es gab nichts mehr zu tun, ich fühlte keine Kraft, und meine Welt gab es auch nicht mehr.
Alles war Vergangenheit, nichts Voraussehbares, es blieb mir nur die Leere. Plötzlich, zum ersten Mal wurde mir die ganze Kraft der Liebe zu meiner Mutter bewusst. Früher hatte ich keine Zeit, darüber nachzudenken, meine Zeit teilte sich zwischen Sorgen um meine Familie und meinen schulischen Aufgaben. Es gab keine Sorgen mehr, es gab nichts, was ich mein hätte nennen können. Meine Mutter war gestorben. Auch wenn sie sich bereits seit Jahren nicht mehr um mich kümmern konnte, war sie da, und es war wichtig, dass es doch jemanden gab, der mich liebte, einen Menschen, auf den ich mich wenigstens in Gedanken stützen konnte. Dieses Gefühl war wichtig. Auch als sie krank war und ans Bett gefesselt, war sie da. Wir hatten unser Häuschen, ich hatte mein Zimmerchen, mein Bett, meine Bücher, ärmliche, aber doch meine Kleider und nun ... Wie bettelarm mein voriges Leben war, im Vergleich zu dem, was ich nun hatte, war ich damals noch reich. Ich hatte gar nichts mehr. Ich lag





























