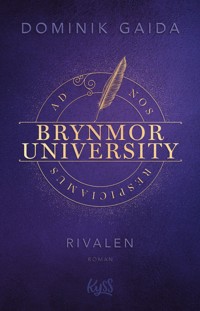
9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: ROWOHLT E-Book
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Serie: Brynmor-University-Trilogie
- Sprache: Deutsch
Zwei verfeindete Familien und eine Liebe, stärker als alle Widerstände: «Romeo und Julia» in modernem, queerem Gewand. Josh war klar, dass ein Studium an der Brynmor University eine Herausforderung wird. Aber genau das wollte er: seine Grenzen austesten. Wachsen. Mutig sein. Hätte er allerdings gewusst, dass auch Finn Godwins an der altehrwürdigen Universität in Cornwall studieren will, wäre er nie hierhergekommen. Nicht nur, dass ihre Familien auf eine jahrzehntelange Fehde zurückblicken, auch er selbst ist in der Vergangenheit immer wieder mit Finn aneinandergeraten. Als sie kurz nach Semesterbeginn für dieselbe Rolle in einem Theaterstück vorsprechen, flammt ihre Rivalität von Neuem auf. Doch dann kommen sie sich bei den Proben ungewollt näher. Und je mehr Zeit vergeht, desto weniger können sie das Knistern zwischen ihnen verdrängen … Band 3 der Brynmor-University-Reihe. Unabhängig lesbar.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 485
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Dominik Gaida
Brynmor University – Rivalen
Roman
Über dieses Buch
Wie viel Mut braucht es für die Liebe?
Josh war klar, dass ein Studium an der Brynmor University eine Herausforderung wird. Aber genau das wollte er: seine Grenzen austesten. Wachsen. Mutig sein. Hätte er allerdings gewusst, dass auch Finn Godwins an der altehrwürdigen Universität in Cornwall studieren will, wäre er nie hierhergekommen. Nicht nur, dass ihre Familien auf eine jahrzehntelange Fehde zurückblicken, auch er selbst ist in der Vergangenheit immer wieder mit Finn aneinandergeraten. Als sie kurz nach Semesterbeginn für dieselbe Rolle in einem Theaterstück vorsprechen, flammt ihre Rivalität von Neuem auf. Doch dann kommen sie sich bei den Proben ungewollt näher. Und je mehr Zeit vergeht, desto weniger können sie das Knistern zwischen ihnen verdrängen …
Zwei verfeindete Familien und eine Liebe, stärker als alle Widerstände: «Romeo und Julia» in modernem, queerem Gewand.
Dieses Buch enthält potenziell triggernde Inhalte. Wenn du dich darüber informieren möchtest, findest du auf unserer Homepage unter www.endlichkyss.de/brynmor3 eine Content-Note.
Vita
Dominik Gaida, 1989 geboren, arbeitet nach einem Freiwilligen Sozialen Jahr in Südafrika und seinem Psychologie-Studium heute als Psychotherapeut. Er hat bereits unter Pseudonym mehrere Hörbuchskripte geschrieben, mit der Brynmor-University-Trilogie tritt er erstmals mit seinem eigenen Namen an die Öffentlichkeit. Alle Bände der Reihe sind unabhängig voneinander lesbar. Als Own-Voice-Autor möchte er zur Sichtbarkeit der LGBTQIA+-Community beitragen. Zurzeit arbeitet er an einer neuen Reihe. Er ist auf Instagram (@dominikgaida) und TikTok (@dominik.gaida) zu finden.
Impressum
Veröffentlicht im Rowohlt Verlag, Hamburg, Oktober 2024
Copyright © 2024 by Rowohlt Verlag GmbH, Hamburg
Redaktion: Christin Ullmann
Die Zitate auf den Seiten 84, 92, 94, 134, 198, 208, 264, 298f, 369 und 378 stammen aus Was ihr wollt von William Shakespeare, in der Übersetzung von August Wilhelm Schlegel.
Covergestaltung ZERO Werbeagentur, München
Coverabbildung Shutterstock
ISBN 978-3-644-02063-4
Schrift Droid Serif Copyright © 2007 by Google Corporation
Schrift Open Sans Copyright © by Steve Matteson, Ascender Corp
Dieses Werk ist urheberrechtlich geschützt, jede Verwertung bedarf der Genehmigung des Verlages.
Die Nutzung unserer Werke für Text- und Data-Mining im Sinne von § 44b UrhG behalten wir uns explizit vor.
Hinweise des Verlags
Abhängig vom eingesetzten Lesegerät kann es zu unterschiedlichen Darstellungen des vom Verlag freigegebenen Textes kommen.
Alle angegebenen Seitenzahlen beziehen sich auf die Printausgabe.
Im Text enthaltene externe Links begründen keine inhaltliche Verantwortung des Verlages, sondern sind allein von dem jeweiligen Dienstanbieter zu verantworten. Der Verlag hat die verlinkten externen Seiten zum Zeitpunkt der Buchveröffentlichung sorgfältig überprüft, mögliche Rechtsverstöße waren zum Zeitpunkt der Verlinkung nicht erkennbar. Auf spätere Veränderungen besteht keinerlei Einfluss. Eine Haftung des Verlags ist daher ausgeschlossen.
www.rowohlt.de
Für alle, die auf der Suche nach einem sicheren Ort sind
«My bounty is as boundless as the sea,
My love as deep; the more I give to thee,
The more I have, for both are infinite.»
Romeo and Juliet, William Shakespeare
Playlist
You Don’t Own Me – Tamino
Marigolds – Kishi Bashi
Valse de Beaufort – Etienne Balestre
Shake It Out – Florence + The Machine
Lights Up – Harry Styles
The Labyrinth Song – Asaf Avidan
First Time He Kissed a Boy – Kadie Elder
Everything I Wanted – Billie Eilish
Stand By Me – Florence + The Machine
Annie’s Song – John Denver
Transformation of Acceptance – The Irrepressibles
Prolog
Josh
Die Welt versinkt in einem Meer aus Feuer und Rauch.
Die Tür. Wo zur Hölle ist die Tür?
Panisch drehe ich mich im Kreis, aber die Flammen haben mich bereits eingeschlossen. Wie ein wild gewordenes Ungeheuer fressen sie sich durch die meterhohen Kulissen. Die Bäume Illyriens, der Palast des Herzogs Orsino und der Fels aus Pappmaschee – die ganze mühevolle Arbeit der letzten Monate geht in Feuer auf. Und es gibt nichts, absolut nichts, was ich dagegen tun kann.
Tränen schießen mir in die Augen. Weil das, was gerade passiert, meine Schuld ist. Ich hätte heute Abend überhaupt nicht in die Tudor Hall kommen dürfen. Ich hätte …
Nein, nein, nein.
Wenn ich hier irgendwie lebend herauskommen will, muss ich mich zusammenreißen. Ich muss mich konzentrieren und …
Irgendwo hinter mir höre ich einen erstickten Schrei. Er wird vom Knistern der Flammen und Bersten der Holzbalken überlagert, aber ich habe ihn mir ganz bestimmt nicht eingebildet.
Was jetzt?
Für einen Moment stehe ich wie gelähmt da. Hin- und hergerissen zwischen Herz und Verstand.
Lauf, bring dich in Sicherheit, sagt mein Verstand.
Du musst ihm helfen, widerspricht mein Herz.
Ich zögere noch kurz. Dann treffe ich eine Entscheidung. Trotz allem, was passiert ist – oder vielleicht gerade deswegen –, kann ich ihn nicht einfach im Stich lassen.
Entweder schaffen wir beide es hier raus.
Oder keiner von uns.
Ich blinzle die Tränen weg und stolpere los. Bete, dass ich nicht in die falsche Richtung laufe und damit die einzige Chance verspiele, die ich vielleicht habe.
Mit jedem Atemzug kommt weniger Sauerstoff in meinen Lungen an. Ein paar Minuten, das ist alles, was mir bleibt. Ein paar Minuten, um einen Weg durch das Flammenmeer zu finden und es nach draußen zu schaffen.
Ein lautes Knacken zu meiner Linken, und dann, mit einer Lautstärke, die mir schier das Trommelfell zerreißt, stürzen die Kulissen in sich zusammen. Kopflos taumle ich zurück und halte meine Arme vors Gesicht. Keine Sekunde später saust ein scharfkantiger Gegenstand an mir vorbei, zerfetzt meinen Pullover und schlitzt mir den Oberarm auf.
Scheiße.
So fest ich kann, presse ich die Zähne aufeinander. Hoffe, dass das unerträgliche Pulsieren zumindest ein bisschen abflacht. Als es das nicht tut, riskiere ich einen Blick. An meinem Arm klafft eine große, hässliche Fleischwunde.
Das Blut läuft in Strömen über meinen Ellbogen und sammelt sich in einer Lache auf dem Boden. Jetzt habe ich wirklich keine Zeit mehr. Jetzt zählt jede Sekunde.
Und mit diesem Gedanken setze ich mich wieder in Bewegung und stolpere meinem – unserem – Schicksal entgegen.
Drei Monate vorher
Kapitel 1
Josh
«Josh. Willst du allein sein?»
Weil der Sand die Schritte meiner Schwester gedämpft hat, habe ich überhaupt nicht mitbekommen, wie sie an mich herangetreten ist. Jetzt steht Grace plötzlich neben mir, in einem cremefarbenen Top mit langen Ärmeln und einer Jeans, die hier und da zerrissen ist.
«Wenn du willst, dass ich gehe, dann gehe ich», sagt sie schnell und streicht sich eine schwarze Strähne aus der Stirn.
Ich blinzle gegen das strahlende Sonnenlicht an und sehe zu ihr hoch, unschlüssig, was ich darauf erwidern soll.
«Ist schon okay», antworte ich, nicht sicher, ob ich das wirklich so meine oder sie einfach nur nicht vor den Kopf stoßen will.
«Bist du sicher?», fragt Grace, als würde sie spüren, dass ich nicht ganz ehrlich zu ihr bin.
Ich zögere. «Ja», antworte ich schließlich, und jetzt meine ich es auch so.
Grace wirkt zwar noch immer nicht überzeugt, hakt aber kein weiteres Mal nach. Während sie ihre Sneaker auszieht und sich neben mich auf den weichen Untergrund fallen lässt, beobachte ich sie aus dem Augenwinkel. Aufgrund unseres Altersunterschiedes – Grace ist Anfang dreißig und damit knapp zehn Jahre älter als ich – haben wir mehr Zeit getrennt voneinander verbracht, als zusammen unter einem Dach gelebt zu haben. Als ich in die Schule kam, war sie schon in der Pubertät. Während ich auf dem Internat gemobbt wurde, studierte sie in Yale. Und später, als sie nach England zurückkehrte, lebte ich bei unserer Tante in Südafrika. Jetzt arbeitet sie in Paris, verbringt ihren Urlaub aber gerade bei unseren Eltern. Es ist das erste Mal seit mehreren Jahren, dass wir beide gleichzeitig zu Hause sind.
«Woher wusstest du, dass ich hier bin?»
«Mum hat es mir gesagt. Sie meinte, dass du dich früher schon immer hierher zurückgezogen hast, wenn dir alles zu viel geworden ist. Ist dir gerade alles zu viel?»
Ich schlucke. Statt ihr eine Antwort zu geben, wende ich den Blick von ihr ab und lasse ihn über die weitläufige Morecambe Bay schweifen. Auf der anderen Seite der Bucht ragen die halb verfallenen Ruinen von Piel Castle in den wolkenlosen Himmel. Die einzigen Geräusche, die zu hören sind, sind das beständige Rauschen der Brandung und das Kreischen einer einzelnen Möwe, die über uns ihre Kreise dreht.
«Josh?»
«Ja?»
«Kann es sein … Ich meine … Hast du Liebeskummer oder so?»
Erst jetzt sehe ich ihr wieder in die Augen. «Liebeskummer?», frage ich verwundert. «Wie kommst du denn darauf?»
Grace zuckt mit den Schultern. «Na ja, irgendetwas beschäftigt dich ziemlich. Etwas, worüber du mit Mum und Dad nicht sprechen willst. Da habe ich wohl einfach auf Liebeskummer getippt.»
«Ich …», setze ich an, verstumme dann aber.
Kann ich ihr erzählen, was mit mir los ist? Soll ich es wagen, mich zu öffnen? Meine Therapeutin aus Pretoria würde mit Sicherheit Ja sagen. Und Youma, meine beste Freundin, würde mir dieselbe Antwort geben. Weil es immer besser ist, über die Dinge zu sprechen, die einem auf der Seele liegen, als sie in sich hineinzufressen. Aber das ist leichter gesagt als getan. Und nur mal angenommen, ich würde Grace die Wahrheit sagen. Wo würde ich anfangen? Wie könnte ich das heillose Chaos in meinem Kopf erklären und wie die vielen Fragen, die wie Feuerwerkskracher wild durcheinanderschießen, in einen halbwegs sinnvollen Zusammenhang bringen?
«Du musst nicht darüber sprechen, wenn du nicht willst», sagt Grace und streckt eine Hand aus, zieht sie aber sofort wieder zurück. «Im Grunde geht es mich ja auch gar nichts an. Ich dachte nur …» Sie holt tief Luft. «Na ja, es ist nur so, dass Mum und Dad sich Sorgen um dich machen. Ich glaube, sie haben ziemliche Angst, dass es dir noch einmal so schlecht gehen könnte wie damals.»
Ihre Worte versetzen mir einen plötzlichen Stich ins Herz.
Wie damals …
«Hat Mum dich hierhergeschickt?», frage ich mit zugeschnürter Kehle.
Grace schüttelt den Kopf. «Nein, hat sie nicht. Ich bin hier, weil ich mir auch Sorgen um dich mache, kleiner Bruder.»
Ich sehe ihr fest in die Augen. Ich will nicht, dass sich irgendjemand um mich Sorgen machen muss. Weder meine Eltern. Noch Grace. Aber wenn ich ehrlich bin, kann ich es ihnen auch nicht verdenken. Wenn ich tagelang kaum ein Wort über die Lippen bekomme, mich in meinem Zimmer einsperre oder ganze Nachmittage am Strand sitze und Löcher in die Luft starre – wer würde sich da keine Sorgen machen? Vor allem, wenn es mir vor einigen Jahren so schlecht ging, dass ich an sozialen Ängsten und Panikattacken gelitten habe?
Und trotzdem … Trotzdem zögere ich noch immer, ihr zu sagen, was mich beschäftigt. Ich kann ihr einfach nicht alles sagen. Nicht nur, weil es so verdammt kompliziert ist. Sondern auch, weil manche dieser Dinge besser nicht an ihre Ohren dringen sollten. Aber vielleicht kann ich ihr zumindest einen kleinen Einblick in mein Inneres geben. Damit weder sie noch meine Eltern sich zu viele Gedanken machen müssen.
«Es ist nicht wie damals», sage ich zögerlich. «Na ja, es ist natürlich auch nicht alles gut. Aber ich fühle mich bei Weitem nicht so schlecht wie im Internat. Und weil du gefragt hast, nein, Liebeskummer habe ich keinen.»
Bevor Grace mir eine weitere Frage stellen kann, ziehe ich einen mehrfach gefalteten Zettel aus der Seitentasche meiner Jeans und reiche ihn ihr.
Auf dem Zettel stehen, in krakeliger Schrift, ein Name und eine Handynummer.
«Nate? Wer ist Nate?!», fragt Grace irritiert. «Ich dachte, du hättest keinen Liebes-»
«Habe ich auch nicht. Nate ist der Typ, den ich im letzten Semester bei Rektor Bellingham verpfiffen habe.»
Grace runzelt die Stirn.
«Er hatte etwas mit einem Dozenten am Laufen. Ich habe die beiden beobachtet, wie sie sich auf dem Campus geküsst haben. Und bin zum Rektor gegangen.»
Was ich getan habe, schien mir in diesem Moment das einzig Richtige zu sein. Weil Nate gegen die Regeln verstoßen hat und ich in der Vergangenheit am eigenen Leib gespürt habe, welche Konsequenzen Regelübertritte nach sich ziehen können. Statt lange darüber nachzudenken – oder noch besser: statt das Gespräch mit Nate zu suchen –, bin ich einfach zu Bellingham marschiert. Etwas, das ich seitdem jeden Tag aufs Neue bereut habe. Nate war mein Freund. Er war einer der wenigen, in dessen Gegenwart ich mich sicher gefühlt habe. Bei dem ich mir nicht wie ein Außenseiter vorkam. Und ausgerechnet diesen Menschen habe ich verraten.
Wenn ich in der Zeit zurückreisen und den Moment ungeschehen machen könnte, ich würde es sofort tun.
«Warum trägst du einen Zettel mit seinem Namen und seiner Nummer mit dir herum?»
«Am Tag seiner Abreise hat er Youma, einer Freundin von uns, den Zettel zugesteckt. Er hat sie gebeten, ihn mir zu geben. Damit ich mich bei ihm melde. Und wir uns aussprechen können.»
Bei der Erinnerung daran, wie mein letztes Gespräch mit Nate in der Schwimmhalle abgelaufen ist, beschleunigt sich mein Herzschlag.
«Wir sind nicht befreundet», hat er mir entgegengeschleudert. Und: «Hast du irgendeine Ahnung, was du angerichtet hast?» Und: «Vielleicht ist es das Beste, wenn wir uns in Zukunft aus dem Weg gehen.»
Seine Worte waren wie Messerstiche. Umso mehr hat es mich verwundert, als Youma mir den Zettel mit seiner Nummer gegeben hat. Zwischen unserem Gespräch in der Schwimmhalle und seinem Abschied muss irgendetwas passiert sein, das seine Meinung zumindest in Bezug auf den letzten Punkt geändert hat. Warum sonst hätte er Youma darum gebeten, mir seine Nummer zu geben? Aber allein die Vorstellung, dass ich ihn anrufe und er seine Vorwürfe doch nur wiederholt … Nein, daran will ich nicht einmal denken.
«Was glaubt dieser Nate denn, worüber ihr euch aussprechen müsst?», fragt Grace kopfschüttelnd. «Dieser Dozent hat etwas getan, das gegen alle Regeln verstößt. Du bist zum Rektor gegangen und hast ihm erzählt, was du beobachtet hast. Ende der Geschichte.»
«Ja. Ja, vermutlich hast du recht», sage ich, auch wenn es sich absolut nicht danach anfühlt.
«Hier.» Entschlossen gibt Grace mir den Zettel wieder zurück.
«Du würdest dich nicht bei ihm melden, wenn du an meiner Stelle wärst.» Es ist keine Frage. Es ist eine Aussage.
«Nein, würde ich nicht. Ich würde den Zettel verbrennen, die Sache vergessen und von jetzt an einfach nach vorne schauen.»
Was sie sagt, überrascht mich nicht. Das ist Grace, durch und durch. Das ist die Haltung, mit der sie alle Probleme angeht. Zielstrebig, pragmatisch, zukunftsorientiert. Und immerhin hat sie mit genau dieser Einstellung ihr Jurastudium gemeistert und es in eine der angesehensten Anwaltskanzleien von Paris geschafft. Aber ich? Ich bin nicht wie sie. Ich bin ganz und gar nicht wie sie. Und selbst wenn ich es wäre und die Sache mit Nate abschließen könnte, wäre das mit dem Nach-vorne-Schauen trotzdem schwierig.
Denn in der Zukunft wartet das nächste, noch größere Problem auf mich.
Ein Problem, über das ich im Gegensatz zur Sache mit Nate nicht ein Wort verlieren darf.
«Josh, was passiert ist, ist passiert», sagt Grace nachdrücklich. «Keine Ahnung, worüber dieser Nate mit dir sprechen will. Aber wenn du nicht mit ihm sprechen willst, musst du es auch nicht tun. Du bist niemandem Rechenschaft schuldig. Was zählt, ist, dass es dir gut geht. Dass du das, was du in den letzten Jahren erreicht hast, nicht aufs Spiel setzt. Dass du gut auf dich und deine Gesundheit aufpasst. Du weißt, dass ohne Gesundheit alles andere nichts ist.»
Ja, natürlich, und wie ich das weiß. Ich habe es auf die denkbar schmerzhafteste Weise lernen müssen.
«Das stimmt», sage ich, nachdem ich ihre Worte noch ein paar Sekunden lang auf mich wirken gelassen habe. «Ich sollte nichts tun, nur damit eine andere Person sich besser fühlt.»
Grace lächelt. Sie streckt ein weiteres Mal ihre Hand aus. Diesmal zieht sie sie nicht zurück, sondern legt sie auf meine Schulter.
«Ich sage dir das nicht oft genug, aber ich hab dich lieb, kleiner Bruder. Ich will, dass du glücklich bist. Genauso wie Mum und Dad. Wenn es also irgendetwas gibt, das wir für dich tun können, lass es uns wissen, okay? Wir sind immer für dich da.»
Ihre Worte erfüllen mich mit mehr Wärme, als alle spätsommerlichen Sonnenstrahlen es je bewerkstelligen könnten.
«Danke», sage ich, wobei sich mein Mund seltsam trocken anfühlt.
«Nichts zu danken», erwidert Grace. Dann nimmt sie ihre Sneaker, steht auf und streicht sich die Sandkörner von den Beinen. «Bleibst du noch hier oder kommst du mit zurück nach Hause?»
Ich lächle. «Ich bleibe noch ein bisschen hier.»
«Dann sehen wir uns beim Abendessen. Bis später, kleiner Bruder.»
«Bis dann, große Schwester», sage ich, hebe zum Abschied die Hand und sehe ihr hinterher, bis sie am anderen Ende des Strands hinter ein paar Felsen verschwunden ist. Dann wende ich mich wieder der Morecambe Bay zu. Erleichtert, weil ich zumindest die Sache mit Nate einmal loswerden konnte. Schuldig, weil ich nicht will, dass sie und meine Eltern sich Sorgen um mich machen. Aber auch ein bisschen aufgewühlt, weil mein eigentliches Problem nicht in der Vergangenheit liegt. Sondern in der Zukunft.
Ein Problem, das ich nicht einfach so in Flammen aufgehen lassen kann wie einen Zettel.
Ein Problem mit dem Namen Finneas Godwins.
Die Temperaturen sind auch am Abend noch so mild, dass wir auf der großen Terrasse unseres Anwesens mit Blick auf die weitläufige Gartenanlage essen können.
Als ich durch die hohe, gläserne Doppelflügeltür trete, sitzen Mum und Grace bereits an der mit einem weißen Tischtuch bedeckten Tafel. Von Dad fehlt jede Spur.
«Josh», sagt Mum und winkt mich zu sich herüber. Sie wirkt wie eine ältere Version von mir: hochgewachsen, sehr schlank, mit heller Haut und schwarzen, schulterlangen Haaren. Der große Unterschied zwischen Mum und mir ist nicht sichtbar, sondern offenbart sich erst, wenn man uns besser kennt. Während ich mir nämlich – wie Grace – nie viel aus unserem Nachnamen und unserer Familiengeschichte gemacht habe, trägt Mum beides wie einen Schutzschild vor sich her.
Lächelnd, um alle Sorgen zu zerstreuen, setze ich mich auf die gegenüberliegende Seite der Tafel. Gerade, als ich sie fragen will, wo Dad steckt, erspähe ich ihn in einiger Entfernung im Schatten einer alten Tanne. Wie so oft hat er das Handy fest ans Ohr gepresst.
«Er hat uns gebeten, schon mal mit dem Essen anzufangen», sagt Mum, die meinem Blick gefolgt ist.
«Gibt es Ärger?» Nach all den Problemen, mit denen Dad sich in den letzten Monaten herumschlagen musste, wäre es zur Abwechslung ganz schön, wenn die Dinge wieder etwas ruhiger laufen würden.
Mum wiegt den Kopf hin und her. «Ja, gibt es», sagt sie vage. «Aber um den kümmert er sich schon.»
Bevor ich ihr eine weitere Frage stellen kann, läutet sie die kleine Silberglocke, die vor ihr auf dem Tisch steht. Als hätten sie nur darauf gewartet, treten Walther und Ryan, zwei unserer Bediensteten, durch die Terrassentür.
«Cock-a-Leekie, Lady Violet», sagt Walther, während er und Ryan die Teller vor uns abstellen. «Bon Appetit.»
So lautlos, wie sie aufgetaucht sind, verschwinden sie auch wieder.
Nach ein paar Minuten beendet Dad sein Telefonat und gesellt sich zu uns. Wenn Mum eine ältere Version von mir ist, ist er eine ältere Version von Grace. Sie haben dieselben feinen Gesichtszüge und dieselben dunkelbraunen Augen. Allerdings sind Dads Haare an den Schläfen bereits ergraut, und seine Stirn ist von Falten gezeichnet.
«Sehr schön, ihr habt nicht auf mich gewartet», sagt er, gibt Mum einen Kuss auf die Wange und setzt sich auf den freien Stuhl neben ihr. Dann wendet er sich an mich. «Alles gut bei dir, Josh? Hast du schon gepackt?»
Ich lächle noch immer, auch wenn es spätestens jetzt etwas Gezwungenes an sich hat. «Alles bestens. Muss nur noch ein paar Kleinigkeiten zusammenpacken, dann bin ich fertig.»
Dad nickt zufrieden. «Morgen früh haben wir nicht allzu viel Zeit. Dein Zug nach Plymouth geht um …»
«Ich bin immer noch der Ansicht, dass wir Josh nach Brynmor fahren sollten», fällt Mum ihm ins Wort und tupft sich den Mund mit einer Stoffserviette ab.
Dad will etwas erwidern, aber ich komme ihm zuvor. «Ist schon in Ordnung», sage ich, um eine sichere Stimme bemüht. Wenn sich meine Rückkehr nach Brynmor schon nicht länger aufschieben lässt, will ich wenigstens noch ein bisschen Zeit für mich haben. Und die habe ich in der Anonymität eines Großraumabteils viel eher als auf der Rücksitzbank unseres Maybachs.
Mum zieht eine Augenbraue hoch, betrachtet mich prüfend, sagt aber nichts. Und damit ist die Sache erledigt.
Sobald wir mit der Hühnersuppe fertig sind, tragen Walther und Ryan den Hauptgang auf: Filet Wellington mit Gemüse und Kartoffelschaum. Die Sonne steht mittlerweile so tief, dass die letzten Strahlen die Spitzen der Tannen kitzeln. Das Gespräch hat sich Grace und Paris zugewandt. Während ich den Beginn des neuen Semesters am liebsten bis zum Sankt-Nimmerleins-Tag vor mir herschieben würde, kann Grace ihre Vorfreude auf die kommenden Monate kaum verbergen.
«… Charles hat mir meinen ersten großen Fall übertragen. Ich werde Tag und Nacht beschäftigt sein. Aber ich würde mich natürlich trotzdem freuen, wenn ihr mich besuchen kommt. Und wenn es nur für ein, zwei Tage ist.»
Mum und Dad wechseln einen kurzen Blick, der mehr als tausend Worte sagt.
«Wir würden wirklich gern kommen», sagt Dad, «aber wir wollen nichts versprechen, was wir nicht halten können. Und so, wie es momentan aussieht …» Seine Stimme verebbt, und er schüttelt den Kopf. «Es hängt wohl ganz davon ab, wie der weitere Prozess verläuft.»
Der Prozess. Ich weiß natürlich genau, wovon er spricht. So wie ich weiß, welchen Ärger es in den letzten Monaten gegeben hat. Ich bin mit den Streitigkeiten zwischen Dad und Sir Alistair Godwins gut vertraut. Nein, ich bin nicht nur gut mit ihnen vertraut. Ich bin bestens mit ihnen vertraut. So wie mit allen anderen Konflikten, die sich in den letzten Jahrzehnten zwischen den Fitz-Stuarts – uns – und den Godwins zugetragen haben. Der Verleumdungsprozess, den Sir Alistair gegen Dad angezettelt hat, ist nur die Spitze des Eisbergs.
«Ich weiß nicht, was an dieser Sache so kompliziert sein soll», sagt Grace seufzend. «Es steht Aussage gegen Aussage. Sir Alistair behauptet, dass du ihn verunglimpft hast. Du streitest das ab. Und bislang hat es nicht den Anschein, als könnte Sir Alistair irgendeinen Zeugen aus dem Ärmel zaubern, der seine Sicht der Dinge stützt. In dubio pro reo. Im Zweifel für den Angeklagten.»
«Wir kennen Sir Alistair gut genug, um uns sicher sein zu können, dass er die eine oder andere Überraschung bereithält.»
Grace zuckt mit den Schultern. «Selbst wenn. Es wird trotzdem prozessfreie Wochen geben. Eine gute Gelegenheit, um ein bisschen Abstand zu der ganzen Sache zu bekommen.»
«Vielleicht wird es prozessfreie Wochen geben», sagt Dad und wiegt dabei den Kopf hin und her. «Vielleicht auch nicht. Mir ist es lieber, mich auf das denkbar schlechteste Szenario vorzubereiten, als mich falschen Hoffnungen auszusetzen.» Beschwichtigend streckt er die Hand aus, allerdings macht Grace keine Anstalten, sie zu nehmen. «Sieh es mal so, Liebling: Du wirst so sehr mit deinem eigenen Fall beschäftigt sein, dass dir überhaupt nicht auffällt, wenn wir es dieses Jahr nicht mehr nach Paris schaffen.»
Grace öffnet noch einmal den Mund. Als wolle sie einen weiteren Anlauf starten, Mum und Dad vom Gegenteil zu überzeugen. Aber dann schließt sie ihn wieder und wendet sich schweigend ihrem Filet zu.
Die Luft knistert vor Spannung, und für ein paar Minuten sagt niemand auch nur ein Wort. Ich atme erst wieder auf, als Walther und Ryan die Teller abräumen und ich mich unter dem Vorwand, dass ich schon ziemlich satt sei und keinen Nachttisch mehr wolle, in mein Zimmer zurückziehen kann.
Von der großen Halle führt mich mein Weg über die breite Treppe in den ersten Stock. Mein Zimmer befindet sich am Ende des langen Gangs. Sobald ich die Tür hinter mir geschlossen habe, lehne ich mich dagegen und sehe mich in dem Raum um, der früher einmal mein Kinderzimmer gewesen ist. Von ein paar Klamotten, meiner X-Box und meinem Laptop abgesehen gibt es hier so gut wie keine persönlichen Gegenstände mehr. Es wirkt wie das Zimmer eines Fremden, in dem ich zufällig für ein paar Wochen zu Besuch bin. Was kein Wunder ist, weil ich die meiste Zeit nach meiner Rückkehr aus Südafrika in Brynmor verbracht habe.
Ich streife die Schuhe ab und lasse mich aufs Himmelbett fallen. Um mich abzulenken – um nicht an Sir Alistair Godwins, den Verleumdungsprozess und vor allem nicht an seinen Sohn Finneas zu denken –, ziehe ich mein Handy aus der Hosentasche. Dabei rutscht der Zettel mit Nates Nummer heraus, dreht eine Pirouette in der Luft und landet neben dem Bett auf dem Boden.
Für einen Moment zögere ich. Ich könnte ihn einfach dort liegen lassen. Damit würde sich die Sache von allein erledigen und ich müsste mir nicht länger den Kopf darüber zerbrechen, was ich tun soll. Die Vorstellung hat etwas sehr Verlockendes an sich. Aber dann hebe ich ihn doch auf und lege ihn sorgfältig auf den Nachttisch.
Nach einem letzten Blick auf den Zettel wende ich mich wieder meinem Handy zu, öffne Spotify und lasse You don’t own me laufen. Parallel schreibe ich mit Youma hin und her, die zufälligerweise gerade online ist.
Josh: Wann kommst du in Brynmor an?
Youma: Wenn mein Flug pünktlich landet, bin ich morgen Mittag da Und du?
Josh: Irgendwann nachmittags. Ich fahre mit dem Zug nach Plymouth und von da aus weiter nach St. Keyne. Braucht ein bisschen, ist aber schon okay.
Youma: Oh, vielleicht triffst du Samuel! Er und Connor wollen morgen auch von London nach Plymouth fahren
Ich schreibe ihr nicht, dass ich nicht gerade scharf darauf bin, Samuel und Connor wiederzusehen. Die beiden sind ebenfalls mit Nate befreundet. Und obwohl wir uns immer gut verstanden haben, befürchte ich, dass sie sauer auf mich sein könnten. Zumindest Samuel hat sich in den letzten Wochen des Semesters ziemlich abweisend verhalten. Hoffentlich rutsche ich nicht wieder in eine Außenseiterrolle.
Wie damals auf dem Internat.
Josh: Ja, vielleicht
Nach ein paar Minuten wünscht Youma mir eine gute Nacht und geht offline. Für eine ganze Weile sitze ich unschlüssig auf dem Bett. Betrachte den gefalteten Zettel auf dem Nachttisch. Höre Grace’ Stimme, die sagt, dass ich mit der Sache abschließen und nach vorne schauen soll.
Nach vorne schauen.
Nach vorne schauen …
Ich stoße einen Seufzer aus und vergrabe mein Gesicht im Kissen. Und dann, einem plötzlichen Impuls folgend, tue ich etwas, von dem ich weiß, dass es ein riesengroßer Fehler ist. Weil es in der Vergangenheit schon ein Fehler war. Aber irgendwie kann ich nicht anders, als ihn immer wieder aufs Neue zu begehen.
Ich öffne Instagram und tippe Finn Godwins in die Suchleiste ein. Augenblicklich springt mir sein Profilbild entgegen. Hellbraune Haare, bernsteinfarbene Augen mit goldenen Sprenkeln und ein strahlendes Lächeln, das meinen Herzschlag jedes Mal beschleunigt und mich zum Dahinschmelzen bringt. Er hat nur noch entfernte Ähnlichkeit mit seinem jüngeren Ich. Die Brille, die er früher getragen hat, ist in den letzten Jahren zumindest auf den Bildern Kontaktlinsen gewichen, und während seine Wangen früher glatt waren, sind hier und da jetzt ein paar Bartstoppeln zu sehen.
Langsam scrolle ich durch seine Posts, darauf bedacht, nicht versehentlich eines der Bilder anzuklicken oder – und das wäre wirklich das absolute Worst-Case-Szenario – versehentlich ein Like zu hinterlassen.
Einer der Posts zeigt Finn an Silvester mit einer Gruppe von Menschen, die ich nicht kenne, im Hintergrund ist Edinburgh Castle zu sehen. Ein anderer Post ist an irgendeinem schottischen See entstanden. Finns Kopf ragt aus dem dunkelblauen Wasser, ein paar Strähnen hängen ihm ins Gesicht, er hat den Mund zu einem Freudenschrei aufgerissen.
So geht es weiter und weiter und weiter. Ein Post nach dem anderen. Ein Bild nach dem anderen. Eine Aneinanderreihung von Momenten, an denen ich nicht beteiligt war.
Alles, was ich getan habe: die Momente aus der Ferne zu verfolgen.
Aber bald werde ich Finn nicht mehr nur aus der Ferne sehen. Denn er wird, aus Gründen, die ich nicht kenne, zum Studium nach Brynmor wechseln. Wie wird es wohl sein, wenn wir uns das erste Mal nach all der Zeit wieder gegenüberstehen? Wird er mich erkennen? Wird er mich ansprechen? Oder wird er mir die kalte Schulter zeigen, weil unsere Familien sich heute noch genauso hassen, wie sie es vor ein paar Jahren getan haben?
Ich schlucke und lege das Handy beiseite. Ich habe keine Ahnung, was passieren wird. Und während ein Teil von mir es unbedingt wissen will, hat der andere unbeschreibliche Angst davor.
Nate.
Samuel.
Connor.
Finn.
Ich hoffe, dass mit Beginn des neuen Semesters nicht alles noch viel schlimmer wird, als es ohnehin schon ist. Aber ob ich will oder nicht, ich werde es in den kommenden Tagen herausfinden.
Kapitel 2
Finn
Der kleine schwarze Ball kommt mit atemberaubender Geschwindigkeit auf mich zugeschossen. Ich mache einen Ausfallschritt, will einen Boast spielen und den Ball über die rechte Seite zurück an die Stirnwand schlagen. Aber ich verfehle ihn um Haaresbreite und mein Schläger zielt ins Leere. Mit einem dumpfen Geräusch prallt der Ball an die Rückwand – und augenblicklich stößt Pete einen Jubelschrei aus. Durch meinen Fehler hat er den Satz für sich entschieden.
«Du warst auch schon mal besser drauf, Mann», sagt Pete, wobei er sich ein süffisantes Grinsen nicht verkneifen kann. «In Gedanken etwa schon in Brynmor?»
«Kann sein», erwidere ich knapp. Selbst wenn es so wäre, würde ich nicht mit ihm darüber sprechen. In der Vergangenheit hatten wir ziemlich guten Sex. Mittlerweile haben wir ziemlich guten Sex undsind ein eingespieltes Team beim Squash. Aber das, was mich beschäftigt, das, was mich wirklich bewegt, würde ich trotzdem nicht mit Pete teilen.
Nicht mit ihm und auch mit sonst keinem.
Mit dem Handrücken wische ich mir die Schweißtropfen von der Stirn. Gerade, als ich Pete zu einer Revanche herausfordern will, öffnet sich die Tür und – scheiße, was hat er hier verloren?
«Jeremiah.» Petes Stimme klingt ehrfürchtig. Irgendwie würde es mich nicht wundern, wenn er gleich einen Knicks macht. Aber darauf verzichtet er. Gott sei Dank.
«Pete», erwidert mein Bruder mit einem knappen Nicken. Er ist einen ganzen Kopf größer als ich, seine Haut ist blasser, seine Haare sind heller, seine Gesichtszüge markanter. In der Vergangenheit hat er mich immer wieder an eine lebendig gewordene griechische Marmorskulptur erinnert. Weil er so aussieht, aber auch, weil er dieselbe emotionale Bandbreite besitzt. Na ja, zumindest habe ich das ziemlich lange Zeit geglaubt. Mittlerweile ist mir klar, dass ich ihm damit unrecht getan habe. Äußerlich mag Jeremiah hart wie Stein sein. Aber hinter dieser Fassade ist er genauso ein emotionales Wrack, wie ich es bin.
«Hättest du was dagegen, wenn ich dich ablöse?»
«Nein, gar nicht», sagt Pete schnell. Und dann an mich gewandt: «Kommst du nachher noch mal bei mir vorbei? Damit wir uns … verabschieden können?»
«Ja, klar.» Ich habe den vagen Verdacht, dass Jeremiah aus einem ganz bestimmten Grund hier ist. Aber ich werde mich von ihm bestimmt nicht davon abhalten lassen, meine letzte Nacht in Edinburgh auf meine Weise zu verbringen. Wenn er darauf spekulieren sollte, hat er sich gewaltig getäuscht.
«Okay, dann bis später!» Mit einem letzten Blick auf Jeremiah zieht Pete die Tür hinter sich zu.
Jetzt bin ich mit meinem Bruder allein.
Normalerweise sieht man ihn kaum in etwas anderem als in modisch geschnittenen Chinohosen und braunen Rollkragenpullovern. Jetzt trägt er Sportklamotten – weißes T-Shirt und kurze Hose – und umklammert den Squash-Schläger in seiner rechten Hand so fest wie einen Knüppel. An seinem Hals hängt eine silberne Kette mit einem mondförmigen Anhänger.
«Was machst du hier?», frage ich mit gepresster Stimme.
Jeremiah lässt den Schläger durch die Luft sausen. «Ist das nicht offensichtlich? Ich dachte, wir spielen noch eine Runde, bevor es nach Brynmor geht.»
«Ach komm, verarsch mich nicht», erwidere ich kopfschüttelnd. «Woher wusstest du überhaupt, dass ich hier bin?»
«So viele Möglichkeiten, wo du am Abend vor unserer Abreise stecken kannst, gibt es nicht.» Jeremiah hebt einen Finger. «Möglichkeit eins: Pete.» Jeremiah hebt einen zweiten Finger. «Möglichkeit zwei: beim Squash.» Und dann noch einen dritten. «Möglichkeit drei: mit Pete beim Squash.»
«Und du bist hier, weil du schon mal für deine Aufgabe in Brynmor üben willst?», frage ich spöttisch. «Mich im Blick zu behalten und zurück in die Spur zu bringen?»
Unsere Eltern haben keinen Hehl daraus gemacht, warum ich mitten im Studium nach Brynmor, die altehrwürdige Elite-Universität in Cornwall, wechseln soll. Damit Jeremiah, der Vorzeigesohn und ganze Stolz unserer Eltern, mich unter seine Fittiche nehmen kann.
«Ich habe keine Hintergedanken», widerspricht Jeremiah. «Ich bin nur hier, um mit dir zu spielen. Und weil ich sehen will, ob ich dich genauso leicht schlagen kann, wie es deinem Freund gerade gelungen ist.»
«Er ist nicht mein Freund», korrigiere ich ihn.
«So? Was ist er denn dann?»
«Das geht dich einen Scheiß an, Jer.» Statt das Thema, in welchem Verhältnis Pete und ich zueinander stehen, zu vertiefen, hebe ich den Ball auf. «Bereit?»
Jeremiah lächelt. «Das war ich schon, lange bevor ich durch diese Tür gekommen bin.»
Wir zögern nicht, sondern nehmen unsere Positionen ein. Nachdem ich noch einmal tief durchgeatmet habe, werfe ich den Ball in die Luft – und das Spiel beginnt.
Tatsächlich ist Jeremiah eine ganz andere Hausnummer als Pete. Alles, was er tut, tut er zu einhundert Prozent, egal ob es sich dabei um seine Rolle als Erstgeborener, sein Studium oder Squash handelt. Innerhalb von Minuten bin ich von Kopf bis Fuß nass geschwitzt. Wenn ich gedanklich so abgelenkt bin, dass ich nicht einmal gegen Pete eine Chance habe, wie soll ich ausgerechnet Jeremiah das Wasser reichen? Kein Wunder, dass er mich von einer Ecke in die andere scheucht und den ersten Satz haushoch gewinnt.
«Deine Zeit in Edinburgh ist dir nicht gut bekommen», sagt Jeremiah. Im Gegensatz zu mir wirkt er kaum außer Atem. «Früher hast du mehr Kraft in deine Bälle gelegt. Deine Spielzüge waren schneller. Überraschender. Jetzt wirkst du ganz schön träge und einfallslos.»
Träge und einfallslos?
«Fick dich», fahre ich ihn an, «und lass uns einfach weiterspielen.»
Jeremiah lächelt. «Wenn du schon wieder genug Luft zum Atmen hast, kein Problem.»
Diesmal geht der Aufschlag an ihn. Der Ball prallt von der Stirnwand ab und schlägt auf dem Boden auf. Ich versuche alles, was ich habe, in den nächsten Schlag zu legen, meinen ganzen Ärger über ihn und meine Eltern – und zum ersten Mal muss sich Jeremiah anstrengen, um den Ball noch rechtzeitig zu erwischen. Mit der Spitze seines Schlägers spielt er ihn an die gegenüberliegende Wand, allerdings nur sehr schwach, wodurch ich sofort zur Stelle bin und meinen nächsten Schlag so präzise ausführe, dass Jeremiah den Ball nicht mehr erwischt – und der Punkt an mich geht.
«Doch nicht so träge und einfallslos, was?», frage ich mit einem Gefühl tiefer Genugtuung.
Jeremiah wischt sich den Schweiß von der Stirn. «Weil ich es aus dir herausgekitzelt habe.» Unsere Blicke treffen sich. «Weißt du, in dir schlummert so viel Potenzial. Aber du nutzt es einfach nicht. Weder in der Uni. Noch beim Squash. Und auch in keinem anderen Lebensbereich.»
Die Worte, die ich mir bereits zurechtgelegt habe, bleiben mir im Hals stecken. Vermutlich, weil er mit dem, was er sagt, nicht ganz unrecht hat. Aber das würde ich nie zugeben.
«Dein Aufschlag», sagt Jeremiah und wirft mir den Ball mit mehr Kraft zu, als unbedingt nötig wäre.
Geschickt fange ich ihn auf. «Du willst spielen? Na gut, spielen wir.»
Jeremiah grinst. «So muss das sein. Das ist der Finn, den ich haben möchte.»
Am Ende schlage ich Jeremiah mit drei zu zwei Sätzen. Wir klatschen uns ab, gehen duschen und ziehen uns um. Die ganze Zeit über wechseln wir kein Wort miteinander. Erst, als wir eine halbe Stunde später ins Freie treten und uns die kühle Abendluft entgegenschlägt, verrät Jeremiah mir, was ihn tatsächlich in die Squash-Halle geführt hat.
«Mum und Dad wollen noch mit uns essen gehen», sagt er, richtet den Kragen seines bordeauxfarbenen Mantels auf und wirft einen Blick auf seine Armbanduhr. «In einer halben Stunde, um genau zu sein. Im Chez Frederic. Am besten rufen wir uns ein Taxi und …»
«Danke, aber nein danke. Mum und Dad können mich nach Brynmor verfrachten. Das ist okay, auch wenn es bestimmt nicht meine erste Wahl gewesen wäre, irgendwo in der cornischen Einöde zu versauern. Aber wie du vorhin vielleicht mitbekommen hast, bin ich noch mit Pete verabredet.»
«Deinem Nicht-Freund?»
«Ganz genau», erwidere ich. «Pete ist vielleicht nicht mein Freund, aber meinen letzten Abend in Edinburgh verbringe ich trotzdem lieber mit ihm als mit euch in irgendeinem Gourmetrestaurant mit überschaubaren Portionen, überteuertem Wein und langweiligen Gesprächen.»
«Du könntest das Potenzial, das in dir schlummert, sehr viel sinnvoller nutzen, als immer nur gegen unsere Familie zu schießen.» Jeremiahs Stimme klingt tadelnd.
«Wenn ich gegen unsere Familie schieße, dann aus gutem Grund.»
«Ja, schon klar, Mum und Dad haben sich nicht immer vorbildlich verhalten. Aber du hast ihnen trotzdem alles zu verdanken. Plätze an den besten Internaten und Universitäten des Landes …»
«Jer, du musst das nicht aufzählen. Ich weiß, was ich den beiden zu verdanken habe. Aber das verpflichtet mich trotzdem nicht dazu, immer und überall nach ihrer Pfeife zu tanzen.» Nicht nach der Art und Weise, wie sie auf mein Coming-out reagiert haben. Kumpelhaft stupse ich mit der Faust gegen seine Schulter. «Aber hey, sie haben ja dich, der das macht. Jeremiah Charles Godwins. Reicht doch, wenn einer von uns beiden die Aufgabe übernimmt, oder?»
Jeremiah taxiert mich aus dunkelblauen Augen. Für ein paar Sekunden sind seine Gesichtszüge versteinert. Dann hellen sie sich wieder auf und ein schwaches Lächeln umspielt seine Lippen.
«Also schön», sagt er und hebt die Hände, als würde ich eine Waffe auf ihn richten. «Ich habe getan, worum die beiden mich gebeten haben. Ich habe dich gesucht, gefunden und zum gemeinsamen Abendessen eingeladen. Wenn du nicht willst, dann eben nicht.» Er legt den Kopf leicht auf die Seite. «Aber sieh wenigstens zu, dass du morgen rechtzeitig rauskommst. Mum und Dad haben einen Termin mit der neuen Rektorin. Professor Parker. Sie wollen bestimmt nicht zu spät kommen, nur weil du dir mit Pete die Nacht um die Ohren geschlagen hast.»
«Keine Sorge, Pete und ich werden schon rechtzeitig zum Ende kommen», gebe ich zweideutig zurück.
Um ehrlich zu sein, ist es mir vollkommen egal, ob Mum und Dad einen Termin mit der Rektorin oder mit dem Premierminister haben. Aber aus der Erfahrung der letzten Jahre weiß ich, dass ich ihre Nervenkostüme auch nicht überstrapazieren sollte.
Für einen Moment sehen wir uns noch unschlüssig an. Dann fangen wir fast gleichzeitig an zu sprechen.
«Also dann, ich sollte …»
«Was ich noch loswerden wollte …», sagt Jeremiah.
Wir verstummen.
«Ja?», frage ich mit hochgezogenen Brauen.
Jeremiah vergräbt die Hände in den Taschen seines Mantels und sieht sich auf dem menschenleeren Parkplatz vor der Squash-Halle um. Plötzlich wirkt er seltsam verlegen. Ein Zustand, der ihm nicht gerade ähnlichsieht. «Du weißt, wer im letzten Semester sein Studium in Brynmor begonnen hat, oder?»
Ich sehe ihn an, ohne eine Miene zu verziehen. Überlege, was ich darauf antworten soll.
Die Wahrheit? Ja, ich weiß, wer sein Studium in Brynmor begonnen hat. Josh Fitz-Stuart. Er ist der Grund, warum ich nicht mehr Widerstand geleistet habe, als Mum und Dad mir offenbarten, mich nach Brynmor zu schicken. Er ist der Grund, warum ich beim Squash-Spiel mit Pete so abgelenkt gewesen bin. Beim Squash-Spiel und allem anderen, was ich in den letzten Tagen und Wochen so getrieben habe.
Aber weil Jeremiah das besser nicht wissen sollte, entscheide ich mich für die Lüge.
«Wer denn?», frage ich und versuche, dabei so unschuldig wie möglich zu klingen.
Jeremiah mustert mich prüfend. «Der Fitz-Stuart-Junge.»
«Dem du damals im Internat das Leben zur Hölle gemacht hast?»
Immerhin hat Jeremiah genug Anstand, bei der Erinnerung daran ein zerknirschtes Gesicht zu machen. «Ja, genau der.»
«Ich hoffe, dass du ihn in den letzten Monaten nicht genauso gequält hast wie früher.» Und gnade dir Gott, wenn du es doch getan haben solltest, füge ich in Gedanken hinzu.
«Nein, natürlich nicht», sagt Jeremiah. «Glaub mir, ich bin nicht stolz darauf, was ich getan habe.»
Innerlich atme ich etwas auf. «Das heißt, du hast ihn in den letzten Monaten …»
«… in Ruhe gelassen. Ich habe Abstand gehalten und ihn ignoriert.» Er macht einen Schritt auf mich zu, bis unsere Nasenspitzen nur noch wenige Zentimeter voneinander entfernt sind. Sollte er glauben, mich dadurch einzuschüchtern, hat er sich gewaltig getäuscht. So leicht lasse ich mich bestimmt nicht einschüchtern. «Und genau das rate ich dir auch. Halte Abstand zu Josh Fitz-Stuart. Sir David, Lady Violet, ihre Kinder … Diese Familie hat uns immer nur Ärger eingebracht.»
«Diese Familie uns?», erwidere ich kühl. «Oder wir ihnen?» Jeremiah macht Anstalten, etwas zu antworten, aber ich komme ihm zuvor: «Du musst dir keine Sorgen machen, Josh und ich sind damals schon nicht gut miteinander ausgekommen …»
«… seid ihr nicht?»
«Sind wir nicht», bestätige ich nachdrücklich. «Und ich glaube auch nicht, dass wir jetzt, Jahre später, gut miteinander auskommen werden. Und genau deswegen werde ich auch auf Abstand bleiben.»
Meine Worte bewirken das, was sie bewirken sollen. Jeremiah macht wieder einen Schritt zurück, seine Gesichtszüge entspannen sich.
«Gut. Sehr gut», sagt er und wirft einen weiteren Blick auf die Uhr. «Ich sollte mich langsam auf den Weg machen, um nicht zu spät zu kommen. Was wolltest du mir noch sagen?»
«Nur dass ich mich jetzt auch auf den Weg zu Pete mache», antworte ich.
Es ist der einzige wahre Satz, der mir in den letzten Minuten über die Lippen gekommen ist.
«Willst du?» Pete streckt mir seinen Joint entgegen, obwohl er die Antwort auf die Frage kennt.
Kopfschüttelnd richte ich mich im Bett auf.
«Dein Pech», sagt er, nimmt einen genüsslichen Zug und bläst mir den Rauch entgegen. «Kann mir nicht vorstellen, dass du in Brynmor so gutes Zeug wie das hier kriegst.» Er liegt auf dem Bauch, nackt und noch verschwitzt vom Sex. Seine dunkelbraunen Haare sind zerzaust, und in seinen hellblauen Augen liegt ein Hauch von Wehmut. Im Hintergrund läuft Marigolds, ein Song seiner Lieblingsband.
«Brynmor ist eine Uni wie alle anderen …»
«… nur noch etwas elitärer. Und noch etwas traditionsbewusster.»
«Kann sein. Ich gehe trotzdem jede Wette ein, dass man dort alles bekommt, was man will. Wenn man es darauf anlegt, versteht sich.»
«Was du aber nicht tust.»
«Nein, tue ich nicht.»
Pete steckt sich den Joint zwischen die Lippen, stützt sich mit den Armen hoch und setzt sich im Schneidersitz vor mich hin. «Weißt du, ich werde dich ziemlich vermissen», sagt er und spricht damit aus, was ihm offenbar schon die ganzen letzten Stunden durch den Kopf gegangen ist. Und obwohl wir nicht zusammen sind – und auch nie zusammengekommen wären, nicht einmal dann, wenn ich in Edinburgh bleiben würde –, treffen mich seine Worte mitten ins Herz.
«Ich werde dich auch vermissen.» Ich räuspere mich. «Aber Brynmor ist nicht Sydney. Und ich wandere nicht aus, sondern bin nur für ein paar Monate weg. Spätestens an Weihnachten bin ich wieder da.»
Pete atmet aus, sein Lächeln hat einen bitteren Zug. «Du musst mir nichts vormachen, Süßer. Wenn du morgen gehst, war es das zwischen uns. Es wird keine Wiederholung geben. Keinen Neustart. Kein Ach-ich-bin-gerade-zufällig-in-der-Stadt-was-hältst-du-von-einem-Treffen. Du bist nicht der Typ dafür. Das warst du nie. Und das wirst du nie sein.»
Verdammt. Er kennt mich einfach viel zu gut.
«Pete …», will ich den Versuch starten, seinen Worten die Schärfe zu nehmen. Allerdings kommt er mir zuvor.
«Wir wissen beide, dass es so ist. Und wir wissen auch beide, dass ich immer mehr für dich empfunden habe als du für mich.»
Kurz spiele ich mit dem Gedanken, darauf etwas zu erwidern. Aber seine Worte haben mir jeden Wind aus den Segeln genommen.
Gedankenverloren lässt er den Blick zur Zimmerdecke schweifen. Dann spricht er weiter. «Ich mache dir keinen Vorwurf. Du bist immer ehrlich zu mir gewesen. Von Anfang an. Du hast mir gesagt, dass du keine Beziehung suchst. Ich habe also gewusst, worauf ich mich mit dir einlasse, und auch wenn ich gehofft habe, du könntest es dir vielleicht noch einmal anders überlegen, war mir doch die ganze Zeit über klar, dass das, was wir haben – was immer es auch ist –, ein Ablaufdatum haben würde. Wäre es nach mir gegangen, hätte das Ablaufdatum aber noch ein bisschen weiter in der Zukunft liegen dürfen.»
Ich fahre mir mit der Hand über den Nacken, unschlüssig, was ich darauf antworten soll. Alle Worte, die mir gerade durch den Kopf gehen, klingen im Vergleich zu dem, was er eben gesagt hat, ziemlich lahm.
«Wie auch immer.» Pete schüttelt den Kopf und sieht mir wieder in die Augen. «Ich habe die Zeit mit dir sehr genossen. Und ich hoffe, auch wenn du nie mit mir zusammen sein wolltest, dass du das auch getan hast.»
Langsam beuge ich mich zu ihm nach vorne, lege eine Hand an seine Wange und streiche mit dem Daumen darüber. Dabei steigt mir der süßliche Geruch von Gras noch viel intensiver in die Nase. «Und wie ich die Zeit genossen habe.»
Pete schließt die Augen und schmiegt sich fester an meine Hand.
«Wir könnten schreiben», sagt er lächelnd, «wir könnten telefonieren und uns gegenseitig auf dem Laufenden halten, was beim anderen gerade so abgeht.» Er schlägt die Augen wieder auf, und das Lächeln ist aus seinem Gesicht verschwunden. «Aber ich glaube, mir wäre ein klarer Schnitt lieber.»
Ich brauche ein paar Sekunden, um zu begreifen, was er da gerade gesagt hat. «Das heißt, dass wir hier und jetzt einen Schlussstrich unter die Sache setzen?», frage ich, nur um wirklich sicherzugehen, dass ich ihn richtig verstanden habe.
Pete wirft einen raschen Blick auf die kleine Uhr auf dem Nachttisch. «Nicht jetzt», sagt er und zwinkert mir zu. «Ich meine, wir haben noch ein paar Stunden, bis du losmusst. Und die würde ich gern bis zum allerletzten Moment auskosten. Aber dann, ja, dann ziehen wir einen Schlussstrich unter die Sache.»
Er legt den Joint in den Aschenbecher, der neben dem Bett auf dem Boden steht, und wendet sich mir wieder zu.
Für den Bruchteil eines Augenblicks spiele ich mit dem Gedanken, ihm zu sagen, dass ich gern mit ihm in Kontakt bleiben würde. Aber weil er es ist, der mehr Gefühle hat, ist es seine Entscheidung, wie er mit der Situation umgehen möchte, und ich will ihn zu nichts drängen. Das Wichtigste ist, dass es ihm gut geht. Ich werde schon irgendwie klarkommen. So, wie ich es immer getan habe. Und vermutlich – nein, ziemlich wahrscheinlich sogar – ist es das Beste, einen klaren Cut zu machen.
«Bis zum allerletzten Moment», sage ich, streichle mit meiner Zunge über seine Lippen und schließe die Augen.
«Bis zum allerletzten Moment», bestätigt Pete.
Und zumindest für den Augenblick kommt mir Brynmor – und alles, was damit zusammenhängt – noch unendlich weit weg vor.
Kapitel 3
Josh
Die junge Frau, die auf der Fahrt von St. Keyne nach Brynmor neben mir im Shuttlebus sitzt, macht einen angespannten Eindruck. Immer wieder spielt sie an ihrem Augenbrauenpiercing herum oder fährt sich mit der Zunge über die Lippen. Als wir schließlich auf dem großen Platz vor dem Eingangsportal anhalten und aus dem Bus aussteigen, betrachtet sie die jahrhundertealte Klosteranlage mit so viel Unbehagen, als würde sie am liebsten auf dem Absatz umdrehen.
Ein Gefühl, das ich ziemlich gut nachempfinden kann. Immerhin geht es mir gerade ganz ähnlich.
«Ist alles in Ordnung mit dir?», frage ich vorsichtig.
Sie zuckt so erschrocken zusammen, dass ich sofort bereue, sie überhaupt angesprochen zu haben.
«Ja, alles bestens», sagt sie leicht zittrig. Ein weiteres Mal wandert ihre Hand zu dem Piercing. Dann lässt sie sie allerdings wieder sinken, atmet tief durch und schüttelt den Kopf. «Na ja, wenn ich ehrlich bin: Nein, es ist nicht alles bestens. Mir geht’s beschissen.»
«Ist das dein erster Tag in Brynmor?»
Ein weiteres Kopfschütteln. «Nein. Ich hatte ganz genau heute vor zwei Jahren meinen ersten Tag.»
Ich runzle die Stirn. Ich kann mich nicht erinnern, sie im letzten Semester schon einmal gesehen zu haben. Was bei knapp tausend Studierenden natürlich nicht unbedingt etwas heißen muss. Aber mit ihren elfenhaften Zügen sticht sie aus der Masse hervor. Wäre sie mir irgendwo auf dem Campus begegnet, wäre sie mir also relativ sicher im Gedächtnis hängen geblieben.
«Ich habe ein Urlaubssemester genommen, um ein paar Dinge für mich zu klären. Im letzten Herbst ist hier ziemlich viel los gewesen und …» Sie zögert einige Sekunden, bevor sie einen weiteren Anlauf startet. «Na ja, was quassele ich dich damit eigentlich voll? Jetzt bin ich wieder hier. Das ist alles, was zählt. Auch wenn es sich irgendwie anders anfühlt als beim Abschlussturnier vor ein paar Wochen.»
«Du warst beim Abschlussturnier?», frage ich neugierig.
Das Abschlussturnier, bei dem Studierende in den unterschiedlichsten Disziplinen gegeneinander antreten, findet einmal jährlich statt. Ich selbst habe beim 200-Meter-Schwimmen teilgenommen und den ersten Platz belegt, mich darüber aber nicht wirklich freuen können. Nate, der ebenfalls ein hervorragender Schwimmer ist, war zu diesem Zeitpunkt nämlich schon nicht mehr in Brynmor. Dadurch fühlte es sich so an, als hätte ich den einzigen ernst zu nehmenden Konkurrenten höchstpersönlich aus dem Rennen gekickt, obwohl mir natürlich klar war, dass das nicht stimmt.
«Ich habe ein paar Freunde besucht. An dem Tag ging’s mir ziemlich gut. Also habe ich wohl gedacht, dass ich es schon irgendwie hinbekomme, mein Studium wiederaufzunehmen. Aber jetzt? Ach, ich weiß auch nicht. Vielleicht war es ein riesengroßer Fehler, nach Brynmor zurückzukommen.»
Obwohl wir uns gerade erst kennengelernt haben, fühle ich mich ihr plötzlich sehr nah. Tatsächlich kommt es mir vor, als würde sie mir mit ihren Worten aus der Seele sprechen.
«Ich weiß, was du meinst», sage ich, ohne lange darüber nachzudenken.
«Ach, echt?» Sie sieht mich interessiert an.
«Ja, echt», gebe ich zu. «Übrigens, ich heiße Josh.»
Ihr Lächeln, das bis gerade eben noch etwas einstudiert gewirkt hat, sieht nun ziemlich echt aus. «Ich bin Lake.»
«Wo sind deine Freunde? Die, die du beim Abschlussturnier besucht hast? Vielleicht wäre es ja eine gute Idee, den Nachmittag mit ihnen zu verbringen, wenn es dir gerade nicht so gut geht.»
«Sie haben ihren Zug verpasst und kommen erst heute Abend an.»
Für einen Moment bin ich unschlüssig, was ich sagen oder tun soll. Ich will ihr unter keinen Umständen zu nahe treten.
«Wenn du magst, kann ich dir ein bisschen Gesellschaft leisten», schlage ich vor. «Ich meine, wenn du das nicht willst, ist das natürlich auch vollkommen in Ordnung.»
Mein Angebot überrascht sie offenbar fast so sehr, wie es mich überrascht. «Ein bisschen Gesellschaft könnte ich ganz gut gebrauchen», sagt sie nach kurzem Zögern. «Aber nur, wenn es dir keine Umstände macht?»
«Nein, macht es nicht», versichere ich schnell.
Lake wirft noch einen letzten, sehnsuchtsvollen Blick auf den Shuttlebus, der gerade hinter einer Hügelkuppe verschwindet. Dann umfasst sie den Griff ihres Rollkoffers.
«Na gut, also dann …»
Nachdem wir beide einmal tief Luft geholt haben, passieren wir das Eingangsportal – und finden uns kurz darauf im großen Innenhof wieder.
Die Fassaden der angrenzenden Gebäude sind mit Efeuranken überwuchert, auf der gegenüberliegenden Seite befindet sich die Klosterkirche mit ihren jahrhundertealten Buntglasfenstern und dem riesigen Turm. Überall stehen Leute in kleinen Gruppen zusammen. Studierende, die sich von ihren Eltern verabschieden. Freunde, die sich nach mehreren Wochen das erste Mal wiedersehen. Erstsemester, die sich vom Universitätspersonal und den Mentoren den Weg zu ihren Zimmern zeigen lassen. Ich höre fast so viele Sprachen, wie ich Menschen sehe: Englisch, Spanisch, Italienisch, aber auch Mandarin. Eine junge Frau, die nur ein paar Schritte entfernt von mir steht, spricht Afrikaans, was mich unweigerlich an meine Zeit in Kapstadt erinnert. Mrs Thompson, die Leiterin des Rektoratsbüros, die mir vor einem halben Jahr an meinem ersten Tag den Weg zum Westflügel erklärt hat, steht auf der anderen Seite des Hofs, in ihren Händen hält sie Klemmbrett und Stift.
«Es ist alles so, wie ich es in Erinnerung habe», sagt Lake nüchtern.
«Ist das etwas Gutes oder Schlechtes?», frage ich, wende meinen Blick von Mrs Thompson ab und ihr zu.
Lake beißt sich auf die Unterlippe. «Beides. Ich hatte hier die beste Zeit meines Lebens. Aber auch die schlimmste.»
Ich frage nicht, was sie damit meint. Damit würde ich auf jeden Fall eine Grenze überschreiten, und das will ich auf keinen Fall.
«Wo musst du denn hin?», will ich stattdessen von ihr wissen.
«Ich muss …» Lake verstummt mitten im Satz. Ich folge ihrem Blick, der starr auf einen Studenten mit schulterlangen, braunen Haaren und einem Fünftagebart gerichtet ist. Er steht vor einem der Arkadengänge und händigt einem Erstsemester gerade ein paar Unterlagen aus. Im letzten Semester bin ich ihm ein- oder zweimal über den Weg gelaufen. Wenn mich nicht alles täuscht, heißt er Elias. Oder Elliot? Ganz sicher bin ich mir nicht. Und eine Ahnung, warum es Lake bei seinem Anblick die Sprache verschlägt, habe ich schon gleich zweimal nicht.
Für ein paar Sekunden wirkt sie noch wie erstarrt. Dann löst sie ihren Blick von ihm und wendet sich wieder mir zu.
«Mein Zimmer ist im Ostflügel», sagt sie, als wäre überhaupt nichts passiert. Ihre rechte Hand wandert wieder zu ihrem Piercing. Diesmal zieht sie so fest daran, dass es selbst beim Zusehen wehtut. Was auch immer mit ihr los ist: Vermutlich wäre es das Sinnvollste, wenn wir so schnell wie möglich von hier wegkommen.
Es dauert nicht lange, bis wir den großen Innenhof hinter uns gelassen haben und das Stimmendurcheinander leiser wird. Aus dem Augenwinkel werfe ich ihr immer wieder besorgte Blicke zu, aber mit jedem weiteren Schritt scheint es ihr wieder ein bisschen besser zu gehen. Nach ein paar Minuten beginnen wir damit, ein bisschen Small Talk zu machen, und stellen fest, dass wir dasselbe studieren: Englische Literatur. Weil wir nicht im selben Semester sind, werden wir aber wohl keine Seminare miteinander haben, was ich sehr bedauerlich finde. Nachdem wir ein paar Innenhöfe passiert haben, verlassen wir das Kloster durch einen kleinen Torbogen.
«Da ist der Ostflügel», sagt sie und zeigt auf ein lang gezogenes, ockerfarbenes Gebäude mit flachem Ziegeldach. «Ich glaube, von hier aus schaffe ich es jetzt auch allein. Danke, dass du mich begleitet hast, Josh.»
«Hab ich gern gemacht», erwidere ich, fühle mich aber trotzdem geschmeichelt.
Lakes Lächeln wird eine Spur breiter. «Weißt du, was auch gleich geblieben ist?»
«Was?»
«Dass die Menschen hier aufeinander aufpassen. Ad nos respiciamus.» Und dann, nach kurzer Pause, fügt sie hinzu: «Die meisten zumindest. Und du scheinst auf jeden Fall einer von ihnen zu sein.»
Mit einem letzten Kopfnicken verabschiedet sie sich von mir. Ich bleibe stehen, wo ich bin, und sehe ihr hinterher, bis sie die Eingangstür des Ostflügels erreicht hat und im Gebäude verschwunden ist.
Erst jetzt fällt mir auf, dass ich in den letzten Minuten so abgelenkt war, dass ich mich kein einziges Mal mit meinen eigenen Sorgen beschäftigt habe.
Die Zeit bis zum Abendessen verbringe ich in meinem Zimmer, räume meine Klamotten in den Schrank und werfe, auf Neuigkeiten von Youma wartend, ab und zu einen Blick auf mein Handy. Weil es Probleme mit ihrem Gepäck gegeben hat, steckt sie immer noch am Flughafen Heathrow fest.
Youma: Wenn ich Pech habe, komme ich hier heute nicht mehr weg
Die Aussicht, allein in den Speisesaal zum Abendessen gehen zu müssen, versetzt meinen Magen in Aufruhr. Youma ist meine wichtigste – und mehr oder weniger einzige – Bezugsperson in Brynmor. Zumindest solange ich nicht weiß, wie Samuel und Connor zu mir stehen.
Mit einem flauen, unbehaglichen Gefühl lege ich das Handy beiseite, stütze mich mit den Handflächen auf dem schmalen Fenstersims ab und blicke durch das Sprossenfenster auf die hügelige Landschaft.
Was um alles in der Welt hat mich vor mehr als einem halben Jahr überhaupt geritten, Südafrika zu verlassen und nach England zurückzukommen? War es Übermut? Weil ich angenommen habe, dass es mir nach meiner Therapie gut genug geht und ich das hier schon irgendwie alles bewerkstelligen könnte? Wenn ja, dann habe ich mich ganz offensichtlich überschätzt. So, wie Lake es getan hat. Vermutlich wäre es das Beste gewesen, wenn ich in Kapstadt geblieben wäre und dort mein Studium zu Ende gebracht hätte. Immerhin war mir dort alles vertraut. Und immerhin hatte ich mir an der UCT – der University of Cape Town – einen kleinen Freundeskreis aufgebaut. Hätte ich Kapstadt nicht verlassen, wäre die Sache mit Nate nie passiert. Ich hätte im letzten Semester nicht ständig befürchten müssen, Jeremiah Godwins über den Weg zu laufen. Und das neue Semester würde jetzt nicht wie ein riesiger, unüberwindbarer Berg vor mir liegen.
Seufzend wende ich mich vom Fenster ab und greife erneut nach meinem Handy.
Josh: Ich hoffe, dass sich alles ganz schnell regelt
Youmas Antwort lässt nur ein paar Sekunden auf sich warten.
Youma: Ich auch! Ich melde mich, sobald ich mehr weiß
Josh: Bis dann!
Gerade, als ich mich dazu aufraffen will, meine Sachen weiter einzuräumen, dringt vom Flur eine Stimme durch die verschlossene Tür. Eine Stimme, die mir vertraut vorkommt. Viel zu vertraut, obwohl Jahre vergangen sind, seitdem ich sie das letzte Mal gehört habe. Sie klingt etwas tiefer und reifer, aber ich würde sie unter hundert anderen jederzeit wiedererkennen.
«… lass gut sein, Jer, okay? Wir sind doch noch mehr oder weniger rechtzeitig hier gewesen. Mum und Dad haben ihren Termin mit der Rektorin nicht verpasst. Ich weiß also gar nicht, warum du so einen Aufstand machst.»
Finn.
Das ist ganz eindeutig Finn.
Finn.
Für einen Moment setzt mein Herz aus.
Für einen Moment bin ich nicht in Brynmor, bin keine einundzwanzig Jahre alt.
Für einen Moment lösen sich die Konturen meines Zimmers auf, falle ich wie durch ein unsichtbares Portal in der Zeit zurück, tauchen Bruchstücke von Erinnerungen auf, kleine Fetzen von Augenblicken, lange vergangen und plötzlich doch ganz klar.
Finn.
Ich bin zwölf Jahre alt, sehe ihn auf der anderen Seite des Hofs an einem Klettergerüst stehen – und kann meinen Blick nicht von ihm abwenden. Das Strahlen in seinen bernsteinfarbenen Augen, das verschmitzte Lächeln, das meine Knie weich werden lässt. Ich habe noch keine Ahnung, wie er heißt, aber eines weiß ich ganz sicher: dass er etwas in mir auslöst, was ich so noch nie verspürt habe. Ein Prickeln, ein Ziehen, etwas, das wunderschön, aber auch ziemlich beängstigend ist.





























