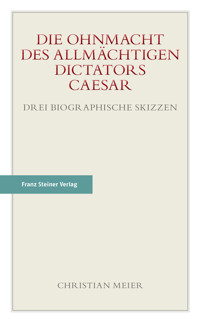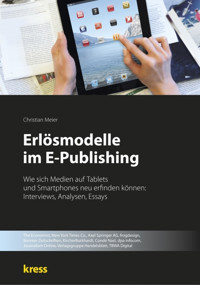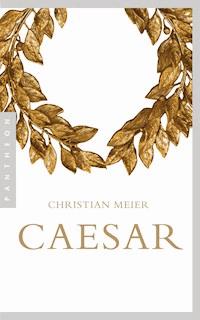
14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 14,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Pantheon Verlag
- Kategorie: Sachliteratur, Reportagen, Biografien
- Sprache: Deutsch
Das Standardwerk über Caesar in edler Neuausstattung
Die Faszination für seine Person ist bis heute ungebrochen: ob als Feldherr, Politiker, Redner oder Schriftsteller – Caesar ist der Inbegriff eines römischen Staatsmannes. Und dabei ist er charmant, verwegen, tatkräftig und leidenschaftlich, und das nicht nur in Staatsangelegenheiten. In dieser einzigartigen Biografie beleuchtet Christian Meier das Leben des Imperators ausgehend von Caesars Jugend in Rom, über seinen politischen Aufstieg und Amtsantritt als Konsul, die ersten innenpolitischen Erfolge und spektakulären Feldzüge bis hin zu seiner Ermordung 44 v. Chr. Die faktenreiche Lebensgeschichte eines der wichtigsten Männer der Antike.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 967
Veröffentlichungsjahr: 2018
Ähnliche
Christian Meier
CAESAR
Pantheon
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Erste AuflagePantheon-Ausgabe 2018
© 1982 für die deutschsprachige Ausgabe by Quadriga GmbH Verlagsbuchhandlung KG, Berlin, Severin und Siedler© der Sonderausgabe by Wolf Siedler Verlag GmbH, München, in der Verlagsgruppe Random House GmbH, Neumarkter Straße 28, 81673 MünchenAlle Rechte, auch das der fotomechanischen Wiedergabe, vorbehaltenZeichnungen: Jean-Claude Lézin, BerlinUmschlaggestaltung: Büro Jorge Schmidt, MünchenUmschlagmotiv: © Getty Images/Grant V. FaintSatz: Lorenz & Zeller, Inning a. A.ISBN 978-3-641-24491-0V001
www.pantheon-verlag.de
Inhaltsverzeichnis
Caesar und Rom – zwei Wirklichkeiten
Der Senat ruft gegen Caesar den Notstand aus · Caesar am Rubicon · Ungeheuerlichkeit des Kriegsgrunds · Standpunkte der Parteien im Zusammenhang der Konstellation · Zwei Wirklichkeiten
Caesars Faszination
Europäische Tradition · Zweifel an Größe und staatsmännischer Leistung · Faszination und Scheitern · Quellen möglicher Täuschung · Unabhängigkeit und Macht in »niederträchtiger Zeit« · Es geht um unsere Sache
Krise und Außenseiter
Eine widerwillige Krise · Die Probleme der späten Republik · Roms gewachsene Verfassung · Überforderung der Ordnung · Populäre Methode · Wenige Außenseiter · Tödlichkeit des aktiven Außenseitertums vor Caesar
Geburt und Familie
Patricisches Geschlecht · Abstammung von Venus · Der angeheiratete homo novus Gaius Marius
Jugend in Rom
Erziehung
Frühe körperliche und geistige Bildung · Prinzipien römischer Erziehung · Welt der Väter · Ordnung des Lernens · Alte Erziehung unter neuen Bedingungen
Spielräume des Erwachsenwerdens
Adoleszenz · Umwege zum Erwachsensein · Unausweichlichkeit der Politik
Im zweiten Jahrzehnt: Bürgerkriegserlebnis und erste Festlegung
Konflikte des Jahres 88 · Marsch auf Rom, Sieg der Cinnaner · Hochzeit und erste Ehren: die Konnexion mit Cinna · Sullas Rückkehr · Opfer des Dictators und Begnadigung · Sullas Ende · Vorbild für Caesar?
Erste Bewährung und die Erfahrung Roms im Restaurations-Jahrzehnt (78 bis 70 v. Chr.)
Die Farce, die auf den Bürgerkrieg folgte · Auftreten auf dem Forum · Freiwilliges Exil im Osten · Ernennung zum Pontifex · Rom in den 70er Jahren · Spartacus-Aufstand · Nicht Leistung, sondern Gefügigkeit wird erwartet · Pompeius’ Heimkehr · Pompeius
Der politische Aufstieg des Außenseiters (69 bis 60 v.Chr.)
Außenseiter und Mutwille · Anforderungen der Laufbahn · Pompeius’ große Kommanden · Kostspieligkeiten und Schulden · Die römische Plebs · Crassus · Das Jahr 63 · Wahl zum Pontifex Maximus · Catilina · Caesars Besonderheit · Catilinarische Verschwörung · Rede am 5. Dezember 63 · Caesar und Cato · Pompeius’ Rückkehr aus dem Osten · Wahl zum Consul · Dreibund
Krise und Gegensätze: Catos Autorität, Pompeius’ Schwierigkeit, Caesars Problem
Mißverhältnis zwischen Alltags- und Verfassungspolitik · Cato in der Stellung des Vorkämpfers des Senats · Warum Pompeius bekämpft wurde · Verantwortlichkeit der senatorischen Führungsschicht · Desintegration, nicht Legitimationskrise · Fehlen des Anknüpfungspunktes für Außenseiter
Das Consulat (59 v. Chr.)
Der Amtsantritt · Senatsdebatte über das Ackergesetz: Verhaftung Catos · Neue Taktik der führenden Senatoren · Zweites Bündnis mit Pompeius Ende April · Opposition · Kompromiß-Angebot an Caesar: Sein Verhältnis zur politischen Ordnung · Ungeheuerliche Veränderung in Rom
Bewährung in Gallien
Bis zum Abgang in die Provinz
Kampf um Caesars Gesetze · Cicero und Cato werden aus Rom entfernt · Cicero · Clodius’ populare Politik · Angriffe auf Caesars Gesetze
Die ersten gallischen Feldzüge (58/57 v. Chr.)
Absicht, ganz Gallien zu erobern · Helvetier-Krieg · Feldzug gegen Ariovist · Panik im römischen Heer: die römischen Soldaten und ihre Affekte · Selbstverständlichkeit und Rechtfertigung des Krieges · Feldzug gegen die Belger · »Ganz Gallien ist befriedet« · Ehrenvolle Senatsbeschlüsse
Caesar und der Krieg im Spiegel seiner Commentarii
Absicht und Stil · Besondere Wahrheit der Darstellung · Ungerechter Krieg · Maßstab des Handelns · Begriff vom Zustandekommen von Ereignissen · Die Souveränität des Feldherrn
Innenpolitische Erfolge, spektakuläre Feldzüge, erste Rückschläge (56 bis Anfang 52 v. Chr.)
Neue Vollmachten für Pompeius · Milo · Wendung der senatorischen Politik · Bündnis in Luca · Krieg im Westen Galliens · Verlängerung des caesarischen Kommandos · Rheinübergang · Landung in Britannien · Theater in Rom: Demonstrative Politik · Zum zweiten Mal in Britannien · Gallischer Aufstand · Clodius’ Ermordung: Der Senat verbindet sich mit Pompeius · Zusammenbruch der Hoffnungen
Caesars Welt in Gallien
Die Leidenschaft der Leistung erfüllt sich · Feldherrnkunst · Caesar und seine Soldaten · Diplomatie in Gallien · Gewöhnung an den großen Stil des Handelns · »Genialität der Selbstbezogenheit«: Gedanken an das angerichtete Unheil? · Verständnislosigkeit und Verdächtigungen in Rom
Die Krise der Statthalterschaft (bis Anfang 49 v. Chr.)
Wendung gegen Caesar · Vercingetorix · Durchbruch zu den eigenen Truppen · Niederlage bei Gergovia · Umbruch bei den Haeduern · Belagerung von Alesia · Die Entscheidungsschlacht · Gesetzgebung zu Caesars Ungunsten · Die Bilanz des Krieges · Senat und Pompeius · Kampf um Caesars Absetzung Lähmung der Innenpolitik · Schwertübergabe · Beschluß gegen Caesar · Paradoxe Situation
Der Prozeß der Krise ohne Alternative, Caesars Recht zum Bürgerkrieg, seine Größe
Von den Konstellationen hängt es ab, wie Handlungen wirken · Korruption · Schwungkraft der großen Auseinandersetzungen · Verantwortung und Schwäche des Senats: Die beschränkte Kapazität der Republik · Tendenz zur Vereinseitigung · Caesars mangelnder Sinn für politische Institutionen · »Hier verlasse ich die Basis des Rechts« · Größe und Unbefangenheit
Der Bürgerkrieg (49 bis 46 v. Chr.)
Italischer Feldzug und Clementia-Politik
Einfall in Italien, Flucht aus Rom · Friedens- Verhandlungen · »Gnade von Corfinium« · Milde als Konsequenz der persönlichen Sache, so freundlich wie herrscherlich · Stimmungsumschwung in Italien · Pompeius entkommt · Caesar in Rom · »In Zukunft wird alles von mir ausgehen«
Erster spanischer Feldzug und zweiter Aufenthalt in Rom (April bis Dezember 49)
Belagerung von Massilia · Kapitulation der spanischen Legionen · Die Pflicht, Bürger zu schonen Meuterei bei Placentia · Wirtschaftliche Maßnahmen und Wahlen in Rom
Griechischer Feldzug (bis September 48)
Übergang über die Adria · Verhandlungsangebot · »Du fährst Caesar und sein Glück« · Belagerung des Pompeius bei Dyrrhachium · Niederlage · Schlacht bei Pharsalos · »Das haben sie gewollt« · Göttliche Zeichen für die Wendung der Dinge · Caesars Religion: Das Glück und die Götter
Feldzug im Osten und ägyptischer Aufenthalt (September 48 bis September 47)
Ernennung zum Dictator · Ephesos ehrt Caesar als »Gott und Retter« · Ungeduld, Leichtsinn · Fahrt nach Alexandria · Das ptolemaische Ägypten · Kleopatra · Belagerung im Palast-Viertel · Entsatz und Sieg · Ausflug auf dem Nil · »Ich kam, sah, siegte«
Zwei Monate in Rom (Oktober bis November 47)
Caesars Gefolgschaft · Antonius · Caesar setzt auf anderes Personal · Das Schuldenproblem · Die Finanzierung des Krieges · Meuternde Legionen vor Rom
Africanischer Feldzug, Catos Tod
Überfahrt nach Africa · Schwierigkeiten des Krieges · Sieg bei Thapsus · Epilepsie? · Die Wut der Soldaten · Catos Abschied von seinem Sohn · Einer der bemerkenswertesten Politiker der Weltgeschichte · Rückkehr über Sardinien nach Rom · »Die Schwierigkeiten wachsen je näher man dem Ziel kommt«
Das Scheitern nach dem Sieg
»Wenn du Unrecht tust, wirst du König« · Pessimismus in Rom · Senatsbeschlüsse über Vollmachten und Ehren · Halbgott · Dictator auf zehn Jahre · Fremdheit und Isolierung: Konnte er Macht über die Verhältnisse gewinnen?
Caesar in Rom
Das Problem und die Frage, wie Caesar es sah · Ciceros Mahnung zur Wiederherstellung der Republik · Für sich und den Ruhm genug gelebt? · Ein unwürdiger Zustand · Triumphe, Schauspiele, das Forum unter dem Sonnendach · Eröffnung des Forum Julium · Projekte · Das Pathos der Leistung · Welt von Aufgaben und Personen · Mißverständnisse · Enttäuschungen
Zweiter spanischer Feldzug, Streit um den toten Cato, Entschluß zum Partherkrieg
Sieg bei Munda · Langsame Heimkehr · Der Anticato · Caesars Wandel in Spanien · Ciceros Versuch eines Sendschreibens · Partherfeldzug als Therapie? · Ratlosigkeit · Neue Ehrungen · Erwartung eines Attentats
Zum letzten Mal in Rom:Vom spanischen Triumph bis zu den Iden des März 44
Jeder Widerspruch reizt ihn · Verspottung der Institutionen · Veteranenansiedlung · Ausbau der Stadt Rom · Schlußstein in der Versöhnungspolitik · Keine neue Ordnung · Problem staatsmännischen Handelns · Ehrungshysterie · Panegyrische Entlarvung · Wollte er den Königstitel? · Was Caesar die Ehren wert waren · Verschwörung · Brutus · Größe und Scheitern · Ermordung
Nachwort
Absicht des Buches · Literatur und Quellen · Danksagungen – Augustus’ Lösung der Krise: Wie schließlich die Alternative entstand
Register
Caesar und Rom – zwei Wirklichkeiten
Der Senat ruft gegen Caesar den Notstand aus · Caesar am Rubicon · Ungeheuerlichkeit des Kriegsgrunds · Standpunkte der Parteien im Zusammenhang der Konstellation · Zwei Wirklichkeiten
Am 1. Januar 49 v. Chr. hatten die Consuln begonnen, mit aller Macht die Absetzung Caesars von seiner Statthalterschaft zu betreiben. Fast neun Jahre hatte er sie innegehabt; ihre Frist war abgelaufen. Nun beabsichtigte Caesar, sich um das Consulat des Jahres 48 zu bewerben und in die römische Innenpolitik zurückzukehren. Eben das aber wollten seine Gegner vereiteln. Noch bevor er überhaupt kandidieren konnte, sollte er sein Kommando niederlegen und als Privatmann nach Rom kommen. Dort sollte ihm der Prozeß wegen verschiedener Verfassungsbrüche gemacht werden, die er sich in seinem Consulat (59 v. Chr.) hatte zuschulden kommen lassen. Und das sollte offenbar unter militärischem Schutz geschehen, damit er das Gericht nicht unter Druck setzen, und wohl auch, damit das Gericht nicht ganz frei von Druck entscheiden konnte. Auf diese Weise, so scheint man gehofft zu haben, ließen sich Caesars politische Existenz vernichten und das Senatsregime voll wieder in Kraft setzen. Gleichgültig ob Caesar wirklich ein Gegner der herkömmlichen Ordnung war oder nicht: Er hatte deren Funktionieren früher nachhaltig gestört. Und es war zu befürchten, daß er verschiedene Forderungen gegen den Willen des Senats durchsetzen und damit so mächtig werden könnte, daß immer neue Konflikte und Niederlagen des Senats vorherzusehen waren. Wenn es ihm jetzt gelang, erneut Consul zu werden.
Schon seit nahezu zwei Jahren hatten Caesars entschiedene Gegner versucht, Roms zentrales Regierungsorgan, den Senat, dazu zu bewegen, ihn abzusetzen. Immer wieder waren sie damit gescheitert, denn Caesar hatte einige Volkstribunen auf seine Seite gezogen, die durch ihr Vetorecht jeden Beschluß gegen ihn vereiteln konnten. Zeitweise ergriffen sie sogar die Offensive und vermochten der Senatsmehrheit Beschlüsse in Caesars Sinn abzuringen. Denn diese Mehrheit war zwar gegen den Proconsul und wünschte durchaus, daß dessen Statthalterschaft bald ein Ende finde. Aber noch mehr als gegen ihn war sie gegen einen Bürgerkrieg. Und daß mit Caesar nicht zu spaßen war, wußte sie, also war sie eher geneigt, ihm nachzugeben.
Anfang Januar setzen dann die entschiedenen Gegner Caesars alle Hebel in Bewegung, um den Senat zu einem Beschluß zu bringen. Anhänger werden aufgeboten, Alarm geschlagen, eine mächtige, mitreißende Stimmung erzeugt. Man beschließt, wenn Caesar nicht bis zu einem bestimmten Tag sein Kommando niedergelegt habe, handle er gegen die Republik. Die Volkstribunen legen dagegen ihr Veto ein. Da sie nicht bereit sind, einzulenken, wird am 7. Januar der »äußerste Senatsbeschluß« gefaßt, das senatus consultum ultimum; grob gesagt: Es wird der Notstand ausgerufen.
Die caesarianischen Volkstribunen verlassen daraufhin, als Sklaven verkleidet, die Stadt in einem der Mietwagen, die an den Stadttoren zu stehen pflegten (das war damals das normale Beförderungsmittel für längere Reisen – neben Pferd und Sänfte –, das Gespann konnte unterwegs gewechselt werden). So gefährdet war die Freiheit des römischen Volkes, wollten sie damit sagen, daß nicht einmal deren eigentliche Wächter, zu deren Schutz sich das Volk einst eidlich verpflichtet hatte, ihres Lebens mehr sicher sein konnten.
1 Caesar. Bildnis aus Tusculum in Turin: das einzige plastische Porträt Caesars, das noch zu dessen Lebzeiten entstanden sein dürfte.
Caesar befand sich zu dieser Zeit im äußersten Südosten seiner Provinz Gallia Cisalpina, in Ravenna. Dort erhielt er am Morgen des 10. Januar 49 – nach unserem Kalender Mitte November – durch einen Kurier die Nachricht von dem Senatsbeschluß und der Flucht der Volkstribunen. Sofort setzte er ohne viel Aufhebens eine Truppe in Richtung Ariminum (Rimini) in Marsch. Das war die erste größere Stadt im eigentlichen Bürgergebiet Italien, jenseits des Rubicon, der Grenze seiner Statthalterschaft. Der Entschluß war unerhört kühn. Denn Caesar hatte nur eine Legion bei sich, fünftausend Mann und dreihundert Reiter. Das Gros seiner Armee stand noch in Gallien. Aber er wollte das Überraschungsmoment nützen und die gegnerischen Vorbereitungen durchkreuzen.
Caesar widmete sich in Ravenna zunächst Routinegeschäften. Er inspizierte eine Gladiatorenschule. Danach begab er sich ins Bad – sei es bei einem Gastfreund, sei es in einem öffentlichen Badehaus: Es hatte sich damals schon eine gewisse Badekultur ausgebildet, und Caesar pflegte sich sehr sorgfältig. Schließlich legte er sich im Kreise einer größeren Gesellschaft zu Tisch. Als die Dunkelheit einbrach, beurlaubte er sich – man möge sich nicht stören lassen, er käme demnächst zurück – und fuhr davon. Nicht auf direktem Wege. Eine unserer Quellen berichtet, er habe sich in der Dunkelheit verfahren. Einer anderen zufolge hat er absichtlich erst eine andere Richtung gewählt, um dann unbeachtet den Weg nach Süden einzuschlagen. Einigen Freunden hatte er insgeheim aufgetragen, sie möchten ihm folgen, jeder für sich. Spätestens am Rubicon traf man zusammen.
Dort hielt Caesar inne. Er zögerte. Noch einmal ließ er – angesichts des kleinen, damals nach starken Regengüssen reißend dahinströmenden Flüßchens – dem Hin und Her der Argumente freien Lauf, setzte sich ihm aus und wiederholte seine Entscheidung. Für einen Moment erschien ihm das Vorhaben, in dem er schon mittendrin steckte, noch einmal von außen; und was er Schritt für Schritt in die Tat umzusetzen begonnen hatte, distanzierte und verdichtete sich ihm zu einem einzigen großen Schreckbild. Alle möglichen Konsequenzen seines Beginnens traten ihm in ihrer ganzen Ungeheuerlichkeit vor Augen; es könnte ihn durchaus geschwindelt haben.
Er stand lange schweigend. Dann bezog er die Freunde in sein Abwägen ein. Einer von ihnen, Asinius Pollio, hat in seinen Historien darüber berichtet. Sie sind nicht überliefert; aber durch zwei antike Autoren ist Pollios Bericht in leicht unterschiedlicher Brechung auf uns gekommen. Ihm zufolge kreisten Caesars Gedanken um das Unglück, das er allen Menschen zumutete, wenn er jetzt den Schritt zum Kriege tat. Er überschlug, »wieviel Unglück der Übergang allen Menschen verursachen wird«. Er suchte, sich und seinen Entschluß im Urteil der Nachwelt zu sehen. Der eine unserer Gewährsmänner läßt Caesars Überlegungen klar sich zuspitzen auf die fatale Alternative: »Der Verzicht auf diesen Übergang wird mir Unglück verursachen, der Übergang aber allen Menschen.«
Offenbar also sprach Pollios Bericht vom Unglück aller Menschen. Und es besteht kein Grund daran zu zweifeln, daß auch Caesar damals davon gesprochen hat. Die militärischen Ressourcen der Gegner erstreckten sich über den ganzen Mittelmeerraum. Es war zu befürchten, daß sie sie mobilisierten. Folglich konnte er sich kaum darüber täuschen, daß der Krieg, den er gerade beginnen wollte, potentiell den ganzen Mittelmeerraum – und das hieß nach damaligem Verständnis die ganze Menschheit – in Mitleidenschaft ziehen konnte. Wohl mochte er hoffen, daß man billiger davonkam. Eben deswegen lag ihm ja daran, die Entscheidung so rasch herbeizuzwingen. Wenn jedoch damals am Rubicon die ganze Tragweite des Unternehmens in so gespenstisch überscharfer Klarheit plötzlich vor Caesars Augen trat, dann mußte die Gravitation dieses Eindrucks wohl auf das Schlimmste stehen.
Nur, wenn das Unglück aller Menschen auf der einen Waagschale lag, lag dann auf der anderen bloß dasjenige Caesars? War die zweite Seite der Alternative so eindeutig klar, so fatal, wie sie bei unserem Gewährsmann erscheint? Wurde der Krieg nur geführt, weil sich Caesar nicht absetzen, nicht in Rom vor Gericht ziehen lassen wollte? War er also allein gegen alle und so sehr auf sich gestellt? Und falls es sich wirklich so verhielt, konnte er das ohne alle Selbsttäuschung so sehen und vor den Freunden am Rubicon so unumwunden aussprechen?
»Schließlich aber raffte er sich mit Leidenschaft aus dem zweifelvollen Abwägen auf und wandte sich dem Bevorstehenden zu.« Mit den Worten: »Der Würfel soll geworfen werden« setzte er über den Rubicon, um nach rascher Fahrt noch vor Morgengrauen mit seinen Soldaten in Ariminum einzumarschieren. Der Ausspruch war ein Zitat aus einer Komödie des Menander. Die Version: »Der Würfel ist gefallen« ist eine falsche Wiedergabe. Denn hier war nicht gewürfelt worden, sondern das Würfeln begann erst, das mit höchsten Einsätzen verbundene Spiel eines Krieges, in dem Fortuna ein gewichtiges Wort mitzusprechen hatte. Das war Caesar so deutlich bewußt wie wenigen anderen; er meinte aber auch, in der Gunst der Göttin zu stehen.
In Ariminum stießen dann die aus Rom gewichenen Volkstribunen zu Caesar. Er führte sie vor seine Soldaten. In einer Ansprache erklärte er – nach eigenem Bericht –, der Senat habe den rechtmäßigen Einspruch der Tribunen mit Waffengewalt unterdrückt. Ganz unberechtigterweise habe er das senatus consultum ultimum beschlossen. Caesar legte »alle Rechtsbrüche dar, die seine Gegner die ganze Zeit über gegen ihn begangen hatten«. Und jetzt wollten sie ihm sogar das Kommando nehmen. Er rief daher die Soldaten auf, »Ansehen und Ehre ihres Feldherrn, unter dessen Führung sie neun Jahre lang so glücklich für das Gemeinwesen gefochten, so viele Schlachten erfolgreich geschlagen und ganz Gallien und Germanien befriedet hatten, gegen seine Gegner in Schutz zu nehmen«. So begann der Bürgerkrieg, der Caesar dann – mit kurzen Unterbrechungen – an die fünf Jahre lang in Anspruch nahm, der sehr viel Blut kostete und die ganze römische Welt tief und nachhaltig erschütterte.
Wenn also nach Caesars eigenen Worten die Soldaten Ansehen und Ehre ihres Feldherrn in Schutz nehmen sollten, hieß das nicht, daß er den Krieg, der schlimmstenfalls die ganze Menschheit in Mitleidenschaft ziehen sollte, um seiner Person willen riskierte? Sieht man die nicht geringe Zahl einschlägiger Quellen daraufhin durch, so kann kein Zweifel daran bestehen, daß es so war. Unglück, Gefahr für die eigene politische Existenz wollte er von sich abwenden. Wenn er sich zum Anwalt der Volkstribunen und auch der Freiheit des römischen Volkes aufwarf, so nur um zu verhüllen, worum es ihm eigentlich ging. Die Hülle war durchaus durchsichtig, und Caesar gab sich gar keine Mühe, das durch geschickte Drapierung wettzumachen. Er wollte gar nicht leugnen, daß die Gefährdung der Tribunen, die er übrigens grob übertrieb, einzig daraus resultierte, daß sie sich für ihn einsetzten. Er hat auch sehr bald von diesem Vorwand keinen Gebrauch mehr gemacht. In seinen eigenen Verlautbarungen wie in Reden, mit denen andere seine Gunst gewinnen wollten, war dann in aller Schlichtheit nurmehr davon die Rede, daß der Krieg um die Wahrung der Ehre (dignitas) Caesars geführt wurde. »Was wollten deine Armeen anderes als beleidigendes Unrecht von dir abwenden?« fragte Cicero. »Das haben sie gewollt; nach so großen Taten wäre ich, Gaius Caesar, verurteilt worden, wenn ich nicht bei meiner Armee Hilfe gesucht hätte«, hat Caesar selbst am Abend der Entscheidungsschlacht vor Pharsalos angesichts des mit Leichen und Verwundeten übersäten Feldes festgestellt. Die Zitate ließen sich vermehren. Caesar hatte keine Sache außer sich selbst. »An allen Dingen hat diese Sache genug«, schrieb Cicero, »nur eine Sache hat sie nicht.«
Insofern ist es durchaus richtig: Das Unglück, das Caesar durch die Eröffnung des Krieges abwenden wollte, war allein seines. Und nichts spricht dafür, daß ihm das nicht klar gewesen wäre.
Ungeheuerlich mutet das an, kaum glaubhaft. Wie kann ein Einzelner sich entschließen, lieber allen Menschen Unglück zu verursachen als sich selbst? Wie war das zu denken, auszusprechen, zu wagen und durchzuhalten? Wie zu rechtfertigen? Muß nicht, wer sich so entscheidet, ein Desperado sein oder ein Kranker, nicht nur unendlich einsam, sondern auch abgespalten von der Tuchfühlung, der »Gleichsinnigkeit« mit seiner Welt? Oder soll darin Größe liegen? Aber was ist dann Größe?
Doch sollte man das Problem nicht zu abstrakt, nicht nur als persönliches nehmen, vielmehr zunächst nach der Konstellation fragen, nach dem »Ensemble«, in dem Caesar sich entschied. Politiker handeln ja nicht nur angesichts von Situationen, sondern in Situationen. Sie sind dann nicht nur sie selbst, sondern in einem gewissen Ausmaß auch Teil einer Konstellation, und das ist wohl in extremen Lagen in besonderem Maße der Fall. Es gilt also nicht nur, nach den Persönlichkeiten, ihren allgemeinen und je besonderen Interessen und Meinungen zu forschen, sondern auch nach ihren Positionen innerhalb der Konstellation, welchselbe sie zwar miteinander ausmachen, von der sie aber auch ausgemacht werden. Von daher bestimmen sich nicht nur Spielräume, sondern auch Perspektiven und Distanzen. Auch in Situationen gibt es eine Ortsgebundenheit, und der Ort bestimmt sich im Rahmen der Umgebung. Es sind also nicht nur die Beteiligten zu beachten, sondern auch die Situation im ganzen, die mehr ist als die Summe ihrer Teile. Das erschwert zwar das eindimensionale Urteilen aus akademischer Distanz, aber es kommt der Sache näher. Bisher ist nur deutlich, wer damals bei einem Krieg hätte in Mitleidenschaft gezogen werden können; noch nicht, wer da gegen wen stand und auf welche Weise.
Caesar erhob sich gegen Rom; so mußte es sich darstellen für den Senat und für alle, die gemäß der römischen Ordnung ihm die Regierungsgewalt und die Verantwortung für das Gemeinwesen zusprachen, das heißt für die römische Gesellschaft. Einhellig ist Caesars bewaffneter Einfall in Rom und Italien verurteilt worden, auch von einigen seiner prominenten Freunde, Verwandten und Verbündeten.
Die bisherige Forschung hat dagegen verschiedentlich versucht, der fatalen Alternative zu entkommen. Man hat Caesar überlegene staatsmännische Einsicht und eine Sache unterstellt, um annehmen zu können, er habe in Wirklichkeit in einem höheren Interesse gehandelt. Danach sei er für Rom und Italien und für die Völker im weiteren Herrschaftsbereich der Stadt aufgestanden gegen einen bornierten, eigensüchtigen Senat, dessen Zeit abgelaufen gewesen sei. Er habe ein gerechtes, handlungsfähiges Regierungssystem schaffen und die Struktur des römischen Reiches grundiegend erneuern wollen.
Wenn dem aber so gewesen sein sollte, so hat Caesar es jedenfalls nicht gesagt, nicht am Rubicon und nicht später, und auch sonst läßt sich kein Zeuge dafür aufrufen. Im Gegenteil: Offensichtlich hat keiner davon gewußt. Es gab auch keine Parteiungen im Bürgerkrieg, die sich an solchen sachlichen Differenzen orientiert hätten. Es fehlte vielmehr an einer Spaltung der römischen Gesellschaft, die dem Gegensatz zwischen Caesar und seinen Gegnern korrespondiert hätte. Wer sich später zu Caesar schlug, tat es, weil er der Erfolgversprechende, der Eroberer und schließlich der Sieger war. Wirklich auf seiner Seite standen nur seine unmittelbaren Anhänger, die ihm bei aller Faszination und Freundschaft zumeist in dem Maße treu ergeben waren, wie sie von seinem Sieg eine Verbesserung ihrer eigenen Verhältnisse erhofften, und seine Soldaten, bei denen es sich ähnlich verhielt. Da war keine Sache, die über den Kreis der Caesarianer hinausgewiesen hätte. Insofern kann kein Zweifel darüber bestehen, daß Caesar isoliert war und mit seiner Gefolgschaft allein stand und, wie es scheint, gegen Rom.
Er selbst sah das allerdings nicht so. Nicht gegen Rom wollte er nämlich antreten, sondern nur gegen seine Widersacher. Und nicht einen Bürgerkrieg, sondern »bürgerliche Streitigkeiten« (civiles controversiae) wollte er austragen. Den Senat vermochte er als eigenständige Größe gar nicht wahrzunehmen. In dessen Beschluß gegen ihn sah er nicht die Willensäußerung der römischen Republik, sondern nur eine Machenschaft seiner Gegner, und in denen konnte er keinerlei staatsmännische, vielmehr ausschließlich höchst eigennützige Motive am Werk sehen.
Entsprechend zog er die Trennlinien. Diese »bürgerlichen Streitigkeiten« sollten das Gros der Bürgerschaft gar nichts angehen. »Was steht einem anständigen Mann (vir bonus) und ruhigen, anständigen Bürger mehr an, als bürgerlichen Streitigkeiten fernzubleiben?« schrieb er damals an Cicero, wie wenn, wo die feindlichen Parteien ihre Bataillen schlugen, Ruhe die erste Bürgerpflicht in einem republikanischen Gemeinwesen gewesen wäre. Wer nicht gegen ihn sei, meinte er, sei sein Freund. Was die Bürger nichts angeht, daran haben sie sich nicht zu beteiligen. Die Gegner urteilten genau umgekehrt: Sie sahen jeden als Feind an, der sich ihnen nicht anschloß. Sie hatten eben die Sache der res publica auf ihrer Seite; da durfte keiner unbeteiligt sein. Das beste Zeugnis für die Unterschiedlichkeit der beiden Positionen war ihre Einigkeit darüber, wohin die Neutralen gehörten. Caesar hatte von deren aktiver Parteinahme nichts zu erhoffen – sie wäre für die res publica und somit gegen ihn erfolgt. So waren sie seine Freunde, wenn sie nicht seine Feinde waren. Praktisch erkannten sie dann an, daß der Krieg nur zwischen ihm und der Gruppe seiner senatorischen Gegner ausgetragen wurde.
Cicero hat in diesen ersten Wochen des Jahres 49 an das Gesetz Solons erinnert, wonach zu bestrafen sei, wer in einem Bürgerkrieg nicht Partei ergreife. Das war ein Versuch gewesen, zwischen den verfeindeten Gruppen das Ganze der Bürgerschaft zur Geltung zu bringen. Er hatte am Anfang der antiken Gemeindestaaten gestanden, die auf dem Ganzen der Bürgerschaft beruhten. Dieses Ganze war für Caesar im Moment seiner äußersten Gefährdung offenbar gar nicht im Spiel, es war – bewußt oder unbewußt – ausgeklammert.
Man schwankt, ob Caesar hier spitzfindig war oder ob er es nicht besser wußte. Sollte er spitzfindig gewesen sein, dann hätte er allerdings entschieden zu kurz gedacht. Wer sollte ihm das abnehmen, daß ein Senatsbeschluß nichts wert, ein Bürgerkrieg nichts als eine Auseinandersetzung zwischen wenigen Herren war? Vermutlich also hat Caesar es wirklich so gesehen, wie er es darstellt. Dann aber erhebt sich die Frage, ob er so befangen, so verblendet gewesen sei, daß er die – immer noch ganz von der res publica geprägte – römische Realität nicht wahmehmen konnte.
Allein, er kam von seinen Voraussetzungen her zu praktisch richtigen Ergebnissen. Man dachte in Rom zwar anders, aber man handelte im allgemeinen durchaus so, wie wenn einen der Krieg nichts anginge. Man arrangierte sich vielmehr schnell und leicht mit Caesar. Selbst viele Senatoren taten das. Von den Consularen schlug sich die knappe Hälfte zu Caesars Gegnern, die andere blieb neutral. Und es war auch nicht das Gros, sondern nur ein guter Teil des Gesamtsenats, der gegen Caesar Stellung bezog. Die römische Gesellschaft litt also unter dem Krieg, aber sie ließ sich nicht bekriegen. Die Republik war gegen den Aggressor, aber sie wehrte sich nicht gegen ihn. Bei diesen Kräfte- und Meinungsverhältnissen gab es in Wirklichkeit keine Partei der Republik, sondern nur eine, die die Republik auf ihre Fahnen schrieb. Die »gute Gesellschaft« Roms war, indem sie den Frieden erhalten wollte, aber nicht konnte, indem sie sich also nicht engagierte, faktisch im anderen Lager.
Folglich spielte auch bei Caesars Gegnern persönliche Anhängerschaft die zentrale Rolle: die Gefolgschaft des Pompeius, des führenden Feldherrn. Auch er war vom Senat lange bekämpft worden, als Einzelgänger, der sich der Disziplin des Standes nicht fügte, der so viel Macht in seiner Hand vereinte, daß er der senatorischen Gleichheit gefährlich zu werden schien. Schließlich hatte man sich aber vertragen und Pompeius in die Koalition gegen Caesar hineinzuziehen vermocht. Er kommandierte schon mehrere Legionen und zog nun aus dem Osten, von den Städten und Fürsten, die ihm verpflichtet waren, eine zusätzliche große Streitmacht zusammen, ein pompeianisches Heer. Die führenden Senatoren waren zwar ebenfalls in seinem Lager oder kommandierten andere Teile der gemeinsamen Armee und Flotte, aber sie hatten nicht viel eigene Macht: Sie verfügten kaum über eigene Truppen, denn die römische Bürgerschaft, die der Senat führte und deren Sache er verfocht, war ihnen ja nicht in den Krieg gefolgt. So war die republikanische Seite wesentlich diejenige des Pompeius, und entsprechend wurde auch befürchtet, daß er im Fall des Sieges eine Alleinherrschaft aufrichte.
Es stand also im wesentlichen Caesar gegen Pompeius. Das Gemeinwesen war präsent nur als Maßstab einer allgemeinen, selbstgewissen, aber praktisch kaum verpflichtenden Meinung. Die res publica hatte keine Legionen. Indem Caesars Blick durch sie hindurch ging – ob er sie nun durchschaute oder nicht –, um nur die Kräfte wahrzunehmen, die zählten, erkannte er die Realität des Krieges gewiß besser als seine Gegner, wenn auch mitnichten ganz.
Die Gegner hatten auch insofern nur ein bedingtes Vermögen, Realität wahrzunehmen, als sie offenbar nicht wußten, mit wem sie es zu tun hatten. Neun Jahre lang hatte der Proconsul eine sehr große Armee befehligt. Er hatte einen ungemein erfolgreichen Krieg geführt, Eroberungen gemacht wie kein Feldherr vor ihm in der an Siegen so reichen römischen Geschichte. Und jetzt sollte er nicht nur nicht die nach altem Maßstab fällige Ehre, den Triumph ernten, sondern sogar Strafe, ja den Verlust seiner politischen Existenz erleiden.
Wohl hatte er sich zehn Jahre zuvor verschiedener Gesetzesbrüche schuldig gemacht – übrigens bei der Durchsetzung wichtiger Forderungen des Pompeius gegen den Senat. Wohl war sein gallisches Kommando gegen den Willen der Senatsmehrheit zustande gekommen, die weder den Krieg noch Caesars Eroberungen gewollt hatte. Aber nachdem sie das alles hatte hinnehmen müssen, war es da noch berechtigt, tunlich, praktisch, über das Geschehene, Geduldete, inzwischen Wirklichkeit Gewordene einfach hinwegzusehen und auf die Ereignisse von 59 zurückzugreifen, um Caesars politische Existenz zu bedrohen? War von dem siegreichen Herrn über neun Legionen und zweiundzwanzig Cohorten wirklich zu erwarten, daß er sich ihnen einfach auslieferte? Konnte man Caesars Absetzung realistischerweise als Sache der res publica ausgeben, nachdem die Senatsmehrheit sich so lange geweigert hatte, gegen den Proconsul zu beschließen? Konnte man sich die res publica überhaupt noch abzüglich Caesars denken?
Andererseits mußten sich Caesars Gegner gerade angesichts einer solchen Senatsmehrheit fragen, ob sie nicht alles nur Mögliche gegen Caesar zu unternehmen hatten. Nach alter Auffassung waren die führenden Kreise im Senat verantwortfich für dessen Politik. Und es war längst selbstverständliches Gebot geworden, Männer, die zu mächtig waren, um sich der Standesdisziplin zu fügen, aufs schärfste zu bekämpfen. Man hatte gewiß allen Anlaß, sich vor Caesars Rückkehr in die Innenpolitik zu fürchten, je mächtiger er wurde, um so mehr.
Selbst ein Bürgerkrieg konnte dabei in Erwägung gezogen werden. Er mußte keineswegs mit einem Sieg Caesars enden. Freilich war es andererseits kaum wahrscheinlich, daß er auf einen Sieg der res publica hinauslief. Die Erschütterungen, die er auslösen, und die militärische Machtzusammenballung, die er mit sich bringen mußte, mußten so bedeutend sein, daß auch ein Sieg des Pompeius mindestens eine fühlbare Einschränkung und Schwächung des Senatsregimes zur Folge gehabt hätte.
Nur, wie sollten Caesars Gegner das erkennen? Wie hätten sie die Distanz gewinnen können, aus der ihnen die Fortexistenz der überkommenen Ordnung hätte fraglich werden können? Alles, was wir von der damaligen Gesellschaft wissen, weist darauf, daß man diese Ordnung für die einzig legitime hielt. Mit ihr hatte Rom die Welt erobert. In ihr hatte die römische Bürgerschaft nicht nur eine politische Form, sondern geradezu ihre gesellschaftliche Identität gefunden. Keiner wußte es anders, allenfalls aus Resignation konnte man Konzessionen machen. Doch Caesars Gegner meinten, wie es immer wieder die führenden Senatoren gemeint hatten, daß man die rechte Ordnung kraftvoll verfechten mußte, gerade angesichts vielfältiger Kleinmütigkeit. Jetzt stand man an einer Schwelle: Ließ man Caesar herüber, so war das Schlimmste zu gewärtigen.
Von heute her fragt es sich, ob Caesars Gegner nicht schon von einer nur noch postulierten, gar nicht mehr tatsächlichen Wirklichkeit ausgingen. Damals aber machte die gesamte Gesellschaft diese Wirklichkeit noch aus, sie sah sie so und bildete sie entsprechend zwischen sich. Nur wollte sie sie nicht verteidigen.
Um es auf eine Formel zu bringen: Caesars Gegner sahen die römische Wirklichkeit von innen, und sie waren sich ihrer gewiß. Caesar hingegen sah sie von außen. Deswegen konnte er die Machtverhältnisse so zutreffend einschätzen, ohne allerdings zu wissen, wie stark die Sache des Senats noch im allgemeinen Denken verwurzelt war. Seine Gegner aber wußten zwar dies, täuschten sich jedoch über ihre Schwäche.
Wenn aber ein Mann mit solchen Leistungen für Rom und einer so großen Armee die römische Wirklichkeit von außen sehen, also derart außerhalb dieser Wirklichkeit stehen konnte, so mußte diese Wirklichkeit irgendwie partikular geworden sein. Ihre Selbstverständlichkeiten, ihr Komment, ihre fundamentalen Gebote griffen bei Caesar nicht mehr; und sie wurden auch nicht mehr unmißverständlich gehandhabt. Das aber bedeutete, daß seine Position nicht einfach zufällig und der römischen Struktur äußerlich war. Sonst hätte doch wohl ein Außenseiter nicht so machtvoll werden können.
Eben deswegen kann Caesar auch nicht einfach ein auf sich gestellter Desperado gewesen sein. Er hatte offenbar so kräftig und so unangefochten einen eigenen Bereich ausbilden können, daß er gleichsam in einer Welt für sich lebte, unter seinen Soldaten, in seinen Provinzen, im Bewußtsein seiner ungeheuren Fähigkeiten und Leistungen. Damit hatte sein persönlicher Anspruch gleichsam Raum genommen, hatte sich zu einer mächtigen eigenen Position befestigt, welche übrigens auch in einem achtbaren, wenn auch einseitigen Ethos gründete: das alte aristokratische Leistungsideal verwirklichte er wie kein anderer. Nur Pompeius kam ihm darin nahe. Diese Position gewann eine gewisse Eigenständigkeit. Sie wurde gleichsam so weit und so mächtig, daß er sich ihr gegenüber verpflichtet fühlen konnte. Das ersetzte in gewissem Maße die überpersönliche Legitimität, also jene Verdichtung zahlreicher Meinungen und Bestrebungen zur Objektivität und zum Recht einer Sache. Sie stellte ihm einen Panzer gegenüber seinen Gegnern dar. So jedenfalls lassen sich am ehesten die Selbstverständlichkeit und Offenheit erklären, in der Caesar um seiner selbst willen einen Krieg begann, der alle Menschen in Mitleidenschaft ziehen konnte. Er wäre sich das dann schuldig gewesen, auch nach intensiver Selbstprüfung. Bewußte oder unbewußte Täuschung seiner selbst oder auch anderer scheint freilich insoweit im Spiel gewesen zu sein, als er nicht zugeben oder nicht sehen konnte, daß die römische Gesellschaft gegen ihn war. Vielleicht hat er gemeint, daß das gar nicht sein konnte, nachdem er solche Taten für Rom vollbracht hatte. Und tatsächlich war es ja auch nur bedingt der Fall.
Wenn einer allerdings durch Roms Institutionen und durch die res publica so hindurch sah wie Caesar – um nur noch seine eigenen Gegner wahrzunehmen –, so hatte er wohl nicht nur eine andere Auffassung von der römischen Wirklichkeit als die anderen, sondern dann scheint er diese Wirklichkeit mit ihnen nicht mehr geteilt zu haben. Denn zu Roms Wirklichkeit gehörte die Homogenität des Wissens über die rechte Ordnung. Sie ließ da keine Wahl: Man konnte den Senat in irgendeinem Punkt bekämpfen, aber man konnte ihn nicht übersehen.
So standen sich in Caesar und seinen Gegnern offenbar zwei verschiedene Wirklichkeiten gegenüber; die alte, die plötzlich vom Ganzen zum Teil geworden, und eine neue, die aus ihr herausgetreten war und die sich ihr auch dann nur schwer wieder hätte einfügen können, falls der Krieg vermieden worden wäre. So weit war man voneinander entfernt und gegeneinander fremd. Das, und nicht nur Interessengegensätze, Mißtrauen, Furcht und Haß oder pathologische Überziehung persönlicher Ansprüche, kennzeichnete die Situation.
Indem man hier das Gegeneinander zweier Wirklichkeiten feststellt, braucht man nicht darauf zu verzichten, Caesars Übergang über den Rubicon als ungeheuerliche Anmaßung eines Einzelnen gegenüber Rom und seinem gesamten Herrschaftsbereich zu verurteilen. Man braucht sich auch nicht zu scheuen, die Borniertheit zu charakterisieren, mit der die Gegner ihre Möglichkeiten überschätzten. Aber man wird die Eigenkräfte der Positionen, in die die Parteien gegeneinander geraten waren, nicht mehr übersehen.
Es wird deutlich, wo die römische Republik damals angelangt war. Denn nicht nur Caesar und seine Gegner, sondern die ganze Gesellschaft fand sich ja vor einer Aporie. Da sie in sich nicht gespalten war – vielmehr einig in der Notwendigkeit, die res publica fortzusetzen –, war ihre Wirklichkeit gespalten. Ein Außenseiter konnte das Ganze mächtig herausfordern, weil er sich eine eigene Welt hatte aufbauen können.
Was war das für eine Gesellschaft? Wenn in ihr Außenseiter gegen den Willen der leitenden Organe so viel Macht sammeln konnten, so kann sie nicht mehr recht integriert gewesen sein und muß sich in einer Krise befunden haben. In der Tat waren die alten, immer noch auf den Gemeindestaat zugeschnittenen Institutionen Roms längst überfordert angesichts des weltweiten Herrschaftsbereichs, über den die Stadt gebot. Wie aber konnte die Bürgerschaft dann noch einhellig an der überkommenen Ordnung festhalten? Wie kam es, daß sie sich nicht angesichts der Krise um große sachliche Gegensätze spaltete? Warum erhoben sich die Notleidenden nicht? Was für eine Spannweite gab es in dieser Gesellschaft und was für Oppositionsmöglichkeiten? Haben wir es in diesem Punkt mit etwas spezifisch Antikem zu tun? »Das Altertum … stellte seine Sachen« – nach Jacob Burckhardt – »nicht aufs Biegen, sondern aufs Brechen«, und das kann sehr wohl damit zusammenhängen, daß man eine Ordnung eher war als hatte, daß hier nicht eine Gesellschaft einen Staat sich gegenüber hatte, sondern eine Bürgerschaft zur politischen Einheit geworden war. Folglich konnte sie wenig Abstand zu sich selbst haben.
Was war das für eine Krise, in der statt der Gesellschaft die römische Wirklichkeit, die Selbstverständlichkeit des gemeinsamen Aufgehobenseins in einer im Kern unangezweifelten Ordnung zerbrach? Eine Krise offenbar, die statt grundsätzlicher Opponenten Außenseiter produzierte. Eine Krise, die – bei der Einhelligkeit, in der man dem Alten anhing – offenbar eher aus der Summierung unbeabsichtigter Nebenwirkungen des Handelns resultierte, also in der Form des Prozesses vor sich ging – was wieder recht modern anmutet. Was bedeutete das für die Gesellschaft im ganzen und für die Einzelnen, die in ihr aufwuchsen und lebten? Wie konnte man sich darin zurechtfinden – und zu Recht sich finden? Was war das für eine Wirklichkeit, die noch stimmte und offensichtlich nicht mehr stimmte?
Rom bot in dieser Zeit anscheinend besondere Möglichkeiten zur Entfaltung von Persönlichkeit. »Was Wettkampf großer Persönlichkeiten betrifft«, schrieb Jacob Burckhardt, »so ist diese Zeit die erste in der Weltgeschichte. Was nicht groß war, das war doch charakteristisch, energisch, wenn auch ruchlos, nach großem Maßstab zugeschnitzt … Alles Große aber sammelt sich in der wunderbaren Gestalt Caesars.«
Resultierte das aus besonderen Handlungsspielräumen? Wenn das aber der Fall gewesen sein sollte, so scheint es keinen Spielraum zur Änderung der Struktur gegeben zu haben. Sonst hätte man doch das Bestehende in Frage stellen und ändern müssen. Dann hätten also Macht zum Handeln und Ohnmacht zum Verändern nebeneinandergestanden, Macht in den Verhältnissen und Ohnmacht über die Verhältnisse. Jedenfalls bot die Sicherheit über das Herkömmliche soviel Halt wie dessen Versagen zu besonderer Bewährung herausforderte. Es gab mächtige Notwendigkeiten, kräftige Erwartungen, ungeahnte Möglichkeiten. Es kam sichtbar sehr viel auf den Einzelnen an in dieser überschaubaren, grundsätzlich beherrschbaren Welt. Und er hatte oft genug mit seinem Scheitern fertigzuwerden. Das mochte zu charakteristischen Ausprägungen führen.
Doch wie dem auch sei, wie kam Caesar in die Position, von der aus er am Rubicon den Krieg eröffnete? Wie wurde er zum Außenseiter? War das schon von Jugend her angelegt? Und war er so groß, wie gern behauptet wird, und was heißt das? Und wenn er es, in welchem Sinn auch immer, gewesen ist, koinzidierten dann in ihm vielleicht – wie Burckhardt von den großen Individuen sagt – das Allgemeine und das Besondere? Hat er dann, wie Hegel meint, indem er am Rubicon nur dem »Interesse, sich, seine Stellung, Ehre und Sicherheit zu erhalten«, folgte, das vollbracht, was an der Zeit war? Weil eben bei großen Menschen »deren eigene partikuläre Zwecke das Substanzielle enthalten, welches der Wille des Weltgeistes ist«? Oder ist das ein historistisches Märchen?
Kann es nicht sein, daß Caesars Größe nur ein besonderer persönlicher Zuschnitt war, ohne alle Vorbestimmung und höhere Wirksamkeit? Hat er vielleicht nicht nur nichts anderes gewußt, sondern auch nichts anderes vollbracht als seine persönlichen Möglichkeiten besonders großartig – übrigens auch liebenswürdig, geistvoll und ganz auf der Höhe seiner Zeit – wahrzunehmen, indem er sich herumschlug mit all den Schwierigkeiten und Unbilden, die ihm begegneten, machtvoll für sich, rücksichtslos gegen das Ganze, das sich ihm nicht aufzwang, zumal er sich von seiner Wirklichkeit so gründlich gelöst hatte? Und das alles in einer Zeit, in der ein Außenseiter so mächtig zu werden vermochte, daß er um seiner selbst willen einen Bürgerkrieg entfesseln konnte?
Caesars Faszination
Europäische Tradition · Zweifel an Größe und staatsmännischer Leistung · Faszination und Scheitern · Quellen möglicher Täuschung · Unabhängigkeit und Macht in niederträchtiger Zeit« · Es geht um unsere Sache
Burckhardts Satz, daß alles Große sich in der wunderbaren Gestalt Caesars sammle, ist nur die besondere Formulierung eines Urteils, das jahrhundertelang in Europa allgemein war. Die Geschichte von Caesars Ruhm, die Friedrich Gundolf geschrieben hat, ist lang, und sie ist voll von Zeugnissen der Faszination durch ihn. Wie kaum ein zweiter hat Caesar auf die Nachwelt fortgewirkt.
Das Mittelalter verehrt ihn als den ersten Kaiser, den Gründer der Monarchie, von dem die höchste weltliche Macht im Abendland ihren Namen hat. Caesar, Rom, das Reich, das schien eins zu sein, und es reichte in die Dimensionen des Mythischen. Dann fand man seit der Renaissance hinter dem Namen die große Persönlichkeit mit all ihren Facetten, den Feldherrn, den Eroberer Galliens und des ganzen weiten römischen Herrschaftsbereichs, den bedeutenden Schriftsteller, den großen Organisator, dem man auch die gründliche Neuordnung Roms nach langer Krise zusprach; Stratege, Soldatenführer, Politiker, Diplomat und Herzensbrecher in einem; Sieger nicht nur, sondern mild gegenüber den Geschlagenen; unbeirrbar und von verwegener Unbekümmertheit; ein Mann, der ununterbrochen tätig war und anscheinend nirgendwo gescheitert ist; der noch aus Rückschlägen zum Erfolg ausholte; rasch zupackend und glanzvoll dabei – bis ganz zuletzt die Verschwörer um Brutus seinem Leben ein, wie es schien, tragisches Ende setzten.
Im Jahrhundert der Aufklärung und der französischen Revolution mehrten sich freilich die Zweifel, und zwar aus politischen Gründen. Man schlug sich mehr und entschiedener als zuvor auf die Seite der Freiheit, die Caesar den Römern genommen, der Republik, die er zerstört hatte. Auch der Feldherr erlitt Einbußen an Ansehen: »Wir sind zu human geworden«, soll Goethe gesagt haben, »als daß uns die Triumphe des Caesar nicht widerstehen sollten.«
Doch gegen all diese Zweifel wurde eine neue Form der Größe konzipiert: die historische. Hegel sah in Caesar den Geschäftsführer des Weltgeistes. In ihm vereinten sich Allgemeines und Besonderes: Denn, »was ihm die Ausführung seines zunächst negativen Zwecks erwarb, die Alleinherrschaft Roms, war … zugleich an sich notwendige Bestimmung in Roms und der Welt Geschichte, so daß sie nicht nur sein partikulärer Gewinn, sondern seine Arbeit ein Instinkt war, der das vollbrachte, was an und für sich an der Zeit war.«
2 Caesar. Kolossaler Bildniskopf des 2. Jahrhunderts n. Chr. Neapel, Archäologisches Museum.
Theodor Mommsen hat die römische Geschichte dann so gedeutet, wie wenn sie auf Caesar zugelaufen sei. Man hat gesagt, nie sei er mit solcher Kraft geschildert worden, weil er nie sehnlicher erwartet wurde. Mommsen inszeniert sein Auftreten, nachdem er Rom so lange im Dunkeln hat tappen lassen, als Epiphanie. In Caesar sei das geschichtlich Notwendige endlich zum Ereignis geworden. Er habe noch, »wo er zerstörend auftrat, … den ausgefällten Spruch der geschichtlichen Entwicklung vollzogen«. Die römische Gesellschaft hatte die Kontrolle über sich verloren, alles ging drunter und drüber, sie trieb im Prozeß ihres Niedergangs dahin, ohne Halt zu finden, wehrlos, nur mehr Objekt eines Geschehens, in dem sie befangen war. Dann kam Caesar. Er gewann – so Mommsen – einen Punkt außerhalb dieser Befangenheit und vermochte Macht über das Ganze zu gewinnen. Durch ihn wurde Roms Ordnung wieder Gegenstand bewußten Handelns, errang wieder ein Mensch die Herrschaft über die Dinge.
Wenn Mommsen davon ausgeht, daß jede Lage für menschliches Handeln bezwingbar ist, so bietet ihm Caesar das schönste Beispiel dafür. Er habe »die Geschicke der Welt für die Gegenwart und die Zukunft« geordnet. »So wirkte und schaffte er wie nie ein Sterblicher vor und nach ihm.« Mommsen führt eine »Wiedergeburt« Roms und des Griechentums auf ihn zurück; er findet, Caesar habe die Germanen davon abgehalten, Rom zu überrennen, und nur das habe der griechischen Zivilisation die Frist verschafft, die sie brauchte, um die westliche Hälfte des Mittelmeers zu durchdringen. Sonst hätten dort die Fundamente »zu dem stolzeren Bau der neueren Weltgeschichte« nicht gelegt werden können.
Der aber derart eine historische Mission erfüllte, war für Mommsen zugleich menschlich ein Vollkommener. Er findet: »Menschlich wie geschichtlich steht Caesar in dem Gleichungspunkt, in welchem die großen Gegensätze des Daseins sich ineinander aufheben. Von gewaltiger Schöpferkraft und doch zugleich von durchdringendem Verstände; … vom höchsten Wollen und vom höchsten Vollbringen; erfüllt von republikanischen Idealen und zugleich geboren zum König; ein Römer im tiefsten Kern seines Wesens und wieder berufen, die römische und die hellenische Entwicklung in sich wie nach außen hin zu versöhnen und zu vermählen, ist Caesar der ganze und vollständige Mann.«
Jacob Burckhardt, der ungleich nüchterner war und Mommsen im ganzen recht kritisch gegenüberstand, macht in Hinsicht auf Caesar keinen Unterschied: »In Betreff der Begabung vielleicht der größte Sterbliche. Alle die sonst groß heißen in der Geschichte, sind einseitig neben ihm.« Und Burckhardt sagt auch: »Die großen Individuen sind die Koinzidenz des Allgemeinen und des Besonderen«. In den Krisen kulminiere in ihnen das Bestehende und das Neue. Sie gehören in »schreckliche Zeiten, welche den einzigen höchsten Maßstab der Größe geben, und auch allein nur das Bedürfnis nach der Größe haben«.
In seiner eigenen Zeit sieht er eher »eine allgemeine Verflachung«. Er fügt allerdings hinzu: »Wir dürften das Aufkommen großer Individuen für unmöglich erklären, wenn uns nicht die Ahnung sagte, daß die Krisis einmal von ihrem miserablen Terrain ›Besitz und Erwerb‹ plötzlich auf ein anderes geraten, und daß dann der ›Rechte‹ einmal über Nacht kommen könnte, – worauf dann alles hinterdrein läuft.«
Eben davon spricht dann 1924 Gundolf in den ersten Sätzen seines Buches über Caesars Ruhm: »Heute, da das Bedürfnis nach dem starken Mann laut wird, da man, der Mäkler und Schwätzer müd’, sich mit Feldwebeln begnügt statt der Führer, da man zumal in Deutschland jedem auffallenden militärischen, wirtschaftlichen, beamtlichen oder schriftstellerischen Sondertalent die Lenkung des Volkes zutraut und bald soziale Pfarrer, bald unsoziale Generäle, bald Erwerbs- und Betriebsriesen, bald rabiate Kleinbürger für Staatsmänner hält, möchten wir die Voreiligen an den großen Menschen erinnern, dem die oberste Macht ihren Namen und Jahrhunderte hindurch ihre Idee verdankt: Caesar.« Solche Beschwörung könne keinen Caesar zeitigen, Geschichte wiederhole sich nicht. »Wie der künftige Herr oder Heiland aussieht, weiß man erst, wenn er waltet.« … »Doch wie er nicht aussieht, das kann Kenntnis lehren.« Der Historiker »kann die Luft regen helfen, worin einsichtige Taten gedeihen, und Geister werben für kommende Helden«. Das war die gleiche Erwartung, der schon Mommsen angehangen und die sein suggestives Bild von Caesar so sehr genährt hatte.
Heute dagegen erscheint Größe unglaubwürdig. Nicht mehr einfach, ob sie segensreich sei, sondern ob es sie überhaupt geben kann, ist die Frage. Die »verhunzte Größe«, von der Thomas Mann im Blick auf Hitler spricht, hat, so scheint es, ihrerseits die Vorstellung von Größe verhunzt. Wenn da eine Faszination über die Jahrhunderte wirken sollte, so träfe sie einstweilen vornehmlich auf Abwehr, wenn nicht auf Unempfindlichkeit.
Zudem ist vieles, was Caesar früher zugesprochen worden war, inzwischen höchst fragwürdig geworden. Die germanische Gefahr zum Beispiel, die er nach Mommsen gebannt hat, hat gar nicht bestanden. Vor allem aber sind gerade Caesars staatsmännische Fähigkeiten oder besser: Möglichkeiten zunehmend in Zweifel gezogen worden. So großartig viele der organisatorischen Werke waren, die er als Herrscher vollbrachte, so unsicher, wenn nicht unwahrscheinlich ist es doch, daß er wirklich einen Ausweg aus der tiefen Krise der römischen Republik gewußt hat.
Denn es ist durchaus möglich, daß die Vorstellung von Krisenlösung, die man so gern mit Caesar verbindet, auf einer Illusion beruht; die Vorstellung nämlich, daß ein wirklich überragender Mann durch Macht, Einsicht und Organisationsfähigkeit jede Krise zu jedem beliebigen Zeitpunkt meistern könne. Es muß doch zu allererst gefragt werden, ob sich in der damaligen römischen Gesellschaft überhaupt Anhaltspunkte für eine Lösung fanden. Schließlich handelte es sich um eine Republik, für deren maßgebende Schichten Freiheit das zentrale Element ihres Lebens war. Da stellten sich nicht nur Organisationsaufgaben, sondern auch solche der gründlichen Umorientierung und der Integration. Nicht jeder Gesellschaft ist primär an Ruhe und Ordnung gelegen, auch um den Preis der Monarchie. Es müßte also irgendeine Bereitschaft, eine Disposition, eine neue Ordnung zu tragen, in nennenswerten Teilen der Gesellschaft vorhanden gewesen sein. Nur dann wäre es möglich gewesen, der Krise durch bewußtes Handeln von einer politischen Zentrale her beizukommen, also Macht über die Verhältnisse zu erhalten.
Caesar jedoch hatte vermutlich nur Macht in den Verhältnissen. Denn die Verfügung über eine Armee, der Sieg in einem Bürgerkrieg, umfassende Vollmachten, die Liebe der Massen, die er zeitweilig genoß, die große Zahl von Freunden, Reichtum und die Möglichkeit, viele Wünsche zu erfüllen, können einen Politiker zwar instand setzen, ungeheuer viel auszurichten und unwiderstehlich zu werden. Um die Verhältnisse, die er vorfindet, aber nachhaltig und dauerhaft zu verändern, braucht er möglicherweise ganz andere Formen von Macht. Sein Wille muß einrasten können in Bedürfnisse, Interessen, Meinungen, muß sie formieren können, nicht nur, damit in diesem und jenem Fall geschieht, was er will, sondern damit sich die Gesellschaft insgesamt neu einrichtet und die neue Ordnung eine gewisse Selbsttätigkeit annimmt. Macht und Gewalt können dazu verhelfen, aber Legitimität läßt sich weder anordnen noch sonstwie erzwingen.
Gelegentlich steht zwar der Stoff zur neuen Legitimität schon bereit, wenn nämlich viele Wünsche, Sehnsüchte und Interessen da sind, die man nur aufrufen und bündeln muß. Dann liegt das Problem der Macht über die Verhältnisse primär bei dem Politiker, dem das aufgegeben ist. Das war etwa bei Augustus der Fall. Doch wie es zur Zeit Caesars damit stand, ist sehr die Frage.
Jedenfalls spricht vieles dafür, daß er in den Verhältnissen der damaligen römischen Republik als Einzelner um so mächtiger wurde, je weniger Anknüpfungspunkte für eine direkte Überwindung des kritischen Zustands der damaligen Gesellschaft es gab.
Allein, wäre damit Caesars Faszination schon erledigt – oder wären es vielmehr nur einige Erwartungen, die man zumal im neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhundert an ihn richtete? Erwartungen, die mindestens ebensoviel mit dem Glauben an einen Sinn der Geschichte wie mit dem an die sinnvolle Rolle großer Männer zu tun haben; Erwartungen aber auch an die außerordentliche menschliche Fähigkeit, politisch Herr über die Probleme zu werden, und sei diese Fähigkeit auch nur versammelt in einem einzigen Mann, einem politischen Retter oder Messias also zu haben? Und Erwartungen schließlich auch, denen spezifisch neuzeitliche – allmählich veraltende – Ansprüche an das geordnete Arbeiten politischer Systeme zu Grunde liegen?
Vielleicht wirkt Caesar trotz oder gerade wegen seines Scheiterns vor der Aufgabe einer Neuordnung Roms großartig. Vielleicht waren die gleichen Umstände, die sein Scheitern bedingten, auch die Voraussetzungen der so besonderen Ausbildung seiner Persönlichkeit sowie seiner Erfolge. Diese Erfolge errang er, weil er Außenseiter war und blieb. Glanz und Souveränität, Heiterkeit und Charme Caesars hingen eng mit der großen Distanz zusammen, in die er zur kleinlichen, ohnmächtigen und stumpfen politischen Welt des damaligen Rom geriet und die er dann mutwillig immer weiter steigerte. Die Freiheit und Sicherheit seines Willens und die volle Entfaltung seiner Gaben wurden erst in der innerlichen und dann auch äußerlichen Ablösung von der römischen Welt möglich, einer Ablösung, die zu einem Gegensatz führte, der so groß war, daß er nur mehr mit Waffen ausgetragen werden konnte. So hat Caesar, was seine Größe ausmachte, vielleicht nur auf Kosten eines letzten Scheiterns gehabt. Die Tatsache, daß es in Rom keine Kraft, keine Sache gab, an der er seinen Willen hätte objektivieren können, hat vielleicht nicht nur die Möglichkeit beschnitten, eine neue Ordnung zu gründen, sondern ihn auch dazu herausgefordert, dann wenigstens sich und seine Welt großartig und imponierend, aber eben neben der etablierten Gesellschaft zu entfalten.
Schließlich hätten zum ernsthaften Versuch einer Neuordnung – wenn Caesar sie denn gewollt hätte – viel Geduld, Einfühlung, zahlreiche Konzessionen sowie große Zurückhaltung gehört; viel Taktik, Berechnung, Überzeugungsarbeit, viel stilles, beharrliches Wirken. Und wenn er das alles hätte aufbringen können, wäre er dann noch der gewesen, der mit seiner Persönlichkeit viele Jahrhunderte lang die Geister Europas bezaubert hat?
3 Caesar. Bildniskopf aus grünem Schiefer. Aus Aegypten, frühes 1. Jahrhundert n. Chr. Berlin, Pergamonmuseum.
Doch kann diese Bezauberung, wovon immer sie ausgegangen sein mag, noch uns berühren? Können wir nach Hitler noch im Sinne der alten europäischen Tradition mit großen Männern rechnen? Und können wir es vor allem auch dann noch, wenn ihre Domäne die Politik und der Krieg waren? Kann uns ein Mann noch faszinieren, der um seiner selbst willen einen Bürgerkrieg – und vorher den Krieg zur Eroberung ganz Galliens – eröffnete?
Doch fragt sich hinwiederum auch, ob wir so viel besser – und nicht nur anders – belehrt sind als die lange Reihe großer Geister seit der Renaissance, die Caesar, bei aller möglichen Kritik an seinen Taten, eine unvergleichliche Größe zuerkannten.
»Schließlich beginnen wir zu ahnen«, schreibt Jacob Burckhardt, »daß das Ganze der Persönlichkeit, die uns groß erscheint, über Völker und Jahrhunderte hinaus magisch auf uns nachwirkt, weit über die Grenzen der bloßen Überlieferung hinaus.« Sollte also das Urteil der Neuzeit durch eine mysteriöse, magische Kraft der Nachwirkung bedingt sein, die erst uns heute aus ihrem Bann entließ? Wenn sie es denn tat.
Ohne daß man magische Wirkungen ganz ausschließen wollte, liegt es näher, an eine andere Erklärung für die hohe Schätzung Caesars durch so viele Generationen hindurch zu denken. Burckhardt beobachtet selbst ein »Gefühl der unechtesten Art, nämlich ein Bedürfnis der Unterwürfigkeit und des Staunens, ein Verlangen, uns an einem für groß gehaltenen Eindruck zu berauschen und darüber zu phantasieren«. Er denkt dabei vor allem an gegenwärtige Eindrücke. Aber sollte es nicht überhaupt ein Bedürfnis nach Größe geben, das nach Vorbildern suchen muß, nach einem Maßstab für die eigenen Ansprüche, als Beleg für deren Recht und die Möglichkeit ihrer Verwirklichung? So könnte Caesar eine Stelle besetzt haben, die gewissermaßen im geistigen Haushalt der Neuzeit vorgesehen war und gebraucht wurde, so daß er zwar vielfältiger Interpretation ausgesetzt, zugleich aber sicher war vor der Entlassung aus seiner Rolle als wichtigstes Vorbild menschlicher Größe.
Er war zeitlich weit entfernt, ein Römer, hatte als erster der Kaiser gegolten. Relativ viel war von ihm bekannt, so daß man sich eine Vorstellung von ihm machen konnte. Auch hat er nicht nur erobert, sondern auch politisch viel bewirkt. Er war nicht an eine bestimmte Nation gebunden, war nicht von gegenwärtigen Feindschaften tangiert. Und vielleicht war er ja wirklich auch unter denen, die die Weltgeschichte des öffentlichen Wirkens zu den Großen zählt, unvergleichlich; durch die Vielseitigkeit seiner Leistungen, seines Wesens, durch die, wie es scheint, nahezu klassische Ausbildung seiner Persönlichkeit. Und alles, was seinem Werk fehlen mochte, konnte man frei zu Plänen ergänzen, deren Ausführung nur die Verschwörer vereitelt hätten. »Sie … sollten den Tod Caesars auf eine vollwürdige Weise, großartiger als Voltaire, schreiben«, forderte Napoleon Goethe auf. »Das könnte die schönste Aufgabe ihres Lebens werden. Man müßte der Welt zeigen, wie Caesar sie beglückt haben würde, wie alles ganz anders geworden wäre, wenn man ihm Zeit gelassen hätte, seine hochsinnigen Pläne auszuführen.« So konnte sich der Glaube an die menschliche Größe, der Traum von der menschlichen Fähigkeit, über alles zu triumphieren, in Caesar geradezu institutionalisieren, also befestigen gegen viele Zweifel, die gegen andere wohl angebracht schienen. Vielleicht ließ das eine besondere Faszinationswilligkeit entstehen.
Und doch: Könnte es nicht sein, daß gleichwohl von Caesar, von all dem, was uns von ihm und über ihn verläßlich überliefert ist – etwas Faszinierendes ausgeht? Etwas, was sogar heute noch den Betrachter in seinen Bann schlagen kann? Und ist dies nicht die Wirkung einer besonderen Größe, die auch durch alle Erfahrungen unseres Jahrhunderts nicht dementiert werden kann?
Die Erfolge Caesars sind jedenfalls imposant. Und die Weise, in der, die Summe der Fähigkeiten, mit denen Caesar sie errang, ist es nicht minder. Cicero rühmt seinen Geist, seine Vernunft, sein Gedächtnis, seine literarische und wissenschaftliche Bildung, seine fürsorgliche Umsicht, Entschlußkraft und Sorgfalt. Drei Generationen später fand der alte Plinius, Caesar sei »mit Geisteskraft am hervorragendsten begabt« gewesen. »Ich will hier nicht von seiner Tatkraft und Festigkeit sprechen, nicht von seiner erhabenen Fähigkeit, alles zu umfassen, was unter dem Himmel ist, sondern von der ihm eigenen Lebenskraft und der durch ein Feuer beflügelten Schnelligkeit seiner Gedanken.«
Burckhardt nennt ihn »einen wundervoll organisierten Geist von unglaublicher Vielseitigkeit, Spannkraft, Schärfe, die größte Kühnheit und Entschlossenheit, verbunden mit Klugheit und Verschlagenheit«, und dafür gibt es Zeugnisse genug. Eine reiche Phantasie, eine enorme technisch-taktische Findigkeit sticht ins Auge. Eine erstaunliche Fähigkeit, Situationen frühzeitig und bis auf den Grund zu erkennen, Scheinwirklichkeit als Schein und verkannte Wirklichkeit als Wirklichkeit zu durchschauen, Möglichkeiten zu sehen, die normalerweise nicht wahrgenommen wurden, und umsichtig auf nahezu alles gefaßt zu sein. Denn er kannte auch die Macht des Zufalls und wollte ihr nicht ausgeliefert sein. Berühmt ist seine Schnelligkeit, die Celeritas Caesaris. Bemerkenswert die Elastizität, mit der er sich auf alles Neue einstellt, das Lernvermögen. In allem, was er tut, wirkt er durchaus männlich, teilweise hart und fest, doch ist zugleich ein spielerisches Element, eine fast jugendliche Fülle der Möglichkeiten an ihm zu beobachten. Offenkundig ist weiter die »Seelenstärke, welche es allein vermag und daher auch allein liebt, im Sturm zu fahren« (Burckhardt), und eine ungeheure Konzentration des Willens, eine starke, rücksichtslose Unbedingtheit, mit der er auch seine Soldaten zu beseelen wußte. Dahinter stehen Erfolgsgewohnheit, Selbstvertrauen und letztlich die maßlose Selbstbezogenheit, in der er um seiner Sicherheit willen sogar den Bürgerkrieg eröffnen konnte. Dem allen gesellte sich seine vielgerühmte Clementia, die Milde gegenüber den Gegnern im Bürgerkrieg. Nicht zu vergessen schließlich das wundervolle Latein, das er schrieb, von großer Einfachheit, Klarheit und Eleganz, von genauester Regelmäßigkeit und dabei höchst individuell – in seiner Brillanz offenbar ein Niederschlag seiner Art zu sehen und zu handeln.
Es gibt Epochen, in denen man – nach Musil – nur die Wahl hat: »diese niederträchtige Zeit mitzumachen (mit den Wölfen zu heulen) oder Neurotiker zu werden«. Die späte römische Republik gehörte auf ihre Weise dazu. Da gab es zwar höchst achtbare, verantwortungsvolle Senatoren, aber ihre Politik war verzweifelt und schwach. In der Regel versank alles in unendlicher Eigensucht und rücksichtsloser Ausnutzung aller Positionen: Ein Bild der Korruption und des Versagens. Die Regel war, daß man mitmachte. Der Historiker Sallust, ein moralisch sehr anspruchsvoller Mann, gibt der Gesellschaft die Schuld, wenn er selbst sich nicht verhalten konnte, wie er es eigentlich wollte: »Anstelle von Anstand, Selbstdisziplin, Tüchtigkeit herrschten Frechheit, Bestechung, Habgier. Wenn ich das auch, ganz unberührt von schlechter Art, verachtete, wurde zwischen so großen Lastern meine ungefestigte Jugend doch von der Sucht nach Ehren und Gewinn verdorben und darin festgehalten.« Relativ wenige wurden, soweit wir sehen, zwar nicht unbedingt zu Neurotikern, aber doch einem Zwang zur Negation ausgesetzt. Und viele schwankten dazwischen.
Caesar hingegen wußte einerseits alle Hebel der Gesellschaft mit Bravour zu betätigen, wußte sich in allem sein Teil zu holen und gewann doch eine innere Unabhängigkeit und damit zugleich eine heitere und leicht arrogante Souveränität über allem. Er blieb Außenseiter und sammelte zugleich eine Macht, die es ihm am Ende ermöglichte, es mit ganz Rom aufzunehmen. Er hielt seinen Kurs, konnte sich nirgends wirklich anschließen, blieb auf sich gestellt. Das gab ihm die unerhörte Freiheit. Er konnte in seiner Gesellschaft keinen Grund für sich finden, war insofern zufällig. Die Bindung, welcher die Freiheit bedarf, die ja nach Sartre »die Wahl eines Ziels im Dienste der Vergangenheit« ist, kam ihm aus dem altrömischen Leistungsethos. Das gab ihm eine Richtschnur, freilich außerhalb seiner Gesellschaft, die ja nicht mehr die alte war. Er entwickelte hohe Ansprüche, an denen er seine Standesgenossen maß, um ihr Versagen desto deutlicher zu erfahren. Er selbst dagegen erfüllte sie in umfassendster Weise, allein, wie er war, stärkster Bedrohung und höchsten Anforderungen ausgesetzt. Er lebte ganz seiner Tatkraft. Die Einfügung in die Standesdisziplin, die das alte Leistungsethos fruchtbar ergänzt hatte, verschmähte er in einer ästhetisch vielleicht imposanten, ethisch höchst problematischen Unbekümmertheit. Gleichzeitig verabsolutierte er seine Persönlichkeit. Denn da er allein war in seiner Gesellschaft, da es da keine Sache gab, der er sich hätte verbinden und in deren Namen er hätte handeln und sein können, blieb ihm nichts, als sich selbst in diesem Raum gleichsam immer weiter auszuspannen. Und er konnte sich unter den Gegebenheiten der weltbeherrschenden Republik, des mächtigsten Adels der Weltgeschichte eine eigene Welt aufbauen, in der er sich wahrhaft selbst zu verwirklichen und alles auszuleben vermochte, was in ihm war: Um den Preis, daß er sich in Rom nicht mehr einfügen konnte. Die Dynamik, mit der er seiner Gesellschaft begegnete, nahm zunehmend etwas Ungeheures, Ungeheuerliches, Dämonisches an.
Wie Caesar seine Rolle spielte, wie hier ein Mann sein Ich wagte, dann aufs äußerste steigerte, seine reichen Möglichkeiten suchte, erfuhr und auskostete, das ist in der Tat ein erregendes Schauspiel. Die Kostüme sind historisch. Immerhin gehören sie der römischen Geschichte an. Und das Stück spielt zu einem Zeitpunkt, da die Klammern sich lösen, die in der Spannung von Kräften und Gegenkräften Roms Ordnung bis dahin zusammengehalten haben: Eine Fülle von Kraft, auf deren Hervorbringung Rom sich in Jahrhunderten in einer dumpfen Geschlossenheit diszipliniert hatte, wird freigesetzt. Und gleichzeitig öffnet sich die Stadt mehr und mehr für die Feinheiten der griechischen Kultur. Ungebärdig trifft alles aufeinander, in so unterschiedlichen Figuren wie Marius und Sulla, Cato und Caesar, Pompeius, Crassus und Lucullus, Cicero und Brutus; nicht zu vergessen die glänzend leichtsinnigen Erscheinungen der Generation, die dazwischen aufwächst, nachmacht, was ihr vorgemacht wird, ohne die Skrupel zu kennen, die in denen, nach denen sie sich richten, gelegentlich doch noch wirksam sind; nicht zu vergessen auch die Damen des römischen Adels, die die Freiheit, die Kultur und zuweilen auch die Macht zu schätzen lernen, die sich ihnen eröffnen. Wo sonst haben sich Macht und persönlicher – nicht institutioneller – Glanz so eindrucksvoll verbunden?
4 Caesar. Bildnis in Pisa. Der Kopf entspricht einem in augusteischer Zeit entstandenen und in mehreren Kopien überlieferten Typus, der sich von dem früheren Porträt (Abbildung 1) deutlich unterscheidet: die als unschön empfundene Glatze ist durch reicheren Haarwuchs verdeckt; stärker betont sind die hohe, gefurchte Stirn und der angespannte, Entschlossenheit markierende Kiefer.
Wenn diese Zeit und ihr bedeutendster Protagonist noch heute faszinieren können, so liegt es daran, daß es im Grunde unsere Sache ist, die dort aufgeführt wurde und deren Ernst man dort begegnet. Neben und in der historischen liegt ja stets die anthropologische Dimension.
Caesars Größe nämlich, »soferne man das pathetische Wort überhaupt ins Spiel zu bringen wagt«, liegt »weder in der Schlackenlosigkeit eines leuchtenden Genius noch in der Lizenz eines freigesetzten Immoralismus …, sondern gerade in seiner auf extreme Weise problematischen Menschlichkeit samt möglichem Glanz und unentrinnbarem Elend, Unheil und Schuldigwerden und vor allem … in seiner historischen Effizienz«, in der er so vieles bewirkt, aber auch zerstört hat.
Otto Seel, dessen Caesar-Studien dieses Zitat entnommen ist, spricht von einem »Wechselspiel von zwingender Faszination und verstörter Betroffenheit, die von diesem Menschen ausgegangen sein muß als Charisma und Dämonie und dem sich außer wenigen … kaum jemand entziehen konnte, vom einfachen Legionär bis in die Oberschicht der Nobilität«. Aber ist nicht beides in der Faszination enthalten, daß sie einen aus Entzücken und Grauen gemischten, zugleich anziehenden und abstoßenden, nur jedenfalls bezaubernden Eindruck hervorruft?