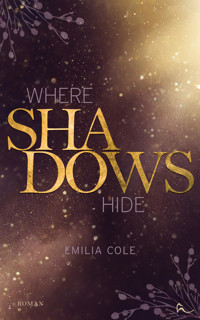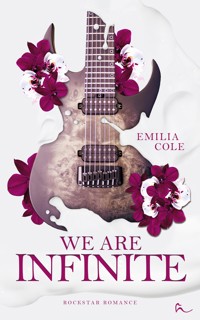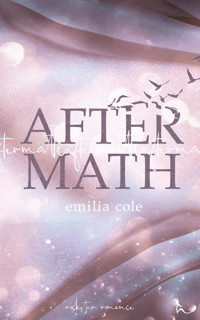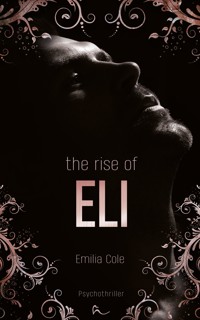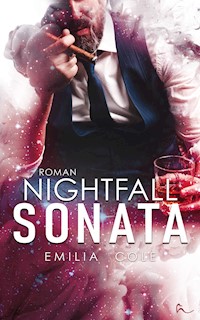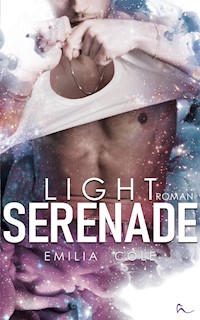6,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 4,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Er ist die Herausforderung, das Unbekannte.
Er ist die Sehnsucht tief in mir.
Er ist anders, als meine sonstigen Patienten. Er passt in kein Raster mit seiner faszinierend düsteren Ausstrahlung und den tiefbraunen Augen. Er ist meine persönliche Sünde und ich schaffe es nicht, der Versuchung zu widerstehen.
Mit welcher Intention er mein Sprechzimmer aufsucht, weiß ich nicht. Aber ich lasse mich auf ihn und sein reizvolles Spiel ein.
Doch er will mehr.
Er will die Abgründe meines Kaninchenbaus.
Er will meine Wahrheit.
Meine Schuld.
Dark Romance meets Psychothriller
Ab 18 Jahren
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2022
Ähnliche
Impressum
© 2024 Rinoa Verlag
c/o Emilia Cole
Kolpingstraße 31, 47608 Geldern
Lektorat: Maria Rumler
ISBN: 9783754622063
www.rinoaverlag.de
www.emilia-cole.de
Alle Personen und Handlungen in diesem Roman sind frei erfunden. Jedwede Ähnlichkeit zu lebenden Personen ist rein zufällig.
Das Werk, einschließlich seiner Teile, ist urheberrechtlich geschützt. Jede Verwertung ist ohne Zustimmung des Autors unzulässig. Dies gilt insbesondere für die elektronische oder sonstige Vervielfältigung, Übersetzung, Verbreitung und öffentliche Zugänglichmachung.
Inhalt
Impressum
Inhalt
Playlist
Prolog
Kapitel 1
Kapitel 2
Kapitel 3
Kapitel 4
Kapitel 5
Kapitel 6
Kapitel 7
Kapitel 8
Kapitel 9
Kapitel 10
Kapitel 11
Kapitel 12
Kapitel 13
Kapitel 14
Kapitel 15
Kapitel 16
Kapitel 17
Kapitel 18
Mein Gestern mit Kellan
Kapitel 19
Mein Gestern mit Henry
Kapitel 20
Mein Gestern mit Kellan
Kapitel 21
Mein Gestern mit Henry
Kapitel 22
Mein Gestern mit Kellan
Kapitel 23
Mein Gestern mit Kellan
Kapitel 24
Mein Gestern mit Henry
Kapitel 25
Mein Gestern mit Henry
Kapitel 26
Mein Gestern mit Kellan
Kapitel 27
Mein Gestern mit Kellan
Kapitel 28
Mein Gestern mit Kellan
Kapitel 29
Mein Gestern mit Kellan
Kapitel 30
Kapitel 31
Kapitel 32
Kapitel 33
Kapitel 34
Nachwort
Dank
Playlist
Die Playlist zum Buch: https://spoti.fi/3ipwRMV
Devil Sold His Soul - Callous Heart
Devil Sold His Soul - Drowning / Sinking
Hundreds - Wilderness
Emily Browning - Sweet Dreams
Apparat - Joel
Gunship, Corin Hardy - Cthulhu
Nobuo Uematsu - Via Purifico
Rhaeide - Beauty And The Beast - Prologue
Max Richter - The End Of All Our Exploring
Nicholas Britell - Memento Mori
Michael Abels - I got 5 on Us
Michael Abels - Anthem
Clint Mansell - Hope Overture
Charlie Clouser - Ella
Charlie Clouser - Hello Zepp + Overture
Charlie Clouser - Hello Eric
The Browning - End Of Existence
The Browning - Dragon
Lorna Shore - And I Return To Nothingness
Chelsea Grin - The Isnis
Make Them Suffer - Erase Me
Make Them Suffer - Soul Decay
And now you see, you’re so fucking callous
This isn’t the way, that it was supposed to be
My mind is made of, this is over
This isn’t the way, that it was supposed to be
From Callous Heart
By Devil Sold His Soul
Gegen Gewaltverherrlichung
Gegen Romantisierung von Missbrauch
Prolog
Wenn dir der Regen zu stark ins Gesicht schlägt, wenn die Wellen um dich herum zusammenbrechen, bist du verloren.
Es ist, als würde der Ozean dich verschlingen.
Ich kann nicht bleiben und das weißt du. Den Winter haben wir beide über uns hereingebracht, aber durch dich sehe ich den Frühling nie mehr.
Es wird kalt bleiben.
Ich bete für meinen Tod, weil der Himmel auf mich herabgestürzt ist. Wie weit deine Arme auch für mich geöffnet bleiben, du hast mein Vertrauen, meinen Verstand und mich gebrochen.
Kapitel 1
Mein Patient sitzt breitbeinig auf der hellbraunen Ledercouch. Als er vor zwanzig Minuten den Raum betrat, hat er sich vor mein Regal gestellt und verschiedene Bücher meiner Enzyklopädien herausgegriffen.
Seine Frau hat Mr Connor dazu verdonnert, mich ab heute einmal in der Woche aufzusuchen, laut ihrer Aussage ist er ein notorischer Fremdgeher.
Er scheint sich darüber im Klaren, wie er auf Frauen wirkt. Allein durch seine Größe und die breite Statur beeindruckt er mich. Seine kurzen hellbraunen Haare hat er akkurat nach hinten gestylt, er ist glattrasiert, er sieht geleckt aus. In seinem arroganten Blick entdecke ich dennoch eine Spur von Wärme.
Mit dem Kugelschreiber klopfe ich auf das Klemmbrett und unterdrücke den Drang auf die Uhr zu sehen, die hinter ihm über der Tür hängt.
»Und dann beschwert sie sich, dass ich sie betrüge. Wir haben kaum noch Sex. Natürlich hole ich mir es bei anderen, wenn meine prüde Frau die Beine nicht mehr für mich breitmacht.«
»Seit wann schlafen Sie nicht mehr miteinander?«, frage ich, male dabei eine Blume auf das Papier. Als ich merke, was ich tue, schaue ich ihn wieder an.
»Seit Monaten!«, schleudert er mir entgegen, seine hellbraunen Augen aufgerissen.
Es kommt vor, dass meine Patienten mich angehen, das ist für mich zur Normalität geworden. Ihre emotionalen Ausbrüche nehme ich hin, schließlich ist es nie gegen mich persönlich gerichtet.
In meinen ersten beiden Jahren als Psychologin fiel es mir schwer, die entsprechende Distanz zu den Patienten zu wahren, aber mittlerweile komme ich gut damit zurecht.
»Fühlen Sie sich von ihrer Frau entmannt, weil sie nicht mehr mit Ihnen schlafen möchte?« Er lehnt sich im Sessel zurück und zerrt an seinem Krawattenknoten. »Glauben Sie, ihre Frau betrügt Sie?«
»Das würde sie nicht tun.«
»Wieso denken Sie das?« Sein rechtes Augenlid zuckt, er setzt sich aufrecht hin und ich werde hellhörig. »Werden Sie wütend, wenn Sie daran denken?«
»Natürlich werde ich das«, stößt er aus.
Ich notiere impulsiv.
Patienten, die wegen leicht negativen Verstimmungen zu mir kommen, gehören zu den einfachen Fällen. Doch ich sehne mich nach mehr. Seit Jahren möchte ich mit jemandem zusammenarbeiten, der mich herausfordert und mich an meine Grenzen bringt.
Klingt das verrückt?
»Haben Sie jemals das Bedürfnis verspürt, ihre Wut nach außen zu tragen?« Stumm blickt er mich an. »Sie sind hier, damit ich Ihnen helfen kann«, sage ich in einem sanfteren Ton.
»Ich schlage meine Frau nicht!« Er ballt seine Hände zu Fäusten.
Ich notiere leicht reizbar.
»Haben Sie ihre Frau zum Sex gezwungen?« Er weicht meinem Blick aus. »Möchte sie deswegen nicht mehr mit Ihnen schlafen?«
»Kann ich jetzt gehen?«, fragt er ausdruckslos. »Das gleicht ja einem Verhör. Bin ich bei einer Seelenklempnerin oder auf dem Revier?«
»Wir haben noch zwanzig Minuten, das ist bezahlte Zeit. Wenn Sie gehen möchten, ist das Ihre Entscheidung. Ich werde Sie nicht aufhalten.«
Er atmet laut durch und sinkt zurück in das Polster.
Nach der Stunde verlässt Mr Connor frustriert den Raum. Ich verabschiede ihn und schließe die Tür zur Anmeldung, damit ich Ruhe habe. Der Raum ist halbhoch mit Holz verkleidet. Die Wand hinter meinem Tisch schmücken lediglich zwei abstrakte Bilder. Das Fensterbrett ziert ein kleiner Bonsai, damit mein Sprechzimmer heimeliger wirkt.
Hinter der Couch und dem Sessel steht der Tisch, an den ich mich setze, um den Aktenstapel zu checken. Wir halten die Daten auch digital fest, doch ich gehe gern auf Nummer sicher und hefte alles noch einmal separat ab.
Danach genieße ich meinen Feierabend, den ich nutzen werde, um mir einen Film anzusehen und vor dem Fernseher einzuschlafen. Hin und wieder gönne ich mir Eis und wenn ich einen besonders wilden Abend plane, kaufe ich mir sogar eine Flasche Rotwein.
Das ist das faszinierende Leben, das ich seit Wochen führe. Ich vegetiere vor mich hin und versuche mich davon abzulenken, dass ich alles hinter mir gelassen habe.
Nur meine Eltern, meine Schwestern und mein Ex Henry wissen, wo ich mich abgesetzt habe, doch sie akzeptierten meinen Freiheitsdrang.
So zumindest habe ich ihnen meinen Umzug erklärt.
Mein Heimweg führt mich zu Marthas Store, wo ich mir noch ein Eis besorgen möchte. Der nächste große Laden ist in Winnipeg, hier in Headingley gibt es nur diesen einen. Ich kaufe hier gerne ein, denn der Laden strahlt Intimität und Nähe aus. Vor dem Eingang pflanzt die Besitzerin beinahe monatlich neue Blumen in den zwei Kübeln an und in den wenigen Gängen erhält man nur das Nötigste. Weniger Auswahl bedeutet außerdem weniger Kopfzerbrechen.
Auf dem Parkplatz stehen zwei Autos. Der alte Toyota der Besitzerin und ein großer dunkler Dodge RAM Pick-up.
Ich lenke meinen Wagen zwischen die beiden, ziehe den Schlüssel aus dem Zündschloss, mustere den schwarzen Pick-up rechts neben mir und steige aus meinem Auto. Am Rückspiegel des RAMs hängt ein Rosenkranz, der noch leicht hin und her schwingt.
Im Laden empfängt mich die klingelnde Glocke über der Tür. Die Besitzerin schaut von ihrer Zeitschrift auf und schenkt mir ein herzliches Lächeln, das ich erwidere.
»Ms Moore«, sagt sie. Die Zeit hat Falten in ihre Haut gemalt, das Leben zeichnet sich deutlich auf ihrem Gesicht ab. Eine breite Haarklammer hält ihr strohiges weißes Haar am Hinterkopf zusammen. Ihre hervorstehende Stirn wirft Schatten auf ihre Wangen.
Sie deutet mit einer leichten Handgeste auf die Gefriertruhe den Gang entlang. »Wir haben heute neues Eis bekommen«, sagt sie und zwinkert mir zu.
Ich lache auf. »Sie kennen mich zu gut. Wie geht es ihrem Sohn?«
»Er kommt mich in zwei Wochen besuchen.«
»Haben Sie etwas geplant?«
Sie lächelt. »Oh, Liebes, nur das übliche. Er wird ein wenig mein Dach ausbessern, das schaffe ich schließlich nicht mehr.«
»Sie sind noch topfit, helfen Sie ihrem Sohn.« Martha lacht herzhaft und dieses ehrliche Lachen erwärmt meinen Brustkorb auf eine wunderbare Weise.
Sie winkt ab. »Liebes, ich bin so Einiges, aber nicht mehr fit.«
Ein Geräusch aus dem Gang weckt meine Aufmerksamkeit. Ein großer, breitschultriger Mann steht mit dem Rücken zu mir vor dem Regal im hinteren Teil des Geschäfts. Er hat dunkle Haare, trägt ein schwarz-weiß kariertes Hemd. Als er zu dem Trockenfleisch greift, entdecke ich den silbernen Ring an seinem Zeigefinger. Danach gleitet mein Blick über seine Hand, die Adern, die Sehnen.
Er dreht sich um und schaut mir direkt ins Gesicht. Die wenigen Meter, die uns trennen werden zu einem Tunnel.
Seine beinahe schwarzen Haare fallen wild in seine Stirn, als würde er wenig Wert darauf legen, sie zu kämmen. Dennoch ist er nicht ungepflegt, er will so aussehen.
Wild.
Rau.
Ungezähmt.
Er will, dass die Menschen ihm aus dem Weg gehen und die Straßenseite wechseln. Pure Provokation.
Er sieht nicht weg, nicht eine Sekunde lässt er den Blick von mir. Auch wenn ich sonst selbstbewusst auf derart einschüchterndes Verhalten reagiere, verspüre ich den Drang, davonzulaufen.
Denn da ist noch mehr in seinem Ausdruck.
Es ist beinahe vertraut.
Ich zucke mit einer Braue, was er mit einem ebenso unbeeindruckten Zucken beantwortet und mein Körper reagiert.
Als würde ein Messgerät ausschlagen. Ein Elektroenzephalograph würde voll anschlagen, da bin ich mir sicher.
Und das, obwohl Männer mit Vollbärten mich nie angezogen haben.
Ich wende mich ab und schenke ihm den Sieg. Stur und auch ein wenig verärgert gehe ich zur Gefriertruhe einen Gang weiter, ohne ihn weiter zu beachten. Trotzdem spüre ich seinen Blick auf mir.
Hitze kriecht meinen Rücken hinauf, umfasst meine Schultern, meinen Hals, meinen ganzen Körper.
Mit einer schwungvollen Bewegung öffne ich den Gefrierschrank, wodurch mir die Kälte entgegenschlägt. Einige Sekunden verharre ich regungslos, bis die Hitze meines Körpers der Kühle aus dem Eisfach weicht. Ich greife nach dem Cookie & Cream Eis und kaum drehe ich mich um, ertönt das Geräusch der Kasse.
Er bezahlt und verlässt das Geschäft.
Als die Glocke über der Tür verstummt, gehe ich zur Verkäuferin, lege das Eis auf den Tresen und öffne meine Geldbörse.
»Dieser Mann ist gefährlich«, flüstert sie. Ich sehe nach draußen. Der Pick-up rollt über den Parkplatz und biegt auf die Straße. »Passen Sie auf sich auf, Liebes.«
»Ich bin mir sicher, Sie machen sich grundlos Sorgen«, erwidere ich lächelnd und zahle.
Sie greift nach einer Papiertüte, aber ich winke ab. »Wissen Sie, wo er wohnt? In dem Haus hinten in der Dodds Road. Das ganz am Ende der Straße.«
»Nur, weil jemand in einem alten Haus lebt, bedeutet das noch lange nicht, dass er gefährlich ist.« Dass ich ebenfalls in der Straße wohne, erwähne ich nicht, aber vermutlich weiß sie es sowieso. »Haben Sie einen schönen Abend und grüßen Sie ihren Sohn von mir«, sage ich und verlasse das Geschäft.
Auf der Heimfahrt kreisen meine Gedanken um diesen Mann.
Um die dunkelbraunen Augen.
Diese Ausstrahlung.
Ich war davon überzeugt gewesen, das Haus am Ende der Straße stünde leer, somit verwerfe ich meine Pläne vor dem Fernseher das Eis zu essen und entscheide mich zu einer Jogging-Runde. Als ich in die Dodds Road einbiege, fällt mein Blick auf die Farm, die neben meinem Haus liegt. Ein Silo steht nur wenige Meter von meinem Garten entfernt. Der alte Schuppen sieht marode aus und wurde sicherlich mehrere Jahrzehnte nicht mehr genutzt.
Den Wagen parke ich auf der schmalen Einfahrt vor der Garage. Mein Dad würde hier stundenlang mit Unkrautvernichter arbeiten, aber mir gefallen die Blumen, die in dem aufgerissenen Beton blühen.
Über zwei Stufen gelange ich auf die schmale Veranda und in meinen Bungalow.
Ein dunkles Ziegeldach bedeckt das blaugestrichene Haus. Die Farbe blättert an wenigen Stellen bereits ab. Ich weiß nicht, ob ich mich hier wohlfühle, aber sobald ich das Haus betrete, schweigen meine Erinnerungen.
Vom Flur aus erreiche ich alle anderen Räume des Hauses. Die Tür am Ende des langen und schmalen Flurs führt zu meinem Garten, der an eins der Felder grenzt.
In mein neues Heim habe ich nur das Nötigste mitgenommen, wenige Fotos schmücken meine Kommode im Flur. In der Küche hängt nur ein Bild und das, weil der Vormieter es zurückgelassen hat. Am Kühlschrank hängt neben einem Rezept für Kirschkuchen nur ein Flyer eines hiesigen Pizzalieferanten. Im Wohnzimmer zieren meine Regale und der Fernseher die Wand. An meinem Esstisch stehen zwei Stühle, in meinem Schlafzimmer habe ich neben dem Bett nur eine Kommode und einen kleinen Kleiderschrank.
Das Eis verstaue ich im Eisfach des Kühlschranks, wobei ich mit der anderen Hand die verzogene Tür am Hängeschrank richte, die sofort wieder herunterrutscht.
Ich gehe ins Schlafzimmer und drücke auf den Lichtschalter. Die Lampe wird surrend hell, doch nach einem leisen Pling verschwindet der Raum im Dunklen. »Scheiße«, zische ich, taste mich an der Wand entlang zum Bett und knipse die kleine Lampe auf dem Nachtschrank ein.
Würde meine Mutter meine Bleibe sehen, würde sie sich mit verschränkten Armen vor mich stellen, mit dem Fuß auf den Boden klopfen und den Kopf schütteln. Mein Plan auf dieses Fleckchen Land ohne größere Infrastruktur zu ziehen, hat sie als unklug und dumm bezeichnet.
Aber nach all dem, was ich erlebt habe, habe ich das Gefühl, nichts mehr verlieren zu können.
Die Dielen in meinem Schlafzimmer knarren unter meinen Schritten. Das Geräusch erinnert mich an die drei Treppenstufen im Haus meiner Eltern.
Meine jüngere Schwester Valerie und ich haben oft versucht, uns aus dem Haus zu schleichen, als wir auf der High School waren. Doch die heimtückischen Stufen haben uns beinahe jedes Mal verraten und unsere Eltern aus dem Bett gelockt. Mom stand dann mit verschränkten Armen in der Tür und es hatte lediglich ein Kopfschütteln von ihr gebraucht, damit wir frustriert in unseren Zimmern verschwanden.
Ich ziehe meine Sportsachen an und stecke mir meine Kopfhörer in die Ohren. Schlüssel und Handy lege ich auf das Vertiko im Flur und schließe die Tür, ohne sie zu verriegeln.
Auf der Veranda ziehe ich die Luft ein und lasse sie entweichen. Durch den Schein der Straßenlaterne erkenne ich die Atemwolke. Dies ist die letzte Straßenlaterne auf der Dodds Road, danach liegt der Weg im Dunklen.
Kanada bringt den Winter schneller als Oregon, wo ich zuvor wohnte, und schon im September ist es abends bitterkalt.
Ich laufe los.
Die kalte Luft peitscht mir ins Gesicht. Nach ein paar Minuten ist meine Haut erhitzt und es tut gut. Ich folge der dunklen Straße, als würde mich ein unsichtbares Seil zu dem alten Haus an deren Ende ziehen. In Headingley ist es generell sehr ruhig und auf der Dodds Road sieht man so gut wie nie Autos.
Am Ende der Straße gelange ich an eine T-Kreuzung, die die Felder einrahmt, und ich werde langsamer. Das Haus erscheint hinter den Tannen. In einem Raum neben der Haustür brennt Licht und ich bleibe auf der Straße stehen. Etwa zehn Meter trennen mich vom Haus. Helle Vorhänge verdecken den Großteil der Sicht auf die Küche. Auf der gegenüberliegenden Seite des Fensters erkenne ich weiße Hängeschränke im Landhausstil.
Die Küche erinnert mich an etwas …
An einen Schatten.
Ich ziehe die Kopfhörer aus meinen Ohren. Mein schneller Atem und der Wind, der gemächlich durch die Tannen weht, umgeben mich.
Ich gehe auf das Grundstück zu und bleibe vor dem verwilderten Rasen stehen.
Etwas zieht mich zu diesem Haus, doch etwas anderes schreit mich an, davonzulaufen.
Das Haus sieht aus, als würde hier seit Jahren niemand mehr leben. Alles, was ich in der Dunkelheit erkenne, wirkt verwahrlost und wenig gepflegt. Der Rasen ist zu lang, Wildblumen wachsen hier und dort und an der Veranda fehlt ein Teil des linken Geländers.
Als ich eine Bewegung am Fenster wahrnehme, schießt mein Puls in die Höhe.
Meine Beine tragen mich näher an das Haus heran. Der Vorhang wird zurückgerissen. Ich unterdrücke einen Schrei, bleibe wie erstarrt stehen und halte die Luft an.
Sein Oberkörper ist nackt und ich erkenne die Konturen der Muskeln. Die dunklen Haare kleben an seinem Gesicht, als wäre er gerade aus der Dusche gekommen.
Er ist wie ein Raubtier.
Definiert, breit und … angsteinflößend.
Ich umfasse die Kopfhörer noch fester.
Mein Atem geht wieder schneller.
Er sieht mich an.
Er sieht mich direkt an.
Unbehagen überkommt mich.
Mein Körper steht unter Hochspannung. Alles in mir ist in Alarmbereitschaft. Einerseits möchte ich, dass er mich sieht, andererseits will ich unsichtbar bleiben.
Ich würde alles dafür geben, diesen Mann auf meiner Couch sitzen zu haben, um ihn zu durchleuchten. Ich will wissen, wieso er hier lebt, wieso er mich in dem Laden angesehen hat. Und auch, wenn mein Kopf sich gegen diesen Gedanken sträubt:
Ich will ihn in meinem Bett.
Er legt seinen Kopf auf die Seite und ein angenehmer Schauer rieselt bei dieser Geste über meinen Rücken.
Auf einmal dreht er sich um. Ich trete einige Schritte zurück, stolpere beinahe über meine Füße, meine freie Hand halte ich an meine Brust. Unbeholfen stecke ich die Kopfhörer in meine Ohren und renne los.
Panik überkommt mich.
Ich habe das Gefühl, dass er mich verfolgt und laufe schneller. Als ich an meinem Haus ankomme, stürze ich mit einem Keuchen in den Flur, falle auf den Rücken und trete gegen die Tür, die mit einem Knall ins Schloss fällt.
Ich kauere auf dem Dielenboden und versuche, Luft zu bekommen. »Ruhig, Liz«, sage ich mir immer wieder, bis ich mich aufraffen kann.
Auf wackeligen Beinen drehe ich mich zur Tür und befürchte, dass sie jede Sekunde auffliegt.
Wie lange ich hier stehe, weiß ich nicht.
Vielleicht eine Minute.
Vielleicht fünf oder zehn.
Aber eins weiß ich sicher: Vor dem, was sich auf der anderen Seite verbirgt, fürchte ich mich seit Jahren.
Kapitel 2
»Guten Morgen, Liz«, grüßt mich meine Sprechstundenhilfe, nachdem ich Dr. Johnsons Praxis betreten habe. Er selbst ist wegen Fachkräftemangels in einer anderen Praxis in Winnipeg selten hier, deshalb habe ich einige seiner Patienten übernommen.
Wie jeden Morgen lasse ich meine Aufmerksamkeit einmal durch den Raum gleiten. Mir gefällt die Praxis, von Anfang an habe ich mich hier sehr wohl gefühlt.
Neben dem Empfang ist eine gemütliche Sitzecke mit zwei Sofas, dazwischen ein Zeitschriftenständer. Wenige Pflanzen verteilen sich hier und über einem Sofa hängt ein abstraktes Gemälde in verschiedenen Blautönen.
»Sam«, grüße ich zurück. Sie steht von ihrem Stuhl auf und hält mir eine dampfende Tasse über den Tresen.
»Früchtetee, wie immer.«
Ich nehme ihr den Tee ab und lächle sie dankbar an. Sie trägt eine rosafarbene Strickjacke und darunter eine etwas zu weit aufgeknöpfte Bluse. In ihrem Haar steckt eine hellblaue Schmetterlingsspange.
Manchmal möchte ich mir eine Scheibe von ihrer Leichtigkeit und Naivität abschneiden.
»Auf einen guten Tag«, sage ich und proste ihr mit der Tasse zu. Sam hat mir wie jeden Morgen die Unterlagen für den anstehenden Tag bereitgelegt, nach denen ich greife. Ich gehe meine heutigen Patienten durch, lediglich drei Einzelstunden und am Nachmittag eine Gruppentherapie mit sechs Patienten. In Kanada stehen die Menschen anders zur Psychotherapie als in den USA, wo es praktisch zum guten Ton gehört. Hier wird man stigmatisiert, wenn man sich Hilfe sucht. Entsprechend bin ich froh, mich mit meinen wenigen Patienten über Wasser halten zu können. »Sollten heute nicht vier Einzelgespräche stattfinden?«
»Ms Leroy hat gestern abgesagt.«
»Wissen Sie, wieso?« Aurélie ist einer meiner schweren Fälle und ich sehe es nicht gern, wenn sie Stunden ausfallen lässt. Vor fünf Jahren wurde bei ihr eine bipolare Störung diagnostiziert und in ihren manischen Phasen ist sie besonders anfällig für selbstverletzende oder suizidale Handlungen. Mithilfe ihrer Medikamente ist sie allerdings halbwegs stabil.
Sam schüttelt den Kopf, wobei ihre braunen Locken hin und her hüpfen. Ihr rundes Gesicht erinnert mich immer an eine Exfreundin. Ich greife die Akten und durchquere den Raum. Ehe ich mein Sprechzimmer betrete, drehe ich mich zu Sam um. »Würden Sie bei Aurélie anrufen?« Sam nickt. »Danke, bis später.«
»Bis später«, trällert sie. Ich schließe die Tür, staple die Akten auf dem Tisch und setze mich. Den Tee stelle ich daneben ab und lege meine Tasche auf den Boden.
Mein tägliches Ritual.
Meine Mom ist davon überzeugt, dass ich pedantisch bin, ich hingegen bin der Meinung, es ist in Ordnung seine kleinen Rituale zu pflegen.
Bevor mein erster Patient kommt, versuche ich Aurélies Eltern telefonisch zu erreichen. Sie sind wichtige Ansprechpartner für mich.
Aurélie hat bereits einen Suizidversuch und mehrere stationäre Aufenthalte hinter sich. Ich muss sicher gehen, dass sich ihre Symptomatik nicht verschlechtert hat. Nachdem ich auch beim dritten Mal niemanden erreiche, beschließe ich, es nach meinem ersten Patienten erneut zu versuchen.
Der Tag verstreicht, meine Patienten kommen und gehen, erzählen mir von ihrem Kummer und ihren Ängsten, während ich mich dafür verfluche, meine Tabletten nicht eingesteckt zu haben. Mein Nacken schmerzt. Oft habe ich zusätzlich Kopfschmerzen und Gelenkprobleme, heute beschränkt es sich zum Glück nur auf eine Baustelle.
Ich weiß, dass es psychosomatisch ist.
Allerdings bin ich gut darin geworden, meine Gedanken auszuknipsen. Dafür habe ich auch meine kleinen Helfer in Pillenform. Lieber ertrage ich körperlichen als seelischen Schmerz.
Nach der Gruppensitzung bleibe ich eine Weile hinter dem Schreibtisch sitzen. Immer wieder fahre ich mit den Fingern über meine Schläfe und versuche meine Gedanken in Schach zu halten.
In den letzten Jahren hat es funktioniert und ich weiß, dass ich sie wieder loswerde. Es ist nur eine Frage der Zeit.
Ich schicke Sam nach Hause und versuche noch einmal, Aurélie zu erreichen. Meine Sorge steigert sich, denn ich fühle mich mitverantwortlich.
Vielleicht weil sie mir ähnlich ist …
Weil ich ihre Verzweiflung und den Wunsch, diese Erde zu verlassen, nachvollziehen kann.
Es raschelt in der Leitung. »Ja?« Als ich ihre Stimme höre, atme ich erleichtert auf.
»Hier ist Ms Moore.«
»Ms Moore?« Sie klingt überrascht.
»Ich wollte nur wissen, wie es Ihnen geht?«
»Mir geht es gut, danke.« Ich warte, weil ich bemerke, dass sie noch etwas sagen möchte. »Wissen Sie«, flüstert sie, »ich habe Besuch und na ja … deswegen habe ich meine Sitzung abgesagt.«
»Besuch?«
»Ähm … ich habe einen neuen Freund und na ja …«
Ich lache auf und reibe mit den Fingern unter der Brille über meine Augenlider. »Ich verstehe, dann sehen wir uns nächste Woche?«
»Ja, versprochen.«
»Viel Spaß, Ms Leroy«, sage ich mit einem weiteren Lachen, das sie erwidert. Beruhigt lege ich den Hörer zurück auf die Station und sehe danach auf das Foto, das hinter dem Aktenstapel auf dem Tisch steht.
Es zeigt meinen Ex Henry und mich. Ich erinnere mich gut an den Tag, wir haben einen Ausflug nach Seattle gemacht und uns vor der Space Needle fotografiert. Man sagt, man suche sich einen Partner, der einem optisch ähnlich wäre, aber Henry und ich könnten verschiedener nicht sein.
Ich reiche ihm nur bis zu den Schultern und habe dazu indische Gene, der Einfluss meiner Mutter. Meine Haut ist dezent olivfarben, die Augen geschwungen und meine Haare pechschwarz. Henry hat ebenfalls dunkle Haare, doch er hat Locken, wo ich glatte Haare habe und einen ruhigen, liebevollen Blick. Im Gegensatz dazu ist mein Ausdruck eher scharf und berechnend.
Trotzdem waren wir beinahe zwei Jahre ein Paar.
Ich schüttle das ab und widme mich den Akten vom Tag. Als ich diese wenig später zusammenlege, mit dem Rücken zur Tür stehend, vernehme ich das Geräusch der Klinke. »Sam, Sie haben Feierabend«, sage ich, doch bekomme keine Antwort.
Die Temperatur um mich herum scheint schlagartig zu steigen, trotzdem bekomme ich eine Gänsehaut.
Ich umschließe die Unterlagen fest mit beiden Händen und hebe den Blick, bis ich gegen eines der Bilder schaue.
»Die Praxis ist geschlossen«, sage ich ruhig, dennoch nachdrücklich.
Die Schritte nähern sich mir. Mein Puls erhöht sich und ich bin bereit, zur Schublade zu hechten, um meine Glock hervorzuziehen. Jemand nähert sich mir, schleichend wie eine Raubkatze. Hinter mir kommt die Person zum Stehen und ich weiß einfach, wer es ist.
Er ist es.
Der Mann aus dem Supermarkt.
Der, den ich gestern verfolgt habe.
»Elizabeth.« Seine Stimme ist tief, voller Zorn und doch butterweich. Ein seltsamer Widerspruch liegt in seinem Tonfall.
Es macht mich rasend vor Neugierde.
Er schnalzt drei Mal, ich rühre mich nicht, denn seine Ausstrahlung lähmt mich. Sie nimmt mich vollkommen ein, als würde sie meine Gliedmaßen packen und gefangen halten. »Es ist unhöflich, einfach vor mir davonzulaufen, ohne sich vorzustellen.«
Räuspernd lege ich die Unterlagen ab, drehe mich um und sehe direkt in seine dunkelbraunen Augen. Er ist mir bedeutend näher, als mir lieb ist und es fällt mir schwer, seinen bedrohlichen Blick zu erwidern.
»Meine Praxis ist geschlossen. Wenn Sie einen Termin vereinbaren möchten, rufen Sie morgen früh an, dann wird meine Mitarbeiterin alles Weitere klären.« Meine Stimme klingt kühl und abweisend, beinahe frostig. Dieser Mann löst etwas in mir aus, das mein Verstand dringend unterbinden will.
Ihn aus dieser Nähe anzusehen, ihn um mich herum zu spüren, verstärkt mein Verlangen ihn zu berühren, zu erfahren wer er ist.
Er neigt den Kopf leicht auf die Seite. »Geschäftlich«, murmelt er und wendet sich von mir ab. Ich bleibe am Tisch stehen und beobachte ihn. Wie ein Löwe stolziert er durch mein Sprechzimmer.
Seine Haltung duldet keinerlei Widerspruch.
Minutenlang scheint er jedes Staubkorn zu scannen, ehe er sich dicht vor mich stellt.
»Möchten Sie einen Termin vereinbaren?«, frage ich ruhig und versuche, irgendetwas in seinem Ausdruck zu erkennen. Seine Mimik aber gleicht einem Safe, seine Maske verrutscht nicht einen Millimeter.
Erneut schnalzt er, dann greift er an mir vorbei nach dem Foto auf meinem Tisch, das Henry und mich zeigt. Mit einem Lächeln nehme ich ihm den Rahmen ab und stelle ihn zurück.
»Kein Partner.« Er tritt noch näher an mich heran.
»Gehen Sie immer so respektlos mit fremdem Eigentum um? Sie haben sich hier ebenso an die Regeln zu halten, wie meine anderen Patienten, also fassen Sie bitte nichts an, das auf meinem Schreibtisch steht.«
»Bin ich das? Ein Patient?«
Weil er meine Individualdistanz nicht respektiert, bekommt meine Rüstung erste Risse.
Ich schaue in seine tiefbraunen Augen, die unter den noch dunkleren Brauen liegen. Neben dem Jäger erkenne ich mehr, es ist beinahe vertraut, es stößt mich ab und zieht mich gleichermaßen an.
»Nicht einmal Bilder deiner Familie stehen auf deinem Schreibtisch. Dieser Raum hier ist ebenso tot wie du, Elizabeth«, flüstert er und beugt sich zu mir. Der Duft seines Rasierwassers schießt in meine Nase, er weckt weit entfernte Erinnerungen in mir.
Erinnerungen, die ich weggesperrt habe.
Erinnerungen an einen Jungen, den ich vor langer Zeit gekannt habe.
Einen Jungen, der nie zu einem Mann wurde.
Es fällt mir schwer, mich auf seine Worte zu konzentrieren. »Ein unpersönliches Zimmer, damit du nicht daran erinnert wirst, was vergangen ist. Die Auszeichnungen an der Wand sollen deinen Patienten Sicherheit vorgaukeln, aber es ist lediglich ein erbärmlicher Versuch, dich selbst zu täuschen.«
Dass er mit seinen Behauptungen richtig liegt, ist ein Zufall, ein dummer Zufall.
»Eli«, sagt er.
»Ihr Nachname?« hake ich nach. Ich spreche meine Patienten mit Nachnamen an, um Distanz zu wahren, und bei ihm ist es mir enorm wichtig, genau das zu tun.
Ich brauche mehr Distanz. Sofort.
»Eli«, sagt er. »Das genügt.«
»Ihr Nachname?«
Eine senkrechte Falte entsteht auf seiner Stirn, er zieht die Brauen zusammen. »Handug. Eli Handug.«
»Mr Handug«, sage ich und trete einen Schritt zurück. »Sie dürfen sich gerne setzen.« Ich deute auf die Couch auf der anderen Seite des Zimmers. Das Licht der späten Nachmittagssonne fällt durch das große Fenster auf die glatte Oberfläche und malt dünne Streifen auf das hellbraune Leder. Wenige Staubkörner tanzen durch das Licht und verleihen dem Raum eine beinahe romantische Atmosphäre.
»Ich stehe lieber«, sagte er, ohne den Blick von mir zu nehmen.
»Möchten Sie einen Termin vereinbaren?«
Er beugt sich an mein Ohr und flüstert: »Möchtest du, dass ich herkomme?«
Dass er mir so nahe kommt, löst ein kaum spürbares Zwicken in meiner Brustgegend aus. Ich ignoriere es, weil Elis Ausstrahlung mich auf etwas hoffen lässt, das ich vor Jahren verlor.
»Möchten Sie, dass ich es will?«
Belustigung blitzt in seinen Augen auf und auf einmal stemmt er die Hände links und rechts neben mich auf das Holz, wodurch ich mich weiter zurücklehne, um ihm auszuweichen.
»Mr Handug«, sage ich ruhig und hebe meine Hand, um ihm zu zeigen, dass er sich zurückziehen soll. Ich möchte ihn nicht berühren, aber es zieht meine Hand zu ihm hin, als wäre er ein Magnet und ich ein Stück Metall.
»Wie tief bist zu bereit, zu fallen, Elizabeth?« Sein Timbre löst eine Vibration unter meiner Haut aus, sein Blick schreit nach Herausforderung.
Und ich bin angefixt.
Ich will in seinen Kopf und mir ist klar:
Er ist sich dessen bewusst.
»Spielen wir ein Spiel.«
»Wie Jicksaw-mäßig«, murmle ich. Seine Miene bleibt auffällig neutral, als wäre dieser Ausdruck in sein Gesicht gemeißelt.
»Wie weit würdest du für deine Freiheit gehen?«, fragt er.
»Eine rhetorische Frage.«
»Eine berechtigte.« Endlich zieht er sich zurück und ich unterdrücke den Drang, aufzuatmen. Eli setzt sich mittig auf die Couch, legt die Arme links und rechts neben sich auf die Lehne und starrt mich an. »Komm schon, lass mich nicht warten.«
Mit einem Räuspern drücke ich mich vom Tisch ab und gehe zur Tür. »Ich hole Ihnen einen Bogen, den können Sie dann ausfü…«
»Das wird nicht nötig sein.«
Ich bleibe stehen. »Mr Handug, ich halte nur verbindliche Sitzungen ab.«
»Ist es das denn?«
Ich fürchte, dass er geht, wenn ich mich querstelle. Somit setze ich mich in den roten Stoffsessel, schlage ein Bein über das andere und lege die Arme auf den Lehnen ab, die Finger auf meinem Schoß ineinander verschränkt. Eli beobachtet mich wie ein Scharfschütze, der nur darauf wartet, sein Ziel im richtigen Winkel zu treffen.
»Also … wieso sind Sie hier?«
»Wieso bist du hier?«
Ich beschließe, nach seinen Regeln zu spielen.
Scheiß auf Professionalität.
»Weil ich nach dem Studium, der anschließenden Arbeit in Oregon und dem Jahr in Indien einen Tapetenwechsel brauchte«, sage ich ehrlich. »Ich wollte nicht zurück in meine Heimat.«
»Sind deine Eltern stolz auf dich?«
Ich blinzle, nicke dann aber. »Ja, das sind sie.«
Lüge.
Eli lehnt sich vor und stützt einen Ellenbogen aufs Knie. Sehnen und Adern zeichnen sich auf seinem Handrücken ab und ich frage mich, wie seine Arme aus der Nähe aussehen. Ist er zärtlich oder grob, wenn er mich berührt?
Mit aller Macht ignoriere ich meinen Heißhunger auf ihn.
»Obwohl es nicht für einen Abschluss in Princeton gereicht hat?« Dieser Satz lässt mich innerlich erstarren. Die verärgerten Kommentare meiner Eltern drängen sich in meinen Kopf, denn ich habe sie enttäuscht.
»Obwohl du nur Auszeichnungen von zweitklassigen Universitäten vorweisen kannst?«
»Meine Abschlüsse sind gut. Ich habe viel erreicht.« Sage ich das, um mich selbst aufzubauen? »Haben Sie studiert?«
»Vielleicht habe ich das.«
»Sind Sie enttäuscht von ihrer Leistung und werten meine Abschlüsse deshalb ab? Weil Sie in ihren Augen weniger erreicht haben?«
»Wertest du dich selbst ab, Elizabeth? Was hat deine Mutter zu dir gesagt, als du dein Studium in Princeton für eine lausige staatliche Uni abgebrochen hast?«
Dein Großvater hat über vierzigtausend Dollar in dein Studium investiert und du brichst nach einem Jahr ab? Wofür? Für diesen Jungen, den du kaum kanntest? Du enttäuschst nicht nur ihn, du enttäuschst uns alle!
Ich schüttle die Worte meiner Mutter ab. Noch immer haben sie zu viel Macht über mich und meinen Verstand, aber vor allem mein Herz.
Eli hat seine Hausaufgaben gemacht. Es ist nicht schwer herauszufinden, welche Unis ich besucht habe. Das rede ich mir zumindest ein.
»Erzählen Sie mir etwas über das eben erwähnte Spiel«, sage ich.
Er lehnt sich zurück, legt die Arme auf die Lehne der Couch. »Es heißt: schlafendes Schäfchen.«
»Erklären Sie es mir.«
Eli steht auf. Ein kaum sichtbares Lächeln zupft an seinen Mundwinkeln. »Wir sind für heute fertig.«
Mit den Worten verlässt er mein Sprechzimmer.
Kapitel 3
Stunden später sitze ich mit meinem halbgeschmolzenen Eis auf der Couch und sehe auf den dunklen Monitor meines Fernsehers. Ich denke an Elis Gesicht, an seine Augen.
Hinter der Kälte seines Blicks versteckte sich eine verträumte Note.
Gedankenverloren schiebe ich mir einen weiteren Löffel vom Cookie & Cream Eis in den Mund und genieße die Kälte, den leichten Oreo-Geschmack und die Keksstücke auf meiner Zunge, ehe ich es herunterschlucke.
Links und rechts von meinem Fernseher stehen meine Regale, das eine gefüllt mit Fachliteratur, Thrillern und anderen Romanen. In dem anderen befindet sich meine Filmsammlung. Ich überlege, ob ich ein Buch von Jo Nesbø lesen oder gleich den Film Schneemann schauen soll, um meinen Kopf zu beschäftigen.
Ein leises Klingeln lässt mich aufschrecken. Ich schaue durch die Tür zur Küche, wo mein geöffneter Laptop auf dem Tisch steht. Eindeutig der Klingelton von Facetime. Den Löffel stecke ich ins Eis, nachdem ich die Packung auf den Tisch gestellt habe und raffe mich auf.
Kaum schaue ich auf den Desktop, verschlechtert sich meine Laune. Nicht, weil ich ihn nicht sehen will, sondern weil es besser für ihn wäre, wenn er mich nicht mehr anrufen würde.
Ich nehme das Gespräch an und setze mich.
»Liz.« Henrys dunkle und raue Stimme klingt ruhig und gesenkt. Noch immer spricht Henry auf diese Weise mit mir und natürlich weiß ich, wieso. Wieso er so verbissen an uns festhält, kann ich nicht erklären. Es ist sechs Jahre her, dass wir eine Beziehung geführt haben.
Sein kurzes dunkles Haar ist leicht zerzaust, wie immer, wenn er Stunden über der Arbeit hing. Durch seine ebenso dunklen Augen schaut er mich intensiv an. Sofort denke ich an Eli. Henrys Blick ist im Gegensatz zu Elis aber offen und einladend.
Er sitzt an seinem Schreibtisch im Arbeitszimmer, der vor einem Bücherregal steht.
»Du hast eine neue Brille«, sage ich. Nach wie vor ist sie schwarzgerahmt mit leicht eckigen Formen. Sie sieht ein wenig nerdig aus und ist meiner sehr ähnlich.
Henry schiebt sie mit dem Zeigefinger zurück auf die Nasenwurzel. »Fast das gleiche Modell.«
»Hm-mh«, mache ich, was ihm ein Lächeln entlockt. Dass mir diese minimale Veränderung aufgefallen ist, scheint ihn zu freuen.
Henry hat auch nach den Jahren noch eine starke Wirkung auf mich. Noch immer trägt er einen Drei-Tage-Bart, unter dem sein kantiger Kiefer gut zur Geltung kommt. Seine Lippen sind nicht zu voll und der Schwung verleiht ihm etwas Lebensfrohes.
Sein gesamtes Auftreten versprüht etwas Freches, trotz seiner dreißig Jahre wirkt er jugendlich. Ich beneide Henry darum, dass er sich seine Jugend bewahrt hat.
Denn das Leben zwang mich, schneller erwachsen zu werden, als mir lieb war. Es zwang mich, Dinge zu verarbeiten, die nicht einmal ein alter gestandener Mensch einfach wegsteckt.
»Wieso rufst du an?«
Henry räuspert sich und legt die gefalteten Hände kurz an die Lippen. »Wie geht es dir?«
»Deshalb rufst du an? Um mich zu fragen, wie es mir geht?« Mein Ton hat sich verhärtet, weil ich Henry bewusst auf Abstand halte. Es gibt einen Grund, wieso wir nicht funktioniert haben.
»Deine Mutter macht sich Sorgen.«
Ich seufze. »Meine Mutter weiß, wo ich wohne. Sie muss dich nicht als Kindermädchen vorschicken.«
Meine Mutter, die es einerseits gut meint, die andererseits Tradition vor persönlichem Glück walten lässt.
Seit ich hier wohne, habe ich nicht mehr mit ihr gesprochen. Ich möchte nicht über meine Mutter nachdenken. Nicht, weil ich sie nicht liebe, sondern weil sie mich an meine Schuld erinnert.
Es juckt mich in den Fingern, Henry von Eli zu erzählen, um seine Meinung zu erfahren. Genau wie ich hat er Psychologie studiert und schon oft führten wie Diskussionen über verschiedene Störungsbilder. Trotzdem hielten wir unsere Patienten aus den tiefgründigeren Gesprächen heraus, weil uns die Schweigepflicht ernst ist. Eli hingegen ist kein Patient.
Doch ich lasse es.
Vielleicht möchte ich Henry nicht verletzen, vielleicht ist es mir aber auch unangenehm, was Eli für eine Wirkung auf mich hat.
»Was ist los?« Henrys Stimme reißt mich aus meinen Gedanken.
»Nichts. Ich bin lediglich müde. Gerade wäre ich fast vor dem Fernseher eingeschlafen.«
»Du hast geblinzelt.«
»Wir haben das besprochen«, sage ich scharf. Damals habe ich geblinzelt, wenn es etwas gab, das ich Henry vorenthielt, obwohl ich es erzählen wollte. In unserer Beziehung ist es oft ein Thema gewesen, wenn wir versucht haben uns zu durchleuchten. Der Ausgang war normalerweise unschön.
»Sorry«, nuschelt er. »Es steht mir nicht mehr zu …«
Gott, ich hasse diese verqueren und hölzernen Konversationen zwischen ihm und mir.
»Wann bist du wieder in den USA?«
»Nicht vor Weihnachten.«
Henry nickt. »Also sehen wir uns erst in drei Monaten.«
Ich will seine nächsten Worte im Keim ersticken, doch er kommt mir zuvor. »Darf ich dich besuchen?«
»Nein.«
Doch.
Ich will ihn sehen und gleichzeitig so weit wie möglich von ihm entfernt bleiben.
Henry beugt sich etwas über den Tisch, um mich durch den Rechner genau anzusehen. Seine Art mich zu scannen hat mir schon immer einen angenehmen Schauer über den Rücken gejagt. »Du läufst weg.«
»Hast du nichts Besseres zu tun, als mich mitten in der Nacht zu belästigen?« Henrys Scharfsinn macht mich fuchsig, ich kann es nicht unterbinden.
»Liz … Du verbringst ein Jahr in Indien, nur um danach zu verschwinden? Nach Kanada? Denkst du nicht, es ist auch für dich an der Zeit, Vergangenes aufzuarbeiten?«
Kurzentschlossen greife ich an den oberen Rand des Rechners, um ihn zuzuschlagen, doch ich halte inne.
Das erste Mal seit vielen Monaten horche ich tief in mich hinein. Wenn ich bedenke, wie einsam ich seit Wochen bin verlässt mich mein Stolz, der mir sonst im Weg steht.
Ergeben sinke ich zurück in den Stuhl. »Wie geht es dir?«
Henrys Miene erhellt sich, denn die Frage hat er lange nicht mehr von mir gehört. Ewigkeiten habe ich Henry ignoriert und bewusst aus meinem Leben und meinen Gedanken ausgeschlossen. Aber ich tat es, um ihn zu schützen. Kann man mir das vorwerfen?
Sollte ich es mir vorwerfen?
»Wenn ich ehrlich bin, geht es mir fantastisch. Ich würde dir gerne von Hailey erzählen«, durchbricht er meine Gedanken und für einen Moment bin ich zu perplex, um zu antworten.
Datet … er ein andere?!
Meine Gedanken beginnen Amok zu laufen.
Findet er sie hübscher als mich?
Ist sie groß, gertenschlank und blond?
Hat sie größere Brüste?
Wie soll ich da mithalten?
Ist sie womöglich … intelligenter?
Langsam entsteht ein Bild einer hübschen und smarten Dozentin mit Brille und wahlweise Kittel vor meinen Augen. Sie lacht über Henrys Witze und im Bett macht sie alles, was er will. Sie stöhnt seinen Namen immer, während er sie hart fickt …
Verflucht, Liz!, schleudere ich mir mental entgegen, um mich dazu zu bringen meine blühende Phantasie einzupacken. Hier muss ich mich zusammenreißen. Es geht mich nichts mehr an. Und wenn Henry drei Frauen datet und gleichzeitig vögelt, habe ich kein Recht, mich einzumischen.
Ich schaffe es, mich zu fangen, obwohl die winzigen Nadelstiche auf meinem Herzen brennen.
Neugierig beuge ich mich vor und lehne meine Unterarme auf den Holztisch. »Hailey?«
Auf seinem Gesicht entsteht ein leichtes Lächeln. Seit unserer Trennung war Henry nicht mehr in festen Händen, ebenso wie ich. Alles, was für mich danach kam, war locker.
»Wir haben uns vor etwa einem Monat kennengelernt«, sagt er. »Sie arbeitet als Dozentin an der medizinischen Fakultät.«
Verdammt.
»Schön«, rutscht es mir viel zu kühl heraus.
Henry drückt den Rücken durch und setzt sich aufrecht hin, was er immer tut, wenn er den Moralapostel heraushängen lässt. Ich wappne mich für seinen Lanzenstoß, denn er wird mich treffen.
»Liza.«
»Liz«, korrigiere ich ihn.
Er atmet hörbar durch und nickt. »Entschuldige, natürlich. Du warst nach dem Aufenthalt in Indien nur wenige Monate zurück und in denen stand bereits fest, dass du wieder gehst. Was erwartest du von mir? Dass ich darauf warte, dass du zurückkommst? Willst du das von mir hören?«
Er rammt die Lanze mitten in mein Herz, doch ich ignoriere das elende Stechen.
Mein Mittelfinger knackt, als ich den Knöchel massiere. »Zwei Wochen, Henry«, sage ich scharf. »Ich bin vor sechs Wochen hergezogen. Also nur zwei Wochen? Zwei Wochen bin ich weg und schon datest du eine andere?«
»Ich möchte nicht mit dir streiten. Du hast mir deinen Standpunkt mehrere Male deutlich gemacht, also hör damit auf, mir Vorwürfe zu machen.«
»Vielleicht möchte ich mit dir streiten?«, gebe ich zurück. »Vielleicht möchte ich endlich mal eine Reaktion von dir haben?«
»Worauf?«, fragt er und hebt die Hände zu den Seiten.
»Auf alles.« Seine wütenden Züge weichen einem irritierten Ausdruck.
Und in dem Moment erinnere ich mich an seinen Blick, wenn er mich vögelte. Daran, wie seine Muskeln sich unter meinen Fingern anfühlten, wenn er über mir war. Aber vor allem daran, wie er mich dabei ansah.
»Ich will, dass du auf das reagierst, was in den wenigen Monaten zwischen uns war, als ich in Oregon war.«
»Liz, du hast mir …«
»Mir ist klar, was ich dir gesagt habe.«
»Es war Sex«, sagt er ruhig und scannt mich regelrecht, als würde er auf eine bestimmte Reaktion warten.
»Das habe ich gesagt, genau.«
»Das bedeutet …?«
»Was könnte es bedeuten, Henry?«
Er antwortet mir nicht, sondern lehnt sich im Stuhl zurück, was mich nervös und wütend macht. Ich weiß nicht, was gerade mit mir los ist, dieses verdammte Gespräch mit Eli geht mir nicht aus dem Kopf.
Er geht mir nicht aus dem Kopf.
»Vergiss es einfach«, sage ich, als Henry mich auch nach einigen Sekunden nur stumm anstarrt. »Du hast recht, es war Sex, mehr nicht. Wie immer.« Ich knalle den Laptop zu. »Scheiße«, rufe ich und stehe so schwungvoll auf, dass der Stuhl über den alten Holzboden rutscht. Innerlich brodelnd gehe ich zum Wohnzimmer und zwinge mich, ruhig zu bleiben, doch als ich in die Eisverpackung schaue, explodiere ich.
Das verfluchte Eis ist geschmolzen.
Ich greife danach und pfeffere es durch den Raum, wobei die Hälfte der Suppe Teppich und Decke besprenkelt, ehe die Verpackung an der Fensterscheibe aufschlägt.
Das Fenster, die Fensterbank und mein Bücherregal sind voller weißer Spritzer.
»Wunderbar!«, rufe ich, verlasse das Wohnzimmer, gehe ins Schlafzimmer und knalle die Tür hinter mir zu.
Am Fußende meines Bettes mache ich Halt. »Es ist offiziell: Ich verliere meinen Verstand!« Mit einem verzweifelten Lachen lasse ich mich rücklings auf die Matratze fallen.
Wegen einer Nichtigkeit raste ich aus, es war irrational und auch unangebracht die Fassung zu verlieren. Es ist passiert, weil mir klar ist, was in dem verstaubten Safe lagert, den ich im Keller meines Kopfes verstaut habe.
Dieser Safe beinhaltet drei meiner schlimmsten Vergehen und wartet wispernd und flüsternd darauf, dass ich ihn öffne.
Aus irgendeinem Grund hat er sich einen Spaltbreit geöffnet.
Willkommen zurück, Dämonen.
Willkommen zurück, Schuld.
Kapitel 4
Am nächsten Morgen meide ich mein Wohnzimmer, koche mir einen Tee und setze mich damit an den Tisch. Ich öffne meinen Laptop und tippe mein Passwort ein. Facetime schlägt mir entgegen. Nach einem kurzen inneren Kampf beschließe ich, den einzigen Menschen anzurufen, den ich gerade ertrage. Die Chance, dass er abhebt ist gering, denn er tourt mit seiner Band durch die USA.
Am Tee nippend warte ich darauf, dass Joshua rangeht. Gerade, als ich die App beenden will, erscheint sein verschlafenes Gesicht vor mir.
Unwillkürlich seufze ich auf. »Hey«, sage ich.
Er reibt mit Zeigefinger und Daumen über seine Augen und liegt im Bett. Nur der Bildschirm seines Telefons spendet Licht. »Guten Morgen«, brummt er mit einem neckenden Unterton.
»Hast du kurz Zeit?«
»Wir haben fünf Uhr morgens, also ja, noch habe ich Zeit. Danke übrigens für das sanfte Wecken.«
»Entschuldige.« Schulterzuckend umschließe ich die Tasse mit beiden Händen. Ich kann nicht damit aufhören, Joshua anzuschauen. Mir ist bewusst, wie unangebracht das ist, aber heute kann ich nicht anders. Heute mache ich eine Ausnahme.
Nachdem ich in den letzten Tagen zu oft an Kellangedacht habe, möchte ich mich erinnern. Wenigstens ein kleines bisschen.
»Halb so wild, jetzt bin ich wach. Was gibt’s, ehemalige Mitbewohnerin?«
»Bist du allein?«
Er reibt sich das Gesicht und nickt. »Mehr oder weniger. Ich liege in meiner Koje im Bandbus, aber die anderen schlafen. Bis nächsten Mittwoch sind wir noch auf Tour, dann geht es für uns zurück in die Heimat.«
Wieso ich das jetzt sage, weiß ich nicht, es ist unangebracht, da er verheiratet ist und ein Kind mit der Frau hat, die er liebt. »Denkst du manchmal noch an … früher?«
Joshua setzt sich auf, knipst eine kleine Lampe an und lehnt sich ans Kopfende. Er greift nach den Kopfhörern, schließt sie an das Telefon an und steckt die kleinen Lautsprecher in seine Ohren. Seine blonden langen Haare sind zerzaust, seine Stirn wirft tiefe Falten und die hellen blauen Augen leuchten.
Ich komme nicht umher, dabei an Kellan zu denken.
Es macht mich traurig, unfassbar traurig und doch will ich Joshua ansehen, um mich zu erinnern. Möglicherweise möchte ich mich quälen.
»Schon gut, das war bescheuert. Ich weiß gar nicht, wieso ich dich überhaupt …«
»Liz, hol erst Mal Luft.« Somit tue ich, was er sagt und atme tief ein. »Wieso sprichst du das an? Ich dachte, es wäre alles geklärt? Es ist außerdem ewig her …«
»Keine Ahnung«, flüstere ich und schaue über meine Küchenzeile, auf der nur ein Wasserkocher steht. Alles hier ist unpersönlich, genau wie die Räume bei mir auf der Arbeit. Wie Eli sagte.
»Ich glaube, ich bin einfach ein wenig …«
Allein.
Verwirrt.
Wütend.
Traurig.
»Einsam?«, sagt Joshua ruhig.
Ich schaue zurück und zucke ein wenig überfordert mit den Schultern.
Ich bin nicht immer so schlecht darin gewesen, über meine Gefühle zu sprechen. Als Kind habe ich stundenlang mit meiner Mutter und auch meinem Vater geredet. Über das, was mich verärgert, aber meistens über Dinge, die mich glücklich gemacht haben. Doch in meiner späten Jugend hat sich etwas grundlegend geändert und so wurde ich zu dem, was ich heute bin.
Eine Frau, die nichts und niemanden in ihre Nähe lässt.
Nicht einmal sich selbst.
»Hin und wieder denke ich an früher. Ich weiß noch, wie wir auf der Couch in der WG saßen und stundenlang über deine dämlichen Marvel-Filme gequatscht haben.«
»Dämlich?«
Er ist ein Meister darin, die richtigen Worte zu finden. Er weiß, dass ich die Geschichten hören will, die uns das Gefühl gaben, schwerelos zu sein. Die, an die ich gerne zurückdenke, ohne mich schuldig zu fühlen.
»Komm schon, die meisten sind dämlich. Und Thor? Bitte.« Er verdreht übertrieben dramatisch die Augen.
»Stört es dich ein wenig, dass deine Frau auf ihn steht?«
»Pffft«, macht er. »Chris Hemsworth stinkt gegen mich vollkommen ab.«
»Tut er nicht!«, vernehme ich eine Stimme im Hintergrund. »Er würde dich mit Mjöllnir zerstören.«
Joshua beugt sich zur Seite und öffnet den Vorhang an seiner Kabine. »Ich zerstöre gleich dein Gesicht, Parker!«
Ich lausche dem seltsamen Wortwechsel der beiden und merke, wie ich mich dabei entspanne. Ich liebe die Art, wie die Jungs miteinander umgehen.
Unbeschwert und ehrlich.
Joshua grinst dümmlich und wendet sich mir wieder zu. »Thor ist die etwas schlechtere Version von mir. Und Mjöllnir würde vor Ehrfurcht erzittern.« Ich bin versucht, irgendetwas nach ihm zu werfen, will sogar nach irgendetwas in Reichweite greifen. Leider würde das nur dazu führen, dass ich meinen Laptop zerstören würde.
»Wir haben ihn mal auf einer Benefiz-Gala getroffen«, sagt er.
»Mjöllnir?«
Joshua legt seinen finster funkelnden Blick auf. Es ist niedlich, wenn er versucht, böse zu schauen. »Und?«
»Er ist ganz okay.«
»Wie bitte? Du beschwerst dich seit Jahren, dass Sofia auf ihn steht und jetzt findest du ihn okay?«
»Wir haben uns ein wenig übers Training ausgetauscht. Sofias Herzchenaugen dabei waren auch gar nicht sooo groß.«
»Sie hat sich blamiert?«
Joshua lacht und nickt grinsend. »Sie hat gestottert, als würde sie ihrem Teenie-Idol gegenüberstehen. Er hat sie nur fragend angesehen und sie ist mit hochrotem Kopf davongerauscht.« Zufrieden rutscht er zurück ins Kissen. »Er hat mich gefragt, was mit ihr los ist, woraufhin ich es noch schlimmer gemacht habe.« Seiner Miene nach zu urteilen tat er das beabsichtigt. »Ich habe ihm gesagt, sie findet ihn heiß.«
»Du bist verkorkst.«
»Auf jeden Fall kann ich mir jetzt sicher sein, dass sie nie wieder mit ihm spricht, sollten wir uns wiedersehen.«
»Deine exzellente Falle hat zugeschnappt.« Er nickt und überhört meinen sarkastischen Tonfall vermutlich bewusst. »Damals habe ich deine Frau belogen, als sie mich nach uns gefragt hat.«
Sofia hat mich vor Jahren nach Joshua und mir gefragt, aber ich habe behauptet, es wäre nichts zwischen ihm und mir gelaufen. Meine Verbindung zu ihr war zu der Zeit schwach und ich wollte sie nicht noch mehr stressen, da sie mit ihren eigenen Sorgen zu kämpfen hatte.
»Vielleicht sollten wir ihr reinen Wein einschenken?« Das würde mein Gewissen immerhin in einem Punkt erleichtern.
»Glaubst du, das ist eine gute Idee? Sie wird erst mich und dann dich vierteilen.«
»Ihr seid verheiratet und habt eine Tochter.«
»Danke für das Update«, sagt er und dieses typische dümmliche Grinsen erscheint auf seinen Lippen.
»Überleg es dir bitte«, sage ich und Joshua legt seine Stirn in Falten. »Mir täte es gut.« Das kommt als Flüstern über meine Lippen.
»Was ist los? Es ist doch nicht nur die Tatsache, dass du da oben alleine bist. Wieso hast du mich wirklich angerufen?«
Ich gebe auf und rede, obwohl ich mich wie eine Schwerverbrecherin fühle, die ihr Geständnis ablegt. »Gestern kam jemand in meine Praxis. Er ist … anders.« Weil ich nichts mehr sage, schleicht sich erneut das dumme Grinsen auf seine Lippen. »Nein, bitte sag nicht, was du sagen wi…«
»Du bist scharf auf den Kerl. Du kleiner Schlingel, du darfst doch nicht an deinen Patienten fummeln.«
Ich lache. »Ich fummle nicht an ihm herum.«
»Aber in deinem Kopf fummelst du bereits, richtig?«
Kurz schweigen wir, weil ich dem nichts entgegensetzen kann. »Entschuldige, ich hätte dich gar nicht anrufen sollen.«
»Red‘ keinen Unsinn«, sagt er brummig und hält das Gerät näher an sein Gesicht.
»Tu das bitte nicht.« Er hält es noch näher, sodass ich lediglich ein Auge von ihm verschwommen wahrnehme. Schon wieder bringt er mich zum Lachen. »Schlaf weiter, du Clown.«
»Du weißt, wenn du was auf der Seele hast …«
»Danke, aber ich rede nicht über meine Seele.«
Er deutet mit einem Finger auf mich. »Du bist gar kein Mensch, du bist eine Maschine, ohne Herz, ohne Seele.