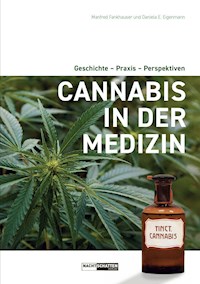
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Nachtschatten Verlag
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Cannabis als Medizin ist heute weltweit ein grosses Thema im Gesundheitswesen. Immer mehr Menschen profitieren von Arzneimitteln auf Hanfbasis oder von Cannabinoiden wie THC und CBD, die als pharmazeutische Präparate inzwischen bei zahlreichen chronischen Krankheiten mit Erfolg zum Einsatz kommen. Die Schweizer Pharmazeuten Manfred Fankhauser und Daniela E. Eigenmann liefern in diesem praxisorientierten Buch Fakten zur Hanfmedizin - für Ärzte und Apotheker, für betroffene Patienten, Angehörige und alle, die sich für medizinisches Cannabis interessieren. Nach einer Einführung zur Geschichte der Cannabismedizin und einem Überblick zum Einsatz von medizinischem Cannabis erklären die Autoren die Unterschiede zwischen den aktuell verfügbaren cannabinoidhaltigen Präparaten und legen dabei den Fokus auf deren praktische Anwendung. Auch die rechtlichen Rahmenbedingungen für Cannabismedikamente in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden erläutert. Ein Kapitel widmet sich speziell der Verschreibungspraxis in der Schweiz. Fallberichte von Patienten geben Einblick in die konkreten Einsatzgebiete und Expertengespräche erhellen den aktuellen Stand der Forschung. Mit einem Vorwort von Dr. med. Franjo Grotenhermen
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 248
Veröffentlichungsjahr: 2020
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Ähnliche
Manfred Fankhauser und Daniela E. Eigenmann
CANNABIS IN DER MEDIZIN
Geschichte – Praxis – Perspektiven
E-Book-Ausgabe
Die Verbreitung dieses Produkts durch Funk, Fernsehen oder Internet, per fotomechanischer Wiedergabe, auf Tonträgern jeder Art, als elektronisches beziehungsweise digitales Medium sowie ein über das Zitier-Recht hinausgehender auszugsweiser Nachdruck sind untersagt. Jegliche öffentliche Nutzung bzw. Wiedergabe setzt die ausdrückliche, schriftliche Genehmigung der Nachtschatten Verlag AG voraus.
Diese Publikation enthält versteckte und personalisierte Informationen bezüglich Herstellung, Vertrieb, Verkauf und Käufer. Im Falle von unerlaubter Verbreitung des Inhalts behält sich der Rechteinhaber vor, Missbräuche juristisch zu belangen.
Herstellung:
Bookwire GmbH
Kaiserstraße 56
60329 Frankfurt am Main
Deutschland
Verlag:
Nachtschatten Verlag AG
Kronengasse 11
4500 Solothurn
Schweiz
Impressum
Manfred Fankhauser, Daniela E. Eigenmann
Cannabis in der Medizin
Geschichte – Praxis – Perspektiven
Nachtschatten Verlag AG
Kronengasse 11
CH-4500 Solothurn
www.nachtschatten.ch
Der Nachtschatten Verlag wird vom Bundesamt für Kultur mit einem Strukturbeitrag für die Jahre 2016–2020 unterstützt.
© 2020 Nachtschatten Verlag
© 2020 Manfred Fankhauser, Daniela E. Eigenmann
Projektbetreuung und Fachlektorat: Markus Berger
Layout und Lektorat: Nina Seiler
Korrektorat: Jutta Berger
Umschlaggestaltung: Cécile Portmann
Druck: Druckerei & Verlag Steinmeier, Deiningen
Printed in Germany
ISBN: 978-3-03788-587-1
eISBN: 978-3-03788-604-5
Alle Rechte der Verbreitung durch Funk, Fernsehen, fotomechanische Wiedergabe, Tonträger jeder Art, elektronische digitale Medien und auszugsweiser Nachdruck nur unter Genehmigung des Verlages erlaubt.
Aus Gründen der besseren Lesbarkeit wird im Text verallgemeinernd das generische Maskulinum verwendet. Diese Formulierungen umfassen gleichermaßen weibliche und männliche Personen; alle sind damit selbstverständlich gleichberechtigt angesprochen.
INHALT
Vorwort von Franjo Grotenhermen
Einführung
1. MEDIZINGESCHICHTE
Anfänge
Cannabis in der Antike
Byzanz und Orient
Die Legende von den Assassinen
Hanf im mittelalterlichen Europa
Hanf in den Kräuter- und Arzneibüchern des Mittelalters
Hanf – ein Berauschungsmittel?
Cannabis im europäischen Arzneischatz des 18. Jahrhunderts
Cannabis in der Schulmedizin des 19. Jahrhunderts
Indischer Hanf kommt nach Europa
Eine folgenreiche Studie
Ein besonderer Klub
Cannabis indica etabliert sich
Der Aufschwung hält an
1880 bis 1900: Der Höhepunkt
Cannabis als Arzneimittel im 20. Jahrhundert
1900 bis 1960
Eine Ära geht zu Ende
Die Renaissance
Literatur
2. BOTANIK
Einführung in die Botanik von Hanf
Botanische/taxonomische Klassifizierung
Chemische Klassifizierung
«Veraltete» taxonomische Klassifizierung
Hanfhenne und Hanfhahn
Literatur
3. CHEMIE
Kurze historische Einführung in die Chemie von Hanf
Inhaltsstoffe der Hanfpflanze
Cannabinoide (Phytocannabinoide)
Tetrahydrocannabinol (THC)
Cannabidiol (CBD)
Weitere wichtige Cannabinoide
Terpene
Literatur
4. DAS ENDOCANNABINOID-SYSTEM
Cannabinoid-Rezeptoren
Endocannabinoide
Funktionen des Endocannabinoid-Systems
Wirkmechanismus von THC und CBD
Literatur
5. CANNABIS IN DER MEDIZIN HEUTE
Indikationen für Cannabis
Einnahmeformen von Cannabis
Dosierungen
Kontraindikationen
Nebenwirkungen und Toxizität
Interaktionen (Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten)
Vielstoffgemische und Monosubstanzen
THC und CBD: natürliche Isolierung und künstliche Synthese
Literatur
6 CANNABIS-PRÄPARATE
Fertigarzneimittel
Rezepturarzneimittel (Magistralrezepturen)
Illegale Präparate
Cannabis in den Pharmakopöen (Arzneibüchern)
Literatur
7. DIE RECHTLICHE SITUATION
Gesetzeslage in der Schweiz
Gesetzeslage in Deutschland
Gesetzeslage in Österreich
Straßenverkehr und Auslandsreisen
8. DIE PRAXIS
Einblicke in die Praxis in der Schweiz
Generelle Entwicklung
Zahlen und Statistiken aus der Bahnhof Apotheke Langnau
Interpretation der Resultate
Erläuterungen und Beobachtungen zu den Indikationen
Altersstruktur der Cannabis-Patienten
Cannabispräparate bei Kindern und Jugendlichen
Cannabispräparate bei älteren Menschen
Finanzierung
Patientenberichte
Zusammenfassung und Perspektiven
Literatur
9. EXPERTENGESPRÄCHE
Raphael Mechoulam
Rudolf Brenneisen
Claude Vaney
Kirsten Müller-Vahl
Kurt Blaas
Eva Milz
Ethan B. Russo
Jürg Gertsch
Nachwort
Danksagung
Die Autoren
Nützliche Adressen
Bildquellen
VORWORT
Was ist dran am Ruf des häufig als Allheilmittel dargestellten Hanfes, der bei so vielen Erkrankungen helfen soll? Was ist mythische Zuschreibung, was Realität? Wie sieht die wissenschaftliche Datenlage aus? Welche Erfahrungen lassen sich aus der täglichen Arbeit mit Patienten gewinnen? Wie kann unter den rechtlichen Bedingungen in den deutschsprachigen Ländern eine Therapie mit Cannabis-Medikamenten praktisch durchgeführt werden?
Die Antworten der beiden Autoren erfolgen aus der Sicht historisch interessierter, engagierter Apotheker und Praktiker mit einer langjährigen Erfahrung. Die Arbeiten von Manfred Fankhauser schätze ich seit nahezu 25 Jahren, als er mir durch seine außerordentlich gelungene Doktorarbeit über die Geschichte von Haschisch als Medikament aufgefallen war. Mir gefiel schon damals die akribische Genauigkeit, mit der er das Thema durchdrungen hatte. Zu dieser Zeit gab es im deutschen Sprachraum kaum Ärzte und Apotheker, die sich überhaupt für das Thema interessierten, geschweige denn solche, die eine mehr als nur oberflächliche Kenntnis davon hatten. Fankhauser war einer dieser wenigen, die sich bereits zu dieser Zeit eine Expertise auf diesem Gebiet erarbeitet hatten. So war es auch kein Zufall, dass seine Apotheke im Jahr 2008 als erste in der Schweiz eine Bewilligung erhalten hatte, cannabishaltige Rezepturen herzustellen. Ich freue mich, dass er mit Daniela E. Eigenmann eine engagierte Kollegin an seiner Seite hat.
Unter den Fallberichten ragt vor allem einer heraus. Wir wissen, dass THC sehr gut vom Magen-Darm-Trakt aufgenommen wird. Danach gelangt es aber über die Pfortader in die Leber, wo es bereits bei der ersten Passage zu 90 Prozent oder mehr abgebaut wird, so dass nur ein sehr kleiner Teil zur Wirkung gelangt. Die Autoren stellen einen Patienten mit einer fortgeschrittenen Leberzirrhose vor, bei dem operativ eine Umgehung des Leberkreislaufes vorgenommen worden war. Durch diese Umleitung wird der größte Teil des Blutes aus dem Magen nicht durch die Leber geführt, sondern gelangt direkt in den Gesamtkreislauf. Das führte bei diesem Patienten dazu, dass auch mehr THC unmittelbar in den Gesamtkreislauf gelangte. Leider war das bei der Eindosierung nicht berücksichtigt worden, so dass nicht 10 Prozent, sondern 100 Prozent zur Wirkung gelangten. «Dies erklärt, warum bei diesem Patienten die tiefe THC-Dosis wie ein langandauernder Vollrausch wirkte. Glücklicherweise ist THC bekanntlich auch in hohen Dosen nicht lebensbedrohend, und so kam die betroffene Person schließlich ‹mit einem Schrecken› davon», heißt es über diesen Fall einer kuriosen Überdosierung.
Das Buch diskutiert auch kontroverse Themen, wie beispielsweise die Verwendung von THC bei Kindern. Einige im Buch vorgestellte Fallberichte demonstrieren eindrücklich, welch großen medizinischen Nutzen Cannabinoide auch bei Kindern haben können. Dies zeigen auch Erfahrungen deutscher Kinderärzte (GOTTSCHLING 2019). Die Autoren lassen zudem eine Schweizer Fachärztin für Kinder- und Jugendmedizin, Mercedes Ogal, zu Wort kommen. Sie beantwortet die Legitimation des Einsatzes auch bei Kindern wie folgt: «Ich selber würde THC nicht bei unter 4-jährigen Kindern einsetzen. Wenn sich bei einem über 4-jährigen Kind mit frühkindlichem Autismus aber trotz intensiver begleitender Maßnahmen nur ungenügende Fortschritte einstellen, würde ich einen Therapieversuch mit THC durchaus in Betracht ziehen.»
Nicht immer teile ich die Sicht der interviewten Experten, etwa wenn Professor Jürg Gertsch von der Universität Bern im Zusammenhang mit CBD darauf hinweist, dass «die Substanz bei hohen Dosen chronisch die Leber belasten könnte« und er es daher «durchaus sehr bedenklich» findet, CBD als Nahrungsergänzungsmittel «unter die Leute zu bringen». Die leberschädigende Wirkung war in Studien mit Mäusen an der Universität von Arkansas in den USA aufgefallen. Die Tiere hatten allerdings extrem hohe orale CBD-Dosen von 2560 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht erhalten (EWING et al. 2019). Kürzlich hat das australische Gesundheitsministerium auf der Basis einer wissenschaftlichen Analyse festgestellt, dass CBD beim Menschen in niedrigen Dosen von unter 60 Milligramm, also etwa einem Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht, «ein gutes Sicherheits- und Verträglichkeitsprofil aufweist» (THERAPEUTIC GOODS ADMINISTRATION 2020). Von solchen Dosen sprechen wir, wenn es um Nahrungsergänzungsmittel geht.
Auch für Cannabinoide gilt der an anderer Stelle des Buches zitierte Grundsatz des Paracelsus «Alle Dinge sind Gift, und nichts ist ohne Gift. Nur die Dosis macht, dass etwas kein Gift ist».
Mehr noch als bei THC besteht bei CBD gegenwärtig etwas, das ich an anderer Stelle als «das große Missverständnis» bezeichnet habe (GROTENHERMEN 2020). Wenn Cannabispatienten Aussagen von Wissenschaftlern über das therapeutische Potenzial von Cannabis lesen, schütteln sie häufig verständnislos den Kopf. Wenn Wissenschaftler, die sich mit Cannabis befassen, Aussagen von Patienten lesen, schütteln sie ebenfalls häufig verständnislos den Kopf.
Gegenwärtig scheint CBD eine ähnliche Geschichte zu durchleben wie die bei der Wiederentdeckung des medizinischen Nutzens von THC beziehungsweise THC-reichen Cannabisprodukten. Es waren Patienten, die in den siebziger und achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts einzelne Ärzte und Wissenschaftler auf ihre therapeutischen Erfahrungen hinwiesen und motivierten, erste klinische Studien mit THC durchzuführen. Und heute sind die Patienten bei der Entdeckung des therapeutischen Potenzials von CBD wieder schneller als die Wissenschaftler. Das Missverständnis wird erst verschwinden, wenn die Forschung nachgeholt hat, was viele Patienten heute bereits erleben, und wenn Patienten akzeptieren, dass umfangreiche Forschung unser Verständnis und damit die Berechtigung der Therapie mit Cannabis-Produkten in der modernen Medizin vergrößert.
Unter diesem Aspekt betrachtet, liefert das Buch auch einen wohltuenden Beitrag zur Versöhnung von Patientenerfahrung und wissenschaftlicher Erkenntnis, wie es heute von einem guten Buch zum Thema erwartet werden darf. Ich kann es nur empfehlen und wünsche ihm eine große Verbreitung.
Steinheim, im Mai 2020
Dr. med. Franjo Grotenhermen
Literatur
Ewing LE, Skinner CM, Quick CM, Kennon-McGill S, McGill MR, Walker LA, ElSohly MA, Gurley BJ, Koturbash I. Hepatotoxicity of a Cannabidiol-Rich Cannabis Extract in the Mouse Model. Molecules. 2019;24(9).
Gottschling S. Cannabinoide bei Kindern. In: Müller-Vahl K, Grotenhermen F. (Hrsg.) Cannabis und Cannabinoide in der Medizin. Berlin: Medizinisch Wissenschaftliche Verlagsgesellschaft, 2019.
Grotenhermen F. Die Heilkraft von CBD und Cannabis: Wie wir mit Hanfprodukten unsere Gesundheit verbessern können. Hamburg: Rowohlt Verlag, im Druck.
Therapeutic Goods Administration. Safety of low dose cannabidiol. Woden, ACT, Australia: Australian Government. Department of Health, 2020.
EINFÜHRUNG
«Und sie tat in den Wein, von dem sie tranken, ein Mittel, Sorgen und Zorn zu stillen und alles Leid zu vergessen. Wer das Mittel genoss mitsamt dem Weine des Mischkrugs, dem rann keine Träne den Tag die Wange herunter, lägen ihm auch tot darnieder Vater und Mutter, selbst, wenn man vor ihm den lieben Sohn oder Bruder mit dem Schwert erschlüge vor seinen Augen» (HOMER 1938: 55).
Ob dieses in der Antike als Nepenthes bezeichnete Wundermittel tatsächlich etwas mit Hanf zu tun hatte, bleibt bis heute ein Geheimnis. Bereits in frühster Zeit wurde über die Zusammensetzung dieses Arzneimittels diskutiert; vielleicht war es bloß eine dichterische Erfindung. Gäbe es ein solches Pharmakon tatsächlich, dann käme dies einem Allheilmittel gleich, einer Panazee. Gerade in Zusammenhang mit Cannabis wird der Begriff Wundermittel oftmals verwendet – doch was davon ist Realität, was Fiktion? Das vorliegende Buch gibt einen Ein- und Überblick zu Hanf in der Medizin. Dabei liegt der Fokus auf der langjährigen praktischen Erfahrung mit diversen Cannabispräparaten unter besonderer Berücksichtigung der Schweiz.
Nach einer kurzen Einführung in die Kulturgeschichte des Hanfs wenden wir uns der Medizin zu. Einblicke in die Medizingeschichte beschreiben den Stellenwert des Arzneimittels Cannabis in der westlichen, abendländischen Tradition, im Wissen, dass in anderen Kulturen der Hanf bereits früher auch als Medikament eingesetzt wurde. Der Aufschwung des Indischen Hanfs in Europa ab Mitte des 19. Jahrhunderts und sein vorübergehendes Verschwinden in der Bedeutungslosigkeit Mitte des 20. Jahrhunderts werden ebenso dargestellt wie die Gründe für die Wiederentdeckung dieser einst hochgeschätzten Medizinalpflanze.
Die Kapitel zu Botanik und Chemie bilden den zurzeit gültigen Kenntnisstand zu diesen Themen ab. Die botanische korrekte Einordnung von Cannabis ist seit Jahrhunderten ein Thema und noch heute nicht abgeschlossen. Auch die Erforschung der chemischen Zusammensetzung der Hanfpflanze ist ein kontinuierlicher Prozess; noch immer werden neue Inhaltsstoffe entdeckt. Dabei spielen die hanfspezifischen Cannabinoide die wichtigste Rolle. Aber auch von anderen Inhaltsstoffen wie den Terpenen verspricht man sich therapeutisches Potenzial. Die beiden wichtigsten Cannabinoide, Tetrahydrocannabinol (THC) und Cannabidiol (CBD), werden kurz porträtiert.
Der Schwerpunkt in diesem Buch ist den medizinischen Anwendungen von Cannabis gewidmet. Als Einstieg werden das hochkomplexe Endocannabinoid-System (ECS) und die dazugehörenden Cannabinoid-(CB)-Rezeptoren vorgestellt. Darauf folgt ein Überblick über die Bedeutung von Cannabis in der heutigen Medizin. Die wichtigsten Anwendungsgebiete von Cannabis werden besprochen. Für Patienten und Fachpersonen wichtige Fragen zu Dosierungen, möglichen Nebenwirkungen, Wechselwirkungen, Abhängigkeitspotenzial usw. werden beschrieben.
Der Praxisteil des Buches basiert auf dem langjährigen Erfahrungsschatz der Autoren mit dem Einsatz von Cannabinoiden bei Patienten. Nebst den aktuell verfügbaren Cannabismedikamenten werden insbesondere cannabinoidhaltige Individualrezepturen aus der Schweiz, aus Deutschland und Österreich eingehend besprochen. Statistiken und grafische Darstellungen zur Verschreibungspraxis in der Schweiz geben einen Einblick, wie für mehrere tausend Patienten eine entsprechende Cannabisrezeptur verordnet wurde. Zur Veranschaulichung werden Fälle aus der Praxis von Patienten vorgestellt. Auch Cannabis verschreibende Ärzte kommen zu Wort und nehmen zu einzelnen Fallberichten Stellung.
Anders als die meisten anderen Medikamente hat Cannabis bis heute eine bewegte Rechtsgeschichte. In Kapitel 7 wird auf die aktuelle gültige Rechtslage eingegangen. Sowohl in der Schweiz als auch in Deutschland und Österreich unterstehen Hanfpräparate (mit wenigen Ausnahmen) dem Betäubungsmittelgesetz. Trotz international gültiger Grundlagen zeigen sich beträchtliche nationale Unterschiede. Schließlich werden die divergenten Ansätze zur Erstattungsfähigkeit von Cannabispräparaten erörtert.
Im Schlusskapitel kommen international bekannte und ausgewiesene Cannabisexperten sowie erfahrene Pioniere des Medizinalcannabis zu Wort und schildern die Fragen und Herausforderungen in der Cannabisforschung und der praktischen Arbeit mit Cannabinoiden.
Das Interesse für Cannabis und dessen Etablierung in der Medizin ist nichts anderes als die schon längst überfällige Wiederentdeckung eines altbekannten Arzneimittels, das sich erneut bewährt.
«Von vorherein war das Interesse, welches die ärztliche Welt dem Mittel [gemeint ist ein Cannabismedikament] entgegentrug, ein bedeutendes und die über dasselbe vorliegende Literatur ist ziemlich umfangreich.»
(E. MERCK, 1883)
Abb. 1: Die erste bekannte Abbildung von Cannabis.Aus dem Codex vindobonensis (512 n.Chr.) des Dioskurides.
1. MEDIZINGESCHICHTE
Anfänge
Die Geschichte von Hanf ist noch nicht geschrieben. Ein Konglomerat aus Beweisen, Vermutungen und Interpretationen liefert ein Bild, das zurzeit für richtig gehalten wird, ein fragmentarisches Mosaik, bei dem Teile fehlen oder neue dazukommen. Der Nebel lichtet sich, doch verschwinden wird er nicht.
Es wird vermutet, dass Hanf eine der ältesten Kulturpflanzen überhaupt ist (RUSSO 2007: 1614-1648). Als relativ sicher gilt, dass die Heimat des Hanfes in Zentralasien zu suchen ist (SCHULTES, HOFMANN 1987: 93, 95). Die ältesten archäologischen Funde (Hanffasern, Schnüre) stammen aus China und zeugen davon, dass Hanffasern wohl bereits vor mehr als 8500 Jahren verwendet wurden: der Anbau von Hanf in China ist seit dem Neolithikum nahtlos belegt (RUSSO 2007: 1614-1648). In Europa wurden im deutschen Thüringen Hanfsamen gefunden, deren Alter man auf 7500 Jahre schätzt (RÄTSCH 1992: 27).
Cannabis in der Antike
Die Bedeutung von Cannabis bei den Griechen und den Römern ist unsicher. Der Gebrauch der Hanffaser wurde mehrfach belegt (HEHN 1887: 158: STEFANIS, BALLAS, MADIANOU 1975: 305). Gesicherte Hinweise, dass die Pflanze als Rauschmittel Verwendung fand, fehlen vollständig. Erste zögerliche Hinweise auf Hanf als Heilmittel stammen noch aus der Zeit vor Christi Geburt, fehlen aber beispielsweise im Corpus hippocraticum, also in der Schriftensammlung, die dem größten aller Ärzte, Hippokrates (460–370 v. Chr.), und seinen Schülern zugeschrieben wird (STEFANIS, BALLAS, MADIANOU 1975: 305).
In der vom griechischen Arzt Dioskurides (um 50 n. Chr.) verfassten Arzneimittellehre De materia medica libri quinque wird Hanf zum ersten Mal in einer abendländischen medizinischen Schrift erwähnt. Er schreibt:
«Gebauter Hanf. Der Hanf – einige nennen ihn Kannabion, andere Schoinostrophon, Asterion – ist eine Pflanze, welche im Leben sehr viel Verwendung findet zum Flechten der kräftigsten Stricke. Er hat denen der Esche ähnliche übelriechende Blätter, lange einfache Stengel und eine runde Frucht, welche, reichlich genossen, die Zeugung vernichtet. Grün zu Saft verarbeitet und eingeträufelt, ist sie ein gutes Mittel gegen Ohrenleiden» (DIOSKURIDES 1902: 359, DIOSKURIDES 1539: 210).
Neben Hippokrates gilt wohl Galen als der bedeutendste Arzt der Antike. Im 2. Jahrhundert nach Christus beschreibt er verschiedene medizinische Anwendungen von Cannabissamen. Interessant ist, dass Galen bereits die psychotrope Wirkung von Cannabis erwähnt. Er schreibt, dass Gästen zum Nachtisch kleine (Haschisch-)Kuchen angeboten wurden, welche die Lust am Trinken erhöhten, aber im Übermaß genossen auch betäubend wirken würden (LEWIN 1980: 150). Einige andere antike Autoren beschreiben verschiedene medizinische Wirkungen von Cannabis, allerdings werden oft die bekannten Indikationen übernommen. Obschon vereinzelt Hinweise auf die psychotrope Wirkung von Hanf zu finden sind, ist dessen Bedeutung als Rauschmittel marginal, im Gegensatz zu Opium.
Zusammengefasst: In der Antike wird Hanf als Faserlieferant sehr geschätzt. Die Samen werden, wenn auch eher selten, als Heilmittel verwendet. Das Cannabiskraut hingegen wird in der Medizin kaum verwendet, als Halluzinogen finden sich spärliche Hinweise.
Byzanz und Orient
Mit der Aufteilung des Römischen Weltreichs in West- und Ostrom im 4. Jahrhundert nach Christus und der Schließung der von Platon gegründeten Philosophenschule in Athen wurde das Ende der Antike definitiv eingeläutet.
Im oströmischen Reich konnte sich Byzanz (das spätere Konstantinopel und heutige Istanbul) als Zentrum behaupten: im Jahr 1453 wurde Konstantinopel von den Türken erobert und in Istanbul umbenannt. Damit ging die mehr als tausend Jahre währende Epoche des Byzantinischen Reichs zu Ende.
Der wohl bedeutendste byzantinische Arzt war Oribasius. Auch er erwähnt Hanf und empfiehlt die Samen gegen Blähungen, weist jedoch auch auf eine kopfschädigende Wirkung (Kopfschmerzen?) hin (ABEL 1980: 34). Grundsätzlich brachten Vertreter der byzantinischen Medizin wenig Neues: in Bezug auf Cannabis wurde vor allem auf das Wissen von Dioskurides und Galen zurückgegriffen.
In der arabischen Welt war die Bedeutung von Cannabis dagegen sehr groß. Anders als in der abendländischen Kultur wurde im Orient das Haschisch dem Opium vorgezogen («Haschisch» – ursprünglich war damit «dürres Kraut» gemeint – löste um 1000 n.Chr. Qanab, die arabische Bezeichnung für Cannabis, ab [STRINGARIS 1972: 1]; heute ist mit Haschisch das Drüsenharz der weiblichen Hanfpflanze gemeint). Auch als Rauschpflanze konnte sich Cannabis in der persisch-islamischen Kultur etablieren. In zahlreichen «Tausendundeine Nacht»-Märchen des 12. Jahrhunderts kommt Haschisch vor: beispielsweise wird in der kurzen Erzählung aus der 143. Nacht ein Haschischrausch beschrieben (REININGER 1955: 2370). Überhaupt ist in der morgenländischen Literatur Hanf allgegenwärtig. Stellvertretend sei auf eine Stelle aus einem orientalischen Volksroman verwiesen, zitiert nach Gelpke (GELPKE 1975: 62-64):
«Vom Haschisch wird der Peniskopf gleich dem Amboss: wie er auch sei – er wird zweimal so groß. Jeder Feueranbeter und Jude und Armenier wird sogleich aus Wohlbehagen ein Moslem, nachdem er Haschisch genoss.
Das Haschisch ist es, das dem Verstand Erleuchtung bringt: (doch) zum Esel wird, wer ihn wie Futter verschlingt. Das Elixier ist Genügsamkeit: Iß von ihm nur ein Korn, damit es goldgleich ganz das Sein deines Daseins durchdringt.
Durch das Essen vom Haschisch wird der Verstand nicht vermehrt, und nicht anders wird vom Nichtessen die Welt (und ihr Wert). Gegen Traurigkeit (hilft es), davon ein wenig zu essen: doch esse keiner sich voll, damit ihn nicht Frechheit versehrt.
Ein jeder, der dem Haschisch als Sklave verfällt, ist bald lebendig, bald ein Toter, vom Schlafe gefällt. (Während) das Essen von wenigem die Traurigkeit abwehrt, ist, wer zu viel isst, in Blödheit zerschellt.»
Auch in der arabischen Medizin konnte sich Hanf behaupten. Anders als bei den Griechen und Römern wurde nun die ganze Pflanze als Arznei eingesetzt. Bereits damals scheint der Hanf aus dem Morgenland wirksamer und potenter gewesen zu sein als der in Europa bekannte. Aus heutiger Sicht ist klar, dass er mehr wirksamkeitsbestimmendes Tetrahydrocannabinol (THC, vgl. Kapitel 2 und 3) enthielt als der in der westlichen Medizin eingesetzte. Auch der berühmteste aller arabischen Ärzte, Ibn Sina, genannt Avicenna, erwähnt in seinem im Jahr 1025 erstmals erschienenen Standardwerk Canon medicinae den Hanf (TSCHIRCH 1910: 602).
Anders als in der westlichen Welt existierten schon damals zeitgenössische Berichte arabischer Ärzte, die den Missbrauch von Cannabis beklagen (MOELLER 1951: 360). In Kairo beispielsweise wurde im Garten von Cafour ein Haschischpräparat namens Okda verkauft. Die Bewohner von Kairo seien durch diesen «Schauplatz aller nur erdenklichen Ausschweifungen und Scheußlichkeiten» angezogen worden (HENKEL 1864: 538), im Jahr 1253 ließ der Gouverneur von Kairo diesen Garten zerstören und alle Hanfpflanzen ausreißen (Abel 1980: 42). Trotzdem verbreitete sich der Gebrauch des Krauts offenbar weiter, bis schließlich der Sultan von Ägypten zu Beginn des 14. Jahrhunderts den Verkauf von Haschisch ganz verbieten ließ (FLÜCKIGER, HANBURY 1879: 547).
Die Legende von den Assassinen
Heftig umstritten ist die Bedeutung von Haschisch in Zusammenhang mit den Assassinen. Der Orden der Assassinen wurde in der zweiten Hälfte des 11. Jahrhunderts vom persischen Ismailiten Has(s)an (ibn) Sab(b)ah gegründet. Der Legende zufolge ließ Hasan die Mitglieder des Ordens einen Trank trinken, der sie berauschte und zu den schrecklichsten Taten trieb. Dieses Getränk – der Abt Arnold von Lübeck war der erste Europäer, der im 13. Jahrhundert darüber schrieb –, über dessen Zusammensetzung immer wieder spekuliert wurde, nannte man Haschischin. Die Bezeichnung «Assassinen» für die fanatischen Ordensanhänger wurde (wenn auch etymologisch umstritten) daraus abgeleitet (BEHR 1992: 97). Der französische Orientalist Silvestre de Sacy kam im Jahr 1818 in einem Aufsatz zum Schluss, dass das französische assassin (= Meuchelmörder) auf das arabisch-persische haschischia (= Haschisch-Leute) zurückgehe (GELPKE 1975: 100-101). Interessant ist, dass diese größtenteils widerlegte Legende bis heute als vermeintlicher Beweis herhalten muss, um die Gefährlichkeit von Cannabis zu illustrieren.
Bereits im frühen Mittelalter nahm man an, dass es sich beim Ordensgründer Hasan um den «Alten vom Berge» handle: dies gilt heute als widerlegt, ist damit doch das Oberhaupt der syrischen Assassinen, Raschid ad-Din Sinan*, gemeint.
Hanf im mittelalterlichen Europa
Hanf zu Beginn des Mittelalters
Wie bis anhin verwendete man im Europa des frühen Mittelalters fast ausschließlich entweder den Hanfsamen oder die Faser. Als Halluzinogen war Cannabis unbekannt: der einheimische Hanf hätte auch kaum Wirkung gezeigt. Im Gegensatz dazu hatten andere psychotrop wirkende Pflanzen wie Stechapfel, Alraune, Bilsenkraut oder Tollkirsche ihre Blütezeit in dieser Periode. Sie dienten fast ausschließlich der Magie und finsteren Machenschaften (SCHULTES, HOFMANN 1987: 26).
Es gibt allerdings vereinzelt Hinweise, dass Hanf oder Hanfsamen zusammen mit anderen schlaffördernden und/oder schmerzbetäubenden Pflanzen in Form von Räucherungen oder als Tolltränke verabreicht wurden (TSCHIRCH 1910: 454-455). Diese These könnte dadurch gestützt werden, dass die Inquisition im 12. Jahrhundert in Spanien und im 13. Jahrhundert in Frankreich verschiedene Naturheilmittel verbot, darunter auch Cannabis (HERER 1993: 126). Später, im 15. Jahrhundert, erreichte die Ächtung von Cannabis einen vorläufigen Höhepunkt, als Papst Innozenz VII. im Jahr 1484 die sogenannte Hexenbulle (Summis desiderantes affectibus) erließ. Darin verbot er Kräuterheilern die Verwendung von Cannabis, da Hanf ein unheiliges Sakrament der Satansmesse sei (FISCHER 1929: 126-128).
Bereits 300 Jahre früher geht die deutsche Äbtissin Hildegard von Bingen in ihrer um 1150 erschienenen Heilmittel- und Naturlehre Physica auf Cannabis ein:
«[De Hanff-Cannabus] Der Hanf ist warm. Er wächst, während die Luft weder sehr warm noch sehr kalt ist, und so ist auch seine Natur. Sein Same bringt Gesundheit und ist den gesunden Menschen eine heilsame Kost, im Magen leicht und nützlich, weil er den Schleim ein wenig aus dem Magen entfernt und leicht verdaut werden kann, die schlechten Säfte mindert und die guten stärkt. Wer Kopfweh und ein leeres Gehirn hat, dem erleichtert der Hanf, wenn er ihn isst, den Kopfschmerz. Den, der aber gesund ist und ein volles Gehirn im Kopfe hat, schädigt er nicht. Dem schwer Kranken verursacht er im Magen einigen Schmerz. Den, der nur mäßig krank ist, schädigt sein Genuss nicht. – Wer ein leeres Gehirn hat, dem verursacht der Genuss des Hanfes im Kopf einen Schmerz. Einen gesunden Kopf und ein volles Gehirn schädigt er nicht. Ein aus Hanf verfertigtes Tuch, auf Geschwüre und Wunden gelegt, tut gut, weil die Wärme in ihm temperiert ist» (REIER 1982: 204).
Hanf in den Kräuter- und Arzneibüchern des Mittelalters
Interessanterweise erschien 1484, im gleichen Jahr wie die Hexenbulle, das Kräuterbuch Herbarius Moguntinis (Mainzer Kräuterbuch), worin «hanff, haniff» aufgeführt ist. Der Verfasser des Werkes ist nicht bekannt: die in Mainz hergestellte Inkunabel gilt zusammen mit dem Herbarium des Pseudo-Apuleius als erstes gedrucktes bebildertes Kräuterbuch der Welt (FISCHER 1929: 74-79). Auch in den folgenden Werken, so in dem im Jahr 1485 gedruckten Kleinen (H)ortus sanitatis wie im Großen Hortus sanitatis (im Jahr 1491 gedruckt) fehlt Hanf nicht. Altbekannte Anwendungen wie die Behandlung von Wasser- und Gelbsucht werden übernommen (HORTUS SANITATIS 1485: FISCHER 1929: 79-94: HEILMANN 1966: 99).
Ähnliches findet sich in Werken des später berühmt gewordenen Paracelsus. Der Hanf(samen) ist Bestandteil in seinem «Arcanum compositum», das er als wichtiges Arzneimittel mit besonderer Heilkraft ansah (MARTIUS 1856: 138: SCHNEIDER 1985: 27).
Nur ganz sporadisch tauchen Berichte auf, dass Hanf auch berauschende Effekte habe. Allerdings bezogen sich solche Aussagen immer auf den Gebrauch von Cannabis oder Haschisch außerhalb Europas. So beschrieben in der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts der deutsche Arzt Johannes Wier (Weyer) oder auch der berbischstämmige Geograf Leo Africanus die psychotropen Effekte von Hanf (ABEL 1980: 108, MARTIUS 1856: 138).
Abb. 2: Darstellung von Cannabis im Kräuterbuch von Leonard Fuchs
Abb. 3: Darstellung von Cannabis im Kräuterbuch des Tabernaemontanus
Ab 1500 entstanden als Folge der sich etablierenden Buchdruckerkunst epochenprägende Kräuterbücher. Man ging dazu über, die Pflanzen so naturgetreu wie möglich abzubilden. Bei den als Väter der Botanik bezeichneten Kräuterbuchautoren Otto Brunfels, Hieronymus Bock und Leonard Fuchs wird die Pflanze beschrieben und in kunstvollen Holzschnitten porträtiert.
Aber auch nachfolgende Kräuterbuchautoren wie Adam Lonicer, Jacobus Theodorus Tabernaemontanus oder Andreas Matthioli erläutern die medizinischen Anwendungen von Hanf. Letzterer schreibt:
«Den Weiber / so von wegen der auffstoßenden Mutter hinfallen / sol man angezündeten hanff für die Nasen halten / so stehen sie bald wiederumb auff»
(TSCHIRCH 1910: 849).
Bemerkenswert ist, dass in diesem Kräuterbuch der therapeutische Gebrauch von Hanfrauch zur Inhalation erwähnt wird, denn man verwendete in dieser Zeit fast ausschließlich die Samen oder das daraus gewonnene Öl, deren Nutzen man schon lange kannte. Im gleichen Kräuterbuch wird ein äußerlich angewandter Umschlag aus Hanfwurzel zur Behandlung von Gichtschmerzen erwähnt: auch dies war bis dahin unüblich.
Auch andere Gelehrte widmen sich der Hanfpflanze. So beschreibt der berühmte Zürcher Arzt Conrad Gessner in einem seiner Werke folgendes Hanfrezept gegen Haarausfall:
«Das Wasser von Hanffsaamen mit Knoblauchsafft gebrannt / eben auff die weise wie das Rosenwasser distilliert wird / ist ein zierd Wasser. Dann so man die glatten kaalen orth darmit bestreicht / so macht es daselbst haar wachsen» (GESSNER 1583).
Hanf – ein Berauschungsmittel?
Im Zuge der Eroberungen oder durch Reisende wurde auch in Europa bekannt, dass Hanf außerhalb Europas als Berauschungsmittel verwendet wurde. So beschreibt der portugiesische Arzt Garcia ab Horto bereits im 16. Jahrhundert den Gebrauch von Bangue (Cannabis) in Indien (GARCIA AB HORTO 1574: 219). Auch der deutsche Arzt Engelbert Kämpfer beschreibt Anfang des 18. Jahrhunderts den rekreativen Gebrauch von Cannabis im Orient (KÄMPFER 1712: 645). Andere Asien- und Orientforscher in dieser Zeit erwähnen den Gebrauch von Cannabis in fremden Kulturen ebenso. Wann genau Haschisch zum ersten Mal nach Europa kam, ist nicht ganz sicher. Eventuell könnte dies im Jahr 1690 geschehen sein, und zwar durch den englischen (Drogen-)Kaufmann John Jacob Berlu, der in seiner Übersicht über die die handelsüblichen Drogen (The Treasury of Drugs Unlock’d) auch das «betörende und schädliche» B(h)ang aufführt (BOUQUET 1912: 13): «Bang. Is an Herb which comes from Bantam in the East Indies, of an Infatuating quality and pernicious use».
Dass Hanf bereits in dieser Zeit auch in Europa als Berauschungsmittel verwendet wurde, ist nur ganz spärlich belegt. Es kommt dazu, dass der einheimische Hanf kaum den berauschenden Inhaltsstoff enthielt und der importierte «indische» Hanf als Medizin erst ab Mitte des 19. Jahrhunderts in Europa richtig populär wurde. Interessant ist, dass das Hanfkraut bereits im 16. Jahrhundert in der europäischen Literatur Einzug hielt. So beschrieb der französische Arzt und Schriftsteller François Rabelais in seinem Werk Gargantua und Pantagruel eingehend ein Kraut namens Pantagruelion, welches insbesondere von älteren Autoren als Hanf identifiziert wurde (REGIS 1841: 1158–1163).
Cannabis im europäischen Arzneischatz des 18. Jahrhunderts
Das bis Mitte des 18. Jahrhunderts wohl populärste Arzneibuch im europäischen Raum war die Pharmacopoeia medico-chymica des Johann Schröder (TSCHIRCH 1910: 890). In der deutschen Ausgabe von 1709 mit dem Titel Vollständige und nutzreiche Apotheke oder medizin-chymischer Artzney-Schatz sind zahlreiche Cannabisrezepturen erwähnt. Einige Beispiele (SCHRÖDER 1709: 902):
«Die Bauern in Niederland geben Hanff Körner zerstoßen und ein Safft deraus gepresst den Patienten zu Anfang der Gelbsucht ein/und offt nicht ohne Nutzen sonderlich wenn sie aus bloßer Verstopfung und ohne Fieber entstehet. Er öffnet den Gang der Gallen und befördert durch den ganzen Leib bilis digestionem.»
«Wer flüssige Augen hat, der siede Hanff Körner in rothen Wein bis sie keimen hernach nehme man einen Schwam tunke den in die Brühe und binde den Schwamm alle Abend in den Nacken / zeucht die Flüsse hinweg.»
«Hanff-Emulsion aus dem Kern davon die Rinde abgemacht mit Rosen- Wasser bereitet und mit Baumwolle übergelegt vertreibet die MaserFlecken und Pocken-Narben / machet man aber mit Bier und Butter/Brühlein davon und trinket sie das morgens nüchtern so praeserviren sie den Kindern von Kinds-Blattern.»
In vielen zeitgenössischen Arzneibüchern wurde Hanf als Bestandteil von Rezepturen erwähnt. Meist waren es immer wieder die gleichen Beschwerden, die man mit Hanf(samen) behandelte. Eine typische Krankheit, die man unter anderem mit Hanfsamen bekämpfte, war die Geschlechtskrankheit Gonorrhoe (Tripper).
Auch der Schweizer Universalgelehrte Albrecht von Haller kannte den medizinischen Gebrauch von Hanf. Nebst den wohlbekannten Indikationen geht er in seinem 1776 erschienenen Werk Historia stirpium indigenarum Helvetiae auch auf die kulturhistorischen Hintergründe dieser Pflanze ein (HALLER 1768: 287-289).
Obgleich die nützlichen und therapeutischen Eigenschaften des einheimischen Hanfes geschätzt wurden, stand man dem bis dahin in der westlichen Medizin unbekannten indischen Hanf kritisch gegenüber. Den berauschenden Eigenschaften der fremdländischen Hanfpflanze und ihrer vermuteten Schädlichkeit wurde mit Vorsicht begegnet. Der Tübinger Medizinprofessor Johann Friedrich Gmelin hielt in seiner 1777 erschienen Allgemeinen Geschichte der Pflanzengifte fest:
«Auch der Saame, die Rinde, die Blätter, noch mehr der Saft, und die Spitzen der grünenden Pflanze haben etwas Betäubendes: sie sind das Brug, oder Bangue der Morgenländer, dass sie gemeiniglich mit etwas Honig anmachen, und es gebrauchen, wenn sie sich in eine angenehme Art von Trunkenheit und Benebelung des Verstandes versetzen wollen. Ob ich gleich nicht zweifle, dass ein langer Gebrauch solcher Mittel tödlich sein kann, so ist mir doch bisher kein Beispiel davon bekannt» (GMELIN 1777: 402).
Zusammengefasst: Auch im 18. Jahrhundert verwendete man von der Arzneipflanze Cannabis sativa fast ausschließlich, wie in der Volksmedizin üblich, die Samen in Form des Öls oder einer Emulsion. Die Heilpflanze Cannabis indica war bis zu diesem Zeitpunkt als Arzneimittel praktisch unbekannt. Es sollte bis Mitte des 19. Jahrhunderts dauern, bis sich der Indische Hanf in der europäischen Schulmedizin etablieren konnte.
Was ist Indischer Hanf?
Der wissenschaftliche Name Cannabis indica, Indischer Hanf, stammt von dem französischen Botaniker Jean Baptiste Lamarck (1744–1829), der ihn damit von dem in Europa angebauten Hanf Cannabis sativa





























