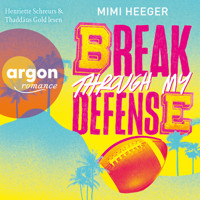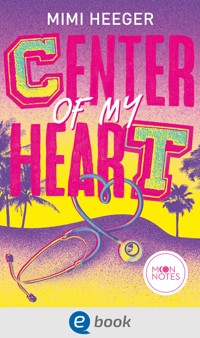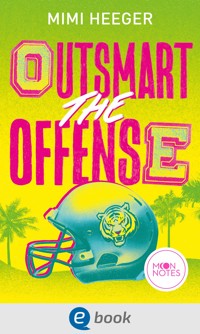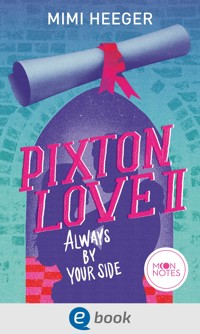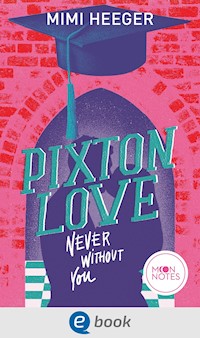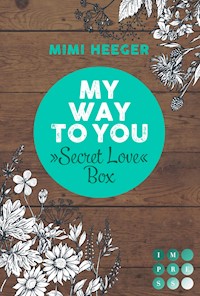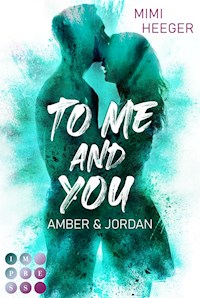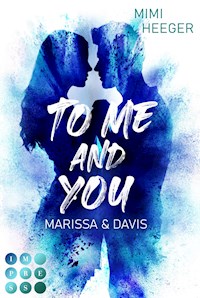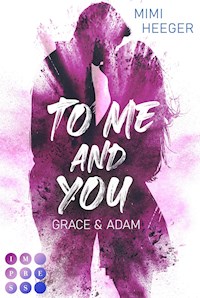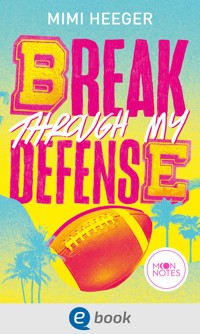
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Moon Notes
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Auf dem Platz gewinnt er jedes Spiel. Aber kann er auch ihr Herz gewinnen? Als die Eltern der 20-jährigen Payton bei einem tragischen Unfall ums Leben kommen, bricht für sie eine Welt zusammen. Da sie die Schulden für ihr Elternhaus in Tennessee nicht abbezahlen kann, zieht sie in das Poolhaus ihres Onkels nach Cape Coral in Florida. Ein Albtraum für die mehrgewichtige Musikstudentin. Zwischen oberflächlichen Models und durchtrainierten College-Sportlern versucht Payton, mit ihrer Trauer fertig zu werden. Und mit den Gefühlen, die Cameron, der Quarterback der Cape Coral Tigers, in ihr auslöst … Bestseller-Autorin Mimi Heeger nimmt Leser*innen ab 16 Jahren in diesem bewegenden New-Adult-Roman mit auf eine emotionale Reise in Paytons Welt – eine Welt voller Trauer, Bodyshaming, Oberflächlichkeiten und der Suche nach sich selbst. Aber auch eine Welt voller Sommer, Sonnenschein und glitzerndem Meer. Lass dich mitreißen von der zarten Slow-Burn-Romance, die sich entwickelt und die Paytons Leben für immer verändern wird. Break through my Defense: Ein Sommer voller Tragödien, Touchdowns und der großen Liebe - Voller Gefühle: Ein bewegender New-Adult-Roman für Leser*innen ab 16 Jahren. - Spannung und Liebe: Die mitreißende Sports Romance mit dem Trope Enemies-to-Lovers fesselt von der ersten bis zur letzten Seite. - Starke Protagonistin: Eine inspirierende Geschichte über Bodyshaming, Selbstfindung, die Kraft der Liebe und die Überwindung von Trauer. - Genial ausgestattet in der Erstauflage: Softcover mit Klappen, trendig illustriertem Buchschnitt und coolem Lesezeichen zum Abtrennen.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Über dieses Buch
A summer of tragedy, touchdowns and true love
Als die Eltern der zwanzigjährigen Payton bei einem tragischen Unfall ums Leben kommen, bricht für sie eine Welt zusammen. Allein kann sie die Schulden für ihr Elternhaus in Tennessee niemals stemmen, und so bleibt ihr nur noch ein Ausweg: Das Poolhaus ihres Onkels in Cape Coral, Florida.
Für die mehrgewichtige Musikstudentin ein absoluter Albtraum. Zwischen den oberflächlichen Models und Sportlern am College versucht Payton, sich ihrer Trauer zu stellen. Und den Gefühlen, die ausgerechnet der Quarterback der Cape Coral Tigers in ihr auslöst …
Liebe Leserin, lieber Leser,
wenn du traumatisierende Erfahrungen gemacht hast, können einige Passagen in diesem Buch triggernd wirken. Sollte es dir damit nicht gut gehen, sprich mit einer Person deines Vertrauens. Auch hier kannst du Hilfe finden: www.nummergegenkummer.de.
Schau gern hinten nach, dort findest du eine Auflistung der potenziell triggernden Themen in diesem Buch. Um Spoiler zu vermeiden, steht der Hinweis ganz hinten.
Schönheit ist nichts, das du sehen kannst.
Schönheit fühlst du.
Für alle, die glauben,
nicht schön genug zu sein für diese Welt.
Ihr seid es … alle.
Prolog
»Ich bin nicht sicher, ob ich so unter die Leute gehen kann.« Stöhnend betrachte ich mein Spiegelbild, doch viel Zeit für Selbstmitleid bleibt mir nicht, denn meine Mom lenkt mit ihrem schief gelegten Kopf meine Aufmerksamkeit zurück auf sich. Dabei kippt der riesige Dutt hoch auf ihrem Kopf leicht zur Seite, was mich zum Schmunzeln bringt.
Über meine Schulter treffen sich unsere Blicke.
»Du siehst wunderschön aus.«
»Findest du nicht, das Blau an mir erinnert irgendwie an einen Wal?«
»Jetzt hör aber auf.« Streng, aber liebevoll taxiert sie mich. »Das Kleid steht dir ausgezeichnet. Du siehst toll aus.«
Seufzend streiche ich über den Satinstoff. »Sieh mich doch an, Mom.«
»Ich schaue dich an. Jeden Tag. Und ich wünschte wirklich, du könntest dich so sehen, wie ich dich sehe, Äffchen.«
Ich rolle übertrieben mit den Augen, auch wenn es mir nur halb so viel ausmacht, wie ich vorgebe, dass meine Mutter mich Äffchen nennt.
»Es macht mich traurig, wenn du schlecht über dich selbst denkst.«
»Sag jetzt ja nicht so etwas wie: ›Die inneren Werte zählen!‹ Dann muss ich mich übergeben.«
Lachend schiebt sie mir eine weitere Haarklammer in meine aufwendige Hochsteckfrisur und schüttelt dabei den Kopf.
»Warum sollte ich so etwas sagen? Schönheit ist definitiv etwas Äußerliches. Ich war auch mal achtzehn, mir ist klar, dass es noch ein paar Jahre dauert, bis du merkst, dass Äußerlichkeiten genau das sind. Eben Äußerlichkeiten. Und somit für dein Leben nicht von Belang. Aber trotz all der mütterlichen Weisheiten können wir uns diese Unterhaltung eigentlich sparen. Denn du bist eine wunderhübsche junge Frau. Komm schon!« Aufmunternd klopft sie mir auf die Schulter. »Heute ist dein Abschlussball. Pack deinen Groll weg und genieß es, einen Abend lang eine Prinzessin zu sein. Morgen darfst du wieder Daddys zynisches Mädchen in den weiten Klamotten spielen und altmodische Musik hören. Aber heute hab ein bisschen Spaß. Trink zu viel und knutsch mit irgendeinem Typ auf dem Rücksitz seines Wagens rum.«
Mein Mund öffnet sich, doch es ist nicht meine Stimme, die lautstark protestiert: »Untersteh dich, mit einem pubertierenden Mistkerl rumzumachen.«
Sobald ich dem Blick meines Dads im Spiegel begegne, verziehen sich meine Lippen unwillkürlich zu einem Lächeln. Er ist und bleibt mein Wingman. Immer und überall. Ich liebe meine Mom wirklich, aber sie hat keine Ahnung, wie das Leben für mich auf der Highschool in den letzten Jahren war. Dad und ich … wir sind eine Einheit. Er erkennt blind, wenn mich etwas bedrückt.
»Kannst du Mom bitte irgendwie verklickern, dass ich nicht auf den Ball gehen sollte? Dabei handelt es sich doch sowieso nur um eine übertrieben sexistische Veranstaltung, die es Leuten wie mir noch schwerer macht, sich zu integrieren.«
Mein Dad lacht dunkel, während er sich auf der Kante meines Bettes niederlässt. Durch die Lichterkette, die über meinem Bett hängt, sieht er viel jünger aus als bei Tageslicht. Seufzend streicht er sich über seinen Vollbart.
»Das sind gute Argumente, Pat. Aber ich fürchte, ich bin gegen den Willen deiner Mom genauso machtlos wie du.«
Mit gequältem Gesicht flehe ich ihn stumm über den Spiegel an.
»Sei nicht so theatralisch, Äffchen. Der Ball ist weder sexistisch, noch musst du irgendwo integriert werden. Und was heißt überhaupt ›Leuten wie mir‹? Du bist ein vollkommen normaler Teenager. Du dramatisierst, Payton Cunningham. Das werde ich nicht tolerieren. Menschen sind so unterschiedlich wie die Blumen eines Gartens. Wer bist du, entscheiden zu können, dass eine Rose hübscher ist als eine Hortensie.«
Übertrieben seufzend sehe ich zurück in den Spiegel. In diesem Kleid bin ich definitiv der Typ aufgeplusterte Hortensie, und ich möchte wetten, die Jungs auf dem Ball sehen das genauso. Und zwar ganz gleich, wie schön die Worte meiner Mom klingen.
»Ich werde definitiv mit niemandem rumknutschen.« Obwohl meine Mom wieder an meiner Frisur herumzupft, lasse ich das Kinn auf die Brust sinken. Meine Motivation, mich in diesem übertrieben engen Kleid zwischen all die schlanken Mädels zu begeben, kratzt nahezu an einem Minimum.
Mit einem etwas zerknirschten Gesichtsausdruck steht mein Dad auf und begutachtet mich. »Es freut mich, das zu hören. Aber daran habe ich nicht gezweifelt. Weil du nämlich nicht nur hübsch bist, denn in diesem Fall gebe ich deiner Mutter zu hundert Prozent recht. Sondern auch, weil du verdammt clever bist. Der Ball mag möglicherweise wirklich sexistische Folter sein, aber du bist klug genug, um ihn als solche zu betrachten. Ich bin sicher, wenn du einmal auf dem Rücksitz eines Wagens landest, dann mit einem Kerl, dessen Verstand mindestens genauso rasiermesserscharf ist wie deiner.« Er legt eine Hand auf meine Schulter und drückt sie sanft.
»Dein Dad hat recht.« Mom küsst meine Wange. »Und jetzt hör auf zu zweifeln, Äffchen. Alles an dir ist genau so, wie es sein soll. Du wirst das eines Tages erkennen. Bis dahin werde ich es dir jeden Tag ins Ohr flüstern: Du. Bist. Wunderschön.« Ihre perfekt geschwungenen Lippen verziehen sich zu einem Lächeln. »Wenn es sein muss, werde ich dir das für den Rest meines Lebens jeden einzelnen Tag predigen.«
Der Rest ihres Lebens sollte nur noch ganze zwei Jahre andauern …
Kapitel 1
Ich kann nicht klar sehen.
Und das liegt nicht an den Tränen, die mir die Sicht verschleiern. Wahrscheinlich bin ich die Einzige hier, die nicht weint.
Das habe ich die ganze Woche noch nicht getan. Ich habe es versucht. Habe geschrien und geflucht, gejammert und gebettelt, aber es wollten einfach keine Tränen fließen. Vielleicht stehe ich unter Schock, oder ich bin schlichtweg ein schrecklicher Mensch. Möglicherweise stimmt irgendetwas nicht mit mir, aber ich kann einfach nicht weinen.
Während um mich herum die Welt, wie ich sie kannte, nach und nach verblasst, stellt sich mein Blick langsam wieder scharf und starrt auf das Unausweichliche.
Erde.
Feuchte, braune Erde, die mit einem dumpfen Geräusch auf die strahlend weißen Särge fällt.
Niemand klärt den Blick für das, was sich tatsächlich genau vor uns abspielt.
Dass die Körper meiner Eltern bereits kalt und ausgetrocknet sind.
Dass die Autolyse eingesetzt hat und sie somit in der zweiten Phase der Verwesung stecken.
Dass es nur wenige Wochen dauern wird, bis die Würmer sich durch das Holz gefressen haben und anfangen, an ihnen zu nagen.
Vier Jahre. So lange wird es dauern, bis nur noch Skelette in den Särgen liegen.
Dann bin ich vierundzwanzig.
Ich werde in dem Jahr mit dem Musikstudium fertig sein, in dem von meinen Eltern nichts mehr übrig geblieben ist als ein Haufen Knochen.
All diese Details über den Tod zu googeln war ein großer Fehler. Ich kann nicht mehr schlafen, nicht mehr essen, und mir ist permanent schlecht, seit ich diese Einzelheiten kenne.
Der Haken am Wissen. Ganz gleich, wie sehr man sich auch wünscht, manches niemals erfahren zu haben, wenn es erst mal da ist, bekommt man es nicht mehr aus dem Gehirn.
Die schwülwarme Luft dieses, objektiv betrachtet, schönen Samstagvormittags will einfach nicht in meine Lunge. Es fühlt sich an, als drückte mich jemand gewaltvoll unter Wasser, und ich kann nicht atmen. Der brennende Schmerz in meiner Brust wird mit jeder weiteren Sekunde unerträglicher. Ich muss Luft holen, muss auftauchen aus diesem Albtraum. Doch mein Körper steht regungslos da und sieht dabei zu, wie die Särge meiner Familie unter einer Schicht Erde verschwinden.
Ich werde untergehen.
Ich werde in die Tiefe gezogen, und es gibt nichts, was ich dagegen tun kann.
»Die Muffins sind von Ms. O’Brian.« Die Stimme unserer Nachbarin reißt mich aus meinen Gedanken. Mit letzter Kraft zwinge ich meine Lider auf und bemühe mich, die Mundwinkel möglichst weit nach oben zu ziehen. »Danke, Lauren. Das ist sehr nett.«
Die Frauen aus der Gegend haben schon vor der Beisetzung ein gigantisches Büfett aufgebaut, von dem inzwischen nur noch die kläglichen Reste übrig sind. Die meisten Gäste sind mittlerweile gegangen. Den ganzen Nachmittag über war das Haus voller Leute. Trauernde, weinende Menschen, die sich in unserem Wohnzimmer und der Küche getummelt haben. Sie haben Erinnerungen an meine Eltern geteilt und neue Details zu dem grausamen Tod getauscht. Es war wie eine blutige Schatzsuche nach weiteren Puzzlestücken, die aus der Tragödie ein noch größeres Horrorszenario machte, als es ohnehin ist. Wenn Menschen auf unnatürliche Weise sterben, fühlt es sich an, als würde man eine Limonade nahe einem Wespennest aufstellen. Es dauert keine Minute, und alle scharen sich darum. Der Anschlag, bei dem meine Eltern umgekommen sind, ist für die ganze Stadt ein Schicksalsschlag.
Ich weiß, sie meinen ihren Besuch und die Beileidsbekundungen nur gut. Sie alle. Doch ich habe seit Stunden das Gefühl, mein Zuhause vor dieser Invasion verteidigen zu müssen.
Sehnsüchtig sehe ich auf die letzten Muffins und denke an meinen Dad. Er liebte Schokoladenmuffins. Wenn er heute hier wäre, würde er mir eine Hand auf die Schulter legen, und ein einziger Blick in sein Gesicht würde genügen. Er müsste mir nicht sagen, wie genervt er von Ms. O’Brian und ihrem ätzenden Sohn ist. Er müsste auch nicht laut aussprechen, dass er das alles meiner Mom zuliebe mitmacht. Ich würde es in seinem Gesicht sehen. Und ich würde mir einen Muffin nehmen und Mom anlächeln, damit beide glücklich wären. Aber meine Eltern sind nicht hier.
Ich bin allein.
Allein mit den Frauen aus der Nachbarschaft, die unsere Möbel wieder zurück an ihren Ort rücken und das Geschirr spülen. Allein mit Onkel Jeff, der mich den ganzen Tag beäugt, als rechnete er jede Sekunde damit, dass ich den Verstand verliere.
Und allein mit meiner endlosen Verzweiflung. Einem riesigen schwarzen Loch ohne Boden, bei dem ich keine Ahnung habe, wie ich je wieder daraus hervorkriechen soll.
Müde schleppe ich mich ins Wohnzimmer und stocke hinter dem Sessel. Dads Sessel. Der Sessel, in dem er laut geschnarcht hat, wenn er nach der Arbeit eingeschlafen ist.
Ich kralle meine Fingernägel in den abgewetzten Stoff. An die Stelle, an der sonst sein Kopf gelehnt hat. Es ist beinahe so, als könnte ich seine dunklen Locken unter meinen Fingerspitzen spüren.
Ms. Denver und Desiree von nebenan sind dabei, mit Jeff die letzten Gläser einzusammeln.
»Ich …« Mein Räuspern kann den Kloß in meinem Hals nicht wirklich beseitigen. »Ich gehe kurz nach oben.«
Ohne lange darüber nachzudenken, flüchte ich in die obere Etage und drücke die Klinke zum Schlafzimmer meiner Eltern hinunter. Der vertraute Geruch zwingt mich beinahe in die Knie.
Sofort schießen Dutzende Bilder auf mich ein.
Mom, wie sie mit ihrer Lesebrille an dem gepolsterten lila Kopfteil sitzt und einen schnulzigen Roman liest, während Dad, die Beine übereinandergeschlagen, irgendein altes Footballspiel im Fernsehen ansieht. Wie beide gemeinsam im Pyjama durchs Zimmer albern und wie Teenager kichern, wenn ich sie dabei erwische.
Heute kichert hier niemand mehr. Es ist still geworden im Hause Cunningham.
Bevor die Erinnerungen es schaffen, mich auf den Boden zu ringen, räuspert sich Jeff hinter mir.
»Es sind jetzt alle weg.«
»Gut.« Es ist nur ein Krächzen, das meine Lippen verlässt.
»Können wir … reden?«
Ich drehe mich zu meinem Onkel um. An der Geste, wie er sich ungelenk über den Nacken streicht, erkenne ich, dass er keine guten Nachrichten hat. Er tut das in den letzten Tagen häufiger.
Sieben Tage.
Sieben Tage ist es her, dass meine Eltern gestorben sind. Sieben Tage, seit ein Mensch eine falsche Entscheidung getroffen und mir damit meine Familie genommen hat.
Sieben Tage ist der Bruder meines Vaters nun hier, und trotzdem stehe ich noch immer vor einem Fremden.
»Klar«, keuche ich und versuche, das Grinsen so lange aufrechtzuerhalten, bis er sich umdreht und aus dem Fenster in unseren Garten blickt. Er hat die schwarze Krawatte abgelegt und die oberen Knöpfe seines Hemds geöffnet. Durch die aufgerollten Ärmel kommen seine sonnengebräunten Arme zum Vorschein. Ich mag den Geruch seines Parfums, aber ich hasse es, dass er sich in unserem Haus verteilt und den Duft meines Dads überdeckt.
Seufzend steht Onkel Jeff eine ganze Weile da. Die Situation ist unbehaglich, und ich fürchte mich vor dem, was er sagen will. Unsere Gespräche sind allesamt eher kühl und strategisch. Keine Umarmungen. Keine aufbauenden Worte.
Langsam lasse ich mich auf die Bettkante meiner Eltern sinken. Ich kann nicht mal sagen, dass ich erschöpft bin. Seit Tagen funktioniert mein Körper wie auf Autopilot. Jeden einzelnen Moment denke ich, dass ich den nächsten nicht aushalten werde, doch dann vergeht Stunde um Stunde, und ich halte den Schmerz weiter aus.
Jeff dreht sich zu mir herum und lässt sich in den Sessel sinken, den Mom immer als Kleiderablage genutzt hat.
»Wie geht es dir?«
Obwohl ich mich Jeff nicht wirklich verbunden fühle, tische ich ihm nicht die gleiche Lüge auf wie allen anderen schon den ganzen Tag über.
»Ich glaube nicht, dass irgendjemand die Antwort auf diese Frage wirklich hören will.«
»Ich schon.« Mein Onkel lehnt sich nach vorn und stützt die Ellbogen auf die Knie. »Es ist wichtig, dass wir ehrlich zueinander sind, Pat. Ich will dir helfen.«
»Ich weiß.« Ich lasse die Worte aus meinem Mund gleiten. Am liebsten möchte ich ihm sagen, dass er mich nicht Pat nennen soll. Mein Name ist Payton. Es gibt nur einen Menschen, der mich Pat genannt hat. Und der ist tot. Müde streiche ich mir über die Stirn. Erst danach hebe ich den Kopf und sehe Jeff in die Augen. Sie erinnern mich schmerzhaft an die meines Dads … und an meine eigenen. Ein tiefes Blau, das wolkenlosem Himmel und Sommertagen gleichkommt. »Danke, dass du diese Woche für mich da warst.« Das Und jetzt kannst du wieder nach Hause fliegen verkneife ich mir.
»Wir müssen da noch ein paar Dinge klären, Pat.« Jeff reibt sich über das Gesicht und fährt sich durch die kurzen dunklen Haare. Sie sind schick frisiert, genau wie sein kurzer Bart so penibel getrimmt ist, dass man meinen könnte, jemand hätte ihn mit einem Lineal geschnitten. »Ich habe heute Morgen noch einmal mit Richard gesprochen.«
Der Kloß in meinem Hals verdoppelt sich bei der Erwähnung unseres Anwalts. Wir waren in dieser Woche bereits zweimal dort, um den Nachlass meiner Eltern zu regeln, allerdings fehlten noch immer Unterlagen von der Bank, um alles an Hinterlassenschaften zusammenzutragen. Die Tatsache, dass Jeff ohne mich beim Anwalt meiner Familie war, lässt all meine Alarmglocken schrillen.
»Waru…?« Meine Stimme bricht, weil die Worte einfach nicht an dem riesigen Ding in meinem Hals vorbeigehen wollen.
»Ich will dir nichts vormachen.«
»Du? Was? Ich verstehe nicht.«
Hitze schießt mir in den Kopf.
»Du kannst das Haus nicht behalten. Die Idee ist vom Tisch.«
Nein.
Nein, nein, nein.
»Was meinst du mit ›vom Tisch‹?«
Vorgestern haben wir uns darauf geeinigt, dass ich das Haus meiner Eltern behalte. Mein Plan war, mir zusätzlich zum Studium einen Job zu besorgen, um die laufenden Kosten zu decken.
»Das Haus ist sehr hoch verschuldet. Du kannst das unmöglich allein finanzieren. Die Bank hält das ebenfalls nicht für angebracht.«
»Die Bank hält das nicht für angebracht?« Ich stoße die Worte einzeln hervor. Jedes davon kommt in meinem Gehirn an, doch nichts von alldem ergibt einen Sinn für mich. »Sie hält es nicht für ›angebracht‹?«, wiederhole ich wütend.
»Pat.«
»Nenn mich nicht so«, keife ich mit zitternder Stimme.
Tränen betteln hinter meinen Augäpfeln darum, endlich freie Bahn zu bekommen und den Druck in meinem Kopf zu lindern. Ich lasse es nicht zu.
Ein weiteres Mal streicht Jeff sich über das Gesicht.
»Es tut mir leid. Ich versuche nur, dir zu helfen. Aber deine Eltern hatten viele Schulden. Der Hausverkauf wird diese im besten Fall gerade so decken. Du kannst die Raten für den Kredit nicht tilgen. Du brauchst auch noch Geld zum Leben. Ich versuche nur, das Richtige zu tun.«
»Dann lass nicht zu, dass sie mir das Haus wegnehmen«, hauche ich. »Das ist mein Zuhause. Ich kann nicht auch noch mein Zuhause verlieren. Was soll ich denn dann machen? Wo soll ich wohnen?«
»Du kannst das Haus nicht behalten.« Kopfschüttelnd sieht er auf den himmelblauen Teppich, den meine Mom erst vor einigen Wochen gekauft hat. »Ich würde dir wirklich gern etwas anderes sagen. Aber ich werde nicht dabei zusehen, wie du in dein Elend rennst. Das hätten deine Eltern nicht gewollt.«
»Aber du hast Geld«, halte ich dagegen, obwohl ich ihn lieber anschreien möchte, dass er keine Ahnung davon hat, was meine Eltern wollten. »Warum kannst du die Schulden nicht begleichen?«
Immerhin kenne ich die Villa, in der mein Onkel wohnt. Unser Haus ist kleiner als seine Garage.
»Payton …« Er spricht meinen Namen aus, als würde er ihm körperliche Schmerzen bereiten. »Ich kann das Haus nicht einfach so kaufen. Und selbst, wenn …«
»Dann was?« Die Verzweiflung in mir nimmt ganz neue Formen an.
Jeff hebt den Kopf. Tränen schimmern in seinen Augen. »Du bist erst zwanzig. Du kannst nicht mutterseelenallein, ohne einen einzigen Angehörigen, in diesem Bundesstaat bleiben. Das fühlt sich falsch an. Du bist gerade erst dabei, erwachsen zu werden. Das Leben ist zu kompliziert, um es in deinem Alter komplett allein zu meistern.«
Ich zucke unter seinen Worten zusammen.
»Ich … ich bin volljährig.«
»Du bist zwanzig. Gerade erst im zweiten Studienjahr. Du hast keinen Cent und niemanden, der sich um dich kümmert. Was, wenn du krank wirst? Was, wenn dein Auto kaputt ist? Und wovon willst du dir überhaupt ein Auto leisten?«
»Ich brauche kein Auto.« Mein Widerstand ist nicht besonders einfallsreich, aber zu allem anderen fehlt mir eindeutig die Kraft.
»Das ist Haarspalterei. Du bist zu jung, um vollständig auf dich allein gestellt zu sein. Es ist das Beste, wenn du mich nach Florida begleitest. Wir sind uns diesbezüglich einig.«
»Wir?« Ich stehe auf. Meine Arme und Beine zittern so sehr, dass ich keine Sekunde länger still sitzen kann.
»Deine Eltern haben mich in ihrem Testament darum gebeten, dass ich mich um dich kümmern soll, solltest du noch unter fünfundzwanzig Jahre alt sein, wenn ihnen etwas zustößt. Offensichtlich waren sie also meiner Meinung.«
»Nein.« Ich schüttle den Kopf. »Das hätte Dad niemals getan.«
»Er hat.« Erschöpft zuckt er mit der Schulter. »Du kannst die Unterlagen einsehen. Lies dir seine Worte durch. Sie wollten nicht, dass du hier allein bleibst.«
»Ich bin volljährig. Du kannst mich zu nichts zwingen.«
»Das stimmt. Und dennoch hast du keine Wahl.«
»Und wenn ich mich weigere?«
»Dann bist du auf dich allein gestellt. Aber dann vollständig.«
Trotzig recke ich das Kinn. Das ist, was ich will. Ich bin erwachsen. Ich brauche Jeff nicht.
Mein Onkel verschränkt die Arme vor der Brust. »Das bedeutet, das Haus geht für die Schulden drauf. Ich werde dich nicht mit den Einlagerungskosten für eure Möbel oder irgendetwas anderem unterstützen. Du wirst dir allein eine Wohnung und einen Job suchen, Versicherungen abschließen und den Nachlass deiner Eltern regeln. Du bist allein. Komplett allein.«
Wut mischt sich in meinem Bauch unter die Trauer und die blanke Angst. Eine ungesunde Mischung, die jeden Moment überzukochen droht.
»Warum tust du mir das an?« Mein Kinn bebt bei jedem Wort. »Das ist Erpressung.« Mein Blick schweift durch das Zimmer. Die Wahrheit ist, ich habe keine Ahnung von all diesen Dingen. Bislang habe ich immer auf meine Eltern gebaut. Wir haben Entscheidungen gemeinsam getroffen. Ich habe sie um Rat gefragt. Immer. Vielleicht macht mich das unselbstständig für mein Alter, aber bisher gab es keinen Grund zur Eile, schneller erwachsen zu werden.
Jeff steht auf und kommt auf mich zu, doch ich weiche zurück.
»Es ist doch nur in deinem Sinn, wenn du mit mir kommst, und ich bin sicher, das ist dir tief in deinem Inneren ebenfalls klar. Ich weiß, es kommt dir gerade nicht so vor, aber eines Tages wirst du mir danken. Ich gebe dir eine Chance. Es ist eine offene Tür, du musst nur hindurchgehen.«
Während er spricht, schüttle ich vehement den Kopf.
»Wir werden alles aus dem Haus einlagern. Ich werde dafür aufkommen, dass alles, was du willst, sauber verpackt und verstaut wird. Komm mit mir nach Florida. Konzentriere dich dort auf dein Studium. Trauere um deine Eltern. Nimm dir die Zeit, die du brauchst, um mit all dem hier klarzukommen. Werde in Ruhe und behütet erwachsen. Versuche es wenigstens. Das ist alles, worum ich dich bitte.«
Ein winziger Teil in meinem Verstand versteht sein Handeln. Aber der größere, verletzte Teil möchte ihm einfach nur die Augen auskratzen. »Meine Eltern sind erst seit ein paar Stunden unter der Erde, und du nimmst mir alles, was mir noch geblieben ist. Warum sollte ich dem zustimmen? Ich verliere mein Leben, meine Freunde. Mein Zuhause.«
Jeff legt sich eine Hand in den Nacken und reibt darüber. Dabei scheint er größte Mühe zu haben, sich ein weiteres Seufzen zu verkneifen. »Dass du dein Zuhause verlierst, ist nicht meine Schuld. Ja, mag sein, dass du manches opfern musst, dafür wird es dir vieles erleichtern, wenn du bei uns lebst.«
»Ich wüsste beim besten Willen nicht, was das sein sollte.«
Ich hasse Cape Coral. Ich hasse Florida. Ich hasse das oberflächliche Leben, das mein Onkel und seine Familie dort führen. Nichts auf der Welt könnte mich dazu bringen, bei ihnen wohnen zu wollen. Tennessee ist meine Heimat. Ich mag die kalten Winter und das regnerische Wetter. Ich mag die Menschen, die mich seit meiner Geburt kennen.
»Es tut mir leid, dass du es so siehst. Wir mögen uns nicht sehr nahestehen. Aber deine Eltern kannten mich besser als die meisten Menschen auf dieser Welt. Sie haben mir vertraut. Und bei aller Liebe: Ich habe dieses Haus und meine Tochter nicht verschuldet zurückgelassen.«
»Das Haus kann nicht verkauft werden!«
»Es kann und es wird.«
Wutentbrannt starre ich ihn an. Ich presse mir eine Hand auf die Brust, fühle mich, als würde ich keine Luft bekommen.
Wasser. Ich bin schon wieder versunken in diesem verdammt dickflüssigen schwarzen Nass und kann nicht atmen. Nirgends ist Licht, zu dem ich auftauchen kann. Die Wände des kleinen Schlafzimmers rücken immer näher. Mein Herz klopft viel zu schnell.
Ich. Kann. Verflucht. Noch mal. Nicht. Atmen.
»Ich weiß nicht, was ich noch sagen soll, Payton. Das hier überfordert mich genauso wie dich. Aber meine Entscheidung ist die beste für dich. Lass mich dir helfen, mit alldem fertigzuwerden. Wenigstens für eine Weile. Dann sehen wir weiter.«
Ich weiß nicht, was ein Mensch alles ertragen kann, aber ich bin sicher, es fehlt nicht mehr viel, um die Grenze dessen hautnah erleben zu können.
»Wann?« Ich flüstere die vier Buchstaben mit gesenktem Blick vor mich hin. Nie zuvor habe ich mich so sehr vor einer Antwort gefürchtet.
Jeff sagt vorerst nichts. Doch irgendwie muss er das auch gar nicht. Der schuldbewusste Ausdruck in seinem Gesicht schreit mir stumm entgegen, dass meine Zeit bereits abgelaufen ist.
Mein Leben ist vorbei.
Als er die Lippen teilt, um zu sprechen, möchte ich mir am liebsten die Ohren zuhalten.
»Ich habe das Umzugsunternehmen für übermorgen bestellt.«
Ein weiteres Mal bleibt meine Welt stehen.
Alle meine Nerven sind zum Zerreißen gespannt. Meine Augen weiten sich, meine Brust schmerzt, und mein Magen zieht sich zusammen. Es ist, als würden meine Eltern noch einmal sterben. Als würde der Polizist noch einmal vor mir stehen und mit gesenktem Kopf Es tut mir leid! murmeln.
Mit letzter Kraft straffe ich die Schultern und halte seinem Blick stand.
»Entschuldigst du mich kurz?« Ich warte nicht auf Jeffs Antwort. Stattdessen gehe ich mit zitternden Knien den Flur entlang. Ich halte die Luft an, bis ich die Tür zum Bad hinter mir geschlossen habe.
Übermorgen.
Mit dem Rücken an die Tür gepresst, denke ich darüber nach, welche Konsequenzen auf mich zukommen.
Ich muss Cat Lebewohl sagen. Und Joe.
Ich werde nie wieder an der TSU einer Vorlesung lauschen. Nicht mehr in die Bibliothek gehen und auch nicht in Susie’s Coffee Bar. Der Friedhof. Ich werde keine Spaziergänge machen können, um das Grab meiner Eltern zu besuchen.
Meine Augen wandern durch das schwarz-weiß geflieste Bad. Unser Zuhause.
Ich werde nie wieder in dieses Haus zurückkehren.
In das Haus, in dem ich laufen gelernt habe.
In dem ich mein ganzes Leben verbracht habe.
Ich werde nie wieder hier in diesem Bad stehen.
Bei dem Gedanken daran dreht sich mir der Magen um. Ich hechte über die Toilette und erbreche das bisschen, was ich heute gegessen und getrunken habe.
Ich würge und würge.
Schluchze und keuche.
Und doch bleiben meine Augen trocken.
Während ich sie zusammenkneife und blind nach der Spülung taste, wünschte ich, ich wäre mit meinen Eltern gestorben. Wenn ich an diesem Tag nicht mit Cat ins Kino gegangen wäre, sondern ihren Hochzeitstag mit ihnen gefeiert hätte. Dann wäre es für alle leichter. Onkel Jeff könnte unser Haus verkaufen und zurück in sein perfektes Leben gehen, und ich läge mit dem Kopf auf Dads Schoß, während Mom mir die Haare aus der Stirn streichen würde. Alles wäre gut. Wir wären zusammen.
Stattdessen liege ich mit dem Kopf auf dem Badvorleger und verfluche die Welt. Und niemand ist da, der mir die Haare aus der Stirn streicht und mir verspricht, dass alles gut wird. Wahrscheinlich, weil nie wieder alles gut werden wird.
An dem Tag, als meine Eltern starben, habe ich meine Wurzeln verloren. Ich verlor meine Kindheit und meine Jugend. Meine komplette Vergangenheit. Doch gerade hat Jeff mir meine Zukunft genommen.
Kapitel 2
»Den wirst du sicher nicht brauchen.« Jeff deutet auf den Hoodie meines Dads, den ich trage. Allerdings nicht der Temperatur wegen.
Ich nicke nur knapp, um wenigstens zu signalisieren, dass ich ihn gehört habe. Gemeinsam stehen wir vor der Gepäckausgabe und warten auf unsere Koffer. Seit wir mein Elternhaus heute Morgen verlassen haben, wird er mit jeder Minute fröhlicher, während meine Laune in den Minusbereich rutscht. Mir ist bewusst, dass ich ihm dafür danken müsste, dass er sich meiner annimmt, und seine Versuche, es mir leichter zu machen, annehmen sollte. Aber ich kann nicht. Beim besten Willen nicht. Nicht nur, weil meine Eltern tot sind und es momentan nichts gibt, was mich aus dem finsteren Tal herausholen könnte. Sondern auch, weil ich ihn für den Schmerz in meinem Inneren verantwortlich mache. Ich verabscheue den Gedanken an Florida. Es ist nach wie vor unvorstellbar für mich, auch nur einen einzigen Tag hier zu verbringen.
»Da draußen sind es sicher jetzt schon über fünfunddreißig Grad.« Er zeigt mit dem Daumen hinter sich. Durch die große Glasfront des Flughafens von Fort Myers erkennt man, wie die Hitze über der Landebahn flirrt.
»Nett«, spucke ich aus und seufze innerlich erleichtert auf, als ich die Gepäckstücke auf dem Rollband entdecke. Gleichzeitig durchzuckt mich der Schmerz, den ich durch die Nervosität und den Flug kurz verdrängt hatte. Das sind Moms Koffer. Zwei große goldene Hartschalenkoffer, die sie sich für unseren Urlaub nach Chicago vor drei Jahren gekauft hat. Koffer, die sie nun nie wieder benutzen wird. Weil sie ihre letzte Reise bereits angetreten hat.
Der Anblick der heranfahrenden Ungetüme bringt mit einem Schlag alles zurück in meinen Verstand. Die Hilflosigkeit, weil ich trotz aller Bemühungen einsehen musste, dass ich mir allein ein Leben in Tennessee nicht leisten kann. Dass es unausweichlich ist und dass ich auf Jeff angewiesen bin. Dass das hier jetzt mein Leben ist.
Cape Coral.
Ein Albtraum.
Für die meisten Menschen mag dieser Ort paradiesisch sein, aber ich bin nun mal nicht wie die meisten Menschen. Wahrscheinlich wäre unter den gegebenen Umständen jeder Ort auf dieser Welt gerade der Horror für mich, aber eine Stadt in Florida voller Bikinigirls und Surfertypen war auch schon vorher der letzte, wo ich mein Leben verbringen wollte.
»Payton?«
Ich zucke zusammen, als Jeff seine Hand auf meine Schulter legt. Erst jetzt registriere ich, dass er mein Gepäck vom Band genommen hat und mich fragend ansieht.
»Alles okay?«
Statt einer Antwort zwinge ich mich zu einem Nicken und nehme ihm die Koffer aus der Hand.
Schweigend gehen wir nebeneinander her, und ich bin froh, dass er endlich aufgegeben hat, mir Cape Coral schmackhaft reden zu wollen. Den ganzen Flug über musste ich mir anhören, von welchem Punkt aus man die Delfine beobachten kann und wie warm die Pools sind. Als ob irgendetwas davon für mich auch nur die geringste Rolle spielen würde.
Um uns herum hechten die Menschen zum Ausgang, weil sie es nicht erwarten können, ihre Liebsten endlich wieder in die Arme zu schließen. Unwillkürlich werde ich stattdessen langsamer, doch es ist unausweichlich.
Schon von Weitem erkenne ich meine Tante Shawna und meine allseits berühmte Cousine Imogen.
Jeff bedenkt mich mit diesem Blick, mit dem er mich seit Tagen verfolgt. Als würde er nur darauf warten, dass ich ausflippe. Zugegeben, die letzten Tage habe ich das ein oder andere Mal heftig rebelliert, während er all unser Hab und Gut in eine Lagerhalle in Knoxville hat einlagern lassen. Ich mag psychisch instabil wirken, aber eigentlich hasse ich ihn einfach nur. Auch wenn er den Rest meiner Schulden getilgt hat, die nach dem Hausverkauf noch immer übrig waren. Ich hasse ihn dennoch. Auch wenn er im Grunde alles richtig macht. Er kümmert sich um sämtliche Angelegenheiten und hat mir versprochen, in ein paar Wochen zurückzukehren, damit ich den alten Pontiac meines Dads und ein paar persönliche Dinge holen kann. Trotz alledem verabscheue ich es, wie er mich gerade ansieht. Aber wer weiß, vielleicht ist es auch nur Mitleid, das da in seinen Augen schimmert, weil er ziemlich genau weiß, was mir hier bevorsteht.
Ich bin quasi Miss Piggy, gestrandet in Barbie World. Jedem wird beim ersten Blick auffallen, dass ich nicht hierhergehöre.
Allein bei dem Gedanken daran, wie meine Tante und Cousine in ihren knappen Jeansshorts und fransigen Bikinioberteilen durch die Stadt watscheln und sich selbst feiern, wird mir schon schlecht.
Genau in diesem Moment hält Tante Shawna ein Schild hoch, auf dem Herzlich willkommen in Cape Coral steht.
Ein angewidertes Schnauben entweicht mir. Weiß diese Frau, dass ich gerade meine Eltern verloren habe und keinen vergnügten Ferientrip bei Verwandten mache?
»Sie meint es gut«, raunt Jeff dicht neben mir und winkt seiner Frau strahlend zu.
»Wusstest du, dass alles, was gut gemeint ist, im Grunde schlecht ist?« Es ist der erste vollständige Satz, den ich heute an ihn richte, und er trieft nur so vor angestauter Wut. Beim besten Willen schaffe ich es nicht, meine Hand zu heben und ebenfalls wie wild zu winken. Shawna darf ruhig merken, dass ich nicht freiwillig hier bin.
Stattdessen wende ich meinen Blick von meiner Tante in ihrem weißen knappen Kleidchen und den hohen Keilsandalen ab und sehe zu ihrer Tochter. Sie sieht aus wie eine jüngere Version ihrer Mutter. Wie gesagt: Barbie und Barbie Girl.
Imogen hebt flüchtig die Hand, ehe sie die Arme wieder vor ihrem perfekten Körper verschränkt. Dadurch presst sie ihre gepushten Brüste nur noch weiter aus dem tiefen Ausschnitt ihres pinken Tops. Ich muss schlucken, als ich ihren Rock betrachte. Wahrscheinlich würde ich nicht mal einen Oberschenkel in diesen Stofffetzen bekommen.
Das Einzige, was mir imponiert, ist, dass sie nicht genau wie ihre Mutter ein Schauspiel aufführt. Ihr sieht man ziemlich genau an, was sie von meiner Ankunft hält. Nämlich genauso viel wie ich.
Sobald wir die automatischen Glastüren hinter uns gelassen haben, beschleunigt Jeff seine Schritte und zieht seine Frau an sich, die ihm mit offenen Armen entgegenkommt. Sie umarmen sich, und er küsst ihren Hals, während sie ihre perfekt manikürten Finger über seinen Hinterkopf gleiten lässt.
Meine Hände krallen sich noch fester um die Koffergriffe. Dann ist meine Cousine dran. Sie öffnet ihre verschlossene Haltung, um meinen Onkel an sich zu drücken. Die ganze Zeit über ruht ihr Blick dabei mit hochgezogenen Augenbrauen auf mir.
»Payton!«, stößt meine Tante aus und klatscht in ihre Hände. Nicht gerade eine subtile Art, um meine Aufmerksamkeit zu erlangen. Aber zumindest funktioniert sie. »Es tut mir ja so leid. Ich wollte zur Beerdigung kommen, aber wir stecken mitten in der Sommersaison, und da kann ich die Mitarbeiter unmöglich allein lassen.«
Sie breitet ihre dürren Arme erneut aus und will auch mich an sich ziehen, doch ich lasse keine Sekunde von meinen Koffern ab.
Stattdessen sehe ich sie trotzig an. In Gedanken werfe ich ihr sarkastisch an den Kopf, wie viel Verständnis ich habe, dass ihre Immobiliengeschäfte wichtiger sind als die Beerdigung meiner Eltern. Aber klar doch!
Unsicher sieht Shawna von mir zu Jeff. Soll er ihr doch erklären, dass ich das hier verabscheue. Dass ich sie verabscheue. Er wollte die Kontrolle? Bitte schön. Immerhin hatte er auch keine Probleme damit, mein Leben über den Haufen zu werfen. Die Situationen, in denen ich diese Menschen getroffen habe, lassen sich an einer Hand abzählen. Sie sind Fremde für mich.
»Fahren wir erst mal nach Hause.« Jeff legt Shawna eine Hand auf die Schulter, und sie lässt ihre Arme langsam sinken. Sie hat ihre blonden Haare zu einem so engen Zopf gebunden, dass ihre Mimik quasi eingefroren ist. Vielleicht liegt es auch am Botox oder anderen tollen Mittelchen, für die im Hause dieser Cunninghams sicher genug Geld vorhanden ist.
Meine Tante senkt den Blick und faltet ihr Willkommensplakat zusammen.
Sobald sie und Jeff sich umgedreht haben, bleiben nur noch Imogen und ich. Zur Begrüßung nicke ich ihr knapp zu, was sie mit einem trotzigen Schnauben erwidert. Dabei wandert ihr Blick abschätzend über meine lange Cargohose und den Hoodie meines Vaters.
Wenn ich nicht gerade meine Eltern und unser Zuhause verloren hätte und dieser Vormittag nicht der schlimmste meines Lebens wäre, würde ich ihr höchstwahrscheinlich einen dummen Spruch drücken.
Ich bin eigentlich niemand, der sich kleinreden oder von Menschen wie Imogen abwertend betrachten lässt. Zumindest nicht mehr. Allerdings fehlt mir die Kraft für einen Kampf. Genauso wie mir die Kraft zum Reden fehlt. Es ist erstaunlich, dass mein Körper es überhaupt noch fertigbringt, Luft in meine Lunge zu pumpen. Daher presse ich die Lippen fest zusammen und folge meinem Onkel und seiner Frau in eine Welt, in die ich niemals gehören werde.
Ich werde das sicher nicht zugeben, aber es lässt sich nicht leugnen, dass Cape Coral an die Internetbilder erinnert, die meine Freundin Cat und ich uns schmachtend angesehen haben, wenn es in Tennessee mal wieder tagelang geregnet hat.
Die Fahrt von Fort Myers bis in den Süden von Cape Coral führt permanent am Wasser entlang. Über Brücken, vorbei am Hafen und parallel zu den Kanälen, die in der Stadt ein ganz eigenes Netz bilden. Cape Coral wird nicht ohne Grund das Venedig Amerikas genannt. Nur dass hier niemand romantisch mit einem Glas Wein in einer Gondel sitzt, sondern sich die Reichen und Schönen auf ihren Jachten bräunen und sich daran aufgeilen, wie hübsch sie sind.
Während ich schweigend auf der Rückbank von Shawnas SUV hocke, zieht eine Villa nach der anderen an uns vorbei. Weiße und gelbe Fassaden mit breiten Einfahrten und schicken Autos davor. Alles wirkt wie in einer inszenierten Realityshow. In einem Vorgarten wäscht ein junger Typ nur in Shorts und mit glänzendem Sixpack seinen Wagen, während seine wasserstoffblonde Freundin ihm etwas zu trinken bringt. Fehlt nur noch, dass das Ganze in Slow Motion abgespielt wird und jemand einen kitschigen Song dazu singt. In einem anderen spielen ein paar blonde Kinder mit einem Golden Retriever. Und ich schwöre, diese Kids müssen genmanipuliert sein, so perfekt wirkt diese kleine Szenerie.
Dieser Ort ist genauso unwirklich, wie ich ihn in Erinnerung hatte.
Ich werde niemals hierher passen. Weil ich nun mal niemals meine Brüste nur mit dünnen Seilchen gehalten an meinem Körper tragen werde, um den ganzen Tag nichts anderes zu tun, als mich mit meinem Aussehen zu beschäftigen. Weil ich kein Interesse daran habe, schicke Drinks aus langstieligen Gläsern zu trinken, während ich mir an Deck eines Bootes nach dem Golfen den Sonnenuntergang ansehe. Das bin einfach nicht ich.
Ich bin schon lange nicht mehr das unsichere Mädchen aus der Highschool, das mit seinem Körper nicht im Reinen ist. Diese Zeiten habe ich hinter mir gelassen. Allerdings schreit Cape Coral mir geradewegs durch die getönten Scheiben zu, dass dies der Ort sein wird, an dem meine Selbstzweifel, die in den letzten Jahren geruht und nur auf diesen Tag gewartet haben, erbarmungslos zurückschlagen. Meine inneren Dämonen haben nur geschlafen, und ich fürchte, sie erwachen hier schneller, als mir lieb ist. Diese Stadt ist ein Mekka für lange Beine und pralle Brüste. Hier zählen kein IQ und keine Emotionen. In Cape Coral heißt es Sehen und gesehen werden. Und ich will definitiv keins von beidem.
Ich zeige in der Regel nicht halb so viel Haut wie die Menschen, die ich allein in den letzten zehn Minuten gesehen habe. Ich werde schon rein optisch immer nach Tennessee gehören. Wo man sich ab September in Hoodies und Jeans wohlfühlt und samstagmorgens in zerschlissenen Arbeitshosen den Rasen mäht, um anschließend sein Haus selbst zu putzen. Mir ist das hier alles zu oberflächlich. Ich verbringe meine Zeit lieber mit anderen Dingen, als am Strand für Instagram zu posieren.
»Erinnerst du dich an unser Haus?« Shawna hat offensichtlich Jeffs Job übernommen und plappert die ganze Fahrt über unaufhörlich über die vielen tollen Plätze und Events rund um Cape Coral.
Die Tarpon Point Marina. Den Sun Splash Family Waterpark und natürlich die vielen Delfin-Touren, die jede Menge Spaß bedeuten.
Weil mir selbstredend nach nichts mehr der Sinn steht, als mich ins nächste Wasserabenteuer zu stürzen.
»Mhm.« Ich murmle eine kaum hörbare Zustimmung, die mir von Jeff einen Blick via Rückspiegel beschert.
Trotz der Hitze ziehe ich die Ärmel von Dads Hoodie über die Hände, was Imogen dazu verleitet, ein leise gegrunztes Geräusch von sich zu geben. Ich spare es mir, sie wütend anzufunkeln. Es ist mir egal, was sie über mich denkt.
»Ich habe dir das Poolhaus, so gut es geht, herrichten lassen. Bist du immer noch sicher, dass du nicht bei uns im Haus wohnen willst?«
Dieses Mal ist Imogens Meinung dazu deutlicher zu hören. Im Augenwinkel sehe ich, wie sie den Kopf schüttelt und den Blick anschließend aus dem Fenster richtet.
»Schon okay«, antworte ich halbherzig. Nie und nimmer werde ich mit diesen Menschen unter einem Dach wohnen. Das Poolhaus ist mehr als nah genug und war eine meiner Bedingungen.
Zum Glück biegt Jeff in diesem Augenblick in die breite Einfahrt ein und beendet die unangenehme Situation mit einem erleichterten: »Da wären wir.«
Ja, ich erinnere mich an das Haus.
Vor sechs oder sieben Jahren haben wir einen kompletten Sommer hier verbracht. Es war der schlimmste meines Lebens.
Sobald Jeff den schwarzen SUV angehalten hat, springt meine Cousine hinaus und schlägt mit voller Wucht die Tür zu, was ihren Vater dazu bewegt, tief zu seufzen. Ich glaube, ich habe meinen Onkel in den vergangenen Tagen öfter seufzen hören als alle Menschen, die ich kenne, in den zwanzig Jahren davor.
Den Türgriff bereits in der Hand, zwinge ich mich daher zu einem leisen »Danke«, ehe ich ebenfalls aus dem Auto steige. Die Hitze trifft mich wie ein Schlag in den Magen. Ich lege eine Hand an die Stirn, um meine Augen gegen die Sonne abzuschirmen.
Die schneeweiße Fassade blendet mich zusätzlich. Dennoch wende ich meinen Blick nicht ab von der Villa, die ab heute mein Zuhause sein soll.
Sie ist perfekt.
Wie einer Maklerhomepage entsprungen. Eine riesige schwarze Haustür, die genau in diesem Moment hinter meiner Cousine ins Schloss fällt. Passende schwarze Sprossenfenster entlang der untersten Etage und mehrere kleine Giebel, die das Haus wie ein Schloss erscheinen lassen. Anthrazitfarbene Gehwegplatten, die rund um das gigantische Gebäude führen und die kleinen Beete mit Pampasgras und Bambus begrenzen. Ja, es ist perfekt und wunderschön. Aber es ist kein Zuhause. Es ist kalt und unpersönlich, und ich hasse es schon jetzt aus tiefstem Herzen.
»Maria hat Quinoasalat mit Gemüsenudeln, Avocado und Lachs gezaubert. Du wirst es lieben.«
Ich zucke zusammen, weil ich nicht mal mitbekommen habe, dass Shawna neben mir aufgetaucht ist und nun ungelenk meine Schulter tätschelt. »Du lebst doch nicht vegan, oder? Wenn doch, ist das kein …«
»Schon gut.« Ich winde mich aus ihrer Nähe und bringe etwas Abstand zwischen uns. »Ich hab keinen Hunger.«
Unsicher zuckt ihr Blick erneut zu Jeff, der gerade dabei ist, meine Koffer auszuladen.
Zwei Koffer. Das ist alles, was mir von meinem Leben geblieben ist. Plötzlich erwischt mich die blanke Wut mit einer so heftigen Kraft, dass ich einen weiteren Schritt nach hinten mache.
»Okay. Dann zeige ich dir erst mal alles, ehe wir …«
»Nein!« Ich selbst zucke unter der Aggressivität meiner Stimme zusammen. »Nein«, schiebe ich daher noch einmal etwas versöhnlicher hinterher. »Ich bin wirklich müde und will nur noch ins Bett.«
Lüge. Lüge. Lüge.
Aber ich halte es keine Sekunde länger mit meiner übertrieben freundlichen Tante und meinem skeptisch dreinblickenden Onkel aus.
Dieser streift sich beide Hände an seinem schicken Poloshirt ab, als hätte er mit dem Tragen der Koffer weiß Gott was geleistet.
»Komm«, knurrt er. Wenigstens sein Tonfall hat sich meiner Stimmung angepasst. »Ich bringe dich zum Poolhaus.«
Mit einem eindeutig vorwurfsvollen Ausdruck in den blauen Augen schiebt er sich an mir vorbei.
Es ist keine Reue, die ich empfinde, sobald wir durch die schwere Eingangstür das Haus betreten. Ich weiß nicht, was ich fühle.
Wir passieren die geräumige Eingangshalle, die mit dem schicken Kronleuchter und den vielen Spiegeln an ein Schloss erinnert, und treten über den schicken Marmor in das riesige Wohnzimmer zu unserer Linken, das leider auch genau das ist … schick. So wie alles hier. Die komplette Front besteht aus Glaselementen, die zur Seite geschoben sind, sodass man den Eindruck bekommt, sich bereits im Garten zu befinden. Die Sonne spiegelt sich in dem übertrieben großen Pool, der aussieht, als hätte ihn jemand mit Minecraft konstruiert. Natürlich deutlich schicker.
Jeff zieht mit hochgezogenen Schultern meine Koffer hinter sich her, tritt durch das Wohnzimmer hinaus und umrundet die verschieden tiefen Wasserbereiche.
Rechts von mir entdecke ich Imogen durch eine weitere Glasfront in der offenen Küche. Es sieht alles etwas anders aus als in meiner Erinnerung, aber ich fürchte, Menschen wie Shawna renovieren in regelmäßigen Abständen. Immerhin gehört sie zu den Top-Immobilienmaklerinnen in Cape Coral.
Um nicht ins Wasser zu fallen, wende ich mich von Imogen ab und schlurfe hinter Jeff her über die dunklen Terrassenplatten, bis wir auf der anderen Seite des Pools ankommen.
»Das Poolhaus ist schon etwas in die Jahre gekommen, du kannst es dir also jederzeit anders überlegen und zu uns ziehen«, versichert er, während er die Koffer anhebt, um sie über die einzelnen Platten zu tragen. Mir wäre ein Stacheldrahtzaun oder eine hohe Mauer lieber gewesen, aber eine Wiese zwischen seiner Familie und mir ist besser als nichts.
»Ich bin nicht anspruchsvoll.« Die letzten Silben kommen allerdings nur noch leise hervor, weil Jeff eine Glasflügeltür öffnet, und ich zum ersten Mal meine neue Bleibe sehe. Zögerlich trete ich über die Schwelle und drehe mich im Kreis.
In die Jahre gekommen wäre jetzt nicht das Erste gewesen, was mir bei diesem Anblick einfällt. Wenn mir mein Zorn und meine Verzweiflung nicht im Wege stünden, hätte ich es wohl als wunderschön bezeichnet.
»Maria hat den Kühlschrank gefüllt und dir Handtücher ins Bad gelegt. Du solltest also alles haben, was du brauchst.«
Er reibt sich mit einer Hand über den Nacken. Eine Geste, die mir inzwischen nur allzu vertraut ist. Zum ersten Mal fällt mir auf, wie müde er aussieht.
»Mir wäre allerdings immer noch wohler, wenn du im Haus wärst.«
»Geht schon.« Ich hole einmal tief Luft. »Danke.«
Langsam beginnt er zu nicken, und wir fechten währenddessen ein stummes Blickduell aus, bis er schließlich einknickt.
»Komm einfach rüber, wenn etwas fehlt. Wir … sind für dich da.«
Das waren so ziemlich die nettesten Worte, die mein Onkel bislang zu mir gesagt hat, aber ich schaffe es nicht, meine Vorbehalte und die aufbrandende Wut in mir hinunterzuschlucken.
Sobald er mich allein gelassen hat, schließe ich die Glastür, schiebe die weißen dünnen Gardinen vor die Fenster und lehne mich mit dem Rücken dagegen.
Das ist es also.
Ein hochwertiges Polsterbett in Altrosé mit einer Kommode und einem Kleiderschrank zu meiner Linken. Das Ganze mit einer halbhohen Wand abgetrennt, auf der frische Blumen in schicken Vasen stehen. Eine süße Retro-Sitzgruppe mit Blumenmuster zur Rechten. Dahinter mit einem Fenster auf den Kanal eine kleine schwarze Küchenzeile, abgetrennt durch einen Tresen, zu dem man zwei Stufen auf eine Art Podest gehen muss. Und geradeaus eine Tür, die mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit in ein Bad führt.
Alles passt perfekt zueinander und fügt sich zu einem harmonischen Bild.
Doch die Gemütlichkeit vor mir will beim besten Willen nicht zu dem passen, was ich fühle.
Erschöpft kicke ich meine Sneakers von den Füßen und marschiere geradewegs auf das Bett zu. Wenigstens ist die Klimaanlage so kalt, dass ich mich samt Hoodie meines Dads unter der Decke verkriechen kann.
Im Schutz der Dunkelheit zücke ich mein Handy aus der Hosentasche und schreibe Cat.
Ich bin in der Hölle. Ich hasse es. Ich hasse sie. Ich hasse alles.
Während mein Daumen die Nachricht abschickt, kann ich nichts gegen das aufkeimende schlechte Gewissen machen, das sich zu all den anderen ätzenden Gefühlen mischt.
Am besten bleibe ich für den Rest meines Lebens unter dieser Decke liegen.
Kapitel 3
Ich verbarrikadiere mich die kommenden drei Tage im Poolhaus. Ich dusche nicht, ich esse so gut wie nichts, und vor allem weine ich nicht. Immer noch nicht. Ganz gleich, wie sehr die Trauer mich aufzufressen scheint, keine einzige Träne verlässt dabei meine Augenwinkel. Stattdessen liege ich da und versinke in einem Strudel aus Vergangenheit und Albträumen.
Wenn ich wach bin, denke ich an all die vielen Erinnerungen, die meine Eltern mir hinterlassen haben. Wenn ich schlafe, holen mich die Bilder des Anschlags ein. Ich habe von den unzähligen Amateurvideos auf TikTok nur ein einziges gesehen, ehe ich sämtliche Social-Media-Apps gemieden habe, als wären sie die Pest. Doch die Videosequenz hat sich wie Säure in mein Hirn geätzt und sich dort für alle Ewigkeit eingebrannt. Nur weil ein einziger Mensch seine Rache gegen eine Verflossene ausleben wollte, mussten meine Eltern sterben.
Die Bilder verfolgen mich Tag und Nacht. Ich kann alles leibhaftig vor mir sehen. Den Staub, die Scherben. Das Schreien der Menschen hallt selbst in absoluter Stille in meinen Ohren nach. Ich versuche, so wenig wie möglich zu schlafen, aber je müder ich bin, desto brutaler und verwirrter werden meine Träume. Es ist ein Teufelskreis, aus dem es keinen Ausweg zu geben scheint.
Gestern habe ich kurz mit Cat telefoniert. Ihre Stimme zu hören hat es nicht besser gemacht. Sie hat während des ganzen Telefonats geweint. Wir sind Freundinnen seit der Middleschool, und es schien unvorstellbar, dass wir jemals getrennt werden würden. Jetzt liegen Tausende Kilometer zwischen uns, und von unseren Zukunftsplänen ist nichts übrig geblieben. Ich kann so oft beteuern, wie ich will, dass ich spätestens in ein paar Monaten zurückkomme, wenn ich ein bisschen Geld gespart habe und mir eine Lösung eingefallen ist. Für den Moment allerdings bleibt uns nichts außer der gemeinsamen Trauer. Mir würde es wohl das Herz brechen, meine Freundin seit Tagen weinen zu hören, wenn es nicht längst in tausend Teile zersprungen wäre. Wenn ich ehrlich bin, beneide ich Cat um ihre Tränen.
All die Gefühle stauen sich in meinem Inneren und wollen mit aller Macht heraus, aber es gibt kein Ventil. Und ich bin kurz davor, zu explodieren. Eigentlich möchte ich mich heulend auf den Boden werfen und schreien, dass ich nicht hier sein will. Aber das bringt keinem von uns etwas.
Sosehr ich Cat vermisse, mit ihr zu telefonieren, tut mir unendlich weh, und ich weiß nicht, ob ich stark genug dafür bin, sie täglich anzurufen.
Gestern Abend hat offensichtlich auch Jeff seine Geduld verloren. Er ist vorbeigekommen, um mich darüber in Kenntnis zu setzen, dass ich am Samstag mit ihnen zu Abend essen werde. Es war keine Frage oder Bitte. Ganz gleich, wie weich seine Stimme auch geklungen haben mochte, der Ausdruck in seinem Gesicht strafte seine Worte lügen.
Er lässt mir keine Wahl. Seine Stippvisite dauerte ganze fünf Minuten und diente wahrscheinlich nur dazu, sicherzugehen, dass ich noch lebe.
Danach habe ich mich wieder verkrochen und mit niemandem mehr geredet. Mir steht nicht der Sinn danach, mit irgendwem Small Talk zu führen oder Gesellschaft zu suchen. Seit dem Todestag war ich kaum mal allein, und es gab keine fünf Minuten der Ruhe. Ständig wollte irgendjemand etwas von mir, oder ich musste mich der Trauer der anderen Leute stellen. Es war … zu laut … zu viel … zu … alles.
Ganz gleich, wie sehr ich Cape Coral hasse, aber hier bin ich wenigstens für mich.
Zumindest war das bisher so. Denn jetzt steht in wenigen Tagen ein Dinner mit der liebreizenden Verwandtschaft an.
Als wollte mir das Schicksal einen Wink erteilen, knallt es plötzlich von draußen. Laute Raketen pfeifen durch die Luft und explodieren am Himmel. Die Wände des Poolhauses färben sich für kurze Zeit rot und blau.
Ich war eigentlich noch nie ein großer Fan von Feuerwerk, und eigentlich interessiert es mich nicht, woher die vielen Explosionen kommen, dennoch schiebe ich die Decke zur Seite und schlurfe hinüber zur Glasfront. Die gesamte Breite ist von der weißen Gardine bedeckt, die ich zur Seite schiebe, um herauszulugen. Im Wasser des Pools spiegeln sich die bunten Lichter, aber ich kann am Himmel nichts entdecken, also öffne ich die Flügeltür und trete zögerlich auf die großen quadratischen Gehwegplatten.
Das Beleuchtungskonzept in Jeffs und Shawnas Garten ist wirklich überzeugend. Die Terrasse und der Pool sehen aus wie die Bilder, die man sonst nur in Filmen oder Serien präsentiert bekommt. Bodenspots beleuchten den Gehweg und werfen warmes Licht in die Pflanzen, die den Pool säumen. Gegenüber befinden sich das Wohnzimmer und die Küche. Beide sind nur schwach erhellt, daher wette ich, dass niemand zu Hause ist.
Nur in Slip und nach wie vor dem Hoodie meines Dads gehe ich ein paar Schritte weiter, während ich bereits den Hals recke, um über dem Flachdach des Poolhauses das Feuerwerk zu bestaunen. Rote und blaue Raketen schießen in den Himmel und regnen mit tausend Funken in die schwarze Nacht.
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich seit drei Tagen nur an die weiß verputzte Decke gestarrt habe, oder daran, dass ich sentimental und ausgelaugt bin. Aber der Anblick ist wunderschön. Es ist magisch, wie die Lichter den finsteren Horizont immer wieder erstrahlen lassen.
Das feuchte Gras streichelt meine nackten Füße, während ich noch ein paar Schritte weitergehe. Die frische Luft dieses Abends füllt meine Lunge mit dem Sauerstoff, den ich dringend gebraucht habe.
Auch nachdem die letzten Lichter längst verglüht sind, stehe ich da und schaue nach oben.
Meinem Verstand ist klar, dass meine Eltern nicht im Himmel sind. Auch wenn wir öfter mal in der Kirche waren und ich prinzipiell an Gott glaube, weiß ich, dass William und Anna Cunningham auf dem Friedhof in Crossville verwesen, und ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass ihre Seelen sie verlassen haben und nun auf mich herabschauen.
Trotzdem beschleicht mich ein seltsames Gefühl der Ruhe, als ich den Kopf in den Nacken lege und in die sternenklare Nacht blicke.
Ich stelle mir vor, was sie wohl für Gesichter machen würden, wenn sie mich jetzt gerade beobachteten. Wie meine Mom angewidert die Nase rümpfen würde, während mein Dad lachend den Kopf schüttelte.
Schuldbewusst lasse ich die Arme sinken.
»Es tut mir leid, okay?«, rufe ich in die Dunkelheit hinein und zucke mit den Schultern. »Aber es ist verdammt schwer ohne euch. Ich … ich komm einfach nicht klar.«
Als wartete ich auf eine Antwort, starre ich wie gebannt in den schwarzen Himmel.
Natürlich passiert nichts. Kein Zeichen. Keine Sternschnuppe oder eine innere Stimme, die zu mir spricht.
Ich bin allein.
»Ich wünschte, ihr wärt hier«, forme ich meine Gedanken zu Worten. »Es ist so ätzend, allein zu sein. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich brauche euch doch.« Stöhnend schiebe ich mir die Haare hinter die Ohren. »Ich brauche euch doch«, wiederhole ich. Dieses Mal nur noch flüsternd.
Langsam senke ich den Kopf und wende den Blick vom schwarzen Nachthimmel ab.
Im gleichen Augenblick geht das Licht in der Küche an, und ich zucke zusammen.
Scheiße.
Shawna und Jeff brauche ich ganz sicher nicht.
So schnell es geht, tapse ich über das feuchte Gras und flitze zurück ins Poolhaus. Blitzschnell schließe ich die Tür hinter mir und ziehe die Gardinen zu.
Doch anstatt mich wieder ins Bett zu verkriechen, bleibe ich mitten im Raum stehen und sehe mich um. Meine Koffer stehen noch immer neben den bunten Retrosesseln, und das hübsch drapierte Obst auf der Küchentheke wird langsam braun.
»Okay«, flüstere ich vor mich hin. Mir ist klar, dass ich mich nicht ewig verstecken kann. Also gehe ich seufzend zu meinem Gepäck. »Ich verspreche, ich versuche es.«
Als Erstes wäre eine Dusche vielleicht ganz angebracht.
»Wow!« Nachdem ich zwanzig Minuten lang genossen habe, wie der breite Regenschauerstrahl meine Schultern massierte, wage ich es zum ersten Mal, mein Spiegelbild anzusehen. »Du siehst beschissen aus, Cunningham.« Keine Ahnung, woher die neue Anwandlung kommt, Selbstgespräche zu führen, aber es tut gut, meine Stimme zu benutzen. »Morgen wirst du dich zusammenreißen, deine Augenringe mit Make-up abdecken und dieses Haus verlassen.«
Die Wucht der Erkenntnis, dass ich mich anhöre wie meine Mom, trifft mich so hart, dass ich mich am Rand des Waschbeckens festhalten muss. Aber es ist so. Genau das würde sie zu mir sagen. Sie würde ihre Arme um mich schlingen und mit gespielt strenger Stimme fordern, dass ich die Sache in die Hand nehmen muss, wenn ich will, dass es erträglicher wird. Meine Mom war eine ewige Optimistin.
Es ist das erste Mal, seit sie tot sind, dass ich etwas empfinde, das im Entferntesten mit Motivation zu vergleichen ist. Allerdings ist es mitten in der Nacht, und ich habe keine Chance, diesen Funken gewonnener Energie umzuwandeln, deswegen schlüpfe ich in mein bodenlanges weißes Nachthemd mit den Spaghettiträgern und bürste mir die nassen Haare aus, die inzwischen beinahe bis zu meiner Hüfte reichen.
Das Bad im Poolhaus erinnert an ein schickes Hotelzimmer. Es gibt einen eingelassenen Kosmetikspiegel in der riesigen Spiegelfront über dem Waschtisch und sogar einen Föhn mit Wandhalterung, so, wie ich ihn aus dem Urlaub kenne. Es wird Ewigkeiten dauern, meine langen Haare mit diesem Ding zu trocknen, aber so groß, dass ich meine Koffer nach meinem eigenen Föhn durchsuchen will, ist meine Motivation dann doch nicht. Allein die Dusche hat gereicht, um mich vollends zu erschöpfen.
Während ich kopfüber versuche, gleichzeitig meine Haare zu trocknen und dabei meine Trauer zu zügeln und mich nicht in düsteren Gedanken zu verlieren, höre ich über das Brummen des Geräts immer wieder Grölen und Gelächter. Es klingt so nah, dass ich das Monstrum schließlich ausschalte und lausche. Die Stimmen kommen definitiv vom Pool, denn immer wieder höre ich lautes Klatschen des Wassers und Schreie, die dieses ankündigen.
Zögerlich strecke ich meinen Kopf aus dem Bad, aber die Gardinen behindern mir die klare Sicht, was hoffentlich für beide Richtungen der Fall ist. Neugierig schleiche ich auf Zehenspitzen hinüber zum Bett und schiebe die Vorhänge etwas zur Seite.
Tausende von E-Books und Hörbücher
Ihre Zahl wächst ständig und Sie haben eine Fixpreisgarantie.
Sie haben über uns geschrieben: