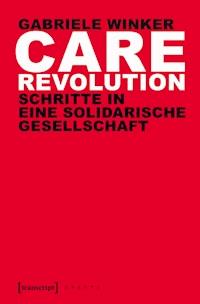
10,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: transcript Verlag
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Serie: X-Texte zu Kultur und Gesellschaft
- Sprache: Deutsch
Viele Menschen geraten beim Versuch, gut für sich und andere zu sorgen, an die Grenzen ihrer Kräfte. Was als individuelles Versagen gegenüber den alltäglichen Anforderungen erscheint, ist jedoch Folge einer neoliberalen Krisenbearbeitung. Notwendig ist daher ein grundlegender Perspektivenwechsel – nicht weniger als eine Care Revolution.
Gabriele Winker entwickelt Schritte in eine solidarische Gesellschaft, die nicht mehr Profitmaximierung, sondern menschliche Bedürfnisse und insbesondere die Sorge umeinander ins Zentrum stellt. Ziel ist eine Welt, in der sich Menschen nicht mehr als Konkurrent_innen gegenüberstehen, sondern ihr je individuelles Leben gemeinschaftlich gestalten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 287
Veröffentlichungsjahr: 2015
Ähnliche
Viele Menschen geraten beim Versuch, gut für sich und andere zu sorgen, an die Grenzen ihrer Kräfte. Was als individuelles Versagen gegenüber den alltäglichen Anforderungen erscheint, ist jedoch Folge einer neoliberalen Krisenbearbeitung. Notwendig ist daher ein grundlegender Perspektivenwechsel – nicht weniger als eine Care Revolution.
Gabriele Winker entwickelt Schritte in eine solidarische Gesellschaft, die nicht mehr Profitmaximierung, sondern menschliche Bedürfnisse und insbesondere die Sorge umeinander ins Zentrum stellt. Ziel ist eine Welt, in der sich Menschen nicht mehr als Konkurrent_innen gegenüberstehen, sondern ihr je individuelles Leben gemeinschaftlich gestalten.
Gabriele Winker (Prof. Dr.) lehrt und forscht an der TU Hamburg-Harburg und ist Mitbegründerin des Feministischen Instituts Hamburg.
www.tuhh.de/agentec/winker/ikf.ch
Gabriele Winker
Care Revolution
Schritte in eine solidarische Gesellschaft
Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar.
eBook transcript Verlag, Bielefeld 2015
© transcript Verlag, Bielefeld 2015
Die Verwertung der Texte und Bilder ist ohne Zustimmung des Verlages urheberrechtswidrig und strafbar. Das gilt auch für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und für die Verarbeitung mit elektronischen Systemen.
Covergestaltung: Kordula Röckenhaus, Bielefeld
Konvertierung: Michael Rauscher, Bielefeld
Print-ISBN: 978-3-8376-3040-4
PDF-ISBN: 978-3-8394-3040-8
ePUB-ISBN: 978-3-7328-3040-4
http://www.transcript-verlag.de
Inhalt
Vorwort
1 Einleitung
2 Unzureichende Ressourcen für Care-Arbeit
2.1 Zwei Begriffe für sorgende Arbeit
2.2 Von Familienernährern und Hausfrauen zu Arbeitskraftmanager_innen
2.3 Mangelnde staatliche Unterstützung für Care-Arbeitende
2.4 Strategische Entthematisierung von Care-Arbeit
3 Zeitnot und Existenzunsicherheit bei Care-Arbeitenden
3.1 Differenzierte familiäre Strategien
3.2 Belastende Arbeitsbedingungen in Care-Berufen
3.3 Erschöpfte Sorgearbeitende
4 Krise sozialer Reproduktion
4.1 Kapitalismusanalyse aus intersektionaler Perspektive
4.2 Kostenreduktion als Reaktion auf die Überakkumulationskrise
4.3 Facetten der Krise sozialer Reproduktion
4.4 Krise sozialer Reproduktion als Moment der Überakkumulationskrise
5 Auf dem Weg zu einer Care-Bewegung
5.1 Care-Initiativen zwischen Reformforderungen und grundlegender Gesellschaftskritik
5.2 Chancen solidarischen Handelns
6 Care Revolution als Transformationsstrategie
6.1 Das Konzept der Care Revolution
6.2 Schritte in eine solidarische Gesellschaft
7 Ausblick
Literatur
Tabellen
Vorwort
Sorgearbeit, meist von Frauen geleistet und häufig nicht entlohnt, nimmt als Thema meiner wissenschaftlichen und politischen Tätigkeit seit vielen Jahren einen großen Raum ein. Mir geht es darum, ihre Organisation im Kapitalismus und die damit verbundenen sozialen Ungleichheiten zu verstehen und zu benennen. Dabei wird mir immer klarer, dass gerade in Zeiten der neoliberalen Individualisierung jegliche politische Initiative Menschen als soziale Wesen mit ihren Bedürfnissen nach Kooperation, Unterstützung oder Zuwendung ernst zu nehmen hat. Entsprechend stelle ich den Wunsch, für sich und andere zu sorgen und selbst Sorge zu erfahren, ins Zentrum meines Transformationsvorschlags. Meine Hoffnung ist, dass sich in diesem Konzept der Care Revolution viele Sorgearbeitende treffen und gemeinsam Schritte gehen können. Daraus kann sich die konkrete Utopie einer solidarischen Gesellschaft entwickeln, mit sicherlich spannenden und überraschenden Wendungen.
Mir ist es wichtig, die Ergebnisse meiner wissenschaftlichen Arbeit und meiner politischen Erfahrungen noch umfassender zur Diskussion zu stellen; deswegen habe ich sie in diesem Buch zusammengefasst. Dieses Buch wäre allerdings nie zustande gekommen ohne all die vielen Freund_innen, Kolleg_innen, Mitstreiter_innen, welche die Idee der Care Revolution positiv aufgenommen, weitergedacht und vor allem Schritte in diese Richtung unternommen haben. Insbesondere bei der Vorbereitung und Durchführung der Aktionskonferenz Care Revolution im März 2014 und der daran anschließenden Gründung des bundesweiten Netzwerkes Care Revolution habe ich viel gelernt. Mit zahlreichen engagierten Menschen durfte ich zusammen debattieren, streiten, demonstrieren und träumen. Dabei habe ich viel konstruktive Kritik und Ermutigung erfahren.
Alle, die mein Denken und Handeln maßgeblich beeinflusst haben, kann ich hier nicht aufzählen. Stellvertretend nenne ich einige der vielen Menschen, mit denen ich in regelmäßigem Austausch meine feministisch-marxistischen Überlegungen zu einem an Care orientierten Weg in eine solidarische Gesellschaft schärfen konnte. Ich danke in diesem Sinn herzlich: Alexandra Wischnewski, Anja Ann Wiesental, Anna Köster-Eiserfunke, Arnold Schnittger, Barbara Fried, Jette Hausotter, Jutta Meyer-Siebert, Kathrin Ganz, Kathrin Schrader, Mario Candeias, Martin Winker, Melanie Groß, Stefan Paulus, Tanja Carstensen, Veronika Steidl, Wibke Derboven und selbstverständlich auch all den vielen hier nicht namentlich genannten Care-Revolutionär_innen. Besonders danken möchte ich meinem Freund und Lektor, Matthias Neumann, der auch die Internetrecherche zur Darstellung einzelner Care-Initiativen in Kapitel 5 durchgeführt hat und mich mit kritisch-solidarischen Hinweisen immer wieder zum Weiterdenken und Weiterschreiben angeregt hat. Ohne die Inspiration all dieser Aktivist_innen hätte ich dieses Projekt nicht zu Ende gebracht. Ich hoffe sehr, dass es zu Diskussionen und politischem Handeln voller Energie anregt. Auf die Care Revolution!
Gabriele Winker im Januar 2015
1 Einleitung
In der Bundesrepublik Deutschland, einem der reichsten Länder der Welt, werden Jahr für Jahr mehr Güter und Dienstleistungen produziert. Dies illustrieren die Wachstumsraten des Bruttoinlandsprodukts. Gleichzeitig nehmen Armut und prekäre Lebensverhältnisse zu. Gründe dafür sind Teilzeitbeschäftigungen, Niedriglöhne, Zeiten der Erwerbslosigkeit und in der Folge unzureichende Renten. Während nach wie vor viele Menschen von Erwerbslosigkeit betroffen sind, arbeiten Beschäftigte immer intensiver und – wenn in Vollzeit tätig – auch länger. Bei der oft ergebnislosen Suche nach einem Arbeitsplatz oder im Bemühen, den Anforderungen der Berufsarbeit gerecht zu werden, verlieren sich viele Menschen in Stress und Hektik. Die resultierende Zeitnot gefährdet zunehmend die Qualität sozialer Beziehungen. Jede_r Einzelne ist damit beschäftigt, sich selbst über Wasser zu halten.
Das Wirtschaftswachstum geht nicht mit einer Erhöhung der gesamtgesellschaftlichen Lebensqualität einher, sondern mit einer zunehmend ungleichen Verteilung und damit einer verschärften Polarisierung zwischen reich und arm. Dies führt zu massiven Problemen für die große Mehrheit der Menschen: Wegen des Mangels an zeitlichen und materiellen Ressourcen werden viele den hohen Anforderungen etwa an lebenslange Qualifizierung oder körperliche Fitness nicht gerecht. Sie hasten im alltäglichen Hamsterrad und sehen keine Möglichkeit zum Absprung; in der Folge kommt die Sorge für sich selbst zu kurz.
Besondere Belastungen und Überforderungen erleben Menschen, die Sorgearbeit für andere Personen übernehmen. Entweder reduzieren sie wegen der Sorgeverpflichtungen ihre Erwerbsarbeitszeit und finden sich aktuell oder in Zukunft in einer prekären Lebenslage wieder oder aber sie leben mit einer hohen Doppelbelastung und dem dauernden Gefühl, den Anforderungen nicht gerecht zu werden, auch wenn sie selbst bis an ihre physischen und psychischen Grenzen gehen. So werden Kindererziehung und Unterstützung pflegebedürftiger Angehöriger oder Freund_innen zu einem Balanceakt, der immer wieder scheitert. Verschärfend kommt in dieser Situation hinzu, dass sozialstaatliche Unterstützungsleistungen im Gesundheits- oder Bildungssystem ab- statt ausgebaut werden. Arbeit ohne Ende wird somit zur alltäglichen Realität. Muße ist zum Fremdwort geworden. So wird in diesem Prozess profitgeleiteten Wachstums nicht nur, wie allgemein wahrgenommen, das Ökosystem der Erde zerstört, sondern gleichzeitig der Mensch.
Die Unzufriedenheit mit diesen und vielen anderen alltäglichen Bedrängungen ist groß. Gleichzeitig nimmt eine Mehrheit der Bevölkerung ihre Lebensumstände, in denen sie sich zurechtfinden muss, als nicht veränderbar hin. Eine Verbesserung erscheint nur möglich, indem jede_r sich selbst eine bessere Nische erkämpft. Dies hängt in hohem Maß damit zusammen, dass beinahe flächendeckend das neoliberale Credo wirkt: Jede Person ist für ihr eigenes Leben selbst verantwortlich; niemand darf sich in der sogenannten Hängematte eines stark ausgedünnten Sozialsystems ausruhen. Von jeder Person wird Leistung im Beruf, aber auch in der Ausbildung, im Studium, in der Schule, ja bereits im Kindergarten erwartet. Wer diesen Leistungswahn nicht mitmachen will oder kann, verliert den Anschluss. Selbst schuld, ist ein häufiger Kommentar der Durchsetzungsfähigen und -willigen.
Dabei wird oft übersehen, dass diese bedrückende Entwicklung nicht diejenigen hervorbringen, die unter ihr leiden. Vielmehr liegt dieser Situation ein System zugrunde, das bewusst in Frage gestellt werden muss, soll sich tatsächlich etwas ändern. In einer kapitalistischen Gesellschaft wird nur dort investiert und gegen Lohn gearbeitet, wo Profite erwartet werden. Sorgetätigkeiten sind meist nicht gewinnträchtig, sondern stellen einen Kostenfaktor dar, den es aus kapitalistischer Sicht zu minimieren gilt. Die staatliche Daseinsvorsorge wird in der gegenwärtigen Krisensituation den steigenden Anforderungen immer weniger gerecht. Die entstehende Lücke wird durch unbezahlte Arbeit insbesondere von Frauen in Familien gefüllt. So lassen sich Lohnkosten und Staatsausgaben begrenzen, was direkt oder indirekt den Profit erhöht.
Dieses Primat der Kapitalverwertung zeigt sich auch im Umgang des Staates mit Migrant_innen. Innerhalb der Europäischen Union sind Freizügigkeit und Zugang zum Arbeitsmarkt garantiert, nicht allerdings der Zugang zur Grundsicherung. Die von außerhalb der EU nach Deutschland migrierenden Menschen werden eingesetzt, wenn sie als Fachkräfte gut ausgebildet oder im Niedriglohnbereich noch günstiger als die einheimische Bevölkerung sind. Ansonsten werden sie aus der BRD ausgewiesen beziehungsweise bereits an den Grenzen der EU abgewiesen.
Doch wie lässt sich diese Situation beeinflussen oder grundlegend verändern? Viele Menschen sind resigniert. Täglich wird über die Massenmedien vermittelt, dass es zu dieser Form des Wirtschaftens keine Alternative gebe. So scheint in der BRD eine Art gesamtgesellschaftlicher Depression vorzuherrschen: Das erlebte soziale Leid nimmt zu, aber positive Einflussnahme und Gegensteuern scheinen nicht möglich zu sein. Es fehlt weitgehend die Vorstellung, dass Menschen grundsätzlich auf ihre Lebensbedingungen Einfluss nehmen können, es sei denn durch Selbstoptimierung und bestmögliche Anpassung.
Gleichzeitig wächst allerdings das Bewusstsein, dass in der heutigen Gesellschaft etwas grundlegend nicht stimmt. Im Rahmen des kapitalistischen Systems lassen sich schon lange viele menschliche Bedürfnisse nicht befriedigen. Insbesondere in den Bereichen von Erziehung und Bildung sowie von Gesundheit und Pflege sind die Mängel offensichtlich. So gibt es durchaus an vielen Orten Menschen, die sich im Kleinen gegen die Hindernisse wehren, die ihnen bei der Bewältigung ihres Alltags in den Weg gelegt werden. Zahlreiche Initiativen auch in der BRD setzen sich bereits für bessere Kinderbetreuung, für qualitativ hochwertige soziale Infrastruktur, für existenzielle Absicherung aller Menschen ein, insbesondere auch von Familien mit Kindern oder unterstützungsbedürftigen Angehörigen, von chronisch Kranken oder Geflüchteten. Notwendig ist allerdings, dass diese vielfältigen sozialen Initiativen, die als Reaktion auf Missstände und soziales Leid im Alltag entstehen, an politischer Kraft gewinnen, indem sie sich gegenseitig wahrnehmen, sich zusammenschließen und damit sichtbarer werden. In einer solchen Care-Bewegung, die grundlegende Bedürfnisse von Menschen ins Zentrum sozialer Auseinandersetzungen stellt, können sich wichtige Ansatzpunkte für Gesellschaftsveränderung entwickeln.
Das vorliegende Buch wendet sich gegen das neoliberale Credo und die dahinter stehenden gesellschaftlichen Strukturen, indem es einen einfachen Gedankengang als Grundlage nimmt: Jeder Mensch hat das Recht auf ein erfülltes Leben, ein gutes Leben. Eine Gesellschaft muss sich daran messen lassen, ob sie in der Lage ist, die Bedingungen hierfür zu gewährleisten. Ist dies für die große Mehrheit der Bevölkerung nicht der Fall, obwohl die Möglichkeit bestünde, steht dieses System in Frage.
In dieser Situation gilt, was Rosa Luxemburg 1918 sagt: „Die revolutionäre Tat ist stets, auszusprechen das, was ist.“ (Luxemburg 2000: 462) In diesem Sinn möchte ich hier einiges von dem, was Menschen in Hinblick auf Care in der BRD erfahren, zur Sprache bringen und analysieren. Ferner setze ich mich im Folgenden damit auseinander, warum diese Entwicklung so ist, wie sie ist, worin also die Gründe für die Einschränkungen in den alltäglichen Lebensbedingungen liegen. Gleichzeitig gehe ich auf die Suche nach Handlungsmöglichkeiten. Es geht mir darum, Wege zu einer Organisation des Zusammenlebens zu skizzieren, in der die gesellschaftlichen Entscheidungen nicht mehr an Macht, Einflusssphären, Konkurrenz und Gewinnmaximierung orientiert sind, sondern an dem Ziel, allen Menschen ein gutes Leben zu ermöglichen. Ich möchte darstellen, wie eine solche Gesellschaft im solidarischen politischen Handeln in der Familie, im Beruf, am Wohnort sowie in überregionaler und globaler Kooperation mit Leben erfüllt werden kann.
Sowohl in der Analyse als auch bei den Handlungsalternativen konzentriere ich mich auf die politisch-ökonomische Situation in der BRD. Das halte ich für erforderlich, weil die politischen und rechtlichen Rahmenbedingungen sich zwischen den Staaten stark unterscheiden. Dadurch kommen allerdings die transnationalen Zusammenhänge in der Darstellung zu kurz. Eine umfassende globale Analyse würde nicht nur den Rahmen des Buches sprengen, sondern sie ist mir derzeit auch nicht möglich.
Aus der genannten Aufgabenstellung ergibt sich für das vorliegende Buch folgender Aufbau: Zunächst beschreibe ich in Kapitel 2 die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die häufig zur mangelnden Selbstsorge und zu großen Belastungen in der Sorge für andere führen. Zu Beginn gehe ich auf die Bedeutung und den Umfang von unentlohnter und erwerbsförmiger Care-Arbeit ein. Daran anschließend analysiere ich, welche Auswirkungen veränderte ökonomische und sozialpolitische Entwicklungen auf die in Familien erbrachte Reproduktionsarbeit haben. Es wird deutlich, dass heute Sorgearbeit weiterhin möglichst kostengünstig in Privathaushalten primär von Frauen geleistet wird. Alle Personen haben jedoch gleichzeitig die Aufgabe, je individuell über Erwerbsarbeit ihre Existenz zu sichern. Ferner erläutere ich, wie Familien-, Pflege- und Sozialpolitik konsequent neoliberal ausgerichtet sind. Somit ist die Unterstützung von Care-Arbeitenden derzeit kein Ziel staatlichen Handelns, sondern Mittel zum Zweck der Wirtschaftspolitik. Abschließend begründe ich, dass eine entscheidende Voraussetzung für dieses Vorgehen ist, dass Reproduktionsarbeit als notwendige Tätigkeit, die Zeit benötigt, nicht thematisiert wird.
In der Folge gehe ich in Kapitel 3 darauf ein, wie in dieser schwierigen Situation familiäre Care-Arbeitende je nach ihren finanziellen Ressourcen und je nach dem Ausmaß der Sorgeverpflichtungen unterschiedlich reagieren. Dabei zeigt sich, dass alle familiären Handlungsstrategien mit großen Belastungen für Sorgearbeitende verbunden sind und in keiner Weise das Kriterium guter Sorge und Selbstsorge für alle Beteiligten erfüllen. Daran anschließend stelle ich die Arbeitsbedingungen im entlohnten Care-Bereich dar, wo beispielsweise Erzieher_innen, Pflegekräfte oder Haushaltsarbeiter_innen bei geringem Lohn und in teilweise sozial nicht abgesicherten Beschäftigungsverhältnissen gesellschaftlich notwendige Care-Arbeit leisten und, vergleichbar mit der Situation Sorgearbeitender in Familien, grundlegend unter Überlastung leiden.
In Kapitel 4 erläutere ich, dass die Überforderungen in der Sorge und Selbstsorge nicht auf massenhaftem individuellem Versagen beruhen, sondern in der Logik des kapitalistischen Systems begründet sind. Es wird deutlich, warum es unter dieser Voraussetzung nicht gelingen kann, ein gesellschaftliches Zusammenleben zu realisieren, das es allen Menschen ermöglicht, sich zu bilden und zu entwickeln, sozialen Aufgaben wie der Kindererziehung ohne Existenzsorgen nachzugehen und auch als kranke oder gesundheitlich eingeschränkte Menschen eine optimale Versorgung zu erhalten. Dies gilt gegenwärtig in ganz besonderem Maß, da sich die Ökonomie weltweit in einer Krise befindet. Der Versuch, in der Folge die Staatsausgaben zu begrenzen, beschränkt die Mittel, die für die soziale Infrastruktur notwendig sind. Diese Entwicklung hat ein Ausmaß erreicht, bei dem die Reproduktion der Arbeitskraft selbst leidet. Deswegen beeinträchtigt diese kostensenkende Politik wiederum die Verwertung des Kapitals, denn Unternehmen benötigen flexible, gesunde, qualifizierte, motivierte Fachkräfte. Diese Entwicklung bezeichne ich als Krise sozialer Reproduktion.
Diese Krise sozialer Reproduktion verschlechtert die Arbeits- und Lebensbedingungen vieler Menschen. Gleichzeitig gibt es bereits eine Vielzahl von Initiativen in Care-Bereichen, die sich dagegen zur Wehr setzen. In Kapitel 5 gehe ich am Beispiel von neun Initiativen auf deren Ziele, Themen und Aktionen ein. Ich zeige, dass sie mit verschiedenartigen Handlungsstrategien unterschiedliche Ziele verfolgen, aber auch grundsätzliche Gemeinsamkeiten haben. So orientieren sich die Gruppen und Organisationen an den Bedürfnissen sowohl der Sorgearbeitenden als auch der Menschen, die umsorgt werden. Menschliche Würde ist hierbei ein zentraler Begriff. Indem sie sich aufeinander beziehen und punktuell zusammenarbeiten, können diese Initiativen sichtbarer und politisch handlungsmächtiger werden.
Als Konsequenz meiner Analyse plädiere ich in Kapitel 6 für einen Perspektivenwechsel. Mit dem Begriff der Care Revolution bezeichne ich eine Transformationsstrategie, die zeitliche und materielle Ressourcen für Selbstsorge und Sorge für andere und damit menschliche Bedürfnisse konsequent ins Zentrum der Politik stellt. Ich erläutere einzelne Schritte einer solchen Care Revolution. Dabei geht es darum, dass alle Menschen die Möglichkeit erhalten, ihre Bedürfnisse zu befriedigen und ihre Fähigkeiten in vielen Lebensbereichen jenseits des dominanten Leistungsprinzips zu entfalten. Dieses Ziel einer solidarischen Gesellschaft skizziere ich als konkrete Utopie, die sich auf jetzt schon vorhandene Möglichkeiten und reale Akteur_innen bezieht. Die Überlegungen, die ich hier entwickle, sind als Anregung für weiterführende Diskussionen gedacht.
Das Buch endet in Kapitel 7 mit einem Ausblick, in dem ich die Ergebnisse kurz zusammenfasse. Dabei wird deutlich, dass der krisenhafte Kapitalismus selbst die Systemfrage und den Übergang in eine solidarische Gesellschaft auf die Agenda setzt, indem er unfähig ist, die Befriedigung grundlegender menschlicher Bedürfnisse zu ermöglichen. Auch wenn das Erreichen dieses Ziels massive soziale Auseinandersetzungen voraussetzt, gibt es heute bereits vielfältige Aktivitäten, in denen Aktivist_innen sich gegenseitig solidarisch unterstützen und politische Erfolge erzielen. Gerade weil das alltägliche Leben voller Belastungen, Überforderungen und Existenznöte ist, möchte das Buch mit der Transformationsstrategie einer Care Revolution und dem Ziel einer solidarischen Gesellschaft Mut machen und vermitteln, dass es sich gut anfühlen kann, sich als Care Revolutionär_in gemeinsam mit anderen auf den Weg zu machen.
2 Unzureichende Ressourcen für Care-Arbeit
In diesem Kapitel beschäftige ich mich mit dem Stellenwert von Care-Arbeit beziehungsweise Sorgearbeit. Diese beiden Begriffe verwende ich synonym. Sorgearbeit ist eine Tätigkeit, die jede Person ausführt. Menschen kochen, erziehen Kinder, beraten Freund_innen, versorgen unterstützungsbedürftige Angehörige. Viele Menschen sind in diesem Bereich auch berufstätig, beispielsweise als Haushaltsarbeiter_in, Pflegekraft, Erzieher_in, Lehrer_in oder Sozialarbeiter_in. Gleichzeitig wird diese Sorgearbeit in der heutigen Gesellschaft primär von Frauen geleistet, abgewertet, nicht ausreichend unterstützt und schlecht entlohnt. Im Folgenden geht es mir darum, die Gründe hierfür darzulegen.
Um mich der Besonderheit und dem gesellschaftlichen Stellenwert von Care-Arbeit anzunähern, nehme ich in Abschnitt 2.1 zunächst eine Begriffsbestimmung vor: Ich halte eine Abgrenzung von Care-Arbeit und Reproduktionsarbeit für sinnvoll und plädiere daher für die Verwendung beider Begriffe in ihrer jeweiligen Besonderheit. In Abschnitt 2.2 verdeutliche ich, wie sich die Rahmenbedingungen für die zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendige Arbeit, die in Familien getätigt wird, in den letzten 40 Jahren entscheidend verändert haben. Dies hat zu enormen Belastungen für familiäre Sorgearbeitende geführt. Daran anschließend zeige ich in Abschnitt 2.3, dass die neoliberale Familien- und Pflegepolitik der Problematik von fehlender Zeit und unzureichender finanzieller Unterstützung für Sorgearbeit nicht entgegenwirkt, sondern diese durch ihre Kostensenkungspolitik verschärft. Gleichzeitig verschlechtern sich dadurch auch die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten im Care-Bereich. In Abschnitt 2.4 komme ich zu der Feststellung, dass in der bundesdeutschen Gesellschaft Care-Arbeit systematisch entthematisiert und abgewertet wird, auch wenn sie für alle Menschen lebensnotwendig und für die Aufrechterhaltung des kapitalistischen Systems grundlegend ist.
2.1 Zwei Begriffe für sorgende Arbeit
Obwohl Menschen auf Sorgearbeit existenziell angewiesen sind, fehlt eine präzise Begriffsbestimmung dieser Arbeit. Zwar beinhaltet Arbeit grundsätzlich alle Tätigkeiten zum Zweck der Existenzsicherung (McDowell 2009), dennoch wird im Alltagssprachgebrauch Arbeit meist mit entlohnter Arbeit gleichgesetzt. Damit verschwindet die unentlohnte Sorgearbeit aus dem Bewusstsein, wird unreflektiert zur Freizeit gerechnet und bleibt damit unsichtbar.
Auch innerhalb sozialer Bewegungen gibt es zwei Probleme mit der Begriffsbestimmung. Erstens wird problematisiert, ob überhaupt einer der Begriffe – Reproduktionsarbeit und Care-Arbeit – dafür taugt, politisch gegen die Abwertung von sorgenden Tätigkeiten in Familien und in Care-Berufen einzutreten, da beide Begriffe unverständlich seien. Auch der Begriff Sorgearbeit wird für nicht geeignet gehalten. Dahinter steht das oben beschriebene Problem, dass nicht entlohnte Sorgearbeit in der Regel überhaupt nicht benannt wird und es deswegen ungewohnt ist, von den alltäglichen sorgenden Tätigkeiten als Arbeit zu sprechen. Ich halte es daher bereits für einen wertvollen politischen Schritt, sich die Begriffe Care- oder Sorgearbeit sowie Reproduktionsarbeit anzueignen. Nur auf diese Weise lässt sich Sorgetätigkeit als notwendige Arbeit ins Zentrum politischer Diskussionen holen.
Zweitens wird häufig anhand der Entscheidung für einen der beiden Begriffe, Reproduktionsarbeit oder Care-Arbeit, versucht, politische Abgrenzungen deutlich zu machen, da mit dem jeweiligen Begriff bestimmte konkrete Inhalte verbunden seien. Diese Einordnung von Sprechenden oder Schreibenden über die Benutzung oder Nicht-Benutzung von Begriffen verhindert allerdings den gerade erst beginnenden Prozess der vertieften Auseinandersetzung mit einem sehr großen Lebensbereich. Das sind die beiden Gründe, warum ich zu Beginn eine differenzierte Begriffsbestimmung vorlege. Diese soll das Lesen im weiteren Verlauf erleichtern und klärt hoffentlich, warum es durchaus sinnvoll sein kann, beide Begriffe zu verwenden, um auf diese Weise differenzierter argumentieren zu können.
Lange bevor sich, verstärkt seit der Jahrtausendwende, in der BRD der Begriff der Care-Arbeit eingebürgert hat, wurde der Begriff Reproduktionsarbeit verwendet. Dieser ist im Rahmen der zweiten Frauenbewegung entstanden und wurde damals vor allem von marxistisch orientierten Feminist_innen benutzt. Wie ich im Folgenden ausführen werde, verstehe ich unter Reproduktionsarbeit als Gegenstück zur Lohnarbeit die unentlohnte Arbeit, meist in familiären Zusammenhängen und von Frauen ausgeführt, die für die Reproduktion der Arbeitskraft notwendig ist. Der Begriff der Reproduktionsarbeit unterscheidet somit die unentlohnte Haus- und Sorgearbeit von der Lohnarbeit und fokussiert auf die Form und Funktion dieser Arbeit im Kapitalismus. Der Begriff Care-Arbeit nimmt dagegen die Arbeitsinhalte in den Blick und bezeichnet die konkreten Sorgetätigkeiten, also das Erziehen, das Pflegen, das Betreuen, das Lehren, das Beraten. Diese Care-Arbeit kann unentlohnt in Familien oder auch in Vereinen oder Initiativen erbracht werden. Sie kann aber auch entlohnt in staatlichen Institutionen, in Einrichtungen von sogenannten Wohlfahrtsverbänden oder in privatwirtschaftlichen Unternehmen stattfinden. Da Care-Arbeit auf die arbeitsinhaltliche Seite von sorgenden Tätigkeiten verweist, hat sie auch in der Diskussion grundlegender menschlicher Bedürfnisse und des Entwurfs einer Gesellschaft, die an diesen Bedürfnissen orientiert ist, einen zentralen Stellenwert. Deswegen spreche ich auch von Care Revolution.
Im Folgenden vertiefe ich die Differenzierung der beiden Begriffe – Reproduktionsarbeit und Care-Arbeit –, um im weiteren Verlauf der Argumentation verdeutlichen zu können, mit welcher Perspektive ich jeweils auf Arbeit in Familien und Care-Berufen schaue.
2.1.1 Zum Begriff Reproduktionsarbeit
Die zweite Frauenbewegung sowie die Frauen- und Geschlechterforschung kritisieren seit fast einem halben Jahrhundert mit Nachdruck die Engführung des Arbeitsbegriffs als Erwerbsarbeit und machen deutlich, wie unverzichtbar für das gesellschaftliche Wohlergehen die unbezahlte Haus- und Sorgearbeit ist (u.a. Bock/Duden 1977, Kontos/Walser 1979). In den 1970er Jahren wurde für diese unbezahlten Tätigkeiten in Familien von feministisch-marxistischer Seite der Begriff Reproduktionsarbeit eingeführt. Darunter werden Tätigkeiten jenseits der Lohnarbeit (oder einer anderen Erwerbsarbeit) gefasst, die zur Erhaltung der menschlichen Arbeitskraft notwendig sind (Notz 2010). Die Untersuchung von Silvia Kontos und Karin Walser (1979: 19) „geht aus von der allgemeinen gesellschaftlichen Funktion der familialen Hausfrauenarbeit als der immer noch zentralen Institution zur Reproduktion menschlicher Arbeitskraft und begreift die Hausarbeit dementsprechend als eine Einheit von materiellen und psychischen Reproduktionsleistungen“.
Daran anschließend verstehe ich unter Reproduktionsarbeit die unter den jeweiligen kapitalistischen Bedingungen zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendigen Tätigkeiten, die nicht warenförmig, sondern ausschließlich gebrauchswertorientiert in familialen und zivilgesellschaftlichen Bereichen geleistet werden. Diese umfassen vor allem die Ernährung, Erziehung und Bildung von Kindern und Jugendlichen als neuer Generation von Arbeitskräften sowie die Reproduktion der eigenen Arbeitsfähigkeit und auch Unterstützungsleistungen zur Reproduktion der Arbeitsfähigkeit anderer Erwerbspersonen. Reproduktionsarbeit im breiten Sinn fokussiert dabei nicht nur auf die Wiederherstellung von Arbeitskraft, sondern bezieht das Wohlbefinden unterstützungsbedürftiger Menschen und damit auch die Versorgung ehemaliger Arbeitskräfte ein. Dies halte ich deswegen für angemessen, weil sich der Einbezug alter und kranker Menschen in den Arbeitsmarkt historisch verändert. Derzeit wird beispielsweise das Rentenalter erhöht, der Zugang zur Erwerbsminderungsrente erschwert und die Rentenbezüge so gekürzt, dass Rentner_innen zur Absicherung ihrer Existenz auch im hohen Alter erwerbstätig sein müssen. Ebenso wird über das Versprechen, die Existenz ehemaliger Arbeitskräfte abzusichern, das kapitalistische System politisch stabilisiert.
Zu betonen ist, dass Reproduktionsarbeit in dieser Definition nicht nur die Sorgearbeit für andere umfasst, sondern auch all das, was eine Person tut, um sich selbst zu versorgen und immer wieder neu zu stabilisieren, so dass sie leistungsfähig bleibt und sich als Arbeitskraft verkaufen kann. Demgemäß gehört Selbstsorge, also die Sorgearbeit für sich selbst, zur Reproduktionsarbeit, was auch Kerstin Jürgens (2006) mit Nachdruck betont. „Bliebe diese Leistung [der Selbstsorge – GW] aus, würde nicht nur die Nutzung von Arbeitskraft, sondern auch die Person insgesamt scheitern.“ (Heiden/Jürgens 2013: 18)
Dem Begriff der Arbeit – sei es Lohn- oder Reproduktionsarbeit – stelle ich in Anlehnung an das von Karl Marx konzipierte „Reich der Freiheit“ (MEW 25: 828) den Begriff der Muße gegenüber. Arbeit bestimme ich als zielbezogene und zweckgerichtete Tätigkeit zur Existenzsicherung – unmittelbar oder mittelbar als Bestandteil der gesellschaftlichen Produktion von Gütern und Dienstleistungen. Dagegen verstehe ich unter Muße Tätigkeiten, die nicht durch eine äußere Zweckmäßigkeit, sondern aus sich heraus motiviert sind und als Selbstzweck ausgeführt werden.
Inwiefern eine Person Tätigkeiten der Selbstsorge – Mahlzeiten zubereiten, Sport treiben, sich weiterbilden – als Selbstzweck oder für die Aufrechterhaltung des Arbeitsvermögens für einen Arbeitsplatz oder Beruf betreibt, ist weder allgemein-gesellschaftlich noch für das einzelne persönliche Leben klar zu beantworten. Die vorgenommene Trennung ist eher analytischer Natur: Steht im Vordergrund einer Tätigkeit die Aufrechterhaltung der eigenen Arbeitskraft, so verstehe ich dies als Selbstsorge beziehungsweise Sorgearbeit für sich selbst. Steht im Vordergrund, dass die Tätigkeit nicht von dieser Leistungsanforderung bestimmt ist und tatsächlich als Selbstzweck ausgeübt wird, benenne ich dies als Muße.
Der Umfang der Reproduktionsarbeit betrug in der BRD im Jahre 2001 mit einem Gesamtvolumen von 96 Mrd. Stunden das 1,7-fache der insgesamt 56 Mrd. Stunden Erwerbsarbeit (BMFSFJ/Statistisches Bundesamt 2003: 11).[1] Diese Arbeiten wurden zu 61% von Frauen erbracht (ebd.: 9). Das hier genannte Ausmaß der Reproduktionsarbeit unterschätzt den tatsächlichen Umfang, da sich diese Studie auf Haus- und Sorgearbeit im engeren Sinn konzentriert; viele Aufgaben im Bereich der Bildung und der Gesundheit sind nicht erfasst. So werden Haus- und Gartenarbeit, Kochen und Spülen, Wohnungsreinigung, Wäsche, Tier- und Pflanzenpflege, Einkaufen und Haushaltsorganisation, Betreuung und Pflege von Kindern und von erwachsenen Haushaltsmitgliedern sowie ehrenamtliche Tätigkeiten einbezogen. Nicht einbezogen sind jedoch Tätigkeiten wie das lebenslange Lernen oder die Aufrechterhaltung der körperlichen Fitness, die immer mehr Bedeutung gewinnen, um als Lohnarbeiter_in tätig bleiben zu können.
Bei der Frage nach der Verschränkung von Lohn- und Reproduktionsarbeit ist es hilfreich, auf die arbeitswerttheoretischen Überlegungen von Marx zurückzugreifen, auch wenn er den Begriff der Reproduktionsarbeit nicht kennt. Ihm zufolge ist der Wert der Arbeitskraft gleich dem jeder anderen Ware durch die gesellschaftlich im Durchschnitt notwendige Arbeitszeit bestimmt, die zur Produktion beziehungsweise Reproduktion dieser spezifischen Ware notwendig ist (MEW 23: 184). In diesen Wert fließen nicht nur die Kosten für die Aufrechterhaltung der Arbeitskraft der Lohnarbeitenden ein, sondern auch die Reproduktionskosten für eine neue Generation (ebd.: 185f., 417). Lohnarbeitende erhalten den Wert ihrer Arbeitskraft in Form des Lohns, von dem sie sich selbst unterhalten und Kinder groß ziehen können. Der Wert der Ware Arbeitskraft und damit auch der Durchschnittslohn hängt also direkt von der Menge der Güter und Dienstleistungen ab, die Lohnarbeitende für ihre eigene Reproduktion und die von ihnen finanziell abhängiger Familienmitglieder benötigen. Dabei betont Marx, dass „die Wertbestimmung der Arbeitskraft ein historisches und moralisches Element“ enthält (ebd.: 185). Das bedeutet, dass das gesellschaftliche Kräfteverhältnis zwischen Kapitalbesitzenden und Lohnabhängigen, über das bestimmt wird, was zum gesellschaftlich anerkannten Niveau der Reproduktion gehört, in die Wertbestimmung der Arbeitskraft einfließt.
Marx betrachtet allerdings bei der Wertbestimmung der Arbeitskraft nur die Sphäre der Warenproduktion und vernachlässigt damit den Teil der zur Reproduktion der Arbeitskraft notwendigen Arbeit, der nicht entlohnt wird. Arbeiter_innen reproduzieren sich nicht nur dadurch, dass sie Waren konsumieren, die sie von ihrem Lohn kaufen, sondern auch durch all die Haus- und Sorgearbeit, die nicht entlohnt in privaten Haushalten ausgeführt wird. Feminist_innen präzisieren entsprechend das Konzept der Reproduktion der Arbeitskraft, indem sie auch die nicht entlohnte Arbeit einbeziehen, die in Familien außerhalb der Sphäre der Warenproduktion zur Reproduktion der Arbeiter_innen geleistet wird (Federici 2012). Sie weisen darauf hin, dass der jeweilige Anteil der gekauften Waren und der nicht entlohnten Haus- und Sorgearbeit an der Reproduktion der Arbeitskraft in gewissem Maß verschiebbar ist.
Im Unterschied zu jeder anderen Ware hat nun die Ware Arbeitskraft die Besonderheit, dass sie mehr Güter und Dienstleistungen produzieren kann als zu ihrer Reproduktion nötig ist. Diese Differenz, den Mehrwert, eignen sich die Produktionsmittelbesitzenden an. Daraus ergibt sich, dass es für die Verwertung des Kapitals nicht nur wichtig ist, dass Arbeitskraft reproduziert wird, sondern auch, dass diese Reproduktion möglichst günstig stattfindet. Wie dies konkret passiert – in Kleinfamilien oder in Wohngemeinschaften oder mit Unterstützung von im Haushalt zu niedrigen Löhnen Beschäftigten –, ist in der Logik des kapitalistischen Verwertungsprozesses weitgehend unbedeutend. Entscheidend ist, dass die entstehenden Reproduktionskosten die Profitrate nicht allzu sehr belasten und gleichzeitig zur Reproduktion einer Arbeitskraft führen, die hinsichtlich ihrer Qualifikation und ihrer physischen und psychischen Gesundheit in der Warenproduktion rentabel einsetzbar ist.
Mit steigender Erwerbsbeteiligung von Frauen fällt der durchschnittliche Lohn, da kein Familienlohn mehr erforderlich ist und zwei Familienmitglieder zur Deckung der Kosten des Lebensunterhalts einer Familie beitragen. Auch wenn eine solche Familie wegen fehlender Zeit für die Reproduktionsarbeit mehr Fertigwaren und Dienstleistungen kauft und damit für zwei Familienmitglieder mehr Lohn bezahlt werden muss als früher für eines, ist dies für die Verwertungsbedingungen dennoch günstig, da zwei Lohnarbeitende eine deutlich höhere Mehrarbeit liefern (MEW 23: 417). In dem Maß, in dem diese Personen neben der Erwerbstätigkeit zusätzlich unentlohnt Reproduktionsarbeit leisten, senkt dies den Wert der Arbeitskraft. Denn damit sind die Reproduktionskosten deutlich geringer als es der Fall wäre, wenn diese Arbeit entlohnt von Care-Beschäftigten realisiert würde. Zwar schafft die Reproduktionsarbeit selbst keinen Mehrwert, da die Arbeitskraft nicht warenförmig produziert wird. Sie kann aber indirekt die Höhe des Mehrwerts positiv beeinflussen, indem sie die durchschnittlichen Reproduktionskosten der Arbeitskraft verringert, weil bestimmte Waren wie beispielsweise der Nachhilfeunterricht durch ein Bildungsunternehmen, das Essen im Restaurant oder die Massage im Fitnessstudio nicht einbezogen werden müssen.
Deutlich wird, dass Lohn- und Reproduktionsarbeit strukturell aufein-ander angewiesen sind. Auch hat die jeweilige Organisationsform gesellschaftlicher Reproduktion der Arbeitskraft einen wesentlichen Einfluss auf die Kosten der Ware Arbeitskraft, also den Durchschnittslohn (vgl. auch Paulus 2013).
2.1.2 Zum Begriff Care-Arbeit
Während sich der Begriff der unentlohnten Reproduktionsarbeit als Pendant zur Lohnarbeit auf die Bedeutung familiärer Sorgetätigkeiten für die Kapitalverwertung bezieht, rücken mit der seit den 1990er Jahren international verstärkt geführten Care-Debatte die konkreten Arbeitsinhalte der Sorgetätigkeiten, deren Besonderheiten und die dafür notwendigen Kompetenzen in den Vordergrund des Interesses. Im Zentrum der Diskussion stehen dabei Tätigkeiten in der Erziehung und Bildung sowie der Gesundheit und Pflege. Care-Arbeit zielt auf die Unterstützung der Entwicklung, Wiederherstellung und Aufrechterhaltung von intellektuellen, körperlichen und emotionalen Fähigkeiten einer Person (England/Folbre 2003, England 2005). Es handelt sich bei Care-Arbeit, wie Mascha Madörin (2006: 283) zusammenfasst, „um Leben erhaltende, lebensnotwendige Tätigkeiten, ohne die Gesellschaften nicht existenzfähig wären und wirtschaftliches Wachstum unmöglich wäre“. Während an dieser Stelle in den Debatten um Reproduktionsarbeit weiter nach der ökonomischen Bedeutung der Reproduktion der Arbeitskraft in der kapitalistischen Gesellschaft gefragt wird, begnügt sich die Care-Debatte mit dem Gedanken der Aufrechterhaltung des Arbeitsvermögens.
Der Begriff Care-Arbeit ersetzt zunächst im englischsprachigen Raum in den 1990er Jahren den davor üblichen Begriff der Hausarbeit. Berenice Fisher und Joan Tronto verwenden bereits 1990 den Begriff caring work und weisen darauf hin, dass caring work eine soziale Aktivität ist, die Machtstrukturen und sozialer Ungleichheit unterworfen ist. Dabei stehen zunächst die nicht entlohnten Sorgetätigkeiten primär von Frauen in familiären Zusammenhängen im Zentrum. Nancy Folbre (1995) bezieht etwas später auch die bezahlte Care-Arbeit ein. Heute ist es weitgehend unumstritten, dass Care-Arbeit bezahlte und unbezahlte Tätigkeiten umfasst. Madörin (2007: 142) konstatiert, dass in der internationalen Fachdebatte der feministischen Ökonomie „unter Care-Tätigkeiten meistens alle unbezahlten Arbeiten im Haushalt und alle bezahlten und unbezahlten Betreuungs- und Pflegearbeiten verstanden“ werden.
In einer kapitalistischen Gesellschaft können Care-Tätigkeiten auf unterschiedliche Weise realisiert werden. In der Regel werden sie in einem Mix aus unbezahlten Tätigkeiten innerhalb von Familien einerseits sowie staatlichen und privatwirtschaftlichen Dienstleistungen andererseits geleistet. So werden unter Care-Arbeit sowohl die Gesamtheit der familialen Sorgearbeit als auch Erziehungs- und Betreuungstätigkeiten in Institutionen wie Kindergärten, Schulen und Altersheimen verstanden (Brückner 2010). Empfänger_innen von bezahlter und unbezahlter Care-Arbeit sind damit Kinder sowie unterstützungsbedürftige Erwachsene, die zeitweise krank oder pflegebedürftig sind oder wegen dauerhafter intellektueller, physischer oder psychischer Beeinträchtigungen besondere Hilfeleistungen benötigen. Dazu kommt die unbezahlte familiäre Care-Arbeit zumeist von Frauen für primär männliche gesunde Erwachsene (Donath 2000, Gubitzer/Mader 2011). Teil dieses Komplexes von Sorgearbeit ist auch die Selbstsorge der einzelnen Haushaltsmitglieder.
Maren A. Jochimsen (2003) betont in diesem Zusammenhang, dass es sich bei Care-Arbeit oft um asymmetrische menschliche Beziehungen handelt, insofern eine Person auf Care-Leistungen angewiesen ist und die pflegende beziehungsweise betreuende Person für die abhängige Person Verantwortung übernimmt. Damit geht es in der Care-Arbeit häufig auch um Abhängigkeitsverhältnisse. Gerade Kleinkinder und Schwerkranke sind beinahe vollständig auf von anderen Menschen geleistete Sorgearbeit angewiesen. Die sorgeleistenden Personen stehen dann in der Verantwortung und können sich kaum gegen die Arbeitsanforderungen zur Wehr setzen; ihre Möglichkeit, die Arbeit zu verweigern, ist beschränkt. Entsprechend verweist Susan Himmelweit (2007) darauf, dass sich die Care-Debatte primär auf jene Verhältnisse bezieht, in denen Menschen deutlich mehr Care benötigen als sie geben können und andere entsprechend hohe Sorgeaufgaben haben. Dagegen steht weniger im Fokus, dass die Care-Arbeit auch zwischen zwei gesunden Erwachsenen häufig ungleich aufgeteilt ist. Dies hängt stark mit geschlechterhierarchischer Arbeitsteilung und der Wirksamkeit von Geschlechterstereotypen zusammen.
Insgesamt wird betont, dass es überwiegend Frauen sind, die die sorgenden Tätigkeiten ausführen. Da familiale Care-Arbeit keine gesellschaftliche Anerkennung als Arbeit erfährt, werden entsprechend auch personennahe Tätigkeiten wie Betreuung und Pflege in staatlichen oder privatwirtschaftlichen Dienstleistungsbereichen gering entlohnt.
Gleichzeitig wird in der Care-Debatte darauf verwiesen, welch hohe ökonomische Bedeutung dem Bereich der Care-Arbeit zukommt. Allerdings fehlt dazu nach wie vor umfassendes und differenziertes statistisches Material. Aus den vorhandenen Daten geht hervor, dass 2010 in der BRD 19,0% aller Erwerbstätigen in den Bereichen Gesundheits- und Sozialwesen (10,6%), Erziehung und Unterricht (6,2%) sowie Häusliche Dienste (2,2%) tätig waren (Statistisches Bundesamt 2013a: 343, vgl. Daten zur Schweiz bei Madörin 2007). Allerdings wird in den statistischen Daten im Bereich der privaten Haushalte die große Gruppe der in der Schattenwirtschaft arbeitenden Haushaltsarbeiter_innen nicht exakt erfasst. Da in den genannten Care-Bereichen überproportional in Teilzeit gearbeitet wird, lag der Anteil dieser Bereiche an der gesamten Erwerbsarbeitszeit mit 16,8% unter dem Anteil der Erwerbstätigen (Statistisches Bundesamt 2013a: 344). Berücksichtigt man die Unterschiede in der durchschnittlichen Arbeitszeit, ergibt sich, dass in der bezahlten Care-Arbeit (9 Mrd. Std.) und in der unbezahlten Care-Arbeit (96 Mrd. Std., vgl. BMFSFJ/Statistisches Bundesamt 2003: 11) mit zusammen 105 Milliarden Arbeitsstunden das 2,2-fache an Arbeitszeit geleistet wird, verglichen mit den übrigen Wirtschaftsbereichen (Landwirtschaft, Güterproduktion, nicht personenbezogene Dienstleistungen) (47 Mrd. Std.).[2] Anders ausgedrückt entfallen auf die Care-Arbeit insgesamt, also den bezahlten und unbezahlten Bereich zusammengenommen, in der BRD circa 69% der gesamten gesellschaftlichen Arbeitszeit.
In der wissenschaftlichen Care-Debatte beschäftigten sich viele Autor_innen mit den arbeitsinhaltlichen Besonderheiten von Care-Arbeit. Dabei ist man sich weitgehend einig, dass bei der Care-Arbeit der Personenbezug, die Beziehungen zwischen Menschen, im Zentrum steht. Kathleen Lynch und Judy Walsh (2009: 36) definieren sehr unterschiedliche Typen von Care-Arbeit als „other-centred work“. Die Fokussierung auf andere Menschen ist damit das entscheidende Merkmal von Care-Arbeit, das mit großer zwischenmenschlicher Verantwortung verbunden ist. Danach sind Lehrer_innen, Ärzt_innen, Therapeut_innen, Coaches, Pflegekräfte, Hebammen, aber auch Eltern und pflegende Angehörige Care-Arbeitende.
Einig ist man sich weiter, dass in der Care-Arbeit die Kommunikation einen hohen Stellenwert hat, weil interaktive Prozesse zwischen Sorgeleistenden und Sorgeempfangenden bedeutsam sind. Gerade weil Care-Arbeit kommunikationsorientiert und auf konkrete einzelne Menschen bezogen ist, ist sie auch sehr zeitintensiv. Sie kann damit nicht beliebig verkürzt oder standardisiert werden, ohne an Qualität zu verlieren. Dies hat die Auswirkung, dass in diesem Bereich Produktivitätssteigerungen, die nicht gleichzeitig die Qualität der Care-Arbeit verschlechtern, nur begrenzt möglich sind (Himmelweit 2007, Madörin 2011).
Ferner ist es kaum möglich, eine sinnvolle Trennlinie zwischen Haushaltsarbeit und Sorgearbeit zu ziehen. Denn diese Tätigkeitsbereiche überschneiden sich in der Praxis. Oft finden Kochen und Putzen beispielsweise neben und mit den zu betreuenden Kindern oder zu pflegenden Personen statt. Ich folge daher dem Vorschlag von Luise Gubitzer und Katharina Mader (2011), die die Unterteilung in direkte und unterstützende Care-Arbeit vorschlagen: Direkte Care-Arbeit ist jene mit und an anderen Menschen. Unterstützende Care-Arbeit wird für Personen gemacht, wie beispielsweise die Besorgung von Medikamenten und alle Hausarbeiten.





























