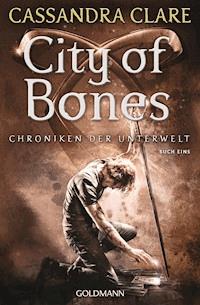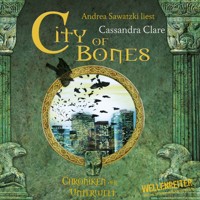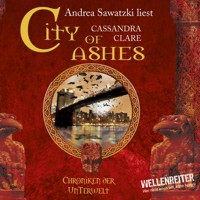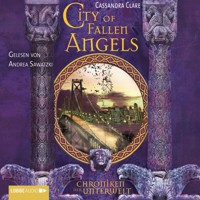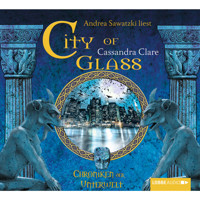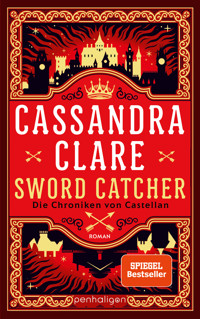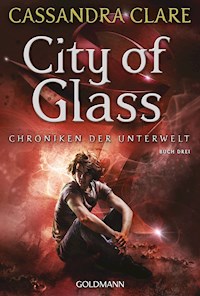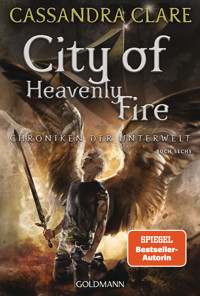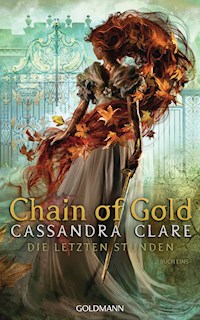
9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 9,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Goldmann Verlag
- Kategorie: Fantasy und Science-Fiction
- Serie: Die Letzten Stunden
- Sprache: Deutsch
Von der eleganten Londoner Soirée zum rauschenden Ball – und unter dem Abendkleid verborgen ein tödlich scharfes Schwert: In Cordelia Carstairs Brust wohnen zwei Seelen. Denn eigentlich sollte die junge Schattenjägerin heiraten. Sie jedoch plant eine Zukunft als Dämonenjägerin – auch in ihren Kreisen eher unüblich Anfang des 20. Jahrhunderts. Während Cordelia noch mit ihrem Schicksal und der aussichtslosen Liebe zu James Herondale hadert, bricht Unheil über Londons Schattenjäger herein: Scheinbar unbesiegbare Dämonen drohen die Stadt zu überrennen. Und Cordelia muss erfahren, was der wahre Preis für Heldentum ist ...
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 1015
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Seit ihrer Kindheit wurde Cordelia Carstairs darauf vorbereitet, eine Schattenjägerin zu sein, eine Kriegerin, deren Leben dem Kampf gegen Dämonen gewidmet ist. Doch als ihr Vater eines schrecklichen Verbrechens bezichtigt wird, sind es weniger finstere Höllenmächte als vielmehr der gesellschaftliche Ruin, den die Familie fürchten muss. Zusammen mit ihrer Mutter und ihrem Bruder reist Cordelia nach London. Dort könnte sie, um das Schlimmste zu verhindern, schnell und vorteilhaft verheiratet werden – wie es sich für eine junge Frau Anfang des 20. Jahrhunderts auch in Schattenjägerkreisen geziemt. Allerdings ist das Londoner Leben mit seinen glitzernden Bällen und geheimen Zusammenkünften viel zu aufregend, um sich irgendeine Zurückhaltung aufzuerlegen. Zudem trifft sie dort ihre Jugendfreunde James und Lucie Herondale wieder und merkt schnell, dass sie für James viel mehr empfindet als bloße Freundschaft. Weil dessen Herz jedoch bereits vergeben scheint, bleibt für Cordelia nur die Sehnsucht einer unerfüllten schwärmerischen Liebe.
Bis sie auf brutale Art von ihren persönlichen Problemen abgelenkt wird. Denn die Stadt wird heimgesucht von einer neuen, besonders heimtückischen Dämonenart, und kein Schattenjäger ist ihr gewachsen. London wird unter Quarantäne gestellt – und Cordelia und ihre Freunde müssen lernen, was es wirklich kostet, ein Held zu sein …
Weitere Informationen zu Cassandra Clare sowie zu lieferbaren Titeln der Autorin finden Sie am Ende des Buches.
Cassandra Clare
Chain of Gold
Die Letzten Stunden
BUCH EINS
ROMAN
Deutsch von Franca Fritz und Heinrich Koop
Die Originalausgabe erschien 2020 unter dem Titel »Chain of Gold« bei Margaret McElderry Books, an imprint of Simon & Schuster Children’s Publishing Division, New York.
Der Inhalt dieses E-Books ist urheberrechtlich geschützt und enthält technische Sicherungsmaßnahmen gegen unbefugte Nutzung. Die Entfernung dieser Sicherung sowie die Nutzung durch unbefugte Verarbeitung, Vervielfältigung, Verbreitung oder öffentliche Zugänglichmachung, insbesondere in elektronischer Form, ist untersagt und kann straf- und zivilrechtliche Sanktionen nach sich ziehen.
Sollte diese Publikation Links auf Webseiten Dritter enthalten, so übernehmen wir für deren Inhalte keine Haftung, da wir uns diese nicht zu eigen machen, sondern lediglich auf deren Stand zum Zeitpunkt der Erstveröffentlichung verweisen.
Copyright © der Originalausgabe 2020 by Cassandra Clare, LLC
Copyright © der deutschsprachigen Ausgabe 2020
by Wilhelm Goldmann Verlag, München,
in der Verlagsgruppe Random House GmbH,
Neumarkter Str. 28, 81673 München
Redaktion: Waltraud Horbas
Umschlaggestaltung: UNO Werbeagentur, München,
nach einer Idee von Nick Sciacca
Titelbildillustration: Cassandra Jean, Copyright © 2020 Cassandra Clare, LLC
Umschlagfoto und -illustration: © Cliff Nielsen
TH · Herstellung: Han
Satz: Buch-Werkstatt GmbH, Bad Aibling
ISBN: 978-3-641-20543-0V001
www.goldmann-verlag.de
Besuchen Sie den Goldmann Verlag im Netz
Für Clary (die echte Clary)
TEIL EINS
Es war dies ein denkwürdiger Tag für mich, denn er bewirkte große Veränderungen in mir und meinen Schicksalen. Aber so geht es in jedes Menschen Leben. Man denke sich irgendeinen gewissen Tag aus seinem Leben herausgestrichen, und wie verschieden wäre dann der ganze Lauf desselben gewesen. Haltet inne, Ihr, die Ihr dieses leset, und denkt einen Augenblick an die lange Kette von Eisen oder Gold, von Dornen oder Blumen, die Euch nie gefesselt haben würde, wäre nicht an jenem denkwürdigen Tage ihr erstes Glied gebildet worden.
Charles Dickens, »Große Erwartungen«
VERGANGENE ZEITEN:
1897
Lucie Herondale war zehn Jahre alt, als sie dem Jungen im Wald zum ersten Mal begegnete.
Da sie in London aufgewachsen war, hatte sie sich einen Ort wie den Brocelind-Wald noch nicht einmal in ihren kühnsten Träumen vorstellen können. Der Forst umgab das Herrenhaus der Herondales von allen Seiten, und seine Baumwipfel neigten sich einander zu wie Lebewesen, die sich verstohlen etwas zuflüsterten – dunkelgrün im Sommer, leuchtend rot und golden im Herbst. Der Moosteppich auf dem Waldboden war so grün und weich, dass ihr Vater Lucie erzählt hatte, die Feenwesen würden ihn in der Nacht als Kopfkissen benutzen. Und aus den weißen, sternförmigen Blüten der Blumen, die nur im verborgenen Land Idris wuchsen, fertigten sie angeblich Armreife und Ringe für ihre feingliedrigen Hände.
James dagegen hatte natürlich behauptet, die Feenwesen würden überhaupt keine Kopfkissen verwenden, unter der Erde schlafen und nur aus ihren Verstecken kommen, um ungezogene kleine Mädchen aus ihrem Bett zu entführen. Dafür trat Lucie ihm auf den Fuß – was wiederum zur Folge hatte, dass Papa sie hochhob und zum Haus zurücktrug, bevor der Streit eskalierte. James entstammte dem uralten und edlen Geschlecht der Herondales, doch das bedeutete nicht, dass er sich zu fein dafür gewesen wäre, seine kleine Schwester nötigenfalls an den Zöpfen zu ziehen.
Eines Nachts war Lucie vom hellen Schein des Mondes geweckt worden. Die Lichtstrahlen ergossen sich in ihr Zimmer wie Milch und zogen schimmernde Streifen quer über ihr Bett und den polierten Holzboden.
Sie schlüpfte aus dem Bett, kletterte aus dem Fenster und sprang leichtfüßig auf das Blumenbeet unter ihrem Zimmer. Die Sommernacht war so warm, dass es ihr in ihrem Nachthemd überhaupt nicht kalt wurde.
Der Rand des Waldes – der kurz hinter den Ställen begann, in denen ihre Pferde standen – schien zu glühen. Lucie glitt auf diesen Lichtschein zu wie ein kleiner Geist; die Pantoffeln an ihren Füßen schienen kaum den Moosboden zu berühren, während sie zwischen den Bäumen hindurchhuschte.
Zuerst vergnügte sie sich damit, aus Blüten Ketten anzufertigen und diese an den Baumästen aufzuhängen. Danach stellte sie sich vor, sie wäre Schneewittchen und würde vor dem Jäger fliehen. Sie rannte durch das dichte Unterholz, drehte sich dann dramatisch um, keuchte entsetzt auf und schlug den Handrücken gegen die Stirn. »Du wirst mich niemals bezwingen«, stieß sie hervor. »Denn ich bin von königlichem Blut und werde eines Tages doppelt so mächtig sein wie die Königin. Und dann werde ich ihr den Kopf abschlagen.«
Im Nachhinein fiel ihr auf, dass sie sich wahrscheinlich nicht ganz genau an das Märchen von Schneewittchen gehalten hatte. Trotzdem machte ihr das Ganze einen Riesenspaß, und so stellte sie erst bei ihrem vierten oder fünften Sprint durch den Wald fest, dass sie sich verlaufen hatte. Die vertraute Silhouette des Herondale Manor war durch die Bäume nicht länger zu sehen.
Voller Panik wirbelte sie herum. Der Wald schien jetzt jeden Zauber verloren zu haben, und die Bäume erhoben sich drohend über ihr wie böse Geister. Einen Moment glaubte sie, über das Rauschen der Bäume hinweg das unaufhörliche Flüstern schauerlicher Stimmen zu hören. Inzwischen waren dichte Wolken aufgezogen und verdeckten den Mond. Sie stand allein in der Dunkelheit.
Lucie war zwar tapfer, aber auch erst zehn Jahre alt. Sie stieß einen leisen Schluchzer aus und lief in die Richtung, in der sie das Herrenhaus vermutete. Doch der Wald wurde immer dunkler und das Unterholz dichter und dorniger. Eine Dornenranke verfing sich in ihrem Nachthemd und riss ihr einen langen Schlitz in den Stoff. Dann stolperte sie …
Und fiel. Es fühlte sich an wie Alice’ Sturz ins Wunderland – nur viel kürzer. Lucie überschlug sich und prallte auf einer Schicht gestampfter Erde auf.
Leise wimmernd setzte sie sich auf. Sie hockte auf dem Boden eines kreisrunden Lochs, das jemand in die Erde gegraben haben musste. Die Wände um sie herum waren glatt und ragten mehrere Meter in die Höhe.
Sie versuchte, ihre Hände in den Lehm zu graben und sich dann daran hochzuziehen, so als würde sie auf einen Baum klettern. Doch die Erde war weich und zerbröckelte unter ihren Fingern. Nachdem sie zum fünften Mal in die Grube zurückgestürzt war, entdeckte sie in der gegenüberliegenden, glatten Seite der Wand etwas Weißes, Schimmerndes. In der Hoffnung, dass es sich um eine Wurzel handelte, an der sie sich hochziehen konnte, ging sie entschlossen darauf zu und streckte die Hand aus …
… als sich ein Stück Lehm löste und Lucie erkannte, dass es sich nicht um eine Wurzel handelte, sondern um einen ausgebleichten Knochen. Und dieser Knochen stammte nicht von einem Tier.
»Nicht schreien!«, warnte eine Stimme über ihr. »Das würde sie nur anlocken.«
Lucie legte den Kopf in den Nacken und starrte in die Höhe. Ein Junge lehnte über den Rand der Grube – älter als ihr Bruder James, vielleicht sogar schon sechzehn Jahre alt. Er hatte ein hübsches Gesicht mit leicht melancholisch wirkenden Zügen und schwarze glatte Haare, deren Spitzen fast den Kragen seines Hemdes berührten.
»Wen würden wir anlocken?«, fragte Lucie und stemmte die Fäuste in die Hüften.
»Die Feenwesen«, antwortete der Junge. »Das hier ist eine ihrer Fallen. Sie benutzen sie für gewöhnlich, um Tiere darin zu fangen, aber über ein kleines Mädchen würden sie sich auch sehr freuen.«
»Du meinst, sie würden mich fressen?«, keuchte Lucie entsetzt.
Der Junge lachte. »Das ist eher unwahrscheinlich. Aber du würdest dem Elbenadel im Land unter den Hügeln dienen müssen, und zwar für den Rest deines Lebens. Ohne deine Familie je wiederzusehen.«
Dabei ließ er bedeutungsvoll seine Augenbrauen tanzen.
»Hör auf, mir Angst einzujagen«, sagte sie.
»Ich versichere dir: Ich sage die reine Wahrheit«, beteuerte er. »Mit der unreinen Wahrheit würde ich erst gar nicht anfangen wollen.«
»Und hör auch auf, dich über mich lustig zu machen«, sagte sie. »Ich bin Lucie Herondale. Mein Vater ist Will Herondale und eine bedeutende Persönlichkeit. Wenn du mich rettest, wirst du dafür belohnt werden.«
»Eine Herondale?«, erwiderte er. »Hab ich ein Glück!« Seufzend robbte er näher an den Rand der Grube heran und streckte Lucie seinen rechten Arm entgegen. Dabei blitzte auf seinem Handrücken eine Narbe auf – groß und wulstig, als hätte er sich verbrannt. »Hoch mit dir.«
Sie umklammerte sein Handgelenk mit beiden Händen, und er zog sie mit überraschender Leichtigkeit aus der Grube heraus. Kurz darauf standen sie einander gegenüber, sodass Lucie ihn genauer betrachten konnte. Der Junge war älter als gedacht und ganz formell in Schwarz und Weiß gekleidet. Inzwischen hatten sich die Wolken verzogen, und im Mondlicht erkannte sie, dass seine Augen von der Farbe des grünen Mooses auf dem Waldboden waren.
»Ich danke dir«, sagte sie steif und förmlich. Dann wischte sie mit den Händen über ihr Nachthemd, im Versuch, den Lehm zu entfernen.
»Bitte folge mir«, sagte er mit sanfter Stimme. »Und hab keine Angst. Worüber wollen wir uns unterhalten? Magst du Geschichten?«
»Ich liebe Geschichten«, antwortete Lucie. »Wenn ich groß bin, werde ich eine berühmte Schriftstellerin.«
»Das klingt wunderbar«, sagte der Junge. In seiner Stimme lag ein sehnsüchtiger Unterton.
Dann liefen sie gemeinsam über die Pfade zwischen den Bäumen. Der Junge schien immer zu wissen, wohin sie gehen mussten, als würde er sich in diesem Wald genau auskennen. Wahrscheinlich war er ein Wechselbalg, dachte Lucie. Er wusste eine Menge über Feenwesen, war aber ganz offensichtlich kein Elbe, und er hatte sie davor gewarnt, dass das Lichte Volk sie verschleppen würde – was ihm vermutlich widerfahren war. Sie nahm sich vor, es nicht zu erwähnen, um ihn nicht in Verlegenheit zu bringen: Es musste schrecklich sein, verschleppt zu werden und weit entfernt von der eigenen Familie ein Leben als Wechselbalg zu verbringen. Stattdessen verwickelte sie ihn in eine Diskussion über Märchenprinzessinnen und fragte ihn, wer seiner Ansicht nach die schönste wäre. Und als sie wieder im Garten des Herondale-Anwesens standen, schien kaum Zeit vergangen zu sein.
»Ich nehme an, dass die Prinzessin von hier aus ganz allein den Weg ins Schloss zurückfindet«, sagte er mit einer leichten Verbeugung.
»O ja«, antwortete Lucie und warf einen kurzen Blick zu ihrem Fenster hinauf. »Glaubst du, sie haben gemerkt, dass ich fort war?«
Doch der Junge lachte nur und wandte sich zum Gehen. Als er das Tor des Anwesens erreicht hatte, rief Lucie ihm nach: »Wie heißt du? Ich habe dir meinen Namen genannt. Wie lautet deiner?«
Der Junge zögerte einen Augenblick – eine schwarzweiße Gestalt in der Nacht, wie eine Illustration aus einem ihrer Bücher. Dann verbeugte er sich, tief und mit eleganten, kunstvollen Armbewegungen, wie ein Ritter vor einer Dame.
»Du wirst mich niemals bezwingen«, sagte er. »Denn ich bin von königlichem Blut und werde eines Tages doppelt so mächtig sein wie die Königin. Und dann werde ich ihr den Kopf abschlagen.«
Lucie keuchte empört auf. Hatte er sie etwa bei ihrem Spiel im Wald belauscht? Wie konnte er sich nur über sie lustig machen! Wütend hob sie die Faust, um ihm zu drohen – doch der Junge war bereits in der Nacht verschwunden. Nur der Klang seines Lachens blieb zurück.
Es sollten sechs Jahre verstreichen, bis sie ihn wiedersah.
1
Gute Engel
So stellen die Schatten unserer Begierden sich zwischen uns und unsere guten Engel und verfinstern den hellen Glanz derselben.
Charles Dickens, »Barnaby Rudge«
James Herondale kämpfte gerade gegen einen Dämon, als er in die Hölle gezerrt wurde.
Es war nicht das erste Mal, dass so etwas geschah – und es würde auch nicht das letzte Mal sein. Einen Moment zuvor hatte er noch am Rand eines abschüssigen Dachs mitten in London gekniet, schlanke Wurfmesser in den Händen, und darüber nachgedacht, wie widerlich der Abfall war, der sich in dieser Stadt ansammelte. Neben ganz gewöhnlichem Dreck, leeren Ginflaschen und Tierknochen klemmte unverkennbar auch noch ein toter Vogel in der Regenrinne unter seinem linken Knie.
Das war das Leben eines Schattenjägers, in all seinem Glanz. An und für sich klang es gut, dachte er, während er in die leere Gasse tief unter ihm schaute – ein enger Durchgang, vollgestopft mit Müll, nur schwach vom Halbmond ausgeleuchtet. Ein Volk außergewöhnlicher Krieger, von einem Engel abstammend und mit Kräften ausgestattet, die es ihnen erlaubten, Waffen aus schimmerndem Adamant zu führen und die dunklen Male heiliger Runen auf ihrer Haut zu tragen – Runen, die sie stärker, schneller und tödlicher machten als jedes menschliche Wesen. Runen, die sie zu hellen Lichtern in tiefer Dunkelheit machten. Aber niemand erwähnte je, dass man dabei auch gelegentlich auf einem toten Vogel knien musste, während man darauf wartete, dass der gesuchte Dämon endlich auftauchte.
Ein Schrei hallte durch die Gasse – ausgestoßen von jemandem, dessen Stimme James nur zu gut kannte: Matthew Fairchild. Ohne Zögern sprang er vom Dach in die Tiefe. Matthew Fairchild war sein Parabatai – sein Blutsbruder und Kampfpartner. James hatte geschworen, ihn zu schützen, doch im Grunde wäre das nicht nötig gewesen: Für Matthew hätte er jederzeit sein Leben gegeben, ob mit oder ohne Eid.
Am Ende der Gasse, die hinter einer schmalen Häuserreihe in einer Biegung endete, war eine Bewegung zu erkennen. James wirbelte in dem Moment herum, als ein Dämon brüllend aus der Dunkelheit auftauchte. Die Kreatur hatte einen gerippten grauen Rumpf, einen gekrümmten, spitzen Schnabel mit gebogenen Zähnen und gespreizte, pfotenartige Füße, aus denen gezackte Klauen hervorragten. Ein Deumas-Dämon, dachte James grimmig. Irgendwo hatte er schon einmal etwas über Deumas-Dämonen gelesen, in einem der alten Bücher, die sein Onkel Jem ihm gegeben hatte – das wusste er genau. Angeblich waren Deumas für irgendetwas berüchtigt. Extrem bösartig vielleicht oder außerordentlich gefährlich? So etwas wäre wieder mal typisch: Nach Monaten ohne irgendwelche dämonischen Aktivitäten mussten er und seine Freunde ausgerechnet auf einen der gefährlichsten Dämonen weit und breit stoßen.
Apropos … Wo steckten seine Freunde eigentlich?
Der Dämon brüllte erneut und stürmte auf James zu. Lange Fäden eines grünlichen Schleims liefen aus seinen Mundwinkeln.
James hob einen Arm und machte sich bereit, sein erstes Messer zu werfen. Die Augen des Deumas fixierten ihn kurz – grün und schwarz glitzernd und erfüllt von einem Hass, der sich jedoch plötzlich in etwas anderes zu verwandeln schien.
So etwas wie ein Wiedererkennen. Aber Dämonen – und ganz sicher nicht die rangniedrigen Arten – konnten keine menschlichen Wesen erkennen: Sie waren wie wilde Tiere, angetrieben von Hass und reiner Gier. James zögerte überrascht … und dann begann der Boden unter ihm zu schlingern. Er konnte gerade noch O nein, nicht jetzt! denken, bevor die Welt grau und still wurde. Die Gebäude um ihn herum verwandelten sich in zerklüftete Schatten, und der Himmel war nur noch ein schwarzes Gewölbe, durchzuckt von weißen Blitzen.
James schloss die rechte Hand um sein Messer – aber nicht um das Heft, sondern um die Klinge. Der plötzliche Schmerz traf ihn wie ein Schlag ins Gesicht und riss ihn aus seiner Erstarrung. Die Welt kam auf ihn zugerast, mit all ihrem Lärm und ihren Farben. Ihm blieb kaum genug Zeit, um festzustellen, dass der Deumas mitten im Sprung war und mit den Krallen voran auf ihn zuflog, als auch schon ein Wirbel aus Stricken durch die Luft zischte, sich um die Beine des Dämons wickelte und ihn zurückriss.
Thomas!, dachte James – und tatsächlich war sein enorm großer und breiter Freund, bewaffnet mit seinen Bolas, hinter dem Deumas aufgetaucht. Direkt hinter ihm folgte Christopher, den Bogen schussbereit, und Matthew, eine flammende Seraphklinge in der Hand.
Der Deumas stürzte gerade aufbrüllend zu Boden, als James auch schon seine Messer schleuderte. Eine Klinge bohrte sich tief in seine Kehle, die andere drang mit voller Wucht in seine Stirn ein. Der Dämon verdrehte die Augen, begann zu zucken … und dann erinnerte James sich plötzlich daran, was er über Deumas-Dämonen gelesen hatte.
»Matthew …«, setzte er an – genau in dem Moment, als die Kreatur zerplatzte und Thomas, Christopher und Matthew über und über mit Sekret und verbrannten Stückchen irgendeiner Substanz bespritzte, bei der es sich ziemlich sicher um Schleim gehandelt haben musste.
Schmierig, erinnerte James sich, leider zu spät. Deumas-Dämonen waren bekanntermaßen schmierig. Die meisten Dämonen verschwanden, wenn sie starben. Das galt jedoch nicht für Deumas-Dämonen.
Die zerplatzten.
»Wie … was …?«, stotterte Christopher, dem deutlich die Worte fehlten. Schleim tropfte von seiner spitzen Nase und der Brille mit Goldfassung. »Aber wie …?«
»Du möchtest wissen, wie es sein kann, dass der letzte Dämon in ganz London, den wir aufspüren, zugleich der widerwärtigste von allen ist?«, fragte James und stellte verblüfft fest, wie unaufgeregt seine Stimme klang – anscheinend hatte er den Schock seines kurzen Ausflugs ins Reich der Schatten schon überwunden. Wenigstens war seine Kleidung sauber geblieben: Der Dämon schien bei der Explosion den größten Teil seines Schleims in die andere Richtung der Gasse verspritzt zu haben. »Wir fragen und zagen nicht, Christopher.«
James wurde das Gefühl nicht los, dass seine Freunde ihn gereizt anstarrten. Thomas verdrehte die Augen; er versuchte gerade, seine Kleidung mit einem Taschentuch sauber zu wischen, das seinerseits halb verbrannt und voller Sekret war, seinen Zweck also vollkommen verfehlte.
Matthews Seraphklinge hatte zu flackern begonnen: Auch wenn diese Klingen mit den Kräften der Engel versehen waren und zu den bewährtesten Waffen der Schattenjäger – und zur besten Verteidigung gegen Dämonen – gehörten, konnten sie von einem Übermaß an Dämonensekret erstickt werden. »Das ist empörend«, sagte Matthew und schleuderte die erloschene Klinge zur Seite. »Weißt du, wie viel ich für diese Weste bezahlt habe?«
»Niemand hat gesagt, du sollst dich wie ein Statist aus Ernst sein ist alles kleiden, wenn du auf Dämonenpatrouille gehst«, meinte James und warf ihm ein sauberes Taschentuch zu. Dabei spürte er ein Ziehen in seiner Hand, und als er einen Blick darauf warf, sah er einen blutigen Schnitt, der sich quer über die Handfläche zog. Er ballte die Finger zur Faust, um zu verhindern, dass seine Freunde das Blut ebenfalls bemerkten.
»Ich finde nicht, dass er wie ein Statist gekleidet ist«, warf Thomas ein, der inzwischen seine Aufmerksamkeit Christopher zugewandt hatte und ihn sauber zu wischen versuchte.
»Vielen Dank«, sagte Matthew und verbeugte sich leicht.
»Ich finde, er sieht eher wie einer der Hauptdarsteller aus«, fuhr Thomas grinsend fort. Er hatte das liebenswürdigste Gesicht, das James sich vorstellen konnte, und dazu sanfte haselnussbraune Augen. Doch das bedeutete nicht, dass er keinen Spaß daran hatte, sich nach Kräften über seine Freunde lustig zu machen.
Matthew tupfte sich mit James’ Taschentuch die dunkelblonden Haare ab. »Das ist das erste Mal seit einem Jahr, dass wir auf einer Patrouille tatsächlich einem Dämon begegnet sind. Deshalb bin ich davon ausgegangen, dass meine Weste den Abend unversehrt überstehen würde. Schließlich trägt von euch auch keiner seine Montur.«
Es stimmte: Für gewöhnlich gingen Schattenjäger in ihrer Montur auf Jagd – eine Art elastischer Rüstung, gefertigt aus einem schwarzen lederartigen Material, das vor Dämonensekret, Klingen und Ähnlichem schützte. Aber aufgrund des Ausbleibens dämonischer Aktivitäten auf den Straßen waren sie alle in dieser Hinsicht sehr nachlässig geworden.
»Hör auf, an mir herumzuschrubben, Thomas«, sagte Christopher und fuchtelte abwehrend mit den Armen. »Lasst uns lieber zur Devil Tavern zurückgehen, dort können wir uns sauber machen.«
Der Rest der Gruppe murmelte zustimmend, und während sie sich aus der klebrigen Gasse einen Weg auf die Hauptstraße hinaus bahnten, dachte James darüber nach, dass Matthew im Grunde recht hatte. Sein Vater Will hatte ihm oft von den Patrouillen erzählt, auf die er gemeinsam mit James’ Onkel, seinem Parabatai Jem Carstairs gegangen war – damals, als sie noch fast jede Nacht gegen Dämonen kämpfen mussten.
Auch heute noch gingen James und andere junge Schattenjäger gewissenhaft in den Straßen Londons auf Patrouille, um die irdische Bevölkerung der Stadt vor Dämonen zu schützen, aber in den vergangenen Jahren hatte es kaum dämonische Aktivitäten gegeben. Was natürlich begrüßenswert war – äußerst begrüßenswert sogar –, aber auch ein wenig eigenartig. Überall sonst auf der Welt kam es nach wie vor zu regelmäßigen Auseinandersetzungen mit Dämonen, doch warum war das in London anders?
Selbst zu dieser späten Stunde eilten noch viele Irdische durch die Straßen der Stadt; die kleine Gruppe Schattenjäger, die in ihrer verschmutzten Kleidung in Richtung Fleet Street lief, fiel allerdings nicht weiter auf. Ihre Zauberglanzrunen machten sie für all jene unsichtbar, die nicht über das Zweite Gesicht verfügten.
Es fühlte sich immer ein wenig unheimlich an, wenn man von menschlichen Wesen umgeben war, die einen nicht wahrnahmen, dachte James. Die Fleet Street war die Heimat der großen Zeitungshäuser und der Gerichte Londons, und überall sah man hell erleuchtete Pubs, in denen sich Zeitungsdrucker und Rechtsanwälte und Referendare drängten, die bis in die Nacht arbeiten mussten und dann bis zum Morgengrauen tranken. Auf dem nahe gelegenen Strand hatten die Varietés und Theater ihre Abendvorstellungen beendet, und gut gekleidete Grüppchen junger Leute versuchten lachend und übermütig, die letzten Omnibusse des Tages zu erwischen.
Auch die Bobbys der Londoner Polizei drehten ihre abendlichen Streifenrunden, und hier und dort konnte man jene bemitleidenswerten Bewohner der Hauptstadt entdecken, die keine eigene Bleibe hatten und notdürftigen Schutz auf den Luftschächten suchten, aus denen warme Luft emporstieg – selbst im August konnten die Nächte hier klamm und kalt werden. Als sie an einer Gruppe dieser zusammengekauerten Gestalten vorbeikamen, blickte eine kurz hoch, und James erkannte die blasse Haut und die glitzernden Augen eines Vampirs.
Er schaute schnell weg: Solange sie sich an die Gesetze des Rats hielten, gingen Schattenweltler ihn nichts an. Außerdem fühlte er sich erschöpft, und das trotz seiner Kraftrunen: Es kostete ihn jedes Mal viel Energie, wenn er in diese andere Welt aus grauem Licht und schwarzen gezackten Schatten gezerrt wurde. So ging es ihm schon seit Jahren – die Auswirkungen des Hexenbluts vonseiten seiner Mutter.
Wie er wusste, waren Hexenwesen die Nachkommen von Menschen und Dämonen: Sie konnten Magie einsetzen, jedoch keine Runen tragen oder Adamant berühren – jenes silberweiße Metall, aus denen die Stelen und Seraphklingen der Schattenjäger gefertigt waren. Zusammen mit den Vampiren, Werwölfen und Feenwesen gehörten sie zu den vier Gruppierungen der Schattenweltler. James’ Mutter, Tessa Herondale, war eine Hexe – deren Mutter wiederum nicht nur irdisches, sondern auch Schattenjägerblut in den Adern gehabt hatte. Tessa besaß die Fähigkeit, ihre Gestalt zu wandeln und das Erscheinungsbild jeder lebenden oder toten Person anzunehmen – eine Fertigkeit, über die kein anderes Hexenwesen verfügte. Und das war nicht das einzig Außergewöhnliche an ihr. Normalerweise konnten Hexenwesen keine Kinder bekommen, doch das galt nicht für Tessa. Und niemand wusste, welche Auswirkungen das auf James und seine Schwester Lucie haben würde – die ersten bekannten Enkelkinder eines Dämons und eines menschlichen Wesens.
Viele Jahre lang schien ihre Herkunft keine Folgen für die beiden zu haben. James und Lucie konnten beide Runen tragen und hatten die gleichen Fähigkeiten wie alle anderen Schattenjäger. Zwar waren sie in der Lage, Geister zu sehen – wie etwa Jessamine, den redseligen Hausgeist des Londoner Schattenjäger-Instituts –, aber das war in der Familie der Herondales nicht ungewöhnlich. Im Grunde schienen sie beide ziemlich normal zu sein – sofern man Schattenjäger als »normal« bezeichnen konnte. Und selbst der Rat, das leitende Gremium der Schattenjägergemeinschaft, schien ihre Existenz vergessen zu haben.
Doch dann, im Alter von dreizehn Jahren, wechselte James zum ersten Mal ins Schattenreich. In einem Augenblick hatte er noch grünes Gras unter den Sohlen, im nächsten Augenblick stand er auf verbrannter Erde. Über ihm wölbte sich ein ebenso versengter Himmel. Bäume wanden sich gekrümmt aus dem Boden empor, mit Ästen wie dünne Gichtfinger, die die Luft zu packen versuchten. Orte wie diesen hatte er zuvor nur als Holzschnitte in alten Büchern gesehen. Doch er wusste sofort, wo er sich befand: in einer Dämonenwelt. Eine Dimension der Hölle.
Sekunden später wurde er ruckartig auf die Erde zurückgezerrt – aber von da an war sein Leben nie wieder so wie zuvor. Die folgenden Jahre waren von der ständigen Furcht beherrscht, er könnte jeden Augenblick wieder in die Schatten zurückgerissen werden. Es schien, als ob ein unsichtbares Seil ihn mit einer Welt voller Dämonen verband – ein Seil, das jederzeit ruckartig angezogen werden konnte, um ihn aus seiner vertrauten Umgebung an einen Ort zu zerren, der nur aus Feuer und Asche bestand.
In den letzten Jahren hatte er, dank der Hilfe seines Onkels Jem, diesen Wechsel recht gut im Griff gehabt – zumindest hatte er das angenommen. Doch die heutige »Reise«, auch wenn sie nur kurz gewesen war, hatte ihn zutiefst erschüttert, und er seufzte erleichtert auf, als die Devil Tavern endlich in Sicht kam.
Die Taverne befand sich in der Fleet Street No. 2, direkt neben einer ehrwürdigen Druckerei. Im Gegensatz zu diesem achtbaren Geschäft war sie durch Zauberglanz getarnt, sodass kein Irdischer den ausgelassenen Lärm hören konnte, der durch die Fenster und die Tür ins Freie drang. Die Fassade war im Tudorstil gehalten, und das alte, schäbige und geborstene Holz des Fachwerks wurde nur noch von Zaubersprüchen zusammengehalten. Hinter der Theke stand der Besitzer Ernie, ein Werwolf, und zapfte ein Bier nach dem anderen. Und vor der Theke hatte sich eine bunte Mischung aus Pixies, Vampiren, Lykanthropen und Hexenwesen versammelt.
Im Allgemeinen schlug Schattenjägern in einem solchen Etablissement eisige Ablehnung entgegen, aber die Stammgäste der Devil Tavern waren an die Jungen gewöhnt und begrüßten James, Christopher, Matthew und Thomas mit einer Mischung aus Willkommensgrüßen und spöttischen Sprüchen. James blieb an der Theke stehen und nahm von Polly, der Kellnerin, ihre Getränke entgegen, während die anderen die Treppe zu ihren Zimmern hinaufpolterten und dabei die Stufen mit Sekret bekleckerten.
Auch Polly war eine Werwölfin. Sie hatte die Jungen unter ihre Fittiche genommen, seit James vor gut drei Jahren die Zimmer unter dem Dach gemietet hatte. Damals war er auf der Suche nach einem unauffälligen Unterschlupf gewesen, in den er und seine Freunde sich zurückziehen konnten, fernab der neugierigen Blicke ihrer Eltern. Polly hatte den vieren auch den Namen die »Tollkühnen Gesellen« gegeben, nach Robin Hood und seinen Männern. James vermutete, dass er Robin von Locksley sein sollte und Matthew Will Scarlett. Und Thomas war definitiv Little John.
»Ich hätte euch vier fast nicht wiedererkannt«, lachte Polly. »Kommt hier hereingetrampelt, von Kopf bis Fuß beschmiert mit was weiß ich.«
»Sekret«, sagte James und nahm eine Flasche Weißwein entgegen. »Mit anderen Worten: Dämonenblut.«
Naserümpfend drapierte Polly mehrere verschlissene Geschirrtücher um seine Schultern. Dann drückte sie ihm ein weiteres Tuch in die Hand, das er gegen den Schnitt in seiner Handfläche presste. Die Blutung hatte zwar aufgehört, aber die Wunde pochte vor Schmerz. »Ach du liebe Zeit.«
»Wir haben in London schon ewig lange keinen Dämon mehr gesehen«, sagte James. »Wahrscheinlich sind unsere Reflexe dadurch ein wenig eingerostet.«
»Ich schätze mal, die haben alle viel zu viel Angst, sich hier blicken zu lassen«, sagte Polly freundlich und wandte sich dann kurz ab, um Pickles, dem ortsansässigen Kelpie, ein Glas Gin zu reichen.
»Zu viel Angst?«, wiederholte James. »Angst wovor?«
Polly setzte zu einer Antwort an, erwiderte dann aber doch nur: »Oh, nichts, nichts«, und machte sich eilig auf ans andere Ende der Theke. Stirnrunzelnd stieg James die Treppe hinauf. Die Wege der Schattenweltler waren manchmal wahrlich geheimnisvoll.
Zwei Treppen mit knarrenden Stufen führten hinauf zu einer Holztür, in die jemand vor Jahren den Spruch eingeritzt hatte: Es kommt nicht darauf an, wie ein Mensch stirbt, sondern allein darauf, wie er lebt. S. J.
James stemmte die Tür mit der Schulter auf und sah, dass Matthew und Thomas es sich bereits an dem kreisrunden Tisch in der Mitte des holzvertäfelten Raums gemütlich gemacht hatten. Mehrere Fenster, deren Glasscheiben im Alter wellig und uneben geworden waren, führten hinaus zur Fleet Street. Auf der anderen Straßenseite konnte man im flackernden Licht der Straßenlaternen die Royal Courts of Justice erkennen – die Umrisse des Gerichtsgebäudes zeichneten sich schwach gegen den wolkenverhangenen Nachthimmel ab.
Der Raum war ein vertrauter, einladender Ort, mit abgenutzten Wänden, zusammengewürfelten, abgewetzten Möbeln und einem Kamin, in dem ein kleines Feuer prasselte. Auf dem Kaminsims stand eine Marmorbüste von Apollo, dessen Nase schon vor langen Jahren abgeschlagen worden sein musste. An den Wänden stapelten sich Bücher über okkulte Wissenschaften, verfasst von irdischen Magiern – Werke, die nicht in die Bücherei des Instituts aufgenommen werden durften. Aber James sammelte sie dennoch: Er war fasziniert von der Vorstellung, dass es Menschen gab, die nicht in die Welt der Magie und der Schatten hineingeboren waren und die es dennoch so sehr danach verlangte zu lernen, die Tore zu diesen Welten aufzustemmen.
Thomas und Matthew hatten sich inzwischen vom Sekret gesäubert. Sie trugen zerknitterte, aber saubere Kleidung, und ihre Haare – Thomas’ sandfarbener und Matthews dunkelblonder Schopf – glänzten noch immer feucht. »James!«, rief Matthew begeistert beim Anblick seines Freundes. Seine Augen schimmerten verdächtig, was wahrscheinlich an der halb leeren Flasche Brandy lag, die vor ihm auf dem Tisch stand. »Entdecke ich in deiner Hand etwa eine Flasche billigen Fusel?«
Während James den Wein auf den Tisch stellte, tauchte Christopher aus dem kleinen Schlafzimmer am anderen Ende des Dachbodens auf. Das Zimmer hatte schon existiert, bevor James die Räumlichkeiten gemietet hatte: Zwar stand ein Bett darin, aber die Tollkühnen Gesellen nutzten den Raum nur, um sich dort zu waschen und Waffen und Wechselwäsche zu lagern.
»James«, sagte Christopher erfreut. »Ich dachte, du wärst nach Hause gegangen.«
»Warum in aller Welt sollte ich das tun?« James nahm neben Matthew Platz und warf Pollys Geschirrtücher auf den Tisch.
»Keine Ahnung«, meinte Christopher fröhlich und zog sich ebenfalls einen Stuhl heran. »Aber du hättest durchaus nach Hause gegangen sein können. Die Leute machen ständig die eigenartigsten Sachen. Wir hatten zum Beispiel eine Köchin, die eines Tages einkaufen ging und die wir erst zwei Wochen später im Regent’s Park wiedergefunden haben. Sie war Tierpflegerin geworden.«
Thomas zog eine Augenbraue hoch. James und die anderen waren sich nie sicher, ob sie Christophers Geschichten uneingeschränkt Glauben schenken sollten. Er war zwar kein pathologischer Lügner, aber sobald es um etwas ging, das nichts mit Kolben und Reagenzgläsern zu tun hatte, schenkte er der Angelegenheit nur einen Bruchteil seiner Aufmerksamkeit.
Christopher war der Sohn von James’ Tante Cecily und Onkel Gabriel. Er hatte den zarten Körperbau seiner Eltern geerbt, dazu dunkelbraunes Haar und Augen von einer Farbe, die man nur als »Veilchenblau« bezeichnen konnte. »Was für eine Verschwendung – bei einem Jungen!«, sagte Cecily oft und gern mit einem theatralischen Seufzer. Eigentlich hätte Christopher bei den jungen Damen äußerst beliebt sein müssen, aber seine dicke Brille verdeckte den Großteil seines Gesichts, und außerdem hatte er ständig Reste von Schießpulver unter den Fingernägeln. Die meisten Schattenjäger betrachteten irdische Waffen mit Misstrauen oder Desinteresse – das Anbringen von Runen auf Metall oder Kugeln verhinderte, dass sich deren Schießpulver entzünden konnte, und Waffen ohne Runen waren im Kampf gegen Dämonen nutzlos. Dagegen war Christopher von der Idee besessen, eines Tages Feuerwaffen für die Zwecke der Nephilim nutzbar zu machen. Und wie James zugeben musste, hatte die Vorstellung von einer Kanone auf dem Dach des Instituts einen gewissen Reiz.
»Deine Hand«, sagte Matthew plötzlich, beugte sich vor und richtete den Blick seiner dunkelgrünen Augen auf James. »Was ist passiert?«
»Nur ein Schnitt«, wiegelte James ab und öffnete seine Faust. Die Wunde zog sich wie ein langer Strich quer über seine Handfläche. Als Matthew James’ Arm ergriff, um sich das Ganze genauer anzusehen, schlug das Silberarmband, das James immer um sein rechtes Handgelenk trug, leise klingend gegen die Weinflasche auf dem Tisch.
»Du hättest es mir sagen sollen«, sagte Matthew und griff in die Westentasche, auf der Suche nach seiner Stele. »Dann hätte ich dich schon in der Gasse verarzten können.«
»Ich habe gar nicht mehr daran gedacht«, erwiderte James.
Thomas, der mit dem Mittelfinger leicht über den Rand seines Glases fuhr, ohne daraus zu trinken, fragte: »Ist irgendetwas passiert?« Thomas war schon fast verstörend scharfsinnig.
»Es ging sehr schnell«, antwortete James zögerlich.
»Viele Dinge, die›sehr schnell gehen‹, können großes Übel anrichten«, meinte Matthew und drückte die Spitze seiner Stele auf James’ Haut. »Guillotinen zum Beispiel fallen sehr schnell in die Tiefe. Und wenn Christophers Experimente explodieren, dann knallt es meist sehr schnell.«
»Ganz offensichtlich bin ich weder explodiert noch guillotiniert worden«, antwortete James. »Ich … bin ins Schattenreich gewechselt.«
Matthew hob ruckartig den Kopf, auch wenn seine Hand, die gerade eine Iratze auf James’ Haut auftrug, ganz ruhig die Heilrune zu Ende zeichnete. James spürte, wie der Schmerz in seiner Handfläche sofort nachließ. »Ich dachte, Jem hätte dir geholfen und die Sache mit diesen Ausflügen wäre erledigt?«
»Jem hat mir in der Tat geholfen. Seit dem letzten Wechsel ist über ein Jahr vergangen.« James schüttelte den Kopf. »Ich schätze, ich habe einfach zu sehr darauf gebaut, dass die Angelegenheit ein für alle Mal erledigt wäre.«
»Passiert das für gewöhnlich nicht immer nur dann, wenn du dich aufregst?«, fragte Thomas. »Hat es an der Dämonenattacke gelegen?«
»Nein«, sagte James schnell. »Nein, das kann ich mir nicht vorstellen – beim besten Willen nicht.« James hatte sich beinahe auf den Kampf gefreut, denn der Sommer war deprimierend verlaufen: Zum ersten Mal seit über einem Jahrzehnt hatte er die Sommermonate nicht mit seiner Familie in Idris verbracht.
Idris lag mitten in Europa – eine von Schutzwällen umgebene, unberührte Landschaft, verborgen vor irdischen Blicken und irdischen Erfindungen: ein Land ohne Eisenbahnen, Fabriken oder Kohlenruß. James wusste, warum seine Familie in diesem Jahr nicht nach Idris gereist war, doch er hatte seine eigenen Gründe, sich lieber dorthin zu wünschen, als hier in London zu sein. Die Patrouillengänge zählten zu den wenigen angenehmen Abwechslungen.
»Dämonen machen unserem Freund nichts aus«, sagte Matthew und stellte die Heilrune fertig. Jetzt, in der unmittelbaren Nähe zu seinem Parabatai, konnte James dessen vertrauten Geruch wahrnehmen, eine Mischung aus Matthews Seife und Alkohol. »Es muss an etwas anderem gelegen haben.«
»Dann solltest du noch mal mit deinem Onkel reden, James«, sagte Thomas.
James schüttelte den Kopf. Er wollte Onkel Jem nicht wegen einer Sache belästigen, die in seinen Augen nur ein kurzes Flimmern darstellte. »Es war wirklich nichts Besonderes. Der Dämon hat mich überrascht, und ich habe aus Versehen in die Klinge gegriffen. Das war auch schon alles.«
»Hast du dich in einen Schatten verwandelt?«, fragte Matthew und steckte seine Stele in die Tasche. Manchmal, wenn James in das Schattenreich gezerrt wurde, hatten seine Freunde gesehen, wie sein Abbild entlang der Konturen zu verschwimmen begann. Gelegentlich hatte er sich sogar völlig in einen Schatten verwandelt – in der Gestalt von James, aber durchsichtig und immateriell.
Und einige Male – einige wenige Male – war es ihm gelungen, sich aktiv in einen Schatten zu verwandeln und durch eine feste Oberfläche hindurchzugehen. Doch davon hatte er bisher noch niemandem erzählt.
Christopher schaute von seinem Notizblock auf. »Wo wir gerade vom Teufel sprechen …«
»… was wir nicht getan haben«, stellte Matthew klar.
»… was für eine Art von Dämon war das überhaupt?«, fuhr Christopher fort und kaute auf dem Ende seines Stifts herum. Er machte sich häufig Notizen über die Details ihrer Kämpfe mit Dämonen; angeblich half ihm das bei seinen Forschungen. »Ich meine den, der explodiert ist.«
»Im Gegensatz zu dem, der nicht explodiert ist?«, fragte James.
Thomas, der ein exzellentes Gedächtnis selbst für kleinste Details besaß, erklärte: »Es handelte sich um einen Deumas-Dämon, Christopher. Was an sich äußerst seltsam ist: Deumas findet man für gewöhnlich nicht in Städten.«
»Ich habe etwas von seinem Sekret aufbewahrt«, berichtete Christopher und zog aus irgendeiner seiner Taschen ein verkorktes Reagenzglas hervor, in dem eine grünliche Substanz zu sehen war. »Ich möchte euch alle davor warnen, auch nur einen Tropfen davon zu trinken.«
»Ich versichere dir, dass keiner von uns daran gedacht hat, du Knalltüte«, erwiderte Thomas.
Matthew schüttelte sich. »Genug über Sekret geredet. Lasst uns lieber darauf anstoßen, dass Thomas wieder zu Hause ist!«
Thomas protestierte, doch James erhob sein Glas und stieß mit Matthew an. Christopher wollte gerade sein Reagenzglas gegen James’ Glas klingen lassen, als Matthew ihm – mit einem unterdrückten Fluchen – das Glasröhrchen aus der Hand nahm und gegen ein Glas billigen Wein austauschte.
Trotz seiner Proteste schien Thomas sich zu freuen. Die meisten Schattenjäger gingen im Alter von achtzehn Jahren für ein paar Monate ins Ausland, um in einem der anderen Institute zu leben und zu arbeiten, und Thomas war erst vor wenigen Wochen aus dem Madrider Institut zurückgekommen, in dem er insgesamt neun Monate verbracht hatte. Sinn und Zweck dieser Auslandsaufenthalte war, neue Gebräuche kennenzulernen und den persönlichen Horizont zu erweitern. Thomas hatte sicherlich neue Sitten und einen anderen Lebensstil kennengelernt, aber erweitert hatten sich vor allem seine Schultern und Oberarme.
Thomas war zwar der Älteste der vier, hatte aber immer eine schmächtige Gestalt gehabt. Als James, Matthew und Christopher an den Docks eintrafen, um ihn vom Schiff aus Spanien abzuholen, hatten sie die eintreffenden Passagiere genauestens studiert und dabei beinahe ihren Freund übersehen, der als muskulöser junger Mann die Gangway herunterkam. Inzwischen war Thomas der Größte der Gruppe und dazu noch so dunkel gebräunt, als ob er nicht in London, sondern auf einem Bauernhof aufgewachsen wäre. Er konnte jetzt mit einer Hand ein Breitschwert führen und hatte dazu in Spanien noch die Bola kennengelernt – eine Waffe aus kräftigen Seilen und Gewichten, die über dem Kopf gewirbelt und geworfen werden konnte. Matthew meinte danach, er hätte das Gefühl, mit einem sanften Riesen befreundet zu sein.
»Wenn ihr mit dem Anstoßen fertig seid, habe ich euch etwas mitzuteilen«, sagte Thomas nun und schaukelte auf den hinteren beiden Stuhlbeinen. »Ihr kennt doch das alte Herrenhaus in Chiswick, das einst meinem Großvater gehört hat? Das ehemalige Lightwood House? Der Rat hat es vor einigen Jahren meiner Tante Tatiana übereignet, doch sie hat nie dort gewohnt und ist lieber auf dem Gut in Idris geblieben, zusammen mit meiner Cousine, äh …«
»Gertrude«, meinte Christopher hilfsbereit.
»Grace«, sagte James. »Ihr Name ist Grace.«
Sie war auch Christophers Cousine – obwohl James wusste, dass die beiden einander noch nie begegnet waren.
»Richtig, Grace«, pflichtete Thomas ihm bei. »Tante Tatiana und sie haben bisher immer in selbst gewählter Einsamkeit in Idris gelebt, ohne Freunde oder Besucher. Doch anscheinend hat Tantchen sich jetzt entschlossen, nach London zurückzukehren – eine Neuigkeit, wegen der meine Eltern vor Aufregung ganz aus dem Häuschen sind.«
James’ Herz schien auf einmal langsamer und lauter zu schlagen. »Grace«, setzte er an und sah, wie Matthew ihm einen schnellen Seitenblick zuwarf, »Grace … zieht nach London?«
»Es scheint, Tatiana will sie in die Gesellschaft einführen.« Thomas wirkte verwirrt. »Ich nehme an, du bist ihr schon einmal begegnet, in Idris? Grenzt euer Anwesen nicht an die Ländereien von Blackthorn Manor?«
James nickte mechanisch. Plötzlich spürte er das Gewicht des Armbands um sein rechtes Handgelenk – obwohl er es seit so vielen Jahren trug, dass er dessen Existenz normalerweise kaum wahrnahm. »Ich sehe sie für gewöhnlich jeden Sommer«, antwortete er. »Nur in diesem Sommer natürlich nicht.«
In diesem Sommer nicht. Als seine Eltern ihm mitteilten, dass die Familie Herondale den Sommer in London verbringen würde, war er nicht in der Lage gewesen, sie davon abzubringen. Er hatte die Gründe für seinen Wunsch, nach Idris zurückzukehren, einfach nicht vorbringen können. In ihren Augen kannte er Grace schließlich kaum. Und die krankhafte Schwäche und das pure Entsetzen, das ihn bei dem Gedanken daran ergriff, dass er sie ein weiteres Jahr lang nicht zu sehen bekam, hätte er durch nichts erklären können.
Es war ein Geheimnis, das sie seit seinem dreizehnten Lebensjahr miteinander verband. Vor seinem inneren Auge sah er die Tore der Zufahrt von Blackthorn Manor vor sich aufragen, und dazu seine eigenen Hände – die Hände eines Kindes, ohne Narben, die fleißig eine Dornenranke nach der anderen zurechtstutzten. Er sah die Große Halle des Herrenhauses und die Vorhänge, die sich vor den Fenstern im Wind bauschten, und hörte Musik. Und er sah Grace in ihrem elfenbeinfarbenen Kleid.
Matthew beobachtete ihn mit einem sorgenvollen Blick; seine grünen Augen funkelten nicht länger. Er war der einzige von James’ Freunden, der wusste, dass es eine Verbindung zwischen James und Grace Blackthorn gab.
»In London wimmelt es zurzeit von Neuankömmlingen«, sagte er. »Die Familie Carstairs wird doch auch bald hier eintreffen, nicht wahr?«
James nickte. »Lucie freut sich wie verrückt darauf, Cordelia zu sehen.«
Matthew goss sich weiteren Wein ins Glas. »Ich kann es ihnen nicht vorwerfen, dass sie vom Landleben in Devon genug haben … Wie heißt ihr Haus noch gleich? Cirenworth? Soweit ich weiß, werden sie in ein oder zwei Tagen hier sein …«
Thomas stieß sein Glas um, und James’ Getränk und Christophers Reagenzglas gleich dazu. Er musste sich noch immer daran gewöhnen, dass er mittlerweile mehr Platz einnahm als zuvor, und wirkte dadurch gelegentlich unbeholfen.
»Die ganze Familie Carstairs kommt nach London – habe ich das richtig verstanden?«, fragte er.
»Alle bis auf Elias Carstairs«, antwortete Matthew. Elias war Cordelias Vater. »Aber Cordelia, und natürlich …« Er verstummte bedeutungsvoll.
»Oh, Hölle und Teufel«, sagte Christopher. »Alastair Carstairs.« Ihm schien plötzlich übel zu werden. »Ein fürchterliches Ekel, wenn ich mich recht erinnere.«
»Und das ist noch diplomatisch ausgedrückt«, sagte James. Thomas war dabei, den umgestoßenen Wein aufzuwischen, und James warf ihm einen sorgenvollen Blick zu. Zu Schulzeiten war Thomas ein schüchterner kleiner Junge gewesen und Alastair ein gemeiner Rüpel. »Wir können uns von Alastair fernhalten, Tom. Es gibt keinen Grund dafür, ihn zu treffen, und umgekehrt kann ich mir auch nicht vorstellen, dass er großen Wert auf unsere Gesellschaft legen wird.«
Plötzlich begann Thomas zu stammeln – aber nicht als Reaktion auf James’ Worte: Der Inhalt von Christophers umgestürztem Reagenzglas hatte sich in ein sprudelndes Braunrot verwandelt und begonnen, sich durch den Tisch zu fressen. Alle vier sprangen von ihren Stühlen auf und griffen nach Pollys Geschirrtüchern. Thomas schüttete eine Karaffe voll Wasser in Richtung Tisch, die Christopher völlig durchnässte, worauf Matthew in schallendes Gelächter ausbrach.
»Alle Achtung«, sagte Christopher und strich sich ein paar nasse Haarsträhnen aus der Stirn. »Ich muss schon sagen, das hat tatsächlich gewirkt, Tom. Die Säure ist neutralisiert.«
Thomas schüttelte den Kopf. »Jemand sollte dich neutralisieren, du Tölpel.«
Matthew schluchzte jetzt beinahe vor Lachen.
Trotz des Chaos um ihn herum fühlte James sich dennoch seltsam unbeteiligt. Über viele Jahre, in vielen Hunderten geheimer Briefe, die zwischen London und Idris hin- und hergeschickt worden waren, hatten Grace und er einander geschworen, dass sie eines Tages zusammen sein würden. Dass sie eines Tages, als Erwachsene, heiraten und gemeinsam in London leben würden – egal ob ihre Eltern diese Beziehung guthießen oder nicht. Das war seit jeher ihr Traum gewesen.
Also warum hatte sie ihm nichts davon erzählt, dass sie in die Stadt kam?
»Oh, sieh nur! Die Royal Albert Hall!«, rief Cordelia und presste ihre Nase gegen das Fenster der Kutsche. Es war ein wunderschöner Tag – strahlendes Sonnenlicht ergoss sich über London und ließ die weißen Häuserzeilen in South Kensington leuchten wie die Bauernfiguren eines teuren Elfenbeinschachspiels. »Die Architektur Londons ist wahrhaft einzigartig.«
»Messerscharf beobachtet«, sagte ihr älterer Bruder Alastair gedehnt. Er saß in einer Ecke der Kutsche und hielt demonstrativ den Blick auf das Buch in seinem Schoß gesenkt – wie um allen Anwesenden klarzumachen, dass er sich nicht dazu herablassen würde, aus dem Fenster zu schauen. »Ich bin sicher, dass das noch nie jemand über die Bauten Londons gesagt hat.«
Cordelia warf ihm einen wütenden Blick zu, aber Alastair sah noch immer nicht auf. War ihm denn nicht klar, dass sie nur versuchte, die allgemeine Stimmung zu heben? Ihre Mutter Sona lehnte erschöpft an der Seitenwand der Kutsche. Sie hatte dunkle Ringe unter den Augen, und ihre sonst so schimmernde braune Haut wirkte fahl. Cordelia machte sich nun schon seit Wochen Sorgen um sie – seit dem Tage, an dem die neuesten Nachrichten über ihren Vater in Idris auch nach Devon gedrungen waren. »Die Sache ist doch die, Alastair: Wir sind nicht zu Besuch in der Stadt, sondern wir werden hier leben. Wir werden andere Menschen treffen, wir können Besucher empfangen, wir müssen uns nicht ständig im Institut aufhalten – auch wenn ich gern bei Lucie wäre …«
»Und bei James«, sagte Alastair, ohne den Blick von seinem Buch zu heben.
Cordelia biss die Zähne zusammen.
»Aber Kinder …« Cordelias Mutter warf ihnen einen tadelnden Blick zu. Alastair schien verärgert – er war nur einen Monat von seinem neunzehnten Geburtstag entfernt und, zumindest seiner Meinung nach, alles andere als ein Kind. »Es geht hier um eine ernste Angelegenheit. Wie ihr nur allzu gut wisst, sind wir nicht nach London gekommen, um uns zu amüsieren, sondern zum Wohl unserer Familie.«
Cordelia und ihr Bruder tauschten einen etwas weniger feindseligen Blick aus. Sie wusste, dass auch er sich Sorgen um Sona machte – selbst wenn er das nie zugegeben hätte. Und sie fragte sich zum millionsten Mal, wie viel er über die Angelegenheit mit Vater gehört hatte. Sie ging davon aus, dass Alastair mehr wusste als sie, dass er aber nie im Leben mit ihr darüber sprechen würde.
Ihr Herz machte vor Aufregung einen kleinen Satz, als die Kutsche vor 102 Cornwall Gardens zum Stehen kam – ein Stadthaus in einer Reihe imposanter weißer viktorianischer Häuser, dessen Hausnummer in schlichtem Schwarz auf die äußerste rechte Säule des Eingangsportals gemalt war. Mehrere Personen erwarteten sie am oberen Absatz der Eingangstreppe, unter dem Portikus. Cordelia erkannte sofort Lucie Herondale, die seit ihrer letzten Begegnung ein klein wenig gewachsen sein musste. Sie hatte ihr hellbraunes Haar unter einem Hut festgesteckt, und ihr hellblaues Kleid samt Jacke passte zur Farbe ihrer Augen.
Neben ihr standen zwei weitere Personen. Eine war Lucies Mutter, Tessa Herondale, die – zumindest in Schattenjägerkreisen – berühmte Frau von Will Herondale, dem Leiter des Londoner Instituts. Tessa wirkte fast so jung wie ihre Tochter: Sie war unsterblich, eine Hexe und Gestaltwandlerin, und sie alterte nicht.
Direkt neben Tessa stand James.
Cordelia erinnerte sich daran, wie sie einmal als kleines Mädchen die Hand ausgestreckt hatte, um einen Schwan zu streicheln, der auf dem Teich neben ihrem Haus schwamm. Der Vogel hatte sie attackiert, war dabei gegen ihren Körper geprallt und hatte sie umgeworfen. Danach hatte sie minutenlang im Gras gelegen und keuchend versucht, wieder zu Atem zu kommen, starr vor Entsetzen bei dem Gedanken, dass sie nie wieder Luft in ihre Lunge saugen könnte.
Zugegeben, es war nicht unbedingt die romantischste Vorstellung der Welt, aber es stimmte: Jedes Mal, wenn sie James Herondale sah, fühlte sie sich, als wäre sie gerade von einem Schwimmvogel attackiert worden.
Er war wunderschön – so schön, dass sie bei seinem Anblick das Atmen vergaß. Sein wildes, zerzaustes schwarzes Haar sah aus, als würde es sich wunderbar weich anfühlen, und seine langen dunklen Wimpern umrahmten Augen, deren Farbe Cordelia an Honig oder Bernstein erinnerte. Mit seinen inzwischen siebzehn Jahren wirkte er nicht mehr so ungelenk wie früher, sondern schlank und attraktiv und perfekt proportioniert – wie ein Meisterwerk der Architektur.
»Uff!« Ihre Füße berührten den Boden, und sie wäre beinahe gestolpert. Irgendwie musste sie die Tür der Kutsche aufgerissen haben, denn jetzt stand sie auf dem Gehweg. Dabei konnte von »stehen« kaum die Rede sein: Sie kämpfte verzweifelt um ihr Gleichgewicht, weil ihre Beine nach der stundenlangen Kutschfahrt eingeschlafen waren.
Sofort erschien James neben ihr, schob eine Hand unter ihren Arm und stützte sie. »Daisy«, fragte er, »geht es dir gut?«
Daisy – sein alter Spitzname für sie. Er erinnerte sich also.
»Pure Unbeholfenheit«, sagte sie kläglich. »Eigentlich hatte ich einen anmutigeren Auftritt geplant.«
»Kein Grund zur Sorge«, erwiderte er lächelnd, und ihr Herz setzte förmlich aus. »Die Gehwege von South Kensington sind berühmt für ihre Boshaftigkeit. Ich selbst bin schon mehrfach von ihnen attackiert worden.«
Gib eine schlaue Antwort, ermahnte sie sich. Sag irgendetwas Geistreiches!
Doch er hatte sich schon abgewandt und den Kopf in Alastairs Richtung gedreht. Cordelia wusste, dass die beiden zu Schulzeiten nicht besonders gut miteinander ausgekommen waren – eine Tatsache, von der ihre Mutter nichts ahnte: Sona war bis heute der Ansicht, Alastair sei in der Schule äußerst beliebt gewesen.
»Wie ich sehe, bist du ebenfalls angereist, Alastair«, sagte James mit einer seltsam ausdruckslosen Stimme. »Und du siehst …«
Überrascht betrachtete er Alastairs strahlend weißblondes Haar. Cordelia wartete darauf, dass er fortfuhr, und hoffte, dass er etwas sagen würde wie Du siehst aus wie eine Steckrübe. Doch das tat er nicht.
»Du siehst gut aus«, sagte er schließlich.
Während die Jungen einander schweigend betrachteten, kam Lucie die Treppe heruntergelaufen und schlang ihre Arme um Cordelia. »Ich freue mich wirklich, wirklich sehr, dich zu sehen!«, sagte sie auf ihre typische, leicht atemlose Art. Für Lucie war immer alles wirklich, wirklich … egal, ob es sich um etwas Schönes oder Aufregendes oder Schreckliches handelte. »Meine liebste Cordelia, wir werden so viel Spaß haben!«
»Lucie, Cordelia und ihre Familie sind nach London gekommen, damit du und Cordelia gemeinsam trainieren könnt«, warf Tessa mit sanfter Stimme ein. »Das bedeutet viel Arbeit und Verantwortung.«
Cordelia blickte nach unten auf ihre Schuhe. Tessa blieb dankenswerterweise bei der Geschichte, nach der die Carstairs in aller Eile nach London hatten reisen müssen, weil Cordelia und Lucie Parabatai werden wollten und dafür sehr viel trainieren mussten – auch wenn das nicht unbedingt der Wahrheit entsprach.
»Nun, Sie erinnern sich doch sicher noch selbst daran, wie es mit sechzehn war, Mrs Herondale«, meinte Sona. »Junge Mädchen sind nun einmal ganz vernarrt in festliche Bälle und schöne Kleider. Das galt ganz sicher für mich damals, und ich kann mir vorstellen, dass es bei Ihnen auch nicht anders war.«
Cordelia wusste, dass ihre Mutter nicht die reine Wahrheit sagte, blieb aber stumm. Tessa zog eine Augenbraue hoch. »Ich erinnere mich an eine Vampirfeier. Und an eine Art Party auf Benedict Lightwoods Anwesen. Aber das war natürlich, bevor er Dämonenpocken bekam und sich in einen Wurm verwandelte …«
»Mutter!«, rief Lucie entsetzt.
»Na ja, er hat sich aber doch in einen Wurm verwandelt«, sagte James. »Eigentlich mehr in eine bösartige Riesenschlange. Das weiß ich aus einer der interessantesten Geschichtsstunden, die wir je hatten.«
Die Ankunft des Transportunternehmens, das die Habseligkeiten der Familie Carstairs anlieferte, verhinderte weitere Kommentare von Tessas Seite. Mehrere kräftige Männer sprangen von einem der Wagen herunter und machten sich daran, die Seile und Packleinwände zu entfernen, mit denen die verschiedenen Möbelstücke sorgfältig verpackt und festgezurrt gewesen waren.
Einer der Möbelpacker half Risa – Sonas Zofe und Köchin – vom ersten Wagen herunter. Risa hatte bei der Familie Jahanshah angefangen, als Sona noch ein junges Mädchen gewesen war, und stand seit damals in deren Diensten. Sie war eine Irdische mit der Gabe des Zweiten Gesichts und daher eine wertvolle Gefährtin für eine Schattenjägerfamilie. Risa sprach nur Persisch, und Cordelia fragte sich, ob die Männer im Wagen versucht hatten, sich mit ihr zu unterhalten. Dabei verstand Risa jedes englische Wort – sie hatte nur einfach gern ihre Ruhe.
»Bitte richten Sie Cecily Lightwood meinen Dank aus, dass sie uns ihre Haushaltshilfen überlässt«, wandte sich Cordelias Mutter an Tessa.
»Aber natürlich! Sie werden jeden Dienstag und Donnerstag vorbeikommen und sich um das Gröbste kümmern, bis Sie selbst passende Bedienstete gefunden haben«, erwiderte Tessa.
»Das Gröbste« umfasste alles, was von Risa – die kochte, die Einkäufe erledigte und Sona und Cordelia beim Anziehen half – nicht erwartet werden konnte, wie etwa das Schrubben der Böden oder die Pflege der Pferde. Doch im Grunde war die Behauptung, dass die Carstairs bald ihre eigene Dienerschaft anstellen würden, nichts als ein Vorwand. Cordelia wusste, dass die Familie bei ihrer Abreise aus Devon alle Bediensteten außer Risa entlassen hatte, um möglichst viel Geld zu sparen, während Elias Carstairs auf sein Gerichtsverfahren wartete.
Dann fiel ihr Blick auf einen großen Kasten, der auf einem der Wagen stand. »Mama!«, rief sie. »Du hast das Piano mitgebracht?«
Ihre Mutter zuckte die Achseln. »Ich mag nun mal ein wenig Musik im Haus.« Dann deutete sie mit gebieterischer Miene in Richtung der Packer. »Cordelia, es wird hier noch eine Weile unordentlich und laut sein. Möchtest du nicht gemeinsam mit Lucie ein wenig die Nachbarschaft erkunden? Alastair, du bleibst bitte hier und hilfst mir mit den Anweisungen für die Dienerschaft.«
Cordelia war begeistert von der Aussicht, ein wenig Zeit allein mit Lucie verbringen zu können. Alastairs Gesichtsausdruck schwankte dagegen zwischen Verdrossenheit über die Tatsache, dass er mit seiner Mutter zurückbleiben musste, und eitler Selbstgefälligkeit darüber, dass man ihm die Aufgaben des Hausherrn übertragen hatte.
Tessa Herondale wirkte amüsiert. »James, bitte begleite die Mädchen. Vielleicht in die Kensington Gardens? Es ist nur ein kurzer Weg und ein wunderschöner Tag.«
»Die Kensington Gardens scheinen mir sicher zu sein«, sagte James ernst.
Lucie verdrehte die Augen und griff nach Cordelias Hand. »Dann lass uns schnell aufbrechen«, sagte sie und zog sie die Stufen hinunter auf den Gehweg.
James holte die beiden mit langen Schritten mühelos ein. »Kein Grund, gleich loszustürmen, Lucie«, sagte er. »Mutter wird dich schon nicht zurückschleifen und von dir verlangen, dass du das Piano ins Haus schleppst.«
Cordelia warf ihm einen Seitenblick zu. Der Wind hatte seine schwarzen Haare zerzaust. Nicht einmal das Haar ihrer Mutter war so dunkel; es besaß einige rote und blonde Strähnen. James’ Haare wirkten dagegen wie flüssige Tinte. Er erwiderte ihren Blick mit einem leichten Lächeln – so als ob er sie nicht gerade dabei erwischt hätte, wie sie ihn anstarrte. Aber wahrscheinlich war er sowieso daran gewöhnt, dass man ihn anstarrte, wenn er mit anderen Schattenjägern unterwegs war. Nicht nur wegen seines Aussehens, sondern auch aus anderen Gründen.
Lucie drückte kurz ihren Arm. »Ich freue mich so, dass du hier bist«, erklärte sie. »Ich hätte nie gedacht, dass es tatsächlich passieren würde.«
»Warum nicht?«, fragte James. »Das Gesetz verlangt, dass ihr miteinander trainieren müsst, um Parabatai werden zu können. Außerdem betet Vater Daisy an, und er stellt die Regeln auf.«
»Dein Vater betet jedes Mitglied der Familie Carstairs an«, sagte Cordelia. »Ich glaube also nicht, dass das mein alleiniges Verdienst ist. Er mag sogar Alastair.«
»Ich glaube, er hat sich selbst eingeredet, dass Alastair verborgene Tiefen besitzt«, meinte James.
»Genau wie Treibsand«, sagte Cordelia.
James lachte.
»Das genügt jetzt«, sagte Lucie und streckte den Arm aus, um James mit ihrer behandschuhten Hand einen leichten Klaps auf die Schulter zu versetzen. »Daisy ist meine Freundin, und du belegst sie völlig mit Beschlag. Lauf los und mach irgendetwas anderes.«
Sie gingen über die Queen’s Gate in Richtung Kensington Road, begleitet vom Dröhnen des dichten Omnibusverkehrs. Cordelia stellte sich vor, wie James einfach in der Menge der Passanten verschwand, in der es sicherlich etwas zweifellos viel Interessanteres zu entdecken gab. Oder vielleicht würde er ja von einer wunderschönen, reichen Erbin entführt werden, die sich auf den ersten Blick in ihn verliebt hatte. Solche Dinge passierten schließlich in London ständig.
»Ich werde zehn Schritte hinter euch zurückbleiben wie ein Schleppenträger«, sagte James. »Aber ich darf euch nicht aus den Augen lassen, sonst wird Mutter mich umbringen. Und dadurch würde ich den morgigen Ball verpassen, und Matthew würde mich umbringen, und damit wäre ich gleich doppelt tot.«
Cordelia lächelte, aber James hatte sich bereits, wie angekündigt, zurückfallen lassen. Er schlenderte hinter den beiden Mädchen her und ließ ihnen genug Raum, sich ungestört miteinander zu unterhalten. Cordelia versuchte, sich die Enttäuschung darüber nicht anmerken zu lassen – immerhin lebte sie jetzt in London und würde James daher nicht nur gelegentlich, sondern hoffentlich regelmäßig zu sehen bekommen.
Sie warf einen Blick über die Schulter zu ihm, doch er hatte bereits ein Buch in die Hand genommen, las beim Gehen und pfiff dabei leise vor sich hin.
»Von welchem Ball hat er gesprochen?«, fragte sie, wieder an Lucie gewandt. Sie hatten die schwarzen schmiedeeisernen Tore der Kensington Gardens passiert und liefen nun im Schatten der Bäume. Der öffentliche Park war um diese Tageszeit voller Kindermädchen, die Kinderwagen mit den Babys ihrer Herrschaft durch die Gegend schoben, und jungen Pärchen, die gemeinsam unter den belaubten Zweigen spazieren gingen. Zwei kleine Mädchen bastelten Ketten aus Gänseblümchen, und ein Junge in einem blauen Matrosenanzug trieb einen Reifen vor sich her und quietschte vor Vergnügen. Er rannte auf einen großen Mann zu, der ihn hochhob und lachend durch die Luft schwang. Cordelia kniff einen Moment die Augen zu, denn sie musste an ihren eigenen Vater denken und daran, wie er sie als kleines Mädchen in die Luft geworfen hatte und sie die ganze Zeit gelacht hatte, bis er sie wieder auffing.
»Von dem Ball morgen Abend«, antwortete Lucie und hakte sich bei Cordelia unter. »Der Ball, den wir zur Feier eurer Ankunft in London veranstalten. Die ganze Brigade wird anwesend sein, und es wird getanzt werden, und Mutter bekommt endlich die Gelegenheit, mit unserem neuen Ballsaal anzugeben. Und ich werde Gelegenheit haben, mit dir anzugeben.«
Cordelia spürte, wie sie ein Schauer überlief – vor Aufregung, aber auch vor Angst. Als »Brigade« bezeichnete man die Gemeinschaft aller Schattenjäger von London: Jede Stadt hatte eine solche Brigade, die ihrem örtlichen Institut unterstand sowie der übergeordneten Autorität des Rats und der Konsulin. Sie wusste, dass es töricht war, aber beim Gedanken an so viele Menschen begann ihre Haut vor Angst zu kribbeln. Menschenmengen hatte sie in ihrem bisherigen Leben nie kennengelernt: Sie und ihre Familie waren ständig auf Reisen gewesen, außer wenn sie sich in Cirenworth Hall in Devon aufhielten.
Und doch würde sie sich von jetzt an daran gewöhnen müssen – sie und alle anderen, die mit ihr nach London gezogen waren. Cordelia musste an ihre Mutter denken.
Es handelte sich nicht um einen Ball, sagte sie sich selbst – sondern um das erste Gefecht in einem Krieg.
»Werden alle dort … werden alle Anwesenden über meinen Vater Bescheid wissen?«, fragte sie leise.
»Aber nein. Nur sehr wenige Leute kennen überhaupt einige Details, und die sind äußerst verschwiegen.« Lucie warf ihr einen forschenden Blick zu. »Wärst du … Würdest du mir erzählen, was passiert ist? Ich schwöre, ich werde keiner Seele etwas davon erzählen, nicht einmal James.«
Cordelia wurde die Brust eng vor Kummer – wie immer, wenn sie an ihren Vater dachte. Aber sie würde Lucie und auch einigen anderen die Wahrheit sagen müssen. Schließlich würde sie ihrem Vater nur helfen können, wenn sie ihre Wünsche offen aussprechen konnte. »Vor etwa einem Monat ist mein Vater nach Idris gereist«, setzte sie an. »Der Auftrag wurde mit größter Verschwiegenheit behandelt, aber man hatte knapp außerhalb der Grenzen von Idris ein Nest von Kravyād-Dämonen entdeckt.«
»Wirklich?«, fragte Lucie. »Die sind besonders heimtückisch, oder? Menschenfresser, wenn ich mich recht erinnere.«
Cordelia nickte. »Die Dämonen hatten ein ganzes Werwolfrudel so gut wie ausgerottet – und die Werwölfe haben sich schließlich an Alicante wegen Hilfe gewandt. Daraufhin stellte die Konsulin ein Expeditionskorps von Nephilim zusammen und berief auch meinen Vater hinzu, aufgrund seiner Erfahrung mit seltenen Dämonenarten. Gemeinsam mit zwei Schattenweltlern half er bei der Planung der Expedition zur Vernichtung der Kravyāds.«
»Das klingt äußerst aufregend«, sagte Lucie. »Und wie schön, dass so etwas in Zusammenarbeit mit Schattenweltlern durchgeführt wird.«
»Ja, das hätte es eigentlich auch sein sollen«, erwiderte Cordelia. Sie schaute sich erneut kurz um, aber James ging ein gutes Stück hinter ihnen, den Blick in sein Buch gerichtet. Aus dieser Entfernung konnte er sie unmöglich hören. »Aber die Expedition erwies sich als Fehlschlag. Die Kravyād-Dämonen waren längst verschwunden, und stattdessen hatten die Nephilim einen Landstrich durchquert, den ein Vampirclan für sich beanspruchte. Also kam es zu einem Kampf – mit schrecklichem Ausgang.«
Lucie wurde bleich. »Beim Erzengel – ist jemand getötet worden?«
»Mehrere Nephilim wurden schwer verletzt«, fuhr Cordelia fort. »Und der Vampirclan glaubte, dass wir … dass die Schattenjäger sich mit den Werwölfen verbündet hätten, um sie anzugreifen. Das Ganze war ein schreckliches Durcheinander, ein Vorfall, der das Ende des Abkommens hätte bedeuten können.«
Lucie starrte sie entsetzt an. Cordelia konnte es ihr nicht verübeln: Das Abkommen war ein Friedensvertrag zwischen Schattenjägern und Schattenweltlern und Grundlage der gegenwärtigen Ordnung. Falls es zu einem Bruch kam, wäre ein blutiges Chaos nahezu unvermeidlich.