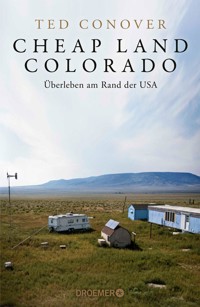
21,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Droemer eBook
- Kategorie: Geisteswissenschaft
- Sprache: Deutsch
Zwischen Zivilisation und Niemandsland – eine herausragende Reportage von der letzten Frontier der USA Die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner haben noch nie vom San Luis Valley gehört: einer flachen, weiten Prärielandschaft mitten im Nirgendwo. Das riesige Gebiet ist nicht erschlossen, trotzdem leben hier Menschen ihren Traum vom eigenen Landbesitz – und von einem besseren Leben. Wer sind die Männer und Frauen, die verstreut in Wohnwagen leben, sich ihren Lebensunterhalt mit Marihuana-Anbau oder Goldschürfen verdienen? Und was können sie uns über Amerika erzählen? Ted Conover gilt als einer der größten Journalisten seiner Generation. Über Jahre hinweg lernt er die Bewohner der sogenannten Flats immer besser kennen. Er trifft Veteranen, Kriminelle, Waffen-Liebhaber und religiöse Fundamentalisten. Prepper, Trump-Jünger und Verschwörungstheoretiker. Aber er macht auch die Bekanntschaft von intakten Familien, erlebt Gastfreundschaft und immer wieder ein starkes Gemeinschaftsgefühl. Meisterhaft taucht Ted Conover in seinem neuen Buch in das Leben dieser Einsiedler ein – und kehrt mit einem unvergesslichen Porträt eines vergessenen Teils der heutigen amerikanischen Gesellschaft zurück. So gelingt ihm nicht weniger als ein atmosphärisches dichtes Stimmungsbild einer gespaltenen Nation. »Einer unserer großen erzählenden Journalisten.« The New York Times »Mit seiner gründlichen und einfühlsamen Reportage beschwört Conover eine lebendige, geheimnisvolle Subkultur herauf, die von Männern und Frauen bevölkert wird, die fesselnde Geschichten zu erzählen haben.« The Washington Post Ted Conover (Jg. 1958) ist Journalist, Schriftsteller und lehrt als Professor an der New York University. Er gilt als ein Meister der immersiven Reportage und veröffentlichte u. a. im New York Times Magazine, dem New Yorker und im Atlantic. Er wurde mit dem National Book Critics Circle Award ausgezeichnet und für den Pulitzer Prize nominiert. Nach Vorhof der Hölle (2001) und Die Wege der Menschen (2011) ist Cheap Land Colorado sein erstes Buch bei Droemer Knaur.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 518
Veröffentlichungsjahr: 2024
Ähnliche
Ted Conover
Cheap Land Colorado
Überleben am Rand der USA
Aus dem Englischen von Christiane Bernhardt
Verlagsgruppe Droemer Knaur GmbH & Co. KG.
Über dieses Buch
Die meisten Amerikanerinnen und Amerikaner haben noch nie vom San Luis Valley gehört: einer flachen, weiten Prärielandschaft mitten im Nirgendwo. Das riesige Gebiet ist nicht erschlossen, trotzdem leben hier Menschen ihren Traum vom eigenen Landbesitz – und von einem besseren Leben. Wer sind die Männer und Frauen, die verstreut in Wohnwagen leben, sich ihren Lebensunterhalt mit Marihuana-Anbau oder Goldschürfen verdienen? Und was können sie uns über Amerika erzählen?
Ted Conover gilt als einer der größten Journalisten seiner Generation. Über Jahre hinweg lernt er die Bewohner der sogenannten Flats immer besser kennen. Er trifft Veteranen, Kriminelle, Waffen-Liebhaber und religiöse Fundamentalisten. Prepper, Trump-Jünger und Verschwörungstheoretiker. Aber er macht auch die Bekanntschaft von intakten Familien, erlebt Gastfreundschaft und immer wieder ein starkes Gemeinschaftsgefühl.
Meisterhaft taucht Ted Conover in seinem neuen Buch in das Leben dieser Einsiedler ein – und kehrt mit einem unvergesslichen Porträt eines vergessenen Teils der heutigen amerikanischen Gesellschaft zurück. So gelingt ihm nicht weniger als ein atmosphärisches dichtes Stimmungsbild einer gespaltenen Nation.
»Einer unserer großen erzählenden Journalisten.« The New York Times
»Mit seiner gründlichen und einfühlsamen Reportage beschwört Conover eine lebendige, geheimnisvolle Subkultur herauf, die von Männern und Frauen bevölkert wird, die fesselnde Geschichten zu erzählen haben.« The Washington Post
Inhaltsübersicht
Widmung
Motto
Prolog
1 Cheap Land Colorado
2 Mein Prärieleben, Teil I
3 So viele unterschiedliche Menschen, oder: Mein Prärieleben, Teil II
4 Unbebautes Land
5 Besitz
6 Liebe und Mord
7 Waffen, Viren und der Klimawandel
Epilog Zufluchtsort und Exil
Dank
Quellen
Meinen Eltern und Schwestern gewidmet,
für all die Hilfe,
und
für Margot, einmal mehr
Diese Landschaft ist mir die liebste. Gerne hätte ich sie täglich vor Augen, lebe heute jedoch in den Bergen. Nach meinem Dafürhalten sehen die High Plains, die Great Plains und die Kurzgrassteppe genauso aus, wie eine Landschaft aussehen sollte: karg und weit, mit Sandhügeln und gewaltigen Wolkengebilden am Himmel. Und dann ist da der Wind, der durch sie hindurchfegt und auf seinem Weg von Kanada nach Texas von nichts aufgehalten werden kann, außer vom Stacheldrahtzaun.
Es ist ein trockener Ort, aber nicht öde, auch wenn das viele Menschen meinen. Er mag nicht lieblich sein und ist doch schön, wenn man weiß, wie man ihn zu betrachten hat. Bäume gilt es, aus seinen Gedanken verbannen. Grün sollte man vergessen. Man muss herunterschalten, still sein; aus dem Auto aussteigen und innehalten.
Kent Haruf
Prolog
Es beginnt mit der Kontaktaufnahme – damit, dass man an einem Grundstück vorfährt und versucht, sich bekannt zu machen.
Allein die Vorstellung ist beängstigend: Viele Menschen leben hier draußen, weil sie niemandem begegnen wollen. Sie suchen die Einsamkeit. Beängstigend ist es auch, weil viele von ihnen dieser Vorliebe Nachdruck verleihen, indem sie ihre Auffahrt mit einem Tor versperren oder einen Hund neben der Eingangstür anketten oder ein Schild mit Zielfernrohrmotiv anbringen, auf dem steht: »Wer das lesen kann, ist in Schussweite!«
Der lokale Fachmann für unangemeldete Besuche ist Matt Little, den die soziale Einrichtung La Puente mit aufsuchender Sozialarbeit im ländlichen Raum (»Rural Outreach«) beauftragt hat. Matt nahm mich in seinem Pick-up mit, damit ich ihm bei seiner Arbeit zusehen konnte. Die Entfernungen zwischen den Haushalten in der offenen Prärie Colorados sind gewaltig. Das gab ihm Zeit, mir sein Vorgehen zu erklären, über das er viel nachgedacht hat – und das offensichtlich funktioniert: Immerhin ist diese Arbeit sein täglich Brot, und er wurde in den letzten drei Monaten nicht erschossen.
Sollten Sie glauben, die Checkliste sei kurz, irren Sie sich. Bevor man sich auch nur in die Nähe eines Grundstücks begibt, muss man sich erst einmal klarmachen, was für einen Eindruck man hinterlässt. Matt fährt einen Ford Ranger Baujahr 2009 mit einem magnetischen »La Puente«-Schild an der Tür. Nichts Schickes. Auch Matt ist nicht gerade schick: Er ist neunundvierzig, Veteran, war auf zwei Einsätzen im Irak; er ist ein schmaler Mann aus der Provinz West Virginias, der gerne lächelt. Er raucht Zigaretten und trägt manchmal einen Bart. Er rät mir, kein blaues Hemd anzuziehen, da Blau die Farbe der Bauaufsichtsbehörde in Costilla County sei, und mit denen willst du nicht verwechselt werden. La Puente hat ihm einen weinroten Kapuzenpullover und ein Poloshirt mit Logo bestellt, und für gewöhnlich trägt er entweder den einen oder das andere zu Jeans und Stiefeln.
Häufig fährt er öfter als einmal an einer Behausung vorbei, bevor er tatsächlich anhält, um sie auszukundschaften. Flattert da eine amerikanische Flagge? Das bedeutet oft eine Schusswaffe im Inneren. Liegen Kinderspielsachen herum? Ist da ein kleines Gewächshaus oder ein hinter einem Zaun verstecktes Fleckchen, das darauf hinweist, dass Cannabis angebaut wird? (Zu Beginn dachte ich, das sei ein gutes Zeichen, da Cannabis Menschen tendenziell entspannt. Doch da widersprach mir Matt vehement. »Eine ausgewachsene Pflanze ist unter Umständen mehrere Tausend Dollar wert und begehrtes Diebesgut!«) Wichtiger noch aber ist, ob die Bleibe bewohnt ist. Sind da frische Reifenspuren? Kommt Rauch aus dem Schornstein? Zahlreiche Behausungen in der Prärie stehen leer oder sind nur im Sommer bewohnt.
Matt war ein Grundstück aufgefallen, auf dessen mit Stacheldraht umzäuntem Inneren jemand Wälle errichtet hatte. Er sah Patronenhülsen und vermutete, dass es sich bei dem Bewohner um einen Veteranen mit psychischen Problemen handelte: »Ich dachte mir, der spielt Krieg und stellt nach, was er durchlebt hat.« Er fuhr hin, um es mir zu zeigen. Das Grundstück lag am Ende einer Sackgasse, was es erschwerte, so zu tun, als würde man einfach nur vorbeifahren.
Matt erzählte, er habe die ersten Male am Ende der Straße angehalten, der Person, die ihn womöglich beobachtete, zugewinkt und sei dann umgekehrt. So machte er einen Monat lang weiter und winkte oder hupte, ohne zu verweilen, bis er eines Tages einen Mann vor dem Haus sah, der Tarnkleidung trug. Matt parkte seinen Truck und stieg aus.
»Ich bin Matt von La Puente«, sagte er. »Ich habe ein bisschen Feuerholz dabei.« Er zeigte auf das Holz auf der Ladefläche seines Trucks, etwas Nützliches, das sich sein Arbeitgeber als Markenzeichen, als Eisbrecher ausgedacht hatte.
Der Mann griff nach einem AK-47. »Du bist ein verdammt zähes Arschloch«, sagte er. Dann: »Was soll es kosten?«
»Es ist gratis«, sagte Matt.
Der Kerl ging auf das Tor zu, öffnete es und winkte Matt hinein.
Normalerweise, erklärte mir Matt, treffe man niemanden draußen an, das Prozedere sei also, am Ende der Auffahrt anzuhalten und zu hupen. Beim ersten Lebenszeichen stieg Matt meist aus seinem Truck, sodass man ihn, eine (hoffentlich) nicht bedrohlich wirkende Gestalt, sehen konnte. Manchmal ließ er Feuerholz, eine Visitenkarte mit seiner Handynummer oder das Angebot zurück, wiederzukommen, sollten die Betreffenden Nahrungsmittel oder Unterstützung beim Ausfüllen eines Antrags benötigen oder eine Mitfahrgelegenheit für einen Arzttermin in der Stadt oder jemanden, der ein Medikament für sie abholte.
Ich passte gut auf, da ich bald selbst anfangen sollte, als Ehrenamtlicher für La Puente zu arbeiten. Es schien eine gute Vorgehensweise, um isoliert lebende Präriebewohner kennenzulernen, und Matt sagte, er könne meine Unterstützung gebrauchen.
Ich setzte mir drei neue Kontakte pro Tag als Ziel. La Puente lieh mir ein »Rural Outreach«-Schild für die Tür meines Pick-ups. Ich wählte eine Gegend und fuhr sie so langsam wie möglich ab, ohne verdächtig auszusehen. Ich ging davon aus, dass viele der Unterkünfte, die ich auskundschaftete, verlassen waren.
Schließlich entschied ich mich für ein Grundstück mit einer kurzen Auffahrt, da ich mir dachte, dass es so schwerer sei, mich zu ignorieren, und einfacher, mich einzuschätzen. Es war ein bescheidenes Haus, vor dem allerlei Müll und Schrott herumlag, darunter kaputte Fahrzeuge, doch anhand der Spuren auf der staubigen Schotterpiste konnte ich sehen, dass jemand hinein- und herausgefahren war. Ich hielt an und betätigte meine Hupe. Genau in dem Moment bemerkte ich, dass sich jemand in dem Jeep Wagoneer vor dem Haus befand. Ich ließ mein Fenster herunter. Kurz darauf öffnete auch er sein Fenster einen Spaltbreit. Ich stieg aus meinem Truck, und um mein Selbstbewusstsein und meine guten Absichten unter Beweis zu stellen, ging ich zu ihm hinüber.
»Hi, ich bin Ted von La Puente«, sagte ich.
»Hey«, sagte er. Seine grüne Corona-Bier-Baseballkappe hatte die gleiche Farbe wie seine Augen.
Ich erzählte ihm von dem Feuerholz.
»Normalerweise nehme ich keine Almosen und so an.«
»Verstehe ich«, erwiderte ich. Er sei gerade aus der Entzugsklinik zurück, sagte er. Weswegen er dort gewesen sei, erkundigte ich mich. Opioide, lautete seine Antwort.
»Und wie geht es Ihnen jetzt?«, fragte ich.
»Ganz gut bislang. Möchten Sie eine Limo?« Er bot mir eine Sprite an, die ich gerne annahm.
Es war November und kalt und windig, und ich hatte meine Jacke im Auto gelassen. Ich hätte sie mir wohl besser geholt, hoffte aber, dass er mich jeden Augenblick in seinen Truck bitten würde, in dem es so warm war, dass ihm ein T-Shirt genügte; auf dessen Vorderseite stand »Single and Ready to Jingle«.
Er bat mich nicht in sein Auto, wollte sich aber unterhalten, und bald darauf erzählte er mir, dass er einmal, als er weg war, einen Kerl in seinem Haus hatte wohnen lassen. Dann, als er zurückkam, gerieten die beiden aneinander, und der Kerl schoss auf ihn. »Genau hier.« Er hielt mir seinen Arm hin, um mir eine große verwachsene Narbe zu zeigen.
Anstatt auf einen Einsiedler zu treffen, dem ich jedes Wort einzeln aus der Nase ziehen musste, fand ich mich in Gesellschaft eines gesprächigen, kontaktfreudigen Menschen, der ganz offensichtlich jemanden zum Reden brauchte … auch wenn er mich nicht in sein Auto lassen wollte.
Hupend versuchte ich mein Glück bei drei weiteren Behausungen, deren Besitzer gerade entweder nicht da waren oder in denen niemand wohnte, und fuhr jedes Mal mit dem Gefühl davon, mich zum Narren gemacht zu haben. Doch dann erblickte ich unweit der Straße ein bescheidenes Häuschen mit einem Pferd auf einer kleinen Koppel und ein paar Hühnern in einem Gehege. Ich hielt am Tor an und hupte. Augenblicklich wurde ich von mehreren Heelern umringt. Ein paar der Hunde knurrten mich an, also machte ich besänftigende Geräusche und hoffte das Beste. Nach ein paar Minuten erschien ein etwa sechzig Jahre alter Hispanic und lief aus etwa fünfzig Metern Entfernung auf das Tor zu. Während er herüberschlenderte, las ich eine amtliche Mitteilung des County, die an einen Zaunpfahl geheftet war. »Unterlassungsklage« stand darauf zu lesen.
»Sind sie wegen der fehlenden Kläranlage hinter Ihnen her?«, fragte ich. Es war ein weitverbreitetes Problem.
»Nein, wegen der Steuern«, sagte der Mann. »Sie haben keine Rechnung geschickt. Ich kooperiere mit ihnen.« Ich bot ihm Holz an, das er annahm, und neue Bettwäsche, die ich zufälligerweise dabeihatte, doch die lehnte er ab (»Ich schlaf in meinen Klamotten«). Er sagte, er sei einem Gericht zehn Stunden gemeinnützige Arbeit schuldig, und fragte, ob er sie bei La Puente ableisten könne. Ich gab ihm die Telefonnummer des Büros und ermutigte ihn, anzurufen. Wir verabschiedeten uns, und ich stieg wieder in meinen Truck. Ich drehte den Zündschlüssel um und … nichts. Beschämt hupte ich erneut. Abermals wurde ich von den Hunden belagert. Der Mann kam wieder heraus und bot mir ohne Umschweife Starthilfe an – es lag auch in seinem Interesse, da ich sein Tor blockierte.
Bei der nächsten Adresse, die ich ins Visier nahm, kam mir das Wort »Wagenburg« in den Sinn. Eine Ansammlung alter Fahrzeuge – darunter ein Lincoln, ein Wohnwagen, ein Pick-up, ein VW-Bus sowie ein SUV – bildeten etwa drei Viertel eines Kreises, wie ein Planwagenzug, der sich in Erwartung eines Angriffs in der Prärie in Stellung bringt, oder ein Donut, bei dem ein großer Bissen fehlt. Draußen sah ich Ziegen, ein Lebenszeichen, doch ich hielt inne: Das Haus war etwa ein Fußballfeld von der Straße entfernt. Niemand würde mein Hupen hören und an mein Fenster kommen. Was soll’s, dachte ich und beschloss, auf das Grundstück zu fahren.
Ich hupte beim Heranfahren und hupte zur Sicherheit noch einmal, als ich mich dem Gebäude näherte und meinen Truck abstellte. Das Wohnhaus befand sich auf der Beifahrerseite, und so ließ ich das Beifahrerfenster herunter, um besser sichtbar zu sein.
Ein weißer Mann mittleren Alters, der eine Sportsonnenbrille mit verspiegelten Gläsern und eine Baseballkappe trug, trat aus einer Tür, ging ein paar Schritte auf mich zu und kam an meine Seite des Trucks. Er blieb auf Distanz und behielt die rechte Hand in der Tasche seines Kapuzenpullovers; ich vermutete eine Pistole darin.
»Wie geht’s?«, fragte er in einem Ton, der sagte: Erklär dich. Ich ließ ihn wissen, ich sei Ted von La Puente, neu in der Gegend, wollte mich nur vorstellen, hätte ein bisschen Feuerholz …
Er unterbrach mich: »Es ist gefährlich, einfach so bei jemandem vorzufahren. Sie müssen entweder mutig oder ein bisschen dämlich sein.« Er lächelte vielsagend.
»Wahrscheinlich ein bisschen dämlich«, räumte ich ein.
Er sei nur zu Besuch da, aus Kalifornien, erzählte er mir schließlich. »Tony wird wahrscheinlich demnächst zurück sein.«
Ich zählte den Namen und die ganzen Autos zusammen. »Warten Sie mal – gehört das Grundstück Tie Rod Tony?« Ihm war ich bereits begegnet. Der Mann nickte. Plötzlich hatte ich keine Angst mehr. Aber ich fühlte mich schwermütig wie eine Katze, die gerade eines ihrer neun Leben vergeudet hat.
1Cheap Land Colorado
Wir kommen wegen der Ausmaße.
Linda Gregerson, Schlafender Bär
Heute ist man zu fortschrittlich. Alles hat sich zu schnell geändert. Eisenbahn und Telegraph, Petroleum und Kohlenherde – es sind alles Annehmlichkeiten, die nur den Nachteil haben, daß die Menschen zu abhängig davon werden.
Laura Ingalls Wilder, Laura und der lange Winter
Meine erste Begegnung mit dem San Luis Valley hatte ich bei einem Familienausflug, als ich elf Jahre alt war. Wir blieben auf den befestigten Straßen, doch allein das war bereits eindrucksvoll. Die Great Sand Dunes, heute der Great-Sand-Dunes-Nationalpark, sahen wie die Landschaftskulisse eines Kinofilms aus, bis wir uns selbst darin befanden. Ihre Entstehungsgeschichte faszinierte mich: Sandkörner, die von einer Seite dieser riesigen Fläche, die in etwa der Größe New Jerseys entspricht, hinübergeweht wurden, hatten sich auf der anderen Seite zu gigantischen Dünen aufgetürmt. In den San Juan Mountains im Westen befanden sich die Überreste eines uralten Supervulkans von gewaltigem Ausmaß, dessen Eruption womöglich die größte Explosion der Erdgeschichte markierte.
Wenn man an einem schönen Ort aufwächst, der jedes Jahr etwas von seiner Schönheit durch Besiedlung (das heißt durch seine bauliche Erschließung) verliert, lernt man das Unveränderliche zu schätzen. Das San Luis Valley sieht auch heute noch ziemlich genauso aus wie vor hundert, ja selbst vor zweihundert Jahren. Der Blanca Peak überblickt mit seinen 4367 Höhenmetern als viertgrößter Berg der Rockies eine schier unendliche Weite.
Karte des San Luis Valley
Den Blanca, nach dem Schnee benannt, der seinen Gipfel fast das ganze Jahr über bedeckt, kann man von fast überall im Valley sehen, und er gilt den Navajo als heilig. Die Bergkette, über der der Blanca thront, die Sangre de Cristos, bildet die Ostseite des Valley. Nördlich des Blanca schmiegen sich die eindrucksvollen Sanddünen an die Bergkette. In Richtung New Mexico, ein wenig nördlich von Taos, verjüngt sich das Tal. Es fällt einem nicht schwer, sich die indigenen Völker vorzustellen, die hier Bilder in die Felsen an den Flüssen ritzten, oder die Hispanics, die Colorados älteste Stadt, San Luis, gründeten und ein auch heute noch funktionstüchtiges Bewässerungssystem im südöstlichen Winkel des Tals schufen, oder einen Planwagenzug der Pioniere. Auch heute noch streifen hier Gabelböcke umher, ebenso Wildpferde und der eine oder andere Puma.
Es fällt auch nicht schwer, eine Verbindungslinie zwischen den Siedlern im neunzehnten Jahrhundert und den Menschen zu erkennen, die heutzutage hier herausziehen. Das Land ist nicht mehr kostenlos, doch es gehört zum billigsten der Vereinigten Staaten. In vielerlei Hinsicht könnte man hier, in dieser unendlichen Leere, leben, wie es die Pioniere in den Great Plains taten, abgesehen davon, dass man einen Truck hätte anstelle eines Planwagens mit Maultier und ein paar Solarpanels, vielleicht sogar schlechten Handyempfang. Und legales Gras. Wer Gras verkauft und tauscht und sich als Saisonarbeiter verdingt, kommt vielleicht sogar ohne festen Job über die Runden, auch wenn das heikel werden kann, vor allem wenn der Winter naht. Es wäre äußert schwierig, vollständig von dem zu leben, was das Land hergibt, vor allem draußen in der offenen Prärie.
Ich ließ Colorado fürs College hinter mir, dann erneut für das weiterführende Studium und dann für New York und meine großstadtliebende Frau. Und doch hängt an der Wand meines Büros mein letztes Nummernschild aus Colorado von 1990. Immer wieder zog es mich zurück auf Besuch bei meiner Familie und meinen alten Freunden. Einer von ihnen war Jay, dessen Familie ein kuscheliges Nurdachhaus in Fairplay, Colorado, besaß, etwa eineinhalb Stunden von Denver entfernt in einem weiteren Graslandgebiet namens South Park. South Park, das in der gleichnamigen Animationsserie als Provinznest persifliert wird, eignet sich ideal als Kontrastfolie zur viel befahrenen, beliebten Interstate 70, die zu den Skigebieten Copper Mountain und Vail führt. Es ist windig, nahezu baumlos und dünn besiedelt. Das Nurdachhaus von Jays Familie lag von Bäumen gesäumt am Rand des Tals, aber im Winter wurde es dort eiskalt (und oft hatte es selbst im Sommer nur wenige Grad). Wir waren im Hinterland jede Menge langlaufen und trafen uns zum Feiern mit Freunden, beginnend mit der Highschool und für viele Silvesterabende danach.
2016 bat mich eine in Denver ansässige Zeitschrift mit dem Titel 5280, einen Beitrag über South Park zu schreiben. Einmal mehr fanden Jay und ich uns dort für ein paar Tage zusammen. Der »Park« ist riesig, und wir wollten die Gebiete aufsuchen, die uns bisher nicht bekannt waren. Einer der Ortsansässigen gab uns Richtungsanweisungen für eine besonders abgelegene Gegend und sagte warnend: »Wenn Sie erst einmal auf der 53 sind, werden Sie nie wieder zurückfinden.«
Am darauffolgenden Nachmittag machten wir uns auf den Weg und stießen auf einen fast menschenleeren Ort, der von den Schotterpisten einer dem Untergang geweihten Wohnsiedlung aus den 1970er-Jahren, die nie wirklich zustande gekommen war, durchschnitten wurde, ganz so wie im San Luis Valley. Ein paar Monate zuvor hatte die Gegend als Wohnort eines geistig unzurechnungsfähigen Mannes namens Robert Dear traurige Bekanntheit erlangt. Er hatte eine Planned-Parenthood-Klinik in Colorado Springs angegriffen und dabei drei Menschen getötet und acht weitere verletzt. Die New York Times veröffentlichte ein Foto des bescheidenen Wohnwagenanhängers, in dem er auf zwei Hektar Land gelebt hatte. Der Wohnwagen war von nichts als Schnee und Ödnis umgeben, das Bild von Isolation und Trostlosigkeit schlechthin. Ich sinnierte: Wie wäre es wohl, dort draußen zu leben? Was treibt einen dazu? Wem würde man begegnen? Wie kommt man damit klar?
Wir sahen ein paar vereinzelt stehende Wohnwagen und Hütten und schlossen daraus, dass eine Handvoll Menschen darin netzunabhängig lebte. Von einem Lehrer in Fairplay hatten wir gehört, dass einige der Jugendlichen vor Ort aus Elternhäusern mit ziemlich extremen religiösen Ansichten stammten, die zu Reibungen mit dem Schulamt geführt hatten. Wir wussten, dass die örtliche Polizei erst vor Kurzem in mehrere Schießereien mit Rechtsextremen in abgelegenen Ecken von South Park verwickelt gewesen war. Einmal mussten wir anhalten, um abzuwarten, bis eine Herde Bisons die Schotterpiste überquert hatte, auf der wir uns befanden, und sich über ein umgefallenes Gatter auf der gegenüberliegenden Straßenseite in ein leeres Feld bewegte. Wir hielten nach einem Cowboy Ausschau, der die Tiere losgeschickt hatte, doch sie waren offenbar im Alleingang unterwegs.
Denver und New York sind komplexe urbane Räume. Hier draußen hatte es den Anschein, als sei das Leben einfach, doch wie konnte ich mir da wirklich sicher sein?
Dieses Gefühl der Unwissenheit nahm einen Monat später zu, im November, als Donald Trump zum Präsidenten der Vereinigten Staaten gewählt wurde. Tags zuvor in New York hatte ich in einem französischen Radiosender verkündet, Trump würde die Wahl niemals gewinnen. (Selbstredend war ich mit diesem Irrglauben in guter Gesellschaft.) Der geistige Horizont Amerikas veränderte sich auf eine Weise, die ich unbedingt verstehen wollte, und diese leeren, vergessenen Orte schienen dabei eine wichtige Rolle zu spielen.
Ich erzählte meiner Schwester von dem Ort. Im Rahmen ihrer Arbeit für eine in Denver ansässige Stiftung sei sie kürzlich in Alamosa gewesen, der größten Stadt im San Luis Valley, und habe von Off-Grid-Siedlungen in weit größerem Maßstab gehört, sagte sie. Mitarbeiter eines Sozialunternehmens namens La Puente hätten ihr Bilder davon gezeigt, wie Menschen draußen »in den Flats« lebten, und ihr von ihrem Outreach-Projekt erzählt; später schickte sie mir ein paar Fotos in einem PDF. Ich kontaktierte La Puente. Die soziale Einrichtung hatte als Notunterkunft für Obdachlose angefangen – eine der ersten Obdachlosenunterkünfte im ländlichen Raum – und war von einer Nonne gegründet worden. Und dann besuchte ich sie.
Lance Cheslock, der Geschäftsführer des Unternehmens, zeigte mir alles, beginnend beim Mittagessen in der Unterkunft. Die Unterkunft befindet sich in einem großen alten Haus im ärmeren Teil Alamosas und wurde umgebaut, um getrennte Badezimmer für Männer, Frauen (die zum Duschen in ihren abgeschlossenen Teil im Obergeschoss gelassen werden) und Familien zu schaffen. Für Letztere sind außerdem separate Schlafzimmer vorgesehen. Insgesamt gibt es fünfundvierzig Betten, doch an diesem Junitag waren nur sechsundzwanzig Personen angemeldet. Das Erdgeschoss besteht hauptsächlich aus einem Speisesaal und einer Küche. Die Unterkunft servierte drei Mahlzeiten täglich. Zum Mittag- und Abendessen waren auch Gäste aus der Stadt willkommen – allerdings erst, wenn sich genug Speisende dafür eingetragen hatten, die Küche danach sauber zu machen. Die AmeriCorps-Freiwillige, der jene Aufgabe zugewiesen worden war, hatte kein Glück. Lance, ein guter Überredungskünstler, nahm ihr das Klemmbrett ab und begann, die Schlange abzulaufen und den Wartenden klarzumachen, dass niemand etwas zu essen bekäme, bis sich ein paar Leute gefunden hätten, die aufräumten. Bald hatte er seine Helfer zusammen, und kurz darauf saßen wir an einem Tisch für sechs Personen, gemeinsam mit Klienten der Unterkunft und einer Mitarbeiterin, die sich als Leiterin derselben herausstellte: Teotenantzin Ruybal.
Tona, wie sie von allen genannt wurde, war im Valley aufgewachsen und leitete die Unterkunft seit mehr als neun Jahren. Sie stammte aus einer der Großfamilien, die seit Generationen in der Gegend leben und sich selbst als Hispanics betrachten. (Die Bezeichnungen »Latino« und »Latinx« sind im Valley weniger gebräuchlich.) Ihr Auftreten war von der raueren Sorte – wer schwach wirkt, kann keine Notunterkunft leiten –, doch im Gespräch wurde deutlich, dass sie ein großes Herz hatte und sich der Aufgabe, den Armen zu helfen, zutiefst verpflichtet fühlte.
Sie erklärte mir den direkten Bezug zwischen den Off-Griddern und der Notunterkunft, an dem ich interessiert war: »Wer im Slum lebt und eine Anzeige sieht, in der drei Hektar Land mit Blick auf den Blanca Peak für fünftausend Dollar angepriesen werden, für den ist das die Chance, ein Stück ungezähmte Wildnis zu bekommen.« Manche kamen einzig für ihr eigenes Grundstück ins Valley, endlich befreit von Vermietern und Stromrechnungen. Und endlich ohne die verurteilenden Blicke anderer: »Manchmal ist ihre Haltung: Lieber habe ich ein hartes Leben dort draußen, als in der Stadt zu wohnen, wo auf mich herabgesehen wird«, erklärte Tona.
»Auch wenn diese Entscheidung nicht vernünftig sein mag, ist es ihre Entscheidung«, fuhr sie fort.
Allerdings war dieser Entschluss nicht immer tragfähig, denn auch wenn sie nun auf ihrem eigenen Land lebten, waren sie weiterhin arm und hatten kaum Rücklagen, sollte etwas schiefgehen. Oft kämen sie mit Einbruch der Kälte in die Notunterkunft, sagte Tona, wenn sie am eigenen Leib spürten, wie unerbittlich der Winter sein konnte. Die widerstandsfähigsten Off-Gridder verfügten meist über irgendeine Art festes Einkommen – beispielsweise eine Veteranen- oder Invalidenrente. Es war schwer, seinen Lebensunterhalt anderweitig zu sichern. Die Flats lagen weitab von Arbeitsplätzen, außerdem erforderte ein Arbeitsplatz ein verlässliches Transportmittel, das vielen fehlte.
Tonas Partner Robert hatte früher als Gefängniswärter und Hilfssheriff gearbeitet und eineinhalb Jahre als La Puentes erster Mitarbeiter für das Rural-Outreach-Projekt. An jenem Wochenende chauffierten mich Tona und Robert für eine Rundfahrt in die Flats hinaus. Wir trafen uns in der Kleinstadt Antonito – die letzte Stadt vor der Grenze zu New Mexico –, an einem ungewöhnlichen, weil bedeckten Tag. Tona und Robert lebten außerhalb des Städtchens auf dem Land, aber nicht netzunabhängig, mit drei Chihuahuas; einer von ihnen, Diego, begleitete uns auf unserer Rundfahrt. Wir waren am Family Dollar Store verabredet, an dem ich meinen Truck stehen ließ und in ihr SUV umstieg.
Früher einmal war Antonito ein Dreh- und Angelpunkt für Schafhirten und den Wollhandel und ein Halt auf der Eisenbahnstrecke der Denver & Rio Grande Western Railroad. Noch immer befand sich eine Bronzestatue des Gewerkschaftsführers Don Celedonio Mondragón neben der ehemaligen, nun leer stehenden Unterkunft der Sociedad Protección Mutua de Trabajadores Unidos (SPMDTU), der Gewerkschaft, die er um 1900 für Schäfer und Landarbeiter gegründet hatte. Zwischen mehreren leer stehenden Ladenlokalen befanden sich in Antonito zwei Geschäfte, in denen man Cannabis kaufen konnte, zwei Getränkeläden, ein Supermarkt und zwei gute mexikanische Restaurants. Es gab die Schmalspur-Museumseisenbahn Cumbres & Toltec Railroad, die ebenso wie das unter dem Namen Cano’s Castle bekannte, barock anmutende Outsider-Art-Gebäude eine Touristenattraktion war. Es gab außerdem ein kleines Hotel mit einem zahmen Schwein, das draußen lebte und ein violettes Halsband trug. Das Beste an Antonito war jedoch etwas, das mir Tona und Robert erst noch zeigen sollten: sein verkannter Status als Tor zu den Flats.
Wir starteten am Family Dollar Store, überquerten die Gleise und fuhren in Richtung Osten. Bald schon ging die Stadt in bewässertes Ackerland über. Eine große Kreisbewässerungsanlage spritzte Wasser auf die Straße, sodass Tona die Scheibenwischer einschalten musste. Zwischen den bescheidenen Häusern standen ein paar alte Mobile Homes verstreut und einige noch ältere, dem Verfall preisgegebene Lehmhütten, deren Mauern langsam dahinbröckelten. Der Asphalt endete an einer kleinen Kirche, der Sagrada Familia Mission, hinter der eine kleine Brücke über einen Bewässerungsgraben führte. Und dann, ein, zwei Meilen danach, versiegte auch der Bewässerungsgraben: Hier gab es keine Bäume mehr, keine Landwirtschaft und kaum noch Zäune. Wir fuhren in ein großes Gebiet, das vom Landverwaltungsamt betreut wurde, und die Landschaft am Horizont wurde immer flacher. Tonas SUV schoss über ein Viehgitter1, dann noch eins und noch eins; wir waren jetzt im Terrain des Wüsten-Beifußes und der Chico-Büsche, hinter uns wirbelte eine Staubwolke auf. Wir befanden uns auf einem sanft geschwungenen Sattel zwischen zwei rundlichen Hügeln, und die Sicht wurde immer weiter.
Als wir schließlich eine Anhöhe erreichten, schien sich das gesamte San Luis Valley vor uns auszubreiten. Ganz im Osten waren die immer noch schneebedeckten Gipfel des Sangre-de-Cristo-Gebirges, viele um die viertausend Meter hoch. Der markanteste war der Blanca Peak. Weit im Süden lag der Ute Mountain, bereits in New Mexico, bis wohin sich das Valley ausdehnte. Dazwischen eingebettet lag auf einer gelbbraunen Ebene ein gigantischer Raum, den Tona und Robert als die Flats bezeichneten, den die meisten Einheimischen, wie ich noch lernen sollte, jedoch »Prärie« nannten.
Die vor uns liegende Straße führte uns gemächlich bergab, auf eine dunkle, schmale Einkerbung in der Landschaft zu, den Rio Grande. Als wir näher kamen, wurde ein Muster in den Flats sichtbar – das gleiche riesige Gitternetz, das ich bereits in South Park gesehen hatte. Die Straßen waren in den 1970er-Jahren im Rahmen von Bebauungsplänen ins Land geschnitten worden. Als wir noch näher waren, tauchten ein paar Behausungen und ehemalige Behausungen in unserem Blickfeld auf, größtenteils Trailer, manche mit kleinen Anbauten versehen. Als sich die Straße vor einer einspurigen Eisenbrücke verengte, der 1892 erbauten Lobatos Bridge, bremste Tona ab. Die Fahrspur bestand aus zwei langen Holztrassen, die ächzten und knarrten, als wir langsam darüberfuhren; der Rio Grande unter uns, sein Canyon, nicht tief, führte nur wenig Wasser.
Über ein Jahr war die Gegend Roberts Rural-Outreach-Revier gewesen, bis Januar 2017, als er sich beim Hochheben schwerer Lebensmittelkisten verletzte. (Damals hatte Matt Little gerade angefangen.) Robert war seit fünf Monaten nicht mehr da gewesen, und als wir vom Fluss auf eine Straße hinauffuhren, auf der er oft unterwegs gewesen war, bestaunte er die neuen Unterkünfte, die seit dem Winter aufgetaucht, und jene, die verlassen worden waren.
Die Lobatos Bridge, gen Osten zeigend, über dem zugefrorenen Rio Grande.
Mehrmals hörte ich ihn von groves (Hainen) reden, die hinter den Holzzäunen oder provisorischen Gewächshäusern lägen; vor meinem inneren Auge taten sich Obsthaine auf. Doch als ich Robert nach weiteren Einzelheiten fragte, stellte sich heraus, dass er von grows gesprochen hatte – eine Abkürzung für Cannabisplantagen. Die Möglichkeit, Cannabis legal anzubauen, habe zahlreiche Bewohner in die Gegend gelockt, erklärte er. Diejenigen, die eine medizinische Anbaugenehmigung besaßen, durften bis zu neunundneunzig Pflanzen kultivieren. Die anderen waren auf sechs beschränkt, was häufig ohne juristische Folgen überschritten wurde.
Tona fuhr uns an den Rand des Flusscanyons, an dem wir ausstiegen und uns die Beine vertraten. Sie warnte mich, vor Klapperschlangen auf der Hut zu sein, und klärte mich über den Herbstzug der Taranteln auf, der ein paar Monate später beginnen würde. Als sie so über den Rand der Schlucht auf den Fluss hinabspähte, erzählte sie, wie ihr Vater sie und ihre Geschwister hier herausgefahren hatte, um Flusskrebse zu fangen, als sie ein Mädchen war. Sie und Robert fischten und jagten auch gerne. Tona zeigte auf einen Weißkopfseeadler, der über dem Fluss schwebte und einen Schrei ausstieß wie ein Rotschwanzbussard.
Robert erinnerte sich gerne an seinen Job bei La Puente, teils auch, weil er es »mir ermöglicht hat, bei der Polizei aufzuhören«. Er war aufgeschlossen und witzig, und es bereitet ihm Freude, auf andere zuzugehen. Dennoch, die größte Herausforderung sei gewesen, Menschen kennenzulernen. »Es hat drei Monate gedauert, bis ich den harten Kern kannte«, sagte er. Viele waren äußerst misstrauisch, da Costilla County, das County, in dem wir unterwegs waren und in dem wohl die größte Anzahl an Bewohnern der Flats lebte, begonnen hatte, hart gegen Verstöße gegen die Bauvorschriften durchzugreifen. Je nachdem, wen man fragte, ging es dabei darum, einer nicht konformen Landnutzung entgegenzuwirken (laut County) oder darum, die Anzahl armer Menschen in den Flats zu reduzieren (laut ebenjenen). Die meisten Leute gerieten in Schwierigkeiten, weil sie keine Kläranlage hatten. Das Erfordernis einer solchen war zwar seit Jahren gesetzlich verankert, doch das Gesetz wurde bis vor Kurzem nur selten durchgesetzt; jetzt gaben die Inspektoren der Bauaufsichtsbehörde den Bewohnern, die bereits seit Jahren dort gelebt hatten, gerade einmal eine Frist von zehn Tagen, um »den Mangel zu beheben«, bevor sie Geldstrafen von 50 bis 100 Dollar pro Tag erhoben. Kläranlagen kosten etwa 7000 bis 12000 Dollar, Fachkräfte für die Installation waren Mangelware, und jemanden zu finden, der das Ganze innerhalb von dreißig – ganz zu schweigen von zehn – Tagen machen konnte, war so gut wie unmöglich, selbst wenn man es sich leisten konnte. Ein paar der Ortsansässigen waren derart paranoid, dass sie Nägel auf ihre Auffahrt streuten, um die Inspektoren der Bauaufsicht an ihrer Arbeit zu hindern und Kontrollen hinauszuzögern; sie bauten sich sogar einen zweiten, sicheren Eingang. Robert sagte, er selbst habe sich auf diese Weise mehrere platte Reifen eingehandelt.
Tona zu kennen verschaffte ihm einen gewissen Vorteil beim Kennenlernen der Einheimischen, da viele von ihnen sie bereits in der Notunterkunft getroffen hatten. Oft hatten sie Drogenprobleme. Manchmal schimpften sie über die staatliche Überregulierung und schworen Rache (sie erwähnte drei Namen). In anderen Fällen war die Notunterkunft offenbar ihr Winterquartier und die Flats ihr Warmwetterzuhause. Einer von ihnen war Armando, der Anwohner, den wir zuerst besuchen sollten.
Armandos Grundstück hatte vier wesentliche Merkmale. Beim ersten handelte es sich um eine Art Tor, das aus zwei mit »Betreten verboten«-Schildern verzierten Pfosten bestand. Zwischen den Pfosten auf dem Boden lagen Stacheldraht und ein mit Nägeln gespicktes Brett, merkwürdigerweise schloss sich jedoch an keiner der beiden Seiten ein Zaun an. Auf Roberts Geheiß hupte Tona und fuhr einfach um das Gebilde herum, so wie Armando selbst es augenscheinlich auch tat. Wir näherten uns einer kleinen, von einem Holzzaun umgebenen Koppel mit einem Pferd, einem bescheidenen Wohnwagenanhänger, vor dem ein Pyrenäenberghund angekettet war, und einem niedrigen Steingebäude, vor dem sich Armando befand.
Armando war sonnengebräunt, abgesehen von seinem Bart haarlos, barfuß und trug nur Shorts. Tona und Robert ließen ihre Fenster herunter; Armando erkannte sie und winkte uns herein. Es wirkte ganz so, als freue er sich, sie zu sehen, und er bot uns prompt eine Besichtigung an. Er arbeitete gerade an dem einfachen Steingebäude, das aus einem fast vollständig geschlossenen Raum mit Lehmfußboden bestand, schlecht eingepasste Fenster und eine Feuerstelle zum Kochen (zwischen den Steinen darüber steckte ein riesiges Messer) hatte. An den Raum schloss sich ein Garten für den Cannabisanbau an, und daneben, am Ende des Grundstücks, befand sich das, was Armando als Swimmingpool bezeichnete. In Wirklichkeit war es ein Erdloch, gerade groß genug für das Gummiboot, das darauf trieb. Es war wesentlicher Bestandteil seiner Vorstellung eines sommerlichen Lebens. In seinen Augen war es schön; er nannte es El Templo de Cielo (Tempel des Himmels). Ursprünglich stamme er aus Puerto Rico, erzählte er mir. Wir blieben eine Weile, tauschten Höflichkeiten aus, und Armando beklagte sich bei Robert über »die Schwuchtel« hinter dem Hügel, an der er einiges auszusetzen hatte.
Der Nachbar, den Armando damit meinte, war Paul. Er war charmant und lustig, wirkte arglos und lebte in zwei zu einem L zusammengefügten Trailern. Entlang der Straße hatte er einen geschmackvollen Holzzaun, der weiß angestrichen war, und, erstaunlicherweise, drei Bäume, eine absolute Seltenheit in der Region. Die Hunde, die unser Auto umzingelten, machten einen friedlichen Eindruck. Wir parkten in der Nähe seiner drei Fahrzeuge, die, wie es aussah, nicht alle funktionstüchtig waren: ein Mercedes-Kombi Baujahr 1991, ein Chevy Blazer 4x4 und ein Dodge-Dakota-Pick-up.
Robert machte uns einander bekannt, und Paul sagte: »Schön, Sie kennenzulernen, und, ja, ich bin schwul!«
Paul bat uns herein und brachte uns Stühle und Limonade. Er reichte einen Brief herum, in dem all denen gedankt wurde, die an La Puente gespendet hatten und der von Lance Cheslock selbst mit einer persönlichen, von ihm unterzeichneten Nachricht versehen worden war. »Seht ihr? Ich bin Klient, aber auch Wohltäter.« Er hatte einen Betrag von etwa fünfzig Dollar gespendet. Paul sagte, er sei seit 1994 da, damals habe er 2300 Dollar für zwei Hektar Land gezahlt. »Ich kam her, weil ich mein eigenes Grundstück besitzen wollte, und in Kalifornien ging das nicht.« Die monatlichen Schecks, die er aufgrund einer Sozialphobie erhielt, waren sein Haupteinkommen. »Wenn zu viele Menschen um mich herum sind, ist das nicht gut. Nach ein paar Minuten im Walmart drehe ich durch.« Er gab zu, sich ein bisschen zu sehr auf seine Nachbarn zu kaprizieren, die in einem Trailer am Fuße des Bergs lebten. Ihr Müll wurde auf sein Grundstück geweht. Ein junger Mann und eine junge Frau wohnten dort, »zurückgelassen von dem alten Mann ohne Auto«. Der alte Mann aus Alabama war vor Kurzem aufgrund von Kindesmissbrauch festgenommen worden.
Paul mit seinen »Mädchen«.
Anfangs, so Paul, sei er gut mit ihnen ausgekommen, doch als die Frau ihn eine Schwuchtel genannt und als »Ausgeburt der Hölle« beschimpft hatte, war es damit vorbei.
Manchmal ärgerten ihn auch die Rinder. Merkwürdigerweise behandelte Costilla County das Land auch nachdem es parzelliert worden war weiterhin wie offenes Gelände, was zur Folge hatte, dass den Bewohnern die Verantwortung oblag, die Rinder durch Zäune fernzuhalten. Pauls Grundstück war bis auf den Eingang umzäunt, und manchmal gelangten die Rinder so auf sein Grundstück, trotz der Hunde.
Paul sagte, zweimal im Jahr versuche er wegzukommen, dass er den Bus von Alamosa zum Flughafen in Denver nehme, nachdem er das günstigste Reiseziel ausgewählt habe – »immer unter dreihundert Dollar«. So war er nach North Carolina, Texas und Kalifornien gereist, doch am Ende jedes Mal wieder zu seinen Trailern zurückgekehrt.
Unser letzter Halt war ein eingezäuntes Grundstück mit einem Schwingtor, das verschlossen war. Tona hupte, und nach ein paar Minuten noch einmal. Als sich nichts regte, öffnete Robert das Tor, und wir begannen, langsam hineinzufahren.
Da schoss ein kleines SUV, das vor dem Haus geparkt hatte, direkt auf uns zu und blockierte uns den Weg. Tona und Robert stiegen aus. Erst als die beiden Frauen in dem Auto sie erkannten, begaben wir uns alle zu ihrem Haus. Dort unterhielten wir uns über das Knurren ihrer Hunde hinweg, die an verschiedenen Gegenständen am Vordereingang festgemacht waren.
Kea und Rhonda waren redselig und lebhaft, baten uns aber nicht hinein. Rhonda, Keas Mutter, hatte eine wilde Mähne, die in alle Himmelsrichtungen abstand. Sie habe in Chicago und Kalifornien gelebt, erzählte sie mir und als sie Robert kennenlernte, habe sie augenblicklich gewusst, dass er einmal Polizist gewesen war, »weil er so eine Bullenaura hat. Er stand so da.« Dieses so verdeutlichte sie, sei eine schräg zum Gegenüber ausgerichtete Grundhaltung, die Polizeibeamte häufig zum Selbstschutz einnehmen, wenn sie mit einer ihnen unbekannten Person reden. Ich erzählte ihr, dass ich als Gefängniswärter gearbeitet und diese Haltung ebenfalls gelernt hatte.
Kea sagte, vor einem Jahr sei sie infolge einer gescheiterten Beziehung selbstmordgefährdet gewesen. Sie war erst kürzlich aus Kalifornien zurückgekehrt, wo sie sich in Behandlung begeben hatte – wofür, erzählte sie nicht –, und verwies auf ihr enormes Körpergewicht. Sie wog über hundert Kilo und fühlte sich, auf die Rückbank des SUV gequetscht, dessen Heckklappe offen war, sichtlich unwohl. Sie sagte, sie und ihre Mutter hätten kreolische Vorfahren und dass sie Hunde liebte und gerne schrieb.
Auch ich schrieb gerne, sagte ich, und dass ich an einem Artikel über das Valley arbeitete und wir uns unterhalten sollten. Sie gehörten zu den wenigen Schwarzen Menschen, denen ich hier draußen begegnet war, und ich wollte zu gerne wissen, welche Kräfte sie an diesen Ort gezogen – oder sie von anderswo abgestoßen hatten.
Unsere Rückfahrt nach Antonito verzögerte sich aufgrund einer riesigen Schafherde, die die vor uns liegende Schotterpiste und das Land auf beiden Seiten belagerte, so weit das Auge reichte – und die Welt wurde weiß und flauschig. Als Tona näher heranfuhr, teilte sich die Herde zwar, allerdings nicht gerade schnell. Wir sahen weit und breit keine Schäfer, doch Robert sagte, typischerweise seien es Mexikaner oder Leute aus Zentralamerika, die während der Saison in kleinen Wohnwagenanhängern lebten.
Tona schaltete Musik an, und Diego, der langhaarige Chihuahua, der mit Robert auf der Rückbank saß, erwachte zum Leben. Tona drehte die Lautstärke auf: AC/DC, Heavy Metal aus den 1980er-Jahren. Diego war voll bei der Sache, er legte seine Pfoten auf die Rückseite des Vordersitzes und jaulte mit.
YOU … shook me all night long
YOU … shook me all night long
»Bei AC/DC geht er ab!«, sagte Tona. »Lateinamerikanische Musik gefällt ihm aber auch.«
Ich hatte nicht gewusst, dass Orte wie diese existieren. Mit den Bergstädtchen, Nationalparks und Wäldern, auf denen die Tourismusbranche Colorados fußt, war ich seit Langem vertraut, und auch die Viehwirtschaft war mir nicht unbekannt. Die Off-Grid-Welt, wie die in South Park, war mir hingegen völlig fremd – und faszinierte mich. In ihr verbanden sich die erhabene Schönheit des Mountain West2 und ein Widerhall der Pioniere mit der harten Realität eines Lebens in Armut.
Um etwas klarzustellen: Das Leben in der Prärie war nicht gleichzusetzen mit dem Leben im Rest des San Luis Valley. Tona sagte, alteingesessene Hispanics blickten oft auf Menschen wie jene herab, die wir gerade besucht hatten. Sie würden das Wort roñoso – grob, ärmlich – verwenden, um sie zu beschreiben, oder bezeichneten sie als illegale Siedler, auch wenn den meisten das Land gehörte, auf dem sie lebten. Kein anständiger Mensch würde freiwillig dort draußen leben, hieß es, wo es an den Rändern des Tals doch so viel schöner war, dort, wo es Bäume und Flüsse gab und ein wenig Zivilisation.
La Puentes Vorhaben, Brücken zu ebendiesen Außenseitern zu schlagen, hatte in meinen Augen eine Vorbildfunktion, ja machte vor, was wir auf landesweiter Ebene brauchten, um die Spaltung Amerikas zu überwinden. Ich wollte mehr erfahren, wollte bleiben, mich ganz darauf einlassen.





























