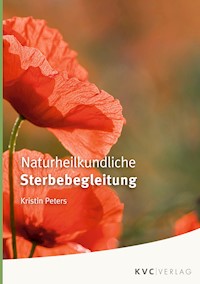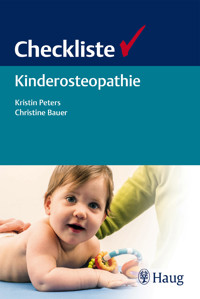
84,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Haug Fachbuch
- Kategorie: Fachliteratur
- Sprache: Deutsch
Für den schnellen Zugriff in der Praxis – Ihr perfektes Nachschlagewerk in der Kinderosteopathie: Übersichtlich strukturiert und illustriert, mit direkt umsetzbaren Therapieanleitungen zu häufig vorkommenden Indikationen.
Zahlreiche praxiserprobte Tipps – vor allem für die Behandlung von Säuglingen – führen Sie effektiv zum Therapieerfolg und regen Sie an, eigene Herangehensweisen zu reflektieren.
Nützlich bei Diagnostik und Therapie:
- die Darstellung der neurologisch-motorischen Entwicklung, ohne deren Kenntnis keine Diagnosestellung möglich ist
- die Herausstellung von altersspezifischen Problemen
- eine Aufteilung der diagnostischen Tests und Behandlungstechniken nach Altersgruppen
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Seitenzahl: 226
Veröffentlichungsjahr: 2017
Ähnliche
Checkliste Kinderosteopathie
Kristin Peters, Christine Bauer
150 Abbildungen
Vorwort
Die Arbeit mit Kindern ist eine Arbeit, die das Herz berührt.
Die Idee, eine Checkliste für die osteopathische Behandlung von Kindern zu verfassen, entstand aus dem Wunsch, die Vielfalt der verschiedenen Behandlungsansätze und Herangehensweisen zu erfassen, zu sortieren und übersichtlich darzustellen. Wichtige und etablierte Techniken aus dem Bereich der Kinderosteopathie werden in diesem Buch vorgestellt – allerdings haben wir eine Auswahl getroffen, die auf eigenen Erfahrungen bei der Behandlung von Kindern beruht.
Von herausragender Bedeutung sind – wie überall in der osteopathischen Praxis – sichere Kenntnisse in der Anatomie und Physiologie der zu behandelnden Gewebe und Systeme. Das Wissen zur Anatomie und Physiologie des Erwachsenen und die osteopathische Behandlung von ausgereiftem Gewebe werden vorausgesetzt. In diesem Buch werden nur die Abweichungen der Anatomie und Physiologie beim heranwachsenden Kind im Vergleich zum Erwachsenen und die damit im Zusammenhang stehende Veränderung der Herangehensweise für die osteopathische Untersuchung und Behandlung genauer betrachtet.
Zu beachten ist, dass die Behandlung von Kindern immer im Kontext der Familie und deren besonderer Situation steht. Die Anamnese erfasst die Situation des Kindes ebenso wie die der Mutter und der weiteren Bezugspersonen.
Die Checkliste Kinderosteopathie ist folgendermaßen aufgebaut:
Teil 1 beschäftigt sich mit dem Beginn des menschlichen Lebens im Mutterleib, der Embryologie und Fetalperiode, die eine wichtige Grundlage für das Verständnis der Gewebebeschaffenheit nach der Geburt bilden; v.a. im viszeralen Bereich können aus den Wachstumsbewegungen osteopathische Behandlungen abgeleitet werden. Die Geburt sowie die verschiedenen Aspekte der kindlichen Entwicklung bis zur Ausreifung der unterschiedlichen Systeme schließen sich an. Hierzu gehören ebenfalls verschiedene Aspekte der Entwicklungsdiagnostik.
In Teil 2 werden die osteopathische Diagnose und Behandlung im kranialen, viszeralen und parietalen Bereich in Wort und Bild beschrieben. Im Vordergrund stehen v.a. Herangehensweisen speziell für den kindlichen Organismus. Techniken, die identisch mit denen beim Erwachsenen sind, werden erwähnt, aber nicht explizit dargestellt. Gleiches gilt für die Anatomie und Physiologie – auch hier werden nur die Abweichungen vom erwachsenen Gewebe gezeigt.
In Teil 3 schließen sich häufig in der osteopathischen Kinderpraxis vorgestellte Krankheitsbilder geordnet nach Alter und Körperregionen an.
Teil 4 beinhaltet tabellarische Übersichten zur Reifung der verschiedenen Systeme und kindlichen Entwicklung und bietet einige Zusatzinformationen zu speziellen Themen, z.B. das Drucksäulenmodell nach Finet/William bei kindlicher Dranginkontinenz.
Der Anhang liefert mit dem Abkürzungs- und Sachverzeichnis eine schnelle Orientierung.
Lüdenscheid und München, im Januar 2017
Kristin Peters und Christine Bauer
Inhaltsverzeichnis
Vorwort
Teil I Grundlagen der Osteopathie in der Pädiatrie
1 Geschichte
2 Kinder in der osteopathischen Praxis – die besondere Verantwortung
3 Embryologie und Fetalperiode
3.1 Intrauterine Entwicklung
3.2 Blasten- und Embryonalzeit
3.2.1 Blastenzeit
3.2.2 Embryonalzeit
3.3 Fetalperiode
4 Geburt
4.1 Regelrechter Geburtsverlauf
4.2 Abweichender Geburtsverlauf
4.2.1 Abweichende Kindslagen
4.2.2 Abweichende Präsentationen
4.2.3 Operative Entbindung
5 Entwicklung
5.1 Sensomotorik
5.2 Psychoemotionale Entwicklung
5.2.1 Emotionale Kompetenz
5.2.2 Soziale Kompetenz
5.3 Kognitive Fähigkeiten
5.4 Entwicklungsdiagnostik
5.4.1 Motoskopie
5.4.2 Reflexstatus
5.4.3 Lagereaktionen nach Vojta
5.4.4 General Movements
6 Reifung
6.1 Skelett
6.2 Organe
6.3 Nervensystem
Teil II Untersuchung und Behandlung
7 Allgemeine osteopathische Untersuchung und Behandlung
7.1 Osteopathische Untersuchung
7.1.1 Säugling
7.1.2 Kleinkind
7.1.3 Schulkind
7.2 Behandlungsprinzipien
7.3 Indikationen
7.3.1 Kraniale Behandlungen
7.3.2 Viszerale Behandlungen (allgemein)
7.3.3 Parietale Behandlung (allgemein)
7.4 Kontraindikationen
8 Kopf und Schädel
8.1 Schädelbasis
8.1.1 Anatomie und prä-/postnatale Entwicklung
8.1.2 Leitsymptome
8.1.3 Untersuchung
8.1.4 Behandlung
8.2 Os occipitale
8.2.1 Anatomie und prä-/postnatale Entwicklung
8.2.2 Leitsymptome
8.2.3 Untersuchung
8.2.4 Behandlung
8.3 Os temporale
8.3.1 Anatomie und prä-/postnatale Entwicklung
8.3.2 Leitsymptome
8.3.3 Untersuchung
8.3.4 Behandlung
8.4 Os sphenoidale
8.4.1 Anatomie und prä-/postnatale Entwicklung
8.4.2 Leitsymptome
8.4.3 Untersuchung
8.4.4 Behandlung
8.5 Neurokranium
8.5.1 Anatomie
8.5.2 Untersuchung und Behandlung
8.6 Os frontale
8.6.1 Anatomie und prä-/postnatale Entwicklung
8.6.2 Leitsymptome
8.6.3 Untersuchung
8.6.4 Behandlung
8.7 Os parietale
8.7.1 Prä- und postnatale Entwicklung
8.7.2 Leitsymptome
8.7.3 Untersuchung
8.7.4 Behandlung
8.8 Viszerokranium
8.8.1 Prä- und postnatale Entwicklung
8.8.2 Leitsymptome
8.8.3 Untersuchung
8.8.4 Behandlung
8.9 Orbitae
8.9.1 Untersuchung
8.9.2 Behandlung
8.10 Os vomer
8.10.1 Untersuchung
8.10.2 Behandlung
8.11 Mandibula
8.11.1 Anatomie
8.11.2 Behandlung
8.12 Kiefergelenk
8.12.1 Untersuchung und Behandlung
8.13 Os hyoideum
8.13.1 Anatomie
8.13.2 Untersuchung und Behandlung
8.14 Reziproke Spannungsmembranen
8.14.1 Prä- und postnatale Entwicklung
8.14.2 Leitsymptome
8.14.3 Untersuchung
8.14.4 Behandlung
8.15 Intrakranielle Membranen
8.15.1 Anatomie
8.15.2 Leitsymptome
8.15.3 Untersuchung
8.15.4 Behandlung
8.16 Venöse Sinus
8.16.1 Prä- und postnatale Entwicklung
8.16.2 Leitsymptome
8.16.3 Untersuchung
8.16.4 Behandlung
9 Bewegungsapparat
9.1 Allgemeine Entwicklung des Körpers und Skeletts
9.1.1 Anatomie der Wirbelsäule des Säuglings
9.1.2 Entwicklung der Wirbelsäule von der Geburt bis zum aufrechten Stand
9.2 Lendenwirbelsäule, Becken und Hüfte
9.2.1 Anatomie
9.2.2 Leitsymptome
9.2.3 Untersuchung
9.2.4 Behandlung
9.3 Lenden-, Brust- und Halswirbelsäule
9.3.1 Anatomie
9.3.2 Leitsymptome
9.3.3 Untersuchung
9.3.4 Behandlung
9.4 Hüftgelenk und untere Extremität
9.4.1 Entwicklung der unteren Extremitäten
9.4.2 Anatomie des Hüftgelenks
9.4.3 Leitsymptome
9.4.4 Untersuchung
9.4.5 Behandlung
9.5 Kniegelenk
9.5.1 Anatomie und Entwicklung
9.5.2 Leitsymptome
9.5.3 Untersuchung
9.5.4 Behandlung
9.6 Fuß
9.6.1 Entwicklung des Fußes und der Fußwölbungen
9.6.2 Leitsymptome
9.6.3 Untersuchung
9.6.4 Behandlung
9.7 Thorax
9.7.1 Anatomie beim Säugling
9.7.2 Leitsymptome
9.7.3 Untersuchung
9.7.4 Behandlung
9.8 Schultergürtel und obere Extremität
9.8.1 Anatomie und prä-/postnatale Entwicklung
9.8.2 Leitsymptome
9.8.3 Untersuchung
9.8.4 Behandlung des Schultergürtels
9.9 Ellenbogen
9.9.1 Anatomie
9.9.2 Leitsymptome
9.9.3 Untersuchung
9.9.4 Behandlung
9.10 Hand
9.10.1 Anatomie
9.10.2 Leitsymptome
9.10.3 Untersuchung
9.10.4 Behandlung
10 Gehirn
10.1 Entwicklung des Gehirns
10.2 Großhirn
10.2.1 Leitsymptome
10.2.2 Untersuchung
10.2.3 Behandlung
10.3 Kleinhirn
10.3.1 Leitsymptome
10.3.2 Untersuchung
10.3.3 Behandlung
11 Respiratorisches System
11.1 Kehlkopf
11.1.1 Anatomie des Kehlkopfes
11.1.2 Leitsymptome
11.1.3 Untersuchung und Behandlung
11.2 Lunge
11.2.1 Anatomie und Entwicklung
11.2.2 Atemfrequenz
11.2.3 Leitsymptome
11.2.4 Untersuchung und Behandlung
11.3 Mediastinum
11.3.1 Anatomie
11.3.2 Leitsymptome
11.3.3 Untersuchung und Behandlung
12 Verdauungssystem und Viszera
12.1 Mundhöhle, Mundboden und Zunge
12.1.1 Anatomie der Mundhöhle
12.1.2 Leitsymptome
12.1.3 Untersuchung
12.1.4 Behandlung
12.2 Ösophagus
12.2.1 Leitsymptome
12.2.2 Untersuchung und Behandlung
12.3 Diaphragma abdominale
12.3.1 Anatomie und Funktionsweise beim Säugling
12.3.2 Leitsymptome
12.3.3 Untersuchung und Behandlung
12.4 Abdomen
12.4.1 Anatomie
12.4.2 Leitsymptome
12.4.3 Untersuchung
12.5 Magen
12.5.1 Anatomie
12.5.2 Leitsymptome
12.5.3 Untersuchung
12.5.4 Behandlung
12.6 Milz
12.6.1 Leitsymptome
12.6.2 Untersuchung
12.6.3 Behandlung
12.7 Leber
12.7.1 Anatomie
12.7.2 Leitsymptome
12.7.3 Untersuchung
12.7.4 Behandlung
12.8 Dünndarm
12.8.1 Leitsymptome
12.8.2 Untersuchung
12.8.3 Behandlung
12.9 Zäkum
12.9.1 Leitsymptome
12.9.2 Untersuchung und Behandlung
12.10 Sigmoid
12.10.1 Leitsymptome
12.10.2 Untersuchung und Behandlung
12.11 Nieren
12.11.1 Anatomie
12.11.2 Leitsymptome
12.11.3 Untersuchung
12.11.4 Behandlung
12.12 Blase
12.12.1 Anatomie
12.12.2 Entwicklung der Blasenkontrolle
12.12.3 Leitsymptome
12.12.4 Untersuchung
12.12.5 Behandlung
12.13 Hoden
12.13.1 Leitsymptome
12.13.2 Untersuchung
12.13.3 Behandlung
12.14 Uterus
12.14.1 Pubertäre Entwicklung
12.14.2 Leitsymptome
12.14.3 Untersuchung des Uterus
12.14.4 Behandlung
12.15 Beckenboden
12.15.1 Leitsymptome
12.15.2 Untersuchung und Behandlung
Teil III Indikationen
13 Einleitung
14 Frühgeborene
14.1 Komplikationen bei Frühgeborenen/Unreife
14.1.1 Atemnotsyndrom
14.1.2 Bronchopulmonale Dysplasie
14.1.3 Kardiale Anpassungsstörung
14.1.4 Frühgeborenen-Retinopathie
14.1.5 Nekrotisierende Enterokolitis
15 Neugeborene und Säuglinge
15.1 Geburtstraumata
15.1.1 Caput succedaneum (Geburtsgeschwulst)
15.1.2 Kephalhämatom
15.1.3 Klavikulafraktur
15.2 Plexusparesen
15.2.1 Obere Plexusparese (Erb-Duchenne)
15.2.2 Untere Plexusparese (Klumpke)
15.3 Neugeborenenzeit
15.3.1 Respiratorische Anpassungsstörung
15.3.2 Apnoe
15.3.3 Saug-, Schluck- und Stillprobleme
15.3.4 Pylorusstenose
15.3.5 Gastroösophagealer Reflux
15.3.6 Vegetative Anpassungs- bzw. Regulationsstörung
15.3.7 Icterus neonatorum (Hyperbilirubinämie, Neugeborenenikterus)
15.4 Säuglingszeit
15.4.1 Dreimonatskoliken (Trimenonkoliken)
15.4.2 Tortikollis
15.4.3 Schädelasymmetrie (Plagiozephalus)
16 Kleinkinder, Schulkinder und Jugendliche
16.1 Hals-Nasen-Ohren
16.1.1 Serotympanon (Paukenerguss)
16.1.2 Otitis media (Mittelohrentzündung)
16.1.3 Sinusitis
16.1.4 Adenoide/Tonsillenhypertrophie
16.1.5 Tonsillitis/Pharyngitis (Angina)
16.1.6 Pseudokrupp (Laryngitis hypoglottica)
16.2 Kiefergelenk
16.2.1 Malokklusion
16.2.2 Bruxismus
16.3 Augen
16.3.1 Amblyopie
16.3.2 Strabismus
16.3.3 Tränenkanalstenose
16.4 Atemwege
16.4.1 Bronchitis
16.4.2 Asthma bronchiale
16.5 Verdauungsapparat
16.5.1 Obstipation
16.5.2 Diarrhoe
16.5.3 Nabelbruch (Hernia umbilicalis)
16.5.4 Leistenbruch (Hernia inguinalis)
16.6 Urogenitalbereich
16.6.1 Blasenentleerungsstörung
16.6.2 Enuresis nocturna
16.6.3 Maldescensus testis (Hodenhochstand)
16.6.4 Menstruationsbeschwerden (Dysmenorrhoe)
16.7 Bewegungsapparat
16.7.1 Angeborene Hüftdysplasie
16.7.2 Coxitis fugax (Hüftschnupfen)
16.7.3 Morbus Perthes (juvenile Hüftkopfnekrose)
16.7.4 Beinachsenfehlstellung: Genu varum, Genu valgum
16.7.5 Morbus Osgood-Schlatter
16.7.6 Chondropathia patellae (peripatelläres Schmerzsyndrom)
16.7.7 Morbus Scheuermann
16.7.8 Skoliose
16.8 Fußdeformitäten
16.8.1 Sichelfuß (Pes adductus)
16.8.2 Klumpfuß (Pes equinovarus)
16.8.3 Spitzfuß (Pes equinus)
16.9 Schmerzen
16.9.1 Kopfschmerzen
16.9.2 Bauchschmerzen
16.9.3 Wachstumsschmerzen
16.10 Schlafstörungen (Parasomnie)
16.10.1 Definition und Ursachen
16.10.2 Osteopathisches Vorgehen
16.11 Teilleistungsstörungen und Entwicklungsverzögerungen
16.11.1 Osteopathisches Vorgehen
16.12 Unfälle
16.12.1 Frakturen
16.12.2 Operationen
16.12.3 Schädel-Hirn-Trauma
16.13 Neurologie
16.13.1 Epilepsie
16.13.2 Entwicklungsneurologische Defizite
Teil IV Übersichten
17 Kindliche Entwicklung
17.1 Durchschnittliche Entwicklung von Größe und Gewicht
17.2 Entwicklung der knöchernen Strukturen
17.2.1 Skelettsystem und Knochen
17.2.2 Schädel
17.3 Entwicklung der Organe
17.4 Entwicklung des Nervensystems
18 Neurokinesiologische Diagnostik
18.1 Frühkindliche Reflexe
18.1.1 Komplexe orofaziale Auslösemechanismen
18.1.2 Tonische Reflexe
18.1.3 Pathologische Reflexe
18.1.4 Angeborene Fremdreflexe
18.2 Lagereaktionen nach Vojta
18.3 Meilensteine der Entwicklung – Diagnostik Pädiater
19 Behandlungsabfolgen bei spezifischen Symptomkomplexen
19.1 Kindliche Dranginkontinenz
19.2 Stimulation des venolymphatischen Rückflusses
19.3 Entlastung des Gesichtsschädels in mehreren Schritten
19.4 Behandlung der zentralen Kette nach Philippe Druelle
19.5 Behandlung der Plexus des Bauchraumes
20 Tipps für die Eltern
20.1 Hochnehmen und Hinlegen des Säuglings aus der Rückenlage
20.1.1 Hochnehmen des Säuglings aus der Rückenlage
20.1.2 Hinlegen des Säuglings auf den Rücken
20.2 Trageposition
20.2.1 Seitliche Trageposition
20.2.2 Vertikale Trageposition
20.3 Drehen auf den Bauch
Teil V Anhang
21 Abkürzungen
22 Danksagung
23 Literatur
Autorenvorstellung
Anschriften
Sachverzeichnis
Impressum
Teil I Grundlagen der Osteopathie in der Pädiatrie
1 Geschichte
2 Kinder in der osteopathischen Praxis – die besondere Verantwortung
3 Embryologie und Fetalperiode
4 Geburt
5 Entwicklung
6 Reifung
1 Geschichte
In den gesammelten Schriften von Dr. Andrew Taylor Still werden u.a. auch Behandlungen von Kindern beschrieben. So behandelte er z.B. einen kleinen Jungen, der an einem schweren Magen-Darm-Infekt litt, mit einer Manipulation der Lendenwirbelsäule (LWS).
Mit der Entdeckung der kraniosakralen Osteopathie durch Dr. William Garner Sutherland konnten durch die Geburt entstandene Dysfunktionen im Bereich des Schädels behandelt werden. Eine Schülerin von Dr. Sutherland, Dr. Beryl Arbuckle, erforschte in zahlreichen pädiatrischen Autopsien die Faserverläufe der Dura mater im Zusammenhang mit bestimmten kranialen Dysfunktionen und beschrieb diese deutlich sichtbaren Faserverläufe als Stressbänder. Über die Entspannung der Stressbänder konnte sie eine deutlich verbesserte Funktion im Bereich des Schädels erreichen. Diese Behandlung wurde besonders für Babys und Kinder angewandt.
Die Pionierin in der Osteopathie für Kinder ist Dr. Viola M. Frymann D.O. Während einer Vorlesung von Dr. Sutherland erkannte sie die Ursachen für den Tod ihres Sohnes, der anscheinend an den Folgen der sehr schweren Geburt gestorben war. Sie erlernte die Behandlung des kraniosakralen Systems und begann mit der Behandlung von Geburtstraumata. Sie erstellte zahlreiche Forschungsarbeiten, die u.a. in den gesammelten Schriften von Viola M. Frymann veröffentlicht wurden ▶ [22], führte eine Kinderarztpraxis und gründete das Osteopathic Center for Children in San Diego, Kalifornien. Seit ihrem Tod im Januar 2016 wird das Zentrum von Dr. Centers weitergeführt, der bereits 20 Jahre mit Dr. Frymann zusammengearbeitet hat. Dr. Frymann hat als Lehrerin und Fürsprecherin für die osteopathische Behandlung von Kindern die ganze Welt bereist und v.a. auch in Europa die Osteopathie bekannt gemacht.
Prof. Jane Carreiro forscht an der University of New England in der Abteilung für Osteopathic Manipulative Medicine. Sie unterrichtet osteopathische Behandlungen von Kindern in den USA und in Europa und hat mehrere Bücher veröffentlicht ( ▶ [10], ▶ [11]).
Mittlerweile gibt es viele europäische Lehrer, die Kinderosteopathen ausbilden, sowie umfangreiche Fachliteratur.
2 Kinder in der osteopathischen Praxis – die besondere Verantwortung
Dieses Buch soll kurz und übersichtlich wichtige Grundlagen der kindlichen Entwicklung aufzeigen, um strukturelle von funktionellen, also osteopathischen Störungen zu unterscheiden. Denn hier liegt die besondere Verantwortung des Osteopathen, der Kinder betreut.
Viele Eltern suchen mittlerweile präventiv einen Osteopathen auf, um eventuell durch die Geburt entstandene Traumata frühzeitig behandeln zu lassen. Daher ist es wichtig, die Symptomatik des Kindes richtig zu beurteilen und bei dem Verdacht auf eine anlagebedingte Störung, z.B. eine zerebrale Dysfunktion, das Kind entsprechend an einen Kinder- bzw. Facharzt weiterzuleiten.
Das bedeutet auch, dass der Therapeut in einem gut funktionierenden Netzwerk arbeiten sollte, um Kind und Eltern entsprechende Versorgungsmöglichkeiten anzubieten. Wünschenswert ist die Zusammenarbeit mit Kinderärzten, Orthopäden, Neurologen, Optikern, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten, Logopäden und Motopäden. Der Osteopath hat in der Regel 30–45 min Zeit, sich mit dem Kind auseinanderzusetzen, und damit gute Möglichkeiten, Abweichungen von der normalen Entwicklung erkennen und einschätzen zu können.
Außerdem soll dieses Buch einen Einblick in die Möglichkeiten der osteopathischen Behandlung von Kindern geben und Verständnis für die Andersartigkeit der Anatomie, Physiologie und Gewebebeschaffenheit wecken.
3 Embryologie und Fetalperiode
Bei der Behandlung von Neugeborenen und jungen Säuglingen sind die intrauterinen Entwicklungsperioden noch sehr präsent und im Gewebe wahrnehmbar. Die Kenntnis der embryonalen Entwicklung ist also essenziell, um das Gewebe des kleinen Patienten adäquat wahrzunehmen.
Die Schwangerschaftsdauer umfasst klinisch betrachtet 40 Wochen; man berechnet sie vom Zeitpunkt der letzten Menstruation (Menstruationsalter). Die Zeitspanne von der Befruchtung bis zur Geburt beträgt in der Regel 38 Wochen (Ovulationsalter).
3.1 Intrauterine Entwicklung
Das intrauterine Heranreifen des Kindes wird in 3 verschiedene Phasen eingeteilt:
Blastenzeit: Sie endet ca. mit dem 17. Tag und umfasst die Befruchtung, die Wanderung durch die Tuba uterina und die Implantation in die Uterusschleimhaut. Sie endet mit dem Erscheinen der Keimblätter.
Embryonalzeit: Diese schließt sich an und endet mit der 8. Woche. Jetzt sind alle großen Organsysteme angelegt.
Fetalperiode: Sie erstreckt sich von der 9. Woche bis zur Geburt. In ihr finden die Differenzierung und die Reifung der verschiedenen Systeme statt. Ungefähr nach der 24. Woche (Ovulationsalter) ist das Kind äußerlich weitgehend entwickelt. In den letzten Wochen bis zur Geburt lagert es verstärkt Fett ein und wächst weiter in die Länge. Der Körper bereitet sich auf die Geburt vor.
Während der Fetalzeit beginnt die perinatale Periode (28. Woche Ovulationsalter). Sie erstreckt sich bis zum 7. Lebenstag.
Die postnatale Periode dauert bis zum Ende des 2. Lebensjahres. Hier finden v.a. im Bereich der Ausbildung von intellektuellen und motorischen Leistungen entscheidende Prozesse statt.
Differenzierung aus den 3 Schichten der Keimscheibe:
Ektoderm: Haut und Nervensystem
Mesoderm: Knochen, Muskeln, Bindegewebe (Faszien, Sehnen, Kapseln, Blutzellen)
Entoderm: Schleimhaut der Organe (Pharynx, Lunge, Verdauungsapparat)
Geschlechtszellen sind keine gewöhnlichen Körperzellen. Sie nehmen an der normalen embryologischen Entwicklung nicht teil. Sie sind „Überbleibsel“ aus frühen Entwicklungsstadien (Morula) und wandern erst relativ spät in die Keimdrüsen ein.
3.2 Blasten- und Embryonalzeit
Im Folgenden werden wesentliche Stadien der intrauterinen Entwicklung dargestellt.
3.2.1 Blastenzeit
Die Blastenzeit reicht von Tag 0 bis maximal Tag 19 ( ▶ Abb. 3.1):
Abb. 3.1 Blastenzeit.
(Drews U. Taschenatlas der Embryologie. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2006, Abb. A, S. 55)
3.2.2 Embryonalzeit
Die Embryonalzeit umfasst insgesamt die 3.–8. Woche:
Frühentwicklung (3. Woche):
Umorganisation des Embryos ( ▶ Abb. 3.2)
Die zweiblättrige Keimscheibe hängt am Haftstiel in der Chorionhöhle (primärer Dottersack).
Der sekundäre (definitive) Dottersack steht in Kontakt mit dem Entoderm, die Amnionhöhle weiterhin in Kontakt mit dem Ektoderm.
Abb. 3.2 Umorganisation der embryonalen Höhlen.
(Drews U. Taschenatlas der Embryologie. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2006, Abb. A, S. 59)
Achsenorgan (kraniokaudale Ausrichtung, 3. Woche):
Verdickung des Ektoderms in der Mittellinie (Primitivstreifen; ▶ Abb. 3.3)
Einsinken im Bereich der Mittellinie (Primitivrinne) und Wanderung von ektodermalen Zellen nach lateral – Induktion des intraembryonalen Mesoderms
Die Bildung der Primitivrinne induziert aus entodermalen Zellen die Entstehung der Chorda dorsalis als 1. Achsenorgan des Embryos (primitive Wirbelsäule)
Abb. 3.3 Entwicklung des Primitivstreifens.
(Drews U. Taschenatlas der Embryologie. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2006, Abb. A, S. 63)
Abfaltung (4. Woche):
Entwicklung des embryologischen Breitgesichts mit Neuralfalten und Schlundbögen
Entwicklung der ersten Somiten im Bereich der Nackenbeuge
Schluss des Neuroporus anterior, dann des Neuroporus posterior
Entwicklung von Arm- und Beinknospen
Am Ende besitzt der Embryo mehr als 30 Somiten ( ▶ Abb. 3.4).
Abb. 3.4 Kraniokaudale Krümmung: Embryo vor der Fixation, Dorsalansicht.
(Liem T, Schleupen A, Altmeyer P, Zweedijk R, Hrsg. Osteopathische Behandlung von Kindern. 2. Aufl. Stuttgart: Haug; 2010, Abb. 2.71 e, S. 71)
Verschluss des Darmrohrs (4. Woche):
Das intensive Wachstum des ektodermalen Anteils des Embryonalkörpers bedingt die kraniokaudale Krümmung und führt damit die vordere und hintere Darmpforte aufeinander zu. Dadurch wird die Verbindung zum Dottersack eingeengt (Dottergang; ▶ Abb. 3.5).
Kranial entstehen Schilddrüse, Lunge, Herz und Leber sowie Ösophagus und Magen, kaudal die Gallenblase und die Darmschlingen.
Abb. 3.5 Verschluss des Darmrohrs.
(Drews U. Taschenatlas der Embryologie. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2006, Abb. 2.15, S. 71)
embryonaler Kreislauf (4. Woche):
Die Krümmung des Embryonalkörpers führt die beiden Dorsalarterien aufeinander zu, sie verschmelzen oberhalb des Septum transversum, das sich weiter in die Horizontale verlagert, zur ersten pulsierenden Herzanlage.
Die Wachstumsbewegung des Septum transversum bietet Raum für die Entwicklung der Lungenknospen in den entstehenden Pleurahöhlen ( ▶ Abb. 3.6).
Abb. 3.6 Abgrenzung der Pleurahöhlen.
(Drews U. Taschenatlas der Embryologie. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2006, Abb. 7.4 B1, S. 311)
Organogenese (5. Woche):
Linse und Augenbecher verschmelzen, das Ohrbläschen bildet Flüssigkeitsräume, Herz, Lunge und der Verdauungstrakt differenzieren sich weiter, einzelne Abschnitte werden deutlich.
Die Wanderung der Myoblasten beginnt, aus denen sich die Rumpf- und Extremitätenmuskulatur entwickelt ( ▶ Abb. 3.7).
Abb. 3.7 Darstellung der Myotome und der Leibeshöhlen. Die Myotomplatten der Somiten sind verschmolzen.
(Liem T, Schleupen A, Altmeyer P, Zweedijk R, Hrsg. Osteopathische Behandlung von Kindern. 2. Aufl. Stuttgart: Haug; 2010, Abb. 2.62 b, S. 58)
Entwicklung der äußeren Gestalt der Sinnesorgane
ventrale Abwinkelung der Arm- und Beinknospen ( ▶ Abb. 3.8)
Ausdifferenzierung der großen Arterien und Venen im Kopf und im Rumpfbereich
Abb. 3.8 Ausdifferenzierung der Neuralleiste, Seitenansicht.
(Liem T, Schleupen A, Altmeyer P, Zweedijk R, Hrsg. Osteopathische Behandlung von Kindern. 2. Aufl. Stuttgart: Haug; 2010, Abb. 2.6, S. 19)
Organogenese (Anfang 6. Woche):
Entwicklung der Hypophyse aus der 1. Schlundtasche und dem Dienzephalon, weitere Ausdifferenzierung von Mundspalte, Unterkieferwulst, Stirnfortsatz und dem sich von lateral einschiebenden Oberkieferfortsatz ( ▶ Abb. 3.9)
Entwicklung des Darmrohrs in die Nabelschleife (physiologischer Nabelbruch)
Entwicklung der Rückenmuskeln, knorpelige Anlage der einzelnen Bestandteile der oberen Extremität
Streckung des Embryonalkörpers
Organogenese (Ende 6. Woche, Ende):
Ausdifferenzierung der unteren Extremität
Abb. 3.9 Gesichtswülste.
(Drews U. Taschenatlas der Embryologie. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2006, Abb. 5.5 A 2, S. 269)
Organogenese (7. Woche):
Entwicklung der Augenlider und der Ohrmuscheln, deutliche Abgrenzung der Fingerstrahlen, Zehen angedeutet
Ausformung der Nasenspitze
Entwicklung des Drüsen- und Hormonsystems (Hypophyse, Schilddrüse und Thymus)
Die Magendrehung ist vollzogen. Dick- und Dünndarm haben sich weiter ausdifferenziert, liegen aber noch außerhalb der Bauchhöhle in der Nabelschnur. Im kleinen Becken hat sich aus der Kloake die Blase mit den Harnleitern vom Rektum abgegrenzt.
Organogenese (8. Woche):
Das Skelett ist knorpelig angelegt im Bereich von Schädelbasis, Wirbelsäule und Rippen sowie Extremitäten. Mit der Entwicklung der Skelettelemente entwickeln sich auch die Gefäße, Nerven und Muskeln. Die Bauchwand zeigt eine Diastase, durch die sich die Leber wölbt. Der Darm liegt noch in der Nabelschnur ( ▶ Abb. 3.10).
Die Größe des Embryos beträgt ca. 18 mm.
Abb. 3.10 Leberdiastase und physiologischer Nabelbruch.
(Drews U. Taschenatlas der Embryologie. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2006, Abb. 7.1 A 6, S. 305)
Abb. 3.11 Sagittalschnitt Fetus, 14. Woche.
(Drews U. Taschenatlas der Embryologie. 2. Aufl. Stuttgart: Thieme; 2006, Abb. 2.36, S. 113)
3.3 Fetalperiode
Die Fetalperiode beginnt mit der 10. SSW und endet normalerweise in der 40. SSW mit der Geburt. Bei der Geburt wiegt der Säugling im Durchschnitt 3 500 g bei einer Größe von 50 cm ( ▶ Abb. 3.11).
Die komplette Rückverlagerung des Darms vollzieht sich in der 11. SSW, der Fetus hat also zunächst noch ein offenes Abdomen.
Das äußere Geschlecht ist ab dem 4. Monat im Ultraschall erkennbar. Das gesamte Bewegungsrepertoire und das Gehör sind entwickelt. Der Fetus bewegt sich dreidimensional und reagiert auf Musik und Rhythmus. Die Augen sind komplett angelegt, aber noch fest verschlossen. Das Herz ist funktionsfähig und pumpt das Blut mit bis zu 180 Schlägen/min in den Körper. Mund, Magen und Darm sind miteinander verbunden, der Fetus beginnt, Fruchtwasser zu schlucken.
Ab dem 5. Monat nimmt die Mutter erstmals Kindsbewegungen wahr. Röntgenologisch ist das Skelett darstellbar, Kalzium ist eingelagert. Lunge, Verdauungssystem, Nerven und Immunsystem reifen heran. Rezeptoren der Sinnesorgane stabilisieren sich in ihrer Verknüpfung zum zentralen Nervensystem (ZNS) und werden empfindlich für Reize (Licht, Geräusche, Geschmack).
Ab dem 6. Monat besitzt die Epidermis die individuellen Hautlinien an den Fingerspitzen, den Handflächen, den Zehen und Fußsohlen, der genetische Fingerabdruck ist determiniert. Lanugohaar und eine dicke Schicht von Käseschmiere (Vernix caseosa) bedecken den Fetus, um die Haut vor dem Aufweichen zu schützen. Bewegungen werden zielgerichtet ausgeführt, Geräusche werden unterschieden und nach der Geburt wiedererkannt (Stimme von Mutter und Vater, häufig vorgespielte Musik).
Bis zum 7. Monat sind alle Organsysteme komplett ausgebildet und bereiten sich jetzt auf die Zeit des extrauterinen Lebens vor. Es beginnt die Wachstumsphase mit Gewichts- und Längenzunahme. In der Lunge wird ein Lipid, der Surfactant-Faktor, gebildet. Er verhindert nach der Geburt das Kollabieren der Alveolen bei der Ausatmung. Feten, die vor dem 7. Monat geboren werden, sind aufgrund des fehlenden Surfactant-Faktors nicht ohne Beatmung lebensfähig.
Im 8. Monat beginnen die Nebennieren, erhebliche Mengen an Kortisol und einem androgenen Hormon zu produzieren. Beide Hormone bereiten den Organismus auf die Belastungen unter der Geburt vor. Ein Nebeneffekt ist die erhebliche Größenzunahme der Geschlechtsorgane und der Nebennieren. Beides bildet sich nach der Geburt zurück.
Im 9. Monat stellt sich der Fetus in seine Geburtsposition ein. Nun sind nicht nur alle Organsysteme voll entwickelt, sondern auch funktionsfähig. Zwischen Haut, Unterhaut und Muskeln hat sich eine Fettschicht gebildet. Die Körperkonturen runden sich. Der Magen-Darm-Trakt ist auf die Aufnahme von flüssiger Nahrung vorbereitet. Im Dickdarm befindet sich der Mekoniumpfropf, der innerhalb der ersten beiden Lebenstage ausgeschieden wird. Befindet sich Mekonium im Fruchtwasser, ist dies ein Zeichen für fetalen Stress.
Der Zeitpunkt der Geburt wird bei einer normal verlaufenden Schwangerschaft größtenteils vom Fetus bestimmt. Einige Tage vorher kann die Mutter schon leichte, unregelmäßig auftretende Wehen verspüren. Kurz vorher und während der Geburt ist ein kompliziertes, genau aufeinander abgestimmtes Wirken von verschiedenen Hormonen für den regelrechten Ablauf erforderlich.
4 Geburt
Die eigentliche Geburt wird in 3 Phasen unterteilt:
Eintritt in den Beckeneingang
Durchtritt durch das Becken
Austritt aus dem Beckenausgang
4.1 Regelrechter Geburtsverlauf
Die meisten Geburten finden aus der linken vorderen Hinterhauptslage (HHL) statt, d.h., der Fetus liegt mit dem Okziput nach vorne in der linken Fossa iliaca, die Nase zeigt zum rechten Iliosakralgelenk (ISG), Rücken und Gesäß füllen die linke Seite der Gebärmutter, die Extremitäten zeigen nach rechts.
Ungefähr 4 Wochen vor der Geburt verspürt die Mutter unregelmäßige Kontraktionen der Gebärmutter, die sog. Übungswehen. Sie entstehen durch die langsame Rückbildung der Plazenta und den damit einhergehenden Rückgang an kontraktionsförderndem Progesteron, einem Hormon der Plazenta.
Die Konzentration von kontraktionshemmenden (Östrogen) und gewebeerweichenden (Relaxin) Hormonen steigt. Die Wehen werden kräftiger, bis sie ungefähr einen Abstand von 3 min erreichen. Der vorangehende Teil des Fetus (normalerweise der Kopf, bei Beckenendlage das Becken) wird in den Geburtskanal geschoben. Der Beckenboden wird gedehnt, die Zervix öffnet sich (ca. 10 cm).
Mit einer Rotation nach rechts um ca. 45° tritt das Kind in das Becken ein. Die kleine Fontanelle zeigt nach links, der Schultergürtel steht anteroposterior ( ▶ Abb. 4.1a). Den 9 cm langen Beckendurchgang passiert das Kind mit einer Rotation um ca. 90°, die kleine Fontanelle steht anterior, und einer zunehmenden Flexion des Kopfes ( ▶ Abb. 4.1b). Der Schultergürtel stellt sich in eine schräge, links-posteriore Achse. Das Schambein der Mutter dient dem Hinterhaupt des Kindes als Hypomochlion. Aus der vollen Flexion streckt sich der Kopf in die maximale Extension und gleitet um das Schambein aus dem Becken der Mutter ( ▶ Abb. 4.1c, d). Der Schultergürtel passiert das Becken durch eine Drehung nach anteroposterior ( ▶ Abb. 4.1e). Die obere Schulter (rechts) wird als Erstes entbunden, dann folgen die untere Schulter, der Rumpf, das Becken und die unteren Extremitäten. Verläuft alles ohne Komplikation, erfolgt die Entbindung mit 4–5 Presswehen.
Abb. 4.1 Normaler Geburtsverlauf. a Eintritt des Kopfes im queren Durchmesser (Pfeilnaht verläuft quer) in das Becken. Der Kopf befindet sich in einer Mittelstellung zwischen Flexion und Extension. b Der Kopf ist durch Rotation um 90° durch die Beckenhöhle durchgetreten (Pfeilnaht gerade). Die Schulterbreite im Beckeneingang ist nun quer eingestellt. c Geburt des Kopfes durch Deflexionsbewegung mit dem Stemmpunkt an der Symphyse. d Äußere Drehung des Kopfes. e Geburt der Schultern.
(Liem T, Schleupen A, Altmeyer P, Zweedijk R, Hrsg. Osteopathische Behandlung von Kindern. 2. Aufl. Stuttgart: Haug; 2010, Abb. 4.5 a–e, S. 125)
4.2 Abweichender Geburtsverlauf
4.2.1 Abweichende Kindslagen
rechte vordere HHL, rechte/linke hintere HHL
hoher Geradstand
Beckenendlage
Querlage
Der hohe Geradstand und die Querlage sind nicht auf normalem Weg zu entwickeln, sondern nur per Sectio cesarea (geplant oder ungeplant).
4.2.1.1 Mögliche osteopathische Dysfunktionen
Befindet sich der Fetus in der rechten vorderen oder rechten/linken hinteren HHL, dauert die Geburt meistens länger, weil das Kind beim Eintritt in das Becken eine Rotation von 135° anstatt 45° beschreiben muss. Der Schädel kann ein Kompressionsmuster wie Torsion oder Sidebending-Rotation (SBR) zeigen.
Die hintere HHL führt im Allgemeinen öfter zu einer Präsentation als „Sternengucker“.
Die Beckenendlage belastet stärker die LBH-Region (LWS-, Becken- und Hüftbereich), was zu einer verminderten Entwicklung der Hüftgelenke führen kann und eine kongenitale Hüftdysplasie begünstigt (statistische Häufung wird beschrieben).
4.2.2 Abweichende Präsentationen
hintere HHL, „Sternengucker“
Stirnlage
Gesichtslage
Asynklitismus
Schulterdystokie
Die Gesichtslage führt in den meisten Fällen zu einem Notkaiserschnitt.
4.2.2.1 Mögliche osteopathische Dysfunktionen
Sternengucker (hintere HHL) und Stirnlagen zeigen eine deutliche frontomaxilläre Kompression mit Dysfunktionen der Ossa lacrimalia und des Os ethmoidale sowie Bewegungseinschränkungen des Os frontale und der Ossa maxillaria.
Der Asynklitismus (Scheitelbeinstellung) hinterlässt Dysfunktionen im Bereich der Ossa parietalia und oft auch eine Lateral-Strain-Dysfunktion der Synchondrosis sphenobasilaris (SSB).
Die Schulterdystokie belastet den Schultergürtel und in den meisten Fällen die rechte Klavikula mit Irritation des Plexus brachialis und des M. sternocleidomastoideus. Weitere Folgen sind intraossäre Dysfunktionen der Klavikula, Frakturen und Bewegungseinschränkungen im Bereich der Sternoklavikular- und Akromioklavikulargelenke. Häufig findet der erste Atemzug noch innerhalb des Geburtskanals statt, sodass sich der Thorax nicht ausreichend aufdehnen kann. Die Lungen können sich nicht voll entfalten, die Alveolen werden nicht ausreichend belüftet, eine Restflüssigkeit persistiert.
4.2.3 Operative Entbindung
Zangengeburt (Forceps-Entbindung)
Vakuumextraktion
geplanter und ungeplanter Kaiserschnitt (primäre/sekundäre Sectio cesarea), Notsectio
4.2.3.1 Mögliche osteopathische Dysfunktionen
Forceps-Entbindungen hinterlassen laterale Kompressionen der SSB, bei denen v.a. die beiden Partes petrosae der Ossa temporalia mit der SSB fixiert sind und nicht selten auch eine Dysfunktion der beiden temporomandibulären Gelenke auftritt.