
3,99 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,49 €
Niedrigster Preis in 30 Tagen: 5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Für Kinder und Jugendliche
- Sprache: Deutsch
Das Restaurant der Familie Mo wird bedroht. Paula und Jim versuchen, Licht in die Hintergründe zu bringen. Und dann sind da noch die Jungen vom Schachclub, die um die 13 Jahre alte Paula wetteifern. Die begabte Jüdin Sarah wird gemobbt und Fati aus der Türkei schießt zur Not auch auf die chinesische Mafia. Ein Buch voller verrückter Ideen, lustiger Charaktere, etwas Schach und Gemeinheit, von Beziehungen und Verliebtsein und detektivischer Spannung. Wer mitknobeln mag, wer seinen Scharfsinn wetzen will oder einfach nur Spaß haben will, liegt mit diesem Buch richtig. Und obendrein gibt es eine ganze Menge Klischees, die es sonst nirgends mehr gibt. Klischees, die man einfach mag.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2021
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Im Käfig der Langeweile
Sarah wird gemobbt
Familie Mos Sorgen
Die erste Partie
Das Gedicht
Schachmatt
Sarah kämpft
Ein neuer Stern
Glück im Schnee
TikTok
Väterchen erzählt
Sarahs Heim
Fatis Zuhause
Old Bob
Erwischt
Große Schritte, kleine Schritte
Der Club
Sarahs Glück
Zwei Paare
Die Brücke
Kommissar Tim
Detektiv Jim
Tipps
Neuanfang
MuChan
Gerüchteküche
Empfang in der Cafeteria
Chessynessie im Ring
Kommissar Tims Gedanken
Das Konzert
Agent Fati
Sarahs Auftritt
Ein ernstes Gespräch
Geschenke
Das Treffen
Acht Detektive
Alle Neue
Qing Wa
Paulas seltsamer Schachfreund
Christus
Wolf
Das Verhör
Prinzessin Paula
Sarahs Feinde, Sarahs Freunde
Kampf mit Dimitrij
Der seltsame Fund
Frau Mo überlegt
Der Kuss
Jim
Am Zaun
Viele Zufälle
Das Ständchen
Mitternachtsgeplauder
So ungeschickt!
Verfolgungen
Das einsame Haus
Unter Gaunern
Neuigkeiten
Der Chinese
Georg und seine Schwester
Im Alleingang
Gefährliches Spiel
Fati in Aktion
Friss!
Geständnis
Xie Li
Der Märchenkenner
Spuren
Ein alter Bekannter
Chessynessie triumphiert
Zwei Frauen
Ein Märchen
Ostern
Anhang
Impressum
Im Käfig der Langeweile
Die Welt war ein Gefängnis. Es gab nichts zu tun. Es waren Ferien, es war Lockdown. Nur der Regen trommelte auf das schräge Fenster des Dachzimmers, als ob Abenteuer und wilde Kämpfe bevorstanden.
Lustlos blickte Paula durch das verschwommene Glas auf den grauen Himmel. Manchmal unterbrach das Summen ihres neuen Smartphones die Eintönigkeit des Tages. Doch im Moment blieb es still. Ihr Kater Neko reckte sich und fuhr seine Krallen aus. Paula streichelte sein getigertes Fell und blickte auf das Tischchen in der Mitte des Zimmers. Ein Geschenk lag darauf, das Geschenk ihres älteren Bruders. Es war noch unausgepackt, groß und mit bereits gebrauchtem bordeauxrotem Geschenkpapier umwickelt. ‚Was immer es ist, es wird mir nicht gefallen‘, dachte Paula.
Einmal hatte er ihr einen Pullover geschenkt, der ihr überhaupt nicht stand, aber ihm ganz gut. Ein anderes Mal Bitterschokolade, die sie nicht mochte und die von ihm gegessen wurde; ein drittes Mal ein Spiel mit komplizierten Regeln, bei dem mit Sicherheit immer er gewann. So waren seine Geschenke.
Darum lag es da seit gestern, seit ihrem dreizehnten Geburtstag, der der Anfang eines neuen, aufregenden Jahres sein sollte.
Lustlos zupfte sie am Papier und an den viel zu fest verknoteten Schnüren.
Die Bewegung des Bandes lockte Neko an, der das Papier bald zerfetzt und den Karton darunter zerkratzt hatte. ‚Gut so‘, dachte Paula unwirsch und sah den Inhalt des Geschenkes neugierig an. Figuren waren in dem Kasten, von denen einige wie Pferde aussahen. Ganz süß. Sie waren schwarz und weiß. Darunter war ein Brett zum Aufklappen mit vielen kleinen, quadratischen Feldern und mit Zahlen und Buchstaben am Rand. Wozu sollte das gut sein?
Paula seufzte, nahm die Pferdchen, stellte sie auf das Regal über ihrem Bett und schob den Karton unter das Bett. Von allen überflüssigen Geschenken war es das allerüberflüssigste. Sie hörte Schritte auf der Treppe, ihre Zimmertür öffnete sich und ihr Bruder Jim stand groß und unbeholfen in ihrem kleinen Dachzimmer. Vom Anklopfen hielt er nicht viel.
„Soll ich dir erklären, wie es geht?“, fragte er herablassend.
„Wie was geht?“
„Das Spiel, das ich dir geschenkt habe.“
„Ist unter dem Bett“, antwortete seine Schwester gelangweilt.
„So gehst du mit meinen Geschenken um.“
Dann bückte er sich und zog das Spiel hervor, hockte sich auf das runde Sitzkissen am Tischchen und fing an, die Figuren auf das aufgeklappte, schwarz-weiß gemusterte Brett zu stellen. Paula bemühte sich zu lächeln. Auch ihr Bruder langweilte sich schließlich.
„Also das ist das Brett und das sind die Figuren“, begann er lebhaft. „Jede Figur hat ihre Besonderheit. Zuerst erkläre ich die Springer, die sind am schwierigsten.“
Er fing an, zwischen den Figuren im Kasten zu wühlen.
„Was suchst du?“
„Sag’ ich doch, die Springer! Was ist das für ein Schachspiel?“
„Hast du mir geschenkt.“ Die Sache fing an interessant zu werden.
Jim schüttete alle Figuren auf das Brett, als ob es seine wären, und schob sie suchend hin und her.
„Wie sehen die Springer denn aus?“, wollte Paula wissen.
„Na, wie Springer eben, wie – Pferde!“
Sie hatte sich das schon gedacht. „Ach so“, sagte sie, „ich glaube, die stehen da oben.“ Dabei zeigte sie auf das Regal und lächelte unschuldig. Jim starrte auf das Regal und holte sie rasch herunter. Offensichtlich wollte er wirklich gern mit ihr spielen, denn er verbiss sich jede Bemerkung.
„Sieht doch süß aus, oder?“, sagte seine Schwester dafür. Sie kniff ihre hübschen dunklen Augen zu fein gezogenen Schlitzen zusammen, zauberte ein Grübchen auf ihre Wange, blinzelte einmal und konnte es an Unschuld mit jeder chinesischen Prinzessin aufnehmen. Ihr Bruder, der mehr von ihrem deutschen Vater hatte, hasste das.
„Pass jetzt auf“, kommandierte er. Die Pferde gehen in jede Richtung. Ein Feld vor und ein Feld schräg. Er demonstrierte es energisch. „Siehst du? Probier es.“ Sie vollführte brav die vorgeschriebenen Sprünge. Das machte ihr Spaß.
Dann wischte ihr Bruder alle Figuren vom Brett, stellte ein weißes Pferd auf das Feld unten links und fragte: „Wie viele Sprünge brauchst du, um zum Feld oben rechts zu kommen?“ Und er sah sie herausfordernd an.
Paula sah das Pferdchen an, ließ den Blick über das Brett schweifen und sagte: „Ich glaube, es heißt Fallada.“
„Was?“
„Das Pferdchen, es sieht aus wie Fallada, findest du nicht?“
Nun mochte ihr Bruder Märchen und Geschichten, aber es war jetzt nicht der Augenblick dafür: „Lenk nicht ab. Lass dir Zeit. Überlege!“
‚Pah‘, dachte Paula, ‚es ist mein Geschenk und mein Geburtstag.‘
Da ging die Tür langsam zum zweiten Mal auf und zwei kleine Köpfe erschienen mit kurzen schwarzen Zöpfen. „Zefan“, rief der eine, und, „Zefan“ schrie der andere. Und um sicher zu sein, dass ihre älteren Geschwister sie auch verstanden, fügten sie mit einem Kopfnicken hinzu: „Essen, bitte.“ Dann schlugen sie die Tür mit der ganzen Kraft ihrer zweieinhalbjährigen Körper zu und stolperten lachend die Treppe hinunter.
Paula atmete erleichtert auf. Wenigstens hatte sich diesmal keine von beiden die Finger gequetscht.
„Gut, essen wir erst mal“, entschied Jim. „Hinterher kannst du es ausprobieren.“
„Wozu?“, fragte Paula
„Was heißt‚ wozu? Willst du spielen oder nicht?“
Paula stand auf, ging zur Tür, drehte sich um und sagte: „Es sind sechs. Von links unten nach rechts oben. Sechs Sprünge.“
Dass ihr Bruder daraufhin einen Moment sprachlos war, gefiel ihr.
Sarah wird gemobbt
Sarah konnte es nicht fassen. So eine Niedertracht, so eine Gemeinheit! Was hatte sie denn getan? Ein Gedicht geschrieben, das war alles. Die Lehrerin hatte es gelobt, das ging ja noch. Aber vorlesen? Ohne Sarah zu fragen, online, versteht sich. Sonst hätten es alle vergessen, sofort, schon im Unterricht. Nun hatten es die meisten gespeichert.
Sarah war die Beste in ihrer Klasse. Gehässige Bemerkungen war sie gewöhnt, Neid und Tuschelleien. Jetzt aber wurde sie offen angegriffen mit ätzendem Spott und Beleidigungen.
Sie hatte keine Freunde in der 7b des Gymnasiums von Bad Heimingen.
Ihre junge Lehrerin hatte kurz vor den Ferien die Aufgabe gestellt, über die eigenen Erfahrungen mit der Pandemie zu schreiben. Sarah hatte ein Gedicht geschrieben. Na und? Sie hatte es für sich verfasst, vielleicht für Frau Wohleben, die Lehrerin, nicht für die Klasse.
Als ob sich alle verabredet hätten, nun über die klasseneigene Chatgroup auf sie loszugehen. Auch eine Idee von Frau Wohleben, diese Chatgroup. Sie, Sarah, hatte sich gesträubt, hatte gleich geahnt, dass hinter dem scheinbar fröhlichen und harmlosen Geplauder Abneigungen und Aversionen lauerten. Es war ja so leicht, auf diese Weise jemanden anzugreifen.
Sarah glitt zum vierten Mal durch die Kommentare. Wie witzig, dachte sie verächtlich. Das war die Jungengruppe um Ivan. Doch die Mädchen waren auch nicht besser: Wer liegt auf weißen Laken und stirbt vor sich hin? hatte Elli gespottet. Und Elenora dazu gereimt: Sarah, mit ihrem Gedicht ohne Sinn.
Am gemeinsten aber war wieder einmal Eveline: So viele halten sich für was Besonderes, so viele sitzen auf ihrem eingebildeten Thron, so viele, die sterben als eine dumme Kuh – die dümmste davon bist du.
War das nicht eine Morddrohung? Sarah grübelte. Sie könnte es der Lehrerin sagen, die würde es dem Direktor sagen. Bestens, dann weiß es bald die ganze Schule! Das war das Gemeine. Man konnte sich überhaupt nicht wehren. Vielleicht wusste Paula Rat.
Paula wurde nie gemobbt. Sie ging auf die Realschule und war Sarahs einzige Freundin. Na ja, Fati natürlich auch, aber Fati war lustig und lieb und verstand sie im Grunde nicht. Sarah griff nach ihrem Smartphone, drückte den grünen WeChat-Button und wartete. ‚Geh schon ran‘, murmelte sie ungeduldig.
„Was gibt’s?“, erklang Paulas muntere Stimme endlich.
„Sie wollen mich umbringen“, hauchte ihre Freundin in das kleine Mikrofon.
„Was?!“
Sarah war es zufrieden. Paula nahm wie immer alles ernst.
„Mit Worten“, fügte sie düster hinzu.
„Ach so“, klang es erleichtert.
„Worte können wie Dolche sein. Schlimmer noch!“
„Natürlich, bestimmt, ich weiß schon wie das ist. Du, Sarah, wir essen gerade. Ich ruf’ dich später an, ja? Dann erzählst du mir alles.“
Es gab ein leises Klicken und Sarah war wieder allein mit ihrem Startbildschirm. Na gut, wartete sie eben.
Familie Mos Sorgen
Der Regen des Vormittags war allmählich in Schnee übergegangen. Nun fiel er sanft und gemächlich vorbei an den großen Fenstern des Restaurants Drachengarten und bedeckte die Wiese und die Bäume dahinter wie mit Puderzucker.
Familie Mo saß und aß, teils mit Stäbchen, teils mit Gabeln. Zwei speisten mit Händchen, Kim und Kiri nämlich, und schlürften die Suppe dabei in ihre kleinen Münder hinein. Jim meinte, sie müssten eigentlich Krach und Chaos heißen, aber im Augenblick waren sie friedlich.
„Gefällt dir dein neues Smartphone?“, fragte Paulas Mutter, während sie versuchte, Suppe aus dem Gesicht von Kiri zu wischen.
„Klar“, erwiderte Paula, wobei sie nicht aufhörte, die Krabben in ihrem Mund zu zerkauen.“
„Wer war das?“, wollte ihr Bruder wissen, nachdem Paula aufgelegt hatte. Sie lächelte innerlich. Sie hatte schon bemerkt, dass er ihre Freundin mochte.
„Sarah.“ Ihr Bruder nickte verständnisvoll.
„Schmeckt super, diese Ingwersoße mit Krabben und Bambus“, lobte Paula.
„Mmh, ein bisschen Weißwein und Safran ist auch noch mit drin“, erklärte ihr Vater zufrieden. Die Mutter blickte ihn vorwurfsvoll an.
„Safran?“
„Ein klitzekleines bisschen“, entschuldigte sich Väterchen und zwinkerte fröhlich mit den Augen.
„Sobald du weißt, wovon wir die Miete bezahlen, kannst du den ganzen Sack hineinschütten.“
„Sicher, ja. Hast du schon mit dem Vermieter gesprochen?“
„Das habe ich.“ Sie wischte heftig den Mund von Kim ab, so heftig, dass sie erstaunt aufsah und überlegte, ob es ein berechtigter Anlass war zu weinen und mit dem Essen aufzuhören.
„Er meint, er kann unmöglich darauf verzichten. Er könne nicht warten. Wenn wir nicht bezahlen, dann sollen wir eben packen und gehen.“
„Ist doch aber gesetzlich vorgeschrieben, dass man die Miete zwei Jahre später zahlen kann“, warf Jim verärgert ein.
„Das interessiert ihn nicht.“
Paula hatte diesen Menschen nie gemocht. Er behauptete, aus China zu sein, aber sie glaubte ihm nicht. Er stammte mit Sicherheit aus einer Wüste, in der es nur Felsen gab und Grausamkeit und Geiz. Ein Chinese war er nicht und er sah auch nicht so aus.
„Können wir da nichts machen?“, fragte Jim mit einer Mischung aus Sorge und Zorn.
„Abwarten“, sagte Väterchen Koch, wie Paula ihren Papa für sich gern nannte. „Für den nächsten Monat kratzen wir es noch zusammen und zu essen haben wir in jedem Fall genug. Das reicht noch für ein ganzes Jahr.“
Zufrieden klopfte er sich auf den Bauch. Dann lächelte er seinem Sohn beruhigend zu: „Es ist nicht leicht Mieter aus dem Haus zu werfen, im Moment schon gar nicht. Macht euch keine Sorgen. Überlasst das euren Eltern und kümmert euch um die Schule.“
„Es sind Ferien“, riefen Paula und Jim zugleich empört.
„Man kann auch in den Ferien lernen“, sagte ihre Mutter entschieden.
„In China vielleicht“, versetzte Jim mürrisch. „In Deutschland ist das nicht erlaubt.“ Frau Mo seufzte. Sie war mit dem deutschen Schulsystem nie ganz glücklich.
„Wir lernen aber schon etwas“, versuchte Paula sie zu trösten. „Wir lernen Schach!“
„Das ist ein Spiel“, meinte ihre Mutter und knüpfte die Lätzchen ihrer beiden Jüngsten los.
Väterchen Koch zog die Augenbrauen hoch. „Schach“, sagte es, „Schach ist ein Sport. Und eine Philosophie.“ Da sah ihn seine hübsche, schwarzhaarige Frau seltsam an, strich sich durch die langen, glatten Haare, rümpfte ein wenig das feine Näschen und schwieg. Das kam nicht oft vor.
„Na“, sagte ihr blonder, großer Mann zufrieden. „Dann wollen wir mal abräumen. In der Küche steht noch Nachtisch.“
Die erste Partie
Die Figuren waren aufgestellt. Glänzend standen die Reihen einander gegenüber. Schwarz gegen Weiß. Paula wusste nun, dass die Läufer sich diagonal, also schräg bewegen, die Türme hingegen gerade; die Dame in jede Richtung, wie auch der König, aber dieser nur ein einziges Feld weit. Einfache Regeln, wie Paula fand.
Jim saß ihr gegenüber an ihrem Beistelltisch, lächelte überlegen und setzte den Bauern vor seinem König zwei Felder vor. Paula zögerte. Es gab so viele Bauern, die sie bewegen konnte. Sollte sie ein oder zwei Felder nach vorne rücken? Oder doch lieber ein Pferd? „Du bist dran.“ Jim wurde schon ungeduldig.
Sie wollte einen Bauern ziehen, aber nicht so dicht an dem angreifenden von Jim, auch nicht ganz am Rand. Sie ergriff den Bauern auf der rechten Seite vor Fallada und schob ihn vorsichtig ein Feld vor.
„Pff“, machte Jim.
„Ist das falsch?“, erkundigte sich Paula.
„Nein, nein, geht schon.“ Dann stellte er seinen Damenbauern keck neben den ersten nach vorn. Das sah gefährlich aus.
Paula bewegte den rechten Läufer auf das Feld, das ihr Bauer frei gemacht hatte. Sie war zufrieden. Dort hatte der Läufer eine gute Aussicht und eine schöne lange Bahn. Wer weiß, vielleicht konnte sie Jims Königsbauern beim nächsten Zug nehmen?
Ihr Bruder zog einen Springer und schützte den Bauer, auf den Ihr Läufer zielte. Paula ließ ihr linkes Pferd über die eigene Bauernreihe springen und griff dadurch den weißen Bauern erneut an. Pferd und Läufer arbeiteten gut zusammen. Das gefiel ihr.
„Du solltest dich mehr um das Zentrum kümmern“, belehrte sie Jim. „Am Anfang muss man vor allem das Zentrum kontrollieren.“ Dann spazierte er mit dem angegriffenen Königsbauern ein Feld vor und ihr Pferd musste weichen. ‚Nun‘, dachte Paula, ‚wenn ich das Zentrum kontrollieren soll, dann springe ich einfach mitten hinein, zwischen die beiden Bauern.‘ Gedacht, getan.
Paula hatte keinen Plan, woher auch, wo sie doch zum ersten Mal spielte; aber sie achtete darauf, dass möglichst viele Figuren etwas zu tun bekamen. Die Dame hielt sie zurück. Sie hatte großen Respekt vor ihr.
Jim hingegen ließ seine Bauern vorwärts marschieren, sprang mit den Pferden vor und zurück, verfolgte erst diesen, dann einen anderen Plan, griff links mit seiner Dame an, aber konnte gegen die gut postierten Pferde und Läufer nichts ausrichten. Darum ließ er sie stehen und probierte einen Angriff auf der anderen Seite.
Paula tat seine Dame leid. Schließlich brauchte sie jetzt nur den linken Bauer vorzusetzen und sie beim nächsten Zug mit dem Pferd anzugreifen, dann hätte sie gar keinen Ausweg mehr und müsste sich ergeben. Von ihrem Bruder hätte sie sich mehr Interesse an seiner Dame gewünscht. Doch, ‚Strafe muss sein‘, dachte sie und brachte den linken Bauern in Position. Nun musste er sich um die Königin kümmern, wenn er sie nicht verlieren wollte.
Jim tat nichts dergleichen. Stattdessen bedrohte er ihren Läufer. Paula musste sich entscheiden. Entweder sie brachte ihn in Sicherheit oder sie führte den geplanten Angriff auf die Dame aus. Gerade streckte sie die Hand nach ihrem Pferd aus, hatte es schon am Kopf gefasst, als ihr Bruder rief: „Halt! Ich nehme den letzten Zug zurück.“
Damit stellte er den zuvor bewegten Bauern wieder auf sein altes Feld und rettete stattdessen seine Dame. „So ist es besser“, erklärte er.
„Darf man denn beim Schach Züge zurücknehmen?“, wunderte sich Paula.
„Wir sind ja nicht bei der Schachweltmeisterschaft.“
Nun, das stimmte. Aber anscheinend dürfte man es eigentlich nicht.
Jim passte nun besser auf und sie konnte keine Figur mehr von ihm gewinnen. Erst als er einmal besonders lange überlegte, betrachtete Paula in Ruhe die Stellung. Jims König war verlassen. Seine Untertanen standen verstreut auf dem Spielbrett herum. Nur zwei Bauern schützten ihn. Ihr Läufer zielte just auf den einen davon. Wenn Sie ihre Dame unauffällig auf die andere Seite des Spielfeldes bringen würde, dann könnte sie geschützt vom Läufer den Bauern nehmen und der König fände keinen Ausweg mehr, ohne im Schach zu stehen. Dann wäre es aus für den König! Das wäre – wie hatte Jim es noch genannt – schachmatt. Nur dürfte ihr Bruder es nicht merken, wenn ihre Dame sich anpirschte.
Enttäuscht ließ sie den Kopf hängen: „Puh, was soll ich machen?“
„Ja“, erklärte ihr Bruder zufrieden, „es wird allmählich schwierig für dich.“
„Ich ziehe wohl lieber meine Dame weg“, erklärte Paula schüchtern. Erster Zug. Jim setzte einen Bauern vor, lächelte überlegen und bemerkte zufrieden: „Dein Läufer ist futsch.“
„O nein!“, rief Paula mit gespieltem Ärger und bewegt ihre Dame auf Angriffsposition. Zweiter Zug.
Sie war jetzt aufgeregt wie lange nicht mehr. Würde ihr Bruder den Läufer nehmen, anstatt den König zu schützen? Wäre er wirklich schachmatt oder hatte sie etwas übersehen? Gab es noch Extraregeln? Dürften jüngere Schwestern ihre älteren Brüder überhaupt im ersten Spiel besiegen? Unruhig bewegte sie die Finger am Rand des Tisches.
Sie war halb chinesisch, halb deutsch erzogen worden. Sie fühlte sich wohl in ihrer Rolle als Prinzessin. Ihr Bruder war älter, er war klüger, er ging aufs Gymnasium, er half ihr manchmal, verspottete sie gern, doch war immer großzügig, vor allem wenn er gewann.
Sie hatte es früh gelernt. Schon beim Memoryspielen. Nie konnte sie verstehen, warum er manchmal nicht wusste, wo welche Karte liegt. Sie konnte sich immer alle merken. Ein Freund ihrer Eltern meinte damals, bestimmt habe sie ein fotografisches Gedächtnis. Das hasste sie seitdem.
Denn am Abend war ihre Mutter gekommen und hatte ihr geraten, doch lieber nicht alle Karten beim Memory bei sich zu sammeln. Für ihren Bruder Jim sei es wichtig, mindestens ebenso viele zu haben.
„Oder? Das verstehst du doch?“ hatte sie gesagt, ihre Mutter, die sonst so lieb und gerecht war. Paula hatte genickt und dabei war es geblieben. Nicht nur beim Memoryspielen.
Neko streckte sich. Er hatte lange müßig auf dem Bett gelegen, stand jetzt neugierig auf und schlich näher. Er spürte die Spannung in der Luft und sah die schlanken Finger seiner Besitzerin, die sich nervös auf dem Seidentuch bewegten, das das Tischchen schmückte, auf dem sie spielten.
Jim streckte die Hand aus, schlug mit seinem Bauern stolz ihren Läufer, schon wollte Paula fast zitternd ihre Dame anheben und ins Ziel führen, da spürte sie plötzlich einen heftigen Schmerz in der linken Hand und sah, wie das Tuch unter dem Brett sich ruckartig bewegte. „Nicht, Neko, nein!“, doch es war zu spät.
Ihr Kater hatte spielerisch nach den aufreizend unruhig tippenden Fingern von ihr geschlagen. Wie alle männlichen Mitglieder der Familie Mo war er stark und dickköpfig. Seine Krallen hatten sich in dem feinen Seidentuch verfangen und er war entschlossen, sich zu befreien. Umsonst bemühte sich Paula um eine friedliche Lösung. Heftig riss Neko am Tuch und es regnete Schachfiguren. Er maunzte erschrocken auf und verkroch sich, befreit aber beleidigt, unter das Bett.
„Tja, das war es dann wohl“, kommentierte Jim nicht unzufrieden. „Du hast gar nicht schlecht gespielt für das erste Mal. Aber einen Läufer weniger, das hättest du nicht aufgeholt.“ Er stand auf und verließ lächelnd das Zimmer.
Seine Schwester setzte sich nachdenklich auf ihr Bett und ließ sich schließlich enttäuscht rückwärts in ihr Kissen fallen.
Das Gedicht
Von ihrem Finger rollte ein roter Tropfen langsam hinunter. Gleichgültig starrte Paula auf ihn und auf das Fenster, das schon weiß gedeckt war vom Schnee, der sich Flocke um Flocke darauf sammelte und nur milchig, schummriges Licht hindurchließ.
Sterben im Schnee soll ja friedlich sein, sobald man sich darin ergibt, dachte Paula. Sie war enttäuscht. Zu gern hätte sie ihren Bruder besiegt. Egal. Ihre Eltern ergaben sich nie. Wie sehr bewunderte sie ihre Mutter. Sie hatte vier Kinder, ein Restaurant im Lockdown, kümmerte sich um alle, putzte, wusch, organisierte, half, ermahnte, schlief immer zu wenig, trank einen Kaffee oder grünen Tee und schuftete weiter. Manchmal zankte sie mit Vater, ziemlich oft sogar, aber es war mehr laut als bedrohlich. Mit ihrem Vater, großmütig und gütig wie er war, konnte man nicht lange streiten.
Wie war bloß dieser Mann einmal allein nach China aufgebrochen, um chinesischer Koch zu werden, den ‚mandeläugigen Gourmets‘, wie er sie nannte, ihre Geheimnisse zu entlocken und ihre kulinarischen Tricks abzuschauen? Wie hatte er ihre Mutter kennengelernt? Paula hätte gern mehr darüber gewusst. Ihre Eltern erzählten nicht viel. Jedenfalls hatten sie sich verliebt und er war mit ihr nach Deutschland zurückgekehrt, wo sie heirateten und vor fünf Jahren dieses Restaurant eröffneten, das eines der besten in der Gegend war.
Gewesen war, denn nun war es geschlossen und für Takeaway war ihre Küche zu fein. Auch die einfachen Gerichte, die sich Väterchen ausgedacht hatte, wurden wenig nachgefragt, wie überall in dieser Zeit der Lethargie und Kälte. Allen war alles egal. Sie fühlte, wie sie langsam selbst zu einem Kristall erstarrte. Halb öffnete sie die Augen und sah, wie das fliederblaue Laken an einer Stelle verdunkelt war. ‚Blut‘, dachte sie. Wovon? Von ihrem Finger. Es war ihr gleichgültig, wie alles andere um sie herum. Schließlich stand sie auf.
Die Schachfiguren lagen verstreut auf dem Boden. Paula stellte die Figuren, auf das Brett wie vor dem letzten Zug. Sie hatte das Bild davon im Kopf. Eines war klar: Ihr Bruder war schachmatt.
Sie packte das Spiel enttäuscht zusammen und schob es unters Bett, was ihre Katze dazu bewog, zögernd hervorzukommen.
„Tut mir leid, Neko. Ich hoffe, du hast dir nicht wehgetan. Wahrscheinlich hattest du recht. Es war besser, nicht zu gewinnen.“
Der Ton ihres Smartphones schreckte sie auf. Sarah. Sie tastete nach ihrem Handy. „Sarah, es tut mir so leid. Ich wollte dich anrufen, ganz bestimmt!“
„Alles klar bei dir, Paula? Hier ist Fati. Bist du blind?“
„Nein, ich war nur – deprimiert.“ Es gelang ihr, die Augen zu öffnen, und sie sah in das lachende Gesicht ihrer Freundin.
„Was gibt‘s?“
„Nichts. Sarah lässt nur fragen, ob wir eine WeChat-Konferenz machen oder ob sie sich umbringen soll.“
„Das habe ich nie gesagt, Fati!“, schaltete sich die Betroffene ein.
„Nein? Aber es klang so.“
„Tut mir leid, Sarah, es ist meine Schuld, ich wollte dich anrufen und ...“
„Nicht schlimm, sicher hattest du etwas Wichtiges.“
„Na ja, ich habe Schach gespielt.“
„Schach? Dieses langweilige Spiel mit den vielen Figuren? Habe ich nie verstanden. Ist nicht für Hauptschüler.“
„Mmh“, meinte Sarah, „mein Vater hat es mir mal erklärt, aber soo interessant fand ich es nicht“,
„Egal. Reden wir über dich, Sarah. Wer hat dich gemobbt?“
„Wer? Die ganze Klasse.“
„Warum werde ich nie gemobbt?“, fragte Fati enttäuscht. „Aber das gibt es wohl nur bei euch auf dem Gymnasium. Wir beschimpfen uns einfach. Wär das nicht ’ne Lösung? Wie ist das auf der Realschule, Paula?“
„Es geht.“ Sie wusste, wenn sie jetzt nicht aufpasste, dann plapperte Fati ohne Ende und ihre andere Freundin wäre genervt.
„Erzähl mal, Sarah, was ist genau passiert?“
„Puh, so viel“, begann sie gedankenschwer. „Es begann mit einem Gedicht.“
„Welchem Gedicht?“
„Meinem Gedicht.“
„Den Rest kann ich mir denken.“
„Jetzt lass sie mal ausreden, Fati!“
„Tschuldigung.“
„Wir sollten etwas über Corona schreiben: unsere Erfahrungen, unsere Empfindungen.“
„Für die Schule?“
„Wofür sonst.“
„Und die Lehrerin hat’s vorgelesen.“
„Ätzend“, kommentierte Fati. Dann hob sie mahnend den Zeigefinger.
„Ein bisschen hast du aber selber Schuld, Sarah. Sage ich dir nicht immer, du sollst keine Hausaufgaben machen? Dann passiert so was nicht!“
„Vielleicht hast du recht.“
„Todsicher. Ich mache seit zwei Jahren keine und mir geht es gut.“
„Auf dem Gymnasium ist das anders, Fati. Sarah ist nun mal die beste Schülerin, da geht das nicht.“
„Warum nicht? Gerade dann!“
„Was schlägst du vor, Paula?“, versuchte Sarah wieder auf das Thema zu lenken.
„Lies mal das Gedicht, dann wissen wir, worum es geht.“
Sarah las mit schwermütiger Stimme:
So viele
Der tod ist weiß geworden.
Auf weißen laken
liegt die angst, keuchend, ohne atem.
Menschen mit masken,
augen ohne gesicht.
Darin furcht und nicht verstehen.
So viele sind gestorben,
so viele haben angst
so viele verzehrt von ihren sorgen.
Ich glaubte an engel, die schützend die menschen umgeben.
So viele sind gestorben,
so viele ausgezehrt.
Das herz ist angstbeschwert.
Sarah schwieg erwartungsvoll. „Ist das ein Liebesgedicht?“, fragte Fati vorsichtig.
„Nein.“
„Dann verstehe ich es nicht. Aber klingt schön!“
„Danke. Was denkst du, Paula?“
„Toll, so gedankenvoll. Aber schwer, alles beim ersten Mal zu kapieren.“
„Mein Vater hat mir geraten nichts zu tun. Es würde von allein aufhören, wie ein Feuer, das keine Nahrung mehr hat, also das Mobben.“
Sarahs Vater war Redakteur bei einer bekannten Zeitung. Da musste man Respekt haben, fand Paula. Doch ihre Freundin war anderer Meinung: „Solange du in der Schule bist, funktioniert das nicht. Die anderen stellen dich nach vor, so wie die Lehrerin.“ Sarah schwieg.
„Du bist doch eigentlich die Beste“, nahm Paula den Faden auf. „Wie die Dame beim Schachspiel.“
„Und?“
„Vielleicht ist es gar nicht so gemein, es ist – ein Spiel. Die stärkste Figur wird angegriffen.“
„Und?“
„Spiel halt mit, nur besser!“
„Genau. Besiege sie auf ihrem Niveau. Dann müssen sie dich akzeptieren.“
„Oder umbringen“, meinte Sarah düster.
Paula begeisterte sich für ihre Idee. „Analysieren wir die Situation. Wer sind die Angreifer, wo sind die Schwachstellen?“
„Am schwächsten waren die Jungen.“
„Kann ich mir denken“, spottete Fati. Jungen können nicht mobben. Sie haben’s einfach nicht drauf.“
„Also, fang damit an. Setz etwas dagegen, bis sie aufgeben.“
„Jungen sind simpel. Es muss nur lustig sein und sie müssen sich toll fühlen, dann fressen sie dir aus der Hand.“ Fati hatte drei Brüder und galt mithin als Expertin in diesen Fragen.
„Alleine schaff’ ich das nicht“, gestand Sarah. „Ich meine, ich verstehe jetzt, was ihr meint, aber …“
„Mut kannst du von mir haben“, tröstete sie Fati.
„Abgemacht“, beschloss Paula. Warum kommt ihr nicht Samstag zu mir? Wir können einen Schneemann bauen, Kakao trinken. Dann besprechen wir alles. „Einverstanden“, meinte Sarah. „Freitag soll es kälter werden und wieder schneien.“
„Perfekt“, rief Fati. „Bis Samstag.“
„Bis Samstag.“
„Bleibt gesund.“
„Bevor ich an Corona sterbe, sterbe ich an Langeweile.“
Schachmatt
Die Zeit schien gedehnt. Wenn es nur schon Samstag wäre! Der Vormittag plätscherte durch den Schneeregen. Es war so langweilig, dass Paula sogar chinesische Schriftzeichen studierte. Im Grunde fiel es ihr nicht schwer. Sie konnte sich die Formen und feinen Unterschiede gut merken, besser als ihr Bruder jedenfalls, doch eben darum gelang es ihrer Mutter selten, dieses Projekt Muttersprache voranzubringen.
Zum Glück kam Besuch. Klaus, der am Wochenende als Kellner aushalf, hatte Essen bestellt, war zum Tee eingeladen worden und saß nun plaudernd mit den Eltern an einem der Tische des Restaurants, mollig angezogen, denn der Drachengarten war kalt, um Heizung zu sparen.
„Was geht ab?“, fragte Klaus Paulas Bruder, der wie von ungefähr dazugekommen war.
„Was soll abgehen? Nichts. Bei dir?“
„Genauso wenig, fürchte ich.“
„Du bist doch Lehrer. Warum arbeitest du nicht an der Schule?“
Klaus zuckte mit den Achseln.
„Im Moment, keine Lust.“ Er lächelte.
„Wenn du bei uns wärest, könntest du mir gute Noten geben!“
„Das ist natürlich ein Anreiz.“
„Du könntest ja auch mehr lernen“, schlug Christiane vor, was übrigens der Vorname von Frau Mo ist.
„Oder du hilfst in der Küche“, ergänzte sein Vater, trank den kleinen Becher grünen Tees leer und erhob seine wuchtige Gestalt. „Muss noch was vorbereiten.“
„In der Küche hilft der nie“, meinte Paula.
„Ist ja auch nichts zu tun im Moment“, antwortete Jim gleichgültig.
„Wollen wir Schach spielen?“ Er hatte sich damit an Klaus gewandt.
„Seit wann hast du ein Schachspiel?“
„Ich hab’s Paula zum Geburtstag geschenkt.“
„Clever. Warum spielst du nicht mit ihr?“
Deswegen mochte Paula Klaus. Er sagte häufig das Richtige. Außerdem hatte er Sommersprossen. Das fand sie süß.
„Sie kann es noch nicht gut“, lästerte Jim.
„Ich habe es erst gestern gelernt!“
„Kannst du es holen?“
Missmutig stand Paula auf. Es hätte nichts genützt, ihm zu sagen, er solle es selber holen. Sie wollte nicht, dass er in ihrem Zimmer herumwühlte.
„Wieso heißt du eigentlich, Jim?“
„Keine Ahnung. Frag Mama.“
Der Gast sah Christiane fragend an. Und da er praktisch zur Familie gehörte, lächelte die Chefin und erklärte: „Das erste Buch, das ich auf Deutsch gelesen habe, war Jim Knopf.“
„Und Paula, wenn ich schon am Fragen bin.“
„Paula ist wegen Paulus. Mama ist doch Christin.“
„Wusste ich gar nicht.“
„Sie geht ja auch nie zur Kirche.“
„Weil ich keine Zeit habe. Sonntagfrüh muss ich vorbereiten, ja!“
Eine kurze, peinliche Stille breitete sich aus.
„Worüber ich immer staune ist, wie gut du Deutsch sprichst. Hast du es bereits in China gelernt?“, fragte der Gast ausweichend.
Christiane schnalzte ablehnend mit der Zunge.
„Sie ist Lehrerin für Chinesisch“, mischte sich Jim ein, „so haben sich meine Eltern kennengelernt. Sie hat versucht, ihm Chinesisch beizubringen.“
„Muss schwierig sein mit den Schriftzeichen.“
„Ja,voll“, bekannte Jim.
„Sicher, wenn man nicht lernt, sondern nur Handy schaut.“ Frau Mo war ungehalten und die Portionen wurden größer auf dem Löffel. Kim und Kiri fanden, sie hätten genug Reis und Gemüse gegessen, und schlängelten sich vom Kinderstuhl.
Paula trat heran und legte das Schachspiel unsanft auf den Tisch. „Viel Spaß!“ Wortlos begann ihr Bruder aufzubauen.
„Ihr könnt ja auch zu zweit spielen“, schlug Klaus vor.
„Keine Sorge“, sagte Paula lächelnd, „ich schaue lieber zu.“
Sie saßen zu dritt an einem Tisch des Restaurants und bald hatte Klaus Jim zwei Bauern abgenommen; seine schwarzen Figuren standen verstreut und seine Königin hilflos am Rand.
„Du hast dich vielleicht zu weit vorgewagt mit deiner Dame, um meinen König anzugreifen“, kommentierte Klaus.
„Ich weiß“, gestand Jim, „was soll ich machen?“
Paula betrachtete die Stellung gedankenvoll. Es stimmte, Weiß konnte nicht angreifen, ohne die Dame zu verlieren, doch, doch ...
„Jim, hilf mir mal in der Küche!“, dröhnte die Stimme ihres Vaters. Es kam nicht oft vor, dass er um Hilfe bat. Noch seltener war es, dass es seinem Sohn recht war. „Jo!“, rief Jim vergnügt, als ob er nichts lieber täte. „Tut mir leid, du hörst ja, ich muss weg. Ich gebe auf. Du kannst mit meiner Schwester spielen.“ Klaus nickte verständnisvoll.
Paula betrachtete das verlorene Spiel. Vor ihren Augen schienen sich die Figuren auf dem Brett zu bewegen. Die Dame griff den König an. ‚Du bist dumm‘, sagte Paula zu ihr. ‚Du bist nicht geschützt. Der König schlägt dich!‘ Die Dame nickte trotzig. ‚Arme Dame‘, dachte Paula und schloss die Augen, willst du dich wirklich opfern?‘
„Alles klar?“, erkundigte sich Klaus.
„Nein. Es ist alles so furchtbar.“
„Du meinst Corona und so?“
„Ja, das auch.“
„Liebeskummer?“ Klaus grinste. Manchmal war er ein bisschen frech.
„Darf ich weiterspielen?“, fragte Paula schüchtern.
„Klar. Du bist dran.“
(Bild 1 im Anhang)
Langsam streckte sie ihre Hand nach der schwarzen Dame aus, hob sie in die Luft und setzte sie auf dem Feld nieder, das ihr Schicksal besiegeln musste. Sie nahm den Bauern und sagte leise: „Schach.“
Klaus wunderte sich: „Magst du deine Dame nicht?“
„Doch“, flüsterte sie. „Es geht nicht anders.“
„Geht schon anders. Dir ist klar, dass der König sie nehmen kann, ja?“
„Mach schon“, sagte sie und ihre Stimme klang seltsam fremd, wie das Fauchen einer Katze, irgendwie. Ihre Dame verschwand vom Feld. Paula ergriff den Turm, der scheinbar in der Mitte des Spielfelds nutzlos blockiert stand, zog ihn herüber auf die äußerste Linie, auf die der König gezogen war, um die Dame zu nehmen. „Schach“, sagte sie zum zweiten Mal. Es klang drohend in ihren Ohren. Klaus stutzte. Überlegte, sah sie fragend an und schob etwas hilflos seinen Läufer zwischen Turm und König. Ungerührt schlug Paula ihn mit dem Turm. „Schach.“
Der König floh auf das einzige Feld, das ihm blieb. Es war das zweite von rechts auf seiner Grundlinie. Noch immer, so schien es, erkannte Klaus das Verhängnis nicht. Ein drittes Mal zog Paula den Turm, zog ihn direkt vor den König in die äußerste Ecke des Brettes und erklärte mit einem Anflug von Stolz: „Schachmatt.“
Sie richtete sich auf und blickte Klaus herausfordernd an. Das hatte sie noch nie getan. Wie in einem Comic starrte er mit offenem Mund auf die Partie.
„Ein Matt in vier Zügen mit Damenopfer? Wie geht das denn?“
Paula zuckte mit den Schultern. Klaus betrachtete nachdenklich das Spiel.
„Aber eins glaube ich dir nicht: Ich glaube nicht, dass du gestern zum ersten Mal gespielt hast.“
Ausnahmsweise kam Jim im richtigen Moment. „Doch, ich habe es ihr beigebracht. Gestern Nachmittag zwischen 12 Uhr und halb drei. „Gibt’s ein Problem?“
„Nein!“, antworteten beide, wie aus einem Mund. Den Kopf schüttelnd, stand Klaus auf. „Ich geh’ dann mal. Mein Essen ist sicher längst kalt.“
Er nahm die Ente, die schon eine Weile eingepackt auf der Theke lag. Christiane brachte ihm noch eine Tüte mit Krabbenchips. „Danke“, sagte sie lächelnd, sei es für die Bestellung, sei es für das Spielen mit den Kindern.
Er wollte gehen, besann sich noch einmal und kritzelte etwas auf ein herumliegendes Papier, drückte es Paula in die Hand. „Das könnte dich interessieren.“
„Was ist das?“, fragte sie erstaunt.
„Eine Seite, auf der du Schach spielen kannst. Du brauchst stärkere Gegner als mich oder deinen Bruder.“ Wortlos nahm Paula den Zettel.
„Was ist denn mit dem los?“, wunderte sich Jim, als er weg war.
„Ach nichts“, erwiderte Paula und packte die Figuren zusammen.
Sarah kämpft
Unter ihren weißen Fingern glitten die Tasten hurtig auf und nieder und erregten dabei einen Rausch von Tönen, der sich wie Sonne und Regenschauer im Zimmer verbreitete und die Gedanken der jungen Pianistin beruhigte. Sarah hasste ihre Klasse und liebte Chopin.
Sie hämmerte die Schlussakkorde mit Kraft in die Tasten, ließ die letzten Töne verhallen, lauschte dem vibrierenden Klang nach und lehnte sich aufatmend zurück. Was soll's. Vielleicht hatten Paula und Fati recht. Bestimmt sogar. Wenn sie nicht gemobbt werden wollte, musste sie mitspielen. Sie war zu exaltiert, sie wusste es, aber sie genoss es auch.
Sie erhob sich vom Klavierhocker und stellte sich vor den großen Spiegel mit dem geschnitzten Holzrahmen. Das war sie, 13 Jahre jung, schüchtern im Grunde, lebend in ihrer eigenen Welt oder der ihrer Eltern, in einem großen Haus, in ihrem großen Zimmer mit ihrem eher kleinen Hund.
„Henry, Platz!“ Henry hob neugierig den Kopf, hielt es aber nicht für nötig, derart sinnlose Befehle zu befolgen. Er lag ohnehin schon auf dem Boden. Er hatte den Kopf gehoben, um zu sehen, ob es für irgendetwas eine Belohnung gab. Es sah nicht danach aus, so ließ er denn den Kopf wieder sinken.
„Henry!“ Der schärfere Ton ließ ihn aufhorchen, und als Sarah in die Tasche zu greifen schien, eilte er auf seine Ernährerin zu, seine lebhaften Augen auf ihre Hand gerichtet.
Sarah knuddelte ihn, denn sonst war niemand da, um Zärtlichkeiten zu verschenken. Dazu gab es ein Leckerli, und so war die Welt zumindest zwischen Frau und Hund in bester Ordnung. Davon abgesehen: Sie konnte sich nicht immer verstecken. „Sollen wir kämpfen, Henry, was meinst du?“ „Wau, wau“, kam die Antwort, was eindeutig als Zustimmung aufzufassen war. „Also gut. Aber wie?“
Schweren Herzens klickte sie den Klassenchat an. Da war es wieder:
„Der weiße Tod ohne Schnee! - hoffentlich schmilzt er nicht.“
Was sollte sie dazu schreiben? „Der nächste Sommer kommt bestimmt.“
Etwas Besseres fiel ihr nicht ein. Sie drückte auf send.
Und hier: „Hilfe, ich habe gesichtslose Augen gesehen. Sarah, rette mich!“
„Sie umschwirren mich! Sie greifen mich an!“
„Ich habe leider keine Zeit, aber ich kann euch meinen Pudel schicken.“
Send. Soviel zu den Jungen. Jetzt die Mädchen.
„Wer liegt auf weißen Laken und stirbt vor sich hin?“
„Sarah, mit ihrem Gedicht ohne Sinn.“
„Wer sagt, dass Gedichte einen Sinn haben müssen?“ Sie drückte abermals auf send und staunte über ihren Mut. Fehlte noch Eveline.
„So viele halten sich für was Besonderes, so viele sitzen auf ihrem eingebildeten Thron, so viele, die sterben als eine dumme Kuh – die dümmste davon bist du.“
„Danke, Eveline. Sobald die Schule wieder anfängt, schreibst du mir das in mein Poesiealbum, ja?“ Das würde sie zum Kochen bringen. Mit dem letzten Rest von Mut sandte sie auch diesen Kommentar in die grausame Onlinewelt. Dann sackte sie auf ihrem Bett zusammen. Henry hatte sich in die hinterste Ecke des weichen Sofas verkrochen und äugte ängstlich zu ihr hinüber. Er war ein sensibles Tier.
Hoffentlich hatte Paula recht, dachte sie. Chatgroups sind gnadenlos. Wie sollte sie das allein durchstehen? Sie wechselte zu WeChat und postete: „Ich hab’s getan.“ Dann presste sie sich das Kissen vors Gesicht, als wolle sie sich ersticken. Henry stupste sie mitfühlend oder hungrig mit seiner weichen Hundeschnauze an. Eine Hand hob sich mühsam von der Decke und kraulte ihn hinter den Ohren.
Ein neuer Stern
In seinem geräumigen Zimmer mit dem auffallend großen Bett und dem noch auffallenderen riesigen Flachbildschirm überlegte Jim, ob es in seiner Klasse jemanden gäbe, der besser aussähe als er. Er kam zu dem Schluss, dass dies nicht der Fall sei, weitete die Frage auf die gesamte Schule aus und konnte nicht anders, als sie wiederum verneinen. Er war nicht eigentlich eitel, er langweilte sich nur, und tatsächlich konnte ein unvoreingenommener Beobachter nicht umhin, ihn hübsch zu nennen.
Seine Augen waren blaugrau, wie die seines Vaters, frecher zwar, aber gutmütig. Jim war freundlich zu allen, außer zu seiner Schwester, nein, auch zu dieser meistens. Er ärgerte sie nur eben gern. Er kämmte just seine kupferfarbenen Haare, die weder vom Vater noch von seiner Mutter ererbt zu sein schienen, weshalb sie das eigentliche, unverwechselbare an ihm waren. Weich umrahmten sie sein ovales Gesicht mit einem harmonisch eingebetteten, keinesfalls hervorstehenden Kinn.
Die dichten, kupferfarbenen Augenbrauen wiederholten den feinen Schwung seiner Lippen, sie wirkten sinnlich mysteriös, und Jim war sich seiner Ausstrahlung durchaus bewusst. Zum Leidwesen seiner Schwester, die ihn viel sympathischer gefunden hätte, wenn er weniger eingebildet gewesen wäre. Dabei war auch Paula eine anziehende junge Dame, schüchterner nur, aber natürlicher und umso liebenswerter. Ihre großen, dunklen Augen, die an den äußeren Rändern zur Mandelform neigten, blickten offen und freundlich in die Welt. Ihre kurzen, schwarzen Haare sahen jungenhaft aus, was ihrem Wesen nicht unbedingt entsprach. Bislang jedenfalls nicht.
So betrat sie ihres Bruders Zimmer, was selten geschah. Jim las und blickte nicht einmal auf. Er war im Bilde. Seine Eltern klopften und alles, was über einen Meter groß war, konnte nur Paula sein.
„Wie gefällt dir das Buch?“, eröffnete seine Schwester das Gespräch.
„Ich habe schon langweiligere gelesen.“ Das war ein Kompliment und Paula freute sich. Sie hatte es ihm zum Geburtstag geschenkt. Eigenartigerweise hatten sie am gleichen Tag Geburtstag. Normalerweise dauerte es Wochen, bis Jim sich herabließ, ihr Geschenk auszupacken, wie letztes Jahr, als sie ihm Schlittschuhe geschenkt hatte, die er erst Ostern entdeckte. In diesem Winter waren sie ihm leider zu klein geworden; aber Paula hoffte, dass sie sie nächstes Jahr tragen könnte. So blieb alles in der Familie.
„Was gibt’s?“, ließ sich Jim endlich herab zu fragen.
„Ich brauche einen Namen!“, platzte Paula heraus.
„Hast du deinen verloren.“
„Natürlich nicht.“
Jetzt endlich ließ Jim das Buch sinken und sah seine Schwester an.
„Ich habe dir immer gesagt: Paula, pass auf deinen Namen auf.“
„Ich brauche einen“, sie überlegte kurz, „ein Pseudonym!“
„Wofür? Willst du schreiben.“
„Nein, Schach spielen.“
„Online?“
„Ja“
Jim seufzte theatralisch und bemerkte weise: „Es gibt so viele Namen.
Was ist dir bisher eingefallen?“ Er sagte das, um sie zu quälen, und sie wusste das.
„Nichts Gutes.“
„Zum Beispiel?“
„Claudia17 vielleicht oder“, sie zögerte, „Lulu möglicherweise.“
„Na, da hast du doch zwei Ideen und kannst frei wählen.“
„Ja, meinst du, das geht?“
„Ja, klar. Sie sind beide genau gleich schlecht.“
„Was denn dann?“, fragte sie enttäuscht. Er überlegte. Er war ja nicht wirklich böse, nur ein bisschen gemein. Natürlich würde er ihr helfen. Paula sah die aufgeschlagene Seite des Buches. Ein seltsames Tier, das seinen langen Hals aus einem See hob und mit drohendem Blick die karge Hügelszenerie um es herum betrachtete. Das musste wohl Schottland sein.
„Was ist das?“, fragte sie neugierig.
„Nessie, das Ungeheuer von Loch Ness.
„Klingt nett.“
„Wie wäre es dann mit Schachnessie?“
„Klingt doof.“
„Und“ –ihr Bruder machte eine bedeutungsvolle Pause – „Chessynessie?“
„Was soll das sein?“
„Ihr lernt wohl gar kein Englisch bei euch auf der Schule.“
„Die anderen schon.“
„Nun, es heißt Schach. Chess gleich Schach. Chessynessie.
Jim strich sich zufrieden sein kupferfarbenes Haar aus der Stirn. Sie musste den Namen wohl nehmen.
„Ich probiere es mal.“
Er nahm das Buch wieder in die Hand. „Sonst noch was?“
„Nein.“
„Viel Spaß beim Verlieren.“
Die Audienz war beendet und Paula verließ erleichtert das Domizil ihres Bruders. „Chessynessie“, murmelte sie vor sich hin. „Jedenfalls besser als Lulu.“
Glück im Schnee
Endlich war es Samstag. Tagelang hatte es geregnet, geschneit, getaut, geregnet, wieder geschneit. Nun hatte sich das Wetter entschieden, zur glänzenden Frostseite hin. Weiß glitzerten die Wiesen, weiß schmückten sich die Bäume, silbern spiegelten die Pfützen und kleinen Teiche das neckende Sonnenlicht, das die frische Welt schier küssen wollte.
„Sarah!“, rief Paula von der Treppe zum Restaurant herab. Sie hatte ihre Freundin erwartet und eilte ihr entgegen, wobei sie ausgiebig von ihrem Pudel begrüßt wurde. „Henry! Du bist auch da, wie schön.“ Das fand Henry auch und rollte sich und tollte wie verrückt im Schnee. Ruhig und würdevoll hingegen stieg Sarah aus der eleganten Limousine, in der sie ihr Vater gebracht hatte. Ein rascher Kuss auf die gefurchte Wange des Fahrers, und der schwere Wagen rollte langsam rückwärts, knirschend über den Kies und den Schnee. Wohlig reckte sich die Angekommene in der Winterluft:
„Brillante Idee von dir uns einzuladen. Wo ist Fati?“
„Keine Ahnung. Kommt sicher wieder zu spät. Komm rein, wir müssen noch warten.“
In der Tür erschien ein wasserdicht verpacktes, kleines Raumfahrtmädchen, das immerhin bereits einen hellblauen Gummistiefel trug.
„Wir kommen gleich“, krähte Kiri und stolperte zurück ins Haus.
„Mama, sagt, wir sollen sie mitnehmen“, erklärte Paula wenig begeistert.
„Ist doch klar, die sind süß, deine Schwestern.“
„Du hast sie nicht jeden Tag.“
Sarah formte einen Schneeball und warf ihn für Henry in die Luft. Geschickt schnappte er ihn im Flug und staunte, als seine Zähne widerstandslos aufeinander schlugen. Dann stolperten ihnen auch die fertig ausstaffierten Zwillinge entgegen mit einem blau-roten Bobschlitten. „Bleibt nicht zu lange“, mahnte Frau Mo, um etwas zum Abschied zu sagen.
Haus und Restaurant grenzen an eine Wiese, die leicht ansteigt zu einem Hügelchen, auf dem zwei kräftige Bäume stehen mit glattem, silbernen Stamm, die an diesem Tag über und über mit Schnee behangen waren. Dazwischen wollten sie den Schneemann bauen. Der Schnee war goldrichtig, er ließ sich formen und gestalten und war dabei so trocken und kühl, dass man kaum nass werden konnte. Vor ihnen lag das weiße Feld, noch unberührt und unbetreten, und alle vier stapften glücklich gen Hügel. Sarah und Paula schwiegen eine Weile, und als Kim und Kiri mit Henry vorausliefen, begann Paula: „Was meintest du eigentlich mit: Ich hab’s getan?“
„Ich habe gekämpft. Ich habe zurückgeschrieben.“
„Gut. Wie war die Reaktion?“
„Nicht schlecht. Einer hat geschrieben: ‚Achtung, Sarah versucht witzig zu sein!‘ Und ein anderer: ‚Apfelstrudel wäre mir lieber.“
„Verstehe ich nicht.“
„Apfelstrudel reimt sich auf Pudel. Deshalb“
Sarah lächelte und sah ihre Freundin an: „Danke Paula, war ein guter Tipp.“
Sie waren oben angelangt und genossen, leicht außer Atem, den glänzenden Ausblick über den Schnee und das anheimelnde Haus dahinter, das ihr Zuhause war.
„Fotoshooting!“, kommandierte Paula. Sie wollte unbedingt die Kamera ihres neuen Smartphones ausprobieren. Einmal die Landschaft, klick; dann Kim und Kiri im Schnee, klick, Zwillinge unter Schnee, klick, Henry im Sprung, als Gif und schließlich, versonnen, verträumt, Sarah, angelehnt an einen Baum.
„Jetzt aber los, sonst schmilzt der Schnee, bevor wir angefangen haben!“
Die Zwillinge drehten kleine Kugeln, Sarah und Paula je eine größere und selbst Henry versuchte, den Schneeball mit der Schnauze zum Rollen zu bringen, den Sarah ihm überlassen hatte. Schnell wuchsen die Kugeln der Mädchen. Paula, die praktisch dachte, hatte ihren Ball zunächst hinunter und bei noch mittlerer Größe mühsam bergauf gewälzt. Sarah, als sie merkte, dass das Rollen schwierig wurde, wählte spät den mühelosen Weg bergab, weshalb sie nun unten an ihrer großen Kugel stand und nachdachte. Zu spät, fand Paula.
Gemeinsam gaben sie dem oberen Ball einige letzte Umdrehungen, wodurch er auf eine stattliche Größe wuchs. Ein würdiger Anfang. Den unteren aber konnten sie auch mithilfe von Kim und Kiri, noch nicht einmal mit Henry zusammen das Hügelchen hinaufrollen. Er blieb auf halbem Wege liegen. Lachend setzten sie sich oben auf das mächtige Unterteil der unvollendeten Schneeskulptur.
„Warten wir halt“, erklärte Paula launig.
„Worauf? Dass die Kugel von alleine nach oben fliegt?“
„Sie wird schon kommen.“
„Wer? Fati? Zeit wird’s.“ Paula grinste. Sie spekulierte auf jemand anderen.
Doch nicht etwa auf ihren Bruder?
Doch, ja, Jim hatte längst aus dem Fenster gesehen und abgewartet, wann sein Auftritt am vielversprechendsten wäre. Nun war es Zeit.
Viel zu leicht bekleidet, mit dünner Jacke, lässiger Baseballkappe, Ohren frei, und ohne Handschuhe, näherte er sich nun dem Desaster aus Schnee, um den schier verzweifelten Winterprinzessinnen ritterlich seine Hilfe anzubieten. So sein Plan. Zumindest wollte er Hilfe in Aussicht stellen. So schritt er Zoll um Zoll ein Helfer, ein Held, aufrecht auf die Mädchen zu, die seiner harrten.
Als er vor ihnen stand, leicht zitternd vor Kälte, begann er: „Naa?“
„Na, was?“, fragte seine Schwester. Jim schaute sich betont gleichgültig um und bemühte sich, nicht zu zittern.
„Die Kugel dort“, er wies auf das Mittelteil, das weiter unten im Schnee lag, „die soll wohl dort rauf, oder?“ Dabei deutete er auf die Schneetonne, auf der Sarah und Paula gleichmütig hockten.
„Muss nicht“, sagte Paula grausam. „Es ist ganz gemütlich so.“ Stand der Satz so im Drehbuch? Jim war unschlüssig. Er konnte ja schlecht bitten, die zweite Kugel nach oben tragen zu dürfen. Zum Glück zupfte ihn Kim an der Jacke und hielt ihm die Leine des Bobschlittens hin.
Also zog Jim. Erst im Trab, dann im Galopp, immer schneller und wilder, verfolgt vom Pudel mit Jauchzen und Gebell. „So wird ihm wenigstens warm“, kommentierte Sarah vergnügt.
„Sollen wir versuchen, ihn selbst zu tragen?“ Sie eilten zur Schneekugel, beugten sich nieder, packten und hoben mit aller Kraft, stolperten einen Schritt, einen zweiten und waren im Grunde entschlossen, beim dritten mit Gelächter in den Schnee zu stürzen und den Schneeklumpen dabei zu vernichten, da trat Jim im letzten Moment überraschend hinzu, stützte die fast entgleitende Kugel von unten, keuchte: „Lasst mich das mal machen“, und schleppte, allein, er ganz allein, die ungeheure Last von gerolltem Schnee den Hügel hinan. Dort ließ er die Kugel sanft auf der unteren nieder und klopfte fachmännisch die letzten Unebenheiten ab und ebnete sie.
Sarah klatschte Beifall, was Paula übertrieben fand, zumal sie ahnte, was als Nächstes käme. „Wie wäre es, wenn ihr euch um den Kopf kümmert?“, kommandierte Jim. Sie folgten brav seiner Anweisung, formten zusammen die dritte, viel kleinere Kugel, hoben sie fröhlich in die Höhe, und setzten sie mit ausgestreckten Armen obenauf, traten einen Schritt zurück und betrachteten sehr zufrieden das prächtige Monument. Jim griff in die Tasche, holte zwei große, alte Knöpfe hervor, die er dem Eismann als Augen ins Gesicht setzte.
Es passte alles. Henry, der am Bach unter den Bäumen, hin und her gelaufen war, suchend und schnüffelnd, trottete mit einem Tannenzapfen zwischen den Zähnen herbei, wofür er das Attribut ‚intelligentester Hund der Welt‘ bekam. Es lässt sich nicht leugnen: Die Zapfennase hatte Charakter, und als Jim aus der anderen Jackentasche eine alte Pfeife zog, die ein Gast vor Monaten im Restaurant vergessen hatte, da waren die vier Mädchen entzückt und staunten über den paffenden Mann aus Schnee, der nun ganz und gar lebendig und puffig aussah. Das Werk war beendet.
„Gehen wir“, sagte Paula, denn sie merkte, dass nicht nur Jim, sondern auch die Zwillinge ein wenig zitterten. „Ich habe Lust auf heißen Kakao.“ Jim nickte dankbar und Sarah hatte nichts dagegen.
„Wie wäre es mit einem Foto, zum Abschied?“, schlug ihr Bruder vor. Gern. Die jungen Damen und die kleinen Mädchen umarmten den einsamen Alten, und dass er dabei nicht schmolz, ist sehr erstaunlich.
TikTok
Vor dem Eingang auf dem Parkplatz, mitten im Licht, der sich allmählich vergoldenden Sonne, stand, gekleidet in schneeweißer, enganliegender Jeans und einer moosgrünen Jacke, eine junge Frau, deren Haare im Nachmittagslicht wie Flammen leuchteten und zu züngeln schienen.
„Fati“, schrie Paula und winkte ausgelassen.
„Der Hammer“, sagte Jim unwillkürlich, was Paula nicht beachtete, aber Sarah mit scheuem Seitenblick registrierte. Jim hatte Fati noch nie gesehen. Sie war immer sehr eingespannt in ihre große Familie, musste oft, wenn ihre Mutter keine Zeit hatte, auf ihren jüngeren Bruder aufpassen oder Essen kochen, oder den älteren hinterher räumen oder Botengänge für ihren Vater besorgen und anderes mehr. Dennoch war sie meist unbeschwert und antwortete jetzt lachend:
„In dieser Hose kann ich mich kaum bewegen. Damit kann ich nur Kuchen essen.“
„Da bist du gerade richtig, komm!“ Kim und Kiri sahen die rothaarige Schöne mit den unzähligen Sommersprossen staunend an, rannten dann aber lieber eilig ins Haus. Paula umarmte Fati und ging mit ihr die Treppenstufen rauf, die zum Eingang führen.
Jim sah ihnen nach, bis sie verschwunden waren. „Wieso hinkt sie denn?“, fragte er verwundert Sarah, die bei ihm geblieben war.
„Sie hat vor zwei Jahren einen Unfall gehabt. Irgendwas ist schiefgegangen bei der OP. Seitdem zieht sie das Bein nach.
„Schade“, meinte Jim, „ich meine, blöd für sie. Kann man da nichts machen? „Nochmal operieren, oder so?“
„Keine Ahnung. Frag sie doch!“, antwortete Sarah schnippisch. „Das heißt, tu‘s lieber nicht. Ich weiß nicht, wie sie darauf reagiert.“
Jim lächelte Sarah zu. „Gehen wir, sonst essen sie alles ohne uns auf.“
Der Vorraum glänzte feucht von Wasser und Schneeresten. Sie zogen ihre Schuhe aus, schlüpften in gemütliche Hauspantoffeln, die für die Gäste bereitstanden, und betraten das heute beheizte Restaurant. An der Decke streckten rote Drachen die Zunge heraus; eine Katze aus Porzellan winkte ihnen zu. An den Wänden hingen geschnitzte Täfelchen mit chinesischen Spruchweisheiten; warmes Licht flutete sanft von oben. Nur die Musik fehlte, die sonst in fremdartiger Weise die Gäste besänftigend oder beunruhigend beschallte.
„Die Süßigkeiten dauern noch etwas. Wenn ihr Kakao oder Tee mit Yuebin möchtet, müsst ihr warten“, verkündete ihnen Frau Mo. „Papa hatte einen Anruf, darum – Geduld.“
„Was ist Yuebin?“, fragte Sarah neugierig.
„Yuebin ist lecker“, erklärte Jim, was nicht viel sagte.
„Das sind Mondkuchen“, fügte Paula hinzu. „Normalerweise isst man das im Herbst, mit Bohnen und Ananasfüllung.“
„Wir warten“, sagte Fati entschieden.
„Und was machen wir so lange?“
„Paula, habt ihr noch die Bühne und die Mikrofonanlage?“, erkundigte sich ihre Freundin interessiert.
„Ja, natürlich.“
„Und das alte Klavier daneben.“
„Ist jetzt noch verstimmter, weil wir nicht mehr heizen. Was willst du damit?“
„Wir nehmen einen Song auf für TikTok.“
„Welchen?“
„I love you so“ von Gregory Chagal.
„Chagall“, bemerkte Jim, um auch etwas zu sagen, „ist das nicht ein Maler?“
„Was weiß ich denn?“ Das Lied ist cool.“
Sarah erläuterte: „Chagall ist Impressionist. Der Blaue Reiter beispielsweise ist von ihm.“
„Perfekt. Das nehmen wir als Hintergrund. Paula, lädst du das Bild runter und machst die Aufnahme? Du hast das neueste Smartphone.“ Paula nickte. „Sarah spielt Klavier und ich singe am Mikrofon. Wir bekommen tausende von ‚Likes‘, ich weiß es!“
„Wieso wir? Du bist die einzige bei TikTok.“
„Egal.“
„Und wo sind die Noten?“, fragte Sarah gelangweilt.
„Was für Noten?“
„Glaubst du, ich kann das Stück ohne Noten spielen?“
„Die Noten sind hier.“ Jim hatte den Song bereits eingegeben und präsentierte eine Klavierfassung auf seinem 12-Zoll-Tablet.
„Also abgemacht“, beschloss Fati, „gehen wir.“
„Gehen wir!“, riefen auch Kiri und Kim, die sich instinktiv derjenigen anschlossen, die die meiste Begeisterung zeigte, was Paulas rothaarige Freundin war.
Allerdings, das Klavier war wirklich verstimmt und so war Sarah. Zunächst weigerte sie sich zu spielen, aber auf Jims Vorschlag einigten sie sich darauf, dass nur ihre Hände gezeigt würden, nicht ihr Gesicht, damit sie nicht mit dem ‚unbrauchbaren‘ Instrument in Verbindung gebracht würde.
Das Stück war nicht schwer. Jim hielt das Tablett für sie und scrollte aufmerksam das Stück hinunter. Dabei berührte er leicht die Schulter der Pianistin. Paula sah es und ärgerte sich. Doch Sarahs Miene hellte sich auf. Nachdem sie das Stück zweimal gespielt hatte, beschied sie der Sängerin, die mit geröteten Wangen am Mikrofon auf ihren Einsatz wartete: „Du kannst lostirillieren, ich bin bereit.“
Sie schlug wuchtig die ersten Akkorde an, leitete elegant über in den ruhigen Melodieteil, nickte Fati zu, die anhob und mit sanftestem Schmelz die erste Strophe sang:
What is a day without you?
What is a thought without you.
I did not live, before I knew you.
I happened to exist, but nothing felt true.
O-oho- why does the sun shine, if you don’t smile?
O-oho- why is the moon bright, if I can’t hold you tight?
I just love you so, love you so.
Irgendwie schaffte es Sarah, Jim anzublicken, während sie die letzte Zeile spielte, und Jim – Paula konnte es nicht fassen – kniff seine Augen halb zusammen und sang träumerisch mit.
Bei der zweiten Strophe begannen die Zwillinge auf der Bühne vor Fati herumzuspringen. Beim Refrain schlugen sie Purzelbäume, bis sich Kim dabei weh tat und zu weinen anfing. Es passte gut zum Text, wie alle hinterher künstlerisch grausam fanden. Der letzte Akkord verklang, die Sängerin hielt genießerisch den letzten Ton und ließ ihn abrupt mit einer heftigen Verbeugung enden. Das Stück war im Kasten. Gerade rechtzeitig, denn die Mondkuchen waren auf dem Tisch. Lärmend verließen alle den Bühnensaal, der vom übrigen Restaurant durch eine Schiebewand abgetrennt war, und eilten dem wärmeren Teil zu, hockten sich strahlend vor Tassen mit dampfendem Kakao und jeweils einem großen, runden Mürbeteiggebäck auf ihrem Teller. Paulas Vater war froh, Gäste bewirten zu können. Er war Koch mit Leidenschaft.
„Die Füllung besteht aus Sesam, Bohnen und Ananas. Guten Appetit.“ Er liebte Kochen und Backen und er liebte es, wenn es seinen Gästen schmeckte, ganz gleich, wie alt oder wie betucht sie waren.
„Herr Mo, das ist unverschämt lecker“, begeisterte sich die rothaarige junge Dame.
„Es gibt noch welche in der Küche.“
„So mein ich das nicht.“
„Mein Vater lässt herzlich grüßen, er hofft, dass es bald wieder möglich sein wird zum Essen zu kommen.“
„Das hoffen wir auch“, nickte Frau Mo.
„Meine Mutter lässt auch grüßen. Sie vermisst ihren Ramen“ (chinesische Nudelsuppe).
„Danke“, sagte Frau Mo lächelnd. „Den gibt es heute Abend wieder.“
„Vielleicht könnten Sie ihn als Takeaway anbieten“, schlug Sarah vor.
Sie gab das letzte Stück Mondkuchen Henry, der schon eine Weile bettelnd und Pfote schwingend zu ihrem Teller hinaufgeschaut hatte.
„Wann kegeln wir mal wieder, Paula?“
„Sobald du eine andere Hose anhast.“
Fati lachte. „Stimmt“, hier drin wird es schwierig. „Aber“, sie zwinkerte fröhlich, „habe ich extra für das Lied angezogen.“
Als Herr Mo mit einem großen Teller Mondkuchen aus der Küche kam, bemerkte Paula, wie ihre Mutter ihm einen unruhigen Blick zuwarf. Sie wandte sich überraschend an die Besucherinnen und sagte: „Möchtet ihr noch einen mitnehmen für zuhause? Es ist fast dunkel. Besser, ihr macht euch auf den Weg.“
„Mama!“, rief Paula verärgert. Wir sind dreizehn!“ Nun, das stimmte und keiner wusste etwas darauf zu sagen. Ein Nachrichtenton von Sarahs Smartphone überbrückte den peinlichen Moment. „Mein Vater hat mir geschrieben“, erklärte sie. „Er kommt mich gleich abholen.“
„Und ich habe kein Licht am Fahrrad“, versicherte Fati. „Besser, ich verdufte, bevor es stockdunkel ist.“ Frau Mo nickte erleichtert.
Paula wunderte sich, warum ihre Eltern so ängstlich waren. Es war sonst nicht ihre Art. Wie auch immer, bis alle fertig waren, sich artig bedankt hatten für den Extrakuchen, Jacken und Schuhe angezogen und sich von den Zwillingen verabschiedet hatten, war die Dämmerung längst überschritten. Draußen lag die Winternacht, kalt und klar. Stern auf Stern blinkte hervor.
Henry schnupperte in die Luft, bellte herausfordernd. „Was ist los?“ Henry wirkte elektrisiert. Er witterte mit vorgestrecktem Hals, schnüffelte unbestimmt in Richtung auf den Hügel hin. Er knurrte wütend, bellte laut und schoss, ehe es Sarah gelang, ihn festzuhalten, über die Wiese davon, ein schwarzer Schatten auf silbernem Schnee.
Schnee knirschte auch unter den Rädern eines Wagens, der auf den Parkplatz einbog. Die Scheibe fuhr herunter: „Kommst du, Sarah?“
„Gleich, Papa! Henry ist entwischt!“
„Warte hier“, sagte Paula entschlossen, „ich hole ihn.“
Sie rannte dem Hund ihrer Freundin nach. Der Schnee war leicht angefroren, und während Henry leichtfüßig darüber sauste, brach sie bei jedem Schritt durch die schwache Kruste des Schneefeldes. Endlich erreichte sie keuchend den Hügel, auf dem der Pudel aufgeregt hin und herlief, die Nase dicht am Boden. Als er an ihr vorüber schnupperte, erwischte sie ihn am Halsband. „Komm, Henry!“ Doch so leicht gab er nicht auf. Wütend kläffte er zum Schneemann hinauf. Paula folgte seinem Blick und erschrak.
Der Kopf war heruntergestürzt und lag in Stücken. Die Pfeife war nirgends zu sehen. Aus dem Rumpf ragte ein Stock, an dem ein viereckiges Stück Karton aufgespießt war. Ängstlich und neugierig zugleich reckte sich Paula, zog das Schild heraus und las im Dunkeln mit Mühe die Worte: Zweite Warnung. ‚Wieso zweite?‘, dachte sie spontan. Dann kehrte sie um, so schnell es ging, den unwilligen Pudel am Halsband ziehend.
„Alles klar?“, fragte Fati besorgt, als beide wieder am Parkplatz anlangten.
„Nein“, antwortet Paula hastig. „Jemand hat unseren Schneemann geköpft und das hier reingesteckt.“ Sie hielt ihren Freundinnen das Schild vor die Augen. „Mobbing“, sagte Sarah kopfschüttelnd. „Jetzt hat es dich auch erwischt, Paula.“
Sarahs Vater war ausgestiegen und betrachtete nachdenklich den Karton. „Wahrscheinlich ein dummer Streich. Es lohnt sich bestimmt nicht, sich Sorgen zu machen. Komm, Sarah, wir müssen nach Hause.“ Henry beschnüffelte noch einmal das fremde Schild, bellte zum Abschied und sprang als Letzter in das Auto. Es hupte und verschwand.
„Krass“, sagte Fati.
„Soll mein Vater dich heimbringen?“, fragte Paula besorgt.
„Ach was, ich fahre am Fluss lang, mit dem Fahrrad bin ich eh schneller.
„Oder meine Mutter?“
„Keine Sorge, ich schreib’ dir, wenn ich zuhause bin. Denk daran, unser Video bei TikTok anzusehen!“
Da ihre Freundin immer noch nicht beruhigt schien, holte sie eine kleine Sprühdose aus der Tasche und verkündete stolz: „Hat mir mein Bruder geschenkt.“
„Ist das ein Deo?“, wunderte sich Paula.
„Hast du sie noch alle? Das ist ein Kampfspray!“ Paula war sprachlos.
Kopfschüttelnd schwang sich Fati mühevoll in ihren engen Jeans auf ihr altes Fahrrad und klapperte entschlossen lichtlos davon. Das Letzte, was Paula von ihr hörte, war die Klingel, die fröhlich schepperte. Dann ging sie zurück ins Haus, das seltsame Schild in der Hand.
Väterchen erzählt
Der Koch, von dem hier bereits mehrfach die Rede war, heißt Peter. Peter Stein ursprünglich. Heute allerdings Mo; denn als er in China heiratete, nahm er den Namen seiner Frau an. Erstens, weil er so kurz war, zweitens, weil er ihn mochte und drittens, weil sowieso alles furchtbar bürokratisch war und es auf diese Weise ein wenig leichter ging.
Wie war er eigentlich nach China gekommen? Mit dem Flugzeug, das schien klar; nur der Grund, der Plan und dann sein Leben im Reich der Mitte, blieben unklar, auch seinen Kindern. Normalerweise redet Peter nämlich nicht viel, vor allem nicht über sich selber. Wenn überhaupt, dann am liebsten über Essen.
An diesem Abend jedoch, als Paula wieder an den Tisch des geheizten Restaurants trat, der auch als Esstisch für die Familie dient, und es eine leckere, fette chinesische Nudelsuppe mit Huhn und gekochten Schweinefüßen gab, die Ramen heißt, zeigte sich Väterchen Koch gesprächig.
„Wieso ist diese Suppe so lecker?“, fragte Jim zunächst.
„Altes Rezept“, schlürfte sein Vater, „aus dem Restaurant, wo ich in China gearbeitet habe.“
„Wie bist du überhaupt hingekommen?“, erkundigte sich Paula, die seltene Gelegenheit nutzend.
„Mit dem Zug.“
„Was?“, rief Jim, „das dauert ja Wochen!“
„Stimmt. Mit dem Flugzeug ging es mir zu schnell und da die Transsibirische Eisenbahn von Berlin über Moskau bis nach Peking zuckelt, bin ich eingestiegen.“
„Einfach so?“
„Einfach so.“
Nun, nicht ganz. Tatsächlich hatte Peter diesen Trip lange geplant. Sogar ein Visum hatte er sich besorgt, ein Z-Visum genauer gesagt, das man zum Arbeiten in China braucht. Aber das soll er selbst erzählen:
„Ich hatte meine Lehre als Koch beendet, zwei Jahren Gesellenzeit hinter mir und wollte raus. Einfach weg“, begann er.
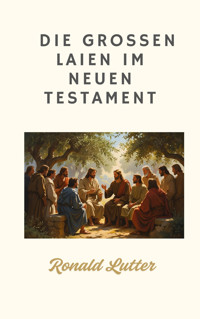

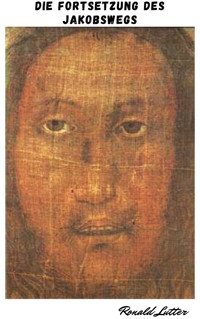
















![Tintenherz [Tintenwelt-Reihe, Band 1 (Ungekürzt)] - Cornelia Funke - Hörbuch](https://legimifiles.blob.core.windows.net/images/2830629ec0fd3fd8c1f122134ba4a884/w200_u90.jpg)









