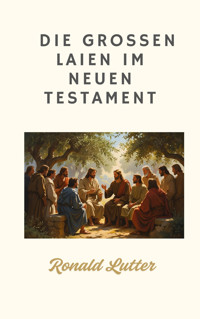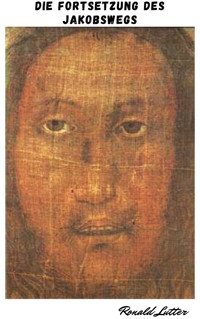5,49 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: via tolino media
- Kategorie: Abenteuer, Thriller, Horror
- Sprache: Deutsch
Ein Käsehändler, der im Gefängnis saß? Und der Rucksack ist weg. Der junge Mann auf der Suche nach Christus und christlicher Gemeinschaft kämpft auch im 2. Teil ums Überleben. Unter sechs Pinien findet er ein Obdach und durchstreift fortan unter Obdachlosen das ewige Rom, das sich von unten besehen keineswegs von seiner schlechtesten Seite zeigt.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Veröffentlichungsjahr: 2020
Ähnliche
Inhaltsverzeichnis
Teil 1: Unter Obdachlosen
Teil 2: Giordana
Teil 3: Die 6 Pinien
Teil 4: Der charismatische Kongress
Teil 5: Marla
Teil 6: Arm und frei
Teil 7: Mission in Wien
Teil 8: Abenteuer in Brixen
Teil 8: Die kleine Meisterin
Kapitelüberschriften
Impressum
Teil 1: Unter Obdachlosen
1. Wie ich meinen Rucksack verlor und fror
Es war Frühling, als ich zurück kam nach Rom, über Umwege natürlich, aber zurück kam ich. Nun bräuchte ich kein Zimmer mehr, Geld hatte ich sowieso kaum mehr. Ich würde draußen übernachten bis - ja, bis man mich endlich aufnähme als Gast bei der Schule von Emmanuel. Ein Baumhaus schwebte mir vor; aber das konnte schwierig sein, denn es sollte nicht allzu weit vom Zentrum liegen.
Zunächst aber tat ich das, wovor man mich einmal gewarnt hatte: Ich übernachtete im Park der Villa Borghese. Dort gibt es einen kleinen Reitstall, zumindest eine Koppel und Heuballen und Stroh und ein Dach darüber. Die erste Nacht war gut. In der zweiten Nacht bekam ich Besuch, ein Obdachloser, ein frisch aus einem Wohnheim mit begitterten Fenstern entlassener, leistete mir Gesellschaft. Er hatte einen weißgrauen Bart, unternehmungslustige, blaublitzende Augen, fast Zutrauend erweckend, zumindest jovial. Ich schlief in den oberen Ballenetagen, er weiter unten. Man plaudert. Er hatte vom Handel gelebt, stellt sich heraus. »Mit welchem Land?« - »Holland«. Ein Käsehändler wahrscheinlich. Nicht sehr wahrscheinlich. Mein Schlafsack war warm. Ich schlief unruhiger als in der letzten Nacht; die Gesellschaft war mir nicht geheuer.
Ich wachte früh auf, wollte so bald wie möglich gehen, bevor die ersten Reiter kamen oder sonst wer. Der Käsehändler schlief noch in 1 Meter Höhe auf zwei breiten Strohballen. Außen, gut sichtbar für jeden, doch das störte ihn nicht. Der Morgen war kühl, er sah aus, als ob er fror und ich breitet meine Aluisomatte über ihn aus, damit er es unter seiner Decke wärmer hätte. Daneben legte ich einen Zettel. Er könne sie später zusammenrollen und hier oder da im Stroh verstecken. Dann versteckte ich meinen Rucksack rechts unter Gerümpel und altem Wellblech neben der Scheune, geschützt obendrein durch eine parallel laufende dichte Hecke, den habgierigen Augen etwaiger Diebe entzogen.
So brauchte ich den Rucksack nicht den ganzen Tag mit herum zu schleppen. Nur einen kleinen nahm ich mit und hatte darin eine Jacke, Wertsachen, das Neue Testament, einen Pullover, Besteck und zufälligen Kleinkram. Als ich abends wieder kam, war der Rucksack weg. Von der Isomatte keine Spur.
Der Käsehändler! - war mein erster Verdacht. Was wollte er mit meinem Rucksack? Den Schlafsack? Es war ein Daunenschlafsack, so einer, da konnte es auch Null Grad werden und du schliefst noch halbwegs gemütlich darin.
Weg ist weg. Es war eine sternklare Nacht. Ich kroch nach oben und rupfte und rupfte Stroh aus den Ballen. Es war kalt und würde noch kälter werden. Stroh wärmt wenig. Die Kälte kriecht zwischen den Halmen, rollt durch ihr Inneres und erreicht dich. Ich rupfte noch mehr Stroh. Mit einem halben Meter über mir ging es halbwegs. Dann kam er. Ich kroch heraus aus dem Stroh, erzählte ihm von meinem Missgeschick, beobachtete ihn dabei aufmerksam wie Kommissar Maigret. Würde er sich verraten? Keine Ahnung. Wenn er es war, ich konnte es nicht erkennen. »Ich habe die Isomatte hier hin gelegt«, beteuerte er und zeigte vorne auf das Stroh. Es tat ihm leid.
Was soll's. Ich kroch zurück ins Stroh. Irgendwann in der Nacht, verließ er sein Lager vorne im Erdgeschoss und kraxelte an mir vorbei bis über mein Lager hinaus ins Dachgeschoss. Er lag jetzt ziemlich dicht bei mir, eine Strohballendicke höher und furzte. Ich fror und dachte: »Wieso eigentlich liege ich in Rom neben einem furzenden Drogenhändler und bibbere vor Kälte mit Stroh im Kopf, Stroh in den Haaren, Stroh in den Ohren und Stroh im Mund?«
2. Armenspeisung bei Sant' Egidio
Mein Mitbewohner der Scheune hatte mir von einer Armenspeisung bei Sant' Egidio erzählt, die dienstags und freitags über 1000 Arme und Obdachlose beköstigte.
»Via Dandolo.« - Das liegt in Trastevere.
»E ti danno cose veramente buone!« (und da gibt es wirklich gute Sachen)
Auch wenn ich so etwas vor mir selber nicht gern zugebe: der Verlust des Rucksacks, der warmen Sachen, des gemütlichen Schlafsacks hatte mich schockiert. Ich hatte kein Zimmer mehr bei Signora Franca, es war Ende März, ich hatte im Freien leben wollen. Vielleicht käme ich so weiter. Gesellschaft und Essen konnte ich brauchen. Ich brach mit meinem kleinen Rucksack auf, sobald es hell war. Wenigstens musste ich mir jetzt keine Gedanken mehr über das Verstecken von Sachen machen. Bloß weg von der Villa Borghese, dem Stroh und allem.
Es war Dienstag. Beköstigungstag. Warum nicht? Obdachlos war ich, und so fand ich mich schon gegen 11 Uhr an besagter Anlaufstelle ein. Männer und Frauen warteten. Männer mit gegerbten Gesichtern, Frauen, die traurige aber lebhafte Augen hatten, eine Mischung aus Trotz und Demut vielleicht, ganz verschieden. Jedenfalls habe ich noch nie so viele interessante Gesichter gesehen. Da lohnte es sich fast, den Rucksack verloren zu haben.
Wenn ich einen Film drehen wollte, Charles Dickens vielleicht und ich bräuchte eine Menge authentische Gesichter - Menschen, die arm waren, die gelitten haben, die Hunger gehabt haben, die gefroren haben, dann würde ich genau da hin gehen und sie als Darsteller nehmen. So sahen sie aus. Nicht alle natürlich, einige hatten sicherlich ein halbwegs normales Leben, waren vielleicht nur sparsam waren und kamen darum hier zum Essen. Die wirklichen Penner, die mit Plastiktüten durch die Straßen ziehen, die sind selten und sie kommen zu solchen Veranstaltungen eh nicht. Viele hier waren aus dem Osten, aus Südeuropa, Kroatien, Albanien. Aber aus Vergnügen waren sie nicht hier. Man soll es sich nicht zu einfach vorstellen.
Erst einmal wartest du. Männer und Frauen, meistens schweigend. Es fiel schon auf, wenn ich mit dem einen oder anderen ein paar belanglose Worte wechselte. Ein gewisses Misstrauen, vielleicht auch Schamgefühl. Im Grunde ist es doch peinlich: Du bist Bedürftiger. Wer ist das schon gern. Es gibt wenig Kommunikation hier draußen vor dem Tor. Du wartest auch nicht direkt vor dem Tor. Wer dagegen verstößt wird immer wieder vertrieben, wegen der Nachbarn. Du wartest die Straße aufwärts oder abwärts, mindestens 20 Meter vom Eingang entfernt. Es hat einen praktischen Grund, aber es erniedrigt ein wenig mehr. ›Du warte dahinten, bis es soweit ist!‹
Ein Mann tritt aus dem Tor hervor, bärtig, ernst und verteilt Nummern. Jetzt dürfen sich alle nähern. Es bildet sich eine Traube um ihn. Der Leitwolf mahnt ruhig zur Disziplin, unterbricht auch schon mal das Verteilen wie ein Lehrer mit ungeduldigen Kindern. Dann schließt sich das Tor wieder und das Warten beginnt erneut. Endlich, nachdem erst die Frauen und die wahren, die Elitepenner, die, die wirklich versifft sind, bedient worden sind, drängen wir durch einen Hof in die Vorräume, sitzen und - warten wieder. Die Stimmung ist jetzt schon lockerer. Man ist drinnen, man ist unter sich. Wer das erste Mal kommt, muss registriert werden. Ohne Papiere geht nichts. Ich habe zuerst nicht verstanden, um was es ging, wer wo warum wartete und ging einfach der kürzesten Schlange nach.
An der Tür zum Esssaal stand ein freundlicher Kontrolleur. Es ging um Registrierkarte und Stempel. Hatte ich nicht. Palaver. Er bat um Verständnis: »Das muss leider so sein, wegen der Zuschüsse, die wir vom Staat bekommen.« Aber dann ließ mich er durch. War ja das erste Mal. Man setzt sich an die gedeckten Tische. Es gibt Wasser und Wein. Es kommt eine freundliche Frau, fragt, ob man Suppe möchte, dies und das. Ja, sehr gern.
Ich saß am Tisch mit einem jungen Obdachlosen, 20 etwa, den ich schon früher gesehen hatte in den engen Straßen von Trastevere. Seine Haare waren tiefschwarz, er war schmutzig, düster und unglaublich verschlossen und hatte dabei trotzdem etwas Anziehendes, eine Art unauslöschbaren, zwar drohenden, doch faszinierenden Charme. Das spürten auch die lächelnden Helferinnen um ihn herum. Aber er ließ sich kein Wort aus den Mundwinkeln locken. Er war keineswegs stumm oder taub. Wahrscheinlich hasste er es nur bemuttert zu werden. Während des Essens riskierte ich eine Bemerkung. Er antwortete sogar, aber karg.
Ich plauderte mit einer noch jugendlichen Nachwuchshelferin, die den Eindruck erweckte, als sei sie das erste Mal da. Das verband uns irgendwie. Als ich ihr jedoch erzählte, dass man mir meine Sachen geklaut hatte, wand sie sich bald ab. Mit zu viel Pech wollte sie lieber nicht so viel zu tun haben. Und da hatte sie Recht. Das war besser, zumindest klüger.
Das Essen war gut und es tat mir gut. Es tut gut bemuttert zu werden, wenn man von der Niedertracht der Welt gebeutelt wird oder von seiner Dummheit. Es war sehr fürsorglich. Man sollte gerade an Tischen sitzen und bedient werden, um auf diese Weise nicht nur zu essen zu bekommen, sondern auch ein wenig Würde und Selbstvertrauen zurück zu erlangen. Und doch - ich war froh als ich wieder draußen war und vor allem froh ohne Karteikarte und Stempel davon gekommen zu sein. Denn drauf stand zwischen den Zeilen: ›Hier bist du, du Obdachloser, der du zur Kaste der Gescheiterten gehörst. Verzweifle nicht, wir kümmern uns um dich, wir reichen dir die Hand, wir lassen dich in deiner Hilflosigkeit nicht allein!‹
Wenn du da hinein gerätst, das war mir klar, dann kommst du so schnell nicht wieder raus. Trotz oder vielleicht auch gerade wegen all der helfenden Hände.
3. San Onofrio
Es war Dienstag und am Abend ging ich zum Gebetsabend bei Chemin Neuf. Fabio tat es sehr leid, was mir geschehen war; doch als ich ihn fragte, ob er mich hospitieren könnte für ein paar Tage, lehnte er bedauernd ab. Ich weiß nicht mehr warum. Lucio, ein Freund von ihm, anfang 20 deutlich jünger als Fabio und ich, bot sich an. Ich kannte ihn aus meiner ersten Zeit aus Rom. Er kam manchmal mit Fabio zu den Gebetsabenden wohl aus Geselligkeit oder weil er nichts zu tun hatte. Der Glaube interessierte ihn nicht wirklich.
Ich hatte so meine Zweifel innerlich, ob das gut gehen könnte, aber ich war nicht in der Lage ›nein‹ zu sagen. Sein Zimmer in einer WG war einfach, zwei Betten, Gemeinschaftsküche, man kocht Pasta, man plaudert, man lacht. Auch am zweiten war es o.k., doch am dritten gab es Streit. Wir waren in Trastevere am Brunnen vor Santa Maria di Trastevere. Er trank und redete mit jungen Frauen, von denen ich leider nicht mehr sagen kann, als dass sie albern war. Mir war kalt. Es wurde 12, es wurde eins. Ich wollte nach Hause, das heißt zu ihm, nur alleine konnte ich nicht, wenn ich auch nicht mehr weiß, wieso eigentlich nicht. Ich war abhängig von Lucio und er ließ mich das spüren. Als er auch den Bus um drei Uhr morgens passieren ließ, hatte ich genug, verließ ihn und die leeren Bierdosen auf dem Pflaster des schönen Platzes und striff allein durch Rom.
Um vier Uhr fiel mir eine Kirche ein in der Nähe des Bocca della Verita, wo in einer Seitenkapelle ewige Anbetung geschieht. An 24 Stunden am Tag, in 365 Tagen im Jahr ist dort das Allerheiligste ausgesetzt, Christus im Sakrament der Eucharistie. Auch dort war es kalt, aber weniger einsam. Man kämpft mit der Müdigkeit. Schlafen ist nicht erlaubt. Ein älterer Mann nickt kurz ein, schnarcht sogar; aber er wird angestoßen und geweckt.
Am Morgen, ein schöner Morgen. Vögel singen, als ich vor die Kirche trete, müde; Rom erwacht im Morgengrauen. Nur kalt ist es. Kalt. Wo geht die Sonne zuerst auf? Was liegt nahe? Der Gianicolo. Endlich ein Hauch von Wärme. Jeder goldene Finger wie ein Kuss auf dem Gesicht. Etwas später komme ich an der franziskanischen Kapelle San Onofrio vorbei. Die kennen vielleicht nicht viele.
Wenn man vom Piazza della Rovere in der Nähe des Petersplatzesbeim Tiber30 Meter Richtung Tunnel geht, führt linker Hand eine steile Gasse den Salita di San Onofrio hinauf direkt auf die Kirche zu. Oft ist das große Eisengittertor davor verschlossen; aber heute hatte ich Glück. Dort im angrenzenden kleinen Konvent gibt es einen kleinen Kreuzgang, der zugänglich ist. Er steht nur in den ausführlichen Touristenführern und nur Wenige nehmen sich dafür Zeit. Darum ist es hier friedlich. An den Wänden sind Fresken, teils abgeblättert, größtenteils aber noch gut erkennbar mit lateinischen Unterschriften, die die denkwürdigen Geschichten des Lebens des Heiligen Onofrio erläutern, wie z.B. das Brotvermehrungswunder. Das war so:
Er wurde als Waisenkind in ein Kloster gebracht und einmal beobachteten die Mönche, wie der kleine Onofrio dem Jesuskind auf dem Schoß Mariens etwas von seinem Brot anbietet und - und das ist das Wunder - Jesus es auch nimmt. Die Mönche sind erstaunt und noch mehr als Onofrio während einer Hungerzeit, als er seinerseits das Jesuskind bittet, einen großen Brotlaib erhält. Den teilt er großzügig mit den Mönchen. Als junger Mann verlässt er das Kloster, um als Einsiedler zu leben. Die Fresken erzählen weiter wie er Brot und Wein, als Leib und Blut Christi täglich von einem Engel überreicht bekommt. Ich liebe diese Geschichte, den Kreuzgang und die Kirche. Und mag man das auch für eine Legende halten, ich habe es im Kleinen auch so erlebt. Gern nimmt Jesus, was du ihm herzlich gibst und gern gibt er, was du zum Leben brauchst.
Die Kirche nebenan wirkt zunächst düster. Die Kirchenbänke sind altersdunkel. Es hat viel Schmuck in dem Kirchlein, Bilder, Leuchter und dabei wirkt sie doch schlicht und bescheiden. Geheimnisumwittert, noch nicht überbelichtet, lichthungrig wie viele neuere Kirchen und kirchliche Richtungen. Sehr schön kann man dort beten im dämmerlichtigem Raum, rechts in einer Seitennische und sich von innen erleuchten lassen.
An diesem Morgen ist obendrein Messe in der Kirche. Es sind nur wenige Leute da. Der Priester ist anscheinend Amerikaner. Die Messe feiert er jedenfalls in Englisch. Kurz vor der Lesung nickt er mir zu, sieht mich fragend an. Was soll ich? Lesen? Ja, tatsächlich. Er hat sich wohl gedacht, dass ich Englisch kann kann, vielleicht wegen den leicht rötlichen, irisch wirkenden Haaren auf meinem Kopf. Es sind aber sonst auch fast nur ältere Leute in der Kapelle. Ich lese also zum ersten Mal in meinem Leben aus der Bibel, während der Messe. Schüchtern gehe ich nach vorne zum Ambo. Es ist aus dem Buch Jeremiah. Der Prophet spricht von dem Neuen Bund:
»I will write my law into your soul«, stand da. Mein Herz brannte wie Feuer.
Immer wieder gibt es Menschen, die meinen, dass man sich Religion selbst erlebt, wohlmöglich ausdenkt. Aber die wissen nicht, wie Gott den Menschen berührt, wenn er es am wenigsten erwartet und an alles andere denkt, als an Ihn. Ich hatte vermeintlich wirklich andere Probleme an diesem Tag, und doch brannte mein Inneres vor Liebe und Sehnsucht. Man kann solche Gefühle nicht beschreiben und darum verzichte ich darauf.
4. Das Kloster am Rosengarten
Es gibt in Rom noch andere Stellen, an denen Obdachlose verpflegt werden. Es gibt sogar eine Unmenge davon. Bei San Egidio hatte ich eine Broschüre bekommen, bunt und auf Hochglanzpapier, in der alle Adressen und Anlaufstellen verzeichnet sind. Irgendjemand hatte sich da mal Mühe gegeben das Obdachlos- und Arm-sein glänzend zu organisieren.
Die Stelle, zu der ich ging, hatte ich allerdings schon früher entdeckt. Sie liegt neben dem Rosengarten, der, wenn man vom Tiber kommt, rechts am Hügel hoch beim Circus Maximus liegt. Es ist schön dort, besonders im Mai und Juni, wenn sich zum Blick auf den Palatin und die Zirkusbahn der Duft der Rosen freundlich gesellt und die Sinne so gemeinsam schwelgen. Daneben liegt ein Kloster und am Montag und am Donnerstag reichen die Schwestern dort Suppe oder Pasta, belegte Brötchen und manchmal ein Stück Kuchen dazu. Es sind hier nicht so viele wie in der Via Dandolo. Ca. 50 drängelten sich vor dem Tor. Aber was heißt drängeln? Beim SSV ist es allemal schlimmer oder bei der Eröffnung eines Buffets. Carmela hatte mich einmal mitgenommen zu einem Abend beim Goethe-Institut, wo sie Deutsch lernte. Das war ganz ähnlich gewesen.
Wie es nun hier zu ging hatte ich einmal beobachtet, als ich noch satt und warm bei Signora Franca wohnte und das hatte mir gar nicht gefallen. Die Nonnen des Klosters öffnen die kleine Tür im Tor nämlich nur so lange, wie sie gerade Essen austeilten. Dann schließen sie sie rasch wieder, als ob sie Angst hätten, sie könnten durch den Kontakt kontaminiert werden. Aber wie ungerecht war dieses Urteil von mir gewesen! Mir gefielen damals auch nicht die aufgeschnittenen halbierten Milchkartons, in denen sie die Suppe reichten. Aber jetzt hatte ich Hunger und ging rechts vom Circus Maximus die Straße Clicio dei Puplici hinauf bis ich links nach dem Zaun des Rosengartens an die Pforte kam.
Ich fühlte mich fremd, ich fühlte mich unsicher. Was tun? Kommunikation ist gut in solchen Situationen. Man redet miteinander, vertreibt sich das Warten und spürt dabei das Hilflose und auch Demütige der Lage weniger.
Mit einem Russlanddeutschen aus Kasachstan kam ich ins Gespräch. Andrej. Dann ging das Gedränge los. Ich hatte nicht vor mich da hinein zu mischen und zu schieben. Ich konnte warten. Auch hier waren die meisten Brotsuchenden keine extremen Obdachlosen. Nur einer, ein älterer Mann mit schmutzigem, weißlichem Bart, schmutzstarrenden Kleidern, Plastiktüten, aber noch - und vielleicht mehr als wir anderen - hellen, klaren Augen, wurde nach vorne durchgelassen. Die Schwestern machen durchaus einen Unterschied. Er ging mit seinem Brötchen und einem besonderen Lunchpaket auch gleich wieder davon. Ein Snob. Als nächstes kamen die Frauen und dann die Meute der Männer, die am Tor angekommen die Hand ausstreckten, um etwas zu empfangen. Dann zogen sie sich zurück. War das nicht viel demütigender, als bei San Egidio, wo man an Tischen saß und bedient wurde? Als ich vorne war und die Hand ausstreckte, gab es nichts mehr. »Mi dispiace«, sagte die Nonne (es tut mir leid).
Die Tür schloss sich und die Raubtierfütterung war vorbei. Pech gehabt. Andreij, der Russlanddeutsche, war aber viel zu nett, als dass er mich hungern ließ. Auch sprach er Deutsch: »Nimm, nimm!« sagte er und drängte mir das eine von seinen zwei Brötchen auf. Ich hatte wirklich Hunger und nahm es. Brötchen mit Mortadellawurst.
Zu den Nonnen am Rosengarten bin später noch ein paar Mal hin gegangen, habe mich dann auch mehr engagiert und Brötchen bekommen, Suppe bekommen und einmal Kuchen. In die Via Dandolo zur Massenspeisung bin ich nur noch einmal hin gegangen und auch ohne Essen wieder weggegangen, weil ich beim Warten mit den Russen dort Schach gespielt habe, bis ich schließlich die Partie verloren und das Essen verpasst hatte. Mir war das aber dort auch nicht geheuer mit den Stempeln und Papieren und dass die, die am wenigsten Chancen hatten Geld zu verdienen, nämlich die ohne Aufenthaltsgenehmigung, nichts zu essen bekamen.
Andreij hätte ich dort nicht kennen gelernt, denn er hatte keine. Er war eher klein, ca. 170 groß und hatte in seinem Wesen etwas sehr Weiches und zugleich Lebhaftes, trug einen breiten Schnurbart und war wirklich der liebste Kerl, den man sich denken kann. Bevor ich aber mehr von ihm erzähle, muss ich noch etwas über den Kuchen sagen. Das mit dem Kuchen tat mir nämlich leid. Nicht jeden Tag gab es Kuchen am Rosengarten, das war eine Ausnahme und sehr freundlich von den Nonnen. Manchen schmeckte der Kuchen nämlich nicht und sie warfen ihn dann teilweise weg oder ließen ihn liegen. Anstatt ihn wenigstens den anderen anzubieten! Auch Suppe und Pasta wurde oft nur halb gegessen und einfach stehen gelassen, obwohl ein großer Müllcontainer dicht am Kloster stand.
Die Nonnen mussten es dann wohl wegräumen. Ist das nicht gemein? Darum lächelten sie vielleicht auch weniger als die Helferinnen bei San Egidio. Ihre Demut aber, so kommt es mir vor, war größer. Sie ertrugen es auf diese Art beschimpft zu werden, ja ließen den Hungrigen die Freiheit es zu tun, und teilten doch am nächsten Donnerstag oder Montag wieder treu und wie selbstverständlich aus.
Hier war ich frei. Die Zeit schien manchmal still zu stehen. Du hast keine Bedürfnisse mehr, kein Ziel, das du verfolgen könntest und das in Wahrheit dich verfolgt. Da ist nur der Himmel über Rom, fast unerträglich blau, die strahlende Sonne darin und der unfassbare Glanz, in den sie das Leben taucht: Die rote Mauer des Palatin auf der anderen Seite der Rennbahn, die Autos, die Passanten, alles bewegt sich wie in einem Bild, schwimmende Punkte auf dem Meer eines hektischen Seins. Du hast keinen Hunger, dir fehlt nichts und um dich herum ist nur ein sanfter Wind und der Duft aufblühender Rosen.
5. Unterwegs mit Andreij
Nun ist das leider nicht die Regel. Das ist Romantik, glückliche Momente, ein Anflug von Ewigkeit, ein Lächeln des Glücks, das nicht bleibt. Andreij bat mich ihn zu begleiten, ich möge mit ihm zu den Jesuiten gehen, die hätten eine Beratungsstelle. Ich verstand nicht gleich, was er da wollte, Aufenthaltsgenehmigung, Papiere, Asylantrag, Lebensberechtigungsschein, irgendwas davon.
Wir gehen in die Via di Astalli, in der Nähe vom Piazza Venezia, ein Stück hinter dem Piazza San Marco, rechts in eine dunkle Straße hinein. An den entsprechenden Tagen steht ein Haufen Leute davor. Andreij hält hier nicht viel vom Anstellen: »Nein, nein, komm! Wir können hier gehen!« und so gingen wir an der Schlange vorbei. Er kannte den Weg. Es ging in ein Kellergewölbe durch einen langen, schmalen, gewölbten Gang mit mehreren Zimmern rechts und links. Nicht gerade Wohlstand. Düster und heruntergekommen, aber die, die dort arbeiteten waren top. Stefano hieß der Jesuit, der uns schließlich - ein bisschen mussten wir dort unten doch warten - empfing.
Ich erinnere keine Einzelheiten von dem Gespräch. Es war konfus, wie eine Suche nach einem Ausweg in einem Irrgarten, aus dem es keinen Ausweg gibt. Stefano wollte helfen, aber machte mir, der ich mehr italienisch konnte als Andreij, klar, das es keine wirkliche Hilfe gibt. Sicher mit Anwalt, etc., manchmal kann man etwas erwirken aber nur durch Anträge. Andreij wollte Asylantrag stellen, das war klar, aber er konnte dadurch nicht mehr als Zeit gewinnen, das war ebenfalls klar. Oder er hatte schon einen gestellt und - ich weiß es einfach nicht mehr.
Es war konfus und im Grunde zum Verzweifeln - nur Andreij blieb immer unverdrossen guter Laune und unternehmungsbereit. Durch Fragen entlockte ich Stefano schließlich noch eine Broschüre, in der wenigstens genau drin stand, welche Rechte wer hat, welche Anträge wer wo stellen kann, etc. Sie war sogar auf Deutsch. All diese Dinge haben die Behörden und Beratungsstellen, aber von alleine rücken sie sie nicht unbedingt raus. Selbst Stefano nicht, der einen netten Eindruck machte. Vielleicht hatte er auch nicht unrecht damit. Praktisch gesehen zumindest. Denn so oder so, es nützt nichts.
Wir zogen weiter. Andreij hatte schon den nächsten Plan. Er wollte zur Katholischen Kirche der Deutschen. Auch das gibt es in Rom. Eine Frau hatte ihm dort Sachen versprochen. Die Sekretärin, die uns öffnete, fragte er höflich, wo denn Frau Penner sei und ob er sie sprechen könne. »Frau Penner?« rief er dann laut die Treppe hinauf. Ich versuchte Andreij klar zu machen, dass es vielleicht keine so gute Idee sei, die Frau, von der er etwas wollte, mit Frau Penner anzureden, wenn es auch nahe lag, weil sie ja für Penner zuständig war, bis ich endlich kapierte, dass Frau Penner Frau Penner war. Sie hieß wirklich so. Es stand an ihrem Schild. Zuerst wollte sie aber nichts von uns wissen. »Nein, nein, nein!« rief sie die Treppe hinunter.
»Liebe, gute Frau wir wollen nur einen Pullover und vielleicht ein paar Brote«, bat Andreij. Er konnte nicht anders als liebenswürdig sein. »Also gut, wartet einen Augenblick.« ließ sie sich erweichen. Frau Penner hatte ein gutes Herz. Eine andere Frau machte uns Brote, richtig schöne, große mit Wurst. Frau Penner kam mit zwei Hemden und zwei Pullovern. Andreij war hoch beglückt. Wir verabschiedeten uns. »Danke, danke«, sagte er und noch einmal »danke!« Dann gingen wir. Er war viel zu großzügig, als dass er etwas für sich behalten konnte. »Nimm, dieser hier ist für dich! Oder dieser? Sieh nur wie gut der Pullover ist. Sehr warm ist er auch. Nimm!« Ich zögerte. Schließlich hatte er sich das alles redlich erworben. Ich war nur hinter her getappert. Aber es machte ihm Freude etwas abzugeben und es war nicht so, dass ich keinen Pullover gebrauchen konnte. Ich nahm das schwarze Sweatshirt mit Kragen und kurzen Reisverschluss oben. »Es steht dir sehr gut. Du siehst gut aus!« sagte er liebenswürdig. »Ich freue mich für dich.«
Ich wollte die Brote gleich essen, aber Andreij sagte: »Nein, später. Ich kenne einen schönen Platz. Es ist gar nicht weit. Komm, komm!« Und wir hasteten weiter. Der Platz war am Tiber bei der Brücke Cavour. Wieso er gerade dahin gegangen war? Wir waren eine halbe Stunde dafür gelaufen, aber die Aussicht ist phänomenal. Wir saßen unten auf einer der Bänke, blickten über das Wasser, belächelt vom Licht, dass der Fluss von der nachmittäglichen Sonne auf uns warf. Es war schön. Butterbrot mit Wurst. Blick auf den Petersdom von fern. Endlich waren wir einen Augenblick zur Ruhe gekommen. Dann fragte er mich dies und das über mein Leben.
»Du hast eine Wohnung?«
Ich nickte.
»Eine eigene Wohnung??«
»Nun, ja, eine Einzimmerwohnung zur Miete.«
»Das ist gut«, rief er begeistert, »ich freue mich für dich. Du hast Papiere, du kannst arbeiten, bald ist es Sommer. Du kannst schön leben. Du bist ein glücklicher Mann!«
Da musste ich lachen, aber nicht über ihn, gewiss nicht, ich lachte von Herzen, weil ich glücklich war. Da stimmte er mit ein und fabrizierte den Reim:
Ich habe Jacke, Schuhe, Hut -
mir geht es gut.
Wie kann ein Mensch mit so wenig zufrieden sein? Er war aus Kasachstan, wo es im Sommer 40 Grad über und im Winter 30 Grad unter Null wird. Vielleicht ist man da abgehärtet. »Ich hatte 5000 Dollar gespart«, erzählte er stolz. »Ich war aus Kasachstan nach Deutschland gekommen mit 5000 Dollar in der Tasche!«
Aber gleich im Bus wurden sie ihm geklaut, mitsamt seinen Papieren. Dann ist er nach Italien gegangen, hatte gearbeitet bei einem Pfarrer für wenig Geld und bei anderen mitleidigen Seelen bis er 2500 DM zusammen gespart hatte. Er wurde nach Deutschland abgeschoben. (Ich musste mir das zusammenreimen so gut es ging. Seine Erklärungen waren ein wenig konfus.) »Ich habe einen Fehler gemacht, als ich getauscht habe. Dollar dürfen sie dir nicht abnehmen«, erzählte er traurig.
Die Deutschen wollten ihn nicht. Das Geld hatten sie ihm abgenommen angeblich für den Lufthansaflug zurück nach Italien. Deutschland hat ihm kein Glück gebracht. Nun war er wieder in Italien und hat 8 Monate mit einem Freund aus der Ukraine am Tiber gelebt. In einer zusammengezimmerten Bretterbude zwischen Uferböschung und Eisenbahnlinie unter den kleinen Bäumen und Hecken da.
Sein Freund war Karatemeister, versicherte er. Es klang so, als hätte er sich immer um ihn gekümmert. Er wollte mit ihm nach Frankreich gehen, aber Andrej entschied anders. Er ging nach Österreich, nach Wien, nachdem er 1000 Euro gespart hatte. Er landet im Gefängnis. Er beginnt einen Hungerstreik.
»Warum?«
»Das war illegal!« Diesmal hat er sich erregt.
»In Deutschland habe ich drei Monate im Gefängnis gesessen. Ein Freund von mir hat 30 Tage nicht gegessen.«
»Und dann?«
»Dann haben sie ihn freigelassen.«
Wenn man sich mit Andreij oder anderen Obdachlosen unterhält, zweifelt man am deutschen Rechtsstaat. Papierlose haben keine Lobby, keine Rechte gar nichts. Auch die 1000 Euro für Wien hat er aus dem Gefängnis nicht mitgenommen. Dass solche Leute geschlagen werden, schlecht behandelt, misshandelt, ist keine Seltenheit. Menschliche Grundrechte werden Menschen beim Staat offenbar ähnlich verweigert wie das Essen bei San Egidio. Ohne Ausweis bist du nichts. Vogelfrei. Man kann mit dir machen, was man will und belangt wird keiner. Von wem auch?
Nach unserm Picknick ging es weiter. Er hatte einen neuen Plan: »Ich habe einen Bauwagen gefunden, sehr, sehr gut. Wir können dort übernachten. Es gibt zwei Plätze. Wir brauchen zwei Decken und Matratzen.« Es dämmerte, es wurde kühl. Der Tag war klar und wolkenlos gewesen. Ich beschloss bei ihm zu bleiben. Wir eilten wieder zu Fuß quer durch Rom bis zum Hauptbahnhof, an dessen Rückseite, wenn man die Straße weit nach unten geht, dorthin, wo es düster und schmuddelig ist, eine Anlaufstelle der Caritas ist. Wir sind 5 Minut en zu spät. »Mi dispiace le coperte sono state prese.« (es tut mir leid, die Decken sind alle schon weg) Das wunderte mich nicht. Es würde eine kalte Nacht werden. Mit einem dünnen Blouson sitze ich auf der Mauer dort am Hauptbahnhof. Einige Matratzen liegen in einer Ecke. »Nimm dir eine, das ist gut«, rät mein erfahrener Freund. Ich überlege. Die oberste ist nicht allzu dick und transportabel, aber ne. Wer weiß, wer da schon alles drauf geschlafen hat. Versifftes Ding. Ich wollte nicht.
Wir hasten durch die Stadt. Andreij immer agil, immer hyperaktiv, scheinbar mit einem Ziel. Welches? - Er will zur Heilsarmee, erfahre ich schließlich, aber er findet den Pallazzo (mehrstöckiges Haus) nicht. Wir irren durch Nebenstraßen, unterwegs sprechen wir immer wieder Passanten an. »Frag sie, ob sie uns alte Decke gibt«, ermuntert mich Andreij. Aber keiner gibt uns eine. Ich würde mittlerweile lieber das Geld für uns beide ausgeben und für eine Nacht in ein Hostel gehen, zu den Freedom-Travellern in der Nähe vom Hauptbahnhof zum Beispiel.
Im Grunde konnte ich mir das nicht leisten, aber noch kam Geld aus dem Automaten, wenn ich die Karte hinein steckte. Aber, das war mir klar, darum ging es nicht. Andreij wollte gerne, dass einer mit zu ihm käme. Sonst war er immer es, der Schutz suchte und fand bei seinem Karategroßmeister aus der Ukraine. Er wollte wohl auch mal der sein, der alles organisierte und fand und jemand anderem, also mir, ein sicheres Nachtlager bereitete. Also unterdrückte ich meine Unlust, fragte, wen er mich hieß und spürte sehr bald eine aufsteigende Wut. Ich hasse diese Fragerei. Wieso gibt keiner eine Decke ab? Sie merkten doch selber wie kalt es war. Was sollte diese Umherirren ohne Ziel und wirr und warum musste es Ende März in Rom so verflucht kalt sein?! Ich fror schon jetzt, obwohl wir zügig durch die Straßen liefen. Ich hatte die Orientierung verloren. Auch das ärgerte mich.
Dann standen wir tatsächlich vor dem Hotel der Heilsarmee: 4 Sterne Obdachlosenwohnungsschuppen. Breite Treppe als Aufgang (der Teppich war wohl in der Reinigung), riesige Empfangshalle mit Portier. Hier allerdings ein Stern Abzug: Er war mürrisch. Es gäbe kein Bett, nicht für uns. (Nicht für so hergelaufene Niederpenner.) Die Zimmerverteilung liefe über die Kommune. Ja, mit Voranmeldung. Selbstverständlich. 3 Monate betrüge die Wartefrist im Augenblick. Außer für Schwangere. Er sah uns prüfend an. Auch dieses Kriterium erfüllten wir nicht.
Ob er uns Decken geben könne, nur für eine Nacht. Wir würden sie zurück bringen? Nein. Er habe keine. Und das seidene Bettzeug wäre für uns ... So viel zur Heilsarmee an diesem Abend. Wir waren offensichtlich noch zu weit unten auf dem Läuterungsberg. So laufen auch bei Dante die Seelen um den Berg herum bis durch Gebete der Lebenden ihr e Zeit verkürzt wird und sie Einlass finden. Nur sind diese entschieden demütiger als ich. Als wir draußen waren und noch eine Frau erfolglos gefragt hatten, trat ich wütend gegen ein Verbotsschild (ich glaube es war Parken) und gegen ein Mülltonne. Ich hatte sehr viel Verständnis für Penner, die randalieren. Nichts ist frustrierender als dieses ständige Zurückgewiesen werden, wenn man etwas ganz Simples wie eine Decke so notwendig braucht. Ich dachte daran einfach Gabi zu fragen; aber auch das ging nicht. Dann wäre ich ja wieder der gewesen, der die Dinge für Andreij organisiert hätte. Er blieb sanft und friedfertig. Wo steckte er das alles hin? Er kam mir fast wie ein Heiliger vor. Ein etwas hyperagiler Heiliger, aber in seiner Duldsamkeit erstaunlich.
Wie als ob Gott mich belehren wollte, fand Andreij kurz darauf das, was er am meisten suchte: Eine Matratze. Sie lag zusammengerollt zwischen Müllcontainern, war dünn und leicht und sah ganz und gar proper aus. Die hätte ich auch genommen; aber Andreij hatte sie gefunden und es war mir klar, dass ich für den Augenblick jedes Anrecht auf derlei lächelnde Gnadengaben verwirkt hatte. Das wäre dann ja so, als hätte ich es dem Himmel abgetrotzt und das ist klar: Das geht nicht. Aber ich freute mich für Andreij.
»Danke Gott«, sagte Andreij. »Die hat mir Gott geschenkt!«
Und daran hatte ich nicht den geringsten Zweifel.
»Gott hat uns diese Matratze gegeben, er wird uns auch Decken geben.«
›Mmh‹, dachte ich. Es war schon spät. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir noch von offizieller caritativer Seite etwas bekämen war auf Null gesunken und auch die Passanten auf der Straße lassen sich nach Einbruch der Dunkelheit verständlicherweise noch weniger gern ansprechen als ohnehin. Es war gegen 22 Uhr, als Andreij entschied, das zu tun, was er lange hatte vermeiden wollen. Nämlich seinen Freund zu fragen. Wir nahmen die Straßenbahn. Sie war völlig überhitzt. Herrlich so in der Wärme zu sitzen. Ich taute auf. Nur die Richtung war falsch. Die richtige Tram war wieder kalt wie alles andere auch. Wenigstens kamen wir jetzt wieder in eine Gegend, die ich kannte.
Die Tram rattere zum Piazza Ostiense, an der Pyramide vorbei, die Via Marmorata entlang bis zum Piazza di Emporio. Wir stiegen aus gingen über die Brücke Ponte Sublicio, steigen auf der anderen Seite zum Tiber hinab und ein Treppchen den Uferdamm dort hinauf. Dann 40, 50 Meter im Dunkeln auf dem schmalen Sims oben entlang, noch ein Treppchen und - ecco! - die Baracke des Freundes. Er ist nicht da. Im Grunde muss ich gestehen, war mir das lieber. Andreij kennt sich aus. Ein Schlafsack hängt über der Wäscheleine, die zwischen kleinen Bäumen gespannt ist. Eine Decke holt Andreij von innen aus der Bretterbehausung. Wir haben alles und verschwinden gleich wieder. Andreij beteuert zwar, es sei völlig o.k., aber er scheint auch nicht länger als nötig bleiben zu wollen. Während wir am Piazza Emporio wieder auf die Tram warten, erfahre ich auch wieso. Es war wohl nicht die Angst vor seinem Freund, die uns schnell wieder gehen ließ.
»Ich lasse dich nie wieder allein«, hatte der ihm beteuert als Andreij vor einiger Zeit aus Wien zurückgekommen war. »Wenn du keine Aufenthaltsgenehmigung hast, dann gehen wir nach Frankreich und bitten um Asyl«, hatte er ihm vorgeschlagen. So erzählte Andreij. Dann klärte sich, warum er nicht einfach in der Baracke unter einer der sicher zahlreichen Decken schlief. Andreij empörte sich, als er mir erzählte, was er zu seinem Freund gesagt hatte: »Du bist dumm gewesen, als du den Polen hereingenommen hast!« Und mir erklärte er: »Der Pole hat einen Albanesen hereingelassen!«
Das war das Problem. Während Andreij in Wien im Gefängnis saß, waren eben andere eingezogen und mit denen verstand er sich nicht. »Wir können Albanesen verjagen!« schlug er mir vor und seine Augen funkelten wütend. Ich hielt das für keine gute Idee. Mir kam dabei auch seltsam vor, dass sein Freund das nicht selber tat, wenn er das Verwaltungsrecht über den Bereich hatte, wie es schien. Vielleicht war ich auch zu feige, mich auf einen Obdachenlosenkrieg einzulassen.
Andreij wurde auch gleich wieder ruhiger und praktisch. »Komm«, sagte er, »wir können uns Hände waschen drüben am Brunnen. Das ist gut. Nachher essen wir Abendbrot.« Ich hatte keine Lust. Ich wollte die Tram nicht verpassen. Er holte eine Seifendose aus seiner Jackentasche und ging von der Haltestelle über die Straße zum Brunnen, der in der Mitte des Kreisels liegt. Dass ihm das wichtig war, beeindruckte mich und ich ging ihm nach. »Ich habe immer ein Stück Seife dabei«, erklärte er fröhlich. »Nimm!«
Und er hatte völlig Recht. Man verloddert leicht als Obdachloser, dabei ist das gar nicht nötig, wenn man ein Stück Seife in der Tasche hat und ein Handtuch wie er. Ich fand das fein. Innerlich fein. Ich wäre noch nicht mal auf die Idee gekommen. Ich hatte vermeintlich andere Sorgen. Dann ging es mit der Tram zurück zum Hauptbahnhof, zum dritten oder vierten Mal kreuz und quer durch Rom an diesem Tag. Wir müssen umsteigen in den Bus. Fährt so spät überhaupt noch einer? Es ist nach Mitternacht. Wir erwischen gerade den letzten. Keine Ahnung, wo er hinfährt. Wieder fahren wir zu weit, wieder müssen wir warten, nehmen denselben zurück. Andreij scheint den Ort endlich wieder zu erkennen. Es ist ein Vorort mit nichts sagendenden Wohnblocks.
Wir gehen durch das nasse Gras eines Parks um abzukürzen; dann über Ackerfurchen. Der Mond steht klar und blass weit oben am schwarzkalten Nachthimmel. Die Sterne schillern wie gefrorene Lichter auf Eis. Irgendeine Parallelwelt musste das sein, zu der ich nie einen Zugang hatte. Der Bauwagen, der mitten auf einem Feld steht, kommt mir so fremdartig vor wie einem Raumfahrer eine Raumstation, zu der er zurückkehrt. Trotz allem irgendwie eine Art von Heimat. Eine andere ist nicht da. Und es ist gar nicht so schlecht, an sich. Andreij hat noch Vorräte verstaut. Tomaten, sehr lecker, und Kekse.
»Ein Kilo kostet nur 1 Euro!« erzählt er begeistert. Sie schmecken. Wir sitzen im Dunklen, nur ein wenig fahles Mondlicht fällt durch die jetzt schon beschlagenen Fenster und futtern. »Mit Milch habe ich sie noch lieber«, sagt Andreij. »Ja, wär nicht schlecht, aber Wasser ist auch o.k.« Irgendwie sind wir zufrieden.
Zeit zum Schlafen. Links und rechts im Wagen ist jeweils ein ca. 75 cm breiter Sims an der Wand. Andreij hat seine Matratze und ich lege Zeitungen unter. Er überlässt mir den Schlafsack. Das ist sehr nett, aber es ist ein Sommerschlafsack, so einer zum Zudecken, dass man das Gefühl hat eine Decke zu haben, mehr nicht. Die Kälte kriecht da durch und schmiegt sich an die Haut, als ob er gar nicht da wäre. Ich stecke den Kopf hinein und atme drinnen. Jedes bisschen Wärme zählt. Ein bisschen hilft das, viel nicht. Sonst erinnere ich nur Frieren und frieren und frieren.
Am anderen Morgen, ich erwartete sehnlich das erste Licht, stellte ich fest, dass ich tatsächlich im Frieren geschlafen habe muss. Das erstaunt mich. Es ist halb sechs. Gehen wir zur Questura? (Polizeistelle und Behörde für Asylanträge, Aufenthaltsgenehmigungen, etc.) Andreij hat einen Termin. Man muss früh da sein, wenn man eine Chance haben will, dran zu kommen. Aber es scheint, Andreij will noch schlafen. Eine Stunde später Frühstück. Kekse. Es ist immer noch kalt. Draußen Raureif. Könnte hübsch sein.
Zurück über den Park. Nasses Gras. Füße nass. Jetzt sind sie nass und kalt. Ich hüpfe. Aber ich bin nicht mehr wütend, auch nicht genervt. Man gewöhnt sich schnell. Ich wünsche nur einfach, es wäre wärmer, ich sehne mich danach, dass die Sonne aufgeht! Sonst ist es wie es ist. Wir warten auf den Bus, der schließlich über Straßenlöcher rumpelt in die Stadt. Die Vororte scheinen alle verbunden zu sein durch römisches Kopfsteinpflaster. Die Römer ertragen das stoisch in ihren feinen Arbeitsanzügen.
Die Questura ist nicht weit vom Hauptbahnhof. Man muss eine Nummer ziehen und warten. Ein agiler junger Reggaetyp schafft es einen Beamten in ein Gespräch über seine Belange zu ziehen. Nicht schlecht. So eine Mischung aus jovialer Freundlichkeit und Hartnäckigkeit, scheint Erfolg versprechend. Gelingt mir nicht. Als es soweit ist, werde ich brüsk abgewiesen: »Danke, wir haben Dolmetscher. Auf Wiedersehen.« Dass sie sie haben ist sicher, nur ob sie sie einsetzten? - Es war nichts zu machen. In den Innenbereich kommt Andreij nur alleine. Wir verabreden uns für den Nachmittag bei San Lorenzo und ich bin froh wieder frei zu sein. Ich kann kaum mehr klar denken. Das alles macht konfus, es ist konfus und aussichtslos. Er hat keine Papiere, das ist alles. Warum sollte er welche kriegen? Aber das kann man nicht sagen, versuchen muss man es. Oder?
6. Zurück in mein Leben
Ich gehe hinunter zum Piazza Venezia in die Kirche San Marco. Eine der schönsten zum Beten in Rom. Natürlich schön, kann man sagen, ohne die Aufmerksamkeit heischenden Kunstschätze, die Touristen locken; dafür mit vielen vom Glauben durchwebten Werken, gewachsen über Jahrhunderte, anheimelnd, dämmerlichtig. Es wird mir sogar ein bisschen warm. Jetzt kann ich auch nachdenken. Noch so eine Nacht in der Kälte im Bauwagen überlebe ich nicht. Zumindest habe ich keinen Bock drauf. Was ich brauche, sind warme Sachen. Der Frühling lässt auf sich warten. Wo krieg ich die her? - BeiMassa. Das ist der bekannteste Billigdiscounter in Rom.
Ich laufe quer durch Rom und kaufe dort eine lange Unterhose, rot, voll peinlich, aber warm und billig, außerdem eine Mütze. Das sind mal die wichtigsten Überlebensutensilien. Erster Schritt. Zweiter Schritt - sparen hin, sparen her - man braucht was Vernünftiges zu Essen. Schafskäse, Oliven, Brot - Mönchsfutter, wie mir mal ein orthodoxer Gottsuchender anvertraut hatte. Das war der Plan, aber es kam anders, zum Glück. Ricotta wurde es, eine Art Frischkäse, und Schinken. Danach geht es besser. Dritter Schritt: Ich brauche eine Decke. Gabi hat einen Schlafsack, Gabi leiht ihn mir bestimmt. Jetzt, wo ich wieder auftauche allmählich in meiner eigenen Welt, ist das das Vernünftigste und Nächstliegenste. Und dann ist der Bauwagen gar nicht so schlecht. Ich besorge auch einen Liter Milch, um Andreij eine Freude zu machen. Ich suche Gabi auf. Gabi ist ein Schatz. Kein Problem.
Als ich gegen 17 Uhr bei San Lorenzo bin, ist Andreij schon da und plaudert mit Martine. Das ist die Belgierin, die mir immer wie ein großes Huhn vorkam, die Verantwortliche für das Zentrum. Martine leiht sich von Andreij ein Feuerzeug. Das kam mir absurd vor. Er will mit mir Tee trinken gehen bei den Schwestern gleich um die Ecke. Dort gibt es am Dienstag für Obdachlose Tee und Gebäck oder Brote. Aber ich will in die Anbetung und später zum Gebetsabend bei Chemin Neuf. Natürlich würde ich mich freuen, wenn er mitkäme, aber das ist nichts für ihn.
Ein bisschen hatte ich ein schlechtes Gewissen. Ich hätte lieber mit ihm Tee trinken sollen. Wir trennten uns. Wir würden uns spätestens nachts im Bauwagen sehen. Die beiden Hemden, die er geschenkt bekommen hatte, trug ich immer noch bei mir im Rucksack. Er wollte, dass ich sie für ihn trage. Ich will sie ihm geben. »Nein, nein, später«, insistiert er.
Der Abend bei Chemin Neuf ist ein besonderer. Wir feiern eine Messa di Riconciliazione. Versöhnungsmesse. Man schreibt dabei Briefe an den oder die mit der oder dem man sich aussöhnen will. Nicht dass die anderen den Brief dann lesen würden, nein, man schreibt eher für sich selber, um etwas auszudrücken und dadurch einen neuen Zugang zu finden, sich Klarheit zu verschaffen, Schuld zu erkennen und schließlich auch verzeihen zu können. Man schreibt auch an Ihn, wenn man will. Das alles geht nicht ohne Tränen, jedenfalls bei mir. Die Barmherzigkeit Gottes bewegt, weil sie real ist, wenn man sie sucht.
Es folgte ein langes Gespräch mit Vincent, dem klugen, humorvollen, spitznasigen Priesteramtskandidaten, der zur Gruppe der Gemeinschaft Chemin Neuf in Rom gehört. Ob ich einen ›Padre spirituale‹ habe? Einen geistlichen Begleiter. Er würde mir das sehr empfehlen. Er ist nicht der erste, der das sagt. Aber ich bin nicht wild darauf. Freunde sind der bessere Spiegel, bilde ich mir ein. Und ich habe ja einen!
7. Wo ist Andreij?
Roma Termini, 23 Uhr. Ich freute mich sogar auf den Bauwagen. Solange mir warm ist, solange der Raumanzug intakt ist, konnte ich gut auf dem Mond leben. Eine Weile. Gabis Schlafsack fühlte sich warm an unter dem Arm. Ich freute mich auf Andreij.
Halbe Stunde Fahrt mit dem 38ger. Der Park, die Ackerfurchen, das Feld. Der Mond hell, die Nacht kristallklar. Es würde eher noch kälter als gestern werden. Von weitem sah ich einen Haufen vor dem Bus liegen. Im Bus selber scheint noch alles dunkel? Als ich näher komme, erkenne ich, dass das, was vor dem Bus auf einen Haufen liegt, seine Sachen sind. Auch die Matratze liegt da. Das sieht nicht gut aus. Soll ich gleich wieder verschwinden?
Nein, das wäre zu feige. Ich beobachte aus der Distanz. Der Bus scheint leer zu sein. Schließlich entscheide ich mich rein zu gehen. Drinnen liegt ein Zettel, schwer zu entziffern mangels Licht. Aber dann wurde es doch klar: «Credo che stanotte ti faccio una visita.« Eine Drohung? Nicht wirklich überzeugend. (Ich denke, ich werde dir heute Nacht einen Besuch abstatten.) Ich schrieb »Che bello!« daneben (wie schön). Was Besseres viel mir nicht ein. Damit war mein Mut auch erschöpft. Ich hatte nicht wirklich vor auf etwaige Besucher zu warten, obwohl es mir sehr unwahrscheinlich vorkam, dass jemand, der so schreibt, tatsächlich käme. Es war auch ein Rechtschreibfehler darin.
Ich ging. Sicher ist sicher. Aber wo war Andreij? War er schon da gewesen? Hätte er dann nicht seine Sachen mitgenommen? Es war lange nach Mitternacht. Käme er noch? Oder hatte er es sich anders überlegt? Obdachlose sind spontan. Kann sein, ihm war etwas anderes eingefallen, etwas dazwischen gekommen? Ich konnte nicht klar denken, sonst hätte ich ihm einfach einen Zettel auf Deutsch da gelassen und geschrieben, wo ich sein würde. Aber wusste ich schon, wo das wäre? Ich wollte in der Nähe bleiben, falls er noch kommen würde, nahm die Matratze und legte mich weiter vorne unter das kahle Geäst eines wilden Apfelbaumes im Park. Wenn er noch käme, konnte ich ihn sehen. Gabis Schlafsack war wunderbar. Daunen, 90/10, dicht und warm und, und das war das Beste: Goretex. Was kümmerte mich da Kälte und Tau? Unter dem Glanz der Sterne schlief ich fast beruhigt ein.
Sind das Sonnenstrahlen, die meine Nase kitzeln? Muss wohl. Augen auf. In meiner Wasserflasche ist Eis. Tut nichts. Mir ist warm, herrlich warm. Wo ist Andreij? Am Bus ist alles unverändert. Ich glaube ich habe ihm noch einen Zettel geschrieben, vielleicht auch nicht. Es sah nicht so aus, als ob er da gewesen war. Soll ich die Matratze mitnehmen oder nicht? Der Bauwagen ist für keinen von uns mehr ein guter Ort. Er weiß ja, dass ich abends fast immer bei San Lorenzo bin. Ich nehm sie für ihn mit.
8. Julia
Eines muss ich noch berichten, das muss nachgetragen werden, nämlich, dass ich einen wesentlichen Schritt vergessen habe, dabei, wie ich heraus kam aus diesem Sumpf. Das ist Julia, ja Julia darf nicht übergangen werden. Julia ist 23 und jobbt bei einem Internet Shop im Borgo Pio in der Nähe der Mauer, die vom Vatikan zur Engelsburg führt. Da haben wir uns kennen gelernt. Soll ich sie nun erst beschreiben oder sagen, was geschah? Julia ist wie ein reifer, frischer Pfirsich und sie hat so eine Art ihre Hand dir auf die Schulter zu legen und sie strahlt etwas aus, wie Mondlicht in einer warmen angenehmen Nacht. Es ist ein sanftes Licht und ein umarmendes und wenn der Tag düster ist, dann möchtest du dich bergen wie in einem Reetdachhaus, wenn draußen Regen und Unwetter ist. Sie macht die Tür hinter dir zu und es gibt heißen Kakao und Schokolade. Das einzige Problem war, dass ich mir nicht sicher war, ob die Tür wieder aufging, wenn die Sonne heraus kam oder ob ich dann für den Rest meines Lebens zu Sinnessanftem verdammt sein würde. Und Arbeit.
Sie war eher klein, hatte brünette Haare, halblang, eine interessante, etwas gewölbte Nase und weiche, schlanke Arme. Diese Julia traf ich gerade als ich aus dem Discountmarkt kam, wo ich die rote, lange Unterhose gekauft hatte. Es war eine ganz andere Ecke von Rom und es war als Zufall so unwahrscheinlich, dass es eigentlich keiner sein konnte. Sie lächelte, als sie mich sah und sie hörte mir zu, als ich ihr von meinem Missgeschick erzählte. Sie hörte mir aufrichtig zu, ohne die Distanz, die wir meisten haben, wenn wir vom Unglück anderer erfahren. Und als wir uns trennten, rief sie mir zu: »Un bacione!« (ein riesengroßer Kuss!) und ließ den Worten eine Bewegung ihrer Hand zu ihrem Mund folgen, was sie als Gruß geworfen mir durch die Luft sandte.
Da schmolz vieles zusammen von dem aufgestauten Trotz gegen die Kälte und das Wohnungslos-Sein und was sich mit dem Frust verhärtet hatte, zerfloss in Tränen. Das war allerdings danach, das war im Park, wo ich auch gegessen habe. Julia habe ich zu verdanken, dass ich dort nun Schinken aß und Ricotta und köstliches frisches Brot, denn nachdem ich sie getroffen hatte, war mir klar, dass ich was Leckeres brauchte. Derart gestärkt und belebt ergab es sich, dass ich zu Gabi ging, um nach dem Schlafsack zu fragen. Sicher, tapferer wäre es gewesen alles allein durchzustehen, wie richtige Obdachlose, denen hilft irgendwann auch keiner mehr, außer die Organisationen hin und wieder und Engel. Aber das ist nicht dasselbe, wie solange man noch Freunde hat.
Julia war eine Frau, wie sie die Zeit der 70ger Jahre hervorgebracht hat. Wenn sie auch jünger war. Sie war einziges Mädchen in einer Jungenklasse gewesen. Sie kannte ihre Pappenheimer. Sie wusste, wann ein Junge ein freundliches Wort brauchte, Mitgefühl, ein offenes Herz. Sie konnte ein Pflaster auf die Wunde legen oder Salböl und konnte mit Worten die Seele trösten wie mit duftenden Kräuter. Aber dann mischte sie sich auch nicht weiter ein. Sie war für mich wie eine barmherzige Samariterin, die die inneren Wunden heilsam berührt. Mit der Kirche hatte sie nichts im Sinn. Sie lebte von der Menschlichkeit mit allem drum und dran.
Am Abend als wir uns noch einmal im Internetshop sahen, redete sie enigmatische Worte über Mauern und Regeln und Regeln befolgen und über Mauern sehen. Ich glaube sie war in einer Klosterschule gewesen und ist eines Tages der Religion davon und in das Leben hinein gerannt. Da war sie souverän. Eine kleine Mondkönigin, eine Prinzessin der Nacht. Mit ihren Paladinen. Nur die Sonne, ich glaube schon, Christus, der im Inneren brennt und dich erleuchtet mit seinem sanftem und dabei hellem, starkem Licht, der fehlte ihr.
9.Madre Spirituale
Nun hatte ich die Matratze von Andreij und wusste nicht wohin. Ich transportierte sie also quer durch Rom, was ausgesprochen peinlich war, bis zum Piazza Sokrates hinauf. Dort, an einem riesigem Eukalyptusbaum geht ein Trampelpfad durch hüfthohes Gras leicht abwärts am Hügelrand entlang, der in ein kleines Wäldchen führt, ein Unterholz mehr, jedenfalls unbegangen, wenn nicht ein Hund eines Hundebesitzers, der weiter oben mit ihm spazieren geht, sich dahin verirrt. Dort am Rand des Gehölzes schlug ich mein Lager auf. Gesehen werden konnte ich nicht und nur der Lärm der Stadt, der ungehindert zu mir hinauf drang, störte ein wenig.
Am anderen Morgen ging ich früh in den Petersdom. Ich wollte in die Beichte. Es war doch alles schief gelaufen, irgendwie. Mir war klar, dass meine Dickköpfigkeit ein Hindernis auf dem Weg zu Gott war, mithin eine Sünde. Es ärgerte mich und es tat mir leid. Der Priester aber, ein älterer, abgeklärter, sah das anders. Auf meinen Bericht hin schüttelte er nur den Kopf.
»Ti dico una cosa: Non ho mai trovato un tedesco che non era ostinato.«
(Ich sage dir etwas: ich habe noch nie einen Deutschen getroffen, der nicht dickköpfig war.)
»Questo e una condizione, non e un peccato!«, fügte er hinzu.
(Das ist ein Bedingt-Sein, keine Sünde)
›Meno male‹, dachte ich (umso besser - wörtlich: weniger schlecht)
»Hai un padre spirituale«, fragte er mich.
(Hast du einen geistigen Begleiter?)
»Nein«, antwortete ich, »ich habe schon genug Stimmen im Kopf.«
Wieder wiegte er den Kopf:
»E molto piu difficile da solo. Ci perdiamo facilmente nelle nostre idee e fantasie. Puo essere anche un laico o una donna.«
(Es ist sehr viel schwieriger alleine. Wir verlieren uns in unseren Ideen und Phantasien. Es kann auch ein Laie sein oder einen Frau.)
Dann gab er mir die Absolution. Ich betete danach und bat Gott, er möge mir doch einen zeigen, der mir da weiter helfen würde. Und das tat er. Ich habe es noch nie erlebt, dass Gott ein Gebet, das von Herzen kommt, nicht erhört. Oft geschieht es erstaunlich schnell. Denn wer kam just in diesem Moment mit zielstrebigem Schritt durch den Petersdom? - Gabi.
Ich kürze den Weg ab, spreche sie an. ›Hallo, dies und das.‹ Ich frage sie nicht direkt, ob sie meine ›Madre Spirituale‹ sein wolle, nein, aber vertrauensvoll in diese Richtung hin. Aber, sie war in Eile. Einziges Problem mit Gabi: Immer in Eile. Wie es dann gekommen ist, weiß ich nicht mehr, wahrscheinlich wollte sie wieder am Wochenende nach Assisi und darauf hin warf ich ihr vor mit diesem Gependel zwischen Rom und Assisi käme sie nie weiter, das mit Emidio (der Mönch aus Assisi mit der behaarten Wade) sei völlig verkehrt und sie vergeude ihr Leben.
Kurz, ich ärgerte mich, dass sie keine Zeit für mich hatte. Wie ich es geschafft habe von meinem Ausgangspunkt, sie solle meine ›Madre Spirituale‹ werden, dahin zu kommen, dass ich erst einmal ihrem ›Padre Spirituale‹ den Krieg erklärte, weiß ich nicht mehr. Aber wirklich. Ich will doch Gabi als Gabi und nicht als Jüngerin von Emidio!
Gabi ist am schönsten, wenn sie sich ärgert. Das tut sie leider sehr selten und selbst jetzt im Petersdom, wo sie es eilig hatte und nicht darauf eingestellt war mit mir dergleichen zu diskutieren, beherrschte sie sich. Ihre Antwort kam später. Ich wunderte mich nach unserem Gespräch erst ein bisschen, dass das so schief gelaufen war, wo ich doch offensichtlich unter der Einwirkung des Heiligen Geistes gehandelt hatte. Aber es würde sich schon richten. Was Gott beginnt, das führt er auch zu einem guten Ende.
Ist das naiv? Keineswegs! Er tat es und noch am selben Tag. Da schrieb sie mir nämlich einen langen Brief, der einiges richtig stellte und mich ein Stück weiter brachte. Es war ein guter und engagierter Brief, genau das, was ich brauchte. Bitte, man muss manche Frauen eben manchmal ärgern, damit sie einem die Wahrheit sagen.
10. Kreuzanbetung
In den ersten Tagen ohne großen Rucksack und einen Platz zum Bleiben, wo man sich zuhause fühlen konnte, war ich konfus, windhaft und wurde wie die Samen des Löwenzahns von jedem Anhauch hierhin und dorthin geweht. Warum war es aber auch so elendig kalt in Rom?
Am Abend des Tages, an dem ich Gabi getroffen hatte, war abends Kreuzanbetung in San Lorenzo. Ein großes, schweres Holzkreuz aus flachen Balken, 3 Meter hoch. Das Weltjugendtagskreuz. Es war von Johannes Paul II zu einem der ersten Weltjugendtage gestiftet worden. Zwischen den Weltjugendtagen besucht es seitdem immer so viele Diözesen und Gemeinden rund um den Globus wie möglich, um die Jugendlichen darum zu versammeln und zusammen zu rufen. Zu dieser Zeit war es in Rom und an diesem Abend in San Lorenzo. Kreuzanbetung die ganze Nacht. Es begann mit einem gemeinsamen Abendessen. Auch Carmela war da, die Neapolitanerin, die leider schon seit Weihnachten nicht mehr im Zentrum arbeitete, sondern in das ehemalige Haus der Schule der Gemeinschaft Emmanuel gewechselt war, wo jetzt andere Ausbildungskurse liefen.
Es waren wenige sonst da und das wunderte mich. Denn es ist ein besonderes Kreuz und die Anbetung in der Nacht eine tiefe und schöne religiöse Erfahrung. Eine junge Farbige war da, Marla. Ich b egleitete sie gegen 22 Uhr mit dem Bus bis zur Metrostation Re di Roma, von wo aus sie es nur noch wenige Stationen bis nach Hause hatte. Das war in Italien durchaus noch eher üblich als es in Deutschland wäre. Einfach zur Sicherheit und aus Höflichkeit. »Tu sei gentilissiomo« (du bist sehr freundlich), sagte sie mir herzlich, als wir uns trennten.
Ich fuhr zurück nach San Lorenzo. Die einzigen, die außer mir die ganze Nacht blieben, waren zwei tschechische Seminaristen, die beide Ende 20 waren. Der eine war etwas anstrengend und wollte unbedingt mit uns seinen Canon singen. Wir taten ihm den Gefallen.
Im Programm war sonst vorgesehen, dass immer eine Gemeinschaft alle zwei Stunden eine Stunde gestaltete. Das war eine gute Regel. So war immer eine Stunde mit Programm und Anregungen mit einer Stunde stillem Gebet im Wechsel. Wer wollte und konnte, wachte die ganze Nacht.
Um 24 Uhr rückte Chemin Neuf an mit Marina, Vincent und Francois. Wir singen, wir beten den Rosenkranz und bringen unsere persönlichen Gebete dar. Ein guter Anfang. Um 2 Uhr gab es in den Aufenthaltsräumen eine fröhliche Pause mit Tee & Keksen. Dann zog sich Chemin Neuf zurück und ein brasilianisches Trüppchen von Shalom übernahm. Beim seltsamen Zungengebet räumte ich meinen guten Platz auf dem ausgebreiteten Teppich nahe am Kreuz. Als ich wieder kam, hatte es sich der Tscheche dort bequem gemacht. Auf meinem Platz. Ich spürte, dass er jetzt fand, dass es seiner sei.
Ich setzte mich auf eine der Seitenbänke und las Psalmen. Gegen vier Uhr morgens, als alle schon sehr müde waren, schafften wir es doch gemeinsam auf dem Teppich zu beten. Eine Frucht des Wachens, dass man persönliche Antipathien überwinden lernt. Die Gedanken und Empfindungen dabei, sind ohnehin schwer wieder zugeben. Der Kampf mit der Müdigkeit wurde der alles beherrschende.
Auch in den Nächten zuvor hatte ich nicht sonderlich viel geschlafen, aber das muss man auch nicht. Schlafen ist bis zu einem gewissen Grad Einbildung. Deshalb ist dieses Wachen eine gute Übung. Jesus erwartet oder erbittet es ja auch von seinen Jüngern: ›Bleibt hier und wachet mit mir!‹ Die Angst Jesu vor seinem Kreuzesopfer ist real und bleibt real durch alle Zeit. Deshalb ist das Wachen mit ihm an sich ein Wert, selbst wenn es einem schwer fällt vor Müdigkeit irgendetwas zu denken, als dass man nicht schlafen will, nicht schlafen will, nicht schlafen will.
Als ich das Schwerste überwunden hatte und innerlich gegen 5 Uhr Ruhe unter dem Kreuz fand, hielt ich es aber doch für angebracht mich eine Etage tiefer in meinen Schlafsack zurück zu ziehen. Ich hatte wohl gemerkt, dass die beiden Seminaristen sehr müde waren und auch gerne 2-3 Stunden geschlafen hätten; aber es war klar, dass sie niemals vor mir die Wache unter dem Kreuz verlassen würden. Um 8:45 wachte ich auf und um neun Uhr gab es eine abschließende Messe. Die Seminaristen schliefen tief und fest. Hinterher waren sie wach. Wir verabschiedeten uns freundschaftlich und tauschten Adressen aus.
11. Haussegnung
Der übernächste Tag war Palmsonntag. Ich schlief nicht lange im Eukalyptuswäldchen, unweit des Piazza Sokrates. Die Sonne weckt einen früh oder der herauf schallende Lärm. Auch am Palmsonntag.
»Il Papa e li!« (Dort ist der Papst!)
Einzug mit Palmenwedeln und Kardinälen. Wir stehen auf dem Petersplatz in der Menge. Die Müdigkeit vergeht während der Messe. Palmsonntag feiert den Einzug Jesu nach Jerusalem. Er reitet auf einem Esel, die Menschen breiten ihre Mäntel vor ihm aus, wie einen langen bunten Teppich. Sie schwenken Palmwedel, sie begrüßen den König der Juden, den Messias: »Hosanna, gelobt sei der da kommt im Namen des Herren!« Die Pharisäer sind bestürzt. Das in der angespannten Lage der römischen Besatzung! »Bring deine Jünger zum Schweigen!«, dringen sie auf ihn ein. Doch Jesus erwidert: »Ich sage euch: Wenn sie schweigen, werden die Steine schreien.«
Auch die Gemeinschaft Shalom ist da mit Maria, die ihre dunkle Sonnenbrille trägt und Marla. Es ist ein Freudenfest und ein wenig springt davon über, trotz der ruhigen Würde und Gelassenheit des Ritus.
Anschließend sind wir alle eingeladen bei einer jungen Frau aus dem Freundeskreis von Shalom, die ihre neue Wohnung einweihen und von Padre Leonardo segnen lassen will. Ich bin in einem Auto mit eben dem schmächtigen Priester, der halb aus Wien, halb aus Brasilien stammt und einem brasilianischen Seminaristen. Man plaudert über das Seminar und der Seminarist charakterisiert für mich das Leben darin mit diesem anschaulichem Bild: »Das Leben im Priesterseminar ist wie Karamell: Hart, aber süß.« Das leuchtete mir ein, das schien mir treffend. Aber ist das nicht komisch, wo doch Jesus zu seinen Jüngern sagt: »Ihr seid das Salz der Erde?«
In der Wohnung selber brauchten wir erst einmal alle Geduld bis Padre Leonardo die entsprechenden Segnungen blätternd aus seinem Buch heraus gelesen hatte.
»Lui mi capisce,« (Er versteht mich) versichert er uns.
Dann dauerte es wieder sehr lange.
»Non e che lo faccio tutti i giorni!« (es ist ja nicht so, dass ich das jeden Tag mache)