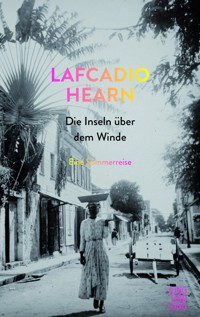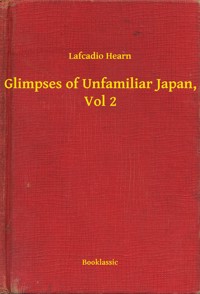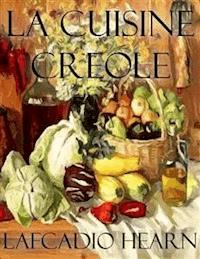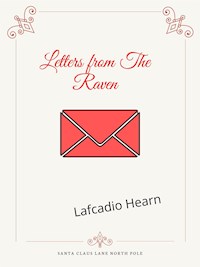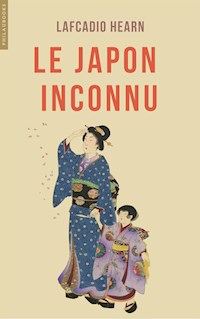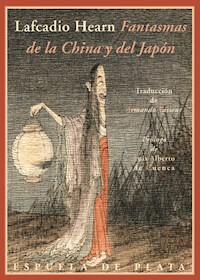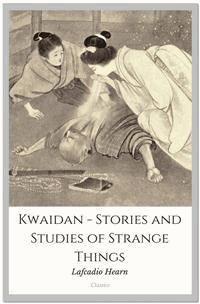Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung u. Jung
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Dies ist die Geschichte eines verlorenen Mädchens, eingebunden in die Erzählung von einem in jeder Hinsicht umwerfenden Sturms, wie es sie in der Literatur nicht ein zweites Mal gegeben hat. Ihren richtigen Namen kennt niemand, nicht einmal Conchita selbst weiß, wer sie ist und woher sie kommt. Chita ruft sie der spanische Fischer, Feliu, der sie eines Tages, nachdem ein Hurricane vor der Küste von New Orleans gewütet hat, aus den Armen ihrer toten Mutter vor dem Ertrinken rettet. Er und seine kinderlose Frau Carmen geben ihr ein neues Zuhause. Doch das Glück, das sie teilen, während der Sturm ganze Inseldörfer ausgelöscht, Leben zerstört und Familien zerrissen hat - wovon hängt es ab? Dass Chitas Vater, der Mann, der ihren richtigen Namen kennt, tot ist. Oder dass er im Glauben lebt, seine Tochter wäre tot, und ihr nie wieder begegnet …Ja, unerschöpflich ist dieser Roman, berührend und voller Farbe, mitreißend im Sog einer Sprache, mit der Lafcadio Hearn ein grandioses Naturschauspiel aufführt. Ein Wirbelsturm ist dieses kleine Meisterwerk, das von einem Wirbelsturm erzählt und davon, wie zerbrechlich menschliche Beziehungen sind, und dass es gleichzeitig nichts gibt, was der Gewalt der Natur widersteht.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 154
Veröffentlichungsjahr: 2015
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Die Originalausgabe mit dem Titel »Chita: A Memory of Last Island«erschien 1889 bei Harper & Brothers, New YorkUmschlagbild: Shutterstock.com / andrej pol© 2015 Jung und Jung, Salzburg und WienAlle Rechte vorbehaltenDruck: Theiss GmbH, St. Stefan im LavanttalISBN 978-3-99027-068-4
LAFCADIO HEARN
Chita
Eine Erinnerung an Last Island
Aus dem Englischen übersetzt und herausgegeben von Alexander Pechmann
Doch die Natur pfiff mit all ihren Winden,Tat, was ihr gefiel, und ging ihres Wegs.Ralph Waldo Emerson1
Je suis la vaste mêlée, –Reptile, étant l’onde; ailée,Étant le vent, –Force et fuite, haine et vie,Houle immense, poursuivieEt poursuivant.Victor Hugo2
Inhalt
Teil I Die Legende der Île Dernière
Teil II Aus der Gewalt des Meeres
Teil III Der Schatten der Flut
Anmerkungen
Nachwort
Editorische Notiz
für meinen Freund Dr. Rodolfo Matas aus New Orleans
Teil I
Die Legende der Île Dernière
I.
Reist man von New Orleans südwärts zu den Inseln, kommt man über sich windende Wasserwege durch ein fremdes Land in ein fremdes Meer. Wenn man will, kann man in einem Logger3 bis zum Golf segeln, doch lässt sich die Strecke viel schneller und angenehmer auf einem jener leichten, schmalen Dampfer zurücklegen, die speziell für das Bayou gebaut wurden und Passagiere für gewöhnlich an einer nicht weit vom Ende der alten Saint-Louis Street gelegenen Stelle aufnehmen, gleich neben dem Anlegeplatz der Zuckerfrachter, wo ständiges Gedränge herrscht und unablässig Dampfschiffe einlaufen, alle auf der Suche nach einem Rastplatz für ihren weißen Bug, um dann wie große müde Schwäne nebeneinander am Kai zu liegen. Doch der winzige Dampfer, auf dem man die Passage zum Golf bucht, bleibt nie lang auf dem Mississippi: Er überquert den Fluss, schlüpft in irgendeine Kanalmündung, schleppt sich eine Weile eine künstliche Wasserstraße entlang und verlässt sie dann mit einem Freudenschrei, um etliche Seemeilen frei durch die dunklen Schatten des Bayou zu schippern. Vielleicht trägt er den Reisenden danach durch die ungeheure Stille überschwemmter Reisfelder, wo der gelbgrüne Wasserspiegel in großen Abständen von der schwarzen Silhouette einer Bewässerungsmaschine durchbrochen wird. – Doch welcher der fünf möglichen Routen man auch folgt, man wird sich mehr als einmal in den düsteren Irrgärten aus Sumpfwäldern wiederfinden, vorbeitreiben an Gruppen von Zypressen, von parasitären Tillandsien4 silbergrau überwuchert, so grotesk wie eine Versammlung von Fetischgöttern. Vom Fluss oder einem der kleinen Seen gleitet der Dampfer stets noch einmal in einen Kanal oder ein Bayou, vom Bayou oder Kanal wieder auf einen See oder in eine Bucht, und manchmal zieht sich der Sumpfwald von diesen Ufern zurück und verdünnt sich zu Ödland aus schilfigem Morast, wo der schwammige Boden sogar in windstillen Nächten zu einem Donner erbebt wie dem von Brechern an der Küste: das Sturmgebrüll von Milliarden Reptilienstimmen, die im Takt singen, im Rhythmus eines gewaltigen Crescendo und Diminuendo5– ein monströser und abstoßender Chor von Fröschen! …
Keuchend, pfeifend, seinen Kiel über die Sandbänke schleifend, versucht der kleine Dampfer den ganzen Tag lang den grandiosen Glanz des blauen offenen Wassers hinter den Marschländern zu erreichen, und wenn er Glück hat, gelangt er ungefähr bei Sonnenuntergang in den Golf. Der Passagiere wegen fährt er nur am Tag, doch es gibt andere Schiffe, die auch nachts unterwegs sind – sie schlängeln sich winters wie sommers durch die Labyrinthe des Bayou: Manchmal steuern sie nach dem Polarstern, manchmal, in der weißen Jahreszeit der Nebel, ertasten sie sich ihren Weg mit Stangen – und dann wieder richten sie sich nach dem Abendstern, der an unserem Himmel wie ein zweiter Mond schimmert und über den stillen Seen versinkt, während das Schiff einen bebenden Pfad aus silbernem Feuer kreuzt.
Die Schatten werden länger; und schließlich schwinden die Wälder achtern zu dünnen bläulichen Linien – Land wie Wasser erscheinen in leuchtenderen Farben – Bayous öffnen sich zu breiten Passagen – Seen verknüpfen sich mit Meeresbuchten – und der Meereswind braust einem entgegen – scharf, kühl und voller Licht. Zum ersten Mal beginnt nun das Schiff zu schaukeln – es bewegt sich im großen lebendigen Puls der Gezeiten. Und lässt man den Blick vom Deck aus umherschweifen, ohne dass einem eine Mauer aus Wald die Aussicht nimmt, kommt es einem so vor, als müsste das Flachland einst vom Meer in Stücke gerissen und in phantastischen Fetzen über den Golf verstreut worden sein …
Manchmal sieht man über einer Wüste aus windgebeugtem Prärieschilf eine Oase auftauchen – ein Bergkamm oder Hügel im Schatten der gerundeten Blätter immergrüner Eichen: eine chénière6. Und aus der schimmernden Flut tauchen auch grüne Kuppen auf – hübsche Inselchen, ein jedes mit seinem Strandgürtel aus flirrendem Sand und gelbweißen Muscheln –, und alles leuchtet vor subtropischen Gewächsen, Myrthen, niedrigen Palmen, Orangenbäumen und Magnolien. In ihrem smaragdgrünen Schatten schlummern eigentümliche kleine Palmhüttendörfer, die von dunkelhäutigen Orientalen bewohnt werden – malayischen Fischern, die das Spanisch-Kreolisch der Philippinen so gut sprechen wie ihr Tagal7 und die in Louisiana die katholischen Traditionen der spanischen Kolonien am Leben erhalten. In diesen fremden Dörfern leben Mädchen, die zu manch einem kunstvollen Bildwerk inspirieren könnten – ihre Schönheit erstrahlt in rötlicher Bronze, ihre Anmut gleicht den Palmblättern, die über ihren Häuptern schwanken … Weiter in Richtung Meer kommt man vielleicht an einer chinesischen Ansiedlung vorbei: ein seltsames Lager aus Holzhütten, die sich um eine gewaltige Plattform drängen, welche sich auf tausend Pfosten über das Wasser erhebt. Über dem winzigen Kai kann man das weiße, mit blutroten Schriftzeichen bemalte Schild schwerlich übersehen. Die große Plattform dient dazu, Fische in der Sonne zu trocknen, und die phantastischen Zeichen auf dem Schild bedeuten wörtlich übersetzt: »Reichlich – Garnelen – jede Menge« … Und schließlich schmilzt das ganze Land zu Einöden aus Salzwassersümpfen, deren Stille selten unterbrochen wird, außer vom melancholischen Ruf stelzbeiniger Vögel und in stürmischen Jahreszeiten von jenem Klang, der alle Küsten erschüttert, wenn der unheimliche Musiker des Meeres die Basstöne seiner mächtigen Orgel anstimmt …
II.
Jenseits der Salzwassersümpfe liegt ein merkwürdiges Archipel. Reist man heute mit dem Dampfer zu den Meeresinseln, erreicht man den Golf höchstwahrscheinlich über Grande Pass – man streift Grande Terre, die bekannteste Insel von allen, bekannt weniger wegen ihrer Nähe zum Festland als aufgrund ihrer großen verfallenden Festung und ihres anmutigen Pharos8: dem unveränderlichen Leuchtfeuer von Barataria9. Ansonsten ist der Ort trostlos und uninteressant: eine Wildnis aus windgebeugten Gräsern und zähem Unkraut, das unablässig von einem schmalen Strand winkt, der stets von angeschwemmten und verfaulenden Dingen gesprenkelt ist – wurmstichiges Holz, tote Delphine. Im Osten wird die rostbraune Ebene vom säulenartigen Umriss des Leuchtturms unterbrochen und noch weiter dahinter von kümmerlichem Gestrüpp, über dem die eckige rötliche Masse der alten Backsteinfestung emporragt, deren Wassergräben von Krabben wimmeln und deren Schleusen von übriggebliebenen, inzwischen von einer dicken Schicht Austern überwucherten Kanonenkugeln halb verstopft sind … Rundherum der graue Kreis eines Meeres voller Haie …
An manchen Herbstabenden, wenn die Himmelssphäre wie das Innere eines Kelchs erglüht und Wellen und Wolken in wilden Herden aus gebrochenem Gold dahineilen, sieht man dort die gelbbraunen Gräser bedeckt mit etwas wie Hülsen – weizenfarbene Hülsen –, groß, flach und gleichmäßig über die Leeseite eines jeden schwankenden Halms verteilt, so dass nur ihre Ränder dem Wind ausgesetzt sind. Doch wenn man näherkommt, brechen all diese blassen Hülsen auf, um eine seltsame scharlachrote und robbenbraune Pracht zu zeigen, mit arabesken Einsprengseln von Weiß und Schwarz: Sie verwandeln sich in wundersame lebende Blüten, die sich vor unseren Augen lösen und in die Luft erheben und zu Tausenden davonflattern, um sich weiter weg niederzulassen und wieder zu weizenfarbenen Hülsen zu werden … eine wirbelnde Blumenwehe aus schläfrigen Schmetterlingen!
Südwestlich, auf der anderen Seite der Passage, schimmert die schöne Grande Isle: ursprünglich eine Palmenwildnis (latanier), dann trockengelegt, eingedämmt und von spanischen Zuckerrohrbauern bepflanzt und nunmehr vor allem als Badeort bekannt. Seit dem Krieg hat der Ozean seinen Anteil zurückgefordert – die Zuckerrohrfelder sind zu sandigen Ebenen verkommen, über die sich Straßenbahnen zu den glatten Stränden schlängeln, die Plantagenwohnhäuser wurden in rustikale Hotels umgebaut und die Sklavenquartiere zu Dörfchen aus gemütlichen Cottages für Feriengäste umgestaltet. Doch mit ihren eindrucksvollen Eichenhainen, ihrer goldenen Pracht aus Orangenbäumen, ihren duftenden Oleanderwegen, ihren großen, mit wilder Kamille gelb besternten Viehweiden bleibt Grande Isle die schönste Insel des Golfs, und ihre Schönheit ist außergewöhnlich. Denn die Trostlosigkeit von Grand Terre zeigt sich auch auf den meisten anderen Inseln – Caillou, Cassetete, Calumet, Wine Island, die beiden Timbaliers, Gull Island und die vielen Inselchen, auf denen der graue Pelikan heimisch ist –, sie alle sind kaum mehr als Sandbänke, bedeckt mit drahtigen Gräsern, Prärieschilf und Gestrüpp. Last Island (L’Île Dernière), einstmals trotz ihrer Abgelegenheit einen ausgedehnten Besuch wert, ist heute eine gespenstische, fünfundzwanzig Meilen große Einöde. Obwohl sie fast vierzig Meilen westlich von Grande Isle liegt, hatte sie noch vor einer Generation viel mehr Bewohner: Sie war nicht nur die berühmteste Insel der Gruppe, sondern auch der angesagteste Badeort des aristokratischen Südens. Heute wird sie nur noch von Fischern besucht, und dies recht selten. Ihr wunderbarer Strand glich in vielem dem von Grande Isle unserer Tage. Auch die Unterkünfte waren sehr ähnlich, allerdings vornehmer: ein charmantes Dorf aus Cottages mit Blick auf den Golf nahe an der westlichen Küste. Das Hotel war ein massiver zweistöckiger Holzbau mit zahlreichen Zimmern, einem großen Speiseraum und einem Tanzsaal. Hinter dem Hotel lag ein Bayou, wo Passagiere an Land gingen – es wird heute noch von den Seeleuten »Village Bayou« genannt –, doch der tiefe Kanal, der etwas weiter östlich die Insel teilt, existierte nicht, als das Dorf noch stand. Das Meer hat ihn eines Nachts gewaltsam ausgehoben – in derselben Nacht, als Bäume, Felder, Häuser allesamt im Golf verschwanden und keine Spur von den dort ansässigen Menschen zurückblieb, außer einigen jener festen Backsteinstützen und -fundamente, auf denen die Holzhäuser und Zisternen errichtet worden waren. Ein einziges lebendes Wesen wurde dort nach der Katastrophe gefunden – eine Kuh! Doch wie jene einsame Kuh den Zorn einer Sturmflut überleben konnte, die tatsächlich die ganze Insel entzweiriss, blieb für immer ein Geheimnis …
III.
An der dem Golf zugewandten Seite dieser Inseln kann man beobachten, dass die Bäume – sofern es welche gibt – sich alle vom Meer abwenden, und sogar an heiteren, heißen Tagen, wenn der Wind ruht, hat ihr an Todesangst gemahnender Ausdruck etwas grotesk Pathetisches an sich. Eine Gruppe Eichen auf Grande Isle kamen mir stets besonders vielsagend vor: Fünf gebeugte Silhouetten in einer Reihe vor dem Horizont gleichen fliehenden Frauen mit flatternden Gewändern und windzerzaustem Haar – gramgebeugt strecken sie ihre Arme nach Norden aus, als wollten sie sich vor einem Sturz bewahren. Und sie werden auch wirklich verfolgt – denn das Meer frisst das Land auf. Meile um Meile an Boden ist durch die unermüdlichen Angriffe der Kavallerie des Ozeans verlorengegangen: Mit einem guten Fernglas sieht man weit draußen Delphine spielen, wo einst das Zuckerrohr seine Millionen Fähnchen ausschüttelte, und Haiflossen pflügen heute durch tiefes Wasser, wo damals noch Tauben gurrten. Menschen bauen Deiche, doch die belagernden Fluten rücken mit ihren Rammböcken vor – ganze Wälder aus Treibholz, dicke Stämme von Wassereichen und schweren Zypressen. Seit Ewigkeiten strebt der gelbe Mississippi etwas aufzubauen, was die See seit Ewigkeiten zu vernichten sucht – und inmitten ihres ewigen Kampfes ändern die Inseln und die Vorgebirge ihre Form, langsamer zwar, aber nicht weniger phantastisch als die Wolken am Himmel.
Und jene fahlen Schlachtfelder, wo die Wälder ihren letzten tapferen Widerstand gegen die unnachgiebige Invasion leisteten, sind einer Betrachtung wert – man findet sie für gewöhnlich an einem langen Ausläufer der Salzwassersümpfe, weiträumig umsäumt von Sanddünen. Genau dort, wo sich die Wellen hinter einem dieser Ausläufer kräuseln, kann man eine Schar geschwärzter, knorriger Gebilde erkennen, die aus dem Wasser ragen – einige hoch genug, um an verfallene Schornsteine zu erinnern, andere haben erstaunliche Ähnlichkeit mit riesigen Skelettfüßen und Skeletthänden, an die sich dort und da weiße Krustentierablagerungen heften, die wie Hautreste aussehen. Dies sind die Körper und Gliedmaßen der ertrunkenen Eichen – sie ertranken vor so langer Zeit, dass die Muschelkruste an einigen Stellen ein Zoll dick ist. Weiter oben am Strand liegen gewaltige umgestürzte Stämme. Einige sehen aus wie riesige zerbrochene Säulen, andere gemahnen an kolossale halbversunkene Torsi und scheinen verzweifelt ihre verstümmelten Glieder aus ihren absinkenden Gräbern zu strecken – und neben diesen gibt es noch andere, die mit verblüffender Hartnäckigkeit aufrecht stehengeblieben sind, obwohl die barbarischen Gezeiten sie seit zwanzig Jahren angegriffen und allmählich den Boden über und unter ihren Wurzeln fortgerissen haben. Der Sand rundum – weich darunter und mit einer dünnen Kruste an der Oberfläche – ist überall von Löchern durchsiebt, die von einer schön gesprenkelten und halbdurchsichtigen Krabbe mit haarigen Beinen, großen Glotzaugen und milchweißen Scheren erzeugt werden – während in den grünen Seggen dahinter ein ständiges Rascheln herrscht, als ob ein Sturmwind durch das Riedgras peitscht: ein wundervolles Gekrabbel von »Fiddlers«10, die ein unerfahrener Besucher anfangs für eine Schar eigenartiger Käfer halten könnte, denn sie laufen seitwärts, ein jeder mit seiner einzelnen Schere, die er wie eine Flügeldecke an seinen Körper faltet. Jedes Jahr wird dieser raschelnde Streifen grünen Landes schmaler, der Sand breitet sich aus und sinkt nieder, bebend und sich faltend wie lebendige braune Haut, und die letzten noch stehenden Eichenruinen, die sich mit bloßen, abgestorbenen Füßen an den abrutschenden Strand klammern, verlieren immer mehr ihren lotrechten Stand. Wenn der Sand absackt, scheinen die Baumstümpfe zu kriechen, ihre ineinander verwobenen Massen schlangenartiger Wurzeln scheinen zu krabbeln, sich zu winden – wie die tastenden Arme von Kopffüßern …
… Grande Terre verschwindet: Das Meer untergräbt ihre Festung, und der Sturm wird in wenigen Jahren die Wälle geschliffen haben. Grande Isle verschwindet – langsam, aber sicher: Der Golf hat sich drei Meilen weit in ihr grasbewachsenes Land gefressen. Last Island ist verschwunden! Wie es verschwand, erfuhr ich zum ersten Mal aus dem Munde eines alten Lotsen, als wir eines Abends zusammen auf dem Stamm einer angeschwemmten Zypresse saßen, die eine Flutwelle weit den Strand von Grande Isle hinaufgedrängt hatte. An jenem Tag herrschten tropische Temperaturen; wir hatten die Küste aufgesucht, um ein wenig frische Luft zu schnappen. Die Sonne ging unter, und die drückende Hitze ließ nach – plötzlich kam eine Brise auf, Blitze flackerten am sich verfinsternden Horizont, Wind und Wasser begannen erbittert miteinander zu ringen, und bald donnerte es entlang der gesamten niedrigen Küste. Da erzählte mein Gefährte seine Geschichte; vielleicht hatte ihn der aufkommende Sturm zum Sprechen gebracht! Und als ich ihm lauschte und gleichzeitig das Tosen der Küste vernahm, erinnerte ich mich plötzlich an einen einzigartigen bretonischen Aberglauben: dass die Stimme des Meeres niemals eine einzige Stimme sei, sondern ein Stimmengewirr – die Stimmen ertrunkener Menschen – das Murmeln zahlloser Toter – das Wehklagen unzähliger Geister, die sich alle erhoben, um zum großen Hexensabbat der Stürme gegen die Lebenden zu wüten …
IV.
Den Zauber eines einzigen Sommertages an den Küsten dieser Inseln kann man unmöglich beschreiben, nie vergessen. In den blasseren Klimazonen leuchten Himmel und Erde selten so strahlend hell: Wer die Pracht eines westindischen Himmels gesehen hat, wird mich am besten verstehen. Und doch sind diese Tage am Golf von einer so zarten Tönung, eine Liebkosung der Farben, die nicht von den Antillen stammt – eine Seelennatur, die ewigem tropischen Frühling gleicht. Xenophanes11 muss einst zu einem Himmel wie diesem aufgeblickt haben, als er schwor, das endlose Blau sei Gott – unter solch einem Himmel gab De Soto12 dem größten und grandiosesten der Häfen des Südens den Namen Espiritu Santo – die Bucht des Heiligen Geistes. Es liegt etwas Unaussprechliches in dieser strahlendhellen Luft des Golfs, das Ehrfurcht erzwingt – etwas Lebendiges, etwas Heiliges, etwas Pantheistisches: Und der Verstand fragt sich demütig, ob das, was das Auge erblickt, nicht in Wirklichkeit das »Pneuma«13 sei, der Unerschöpfliche Atem, der Geist Gottes, die große Blaue Seele des Unbekannten. Alles, alles ist blau in der Windstille – bis auf das flache Land unter den Füßen, das man fast vergisst, da es sich nur um ein winziges grünes Blättchen zu handeln scheint, das für immer durch die Ewigkeit des Tageslichts treibt. Dann, allmählich, zärtlich, unwiderstehlich, wird man vom Hexenwerk des Unendlichen überwältigt: Jenseits von Zeit und Raum beginnt man mit offenen Augen zu träumen, in die köstliche Weltvergessenheit hineinzugleiten, die Vergangenheit, die Gegenwart, die Materie zu vergessen, nichts zu erfassen als die Existenz jenes unendlichen blauen Geistes, als etwas, mit dem man vollkommen und für immer verschmelzen möchte …
Und diese azurblaue Tagesmagie hält manchmal monatelang an. Wolkenlos rötet sich die Dämmerung durch einen violetten Osten: Man sieht keinen Makel auf der Blütenpracht ihrer mystischen Rose – bis auf die Silhouette einer vorbeifliegenden Möwe, die ihre Sichelflügel vor dem blutroten Hintergrund ausbreitet. Mit der aufsteigenden Sonne ändert die Flut unablässig die Farbe. Zuweilen glatt und grau, doch glitzernd mit dem Gold des Morgens, ist sie die Offenbarung des Johannes – das apokalyptische Meer aus Glas, das sich mit Feuer mischt;14 dann wieder nimmt sie mit der aufkommenden Brise jenen unglaublichen Purpurton an, der am ehesten Malern westindischer Landschaften vertraut ist; noch einmal, im Glanz der Mittagssonne, wandelt sie sich zu einer Wüste aus zerbrochenem Smaragd. Mit dem Abend nimmt der Horizont Tönungen von unbeschreiblicher Schönheit an – Perlenlichter, opalene Farben aus Milch und Feuer, und im Westen zeigen sich Topazglut und wundersame Erscheinungen wie von Perlmutt. Dann, wenn das Meer schläft, träumt es von all diesen Dingen – matt, unheimlich –, verfolgt sie sogar bis an die Grenze des Himmels.
Ebenso schön sind jene weißen Phantasmagorien, die mit dem Nahen der Tag- und Nachtgleiche die Ankunft der Stürme markieren. Über den Rand des Meeres erhebt eine helle Wolke sanft ihr Haupt. Sie steigt auf, und andere begleiten sie zur Rechten und Linken – langsam zunächst, dann rascher. Alle sind strahlend weiß und flaumig, wie lockere frische Baumwolle. Allmählich steigen sie in einer ungeheuren Linie über dem Golf auf, rollen und winden sich zu einem Bogen, der sich weiter ausdehnt und voranschreitet – sich von Horizont zu Horizont wölbt. Ein klarer, kalter Hauch begleitet seine Ankunft. Erreicht er den Zenit, scheint er eine Zeitlang im Gleichgewicht zu schweben – eine geisterhafte Brücke über das Empyreum15 –, seine unermessliche Spannweite gründet in beiden Unterseiten der Welt. Dann beginnt das kolossale Phantom sich wie an einer Spindel aus Luft zu drehen – es behält dabei stets seine symmetrische Kurvenform, bewegt aber seine unsichtbaren Enden jenseits und unter dem Himmelskreis. Und schließlich treibt es als Ganzes jenseits der blauen Himmelskuppel davon, mit einem Wind, der ihm folgt. Jeden Tag, fast zur selben Stunde, steigt der weiße Bogen auf, dreht sich und verschwindet …