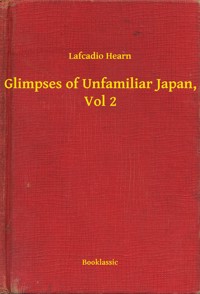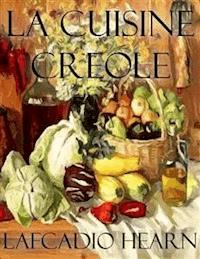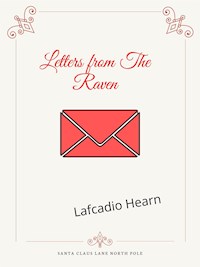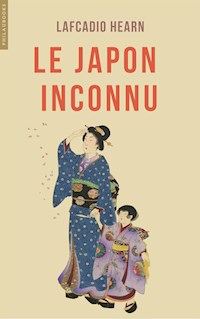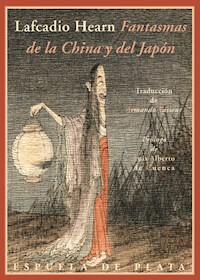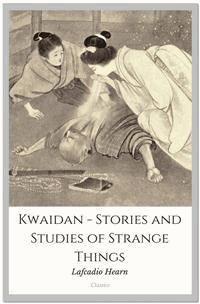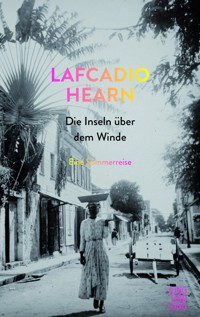
Erhalten Sie Zugang zu diesem und mehr als 300000 Büchern ab EUR 5,99 monatlich.
- Herausgeber: Jung und Jung Verlag
- Kategorie: Gesellschafts- und Liebesromane
- Sprache: Deutsch
Einen Sommer lang fährt Lafcadio Hearn als Passagier eines Dampfschiffs auf den Kleinen Antillen von Insel zu Insel. Zurück in New York, verarbeitet er seine Notizen zu einem Reisebericht von exotischer Sinnlichkeit, zu einem Wortgemälde von intensiver Leuchtkraft. Mit einem frappanten Gespür für Farben, Formen und Gerüche, mit der staunenden Neugier des Verliebten und dem genauen Blick des Journalisten versucht er jedes noch so kleine Detail sprachlich zu fassen. Wieder und wieder begeistert er sich daran, die geringfügigsten Unterschiede im Immergleichen der Landschaft und des Tropenalltags zu beschreiben. Dabei behält er stets die sozialen Verhältnisse, die Menschen und ihre Eigenarten, ihre Gewohnheiten und Bräuche im Blick: Es ist eine Welt blühenden Niedergangs nach einer langen und leidvollen Geschichte kolonialer Verwerfungen.Hearn will bewahren, was er sieht, weil er weiß, dass es nicht von Dauer ist. Nach Abschluss seines Reiseberichts kehrt er für knapp zwei Jahre nach St. Pierre, Martinique, zurück. 15 Jahre später, da lebt er längst in Japan, ist das "Paris der Karibik" nach einem Vulkanausbruch fast vollständig zerstört.
Sie lesen das E-Book in den Legimi-Apps auf:
Seitenzahl: 152
Veröffentlichungsjahr: 2018
Das E-Book (TTS) können Sie hören im Abo „Legimi Premium” in Legimi-Apps auf:
Sammlungen
Ähnliche
Die Originalausgabe mit dem Titel »A Midsummer Trip to the Tropics«
erschien 1888 in Harper’s New Monthly Magazine
© 2018 Jung und Jung, Salzburg und Wien
Alle Rechte vorbehalten
Coverfoto: Martinique, une rue Est-Ouest à Fort-de-France (Déc. 1894)
© Société de Géographie / BnF - Cartes et Plans
Umschlaggestaltung: BoutiqueBrutal.com
eISBN 978-3-99027-165-0
LAFCADIO HEARN
Die Inseln über dem Winde
Eine Sommerreise
aus dem Englischen übersetztund herausgegeben vonAlexander Pechmann
»Die Inseln über dem Winde« besteht zum großen Teil aus Notizen, aufgezeichnet während einer weniger als zwei Monate langen Reise über fast dreitausend Meilen. Einem Autor, der so hastig unterwegs ist, ist es kaum möglich, etwas Ernsteres zu Papier zu bringen, als bloß über seine persönlichen Erfahrungen nachzudenken; und, trotz diverser berechtigter Abweichungen vom einfachen Notizenmachen, soll dieser Bericht nur ein Versuch darstellen, die visuellen und emotionalen Eindrücke des Augenblicks festzuhalten.
L. H.
Inhalt
Kapitel I
Kapitel II
Kapitel III
Kapitel IV
Kapitel V
Kapitel VI
Kapitel VII
Kapitel VIII
Kapitel IX
Kapitel X
Kapitel XI
Kapitel XII
Kapitel XIII
Kapitel XIV
Kapitel XV
Kapitel XVI
Kapitel XVII
Kapitel XVIII
Kapitel XIX
Kapitel XX
Kapitel XXI
Kapitel XXII
Kapitel XXIII
Kapitel XXIV
Kapitel XXV
Kapitel XXVI
Kapitel XXVII
Kapitel XXVIII
Kapitel XXIX
Kapitel XXX
Kapitel XXXI
Kapitel XXXII
Kapitel XXXIII
Anmerkungen
Nachwort Ein Sommer in den Tropen
Editorische Notiz
I
… Ein langer, schmaler, anmutiger Stahldampfer mit zwei Masten und einem orange-gelben Rauchfang – am East River Pier 49 wird er beladen. Durch seine klaffenden Frachtluken sieht man auf berghoch aufgestapelte Fässer hinab; – unentwegt rumpeln und rattern Dampfwinden, Ladebäume knirschen, Taljen stöhnen, während die Fracht an Bord geholt wird. Ein windstiller Julimorgen und eine ungeheure Hitze – schon 30° Celsius.
Das Saloondeck weckt Vorstellungen von vergangenen und zukünftigen Reisen. Unter den weißen Sonnensegeln stehen verstreut lange Klubsessel – ein jeder besetzt, der eine mit einem still rauchenden Passagier, der andere mit einem dösenden, dessen Kopf sich zur Seite neigt. Ein junger Mann, der erwacht, als ich an ihm vorbei zu meiner Kabine gehe, sieht mich mit seltsam leuchtenden schwarzen Augen an – kreolischen Augen. Offenkundig aus der Karibik …
Der Morgen ist immer noch grau, doch die Sonne lichtet den Dunst. Das Grau verschwindet allmählich, und ein schönes, blasses, nebliges Blau – ein beseeltes nordisches Blau – färbt Wasser und Himmel. Ein Kanonenschuss lässt plötzlich die drückende Luft erbeben: unser Lebewohl an die amerikanische Küste; – wir bewegen uns. Der Kai fällt hinter uns zurück und verschwimmt in bläulichem Dunst. Durchscheinende Nebel scheinen die Farbe des Himmels eingefangen zu haben; und selbst die großen roten Lagerhäuser nehmen einen blassblauen Farbton an, als sie zurückfallen. Der Horizont zeigt nun ein grünliches Glühen. Überall sonst wirkt es, als würde man durch sehr hellblaue Augengläser blicken …
Wir tuckern unter dem kolossalen Bogen der gewaltigen Brücke durch; dann, für eine kurze Weile, ragt Lady Liberty über unserem Kurs auf – sie scheint sich uns zunächst zuzuwenden, dann die ernste Schönheit ihres leidenschaftslosen Bronzegesichts abzuwenden. Die Farben hellen sich auf – der Himmel leuchtet ein wenig blauer. Eine Brise kommt auf …
Dann nimmt das Wasser einen anderen Farbton an: hellgrüne Lichter funkeln darin. Es hat zu klingen begonnen. Kleine Wellen heben ihre Häupter, als ob sie uns anblicken möchten – beklopfen die Schiffswand und flüstern einander zu.
In weiter Ferne beginnt die Oberfläche hier und da plötzlich weiße zu blitzen, und der Dampfer beginnt zu schaukeln … Wir nähern uns den Wassern des Atlantik. Die Sonne steht nun hoch am Horizont, fast direkt über uns: Da stehen ein paar wenige dünne Wolken am sanft gefärbten Firmament – seidige, langgezogene weiße Gebilde. Der Horizont hat sein grünliches Glühen verloren: Es ist ein gespenstisches Blau. Masten, Spiere, Takelage – die weißen Beiboote und der orange Rauchfang – die hellen Decklinien und die schneeweiße Reling – zeichnen sich in einem fast schwindelerregenden Relief vor dem farbigen Licht ab. Obwohl die Sonne heiß herniederbrennt, ist der Wind kalt: seine starken, unregelmäßig fächernden Böen sorgen für eine gewisse Ermattung. Ebenso der schläfrige Gesang der Maschinen – do-do, hey! do-do, hey! –, der einen einlullt.
… Gegen Abend schwindet die graugrüne Färbung des Meeres – das Wasser wird blau. Es ist voller großer Blitze, als würden sich Nähte über einer weißen Fläche öffnen und schließen. Es spuckt Gischt in einem ununterbrochenen Sprühregen. Manchmal greift es nach oben und schlägt gegen die Schiffswand, was wie der Schlag einer großen nackten Hand klingt. Der Wind wird zunehmend stürmisch. Frei hängende Tauenden schnalzen wie Peitschen. Da ist ein ungeheures Brummen, das jedes Wort übertönt – ein Brummen, das aus vielerlei Geräuschen besteht: das Heulen der Taljen, das Surren der Taue, das Knattern und Flattern der Leinwand, das Brüllen von Netzwerk im Wind. Und dieses sonore Durcheinander, das stetig lauter wird, hat Rhythmus – ein Crescendo und Diminuendo,1 dessen Takt das regelmäßige Schaukeln des Dampfers vorgibt: wie eine laute Stimme, die »Hu-oh-oh! Hu-oh-oh!« ruft. Wir nähern uns den Lebenszentren der Winde und Strömungen. An Deck kommt man gegen den ständig stärker werdenden Wind kaum an – doch nun ist die ganze Welt blau – man sieht nicht die kleinste Wolke; und die vollkommene Durchsichtigkeit und Leere ringsum lässt die gewaltige Kraft dieses unsichtbaren Elements beinah geisterhaft und entsetzlich erscheinen … Das Log heult bei jeder Umdrehung, heult exakt wie ein Hundewelpen; – man kann es durch all das Getöse noch ganze vierzig Fuß entfernt hören.
… Bald geht die Sonne unter. Den ganzen Tag lang sind wir nach Süden getuckert. Nun ist der Horizont goldgrün. Rund um die sinkende Sonne erreicht das goldgrüne Licht eine unfassbare Ausdehnung … Genau am Rand des Meeres segelt ein großes, anmutiges Schiff auf den Sonnenuntergang zu. Als es das dunstige Feuer einfängt, scheint es sich in ein Phantom zu verwandeln – ein Schiff aus goldenem Nebel: all seine Spieren und Segel leuchten auf und erinnern an Dinge, die man in Träumen gesehen hat.
Immer röter werdend, versinkt die Sonne im Meer. Das Phantomschiff nähert sich ihr – berührt den Rand ihrer glühenden Scheibe, segelt direkt hindurch! Oh, die gespenstische Pracht dieses Anblicks! Das ganze große Schiff unter vollen Segeln bildet sogleich eine scharfe Silhouette vor der monströsen Scheibe – ruht dort, genau in der Mitte der zinnoberroten Sonne. Ihr Antlitz rötet sich hoch über seinen Mastspitzen – dehnt sich weit über Ruderpinne und Bugspriet hinaus. Vor dieser unheimlichen Pracht verändert seine ganze Gestalt ihre Farbe: Rumpf, Masten und Segel werden schwarz – grünlich schwarz.
Sonne und Schiff sind nach einer Minute gemeinsam verschwunden. Violett kommt die Nacht; und die Takelage des Fockmasts schneidet ein Kreuz in das Gesicht des Mondes.
II
Morgen: der zweite Tag. Das Meer ist von außergewöhnlichem Blau – mir kommt es vor wie violette Tinte. In der Nähe des Schiffs, wo die Gischtwolken aufsteigen, ist es schön gesprenkelt – sieht aus wie blauer Marmor mit feinster Maserung und Nebelflecken … Lauer Wind und weiße Wattebauschwolken – Zirren steigen ringsum über den Rand der See. Der Himmel ist immer noch blassblau, und der Horizont ist voll von weißlichem Dunst.
… Ein freundlicher alter französischer Gentleman aus Guadeloupe wagt zu behaupten, dass dies kein blaues Wasser sei; – er nennt es grünlich (verdâtre). Da ich kein Grün erkennen kann, erklärt er mir, ich wisse nicht, was blaues Wasser ist. Attendez un peu!2 …
… Die Färbung des Himmels wird tiefer, während die Sonne aufgeht – herrlich tiefer. Der warme Wind erweist sich als schlaffördernd. Ich schlafe ein mit dem blauen Licht auf meinem Gesicht – dem starken Hellblau des Mittagshimmels. Während ich döse, scheint es wie kaltes Feuer direkt durch meine Augenlider zu brennen. Als ich aufschrecke, stelle ich mir vor, dass alles blau wird – ich eingeschlossen. »Würden Sie das nicht als das wahre tropische Blau bezeichnen?«, rufe ich meinem französischen Mitreisenden zu. »Mon dieu! Non«3, ruft er, als wäre er über die Frage verwundert – »das ist kein Blau!« … Ich frage mich, was wohl seine Vorstellung von Blau sein mag!
Klumpen Sargasso treiben vorbei – hellgelber Seetang. Wir nähern uns dem Sargasso-Meer – betreten den Pfad der Passatwinde. Hier gibt es eine lange Grunddünung, der Dampfer stampft und schlingert, und das aufgewühlte Wasser scheint mir immer blauer zu werden; doch mein Freund aus Guadeloupe sagt, dass die Farbe, »die ich blau nenne«, nichts als Dunkelheit sei – nichts als der Schatten einer ungeheuren Tiefe.
Nun nichts als blauer Himmel und das, was ich beharrlich blaues Meer nenne. Die Wolken sind im hellen Glanz dahingeschmolzen. In der azurblauen Weite über mir und dem Abgrund unter mir gibt es kein Zeichen von Leben – man sieht weder Schwingen noch Flossen. Gegen Abend, unter dem schräg einfallenden goldenen Licht, verdunkelt sich die Farbe des Meeres zu Ultramarin; dann versinkt die Sonne hinter einer kupferroten Wolkenbank.
III
Der Morgen des dritten Tages. Derselbe milde, warme Wind. Strahlend blauer Himmel, mit einigen sehr dünnen Wolken am Horizont – wie Dampfwölkchen. Die Glut des Meereslichts durch die offenen Luken meiner Kabine verleiht den Wolken den Anschein, mit dickem blauem Glas bestückt zu sein … Es wird zu warm für New Yorker Garderobe …
Das Meer ist gewiss viel blauer geworden. Man denkt bei seinem Anblick an verflüssigten Himmel; die Gischt könnte von zusammengeballten Zirruswolken gebildet worden sein – so überirdisch weiß sieht sie heute aus, wie Schnee in der Sonne. Nichtsdestotrotz beharrt der alte Gentleman aus Guadeloupe, dies sei nicht das echte Blau der Tropen!
… Der Farbton des Himmels wird heute nicht tiefer: er wird heller; – das Blau glüht, als wäre es von Feuer durchdrungen. Vielleicht verdunkelt sich das Meer; – ich glaube nicht, dass es eine noch leuchtendere Farbe annehmen kann, ohne in Flammen aufzugehen … Ich frage den Schiffsarzt, ob es denn wirklich wahr sei, dass die westindischen Gewässer noch blauer sind als diese hier. Er blickt kurz auf das Meer und erwidert: »Oh ja!« In seinem »Oh« liegt so viel Überraschung, dass man meinen könnte, ich hätte eine sehr dumme Frage gestellt; und sein Blick scheint Zweifel auszudrücken, ob ich es ernst meine … Ich bin dennoch der Meinung, dass dieses Wasser außergewöhnlich, irrwitzig blau ist!
… Ich lese ein, zwei Stunden; schlafe im Sessel ein; erwache plötzlich, blicke aufs Meer – und schreie auf! Dieses Meer ist unmöglich blau! Den Maler, der es zu malen versucht, würde man als verrückt abstempeln … Dennoch ist es durchsichtig; die Gischtwolken werden himmelblau, während sie hinabsinken – ein Himmelblau, dass nun im Kontrast zur seltsamen und violetten Pracht der Meeresfarbe weiß wirkt. Es scheint, als würde man in einen unermesslichen Färbkessel blicken oder als ob der gesamte Ozean mit Indigo verdickt worden wäre. Zu behaupten, dies sei eine bloße Spiegelung des Himmels, ist Unsinn! – der Himmel ist dazu um hundert Schattierungen zu blass! Dies muss die natürliche Farbe des Wassers sein – ein flammendes Azurblau – herrlich, unmöglich zu beschreiben.
Der französische Passagier aus Guadeloupe bemerkt, das Meer werde »allmählich blau«.
IV
Und der vierte Tag. Man erwacht unbeschreiblich faul; – dies muss die westindische Trägheit sein. Derselbe Himmel, mit ein paar hellen Wolken mehr als gestern; – stets weht der warme Wind. Es gibt eine lange Dünung. Unter dieser Passatbrise, warm wie menschlicher Atem, scheint der Ozean zu pulsieren – sich mit einem ungeheuren Ein- und Ausatmen zu heben und zu senken. Sein blauer Kreis hebt und senkt sich abwechselnd vor und hinter uns; – wir steigen sehr hoch; wir sinken sehr tief – doch immer mit einer langsamen, langgezogenen Bewegung. Trotzdem sieht das Wasser glatt aus, vollkommen glatt; die Wogen, die uns heben, sind nicht zu sehen – dies deshalb, weil die Wogenkämme sich über eine Meile erstrecken; – zu weit, als dass man sie von der Höhe unseres Decks aus sehen könnte.
… Zehn Uhr vormittags – Das Meer brennt unter der Sonne, blendender Lazulith. Mein französischer Freund aus Guadeloupe räumt freundlich ein, dass dies beinah die Farbe tropischer Gewässer sei … Seetang treibt vorbei, knapp unter der Oberfläche färbt er sich azurblau. Doch der Gentleman aus Guadeloupe sagt, er habe noch blaueres Wasser gesehen. Es tut mir leid – ich kann ihm nicht glauben.
Mittag. – Die Pracht des Himmels ist unheimlich! Keine Wolken über mir – nur blaues Feuer! Über der warmen dunklen Farbe des Meereskreises glüht der Rand des Himmels wie in grünliche Flammen getaucht. Der schwankende Kreis des prangenden Meeres scheint den Zenit mit seinen funkelnden Juwelenfarben zu überziehen.
Kleidung fühlt sich nun fast zu schwer an, um sie zu ertragen; und der warme Wind bringt eine verlockende Trägheit mit sich … Man spürt einen unwiderstehlichen Wunsch, an Deck zu dösen – die rauschende Sprache der Wellen, das lange Schaukeln des Schiffes, die lauwarme Umarmung des Windes, drängen zum Schlummern; – doch das Licht ist zu gewaltig, es gestattet keinen Schlaf. Seine blaue Kraft erzwingt Wachheit. Und schließlich wird das Hirn dieser verdoppelten azurnen Herrlichkeit von Himmel und See überdrüssig. Wie gnädig besucht uns der Abend – mit seinen violetten Dunkelheiten und Versprechungen von Kühle!
Dieses ganze sinnliche Verschmelzen von Wärme und Kraft in Winden und Wassern, weckt mehr und mehr eine Vorstellung von beseelten Elementen – ein Gefühl von Weltleben. In all diesen sanften schläfrigen Schaukelbewegungen, diesen Umarmungen des Windes und dem Schluchzen der Wasser scheint die Natur eine leidenschaftliche Stimmung einzugestehen. Passagiere sprechen über freundliche, verlockende Dinge – tropische Früchte, tropische Getränke, tropische Bergbrisen, tropische Frauen … Es ist eine Zeit für Träume – jene Tagträume, die so sanft wie Nebel kommen, mit einer magischen Erfüllung von Hoffnungen, Wünschen, ehrgeizigen Zielen … Männer, die zu den Minen Guianas segeln, träumen von Gold.
Der Wind scheint ständig wärmer zu werden; die Gischt fühlt sich warm an wie Blut. Sonnensegel müssen aufgegeit und Windsegel eingeholt werden – immer noch keine weißen Schaumkronen – nur die gewaltigen Wogen, deren Anfang und Ende unsichtbar bleiben, während der Ozean sich hebt und senkt wie die Brust eines Träumers …
Der Sonnenuntergang kommt mit einem großen, brennenden, gelben Glühen, das zu hellen Grüntönen erblasst, bis es sich in violettem Licht verliert; – es gibt keine Dämmerung. Die Tage sind bereits kürzer geworden … Durch die offenen Luken dringt ein erhabenes Flüstern zu uns, als wir uns schlafen legen – das Flüstern der Meere: Geräusche wie von leisen Gesprächen – wie von Frauen, die Geheimnisse austauschen …
V
Fünfter Tag auf See. Passatwinde aus Südost; ein ungeheures Wälzen von bergspurpurnen Wellen; – der Dampfer krängt unter vollen Segeln. Der Wind hat heute etwas Frühlingshaftes – etwas, was einen an das Austreiben nördlicher Wälder denken lässt, wenn die kahlen Bäume sich erst mit einem Nebel aus zartem Grün bedecken – etwas, das an erstes Vogelgezwitscher erinnert, an das erste Aufsteigen des Safts zur Sonne und ein Gefühl von Lebensfülle vermittelt.
… Der Abend füllt den Westen mit vergoldeten Schäfchenwolken – ihre Wolle ist das Goldene Vlies. Dann erstrahlt Hesperus wie ein zweiter Mond, und die Sterne leuchten sehr hell. Immer noch beugt sich das Schiff unter dem gleichmäßigen Druck des warmen Winds in den Segeln; und sein Kielwasser wird zu einem Pfad aus Feuer. Große Funken werden ständig durch ihn hindurch geschleudert, wie beim Auflodern einer Flamme; – und seltsam breite Wolken aus blassem Feuer wirbeln vorbei. Weit draußen, wo das Wasser pechschwarz ist, gibt es keine Lichter: Es scheint, als bringe der Dampfer unter seinem schleifenden Kiel nur mühsam Funken hervor, als entfache er mit seiner Schiffsschraube Feuer.
VI
Sechster Tag auf See. Wind lauwarm und noch stärker, aber Himmel sehr klar. Ein indigoblaues Meer mit schönen weißen Wellenkämmen. Die Farbe des Ozeans wird dunkler: sie ist nun sehr kräftig, mir aber erscheint sie nicht ganz so wundervoll wie zuvor – eine üppige Stiefmütterchenfarbe. Nah am Schiff wirkt sie schwarzblau; – die Farbe, die in gewissen keltischen Augen bezaubert.
Es liegt etwas Fiebriges in der Luft; – die Hitze wird drückend; bei der geringsten Anstrengung bricht man in Schweiß aus; unter Deck ist die Luft heiß wie in einem Backofen. Oben an Deck ist die Wirkung von all dem Licht und der Hitze nicht ganz und gar unangenehm; – man spürt, dass gigantische Elementarkräfte in unmittelbarer Nähe walten und dass das Blut ihr Aufziehen bereits bemerkt hat.
Den ganzen Tag der makellose Himmel, die dunkler werdende Farbe des Meeres, der lauwarme Wind. Dann kommt ein herrlicher Sonnenuntergang! Im Westen ist ein Gemälde, geschaffen aus Wolkenfarben – ein Traum von hohen karminroten Klippen und Felsen, die in ein grünes Meer ragen, das ihre Füße mit goldener Gischt peitscht …
Selbst nach Einbruch der Dunkelheit ist der Wind so warm wie Menschenhaut. Kein Mond scheint; der Meereskreis ist schwarz wie Acheron;4 und unser phosphoreszierendes Kielwasser kehrt wieder, ihn zitternd durchschneidend – es scheint gar bis zum Horizont zu reichen. Heute ist es heller – es sieht aus wie eine zweite Via Lactea5 – deren Enden es durchbricht wie Sterne in einem Sternennebel. Von unserem Bug fliehen unablässig kleine, mit Feuer besetzte Wellen nach links und rechts in die Nacht – werden davoneilend heller, verschwinden dann plötzlich, als wären sie über eine Klippe gestürzt. Wellenkämme scheinen zu Funkenschauern zu zerbersten; und große Flächen aus Gischt fangen Feuer, verglühen und vergehen … Das Kreuz des Südens ist zu sehen – nach hinten und zur Seite geneigt, als würde es am Himmelsgewölbe lehnen; das ungeübte Auge kann es nicht einfach erkennen; erst nachdem man es gezeigt bekommen hat, sieht man seine Position. Dann stellt man fest, dass es nur die Andeutung eines Kreuzes ist – vier Sterne, die fast ein Viereck bilden, einige heller als andere.
Zwei Tage lang wurde an Bord nur wenig gesprochen. Es mag zum Teil an der einschläfernden Wirkung des warmen Windes gelegen haben – zum Teil am unablässigen Tosen der Wasser und am Brüllen der Takelage, in denen menschliche Stimmen untergehen; doch ich bilde mir ein, dass es vielmehr an den Eindrücken von Raum und Tiefe und Weite liegt – den Eindrücken von Meer und Himmel, die etwas wie Ehrfurcht erzwingen.
VII
Morgendämmerung über dem Karibischen Meer – einem ruhigen, äußerst dunkelblauen Meer. Küsten sind zu sehen – hohe Küsten, mit scharfen, spitzen, fremdartigen Umrissen.