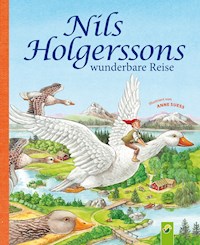1,99 €
Mehr erfahren.
- Herausgeber: Booksell-Verlag
- Kategorie: Religion und Spiritualität
- Sprache: Deutsch
- Veröffentlichungsjahr: 2023
In "Christuslegenden für Weihnachten" entführt die schwedische Nobelpreisträgerin Selma Lagerlöf die Leser in eine lyrisch-religiose Welt, in der sich biblische Geschichten mit folkloristischen Elementen vermischen. Die Erzählung zeichnet sich durch ihre poetische Sprache und die tiefgründige Auseinandersetzung mit dem christlichen Glauben aus. Lagerlöf gelingt es, die biblischen Legenden mit einer ergreifenden Emotionalität und bildhaften Kraft zu versehen, die die zeitlose Botschaft von Weihnachten in neuem Licht erscheinen lässt. In einem feierlichen Stil transportiert sie die universellen Themen von Liebe, Hoffnung und Erlösung in eine zugängliche und ansprechende Form, die sowohl Kinder als auch Erwachsene anspricht. Selma Lagerlöf, geboren 1858 in Schweden, war nicht nur eine bedeutende Schriftstellerin, sondern auch eine leidenschaftliche Verfechterin sozialer und feministischer Themen. Ihre eigene Erfahrung mit Glaubenskrisen und der schwedischen Kultur der Neuen Aufklärung prägten ihr literarisches Schaffen maßgeblich. Die Inspiration für die "Christuslegenden" fand sie in ihrer tiefen Verbundenheit zu den skandinavischen Traditionen und ihrer unerschütterlichen Suche nach spirituellen Antworten in einer modernen Welt. Lagerlöfs Werk ist eine wunderbare Einladung, Weihnachten in seiner ursprünglichen Bedeutung zu reflektieren. Von der tiefen Menschlichkeit der Figuren bis zu den berührenden moralischen Fragen bietet das Buch eine wertvolle Perspektive auf die Weihnachtsbotschaft. Es eignet sich hervorragend für Leser, die sowohl die literarische Qualität als auch die spirituelle Tiefe schätzen und sich auf eine besinnliche und nachdenkliche Reise in die Welt der Christlichen Legenden begeben möchten.
Das E-Book können Sie in Legimi-Apps oder einer beliebigen App lesen, die das folgende Format unterstützen:
Ähnliche
Christuslegenden für Weihnachten
Inhaltsverzeichnis
Die heilige Nacht
Als ich fünf Jahre alt war, hatte ich einen großen Kummer. Ich weiß kaum, ob ich seither einen schwereren erlitten habe.
Es war damals, als meine Großmutter starb. Tag für Tag hatte sie bis dahin in ihrem Zimmer auf dem Ecksofa gesessen und Märchen erzählt.
Ich kann es mir gar nicht anders vorstellen, als daß Großmutter dasaß und vom Morgen bis zum Abend erzählte und erzählte, während wir Kinder ganz still neben ihr saßen und lauschten. Es war ein herrliches Leben. Und es gab keine Kinder, die es so schön hatten wie wir. Sonst weiß ich nicht mehr viel von meiner Großmutter. Ich entsinne mich nur, daß sie schönes, schlohweißes Haar hatte, daß sie mit tiefgebeugtem Rücken einherging, und daß sie immer dasaß und an einem Strumpf strickte.
Auch entsinne ich mich, daß sie immer, wenn sie ein Märchen erzählt hatte, ihre Hand auf meinen Kopf legte und dabei sagte: »Und all dies ist so wahr, wie ich Dich sehe und wie Du mich siehst.«
Dabei fällt mir auch noch ein, daß sie Lieder singen konnte. Das tat sie jedoch nicht alle Tage. Eine dieser Volksweisen handelte von einem Ritter und einem Meerweib, und der Kehrreim lautete: »Es stürmt der Wind so eisig kalt auf Meereswellen hin.«
Und dann erinnere ich mich auch noch eines kleinen Gebetes, das sie mich lehrte, und ein Psalmenvers kommt mir in den Sinn. An all die schönen Märchen, die sie mir erzählte, habe ich nur eine schwache, verworrene Erinnerung. Nur einer einzigen Geschichte entsinne ich mich so gut, daß ich sie nacherzählen könnte. Es ist eine kleine Geschichte von Jesu Geburt.
Seht, das ist nun fast alles, was ich noch von meiner Großmutter weiß, ausgenommen das eine, dessen ich mich am besten entsinne, und das war die schmerzliche Sehnsucht, die ich empfand, als sie von uns gegangen war. Ich erinnere mich noch jenes Morgens, an dem das Ecksofa plötzlich leer dastand, und wie unbegreiflich es uns erschien, daß die Stunden jenes Tages ein Ende nehmen könnten. Dessen entsinne ich mich. Das werde ich niemals vergessen.
Und ich erinnere mich, daß wir Kinder hereingeführt wurden, um die Hand der Toten zu küssen. Wir fürchteten uns davor, aber da sagte uns jemand, es sei das letzte Mal, daß wir Großmutter für alle Freude danken könnten, die sie uns gespendet hatte.
Und ich erinnere mich, wie Märchen und Lieder, in einem langen, schwarzen Sarge verpackt, vom Gutshof wegführen und niemals zurückkehrten.
Ich erinnere mich, daß uns damals etwas aus dem Leben unwiederbringlich entschwunden war. Es war, als hätte sich die Pforte einer ganzen herrlichen Zauberwelt geschlossen, in der wir zuvor frei ein-und ausgehen konnten. Und nun war niemand mehr, der sich darauf verstand, diese Pforte zu öffnen.
Ich erinnere mich, daß wir Kinder ganz allmählich lernten, mit Puppen und Spielzeug zu spielen und wie andere Kinder zu leben – und das mochte wohl so aussehen, als entbehrten wir Großmutter gar nicht mehr, oder als erinnerten wir uns ihrer nicht.
Aber noch heutigen Tages, nach vierzig Jahren, wie ich nun dasitze und diese Legenden über Christus sammle, die ich im fernen Morgenlande vernommen habe, ersteht in meinem Inneren die kleine Geschichte von Jesu Geburt, die meine Großmutter zu erzählen pflegte. Und ich verspüre Lust, sie noch einmal zu erzählen und in meine Legendensammlung aufzunehmen.
Es war ein Weihnachtstag, an dem alle, außer Großmutter und mir, zur Kirche gefahren waren. Ich glaube, daß wir im ganzen Hause allein waren. Wir hatten nicht mitfahren können, weil die eine zu jung und die andere zu alt war. Und wir waren beide ganz traurig darüber, daß wir nicht zur Frühmette fahren und die Weihnachtskerzen nicht sehen konnten. Als wir aber so in unserer Einsamkeit dasaßen, begann Großmutter zu erzählen:
»Es war einmal ein Mann, der in die dunkle Nacht hinausging, um sich etwas Feuersglut zu holen. Er ging von Hütte zu Hütte und klopfte an jede Tür, ›Helft mir, Ihr lieben Leute!‹ sagte er. ›Mein Weib ist eben eines Kindleins genesen, und ich muß Feuer anzünden, um sie und das Kindlein zu erwärmen.‹
Aber es war tiefe Nacht, so daß alle Menschen fest schliefen. Niemand antwortete ihm.
Der Mann ging immer weiter. Schließlich gewahrte er in weiter Ferne einen hellen Feuerschein. Er wanderte in dieser Richtung fort und sah, daß das Feuer im Freien brannte. Eine Menge weißer Schafe lagerte schlafend ringsumher, und ein alter Hirt saß daneben und bewachte die Herde.
Als der Mann, der das Feuer holen wollte, die Schafe erreicht hatte, sah er, daß drei große Hunde schlafend zu des Hirten Füßen lagen. Bei seinem Kommen erwachten sie alle drei und sperrten ihre weiten Rachen auf, als ob sie bellen wollten, man vernahm jedoch keinen Laut. Der Mann sah, daß sich die Haare auf ihrem Rücken sträubten, er sah, daß ihre spitzen Zähne im Feuerschein weißleuchtend aufblitzten, und er sah auch, daß sie auf ihn zustürzten. Er fühlte, daß einer ihn ins Bein biß, der zweite nach seiner Hand schnappte und der dritte ihm an die Kehle sprang. Aber die Kinnladen und die Zähne, mit denen die Hunde ihn beißen wollten, gehorchten nicht, und der Mann erlitt nicht den geringsten Schaden.
Nun wollte er vorwärts gehen, um zu holen, was er brauchte. Aber die Schafe lagen Rücken an Rücken so dicht gedrängt, daß er nicht vorwärts kam. Und der Mann schritt über die Rücken der Tiere zum Feuer hin. Aber keines erwachte oder bewegte sich.«
Bis dahin hatte Großmutter ungestört erzählen können, länger jedoch vermochte ich nicht an mich zu halten, ohne sie zu unterbrechen. »Weshalb taten sie es nicht, Großmutter?« fragte ich. »Das wirst Du bald erfahren,« sagte Großmutter und erzählte weiter.
»Als der Mann schon beim Feuer angelangt war, blickte der Hirt auf. Er war ein alter, heftiger Mann, unfreundlich und hart gegen alle Menschen. Als er nun einen Fremden nahen sah, griff er nach einem langen, spitzen Stabe, den er in der Hand zu halten pflegte, wenn er seine Herde weiden ließ, und schleuderte ihn nach dem Manne. Der Stab flog sausend gerade auf ihn zu, aber ehe er ihn treffen konnte, wich er zur Seite und flog an ihm vorbei ins Feld hinaus.«
Als Großmutter so weit gekommen war, unterbrach ich sie nochmals. »Großmutter, warum wollte der Stecken den Mann nicht treffen?« Aber Großmutter kümmerte sich um meine Frage gar nicht, sondern fuhr in ihrer Erzählung fort.
»Nun kam der Mann auf den Hirten zu und sprach zu ihm: ›Lieber, hilf mir und laß mich etwas von Deiner Feuersglut nehmen! Mein Weib ist eben eines Kindleins genesen, und ich muß Feuer anzünden, um sie und das Kindlein zu erwärmen.‹
Der Hirt hätte es ihm am liebsten abgeschlagen, aber er dachte daran, daß seine Hunde diesem Manne keinen Schaden hatten zufügen können, daß die Schafe nicht vor ihm davongelaufen waren, und daß sein Stab ihn nicht hatte hinstrecken wollen. Da wurde ihm etwas bänglich zumute, und er wagte nicht, ihm die Bitte abzuschlagen. ›Nimm so viel Du brauchst!‹ sagte er zu dem Manne.
Das Feuer war jedoch fast gänzlich niedergebrannt. Weder Holzscheite noch Zweige waren vorhanden, nur ein großer Gluthaufen lag da, und der Fremde hatte weder Schaufel noch Eimer, um darin die rotglühenden Kohlen heimzutragen.
Als der Hirt dies sah, sprach er abermals: ›Nimm so viel Du brauchst!‹ Und er freute sich, daß der Mann nicht imstande sein würde, die Glut mitzunehmen.
Aber der Mann beugte sich nieder, las mit bloßen Händen die glühenden Kohlen aus der Asche und wickelte sie in seinen Mantel. Und die Kohlen versengten ihm weder Hände noch Mantel, und der Mann trug sie davon, als wären es Aepfel und Nüsse.«
Aber hier unterbrach ich die Märchenerzählerin zum drittenmal. »Großmutter, warum wollten die Kohlen den Mann nicht verbrennen?«
»Das wirst Du noch erfahren,« sagte Großmutter und erzählte weiter.
»Als jener Hirt, der ein so böser und heftiger Mensch war, all dies sah, fragte er sich selber verwundert: ›Was kann das für eine Nacht sein, da die Hunde nicht beißen, die Schafe sich nicht fürchten, der Speer nicht tötet und das Feuer nicht versengt?‹ Er rief den Fremden zurück und sprach zu ihm: ›Was ist das für eine Nacht? Und wie kommt es, daß alle Dinge Dir Barmherzigkeit zeigen?‹
Da sprach der Mann: ›Das kann ich Dir nicht sagen, wenn Du es nicht selber erkennst.‹ Und wollte seines Weges gehen, um bald ein Feuer anzuzünden und sein Weib und Kind erwärmen zu können.
Der Hirt aber dachte, er wolle den Mann nicht ganz aus dem Gesicht verlieren, ehe er erführe, was all dies zu bedeuten habe. Er stand auf und ging ihm nach, bis er dorthin kam, wo der Fremde hauste.
Da sah der Hirt, daß der Mann nicht einmal eine Hütte besaß, um darin zu wohnen, sondern sein Weib und Kind lagen in einer Felsenhöhle, die nur nackte, kalte Steinwände hatte. Und der Hirt dachte, daß das arme unschuldige Kind vielleicht in dieser Höhle erfrieren und sterben würde, und obwohl er ein hartherziger Mann war, rührte ihn dieses Elend, und er sann nach, wie er dem Kinde helfen könnte. Er löste seinen Ranzen von der Schulter und nahm daraus ein weiches, weißes Schaffell, gab es dem fremden Manne und sagte, er solle das Kindlein darauf betten.
Aber sobald er gezeigt hatte, daß auch er barmherzig sein konnte, wurden ihm die Augen geöffnet, und er sah, was er zuvor nicht wahrgenommen hatte, und hörte, was zuvor seinen Ohren verschlossen war:
Er sah, daß er inmitten einer dichten Schar kleiner, silberbeschwingter Engel stand, die einen Kreis um ihn bildeten. Und jedes Englein hielt ein Saitenspiel, und alle sangen mit jubelnder Stimme, daß in dieser Nacht der Heiland geboren sei, der die ganze Welt von ihren Sünden erlösen würde.
Da verstand er, weshalb sogar alle leblosen Dinge in dieser Nacht so froh waren, daß sie niemandem etwas zuleide tun mochten.
Und nicht nur rings um den Hirten waren Engel, überall gewahrte er sie. Sie saßen in der Felsenhöhle, und sie saßen draußen auf den Bergen, auch unter dem Himmel flogen sie hin und her. Sie kamen in großen Scharen auf den Wegen dahergewandelt, und wenn sie vorbeischritten, blieben sie stehen und warfen einen Blick auf das Kindlein in der Höhle.
Jubel und Freude, Sang und Spiel waren allüberall, und der Hirt sah es in der dunkeln Nacht, in der er sonst nichts hatte wahrnehmen können. Voll Freude, daß seine Augen geöffnet waren, sank er auf die Knie und lobete Gott.«
Und als Großmutter so weit gekommen war, seufzte sie und sprach: »Aber was der Hirt sah, das könnten wir auch sehen, denn die Engel fliegen in jeder Weihnachtsnacht unter dem Himmel einher, wenn wir sie nur zu erkennen vermögen.«
Und dann legte Großmutter ihre Hand auf meinen Scheitel und sprach: »Dessen sollst Du eingedenk sein, denn es ist so wahr, wie ich Dich sehe und Du mich siehst. Nicht auf Kerzen und Lampen kommt es an, noch auf Sonne und Mond, sondern was nottut, ist einzig und allein, daß wir die rechten Augen haben, Gottes Herrlichkeit zu sehen.«
Des Kaisers Vision
Es war zu jener Zeit, da Augustus Kaiser in Rom Herodes König in Jerusalem war.
Da geschah es, daß eine sehr bedeutsame und heilige Nacht auf die Erde sich breitete. Es war die schwärzeste Nacht, die man je gesehen hatte, man hätte glauben können, die ganze Erde sei in ein riesiges Kellergewölbe versunken. Unmöglich war es, Wasser von Land zu unterscheiden, und auf den bekanntesten Wegen konnte man sich nicht zurechtfinden. Es konnte auch gar nicht anders sein, denn kein Lichtstrahl drang vom Himmel herab. Alle Sterne waren daheim in ihren Häusern geblieben, und der freundliche Mond hatte sein Antlitz von der Erde abgewandt.
Und ebenso tief wie die Finsternis war die Stille. Die Flüsse hatten ihren Lauf gehemmt, kein Windhauch regte sich, und sogar das Espenlaub hatte aufgehört zu zittern. Wäre man zum Meere hinabgegangen, so hätte man entdeckt, daß die Wellen nicht mehr den Strand umspülten, und wäre man in die Wüste gegangen, so hätte der Sand nicht unter den Füßen geknirscht. Alles war wie versteinert und regungslos, um diese heilige Nacht nicht zu stören. Das Gras wagte nicht zu wachsen, der Tau konnte nicht fallen, und die Blumen getrauten sich nicht, Düfte auszuhauchen.
In dieser Nacht jagten die Raubtiere nicht nach Beute, die Schlangen bissen nicht, die Hunde bellten nicht. Und was noch weit herrlicher war, keines der leblosen Dinge hätte die Heiligkeit der Nacht dadurch entweihen mögen, daß es sich zu einer Uebeltat hergab. Kein Dietrich hätte ein Schloß öffnen können, und kein Messer wäre imstande gewesen, Blut zu vergießen.
In dieser Nacht nun schritt eine kleine Zahl von Menschen aus dem kaiserlichen Palast auf dem Palatin und schlug die Richtung über das Forum nach dem Kapitol ein. Die Ratsherren der Stadt hatten am jüngst verflossenen Tage den Kaiser befragt, ob er Einspruch erheben würde, wenn sie auf Roms geheiligtem Berge einen Tempel für ihn erbauen ließen. Augustus jedoch hatte seine Zustimmung nicht sogleich erteilt. Er wußte nicht, ob es den Göttern wohlgefällig sein würde, daß er einen Tempel neben ihren Altären besäße, und er hatte geantwortet, daß er zuvor seinem Schutzgeist ein nächtliches Opfer darbringen wolle, um den Willen der Götter zu erforschen. Und er war es, der nun, von einigen Getreuen geleitet, sich anschickte, dieses Opfer darzubringen.
Augustus ließ sich in seiner Sänfte tragen, denn er war alt, und das Ersteigen der hohen Treppen des Kapitols wäre ihm beschwerlich gefallen. Er selbst hielt das Vogelbauer mit den Opfertauben. Weder Priester noch Soldaten oder Ratsherren folgten ihm, nur seine nächsten Freunde. Die Fackelträger schritten vor ihm her, um einen Weg durch das nächtliche Dunkel zu bahnen, und hinter ihm gingen Sklaven, die den dreifüßigen Altar, die Messer, das heilige Feuer und alles andere trugen, was zur Opferung notwendig war.
Da der Kaiser unterwegs heiter mit seinen Getreuen plauderte, achtete niemand von ihnen auf die grenzenlose Verschwiegenheit und Stille dieser Nacht. Erst als sie die oberste Terrasse des Kapitols erreicht hatten, dessen leerer Platz für den neuen Tempel ausersehen worden war, wurde ihnen offenbar, daß Ungewöhnliches bevorstehe.
Diese Nacht glich keiner ihrer Schwestern, denn die Kommenden gewahrten oben am Felsenabhang eine höchst seltsame Erscheinung. Anfangs glaubten sie einen uralten, verkrüppelten Olivenbaumstamm zu erkennen, dann meinten sie, es müsse eine steinalte Statue aus dem Jupitertempel auf den Felsen hinausgewandert sein. Schließlich schien ihnen, daß jene Erscheinung nur die alte Sibylle sein könnte.
Nie hatten sie etwas so Altes, Verwittertes und Gigantisches gesehen. Diese greise Frauengestalt wirkte schreckenerregend. Wäre der Kaiser nicht dabei gewesen, so hätten sie ihr Heil in der Flucht gesucht, um zu Hause in ihre Betten zu kriechen. »Das ist jene,« flüsterten sie untereinander, »die der Jahre so viele zählt, wie es Sandkörner an der Küste ihrer Heimat gibt. Weshalb ist sie just in dieser Nacht aus ihrer Höhle hervorgekommen? Was verkündigt sie dem Kaiser und dem Reich, sie, die ihre Prophezeiungen auf das Laub der Bäume niederschreibt und weiß, daß der Wind ihr Orakelwort jenem zuweht, für den es bestimmt ist?«
So entsetzt waren sie, daß sie alle auf die Knie gestürzt wären und die Stirn an den Boden gepreßt hätten, hätte die Sibylle sich auch nur im geringsten bewegt. Sie aber saß da, als wäre alles Leben aus ihr entwichen. Sie kauerte am äußersten Rande des Felsens, hatte die Augen mit der Hand beschattet und spähte in die Nacht hinaus. Als hätte sie den Felsen erklommen, um etwas, das sich in weiter Ferne zutrug, schärfer beobachten zu können, saß sie dort. Sie konnte also in solch einer Nacht dennoch etwas erkennen.
Eben hatten der Kaiser und sein ganzes Gefolge wahrgenommen, welch tiefe Dunkelheit herrschte. Niemand konnte eine Handbreit vor sich etwas sehen. Und welche Stille, welch unergründliches Schweigen! Nicht einmal das dumpfe Murmeln des Tiber war zu vernehmen. Die Luft lastete erstickend auf den Menschen, kalte Schweißtropfen bedeckten ihre Stirn, und steif und kraftlos hingen ihre Hände herab. Sie ahnten, daß sich Grauenvolles ereignen würde.
Niemand jedoch wollte seine Angst verraten, sondern alle versicherten dem Kaiser, daß dies eine gute Vorbedeutung sei: denn die ganze Natur hielte den Atem an, um einen neuen Gott zu empfangen.
Sie mahnten Augustus, sein Opfer zu beschleunigen, und sagten, daß die alte Sibylle sicherlich, um seinen Schutzgeist zu begrüßen, aus ihrer Höhle emporgestiegen sei. Aber in Wirklichkeit war die alte Sibylle so ganz von einer Vision erfüllt, daß sie von der Ankunft des Augustus auf dem Kapitol nichts gemerkt hatte. Ihr Geist war in einem fernen Lande. Dort, so schien es ihr, wanderte sie über eine weite Ebene. In der Finsternis pochte ihr Fuß unaufhörlich gegen Hindernisse, die sie für kleine Erdhügel hielt. Sie beugte sich, mit den Händen tastend, zur Erde. Nein, es waren nicht Erdhügel, sondern Schafe. Sie wandelte zwischen großen Herden schlummernder Schafe dahin.
Jetzt gewahrte sie die Hirtenfeuer. Die brannten inmitten des Feldes, und sie suchte dorthin zu gelangen. Schlafende Hirten hatten sich um die Feuer gelagert, und neben ihnen sah man lange, spitzige Stecken am Boden, mit denen sie ihre Herden gegen die wilden Tiere zu verteidigen pflegten. Aber waren jene kleinen Tiere mit den funkelnden Augen und den buschigen Schwänzen, die dort zum Feuer heranschlichen, nicht Schakale? Und dennoch schleuderten die Hirten nicht ihre Stecken nach ihnen, die Hunde schliefen ruhig weiter, die Schafe flohen nicht, und die Raubtiere streckten sich neben den Menschen zum Schlummer hin.
Das alles sah die Sibylle, aber sie wußte nichts davon, was sich hinter ihr auf dem Gipfel des Berges zutrug. Sie wußte nichts davon, daß man dort einen Altar errichtete, ein Kohlenfeuer entzündete, Weihrauch ausstreute, und daß der Kaiser eine Taube aus dem Vogelbauer nahm, um sie zu opfern. Seine Hände waren jedoch so schlaff, daß er den Vogel nicht festhalten konnte. Die Taube befreite sich mit einem einzigen Flügelschlage, schwang sich empor und verschwand im Nachtdunkel.
Als dies geschah, blickten die Hofherren voller Mißtrauen nach der alten Sibylle hin. Sie glaubten, sie müsse die Urheberin dieses Mißgeschicks sein.
Konnten sie wissen, daß die Sibylle noch immer am Kohlenfeuer der Hirten zu stehen wähnte, und daß sie eben einem leisen Klange lauschte, der bebend durch die todesstille Nacht schwebte? Sie vernahm ihn, lange bevor sie inne ward, daß er nicht von der Erde kam, sondern aus dem Gewölk drang. Endlich hob sie ihr Haupt, und nun sah sie lichte, strahlende Gestalten durch das Dunkel hingleiten. Es waren Scharen kleiner Engel, die lieblich singend und gleichsam suchend über die weite Ebene hin und her flogen.
Indessen die Sibylle dem Engelsang lauschte, bereitete sich der Kaiser zu einem erneuten Opfer. Er wusch sich die Hände, säuberte den Altar und ließ sich die zweite Taube reichen. Aber obwohl er sich jetzt aufs äußerste bemühte, sie festzuhalten, entglitt der geschmeidige Taubenkörper seiner Hand, und der Vogel schwang sich in die undurchdringlich dunkle Nacht empor.
Entsetzen faßte den Kaiser. Vor dem leeren Altar stürzte er auf die Knie und betete zu seinem Schutzgeist. Er flehte ihn um Kraft an, auf daß er alles Unheil abwende, das diese Nacht zu verkündigen schien.
Auch davon hatte die Sibylle nichts vernommen. Mit ganzer Seele lauschte sie dem Engelsang, der immer mächtiger anschwoll. Schließlich ertönte er so stark, daß die Hirten davon erwachten. Sie stützten sich auf ihre Ellbogen und sahen leuchtende Scharen silberweißer Englein in langen, wogenden Reigen gleich Zugvögeln hoch oben im Dunkel schweben. Einige hatten Lauten und Geigen in den Händen, andere trugen Zithern und Harfen, und ihr Gesang erklang so fröhlich wie Kinderlachen und so sorglos wie Lerchengezwitscher. Als die Hirten dies vernahmen, erhoben sie sich alsobald, um sich nach der Bergstadt zu begeben, in der sie wohnten, und dort von dem Wunder zu berichten.
Sie tasteten sich vorwärts auf einem schmalen, gewundenen Pfade, und die alte Sibylle folgte ihnen in Gedanken. Plötzlich wurde es oben auf dem Berge hell. Mitten darüber flammte ein großer, klarer Stern, und die Stadt auf dem Berggipfel erschimmerte wie Silber im Sternenlicht. Alle die schwebenden Engelscharen flogen darauf zu, und die Hirten beschleunigten ihre Schritte, so daß sie fast liefen. Als sie die Stadt erreicht hatten, sahen sie, daß die Engel sich über einem niedrigen Stall in der Nähe des Stadttores versammelt hatten. Es war eine elende Baracke mit einem Strohdach und dem nackten Felsgestein als Rückenwand. Senkrecht darüber stand der Stern, und dort scharten sich die Engel immer dichter und dichter. Einige setzten sich auf das Strohdach oder ließen sich auf der steilen Felswand hinter dem Hause nieder, andere flogen mit flatternden Schwingen hin und her. Hoch, hoch oben war die Luft von ihren strahlenden Schwingen verklärt und erleuchtet.
In demselben Augenblick, als der Stern über der Bergstadt aufglomm, erwachte die ganze Natur, und den Männern auf der Höhe des Kapitols konnte der plötzliche Wechsel nicht entgehen. Sie fühlten, daß frische Winde sie umkosten. Liebliche Düfte strömten empor, die Bäume rauschten, der Tiber begann zu murmeln, die Sterne erglänzten, und der Mond stand hoch am Himmel und erhellte die Welt. Und aus den Wolken schwangen sich zwei Tauben herab und ließen sich auf des Kaisers Schultern nieder.
Als dieses Wunder geschah, erhob sich Augustus in stolzer Freude, seine Vertrauten und Sklaven aber sanken auf die Knie und riefen: »Ave Caesar! Dein Schutzgeist hat Dir nun Antwort gegeben. Du bist der Gott, der auf dem Gipfel des Kapitols angebetet werden soll!«
Und die Huldigung, die jene begeisterten Männer dem Kaiser darbrachten, hallte so mächtig, daß die greise Sibylle sie hörte. Sie war aus ihrer Entrücktheit erwacht. Sie erhob sich von ihrem Platze am Felsenabhang und schritt auf die Menschen zu. Es war, als hätte sich eine düstere Wolke aus der Tiefe des Abgrunds emporgehoben und drohte über den Felsgipfel hinabzustürzen. Grausig war die alte Sibylle in ihrer Greisenhaftigkeit. Struppiges Haar hing in wirren Strähnen um ihr Haupt, die Gelenke der Glieder waren unförmig gestaltet, und die fahlgelbe Haut umgab den Körper hart wie Baumrinde, Runzel an Runzel.
Aber gewaltig und ehrfurchtgebietend schritt sie auf den Kaiser zu. Mit der einen Hand umspannte sie sein Handgelenk, mit der andern wies sie nach dem fernen Osten.
»Sieh!« gebot sie ihm, und der Kaiser hob die Augenlider und blickte hinab.
Der weite Raum eröffnete sich seinen Augen, und seine Blicke drangen bis ins ferne Morgenland. Er sah einen dürftigen Stall unter einer steilen Felswand, in dessen offener Tür einige Hirten knieten. Drinnen im Stall sah er eine junge Mutter. Sie kniete vor einem kleinen Kinde, das auf einem Strohbündel am Boden lag.
Und die unförmigen, knochigen Finger der Sibylle wiesen auf dieses arme Kindlein hin.
»Ave Caesar!« sprach die Sibylle mit einem Hohnlachen. » Dort liegt der Gott, der auf der Höhe des Kapitols angebetet werden wird!«
Da wich Augustus vor ihr zurück, wie vor einer Wahnwitzigen.
Aber nun kam die mächtige Sehergabe über die Sibylle. Ihre wilden Augen begannen zu glühen, ihre Arme streckten sich zum Himmel empor, ihre Stimme verwandelte sich, als wäre es nicht mehr ihre eigene, und sie bekam einen Klang und eine Kraft, daß sie auf dem weiten Erdenrund hätte vernommen werden können. Und sie sprach Worte aus, die sie hoch oben in den Sternen zu lesen schien:
»Auf der Höhe des Kapitols wird man den Weltenerneuerer anbeten, den Christ oder den Antichrist, doch nicht einen schwachen Sterblichen.«
Nachdem sie also gesprochen hatte, schritt sie an den vor Schreck erstarrten Männern vorüber langsam von der Bergeshöhe hinab und verschwand.
Augustus aber erließ am nächsten Tage ein strenges Verbot der Absicht, einen ihm geweihten Tempel auf dem Kapitol zu bauen. Statt dessen errichtete er dort ein Sanktuarium für den neugeborenen Gottessohn und nannte es Himmelsaltar, Ara coeli.
Der Brunnen der weisen Männer
Im alten Lande Judäa zog die Dürre einher, hohläugig und voll Bitterkeit schritt sie über vertrocknete Disteln und vergilbtes Gras hin.
Es war Sommerzeit. Die Sonne schien auf schattenlose Berggipfel, der leiseste Wind wirbelte dichte Wolken von Kalkstaub aus der grauweißen Erde, die Herden drängten sich um die ausgetrockneten Bäche der Täler.
Die Dürre ging durchs Land und beschaute die Wasservorräte. Sie wanderte nach den Teichen Salomos, und seufzend erkannte sie, daß diese noch eine große Menge Wassers zwischen ihren felsigen Ufern bargen. Dann ging sie zu dem berühmten Davidsbrunnen bei Bethlehem hinab und fand auch dort Wasser. Mit schleppenden Schritten zog sie nun auf der großen Heerstraße weiter, die von Bethlehem nach Jerusalem führt. Als sie etwa den halben Weg zurückgelegt hatte, erblickte sie den Brunnen der weisen Männer, der dicht am Wegrande liegt, und sie gewahrte sofort, daß er nahe am Versiegen sei.
Die Dürre ließ sich auf der Brunnenschale nieder, die aus einem einzigen großen, ausgehöhlten Stein besteht, und blickte hinab in den Brunnen.
Der glänzende Wasserspiegel, der sonst nahe der Oeffnung sichtbar wurde, war tief hinabgesunken und durch Schlamm und Schlick trübe und unrein.
Als der Brunnen das braungebrannte Gesicht der Dürre auf seinem matten Wasserspiegel erkannte, ließ er ein Plätschern der Angst vernehmen.
»Ich bin neugierig, wann es mit Dir aus sein wird,« sagte die Dürre. »Dort unten in der Tiefe kannst Du wohl keine Wasserader finden, die da käme, Dir neues Leben zu verleihen. Und, Gott sei Dank, kann von Regen vor zwei, drei Monaten gar keine Rede sein.«
»Da sei Du beruhigt,« seufzte der Brunnen. »Mir hilft nichts mehr. Es müßte denn zum mindesten ein Quellenlauf aus dem Paradies mich speisen.«
»So will ich Dich nicht verlassen, ehe alles überstanden ist,« sagte die Dürre. Sie erkannte deutlich, daß der alte Brunnen am Versiegen war, und nun wollte sie auch die Freude haben, ihn Tropfen für Tropfen hinsterben zu sehen.
Sie setzte sich befriedigt auf der Brunnenschale zurecht und hörte mit Behagen, wie der Brunnen dort unten in der Tiefe stöhnte. Es war ihr auch eine große Labsal, daß durstige Wanderer dem Brunnen sich näherten, die den Eimer hinabließen und nur mit etlichen Tropfen schlammigen Wassers emporzogen.
So ging der ganze Tag dahin, und als das Dunkel herniedersank, blickte die Dürre nochmals in den Brunnen hinunter. Noch schimmerte dort ein wenig Wasser. »Ich werde über Nacht hier bleiben,« rief sie. »Beeile Dich nur nicht! Wenn es so hell wird, daß ich wieder in Dich hinabsehen kann, dann ist es sicherlich mit Dir zu Ende.«
Die Dürre kauerte auf dem Brunnendach zusammen, während die heiße Nacht, die noch grausamer und qualvoller wirkte als der Tag, sich über Judäa breitete. Die Hunde und Schakale heulten unablässig, und die durstigen Rinder und Esel antworteten ihnen aus ihren heißen Ställen. Regte sich auch zuweilen der Wind, so brachte er doch keine Kühlung, sondern war glühend und dumpf wie die keuchenden Atemzüge eines riesigen, schlafenden Ungeheuers.